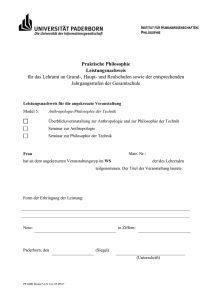Die philosophischen Grundlagen der
Werbung

Philosophie im Zeitalter der Neurowissenschaften XVII Jahrzehnten erworbene Wissen über die Funktionsweise des Gehirns“ (S. 555) liefert keine Theorie psychischer Fähigkeiten und deren Ausübung. Unstrittig sind die Neurowissenschaften bestrebt und in der Lage, die neuralen Bedingungen für menschliche Fähigkeiten wie „Empfindung, Wahrnehmung, Gedächtnis, Affektion und Wollen“ (S. 553) zu analysieren; dies sind aber Bedingungen, nicht Ursachen der entsprechenden Fähigkeiten und Vermögen. Nimmt man Letzteres an, so erliegt man je nach der gewählten „Begriffsverwirrung“ den Schwierigkeiten, die letztlich zur These von der Unlösbarkeit des Leib-Seele-Problems geführt haben. Hier ist der Verzicht auf die unbewussten und auf keinen Fall gerechtfertigten Anleihen bei der Metaphysik des 17. Jahrhunderts (sei es beim cartesischen Dualismus, sei es bei der reduktionistischen Position eines reinen Materialismus; so z. B. S. 538) unumgänglich. Denn diese metaphysischen Versatzstücke verleiten einerseits zur Ausweitung des Konzepts wissenschaftlicher Erklärung auf die gesamte Realität, und sie erliegen andererseits der Verhexung durch die Sprache. Denn sie machen, sobald sie nicht nur auf physische, sondern auf psychische Phänomene angewandt werden, und gar da, wo sie anthropologische Erklärungen liefern, von der metaphysischen Verwirrung Gebrauch, die bereits unsere Alltagssprache verhext. Die Substantiierung von Vermögen, der Schritt von empfinden zu Empfindung, wahrnehmen zu Wahrnehmung, erinnern zu Erinnerung/Gedächtnis, wollen zu Wille öffnen dem mereologischen Fehlschluss Tür und Tor. Es bleibt die Frage, was die Philosophie in dieser Debatte zu leisten vermag. Glaubt man den Neurowissenschaftlern – und zwar durchweg den im dritten Teil des Bandes von Bennett und Hacker untersuchten zeitgenössischen Neurowissenschaften einschließlich der hier nicht eigens mitkritisierten deutschen Neurowissenschaft – so wird Philosophie überflüssig, sobald die Prozesse des Gehirns mit Hilfe einer naturwissenschaftlich-physikalischen Methode gänzlich analysiert sind. Dann kennt man psychische Prozesse, weil man ihre Ursachen beschreiben und die Zusammenhänge der physischen Ereignisse im Gehirn, der neuralen Basis, mit den mentalen Ereignissen wissenschaftlich erklären kann. Hier ist bereits der klärende Hinweis darauf, dass es sich bei Gehirnprozessen zwar um Konditionen aller bewussten Erfahrungen handelt, nicht aber um Ursachen, angetan, eine erste Skepsis gegen den Global- und Gesamtanspruch zu nähren. Das nächste Problem wird durch den Hinweis auf den neben der ontologischen Option fundamentalen „methodologischen Fehlschluss“, also einen ebenfalls ontologiebedingten Irrtum, markiert. Diese Prüfung und Klärung obliegt der Philosophie. Ihr drittes, nicht ersetzbares Arbeitsfeld ist die „Klärung unserer Darstellungsform“. Durch diese Prüfung legt die Philosophie die „Sinngrenzen: das heißt die Grenzen dessen, was auf kohärente Weise gedacht und gesagt werden kann“ (S. 541) fest. Im Blick auf die allenthalben virulenten „Überschreitungen der Sinngrenzen“ und ihre Ursachen erweist sich die sprachkritische Philosophie im Sinne und im Gefolge Wittgensteins als „destruktiv“. In der „Überprüfung und Beschreibung des Wortgebrauchs – dessen, was kompetente Sprecher, indem sie Worte richtig verwenden, sagen und nicht sagen“ (S. 543), liegt die konstruktive Aufgabe der Philosophie. Das mag sich zunächst bescheiden anhören, es XVIII Vorwort liegt darin aber eine Aufgabe der Philosophie, die „kein Ende nehmen“ wird, denn jede Begriffsverwirrung, „jede einzelne Konfusion stellt einen neuen Behandlungsfall dar“ (S. 543). So gibt es keine philosophische Grund- und Gesamterklärung etwa im Sinn der Eruierung metaphysischer Letztbegründung. Es ist aber auch keine übergroße Bescheidenheit angesagt, die die Fähigkeiten der Philosophie leichtfertig verspielt. Im Gegenteil lässt sich unter Beweis stellen, was die Abhandlung zu den Philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften überzeugend geleistet hat, dass die Philosophie, die sich in diesem Sinne versteht, auch für die Wissenschaften ein unverzichtbarer Gesprächspartner wird, dessen Hinweise zwar nicht die Ergebnisse, wohl aber Ziele und methodischen Aufbau wissenschaftlicher Forschung beeinflussen. Anhand einer Reihe in der Diskussion virulenter irriger Annahmen zeigte sich nämlich, dass und wie die begriffliche Klärungsarbeit auch für die neurowissenschaftliche Forschung sinnvolle Korrektive an die Hand gibt. Das geschieht beispielsweise in der Kritik an der Konzeption der Wahrnehmung, die weder „Bildersehen oder Bilderhaben . . . [oder] die Hypothesenbildung des Gehirns ist“, daran, dass „Emotionen keine körperlichen Reaktionen auf Vorstellungsbilder sind“, dass mentale Ereignisse nicht einer Innensphäre zugehören, die sie zu unerschließbarer Privatheit verdammt, dass sie aber auch nicht auf ihre physischen, d. h. neuronalen Bedingungen verrechnet werden können, dass das Selbst des Selbstbewusstseins oder der Wille keine eigenen Entitäten sind und vieles mehr. Durch die Festlegung der Sinngrenzen gewinnt die Philosophie Begriffsklärungen, die für das Erreichen neurowissenschaftlicher Ziele „alles andere als unerheblich“ (S. 549), ja letztlich unverzichtbar sind, will man Ziel und Aufbau der Wissenschaften mit den Mitteln der Wissenschaft erreichen können. Die Untersuchung zu den Philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften weist nämlich an den faktischen Fragestellungen und der Entwicklung der Neurowissenschaften Probleme auf, die die Wissenschaft beeinträchtigen und vor allen Dingen den Erklärungsanspruch als erschlichen kenntlich machen. Nicht zuletzt werden Vorschläge entwickelt, wie man durch eine sinnvolle sprachliche Fassung auch belastbare Ergebnisse mit den Methoden der Wissenschaft erreichen kann. Die vorgeschlagenen Mittel zur Beseitigung der Irritationen sind überraschend einfach, aber auch überraschend effektiv. Man wird an jenen Helden der Menschheitsgeschichte erinnert, den man den „Großen“ nannte, weil er den gordischen Knoten, an dessen Lösung sich viele vergeblich wagten, nicht durch das Zerren und Zupfen an möglicherweise erfolgsträchtigen Schlingen und Fäden, sondern durch die Schärfe seines Schwertes löste. Auch in den Kritiken Bennetts und Hackers wird gegen die verdeckten ontologischen Optionen, ihre Verflechtung und Verfilzung zu immer subtileren Differenzierungen die typisch philosophische Variante der Problemlösung, nämlich Occham’s Razor eingesetzt: Entia non sunt multiplicanda sine neccessitatem – d. h. keinesfalls ohne wirklich einsichtige Argumente. Verzichtet man auf die den Problemlösungen nicht förderlichen, sondern eher erschwerenden metaphysischen Annahmen, so wird die Kritik an mereologischen Fehlschlüssen eo ipso triftig. Denn diese Form der Aus- Philosophie im Zeitalter der Neurowissenschaften XIX stattung von Teilen bzw. Organen mit den Fähigkeiten eines lebendigen Organismus verdankt sich selbst wieder der Vorgabe, dass zunächst Realitätsbereiche verselbständigt, dann auf der Basis solcher substantiierter Bereiche (i. e. der Teile lebendiger Organismen) ihre Eigenständigkeit als jeweils deskribierbare Entität unterstellt wird. Wittgensteins Sprachkritik tut das Ihre, um zu anspruchsvolle Annahmen zu destruieren. Zwar wird behauptet, nur eine sprachkritische Reflexion zur Vorbereitung einer unbelasteten Lösung des nun nicht mehr unlösbaren Rätsels des Verhältnisses von Leib und Seele, Körper und Geist, Geist und Gehirn zu geben, aber diese dem Anspruch nach bescheiden daherkommenden Vorschläge sind triftig und durchschlagend. Des Rätsels Lösung ist die, die schon Ödipus der Sphinx, ihre mystische Aura zerstörend, entgegengeschleudert hat: „der Mensch“. Als ein Wesen mit spezifischen Fähigkeiten müssen psychologische Prädikate, die seine Vermögen umschreiben, auf ihn bezogen, ihm als Ganzem zugeschrieben werden. Eine Prüfung solcher Zuschreibungen, die bereits zum Schatz der Alltagssprache gehören, lässt die Philosophie dann nicht als eine dürre Form rein formaler Kritiken, als rein destruktives Unternehmen erscheinen. Sie bietet die Basis für den konstruktiven Versuch, den Menschen als ein sprachfähiges Wesen durch eine kritische Sichtung der Medien zu erschließen, mit deren Hilfe er sich die Welt und sich selbst zugänglich hält. In weiterführenden Arbeiten will Hacker zeigen, dass der zunächst bescheiden anmutende Ansatz sich durchaus zu einer Anthropologie erweitern lässt.4 Da die einzelnen Kapitel des Bandes – nach dem Anspruch der Autoren – so aufgebaut sind, dass sie jeweils in sich schlüssig auch gesondert zur Kenntnis genommen werden können, bieten sie nicht nur die Möglichkeit, spezifische Interessen des eigenen Studiums zu verfolgen, sondern sie sind zugleich ein reiches Schatzkästlein an Argumenten, die die unterschiedlichen Aspekte der gegenwärtigen Debatte um die Grundlegung von Psychologie und Anthropologie bereichern. In den einzelnen Kapiteln des Bandes findet daher auch der deutschsprachige Leser triftige Argumente, um sich mit den ihm bekannten Versionen des Leib-Seele-Problems auseinanderzusetzen. Die abschließenden Überlegungen des Bandes über die Leistungsfähigkeit sowohl der Neurowissenschaften als auch der Philosophie liefern Korrektive für die Auseinandersetzung mit den Ansprüchen einer neurophilologischen Anthropologie und können daher auch die heimische Debatte um das Leib-Seele-Problem einerseits vom Nimbus des Geheimnisvollen, andererseits von der das menschliche Selbstverständnis beeinträchtigenden Reduktion auf materielle Steuerung entlasten. Trotz der von Hacker wie Bennett betonten Bescheidenheit, es handele sich um Vorüberlegungen zu einer Anthropologie, die sowohl mit (neuro-)wissenschaftlichen als auch mit philosophischen Ansätzen vereinbar ist, zeigt sich hier die Tragweite einer methodisch-sprachkritischen Bereinigung. Wenige Direktiven der Argumentation reichen 4 So geschehen in dem ersten publizierten Teil einer auf drei Bände angelegten Anthropologie, der den Titel On Human Nature (Harvard 2004) trägt. XX Vorwort hin, um überkomplexe Erklärungen und Deutungen überflüssig zu machen und zugleich tragfähige methodische Grundlagen für eine Anthropologie vorzugeben. Diese sollte sich auf die sprachlichen Vergewisserungen des Menschen über sich selbst beziehen; sie wird sich von Psychologie und Neurowissenschaften dadurch unterscheiden, dass sie keine Deskriptionen von Ursachenzusammenhängen, sondern unter Anerkennung gegebener physisch-biologischer Bedingungen die Besonderheit eines Lebewesens analysiert, das sich selbst sprachlich gegeben ist. Annemarie Gethmann-Siefert Einführung Die philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften sind die Früchte eines Gemeinschaftsprojekts eines Neurowissenschaftlers und eines Philosophen. Die Darstellung erörtert die begrifflichen Grundlagen der kognitiven Neurowissenschaften – Grundlagen, die von den strukturellen Beziehungen zwischen den psychologischen Begriffen gebildet werden, die bei Erforschung der neuralen Verhältnisse der kognitiven, affektiven und willentlichen menschlichen Fähigkeiten Verwendung finden. Die logischen Verbindungen zwischen diesen Begriffen zu untersuchen, ist eine philosophische Aufgabe. Mit dieser Untersuchung so umzugehen, dass die Hirnforschung in ein helleres Licht gerückt wird, eine neurowissenschaftliche. Darum unser Joint Venture. Will man die neuralen Strukturen und Kräfte verstehen, die der Wahrnehmung und dem Denken, dem Gedächtnis, der Emotion und dem intentionalen Verhalten zugrunde liegen und sie ermöglichen, muss man sich über diese Begriffe und Kategorien Klarheit verschaffen. Beide Autoren, die sich der Untersuchung aus ganz verschiedenen Richtungen näherten, waren von der Anwendung der psychologischen Begriffe innerhalb der heutigen Neurowissenschaften verwirrt, mitunter sogar beunruhigt. Die Verwirrung resultierte häufig daher, dass wir uns fragten, was die Neurowissenschaftler mit ihren Behauptungen, das Gehirn und den Geist betreffend, wohl gemeint haben könnten oder weshalb ein Wissenschaftler davon ausging, seine Experimente hätten die zur Untersuchung stehende psychische Fähigkeit erklärt, oder sie wurde von den begrifflichen Vorannahmen ausgelöst, die in die aufgeworfenen Fragen eingingen. Das Unbehagen rührte von dem Verdacht her, dass die Begriffe in manchen Fällen fehlerhaft ausgelegt oder angewendet wurden oder die Grenzen ihrer definierten Anwendungsbedingungen überschritten. Und je mehr wir nachforschten, desto stärker waren wir davon überzeugt, dass trotz der beeindruckenden Fortschritte der kognitiven Neurowissenschaften mit den allgemeinen Theorieentwürfen etwas nicht stimmte. Die Neurowissenschaften haben mit den empirischen Fragen zum Nervensystem zu tun. Ihr Geschäft ist die Feststellung von Tatsachen, die mit den neuralen Strukturen und Vorgängen in Zusammenhang stehen. Die kognitiven Neurowissenschaften haben es sich zur Aufgabe gemacht, die neuralen Ermöglichungsbedingungen der kognitiven, kogitativen, affektiven, die Wahrnehmung und den Willen betreffenden Funktionen zu erklären. Solche erklärenden Theorien werden durch experimentelle Untersuchungen bestätigt oder verworfen. Dagegen sind begriffliche Fragen (die beispielsweise die Begriffe des Geistes oder des Gedächtnisses, des Denkens oder der Vorstellungskraft betreffen), die Beschreibung der logischen Beziehungen zwischen den Begriffen (wie die zwischen den Begriffen der Wahrnehmung und der Empfindung oder den Begriffen des