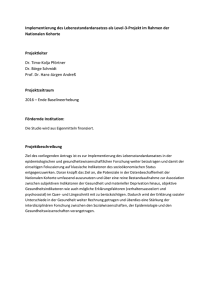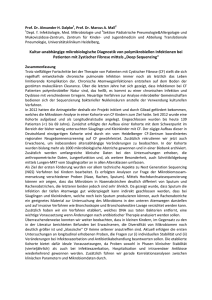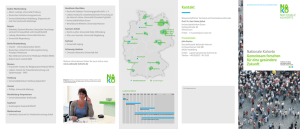alles zusammen
Werbung

Aus der Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Prof. Dr. med. C. Herrmann-Lingen) im Zentrum Psychosoziale Medizin der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen Die Symptomatik der Klienten der Ärztlich-Psychologischen Beratungsstelle für Studierende der Georg-August-Universität Göttingen Ein Vergleich von 4 Jahrgangskohorten (1971-1981-1991-2001) INAUGURAL – DISSERTATION zur Erlangung des Doktorgrades der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität zu Göttingen vorgelegt von Irma Ebeling aus Bad Pyrmont Göttingen 2010 Dekan: Prof. Dr. med. C. Frömmel I. Berichterstatter: Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. G. Reich II. Berichterstatter/in: Prof. Dr. med. A. Rothenberger III. Berichterstatter/in: Prof. Dr. rer. nat. P. Virsik-Köpp Tag der mündlichen Prüfung: 16.05.2011 Inhaltsverzeichnis Beschreibung einer spätadoleszenten Reifungskrise, die sich im Studium manifestiert 1 1 Einleitung 2 1.1 Studieneingangsphase als Transitionsphase 3 1.2 Die Spätadoleszenz 4 1.3 Psychophysische Gesundheit 7 1.4 Psychische Probleme Studierender 8 1.5 Ärztlich-Psychologische Beratungsstelle für Studierende der Georg-AugustUniversität Göttingen (jetzt: Psychotherapeutische Ambulanz für Studierende) 9 2 Ziele und Fragestellung der Arbeit 10 3 Methodik 10 3.1 Studiendesign und Stichprobe 10 3.2 Untersuchungsinstrumente 11 3.2.1 Sozialbogen 11 3.2.2 Persönlichkeits- und Symptomfragebögen 12 3.2.2.1 Gießen-Test (GT von Beckmann und Richter 1972) 3.2.2.2 Fragebogentest zur Beurteilung der Suizidgefahr–FBS (Stork 1972b) 12 3.2.2.3 Prüfungsangst-Fragebogen (Spitznagel 1968) 3.2.3 Fremdeinschätzung durch Therapeuten 12 13 13 3.2.3.1 Symptombogen (Sperling und Jahnke 1974) 13 3.2.3.2 Einschätzung der Prognose 13 3.3 Studienbeschreibung 14 3.4 Statistische Analysen 14 4 Ergebnisse 15 4.1 Deskriptiver Vergleich der 4 Kohorten 15 4.1.1 Definierung der Kohorten bezüglich Gruppengröße und Jahreszahlen 4.2 Soziale und biographische Merkmale der Patienten und Gesamtstudierenden der vier Kohorten 4.2.1 15 Alter 16 16 I 4.2.2 Geschlecht 17 4.2.3 Soziale Schicht des Vaters 19 4.3 Studienspezifische Merkmale der Patienten und Gesamtstudierenden der vier Kohorten 22 4.3.1 Anzahl der Hochschulsemester 22 4.3.2 Langzeitstudierende 24 4.3.3 Fakultätszugehörigkeit 25 4.4 Art der Studienwahl 31 4.5 Selbstbilder der Patienten/Persönlichkeitsmerkmale 32 4.5.1 Persönlichkeitsmerkmale- Gießen-Test 32 4.5.2 Prüfungsangst 34 4.5.3 Fragebogen zur Beurteilung der Suizidgefahr 34 4.6 Wöchentliche Arbeitszeit 35 4.7 Berufsperspektive 36 4.8 Therapeuten-Prognosen nach Erstgespräch 36 4.9 Symptomzuschreibungen durch Therapeuten nach Erstgespräch 38 4.9.1 Körpersphäre 38 4.9.2 Leistungsbereich 39 4.9.3 Sozialbereich 40 4.9.4 Psychische Symptome 42 4.9.5 Die häufigsten psychischen Probleme/Mittelwert der vier Kohorten 44 4.10 Tabellarische Zusammenfassung der Ergebnisse aufgeteilt nach Kohorten 46 5 Diskussion 48 5.1 Vorbemerkungen 48 5.2 Diskussion der Methodik 48 5.3 Die Unterschiede der soziodemographischen und studienspezifischen Charakteristik der Studierenden 49 5.3.1 Geschlechtsspezifische Aspekte 51 5.3.2 Fakultätsspezifische Unterschiede 52 5.3.3 Unterschiede in der sozialen Herkunft der Studierenden 54 5.4 Die Unterschiede in der Prävalenz von psychischen Symptomen aus Sicht der Klienten und Therapeuten 5.4.1 Prüfungsangst als Anlass zum Aufsuchen einer Beratungsstelle 55 57 II 5.4.2 Unterschiede in den Symptomatiken der Studierenden 58 5.5 Vergleich der Ergebnisse mit der Allgemeinbevölkerung junger Erwachsener 66 5.6 Ausblick 67 6 Zusammenfassung 69 7 Anhang: Untersuchungsinstrumente 71 7.1 Sozialbogen 71 7.2 Gießen-Test (Beckmann und Richter 1972) 74 7.3 Fragebogen zur Beurteilung der Suizidgefahr – FBS (Stork 1972b) 77 7.4 Prüfungsangst-Fragebogen (Spitznagel 1968) 79 7.5 Symptombogen (Sperling und Jahnke 1974) 81 8 Literaturverzeichnis 82 9 Abbildungsverzeichnis 90 10 Tabellenverzeichnis 91 III Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen Abb. BGS 98 bzw. DE DEGS d. h DO DSM-IV DU FBS GE GEW GT HIS HM HS ICD-10 IP Math.-Nat. n n. e. NR n. s. PO PR RE SS Std. s. Tab. UK vgl. WS z. B. ZW Abbildung Bundesgesundheitssurvey 1998/99 beziehungsweise depressive Verstimmung „Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ das heißt Dominanz Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen bzw. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Durchlässigkeit Fragebogentest zur Beurteilung der Suizidgefahr Gefügigkeit Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Gießen-Test Hochschul-Informations-System Hypomanie Hochschulsemester Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme bzw. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems soziale Impotenz Mathematik und Naturwissenschaften Anzahl nicht erhoben negativ erlebte Resonanz nicht signifikant soziale Potenz positiv erlebte Resonanz Retentivität Sommersemester Stunden siehe Tabelle Unterkontrolle vergleiche Wintersemester zum Beispiel Zwanghaftigkeit IV Beschreibung einer spätadoleszenten Reifungskrise, die sich im Studium manifestiert Nach Verlassen des behüteten Elternhauses in Frankfurt, findet sich ein junger Mann einsam und verzweifelt in der Stadt Leipzig wieder. Wäre es ausschließlich nach ihm gegangen, wäre er jetzt in Göttingen, um sich dem Studium der Altertumswissenschaften zu widmen. Nun versucht er, den Wünschen des Vaters zu entsprechen, und studiert an dessen alter Universität Jura. Für später ist die Laufbahn eines höheren Verwaltungsjuristen geplant, eine Karriere, die sein Vater in jungen Jahren fokussierte, aber nicht verwirklichen konnte. Der junge Mann ist von Heimweh geplagt. Die Wirtstochter erwidert seine Liebessehnsüchte nicht. Mehr und mehr zieht er sich zurück, das Studium wird vernachlässigt. Auffällig wird der Studierende durch eine sich nach und nach entwickelnde Vielzahl von Krankheitssymptomen. Dazu gehören Obstipation, Infektanfälligkeit, Zahnschmerzen, rezidivierender Husten und Schwellungen am Hals. Er leidet unter Arbeitsstörungen und ausgeprägten hypochondrischen Befürchtungen (Boerner 1964). Was ist mit ihm passiert? Die Meinungen und Behandlungen der unterschiedlichen Experten divergieren. Einige gehen von einer syphilitischen Infektion oder dem Verdacht einer tuberkulösen Erkrankung aus, andere schlagen den Bogen weiter und diagnostizieren ihm eine psychische Erkrankung. Fakt ist, dass der Patient von einem Gefühl spricht, das ihm „das Gehirn verdüstert und die Eingeweide paralysiert“ (Holm-Hadulla 2001, S.7). Er schwanke zwischen Ausgelassenheit und tiefer Verstimmung, die sogar in Selbstmordphantasien münde. Ein langjähriges psychisches Auf und Ab schließt sich an diese Phase an. Die Zwischenprüfung kann er wie durch ein Wunder bestehen, danach folgen psychischer Zusammenbruch und ein Blutsturz. Es geht um Leben und Tod. Als Schiffbrüchiger kehrt er in seine Vaterstadt zurück. Die Phase der Regeneration/Rekonvaleszenz dauert lange. Die Geschichte ist, wie Sie sicherlich bemerkt haben, nicht frei erfunden. Es ist die Biographie des jungen Studenten Johann Wolfgang von Goethe in den Jahren von 1765 bis 1768. Seine schöpferischen Betätigungen waren Ressourcen, die es ihm ermöglichten, sein Leiden und die spätadoleszente Reifungskrise später mit einem guten Ende zu überwinden. Wesentliche Elemente dieser Zeit hat er literarisch verarbeitet (Rueger 1996). „Den Wenigsten stehen diese schöpferischen Kräfte und nicht allen eine günstige Umgebung zur Verfügung, um Entwicklungskrisen so leicht und gelungen zu lösen“ (Holm-Hadulla 2001, S.7). 1 1 Einleitung Damals wie heute werden von dem Individuum Student die unterschiedlichsten Adaptationsleistungen in der Studienzeit gefordert. Das Fallbeispiel von Goethe aus dem 18. Jahrhundert zeigt, dass die Studieneingangsphase, das „Einleben“ an der Universität, der alma mater, aber auch die Endphase im Kontext der Spätadoleszenz zu Reifungskrisen und psychischen Schwierigkeiten führen können. Psychosoziale Voraussetzungen, die die Studierenden mitbringen, und die Anforderungen der Universität bedingen die klassischen Probleme des Studienalltags (Knigge-Illner 2002). Das Fallbeispiel ist auch zur heutigen Zeit kein Auslaufmodell. Aktuelle Studien zeigen, dass Studierende häufig unter psychischen Problemen leiden, die zur einer Gesundheitsbeeinträchtigung führen und Einfluss auf den Studien- und Lebensverlauf haben (Meier et al. 2007; Isserstedt et al. 2007; Bailer et al. 2008; Holm-Hadulla et al. 2009). Die Symptomatiken der Studierenden reichen von psychischen Schwierigkeiten, Arbeits- und Lernstörungen, Prüfungsangst, Depressivität, sozialer Isolation, bis hin zur Alkohol- und/oder Drogenabhängigkeit und Suizidalität. Ein Studienabbruch kann ein Hinweis auf eine Überforderung der Studierenden sein. 25% der Studierenden in Deutschland verlassen die Hochschule ohne Abschluss. Nimmt man die Quote des Studienabbruchs als wesentlichen Indikator für das Leistungspotential an deutschen Hochschulen, so können tendenzielle Fehlleistungen von finanziellen, aber auch von Humanressourcen umso höher eingestuft werden, je mehr Studierende ihr Studium ohne Examen abbrechen (Heublein et al. 2005). Dadurch gehen dem Staat ein Teil der dringend benötigten (potentiellen) Akademiker verloren. Laut der „Heidelberger Studie“ ist jeder neunte Studierende als behandlungsbedürftig anzusehen. Jedoch nur jeder 20. Studierende nimmt psychotherapeutische Hilfe in Anspruch (Soeder et al. 2001). Diese Fakten verdeutlichen die gesundheits- und gesellschaftspolitische Relevanz der psychischen Störungen von Studierenden. Umso wichtiger ist es, die betroffenen Studierenden professionell zu beraten, Hilfeleistungen anzubieten und Förderung auszuüben. Beratungsstellen unter Psychologischer und/oder Psychiatrischer Leitung vereinen all diese Aspekte und können die betroffenen Studierenden mit einer geeigneten professionellen Therapie unterstützen. Aufgrund von psychotherapeutischen Hilfen können Studierende zufriedener leben und erfolgreicher studieren (Holm-Hadulla et al. 1997). Darüber hinaus ist es ebenso wichtig, neben der Beratung wissenschaftliche Forschung zu integrieren. 2 Es sollte untersucht werden, inwieweit sich die Symptomatiken in vier verschiedenen Jahrgangskohorten der Klientel der Ärztlich-Psychologischen Beratungsstelle der Georg-AugustUniversität Göttingen unterscheiden, ob es Unterschiede in den sozialen und biographischen Merkmalen der Studierenden innerhalb dieses großen Zeitfensters gibt. Die vorliegende Studie ist eine der ersten im deutschsprachigen Raum, welche eine größere Stichprobe studentischer Klientel der jeweiligen Jahrgangskohorte einer Beratungsstelle im Abstand von jeweils 10 Jahren über vier Jahrgangskohorten im Vergleich betrachtet. Daraus können Tendenzen und Empfehlungen für zukünftige Schwerpunkte der Einrichtung und der dementsprechenden Anpassung und Weiterentwicklung der Beratungs- und Therapiekonzepte abgeleitet werden. Der erste Teil der Arbeit geht im Speziellen auf die Studieneingangsphase, die Spätadoleszenz, psychophysische Gesundheit und psychische Probleme Studierender ein. Es folgen ein kurzer Unterpunkt zur Ärztlich-Psychologischen Beratungsstelle der Universität Göttingen und schließlich die Ziele und Fragestellung dieser Arbeit. 1.1 Studieneingangsphase als Transitionsphase Als Transitionsphase oder Statuspassage wird der Übergang von einem Lebensabschnitt, Berufssystem oder Status in einen anderen bezeichnet. Gekennzeichnet werden diese Übergänge durch vielfältige Verunsicherung, neue Anforderungen und Probleme. Jedoch findet die Verunsicherung dabei nicht nur auf Seiten des Einzelnen statt, der sich vom sicheren Terrain auf ein neues, unbekanntes Feld begibt, sondern auch auf Seiten der Institution oder Gruppe, in die es sich zu integrieren gilt (Friebertshäusser 1992). Der Studienbeginn ist eine solche Transitionsphase. Viele unvertraute Anforderungen, die als Stressoren wirken können, gilt es zu meistern wie z.B. einen Wohnortswechsel, das Verlassen des Elternhauses, der Verlust bzw. die räumliche Distanz zu Freundes- und Bekanntenkreis, das Zurechtfinden an der Institution Universität und nicht zuletzt natürlich auch die Bewältigung der fachlichen Anforderungen. An der Hochschule herrscht ein unbekanntes geistiges Klima mit noch unbekannten Rollenerwartungen. Die fachlichen Anforderungen und andere Arten von Leistungskontrollen, als die in der Schulzeit erlernten, sind in der Anfangsphase befremdend. Als Beispiele sind hier das Verfassen von Hausarbeiten, das Halten von Referaten oder für Mediziner das Einarbeiten in die MultipleChoice-Prüfungen zu nennen. Die Schlüsselqualifikationen des jeweiligen Studienganges zu erkennen, zu erlernen und zu beherrschen, ist eine große Herausforderung, genauso wie eine selbstständige Planung und Strukturierung des eigenen Studiums. 3 Zusammenfassend kann der Studienbeginn als Übergangs- oder Transitionsphase nach Hornung (1999) zu potentiellen Krisensituationen führen. Hornung (1999) definiert Krisen als Lebensereignisse, die auf das Mensch-Umwelt-System derart einwirken, dass eine interne Restrukturierung erforderlich wird. Psychische Störungen und körperliche Erkrankungen können sich als Folge einer misslungenen Anpassung und Neuorientierung des Individuums manifestieren. Die Statuspassage vom Schüler zum Studenten, sowie vom Jugendlichen zum Erwachsenen wird in der Studienphase vollzogen. Jedoch sind Studenten keine Erwachsenen im Hinblick auf Status und gefestigte Identität (Teuwsen 1992). Ihrem Alter entsprechend gelten Studierende rechtlich als mündige Bürgerinnen und Bürger, sind jedoch sozial und existentiell meist noch von den Eltern abhängig. Zudem fordert die noch nicht vollständig stattgefundene Identitätsbildung ein hohes Maß an psychischer Kraft und geistiger Reflexion. Ob der Studienbeginn als biographische Chance, Ereignis, Wendemarke oder Freisetzung aus alten, durch Elternhaus, Schule und Beruf auferlegten Zwängen verstanden werden kann, hängt von der Wahrnehmung des Individuums ab. Denkbar ist auch eine durch die Trennung von der gewohnten Lebenswelt ausgelöste psychische Belastung und Orientierungslosigkeit (Meyer 2005). 1.2 Die Spätadoleszenz Die Spätadoleszens ist eine Entwicklungsphase, die durch Identitätsbildungsprozesse gekennzeichnet ist. Facettenreich, konfliktreich, die im psychosozialen Moratorium stattfindende Identitätsentwicklung ist „ein Charakteristikum unserer westlichen, spätkapitalistischen Gesellschaft und kann nicht von dieser losgelöst betrachtet werden“ (Leuzinger-Bohleber und Mahler 1993, S.23). Jeder Jugendliche im Alter von 18 bis 24 Jahren, die Zeitspanne der Spätadoleszenz, ist vor die Aufgabe gestellt, die Adoleszenz definitiv zum Abschluss zu bringen (Teuwsen 1990). Auf die Frage „Wer bin Ich?“ soll die in der Adoleszenz gefundene Antwort überprüft und in eine eigene Identitätsentwicklung integriert werden. Das Herstellen von Identität bleibt, einmal angefangen, ein lebenslanger krisenanfälliger Prozess und rückt in der Spätadoleszenz als entwicklungsspezifische Aufgabe in den zentralen Vordergrund (Krejci 1982; Bohleber 1982). Loslösung und Trennung von den Eltern der Kindheit, um eine neue erwachsene Beziehung zu Ihnen aufbauen zu können, auf sich selbst gestellt sein, seinen eigenen Platz in der Gesellschaft finden, Fragen der Berufswahl, neue Gestaltung von Freundschaft und Partnerbeziehung, sind zentrale Herausforderungen und Fragen eines Individuums in der Spätadoleszenz. Selbstständig Entscheidungen zutreffen und das Leben selbst zu verantworten, ist eine mühevolle Arbeit, die die Psyche sehr stark fordert, eine psychische Arbeit, die Gewinn und Verlust und somit ambivalente Gefühle zur Folge hat. Zum einen den Gewinn von Selbstständigkeit und somit auch 4 Bestätigung und Anerkennung von der Gesellschaft, zum anderen Verlust durch Abwendung und Abschied der alten Bindung an die Eltern verbunden mit Traueraffekten. Die Spätadoleszenz bildet häufig einen Kristallisationspunkt der eigenen Biographie, von dem aus sich die weitere Entfaltung der eigenen Persönlichkeit ausbreitet oder aber ein Weg in die Krankheit abzeichnet (Leuzinger-Bohleber 2001). Bei diesem Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter werden oft die entscheidenden Weichen hin zu einer stabilen seelischen Verfassung einerseits oder aber zur pathologischen Entwicklung andererseits gestellt (Leuzinger-Bohleber 2001). Laufer (1965) beschreibt die inhaltlichen Aufgaben von Adoleszenz und Spätadoleszenz sowie den Übergang zwischen den Entwicklungsstufen anhand von folgenden vier Phasen. (1) Das noch infantile Ich des Adoleszenten droht durch die einsetzende physiologische Reifung und den einhergehenden Triebschub überwältigt zu werden. Es folgt eine Umstrukturierung des Körperbildes. Die Integration der körperlichen Veränderungen und der physisch reifen Genitalien muss vollzogen werden. (2) Eine Beziehungsveränderung zu den Bezugspersonen, vor allem den Eltern, muss stattfinden. Die Lösung der infantil-libidinösen Bindung an den gegengeschlechtlichen Elternteil muss erfolgen. Zunächst leben ödipale Strebungen wieder auf, wobei es sich nicht um eine äußere Loslösung von den Eltern handelt, sondern vielmehr um eine Auseinandersetzung mit den mächtigen inneren Repräsentanzen der Elternfiguren. Die bestehenden Identifizierungen mit den Elternfiguren im Ich und Über-Ich verlieren, nachdem sie einer Revision unterzogen worden sind, allmählich an Bedeutung. Außerfamiliäre Identifizierungen kommen hinzu. Übernommene Peer-Group-Ideale und Haltungen bilden im Loslösungsprozess von den Eltern wichtige haltgebende Werte. Das Ich des Adoleszenten erwirbt durch diesen Prozess sukzessiv sekundäre Autonomie und Unabhängigkeit. (3) Dem Finden eines heterosexuellen Liebesobjektes geht die Loslösung von den Eltern sowie die Ablösung der libidinösen Objektbesetzung voraus. Onaniephantasien und das Ausprobieren lockerer Beziehungen sind die Vorstufen dazu. Denn durch die Auseinandersetzung mit den ödipal-libidinösen Bestrebungen, ihrer Abwehr, Umformung und Ablösung bilden sich spezifische persönliche Liebesbedürfnisse heraus. (4) In einer stabilen Identität müssen präödipale und ödipale Identifikationen sowie die gegenwärtigen inneren und äußeren Verhaltenserwartungen und Ideale integriert werden. Es gilt, individuelle Antwort auf die Frage „Wer bin Ich?“ zu finden. Der eigenständige, unverwechselbare Charakter stellt sich in dieser Identität dar. Infantile Triebschicksale und traumatische Erfahrungen, deren Bewältigung lebenslange Aufgabe sein wird, sind ebenfalls Teil dieser Identität (Laufer 1965). Die Beschreibungen Laufers`s (1965) zu den psychischen Entwicklungsprozessen sollen an dieser Stelle als ein mögliches Modell verstanden werden. 5 Reich (1998) beschreibt die Spätadoleszenz als zweiten Individuationsprozess mit eigenen Möglichkeiten und Konflikten und weist auf eine Ausdehnung auf das dritte und sogar vierte Lebensjahrzehnt dieser Phase in den letzten 30 Jahren durch veränderte soziale Rahmenbedingungen hin. Krampen und Reichle (2002) führen für den Übergang vom Jugendalter zum frühen Erwachsenalter charakteristische Kriterien auf, die sich auf verschiedene Ebenen beziehen. 1. Formale und rechtliche Kriterien, die sich etwa auf die Volljährigkeit und das aktive Wahlrecht beziehen. 2. Objektive, verhaltensnahe Kriterien, wie etwa der Auszug aus dem Elternhaus, finanzielle Unabhängigkeit, Heirat oder Elternschaft. 3. Psychologische Kriterien, wie Ablösung, emotionale Autonomie oder psychologische Reife, die zwar plausibel erscheinen, aber mehrdeutig und nur unter Bezug auf eine normative Entwicklungstheorie operationalisierbar sind. 4. Subjektive Kriterien, bei denen nach der Selbstklassifikation von Personen zu einer Altersgruppe gefragt wird. Knigge-Illner (2002) geht mit Bezug auf Bohleber (1982) vor allem auf die Widersprüche und Unsicherheiten ein, mit denen spätadoleszente Studierende zurechtkommen müssen. Es folgt eine Auflistung der Widersprüche und Unsicherheiten, die sie hervorheben: 1. Der Widerspruch zwischen Autonomie und (wirtschaftlicher und psychischer) Abhängigkeit von den Eltern. 2. Der ungesicherte Status des Vorläufigen. 3. Die Offenheit und Unverbindlichkeit von Identifikationsmöglichkeiten, woraus eine reizvolle Herausforderung, aber auch der Stress eigener Verantwortlichkeit erwächst. 4. Die aufgeschobenen Übernahme von Rollen des Erwachsenenlebens (Elternrolle, Berufsrolle), die zu Defiziten in der Gewinnung von Identität führt. 5. Die Ungewissheit der beruflichen Zukunft, die in das Studium hineinwirkt. Zusammenfassend lassen sich die Besonderheiten von Studierenden als Spätadoleszenten so auf verschiedene Ebenen einteilen. Entwicklungspsychologisch kommt es zu einer Prolongierung und Intensivierung der „Identitätskrise“ in der Übergangsphase vom Jugendlichen zum Erwachsenen, sowie zu einer längeren emotionalen Abhängigkeit von den Eltern als altersgleiche Berufstätige (Hell 1978). Auf der sozialpsychologischen Ebene sind die Verlängerung der Ausbildungszeit und der Aufschub der gesellschaftlichen Integration zu benennen (Hell 1978). Es ergibt sich eine Übergangsproblematik von Schule und Elternhaus, gekennzeichnet durch bekannte, klar umgrenzte Aufgaben und feste soziale Beziehungen, in eine zum Teil unklare, wenig strukturierte Hochschulsituation (Woeller 1978). Die sozioökonomische Ebene kennzeichnet sich durch finanzielle Abhängigkeit (Hell 1978). Aus psychodynamischer Sicht zeigt sich eine nicht-neurotische Retardierung in der emotionalen Persönlichkeitsentwicklung zugunsten der intellektuellen Entfaltung 6 (Hell 1978). Des Weiteren stellt die Hochschule eine spezifische Umwelt mit besonderen Arbeits-, Lebensbedingungen und Kommunikationsstrukturen dar (Sperling und Jahnke 1974). Es wird deutlich, dass dieser Lebensabschnitt für jeden Menschen einer der wichtigsten sozialen und psychischen Übergänge im Laufe seines Lebens ist, ein biographischer Kristallisationspunkt mit offenem Ausgang im Hinblick auf das zukünftige Leben. Um Leuzinger-Bohleber`s (2001) Aussage zu komplettieren, verdient daher die Spätadoleszenz besondere klinische Aufmerksamkeit. 1.3 . Psychophysische Gesundheit Psychophysische Gesundheit kann als Ergebnis einer Bilanz zwischen Belastungen und Ressourcen betrachtet werden (Hornung und Fabian 2001). Speziell auf das Studium bezogen können Belastungen in vielerlei Hinsicht entstehen. In Verbindung mit dem Studiensetting sind hier Prüfungsstress, überfüllte Vorlesungssäle, unüberschaubare Anforderungen oder mangelnde soziale Kontakte als denkbare Belastungen zu nennen. Belastungen, die aus anderen Lebensbereichen resultieren, wären z.B. eine neue Wohnsituation oder unzureichende finanzielle Möglichkeiten. Die Ressourcen können wiederum aufgeteilt werden in interne und externe Ressourcen. Zu den persönlichen und somit internen Ressourcen zählen die Selbstwirksamkeit und der Selbstwert sowie die subjektive Autonomie. Ressourcen aus der Umwelt (externe) sind zum einen der gute Kontakt zu Mitstudierenden oder auch zu Dozenten, also soziale Unterstützung, oder aber auch der elterliche Rückhalt (emotional und finanziell). Gerade der Kontakt zu Mitstudenten stellt die wahrscheinlich wichtigste gesundheitsfördernde Ressource im Studienalltag dar. Untersuchungen von Bachmann et al. (1999) zeigen, dass die Studierenden, welche über ein größeres soziales Netzwerk unter Ihren Mitstudierenden verfügten, von einer Stärkung in Ihrem Studium und Wohlbefinden profitierten. „Die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung durch die Mitstudierenden ist insgesamt gesehen (Stärke und Konsistenz) die wichtigste Ressource für die Gesundheit der Studierenden [...]. Bedingungen, welche die Kontaktaufnahme unter den Studierenden fördern (z.B. klassenähnliche Ausbildungsstruktur, das Vorhandensein von semi-privaten LernRäumen), stellen deshalb neben individuumszentrierten Strategien wichtige Ansatzpunkte zur unspezifischen Prävention und Gesundheitsförderung an der Hochschule dar.“ (Bachmann 1999, S.169). Zum anderen können Studierende Ressourcen in studentischen Beratungsstellen finden, um letztendlich das Selbsthilfepotential zu aktivieren oder auch eine geeignete professionelle Weiterbehandlung zu bekommen. 7 Inwieweit spätadoleszente Reifungskrisen überwunden oder aber vertieft werden, hängt von der Beanspruchung bzw. der Verfügung der beschriebenen Ressourcen unmittelbar ab. Überwiegt die Seite der Belastungen, wird das individuelle Wohlbefinden sinken und die psychophysische Gesundheit und das Studium negativ beeinträchtigen. Arbeitsstörungen, Selbstwertprobleme, depressive Verstimmungen, soziale Isolation, Drogenabhängigkeit oder Suizidalität zählen zu den Folgen der Reifungskrise. 1.4 Psychische Probleme Studierender Psychische Krisen und Störungen sind in der Studentenschaft keine Seltenheit, dennoch ist der Schlussfolgerung, Studierende als eine Risikopopulation für psychische Störungen anzusehen, laut Holm-Hadulla et al. (1997) zu widersprechen. „Anderseits bestätigen unsere Untersuchungen, dass psychische Krisen und Störungen in der Studentenschaft sehr präsente Erfahrungen sind“ (Holm-Hadulla et al. 1997, S. 424). Studierende, die eine psychologische Beratungsstelle aufsuchen, präsentieren eine breite Palette von Problemen, psychischen Symptomen, Befindlichkeits- und Identitätsstörungen. Sie stehen im Zusammenhang mit den Entwicklungs- und Selbstfindungsprozessen dieses Lebensabschnittes, betont Krejci (1982). „Diejenigen jungen Menschen, die neurotisch dekompensieren, bringen entsprechende Dispositionen aus ihrer Biografie in ihre neue, aktuelle Umwelt mit. Belastungen können als auslösende Ursache die bislang latenten Konflikte reaktiveren“ (Kutter 1982, S.191). Krisen im Studium sind nicht nur negativ (Hahne et al. 1999). In ihrer Studie „Studium und psychische Probleme“ wurden bundesweit repräsentativ 20.533 Studierende befragt. Es zeigt sich, dass sich die Studierenden im Spannungsfeld zwischen dem Heute und einer ungewissen Zukunft befinden. Vor allem den zweiten Abschnitt ihres Studiums erleben Studierende als prägend und für ihre Zukunft entscheidend. Ähnlich beschreibt es Biermann (2000) „ Psychische Konflikte und Krisensituationen sind demnach für die Phase des Studiums notwendige, oft sogar sinnvolle Abschnitte im Prozess der Ausgestaltung der eigenen Identität“ (Biermann 2000, S.17). 8 1.5 Ärztlich – Psychologische Beratungsstelle für Studierende der Georg-AugustUniversität Göttingen (jetzt: Psychotherapeutische Ambulanz für Studierende) Die Gründung der Ärztlich-Psychologischen Beratungsstelle für Studierende der Georg-AugustUniversität Göttingen geht auf eine Initiative von Prof. Dr. J. E. Meyer zurück, den damaligen Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik. Am 1. April 1966 nahmen der Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und Psychoanalytiker Prof. Dr. med. Eckhard Sperling und der klinische Psychologe Dr. rer. nat. Jürgen Jahnke die Arbeit in der Ärztlich-Psychologischen Beratungsstelle auf (Sperling und Jahnke 1974). Anfänglich wurde die psychotherapeutische Beratung von Studierenden im Rahmen eines Forschungsprojektes angeboten. Ab 1971 wurde die Beratungsstelle in den Universitätsetat aufgenommen. Von 1971 bis 1980 war die Ärztlich - Psychologische Beratungsstelle ein Teil der Abteilung für Psycho- und Soziotherapie, seit 1980 ist sie dem Zentrum für Psychologische Medizin (jetzt: Psychosoziale Medizin) angegliedert. Sie blieb bis 1990 unter der Leitung von Prof. Dr. med. E. Sperling. Seit 1990 gehört die Beratungsstelle zur Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen (Nunnendorf 1996). Seit 2005 trägt die Einrichtung den Namen Psychotherapeutische Ambulanz für Studierende. Das themenspezifische Angebot ist breit gefächert und umfasst tiefenpsychologisch und verhaltenstherapeutisch orientierte Einzeltherapien, Familien-, Paar- und Gruppentherapien. Faktisch ist die Beratungsstelle eine Sonderambulanz vor allem für psychische Störungen von Studierenden in der Spätadoleszenz. Die Beratungsstelle ist eine Institution der ambulanten Krankenversorgung. Trotz der in Göttingen vergleichsweise ausgezeichneten Versorgung mit Psychotherapeuten hat die Beratungsstelle einen wichtigen Stellenwert. Die Schwelle einer Beratungsstelle ist für Studierende viel niedriger als die eines niedergelassenen Psychotherapeuten oder gar eines Psychiaters. Die ratsuchenden Studierenden profitieren in Krisensituationen davon, dass die Therapeuten das universitäre Umfeld und die spezifische Lebenssituation von Studierenden gut kennen. Außerdem können informelle Kontakte leichter hergestellt werden. Die Abklärung des Beratungsanliegens, Krisenintervention und weiterführende Beratungs- bzw. Behandlungsangebote zählen zu den Hauptaufgaben der Beratungsstelle. Ziel der Beratungsstelle ist es, ihre Klienten in schwierigen Studien- und Lebenssituationen zu unterstützen, die Eigenständigkeit und Leistungsfähigkeit der Studierenden zu fördern und einen Beitrag an Orientierungs- und Entscheidungshilfen zu leisten. Die Beratungstätigkeit wird bei akuten Krisen im Studium oder Privatleben, bei Arbeits- und Lernstörungen, Kontaktschwierigkeiten, Ängsten (z. B. Prüfungsängste), Partnerschaftskonflikten, psychosomatischen und psychischen Symptomen von den Studierenden in Anspruch genommen. 9 2 Ziele und Fragestellung der Arbeit Ziel der vorliegenden Studie ist es zu untersuchen, in welcher Weise sich die psychische Symptomatik, wegen der Studierende die Ärztlich-Psychologische Beratungsstelle der Georg-AugustUniversität Göttingen aufsuchten, bei vier Jahrgangskohorten verändert hat. Folgende Fragestellungen werden im Einzelnen untersucht: 1. Unterscheiden sich die vier Jahrgangskohorten von Studierenden der Beratungsstelle der Universität Göttingen hinsichtlich soziodemographischer und studienspezifischer Merkmale? 2. Unterscheiden sich die Ratsuchenden von den jeweiligen Jahrgangskohorten von Studierenden der Gesamtuniversität und in welchen Variablen? 3. Unterscheiden sich die vier Jahrgangskohorten bezüglich der Prävalenzen psychischer Symptome? 4. Gibt es Unterschiede zu einer Normpopulation junger Erwachsener? 3 Methodik 3.1 Studiendesign und Stichprobe Es handelt sich um eine retrospektive Studie. Die von Studierenden der Universität Göttingen, welche erstmals die Ärztlich-Psychologische Beratungsstelle aufsuchten, selbst ausgefüllte Basisdokumentation, sowie die von den Therapeuten erfasste Symptomatik und eingeschätzte Prognose nach dem Erstgespräch bilden die Datengrundlage. In die vergleichende Untersuchung gehen die Daten von vier Jahrgangskohorten ein: Kohorte 1: SS1971 und WS 1971/72 (n=182); Kohorte 2: SS 1981 und WS 1981/82 (n=239); Kohorte 3: SS 1990 und WS 1990/91 (n= 177); Kohorte 4: SS 2000 und WS 2000/01 (n= 210). Um die Anonymität der Teilnehmenden zu gewährleisten, wurden die Informationen unabhängig von den Namen der Klientel derart verschlüsselt, dass neben der Semestererkennung eine Zufallsnummerierung stattfand. Eine Rückverfolgung der Datenauswertung auf einzelne Personen war und ist nicht möglich. 10 3.2 Untersuchungsinstrumente Seit Bestehen der Beratungsstelle werden vor jedem Gespräch ausführliche Sozialdaten und Symptome erhoben. Ab 1971 wurden sukzessiv noch objektive Persönlichkeitsfragebogen zur besseren Diagnoseerstellung aufgenommen. Es folgt eine Auflistung der verschiedenen Fragebögen, die die Beratungsstelle verwendete und die als Instrumente zur Durchführung der Studie genutzt wurden. ● Sozialbogen (seit 1966) ● Persönlichkeits- und Symptomfragebögen (Selbsteinschätzung): - Gießen –Test (Beckmann und Richter 1972) - Fragebogen zur Beurteilung der Suizidgefahr – FBS (Stork, 1972b) seit WS 73/74 - Prüfungsangst-Fragebogen (Spitznagel 1968) ● Fremdeinschätzung durch Therapeuten: - Symptombogen (seit 1966) - Einschätzungen der Prognose (seit 1967) 3.2.1 Sozialbogen Der Sozialbogen umfasst Fragen zu Geschlecht, Alter, Religion, Familienstand und Partnerschaft. Ergänzend kommen hochschulspezifische Fragen, wie Studienfach/-fächer, Semesterzahl, Hauptfachwechsel, Zwischenprüfung und Abiturnoten hinzu. Die Fragen zu Finanzierung des Studiums, monatlichen Mitteln, Erwerbstätigkeit und Wohnung am Studienort ermöglichen eine Einschätzung der derzeitigen finanziellen und wohnlichen Situation des Studierenden. Der Sozialbogen inkludiert ebenfalls Fragen zum familiären Hintergrund. 11 3.2.2 Persönlichkeits- und Symptomfragebögen 3.2.2.1 Gießen - Test (Beckmann und Richter 1972) Der Gießen-Test wurde von Beckmann und Richter (1972) entwickelt, um im Selbst- oder Fremdbericht klinisch und sozialpsychologisch relevante Persönlichkeitseigenschaften zu messen. Zur Interpretation z.B. individueller Persönlichkeitsstrukturen werden die 40 siebenstufigen Items zu sechs bipolaren Standardskalen zusammengefasst, die von den Autoren wie folgt benannt werden: Skala 1: Soziale Resonanz (NR) negativ erlebte Skala 2: Dominanz (DO) Dominanzstreben - Gefügigkeit (GE) Skala 3: Kontrolle (UK) Unterkontrolle - Zwanghaftigkeit (ZW) Skala 4: Grundstimmung (HM) Hypomanie - depressive Verstimmung (DE) Skala 5: Durchlässigkeit (DU) Durchlässigkeit - Retentivität (RE) Skala 6: Soziale Potenz (PO) soziale Potenz - soziale Impotenz (IP) Das hier angewandte Selbstberichtsverfahren - positiv erlebte soziale Resonanz (PR) ist eines der am häufigsten eingesetzten deutschsprachigen psychodiagnostischen Verfahren in Forschung und Praxis. 3.2.2.2 Fragebogentest zur Beurteilung der Suizidgefahr – FBS (Stork 1972b) Der Fragebogentest zur Beurteilung der Suizidgefahr misst die Ausprägung eines suizidal-depressiven Persönlichkeitsbildes. Es wird dabei unterschieden zwischen Gruppen ohne Selbstmordtendenzen, einer Zwischengruppe, der diese Tendenzen nicht eindeutig zuzuordnen sind, Personen mit Suizidtendenzen und Personen mit Suizidversuch. Aus einer Vorform von 175 Einzelfragen (Stork 1972 a) wurden schließlich 52 dual kodierte Items ausgewählt, die mit „richtig“ bzw. „falsch“ bewertet werden können. Anhand des Gesamtwertes im FBS kann die Suizidgefährdung einer Person in fünf Kategorien eingeschätzt werden. Normalität (0-30 Punkte), Normalität zweifelhaft (31-34), schwache Suizidgefahr (35-39), starke Suizidgefahr (40-49) und besonders starke Suizidgefahr (50 und mehr Punkte). In der Berechnung des Gesamtwertes gehen die 14 Items mit besonders hoher Trennschärfe zwischen Personen ohne Suizidgefahr (Normalität) und denjenigen mit hoher Suizidgefahr mit doppelter Gewichtung ein. 12 3.2.2.3 Prüfungsangst-Fragebogen (Spitznagel 1968) Beim Prüfungsangst-Fragebogen von Spitznagel handelt es sich um ein bisher unveröffentlichtes Verfahren, das als fester Bestandteil der Basisdokumentation innerhalb der Ärztlich-Psychologischen Beratungsstelle eingesetzt wird. Der Fragebogen umfasst 38 Items, die auf einer fünfstufigen Skala von „1= trifft immer zu“ bis „5= trifft nie zu“ bewertet werden können. Die Split-half-Reliabilität dieses Fragebogens ist mit .94 als gut zu bewerten. Darüber hinaus liegt eine Reihe von Auswertungen vor, welche die Validität des Verfahrens zur Diagnose von Prüfungsangst bei Studierenden bestätigen (Kuda und Spitznagel 2002). 3.2.3 Fremdeinschätzung durch Therapeuten 3.2.3.1 Symptombogen (Sperling und Jahnke 1974) Die Therapeuten der Ärztlich-Psychologischen Beratungsstelle kreuzten nach dem Erstgespräch auf einer Checkliste (Symptombogen) die von den Patienten angegebenen Symptome an (siehe Anhang S.71). Dieses Fremdberichtverfahren wurde erstmals von Sperling und Jahnke (1974) beschrieben. Der Symptombogen besteht aus 40 Einzelsymptomen, die fünf verschiedenen Kategorien zugeordnet sind. 1. Körpersphäre (17 Items) 2. Psychische Symptome (11 Items) 3. Leistungsbereich (6 Items) 4. Sozialbereich (11 Items) 5. Sonstiges (2 Items) 3.2.3.2 Einschätzungen der Prognose Zusätzlich werden von den Psychotherapeuten vier Prognoseschätzungen auf einer 7-stufigen Ratingskala von „1= günstig“ bis „ 7= ungünstig“ abgegeben. Diese Prognoseschätzungen betreffen die Bereiche „Soziale Integration“, „Studienerfolg“, „geäußerte Symptomatik“ sowie „zukünftige Suizidgefährdung“. Zu den Gütekriterien dieses Verfahrens gibt es bisher noch keine Studien. 13 3.3 Studienbeschreibung Mit Hilfe dieser umfangreich erhobenen Daten wurde retrospektiv untersucht, mit welchen psychischen Probleme und Symptomatiken die Studierenden die Beratungsstelle aufsuchten und ob sich die vier Kohorten in ihrer sozialdemographischen und studienspezifischen Charakteristik unterscheiden. Im ersten Schritt wurden die Sozialdaten, bei denen es sich um nichtstandardisierte Fragen handelt, deskriptiv beschrieben. Bezüglich des Geschlechtes, der Anzahl der Hochschulsemester und der Fakultätszugehörigkeit wurde zusätzlich ein Vergleich mit den entsprechenden Informationen aus der Gesamtuniversität durchgeführt. Damit war feststellbar, ob die jeweiligen Patientenstichproben bereits eine Spezialauswahl sind. Diese Deskriptionen erfolgten auch bezüglich der verschiedenen Symptomatiken. Hier konnte allerdings kein Vergleich mit der Gesamtuniversität durchgeführt werden, weil keine Daten vorlagen. Pro Kohorte wurden auch die weiteren Informationen zu Prüfungsangst, Suizidalität und Persönlichkeitseigenschaften beschrieben, hier mit den Skalenwerten oder jeweiligen Gesamtwerten. 3.4 Statistische Analysen Mit dem Programm SPSS in der Version 15 für Windows erfolgte die statistische Analyse. Univariate und Multivariate statistische Verfahren wurden zur Untersuchung der Daten eingesetzt. Der ChiQuadrat-Test nach Pearson wurde zur Signifikanzbeurteilung bivariater Zusammenhänge kategorialer Variablen verwendet. Als signifikant wurden jeweils Ergebnisse mit p ‹ 0,05 angesehen. Die Prozentangaben wurden zur besseren Lesbarkeit auf eine Nachkommastelle gerundet. Bei den Analysen von Zusammenhängen wurden fehlende Daten (missing values) ausgeschlossen, demzufolge können in den Kohortenvergleichen jeweils leicht variierende Fallzahlen vorkommen. Untersuchungen zwischen den vier Kohorten: Ein Vergleich der deskriptiven Befunde mittels Chi–Quadrat-Test wurde durchgeführt, um eventuelle Unterschiede zwischen den 4 Zeitpunkten statistisch abzusichern. Für die anderen Informationen (Prüfungsangst, Persönlichkeit, Suizidalität) wurden Mittelwertsvergleiche (t – Tests für unabhängige Stichproben) zwischen den vier Kohorten berechnet. 14 4 Ergebnisse 4.1 Deskriptiver Vergleich der 4 Kohorten Vorbemerkung In die Untersuchung wurden insgesamt 808 Patientinnen und Patienten eingeschlossen. In den nachfolgenden Ausführungen ist die Rede von Patienten, wobei beide Geschlechter gemeint sind. Es wurden zum einen Schwerpunkte auf die sozialen Merkmale der Patienten, wie z. B. das Alter, das Geschlecht und die soziale Schicht des Vaters, gelegt, zum anderen wurden natürlich auch die studienspezifischen Merkmale, wie z. B. die Fakultätszugehörigkeit, die Semesteranzahl und die Art der Studienwahl untersucht. Um Aufschlüsse über die Symptomatiken der Studierenden zu bekommen — der Kernpunkt dieser Arbeit — mussten Persönlichkeitsmerkmale und Persönlichkeitseigenschaften als Selbstbilder der Patienten integriert werden. Dieser Punkt wurde vor allem durch den Gießen-Test, den Prüfungsangst-Fragebogen und den Fragebogen zur Suizidgefährdung (FBS) untersucht. Ergänzend zu diesem Themenschwerpunkt wurde der Arbeitsund Leistungsbereich durch Bestimmung der wöchentlichen Arbeitszeit, sowie die Berufsperspektive durch spezifische Fragen untersucht. Neben den Selbstbildern der Patienten wurden zur Objektivierung der Symptomatiken die Therapeuten (Fremd-) Beurteilungen nach dem Erstgespräch in diese Studie integriert. Die Symptomzuschreibungen reichen von Angst, depressive Verstimmung, Störung des Selbstwertgefühls, Kontaktschwierigkeiten und Partnerproblematik über Suizidideen, Sexual- und/oder Schlafstörungen bis hin zu reinen Störung des Arbeitsverhaltens, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die Symptomzuschreibungen durch die Therapeuten wurden ergänzt von der abgegebenen Therapeutenprognose bezüglich der geäußerten Symptomatik, zum zukünftigen Studienerfolg und der Suizidgefährdung. 4.1.1 Definierung der Kohorten bezüglich Gruppengröße und Jahreszahlen Die Anzahl der Patienten aus der ersten Kohorte, die sich aus den Neuanmeldungen aus dem Sommersemester 1971 und Wintersemester 1971/72 zusammensetzt, beträgt 182 Studierende. Bezogen auf die Gesamtzahl aller zur Untersuchung eingeschlossenen Patienten macht diese erste Kohorte einen Anteil von 22,5% aus. 15 Die zweite Kohorte setzt sich aus den Neuanmeldungen der Patienten aus dem Sommersemester 1981 und Wintersemester 1981/82 zusammen. Insgesamt 239 Patienten, ein Anteil von 29,6% der Gesamtzahl inkludiert diese zweite Kohorte. Die Neuanmeldungen aus dem Sommersemester 1990 und Wintersemester 1990/91 machen mit 177 Patienten einen Anteil von 21,9% der Gesamtanzahl der Patienten aus und zählen zu Kohorte 3. Die vierte Kohorte bezieht sich auf das Sommersemester 2000 und Wintersemester 2000/01. Sie zählt 210 Neuanmeldungen. Abb. 1 Anzahl der neuangemeldeten Patienten innerhalb der 4 Kohorten 300 Gesamtanzahl 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 Kohorten 4.2 Soziale und biographische Merkmale der Patienten und Gesamtstudierenden der vier Kohorten 4.2.1 Alter Mit Hilfe der Sozialdaten der Patienten konnten folgende Berechnungen zum Alter der Patienten ermittelt werden. Die erste Kohorte mit 182 Patienten hat ein mittleres Alter von 23,3 Jahren. Die Patienten der Kohorte 2 (n=239) haben ein Durchschnittsalter von 25,1 Jahren. 25,4 Jahre beträgt das Durchschnittsalter in Kohorte 3 (n=177). Die Kohorte 4 (n=163) folgt mit einem mittleren Alter von 25,9 Jahren. Die Patienten der Kohorte 1 sind mit einem Mittelwert von 23,3 Jahren die Jüngsten in der Untersuchung (p‹0,001). 16 Die späteren Kohorten zeigen ein stetiges ansteigendes Patienten-Durchschnittsalter. Die Patienten der Kohorte 4 sind mit 25,9 Jahren die Ältesten. Unter der Kohorte 4 befinden sich gleichzeitig der jüngste Patient mit 19 Jahren und der älteste mit 44 Jahren. Tabelle 1 Alter in Jahren der Patienten (Mittelwert) Kohorte 1 Kohorte 2 Kohorte 3 Kohorte 4 n=182 n=239 n=177 n=163 23,3 ± 3,4 25,1 ± 3,6 25,4 ± 3,3 25,9 ± 4,1 Df F Signifikanz (p) 3 18,4 ‹0,0001 ± Standardabweichung In den Statistiken der Universität wird der Schwerpunkt auf die Hochschulsemester und nicht auf das Alter der Studierende gelegt. Ein direkter Vergleich ist an dieser Stelle deshalb leider nicht möglich, weil die Daten nicht zur Verfügung standen. 4.2.2 Geschlecht Bezüglich des Geschlechts zeigt sich folgende Entwicklung: von 187 Patienten der Kohorte 1 sind 87 weiblich und 100 männlich. Es ergibt sich daraus ein prozentuales Verhältnis von 46,5% Frauen und 53,5% Männern für das Patientenkollektiv im Jahr 1971. Die Universitätsstatistik zeigt im Jahre 1971 dazu im Vergleich eine Verteilung von 25,8% Frauen und 74,2% Männern. Das Patientenkollektiv der Beratungsstelle besteht somit überproportional aus Frauen. Für die Kohorte 2 ergibt sich das folgende Bild: von 234 Patienten sind 122 weiblich und 112 männlich. Die Frauen bilden mit 52,1%, versus 47,9 % Männer, erstmals über die Hälfte des Patientenkollektivs. Die Universität hat 1981 einen Anteil von 39,4% Frauen und 60,6% Männer als ordentliche Studenten registriert. 1990 sind 177 Neuanmeldungen in der Beratungsstelle eingegangen, darunter sind 91 (51,4%) Patientinnen und 86 (48,6%) Patienten. Die Universität zählt im Vergleich 42,7% Frauen und 57,3% Männer. Eine erneute Zunahme von Frauen, die Hilfe in der Beratungsstelle suchen, zeigt sich für 2000. Die Zahl der Frauen ist auf 59,7% angestiegen. Die Männer bilden mit 40,3% den niedrigsten Anteil seit Erfassung der Daten. Von 206 Patienten sind 123 weiblichen Geschlechts und 83 männlichen Geschlechts (p‹0,07). Die Universitätsdaten zeigen einen stetigen Anstieg von weiblichen Studierenden. Im Jahr 2000 gibt es folgende prozentuale Verteilung: 47,3% der Gesamtzahl aller Studierenden der Georg-AugustUniversität sind Frauen und 52,7% sind Männer. 17 Abb. 2 Geschlechterverteilung der Beratungsstelle pro Kohorte 60 Anzahl in Prozent 50 40 30 20 10 0 We iblich Männlich Geschle cht Kohorte 1 Kohorte 2 Kohorte 3 Kohorte 4 Tabelle 2 Geschlechterverteilung innerhalb der vier Kohorten Geschlecht Kohorte 1 n=187 Kohorte 2 n=239 Kohorte 3 n=177 Kohorte 4 n=206 Total Chi 2 Df p-wert Weiblich 46,5% (87) 52,1% (122) 51,4% (91) 59,7% (123) 52,6% (423) 7,07 3 0,07 Männlich 53,5% (100) 47,9% (112) 48,6% (86) 40,3% (83) 47,4% (381) 18 Abb. 3 Aufteilung der Studierenden der Gesamtuniversität nach Geschlecht 80 Anzahl in Prozent 70 60 50 40 30 20 10 0 Weiblich Männlich Geschlecht Kohorte 1 Kohorte 2 Kohorte 3 Kohorte 4 Daten von der Georg-August-Universität Göttingen, Stabsstelle DV der Zentralverwaltung Die Graphiken zeigen deutlich, dass zu jedem Zeitpunkt im Verhältnis mit der Gesamtzahl an Studierenden der Universität Göttingen prozentual mehr Frauen eine Beratung in Anspruch nehmen. 4.2.3 Soziale Schicht des Vaters Bei der Frage zur sozialen Schicht des Vaters zeigt sich eine Tendenz der Zunahme bei den leitenden Angestellten und mittleren Beamten. Die Patienten, deren Väter leitende Angestellte sind, nehmen von Kohorte 1 mit 12,6% über Kohorte 2 mit 10,1% und Kohorte 3 mit 18,1% zu. Ähnlich sieht es bei den Patienten aus, deren Väter mittlere Beamte sind. In Kohorte 1 sind es 12,6%, in Kohorte sind es 2 10,6% und in Kohorte 3 sind es 14,1%. Eine Tendenz der Abnahme zeigt sich bei den höheren Beamten, von 22,2% in Kohorte 1 über 11,5% in Kohorte 2 zu 10,2% in Kohorte 3. In Kohorte 4 wurden diese Daten nicht erhoben. Ein interessantes Bild ergibt sich in Kohorte 2 für die Arbeiterschicht. Die Beratungsstelle verzeichnet einen Zuwachs von 7,2% (Kohorte 1) auf 12,8% (Kohorte 2). Die Patienten, deren Väter Landwirte sind, zeigen sogar noch einen höheren Anstieg von 0% auf 8,8% in Kohorte 2. Für Kohorte 3 stellt sich für beide Berufsgruppen dann wieder eine abnehmende Tendenz ein. 19 Abb. 4 Aufteilung der Klienten nach der sozialen Schicht des Vaters 25 Anzahl in Prozent 20 15 10 5 So n Le it. A ng s st . A t. H ng öh e . B st. e M am itt . B ter Ei eam nf . B ter ea m Se te lb r A s rb t. U e H ns an ite el bs dw r t. er H ke an dw r Fr erk e ei be r ru f La ler nd w ir t 0 soziale Schicht des Vaters Kohorte 1 Tabelle 3 Soziale Vaters Kohorte 2 Kohorte 3 Soziale Schicht des Vaters der Klienten innerhalb der vier Kohorten (in Prozent) Schicht des 1 (n=167) 2 (n=227) 3 (n=177) Leit. Angestellter 12,6 (21) 10,1 (23) Sonst. Angestellter 21,6 (36) Höherer Beamter 4 n. E. Total Chi 2 Df p-Wert 18,1 (32) 13,3 (76) 38,680 18 ‹0,003 22,5 (51) 20,3 (36) 21,5 (123) 22,2 (37) 11,5 (26) 10,2 (18) 14,2 (81) Mittlerer Beamter 12,6 (21) 10,6 (24) 14,1 (25) 12,3 (70) Einfacher Beamter 2,4 (4) 1,8 (4) 1,1 (2) 1,8 (10) Arbeiter 7,2 (12) 12,8 (29) 9,6 (17) 10,2 (58) Selbst. Handwerker 4,8 (8) 4,0 (9) 5,1 (9) 4,6 (26) Unselbst. Handwerker 0,6 (1) 3,1 (7) 2,3 (4) 2,1 (12) Freiberufler 16,2 (27) 15,0 (34) 14,1 (25) 15,1 (86) Landwirt 0 8,8(20) 5,1 (9) 5,1 (29) Gesamt Anzahl % von Kohorte % von Gesamtanzahl 167 100 29,2 227 100 39,8 177 100 31,0 n=571 100% 100% 20 Auf Universitätsebene wurden die Daten zur sozialen Herkunft der Studierenden von der HochschulInformations-System GmbH (HIS) für das Studentenwerk Göttingen ermittelt. Das HIS hat ein Modell entwickelt, welches die Variablen „Stellung im Beruf“ und „Bildungsherkunft der Eltern“ in einer Herkunftsvariable kombiniert. Mit der Herkunftsvariable wurde laut HIS eine bessere soziale Differenzierung gefunden, als sie üblicherweise durch die versicherungsrechtlichen Kategorien Arbeiter, Angestellter, Beamter und Selbständiger erreicht wird laut Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (Daten: Henkel et al. 1990 für Studentenwerk Göttingen; Hehn und Sander 2002 für Studentenwerk Göttingen). Die Zahl der Studierenden aus einfachen sozialen Verhältnissen an den bundesdeutschen Hochschulen nahm in der Zeit von 1973 bis 1982 zu. Der Trend ist wieder gegenläufig, sowohl im Bundesdurchschnitt als auch in Göttingen. Seit 1982 nimmt die Zahl der Studierenden aus „einfacheren“ sozialen Verhältnissen an der Universität Göttingen ab. Im Gegenzug steigt der Anteil der Studierenden aus den höheren sozialen Herkunftsgruppen. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt hat die Universität Göttingen einen deutlich größeren Anteil an Studierenden aus „höheren sozialen Herkunftsgruppen“. Sie hat somit eine relativ „elitäre“ Studentenschaft. 21 Abb. 5 Soziale Schicht der Eltern Göttinger Studierender 45 40 Anzahl in Prozent 35 30 25 20 15 10 5 0 1982 1988 1991 2000 Soziale Schicht der Eltern niedrig mittel gehoben hoch Erläuterung der Herkunftsgruppen: „niedrig“ un- und angelernte Arbeiter, Facharbeiter, ausführende Angestellte und Beamte „mittel“ qualifizierte Angestellte und kleine Selbstständige „gehoben“ Uni und hoher Abschluss Uni „hoch“ hohe Akademiker und größere Selbständige Daten: Henkel et al. 1990 für Studentenwerk Göttingen; Hehn und Sander 2002 für Studentenwerk Göttingen 4.3 Studienspezifische Merkmale der Patienten und Gesamtstudierenden der vier Kohorten 4.3.1 Anzahl der Hochschulsemester Die durchschnittliche Zahl der Hochschulsemester steigt bei den neuangemeldeten Studierenden in der Beratungsstelle über die Jahre kontinuierlich an. Für Kohorte 1 beträgt der Mittelwert 6 Semester. Die nachfolgenden Kohorten zeigen einen stetigen Anstieg des Mittelwertes. Die Kohorte 2 zeigt mit 8,4 Hochschulsemester den größten Anstieg. Von 1971 auf 1981 hat sich die durchschnittliche Hochschulsemesteranzahl um über 2 Hochschulsemester im Durchschnitt erhöht. Die nachfolgenden Kohorten zeigen eine weitere Zunahme der Anzahl der Hochschulsemester. 22 Für Kohorte 3 beträgt der Wert 8,6 Hochschulsemester und für Kohorte 4 9,6 Hochschulsemester im Durchschnitt. Zwischen Kohorte 1 und 4 ergibt sich eine Differenz von 3,6 Hochschulsemestern und somit ein hochsignifikantes Ergebnis (p‹0,001). Interessant sind die hohen Bandbreiten, die von minimal 1 Hochschulsemester bis zu 51 Hochschulsemestern in Kohorte 2 maximal reichen. Die Hochschulsemesteranzahl zeigt eine ansteigende Tendenz, genauso wie die Zunahme des Alters und ist daher kompatibel mit dem Anstieg des Mittelwertes des Alters der Klienten. Abb. 6 Mittelwerte der Semesteranzahl innerhalb der 4 Kohorten im Vergleich mit der Gesamtuniversität 12 9,6 Mittelwert Semesteranzahl 10 9,7 8,6 8,4 7,5 8 7,1 6 6 4 2 0 1 2 3 4 Kohorten Beratungsstelle Universität Daten von der Georg-August-Universität Göttingen, Stabsstelle DV der Zentralverwaltung Tabelle 4 Mittelwert und Standardabweichung der Anzahl der Hochschulsemester der Klienten innerhalb der vier Kohorten Kohorte 1 Kohorte 2 Kohorte 3 Kohorte 4 n=183 n=226 n=177 n=178 6,0 HS ± 4,4 8,4 HS ± 5,6 8,6 HS ± 5,6 9,6 HS ± 6,2 Df F p-Wert 3 14,137 ‹0,001 ± Standardabweichung 23 Im Bereich der Universität scheint es eine ähnliche Entwicklung zu geben. Für das SS 90 und WS 90/91 ergibt sich eine durchschnittliche Hochschulsemesteranzahl von 7,1 HS, im Vergleich zu SS 00 und WS 00/01, steigt diese auf den Wert 9,6 HS an. Ein Anstieg von 2,5 Semestern innerhalb von 10 Jahren. Für Kohorte 2 ergibt sich mit 7,5 Hochschulsemester ein ähnliches Ergebnis wie für Kohorte 3. Wobei die Ergebnisse für Kohorte 2 und 3 innerhalb der Universitätsstatistik kritisch betrachtet werden müssen, da bei Kohorte 2 und 3 die Daten, welche 12 Hochschulsemester überschreiten, nicht weiter einzeln differenziert werden. Für die Kohorte 4 gibt es eine einzelne Erfassung bis zum 25. Hochschulsemester, erst die Studenten mit mehr als 25 Hochschulsemestern werden nicht weiter differenziert und zu einer Gruppe zusammengefasst. Für Kohorte 1 liegen keine Daten vor. 4.3.2 Langzeitstudierende Zu den Langzeitstudenten werden nach der Definition Studenten mit größer gleich 14 Hochschulsemestern gezählt. In Kohorte 1 spielen Langzeitstudierende noch keine große Rolle. Lediglich 14 Studierende von 181 Neuanmeldungen somit 7,7%, entsprechen der Definition eines Langzeitstudierenden. In den folgenden 10 bis 30 Jahren nimmt diese Zahl stetig zu. In der Kohorte 2 sind es 13,7% Langzeitstudierende, in der Kohorte 3 sind es 20,3% Langzeitstudierende und in der Kohorte 4 sind es 20,2% Langzeitstudierende. Die beiden letzten Kohorten bilden mit jeweils über 20% den größten Anteil der Langzeitstudierenden innerhalb der Beratungsstelle. Abb. 7 Prozentualer Anteil der Langzeitstudierenden innerhalb der 4 Kohorten im Vergleich mit der Gesamtuniversität 25 21,6 20,3 20,2 20,2 21,7 Anzahl in Prozent 20 13,7 15 10 7,7 5 0 1 2 3 4 Kohorte Beratungsstelle Universität Daten von der Georg-August-Universität Göttingen, Stabsstelle DV der Zentralverwaltung 24 Tabelle 5 Anzahl der Langzeitstudierenden unter den Klienten innerhalb der vier Kohorten Kohorte 1 Kohorte 2 Kohorte 3 Kohorte 4 n=181 n=226 n=177 n=178 7,7% Max. HS (14) 13,7% Max. HS (31) 20,3% Max. HS (36) 20,2% Max. HS (36) Df Chi 2 p-Wert 3 15,184 ‹0,002 HS = Hochschulsemester Im Vergleich mit der Georg-August-Universität sind es 1981 21,6% der Studierenden, welche zu den Langzeitstudierenden gezählt werden. Für Kohorte 3 ergibt sich ein prozentuales Ergebnis von 20,2% und in Kohorte 4 zählen 21,8% der Gesamtstudierenden zu den Langzeitstudierenden. Es zeigt sich dementsprechend eine ansteigende Tendenz der Langzeitstudierenden innerhalb der Beratungsstelle und auf Ebene der Georg-August-Universität Göttingen. 4.3.3 Fakultätszugehörigkeit Zu der studienspezifischen Charakteristik gehört die Zuordnung auf die einzelnen Fakultäten. Die folgenden Fakultäten bzw. Studienfächer werden von den verschiedenen Patienten angegeben: Theologie, Jura, Medizin, Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften, Landwirtschaft (Agrar), Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Forstwirtschaft und Erziehungswissenschaften. Zu Mathematik und Naturwissenschaften werden Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Geowissenschaften gezählt. Diese Fakultäten haben sich im zeitlichen Verlauf aus der mathematischnaturwissenschaftlichen Fakultät gebildet. Für einen besseren Vergleich über 30 Jahre werden diese allgemein als Mathematische und Naturwissenschaftliche Fakultät zusammen betrachtet. Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften werden aus demselben Grund zusammen aufgeführt, Sie wurden ebenso erst im weiteren zeitlichen Verlauf auf Universitätsebene voneinander getrennt. Für einen besseren Überblick wird auf jede Fakultät im Folgenden separat eingegangen: Jura: Die Patienten der Beratungsstelle, welche Jura studieren und somit der Juristischen Fakultät angehören, sind relativ konstant über die 4 verschiedenen Zeiträume gleichmäßig verteilt. Sie bilden jeweils über 10% der Klientel der Beratungsstelle pro Kohorte. Es zeigt sich über den Zeitraum von 30 Jahren kein wesentlicher Unterschied in der Inanspruchnahme von professioneller Beratung bei Jurastudenten. 25 Die Vergleichswerte der Universität zeigen ein ähnliches konstantes Bild in der Verteilung, wobei die Kohorte 1 etwas heraus sticht. 1971 zählen 15,1% der ordentlich immatrikulierten Studierenden zu der juristischen Fakultät, der größte Anteil im Verlauf von 30 Jahren. Die Jurastudenten machen jeweils über 10% der Gesamtstudierenden der Universität pro Kohorte aus. Medizin: Die Medizinstudierenden zeigen einen deutlichen Anstieg in der Inanspruchnahme von professioneller Beratung. Innerhalb von 10 Jahren hat sich der prozentuale Anteil der Medizinstudierenden an der Klientel der Beratungsstelle verdoppelt. In den darauf folgenden Kohorten zeigt sich kein weiterer größerer Sprung. Es bildet sich ein konstantes Niveau zwischen 10,4% (Kohorte 2), 14,7% (Kohorte 3) und 11,1% (Kohorte 4) als prozentualer Anteil der Medizinstudenten an der Klientel der Beratungsstelle innerhalb der Kohorten. Die Verteilung innerhalb der Universität bleibt mit 11,6% in Kohorte 1 und 11,4% in Kohorte 2 annähernd gleich. Die Kohorte 3 und 4 zeigen eine ansteigende Tendenz, mit jeweils 14,3% und 16,1%. Die Gesamtzahl der Studierenden unterscheidet sich jedoch von Kohorte 1 mit 1.448 Medizinstudierenden auf 2.914 Medizinstudierenden in Kohorte 2. Der Anstieg der Gesamtanzahl an Studierenden von Kohorte 1 auf Kohorte 2 spielt in allen Fakultäten eine Rolle und ist nicht auf einzelne beschränkt. In Kohorte 1 sind 12.450 Studierende an der Georg-August-Universität Göttingen immatrikuliert, in Kohorte 2 sind es 25.506 Studierende. Diese Zeitperiode prägte das Stichwort „Massenuniversität“. Philosophische Fakultät: Die Studierenden der Philosophischen Fakultät machen in Kohorte 1 den größten Anteil der Klientel der Beratungsstelle mit 31,5% aus. In den darauf folgenden Kohorten 2 und 3 kann diese Position mit prozentualen Einbussen auf 24,8% bzw. 26,6% gehalten werden. Die Kohorte 4 zeigt eine große Abnahme auf 14%, das entspricht der Abnahme der Anzahl von 47 Studierenden in Kohorte 3 auf 29 Studierende in Kohorte 4, die für sich Beratung in Anspruch nehmen. In der Gesamtzahl aller Studierenden, welche die Beratungsstelle über den Zeitraum von 30 Jahren aufsuchten, ist die Philosophische Fakultät auf dem ersten Rang. Im Vergleich mit der Universitätsstatistik bildet auch hier die Philosophische Fakultät den größten Anteil von den Gesamtstudierenden mit 25,2% in Kohorte 1 und 18,5% in Kohorte 2. Die abnehmende Tendenz wird in Kohorte 3 durch einen Anteil von 17,9% sichtbar. Die Philosophische Fakultät fällt auf den zweiten Rang und wird von den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften auch in der folgenden vierten Kohorte mit einem um 8% höherem Anteil übertroffen. Die Anzahl der Studierenden der Philosophischen Fakultät sinkt von 1990 mit 5.389 bis 2000 mit 3.882 Studenten um 1.505 Studenten. In der Gesamtzahl aller Studierenden über den Zeitraum von 30 Jahren ist die Philosophische Fakultät die zweitgrößte Gruppe. Mathematik und Naturwissenschaften: Zu dieser Gruppe zählen wie anfangs schon beschrieben die Fachbereiche Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Geowissenschaften. Diese Gruppe macht einen großen Anteil der Klientel der Beratungsstelle in 3 von 4 Kohorten aus. In der ersten Kohorte ist der Anteil so groß, dass die Mathematische und Naturwissenschaftliche Fakultät (Math.-Nat.) mit 26 16,8% die zweitgrößte Gruppe hinter den Studierenden der Philosophischen Fakultät mit 31,5% bilden. Für Kohorte 3 fällt das Ergebnis ähnlich aus mit 26,6% für die Philosophische Fakultät und 20,3% bei der Math.-Nat. Gruppe. In Kohorte 2 ist der Anteil auf 13,5% abgefallen, im Gegensatz dazu ist in dieser Zeit ein Anstieg unter den Wirtschafts- und Sozialwissenschaft Studierenden erkennbar. Eine geringere Inanspruchnahme zeigt sich zwischen Kohorte 3 und 4, in 1990 meldeten sich 36 Math.-Nat. Studierende neu in der Beratungsstelle an, in 2000 sind es nur noch 6 Studierende. Der prozentuale Anteil an der Klientel sinkt in dieser Periode von 20,3% auf 2,9% ab. Die Universitätsdaten zeigen eine gewisse Konstanz der Math.-Nat. Studierenden zwischen 16,1% und 19,6% der Gesamtstudierenden. Der Mittelwert liegt bei 18,3% und somit ist die Math.-Nat. Fakultät im Durchschnitt die drittgrößte Gruppe unter allen Fakultäten. Agrar- /Landwirtschaft: Die Landwirtschaftsstudierenden machen in 3 von 4 Kohorten nur einen geringen Prozentanteil der Klientel der Beratungsstelle aus. Von Kohorte 3 auf Kohorte 4 ergibt sich ein großer Anstieg auf 15% der Gesamtklientel. Das entspricht einer Zunahme von 7 Patienten auf 31 Patienten. Faktisch handelt es sich um eine Vervierfachung des Anteils der Landwirtschaftsstudierenden und dementsprechend bildet die Landwirtschaftliche Fakultät in Kohorte 3 die drittgrößte Gruppe innerhalb der Beratungsstelle hinter den Wirtschafts- und Sozialwissenschaftsstudierenden und Forstwirtschaftstudierenden. Aus den Universitätsdaten zeigt sich zum einen der bekannte Anstieg der Studierenden von Kohorte 1 im Mittel 620 Studenten auf 2.056 in Kohorte 2. Im Verhältnis zu den Gesamtstudierenden liegt die Landwirtschaftliche Fakultät bei 5% bzw. 8,1%. Die Kohorte 2 bildet den größten Anteil der Landwirtschaftsstudierenden im Verhältnis zu Gesamtstudierenden in den darauf folgenden Jahren zeigt sich eine abnehmende Tendenz. In Kohorte 3 sind 1.929 und in Kohorte 4 nur noch 998 Studierende als Landwirtschaftsstudierende eingeschrieben. Somit zeigt sich ein Abstieg von 8,1% auf 6,4% auf 4,4% des Anteils der Gesamtstudierenden. Die Kohorte 4 hat mit 4,4% den kleinsten prozentualen Anteil an der Gesamtstudierendenstatistik. Im Verlauf von 1981 auf 1990 hat sich die Landwirtschaftliche Fakultät um fast 1.000 Studierende verringert. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftsstudierenden werden zusammengezählt, da Sie erst für Kohorte 2 von der Universität einzeln aufgeführt werden. Um einen besseren Vergleich über 30 Jahre gewährleisten zu können werden die Fakultäten in dieser Untersuchung nicht getrennt voneinander untersucht. Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftsstudierenden machen seit Bestehen der Beratungsstelle einen Anteil von über 13% der Gesamtpatienten aus und bleiben im Verlauf von 30 Jahren konstant über diesem Anteil. Die Kohorten 1 und 3 zeigen mit 14,1% und 13,6% die geringsten Werte für die Wirtschaft- und Sozialwissenschaftsstudierenden. Die Kohorten 2 und 4 setzten sich von den anderen beiden Kohorten ab, indem sie jeweils ein zunehmendes Potential aufweisen. Für die Kohorte 2 eine Zunahme auf 17% 27 des prozentualen Kohortenanteils, für die Kohorte 4 zeigt sich eine noch größere Zunahme auf 22,2%. Die Kohorte 4 bildet mit 22,2% sogar die größte Gruppe. Die Wirtschaft- und Sozialwissenschaftsstudierenden belegen also Rang 1, unter den Gesamtklienten der Beratungsstelle. Somit löst diese Fakultät die langjährige Mehrheit der Philosophischen Fakultät unter den Klienten ab. Im Vergleich mit den Universitätsdaten zeigt sich hier eine ansteigende Tendenz über alle Kohorten hinweg. Der größte Anstieg der Anzahl der Studierenden liegt nicht wie erwartet von Kohorte 1 auf 2 (2.379 zu 4.628 Differenz 2.249), sondern von Kohorte 2 auf 3 (4.628 zu 6.988; Differenz 2.360). Bezogen auf die Gesamtanzahl bilden die Wirtschaft- und Sozialwissenschaftsstudenten mit 23,3% und 25,4% jeweils für Kohorte 3 und 4 die größte Gruppe und lösen somit die Studierenden der Philosophischen Fakultät, die in Kohorte 1 und 2 jeweils die größte Gruppe bildeten, ab. Die Entwicklung in der Beratungsstelle ist in diesem Punkt kompatibel mit der Entwicklung auf Universitätsebene. Forstwirtschaft: In der ersten Kohorte hat sich kein einziger Forstwirtschaftsstudent in der Beratungsstelle angemeldet, in der darauf folgenden Kohorte 2 hat sich lediglich einer. Die ersten beiden Kohorten zeigen eine geringe Inanspruchnahme an psychologischer Beratung innerhalb dieser Fakultät. Ab Kohorte 3 gibt es einen Anstieg von einem auf 6 Studenten und somit einem prozentualem Zuwachs von 0,4% in Kohorte 2 auf 3,4% in Kohorte 3 bezogen auf das Gesamtklientel der Beratungsstelle für die beschriebene Kohorte. In Kohorte 4 erhöht sich der Bedarf derart, dass eine Versechsfachung vorliegt. In 2000 haben sich 40 Forstwirtschaftsstudierende in der Beratungsstelle neu angemeldet. Somit vertritt die Forstwirtschaftliche Fakultät mit 19,3% die zeitgrößte Gruppe hinter der Wirtschaft- und Sozialwissenschaftliche Fakultät mit 22,2% im Bezug auf die Gesamtklientel neuangemeldeter Studierende für 2000. In den Universitätsdaten ist keine parallele Entwicklung zu erkennen. Von Kohorte 1 auf 2 gibt es einen allgemeinen bekannten Zuwachs von 138 auf 581 Studierende. Bezogen auf die Gesamtuniversität spielt die Forstwirtschaftliche Fakultät mit 1,1% und 2,3% eine untergeordnete Rolle. Für Kohorte 3 und 4 ändert sich dieses Ergebnis lediglich um 0,3% auf 2,6%. Sowohl die Kohorte 3 als auch die Kohorte 4 zeigen hier mit 2,6% das gleiche Ergebnis, wobei die absoluten Zahlen sogar von 769 in Kohorte 3 auf 582 Studierende in Kohorte 4 sinken. Diese Daten zeigen nicht, wie etwa in der Beratungsstelle, eine Erhöhung der Studierendenzahl in Kohorte 4. Theologen: Beim Betrachten der Ergebnisse für die Theologiestudierende zeigt sich ein sprunghaftes Bild. In Kohorte 1 melden sich 4 Theologiestudierende neu an, in Kohorte 2 sind es 29, in Kohorte 3 sind es wie in Kohorte 1 vier Studenten und in Kohorte 4 meldet sich kein einziger Studierender in der Beratungsstelle an. Die Kohorte 2 bildet mit 12,6% den vierten Rang unter allen Fakultäten zu diesem Zeitpunkt. In allen anderen Zeiträumen ist die Anmeldungsrate, ob absolut oder prozentual, sehr gering. 28 Die Universitätsdaten zeigen die bekannten Erhöhung der Anzahl an Studierenden von Kohorte 1 mit im Mittel 491 Studenten auf Kohorte 2 mit 1.551 Studenten. Prozentual gesehen ist ein Zuwachs von 3,9% auf 6,1% im Bezug auf die Gesamtstudierenden zu sehen. Die darauf folgenden Kohorten zeigen eine absteigende Tendenz mit 3,4% für Kohorte 3 und 1,6% für Kohorte 4 jeweils bezogen auf die Gesamtstudierenden der Universität Göttingen zu den verschiedenen Zeiträumen. Die absolute Zahl für 2000 liegt nur noch bei 370 Theologiestudenten. Erziehungswissenschaftler: Die Studierenden der Erziehungswissenschaften nehmen den dritten Rang unter allen Neuangemeldeten Studierenden für Kohorte 1 mit 15,2% ein. Die absolute Zahl beträgt 28 Studierende. In den anderen Kohorten vermindert sich das Ergebnis von 11 Studierenden in Kohorte 2 und 4,8% bezogen auf das Gesamtklientel, auf 5 Studierende in Kohorte 3 und 4 und jeweils einen Anteil von 2,8% bzw. 2,4% an der Klientel der Beratungsstelle. Für die Kohorten 1 und 4 lassen sich auf Universitätsebene für die Studierenden der Erziehungswissenschaften leider keine Ergebnisse feststellen. Die Daten sind nicht vorhanden. Die abnehmende Tendenz zwischen Kohorte 2 und 3 ist aber ebenfalls erkennbar. 1981 sind es im Mittel 1.663 Studierende, 1991 ist es mit 622 Studierenden weniger als die Hälfte. Bezogen auf die Gesamtstudierenden beträgt die Anzahl 6,5% für Kohorte 2 und 2,1% für Kohorte 3. Tabelle 6 Klientel der Beratungsstelle aufgeteilt nach Fakultätszugehörigkeit in Prozent Fakultät 1 2 3 4 Gesamt Chi 2 Df p-wert Juristische Fakultät 12,0 (22) 10,9 (25) 12,4 (22) 11,1 (23) 11,5 (92) 254,99 27 ‹0,001 Medizinische Fakultät 4,9 (9) 31,5 (58) 16,8 (31) 2,7 (5) 0 10,4 (24) 24,8 (57) 13,5 (31) 5,7 (13) 0,4 (1) 17,0 (39) 12,6 (29) 4,8 (11) 0 14,7 (26) 26,6 (47) 20,3 (36) 4,0 (7) 3,4 (6) 13,6 (24) 2,3 (4) 2,8 (5) 0 11,1 (23) 14,0 (29) 2,9 (6) 15,0 (31) 19,3 (40) 22,2 (46) 0 10,3 (82) 23,9 (191) 13,0 (104) 7,0 (56) 5,9 (47) 16,9 (135) 4,6 (37) 6,1 (49) 0,6 (5) Philosophische Fakultät Math.-Naturwissen. Fakultät Landwirtschaftliche Fakultät Forstwirtschaftliche Fakultät Wirtschaft. -Sozialwiss. Fakultät Theologische Fakultät Erziehungswiss. Nicht immatrikuliert 14,1 (26) 2,2 (4) 15,2 (28) 0,5 (1) 2,4 (5) 1,9 (4) 29 Abb. 8 35 30 25 20 15 10 5 0 ni ch t im m at ri ku lie rt Ju ri M st ed .F iz . in Ph i sc ilo he so F. M ph at i sc h. he -N at F. ur w La iss nd .F w . ir ts Fo ch rs .F tw . ir ts ch .F . W i.So .F Th . eo Er lo g. zi F. eh un gs w iss . Prozent Klienten aufgeteilt nach Fakultätszugehörigkeit Kohorte Kohorte 1 Kohorte 2 Kohorte 3 Kohorte 4 Abb. 9 30 25 20 15 10 5 0 M Ju ri st ed F. iz in isc Ph he ilo F. so ph M isc at h. he -N F. at ur w iss La .F nd . w ir ts ch Fo .F rs . tw ir ts ch .F . W i.So .F . Th eo lo Er g. zi F. eh un gs w iss . Prozent Studierende der Georg-August- Universität aufgeteilt nach Fakultätszugehörigkeit Fakultät Kohorte 1 Kohorte 2 Kohorte 3 Kohorte 4 Daten von der Georg-August-Universität Göttingen, Stabsstelle DV der Zentralverwaltung 30 4.4 Art der Studienwahl Zur Art der Studienwahl gibt der größte Teil der Studierenden in allen Kohorten als Erstnennung die eigenen Interessen an. Sie macht in jeder Kohorte über 80% aus. Lediglich in Kohorte 3 gibt es eine Abnahme, so dass hier dementsprechend die Angabe der Eltern einen Zuwachs verbuchen kann. Neben den Eltern sind noch die Freunde, Bekannte zu beachten. Hier zeigt sich in Kohorte 2 eine größere Relevanz (4%) als in den folgenden Kohorten. Die Schule, bestimmte Lehrer und die Berufsberatung spielen eine geringe Rolle bei der Studienwahl. In der Kohorte 1 wurden diese Daten nicht erhoben (p‹ 0,032). Abb. 10 Art der Studienwahl der Klienten innerhalb der vier Kohorten So ns t ig es er es se n El te rn Sc hu le Le hr er F Be re un ru fs be de ra tu ng Ei g en e In t Anzahl in Prozent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Art der Studienwahl Kohorte 2 Kohorte 3 Kohorte 4 31 4.5 Selbstbilder der Patienten/Persönlichkeitsmerkmale 4.5.1 Persönlichkeitsmerkmale — Gießen-Test Die Persönlichkeitsmerkmale und Selbstbilder der Patienten wurden mittels des Gießen-Tests ermittelt. Die erste Standardskala des Gießen-Test GT1 soziale Anerkennung/Resonanz, in der es hauptsächlich um die Interaktion mit der Umgebung geht, zeigt für Kohorte 1 den geringsten Mittelwert mit 22,3, jedoch ist der Unterschied nicht signifikant (p=0,11). Es ist anzunehmen, dass sich die Patienten aus Kohorte 1 tendenziell zum größten Teil negativ sozial resonant gefühlt haben. Negative soziale Resonanz kann durch Adjektive wie z.B. unbeliebt, nicht durchsetzungsfähig und unattraktiv definiert werden (Normwert 28,86). Die zweite Standardskala des Gießen-Test GT2 Dominanz versus Gefügigkeit zeigt eine eher dominante Selbsteinschätzung in Kohorte 3 mit einem Mittelwert von 23,1 (vgl. Abb.11). Die Werte der anderen Kohorten liegen in der Nähe, so dass eine Signifikanz lediglich auf dem 10%-Niveau besteht (p=0,098) und dementsprechend nur eine Tendenz da ist. Dominanz wird charakterisiert durch ein Selbstbild, welches sich eher eigensinnig zeigt, häufig in Auseinandersetzungen verstrickt ist und sich schwer unterordnet (Normwert 27,35). In der dritten Standardskala GT3 Kontrolle (unterkontrolliert/zwanghaft) ergeben sich in der Untersuchung mittels Duncan-Test drei Untergruppen. Die Kohorte 2 zeigt sich gering unterkontrolliert mit einem Mittelwert von 25,3 liegt die Gruppe am nächsten zum Normwert von 27,7. Die Kohorten 3 und 4 zeigen eine höhere Unterkontrolle. Mit einem Mittelwert von 21,7 für Kohorte 4 und 21,8 für Kohorte 3 beschreiben Sie sich als tendenziell eher unordentlich, bequem und eher unbegabt im Umgang mit Geld, bei einem Signifikanz-Niveau von p kleiner 0,001. In der GT4 Grundstimmung ergeben sich erneut 3 Untergruppen im Duncan-Test. Die Kohorten 1 und 2 bilden die Gruppe mit einer hohen Depressivität. Personen aus dieser Gruppe sehen sich als sehr ängstlich, sehr selbstkritisch, häufig bedrückt, stark zur Selbstreflexion neigend und eher abhängig an. Die Kohorte 4 bildet mit 29 die mittlere Gruppe. Die Kohorte 3 zeigt eine geringere Depressivität bei 27,5 (Normwert 22,8). Der Unterschied ist hoch signifikant (p‹0,001). Die GT5 beschäftigt sich mit der Durchlässigkeit. Es zeigen sich im Duncan-Test überschneidende Untergruppen 4, 3 und 1 versus 3, 1 und 2. Die Kohorte 2 zeigt die höchste Retentivität und sieht sich somit eher verschlossen, anderen fern und eher wenig preisgebend. Die Kohorte 4 zeigt die geringste Retentivität und ist daher eher aufgeschlossener und anderen nahe. In dieser Untersuchung ist kein systematischer zeitlicher Kohorteneffekt erkennbar (Normwert 23,44). In der GT6 Soziale Potenz ergibt sich ein ähnliches Ergebnis wie in GT5. Es bilden sich wieder zwei sich überschneidende Untergruppen im Duncan-Test 4, 1 und 3 versus 1, 3 und 2. Die Kohorte 2 zeigt die höchste soziale Impotenz mit einem Mittelwert von 22,4. 32 Soziale Impotenz lässt sich durch die Attribute ungesellig, kaum fähig zur Dauerbindung, wenig hingabefähig und phantasiearm beschreiben. Die Kohorte 4 zeigt mit einem Mittelwert von 20,8 die Selbsteinschätzung Richtung soziale Potenz und sieht sich daher eher gesellig, hingabefähig und zur Dauerbindung fähig (Norm 21,51). Tabelle 7 Gießen-Test-Auswertung innerhalb der vier Kohorten GT Skala 1 (n=87) 2 (n=229) 3 (n=171) 4 (n=210) Standard Normwert p-Wert Soziale Resonanz Mean ± SD 22,3 ± 5,4 Mean ± SD 23,2 ± 5,8 Mean ± SD 22,7 ± 6,2 Mean ± SD 23,8 ± 5,4 28,86 0,1 Dominanz 23,4 ± 5,8 24,2 ± 5,5 23,1 ± 4,9 23,2 ± 5,3 27,35 0,098 Kontrolle 23,1 ± 5,5 25,3 ± 5,5 21,8 ± 5,2 21,7 ± 5,2 27,74 ‹0,001 Grundstimmung 32,1 ± 5,1 32,0 ± 5,4 27,5 ± 5,5 29,0 ± 5,2 22,80 ‹0,001 Retentivität 25,3 ± 7,1 25,7 ± 7,1 24,5 ± 7,7 23,7 ± 7,0 23,44 ‹0,03 Soziale Potenz 21,5 ± 5,4 22,4 ± 5,4 21,7 ± 4,5 20,8 ± 4,9 21,51 ‹0,01 ± Standardabweichung Abb.11 Gießen-Test- Profilblatt der 4 Kohorten aus Mittelwerten Standard-Normwerte NR PR 10 15 20 25 30 35 40 DO GE 10 15 10 15 20 25 30 35 30 35 40 UK 20 25 ZW 40 HM DE 5 10 15 20 25 30 35 DU 5 10 15 20 25 30 35 RE 40 PO IP 5 10 15 20 25 30 35 40 Kohorte 1 Kohorte 2 Kohorte 3 Kohorte 4 33 4.5.2 Prüfungsangst Die Untersuchung zur Prüfungsangst führt interessanterweise zu keinem signifikanten Unterschied zwischen den verschiedenen Kohorten (p=0,47). Die durch die Patienten erlebte Prüfungsangst ist zu allen erhobenen Zeitpunkten gleich hoch und innerhalb von allen Kohorten permanent vorhanden. Der Prüfungsangst-Fragebogen von Spitznagel (1968) wurde erst ab Kohorte 2 eingesetzt. Für den Gesamtpunktwert ergab der T - Test keinen signifikanten Unterschied. Für die Teilskala I war die Differenz hochsignifikant (p<0,01), d.h., die Kohorte 4 erlebte im Mittel die direkte "Interaktion mit dem Prüfer" als belastender. Tabelle 8 Mittelwert und Standardabweichung von Prüfungsangst innerhalb der Kohorten Kohorte 1 Nicht erhoben Kohorte 2 Kohorte 3 Kohorte 4 Signifikanz: n=223 n=172 n=194 p-Wert 5,3 ± 1,6 5,2 ± 1,6 5,4 ± 1,6 0,47 ± Standardabweichung 4.5.3 Fragebogen zur Beurteilung der Suizidgefahr Die persönliche Einschätzung der Suizidgefährdung mittels FBS-Fragebogen führt zu dem Ergebnis, dass die Kohorte 2 das höchste depressiv-suizidales Empfinden mit 29,5 angibt. Die Kohorte 3 liegt bei 27,5 und die Kohorte 4 bei 26,3. In Kohorte 1 wurde dieser Test nicht durchgeführt. Die kohortenbezogenen Differenzen in diesem Punkt erweisen sich als hochsignifikant (p‹ 0,005). Tabelle 9 Mittelwert und Standardabweichung Fragebogen zur Suizidalität Kohorte 1 Nicht erhoben Kohorte 2 Kohorte 3 Kohorte 4 Signifikanz: n=220 n=173 n=151 p-Wert 29,5 ± 10,2 27,5 ± 10,3 26,3 ± 8,9 ‹0,005 ± Standardabweichung 34 4.6 Wöchentliche Arbeitszeit Die Frage „wie viel Stunden, schätzen Sie, wenden Sie während des Semesters für Ihr Studium auf?“ (Antwortmöglichkeit „X“ Stunden/Woche) führte zu dem Ergebnis einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 27,7 Stunden in Kohorte 3, 29,3 Stunden in Kohorte 4 und 31,8 Stunden in Kohorte 2. Damit geben die Studierenden in Kohorte 2 die höchste wöchentliche Arbeitszeit unter allen Kohorten an. Zwischen Kohorte 2 und 3 ergibt sich eine Differenz von rund 4 Stunden (p‹ 0,37). Tabelle 10 Mittelwert und Standardabweichung der wöchentlichen Arbeitszeit pro Kohorte Kohorte 1 Nicht erhoben Kohorte 2 Kohorte 3 Kohorte 4 Signifikanz n=200 n=173 n=167 p-Wert 31,8 Std. ±13,9 27,7 Std. ± 16,7 29,3 Std. ± 15,5 ‹0,04 ± Standardabweichung Das Studentenwerk Göttingen führt seit 1988 die Befragung zum studentischen Zeitbudget und Anwesenheit an der Hochschule im Rahmen der Befragung zur sozialen Lage der Göttinger Studierenden durch. Die von uns verwendeten Daten inkludieren jeweils die Zeit für Lehrveranstaltungen und die Zeit für sonstigen studienbezogenen Aufwand. Zum sonstigen studienbezogenen Aufwand zählen beispielsweise die Vor- und Nachbereitung, aber auch Arbeitsgruppen und die Zeit für eventuelle Sprechstunden. Die Zeit für Erwerbstätigkeit an der Hochschule wurde nicht berücksichtigt. 1988 beträgt die wöchentliche Arbeitszeit für Lehrveranstaltungen (18,2 Std.) und sonstigen studienbezogenen Aufwand (21,8 Std.) insgesamt 40 Stunden. 1997 gehen die Göttinger Studenten durchschnittlich 16,3 Stunden zu Lehrveranstaltungen pro Woche und verwenden 21,6 Stunden für sonstigen studienbezogenen Aufwand, insgesamt beträgt die wöchentliche Arbeitszeit somit 37,9 Stunden. Im Jahr 2000 nimmt die Zeit für den Besuch von Lehrveranstaltungen auf 19,8 Stunden zu, der studienbezogene Aufwand geht leicht zurück auf 20 Stunden, insgesamt beträgt die wöchentliche Arbeitszeit 39,8 Stunden (Daten von Henkel et al. 1990). Die Klientel der Beratungsstelle schätzt Ihre wöchentliche Arbeitszeit über alle 4 Kohorten hinweg jeweils geringer ein, als die Studierenden der Universität Göttingen. 35 4.7 Berufsperspektive Auf die Frage: „ Hatten Sie, als Sie anfingen zu studieren, schon genaue Vorstellungen darüber, was Sie später beruflich machen werden?“ (Antwortmöglichkeit ja/nein) konnten 32,8% der Kohorte 2, 32% der Kohorte 3 und 42,6% von Kohorte 4 diese Frage bejahen. In Kohorte 1 wurde diese Frage nicht gestellt (p=0,057). Abb. 12 Äußerungen zur Berufsperspektive innerhalb der Kohorten 80 70 Anzahl in Prozent 60 50 40 30 20 10 0 keine Nennung Nennung Berufsperspektive Kohorte 2 Kohorte 3 Kohorte 4 nicht erhoben innerhalb von Kohorte 1 4.8 Therapeuten-Prognosen nach Erstgespräch Dieser Teil der Arbeit befasst sich mit den Ergebnissen/Daten, welche durch die Therapeutenangaben gewonnen wurden. Hierbei kreuzten die Therapeuten nach dem Erstgespräch mit dem Patienten auf dem Erstinterviewbogen ihre Einschätzungen/Prognosen bezüglich der sozialen Prognose, Studienerfolg, in Bezug auf die geäußerte Symptomatik und ab Kohorte 2 auch bezüglich der Suizidgefährdung auf einer Skala von 1 „günstig“ bis 7 „ungünstig“ an. 36 Auf dem Erstinterviewbogen erscheinen ebenfalls die Einschätzungen zu Körpersphäre, psychische Symptome, Leistungsbereich und Sozialbereich, die im nächsten Unterpunkt Themenschwerpunkt sind. In den ausgewerteten Daten zur Prognoseeinschätzung zeigt sich ein hochsignifikanter Unterschied bezüglich des Studienerfolges für Kohorte 1. Dieser Unterschied ist derart signifikant (p‹0,001), dass für Kohorte 1 die günstigste Prognose angegeben wird. Der genaue Wert liegt bei 2,8 für Kohorte 1 und jeweils bei 3,2 für Kohorte 2 und 4. Die ungünstigste Prognose bezüglich des Studienerfolges wird bei Kohorte 3 von den Therapeuten mit einem Wert von 3,4 eingeschätzt. Im Bezug auf die geäußerte Symptomatik ergeben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Kohorten. Die Prognosezuschreibungen durch die Therapeuten sind genauso wie bei der sozialen Prognose ungefähr gleich bleibend. Über 30 Jahre bleiben die Einschätzung zur sozialen Prognose und die Einschätzung bezüglich der geäußerten Symptomatik durch die Therapeuten gleich. Ab Kohorte 2 wurde noch zusätzlich die Prognose zur Suizidgefährdung von den Therapeuten eingeschätzt. Es ergibt sich ein signifikanter Unterschied (p‹0,001) zwischen den einzelnen Kohorten. Die Kohorten 2 und 4 sind sich ähnlich und bilden eine Untergruppe, Kohorte 3 zeigt mit einem Wert von 2,8 die ungünstigste Prognose bezüglich der Suizidgefährdung. Vergleicht man die Skalen „Prognose hinsichtlich der angegebenen Symptomatik und Prognose des Studienerfolgs“ zeigt sich speziell bei Kohorte 1, dass der Therapeut eher erwartet, dass der Patient sein Studium erfolgreich abschließt, als dass er seine Störungen in einer Behandlung verlieren kann. Tabelle 11 Mittelwert und Standardabweichung der Therapeuten-Prognosen Therapeutenprognose Kohorte 1 Kohorte 2 Kohorte 3 Kohorte 4 p-Wert Studienerfolg 2,8 ± 1,8 3,2 ± 1,6 3,4 ± 1,5 3,2 ± 1,6 ‹0,001 Geäußerte Symptomatik 4±2 3,8 ± 1,1 3,8 ± 1,2 3,6 ± 1,2 n. s. Soziale Prognose 3,1 ± 1,8 3 ± 1,2 3,2 ± 1,1 3,1 ± 1,4 n. s. Suizidgefährdung n. e. 2,3 ± 1,4 2,8 ± 1,4 2,3 ± 1,9 ‹0,001 ± Standardabweichung 37 4.9 Symptomzuschreibungen durch Therapeuten nach Erstgespräch Wie schon im Material- und Methodenteil beschrieben kreuzten die Therapeuten nach dem Erstgespräch einen Erstinterview-/Symptombogen mit Symptomen zu 5 verschiedenen Ebenen (Körpersphäre, psychische Symptome, Leistungsbereich, Sozialbereich und Sonstiges) an. Auf der Ebene der Körpersphäre werden in dieser Arbeit Ess- und Appetitstörungen, Sexualstörungen (Impotenz, Frigidität) und Schlafstörungen untersucht. Zum Leistungsbereich zählen Leistungsabfall, versagen, generelle Lernstörung, Plan- und Ziellosigkeit des Arbeitsverhaltens sowie Überforderung (Perfektionist, Zwanghaft), Versagen vor Examen und Versagen nach Examen. Im Sozialbereich wurden speziell Kontaktschwierigkeiten und Partnerproblematik für die einzelnen Kohorten untersucht. Bezogen auf die psychischen Symptome spielen depressive Verstimmung, Störungen des Selbstwertgefühles, Suizidideen, frei flottierende Angst und objektiv und situationsgebundene Angst eine Rolle. Die Auswertungen im Bereich Körpersphäre zeigen einen hochsignifikanten Unterschied bei Sexualstörungen (p‹0,001) (s.Tab.11 S.40). 4.9.1 Körpersphäre In Kohorte 1 gibt es verhältnismäßig viele Therapeuteneinschätzungen im Bezug auf eine vorhandene Sexualstörung der Patienten. Die absolute Zahl beträgt 37 Patienten, welche einen prozentualen Anteil von 19,8% ausmacht. In den folgenden Kohorten zeigt sich eine abnehmende Tendenz auf 6,7% für Kohorte 2 und nur 1,3% für Kohorte 4. In Kohorte 3 wurde diese Untersuchung nicht durchgeführt. Somit wird in Kohorte 1 das größte Potential an Sexualstörungen aus Therapeutensicht gesehen (p‹0,001). Zum Thema Schlafstörungen sehen die Therapeuten die Kohorte 4 am gefährdeten. Von 156 Patienten geben sie für 29 Patienten eine Schlafstörung an (18,6%). Am geringsten ist die Schlafstörung in Kohorte 2 mit 8,1% ausgeprägt. Die Kohorte 4 differenziert sich auch im Bereich Ess-/ und Appetitstörungen als die größte Gruppe. Von 156 Patienten bekommen 15 Patienten eine Ess-/ und Appetitstörung diagnostiziert. Das entspricht einem Anteil von 9,6%. Am wenigsten wird dieses Symptom in Kohorte 1 angegeben. Von 187 Patienten wird bei 6 Patienten eine Ess-/Appetitstörung bejaht, was einen prozentualen Anteil von 3,2% ausmacht. Für Kohorte 3 wurden diese Daten nicht erhoben. 38 Abb. 13 Therapeuteneinschätzung zur Symptomatik der Körpersphäre innerhalb der vier Kohorten 20 18 Symptomatik in Prozent 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1 2 3 4 Kohorten Ess-/Appetitstörungen 4.9.2 Sexualstörungen Schlafstörungen Leistungsbereich Im Leistungsbereich ergeben sich Unterschiede zum Thema Plan- und Ziellosigkeit des Arbeitsverhaltens. Hier nimmt die Kohorte 3 mit 22% bzw. 39 Patienten für welche diese Symptomatik zutrifft von 177 Neuanmeldungen in 1990 den ersten Rang ein. In allen anderen Kohorten liegt die Einschätzung der Therapeuten bezüglich dieser Symptomatik nahezu konstant zwischen 14 bis 16% der Neuanmeldungen (p= 0,198). Im Bereich Leistungsabfall, -Versagen, allgemeine Lernstörung nimmt die Kohorte 3 ebenfalls den ersten Rang mit 31,1% bzw. 55 Patienten ein, für welche diese Symptomatik nach Therapeuteneinschätzungen zutrifft, von 177 Neuanmeldungen in 1990 ein. Die Kohorte 4 bildet den geringsten Teil mit 14,7%, die anderen beiden Kohorten 1 und 3 liegen bei 23 bzw. 24,2% (p‹ 0,01). 39 In dem Bereich Überforderung, Perfektionist, Zwanghaft bildet die Kohorte 4 mit 23,7%, d. h. von 156 Neuanmeldungen wird für 36 Patienten diese Symptomatik bejaht, die größte Gruppe. Die Kohorte 3 folgt mit 19,8%, dahinter die Kohorte 2 mit 12,1%. Mit nur 3,7% bildet die Kohorte 1 die kleinste Gruppe im Bereich dieser Symptomatik. Der Komplex der Symptomatiken im Leistungsbereich wird von Kohorte 3 dominiert. Abb. 14 Therapeuteneinschätzung zur Symptomatik im Leistungsbereich innerhalb der vier Kohorten 35 Anzahl in Prozent 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 Kohorten Leistungsabfall / Lernstörungen Plan -und Ziellosigkeit d. Arbeitsverh. Überforderung, Perfektionist, Zwanghaft Versagen vor Examen Versagen im Examen 4.9.3 Sozialbereich Zum Punkt Sozialbereich wurden die Daten hinsichtlich Kontaktschwierigkeiten und Partnerproblematik näher untersucht. Im Bereich Kontaktschwierigkeiten liegt die größte Anzahl nach Therapeutenangaben bei Kohorte 2 mit 37,7%. Von 223 neuangemeldeten Patienten wird 84 Patienten diese Symptomatik diagnostiziert. Auf den zweiten Rang folgt Kohorte 1 mit 27,6% und dahinter Kohorte 3 mit 27,1%. Den geringsten Anteil in diesem Bereich macht Kohorte 4 mit 19,9% aus, wenn man diesen Wert jedoch auf alle weiteren anderen Symptomatiken bezieht, kann man wirklich nicht von einem geringen Anteil sprechen (p‹0,01). 40 Beim betrachten des Mittelwertes für alle 4 Kohorten wird dieses Ergebnis verdeutlicht. Im Mittel weisen 30,1% aller neuangemeldeten Patienten nach Therapeutenangaben eine Kontaktschwierigkeit auf. Diese Symptomatik ist in der gesamten Untersuchung überrepräsentiert. Für die Partnerproblematik zeigt sich ein ähnliches Bild bezogen auf die Kohorte 2. Von 223 Neuanmeldungen in 1981 werden 93 Patienten eine Partnerproblematik diagnostiziert. Somit liegt der prozentuale Anteil bei 41,7%. Dieser hohe prozentuale Anteil kann in den folgenden Kohorten nicht erreicht werden. In Kohorte 3 sind es 26% und in Kohorte 4 17,9%. Es ergibt sich ein signifikanter Unterschied mit p‹0,001. Im Mittel werden über die 4 Kohorten 22,7% Patienten mit einer Partnerproblematik diagnostiziert. Für den Sozialbereich ergibt sich eine herausragende Stellung der Kohorte 2, die bei Kontaktschwierigkeiten und Partnerproblematik jeweils dominiert. Abb. 15 Therapeuteneinschätzung zur Symptomatik im sozialen Bereich innerhalb der vier Kohorten 45 40 Anzahl in Prozent 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 Kohorten Kontaktschwierigkeiten Partnerproblematik 41 4.9.4 Psychische Symptome Im Bereich psychische Symptome wurden, wie bereits eingangs erwähnt, 5 Symptomenkomplexe untersucht. Das Symptom Angst, frei flottierend wird besonders häufig von den Therapeuten in Kohorte 2 angekreuzt. Für Kohorte 2 ergibt sich ein Ergebnis von 21,1% und somit der erste Rang im Bereich dieser Symptomatik. Es folgen Kohorte 3 mit 11,9%, Kohorte 1 mit 9,6% und Kohorte 4 mit 9%. Im Mittel ergibt sich eine prozentuale Anzahl von 13,5% für die frei flottierende Angst (p‹0,001). Im Bereich Angst, objektiv und situationsgebunden ist die Kohorte 3 mit 23,2% die größte Gruppe. Es folgen Kohorte 4 mit 19,9%, Kohorte 2 mit 13,5% und Kohorte 1 mit 9,1%. Im Mittel ergibt sich eine prozentuale Anzahl von 16% für die objektive und situationsgebundene Angst (p‹0,01). Die Untersuchung zeigt, bezogen auf das Symptom Depressive Verstimmung, eine kontinuierliche Erhöhung im Verlauf der letztem 30 Jahre. Ausgehend von 24,1% in 1971 steigt der prozentuale Anteil auf 33,2% in 1981. In Kohorte 2 hat sich das Symptom depressive Verstimmung von dem Ausgangswert fast verdoppelt. Von Kohorte 2 auf Kohorte 3 ist ein Anstieg um 19,3% auf 52,5% erkennbar. Das Maximum dieser Untersuchung zeigt sich in Kohorte 4 mit 53,8%. Über die Hälfte der neu angemeldeten Studierenden der Beratungsstelle in Kohorte 3 und 4 werden nach dem Erstgespräch von den Therapeuten mit der Symptomatik einer depressiven Verstimmung diagnostiziert. Im Mittel über die 4 Kohorten gesehen entspricht der Wert 42,3%. Somit hat diese Symptomatik neben den Kontaktschwierigkeiten eine Sonderstellung innerhalb der ganzen Untersuchung der Symptomatiken von Studierenden, die die Beratungsstelle aufsuchten (p‹0,001). Für den Symptomenkreis „Störung des Selbstwertgefühles“ zeigt sich ebenfalls wie bei der Depressivität eine ansteigende Tendenz im Verlauf von 30 Jahren. 1971 liegt der Wert bei 25,1%, 10 Jahre später ist er um 14,8% auf 39,9% gestiegen. In Kohorte 3 ist der maximal Wert für diese Untersuchung von 46,3% erreicht. Die Kohorte 4 liegt mit 44,9% knapp darunter. Wie auch schon für das Symptom depressive Verstimmung zeigt sich bei Störungen des Selbstwertgefühles eine deutliche Mehrheit in Kohorte 3 und 4. Über die 4 Kohorten gesehen entspricht der Wert 38,8%. Somit hat diese Symptomatik, neben Kontaktschwierigkeiten und depressiver Verstimmung, eine Sonderstellung innerhalb der ganzen Untersuchung der Symptomatiken von Studierenden (p‹0,01). Die letzte Untersuchung zu psychischen Symptomen bezieht sich auf Suizidideen. Hier zeigt sich ein erneutes Mal eine Mehrheit für Kohorte 3 in diesem Symptomenkreis. Mit 14,1% nimmt die Kohorte 3 den ersten Rang ein, gefolgt von Kohorte 2 mit 8,1% und Kohorte 4 mit 4,5%. Für Kohorte 1 liegen keine Daten vor. Im Mittel liegt der Wert bei 8,9% (p‹0,01). 42 Abb. 16 Therapeuteneinschätzung zur psychischen Symptomatik innerhalb der vier Kohorten 55 50 45 40 Anzahl in Prozent 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 Kohorten Allgemeine Angst Depressive Verstimmung Suizidideen Situative Angst Störungen d. Selbstwertgefühls 43 Tabelle 12 Symptomzuschreibung von Therapeuten nach Erstgespräch (Mehrfachnennung möglich, Angaben in Prozent) Symptom 1 2 3 4 Gesamt Chi 2 Df p-wert Essstörungen 3,2 4,5 n. e. 9,6 5,5 7,44 2 ‹0,05 Sexualstörungen 19,8 6,7 n. e. 1,3 9,5 37,12 2 ‹0,001 Schlafstörungen 11,2 8,1 14,1 18,6 12,5 9,98 3 ‹0,05 Leistungsabfall 23,0 24,2 31,1 14,7 23,6 12,37 3 ‹0,01 Plan und Ziellosigkeit des Arbeitsverhaltens Überforderung 14,4 15,2 22,0 16,0 16,8 4,66 3 n. s. 5,7 12,1 19,8 23,7 16,2 17,94 3 ‹0,001 Versagen vor Examen 1,1 10,3 13,0 12,8 10,4 10,23 3 ‹0,05 Versagen im Examen 1,1 1,3 n. e. 0,6 1,1 0,44 2 n. s. Kontaktschwierigkeiten 27,6 37,7 27,1 19,9 29,1 14,81 3 ‹0,01 Partnerprobleme n. e. 41,7 26,0 17,9 22,7 64,49 3 ‹0,001 Allgemeine Angst 9,6 21,1 11,9 9,0 13,5 16,55 3 ‹0,001 Situative Angst 9,1 13,9 23,2 19,9 16,0 20,1 6 ‹0,01 Depressive Verstimmung 24,1 33,2 52,5 53,8 42,3 35,48 3 ‹0,001 Selbstwert 25,1 39,9 46,3 44,9 38,8 21,48 3 ‹0,01 Suizidideen n. e. 8,1 14,1 4,9 8,9 9,8 2 ‹0,01 n. e.= nicht erhoben n. s.= nicht signifikant 4.9.5 Die häufigsten psychischen Probleme /Mittelwert der 4 Kohorten 1.Depressive Verstimmung: 42,3% 2.Störung des Selbstwertgefühles: 38,8% 3.Kontaktschwierigkeiten: 29,1% 4.Leistungsabfall allg. Lernstörung: 23,6% 5.Partnerschaftsprobleme: 22,7% 6.Plan und Ziellosigkeit des Arbeitsverhaltens: 16,8% 7.Situative Angst (Examensangst): 16% (Gesamtergebnis über die 4 Kohorten, Mehrfachnennung möglich) 44 Nach Kohorten und Häufigkeiten aufgeteilt: Kohorte 1: 1. Kontaktschwierigkeiten: 27,6% 2. Störungen des Selbstwertgefühles: 25,1% 3. Depressive Verstimmung: 24,1% 4. Leistungsabfall, allgemeine Lernstörung: 23% 5. Sexualstörungen: 19,8% 6. Plan- und Ziellosigkeit des Arbeitsverhaltens: 14,4% Partnerschaftsprobleme hier nicht erhoben! Kohorte 2: 1. Partnerschaftsprobleme: 41,7% 2. Störungen des Selbstwertgefühles: 39,9% 3. Kontaktschwierigkeiten: 37,7% 4. Depressive Verstimmung: 33,2% 5. Leistungsabfall, allgemeine Lernstörung: 24,2% 6. Allgemeine Angst (frei flottierend): 21,1% 7. Plan und Ziellosigkeit des Arbeitsverhaltens: 15,2% Kohorte 3: 1. Depressive Verstimmung: 52,5% 2. Störungen des Selbstwertgefühles: 46,3% 3. Leistungsabfall, allgemeine Lernstörung: 31,1% 4. Kontaktschwierigkeiten: 27,1% 5. Partnerschaftsprobleme: 26% 6. Situative Angst (Examensangst): 23,2% 7. Plan und Ziellosigkeit des Arbeitsverhaltens: 22% Kohorte 4: 1. Depressive Verstimmung 53,8% 2. Störungen des Selbstwertgefühles 44,4% 3. Kontaktschwierigkeiten 19,9% 3. Situative Angst 19,9% 4. Schlafstörungen 18,6% 5. Partnerschaftsprobleme 17,9% 6. Plan und Ziellosigkeit des Arbeitsverhaltens 16% 45 4.10 Tabellarische Zusammenfassung der Ergebnisse aufgeteilt nach Kohorten: Kohorte 1 (SS 1971 und WS 1971/72; n=182 ): Am „jüngsten“ 23,3 Jahre Am wenigsten Hochschulsemester (6 HS) Am wenigsten Langzeitstudierende (7,7%) GT 1 geringste soziale Anerkennung (22,3) GT4 Depressivität (1.32,1) Therapeuten: günstigste Prognose bezüglich Studienerfolg (2,8), schlechteste Prognose in Bezug auf geäußerte Symptomatik (4) Kohorte 2 (SS 1981 und WS 1981/82; n=239): Alter: 25,1 Jahre Hochschulsemester: 8,4 Langzeitstudierende: 13,6% Am meisten Neuanmeldungen Soziale Schicht des Vaters: viele Arbeiter, unselbstständige Handwerker, Landwirte Stichwort: „BILDUNGSBOOM“ höchste wöchentliche Arbeitszeit (31,8 Stunden) sieht sich (SELBSTBILD) problematischer: FBS 1. mit 29,5 GT4 Depressivität 2. mit 32 GT5 Retentivität 1. mit 25,7 GT6 Soziale Impotenz 1. mit 22,4 Therapeuten: Sozialbereich: Kontaktschwierigkeiten und Partnerproblematik jeweils am höchsten (37,7% und 41,7%), psychische Symptome: allgemeine Angst am größten ausgeprägt (21,1%) 46 Kohorte 3 (SS 1990 und WS 1990/91; n= 177): Alter: 25,4 Jahre Hochschulsemester: 8,6 Größter Langzeitstudierendenanteil (20,3%) Am wenigsten Neuanmeldungen (n=177) Geringste wöchentliche Arbeitszeit (27,7 Stunden) GT 2: Dominanz am „größten“ ausgeprägt (23,1) GT 3: Unterkontrolle am „größten“ ausgeprägt (21,8) Therapeuten: Prognose: „Am meisten“ Suizidgefährdung 2,8 (in GT4 aber „am wenigsten“ Depressivität: 27,5), ungünstige Prognose bezüglich des Studienerfolges (3,4) Symptome: Leistungsbereich: ausgeprägte Plan- und Ziellosigkeit des Arbeitsverhaltens (22%), Leistungsabfall-allgemeine Lernstörung (31,1%) Psychische Symptome: Depressive Verstimmung (52,5%), Störung des Selbstwertgefühles (46,3%), Angst objektiv und situationsgebunden (23,2%), Suizidideen (14,1%) Kohorte 4 (SS 2000 und WS 2000/01; n= 210): Am „ältesten“ (25,9 Jahre) „Meisten“ Hochschulsemester (9,6HS) Langzeitstudierendenanteil: 20,2% Frauenanteil: 59,7% GT 1:Höchste soziale Anerkennung 23,8 GT 2: Dominanz 23,2 GT 3: Unterkontrolle 21,7 GT 6: soziale Potenz 20,8 FBS am „geringsten“ 26,3 Therapeuten: „Maximum“ an depressiver Verstimmung (53,8%) und Störung des Selbstwertgefühles (44,9%), Körpersphäre: Schlaf- und Essstörungen (18,6% und 9,6%), Leistungsbereich: Überforderung (23,7%), aber dafür im Verhältnis wenig Lernstörungen (14,7%) 47 5 Diskussion 5.1 Vorbemerkungen Die dargestellten Ergebnisse sollen im Folgenden mit themenspezifischer Literatur verglichen und diskutiert werden. Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, die soziodemographische und studienspezifische Charakteristik, sowie die Symptomatik der Klienten der 4 Kohorten (Kohorte 1: SS 1971 und WS 1971/72 n=182 ; Kohorte 2: SS 1981 und WS 1981/82 n=239; Kohorte 3: SS 1990 und WS 1990/91 n= 177; Kohorte 4: SS 2000 und WS 2000/01 n= 210) näher zu untersuchen. Diese Untersuchung ist eine der ersten im deutschsprachigen Raum, welche eine größere Stichprobe studentischer Klientel der jeweiligen Jahrgangskohorte einer Beratungsstelle im Abstand von jeweils 10 Jahren über vier Jahrgangskohorten im Vergleich betrachtet. 5.2 Diskussion der Methodik Es wurden alle Studierenden in diese Untersuchung integriert, die sich zu den verschiedenen Kohortenzeitpunkten in der Ärztlich-Psychologischen Beratungsstelle für Studierende der GeorgAugust-Universität Göttingen neu anmeldeten. Unser Datenmaterial erlaubt Rückschlüsse auf die Anzahl der insgesamt betroffenen Studierenden mit psychischen Beeinträchtigungen. Die Untersuchung ermöglicht eine differenzierte Betrachtung der soziodemographischen und studienspezifischen Charakteristik der Studierenden als Klientel der Beratungsstelle innerhalb der 4 Jahrgangskohorten. Die Referenzdaten der Universität wurden integriert, um die Klientel mit den Gesamtstudierenden der Universität Göttingen vergleichen zu können. Die Generalisierbarkeit der Prävalenzangaben durch Therapeuteneinschätzungen ist zu hinterfragen. Gerade im Bereich des Symptomfragebogens, der durch die Therapeuten nach dem Erstgespräch ausgefüllt wurde, wäre es interessant gewesen, die Symptome noch weiter mit anderen Instrumenten zu validieren. Das Symptom Depressive Verstimmung hätte so z. B. durch gezielten Einsatz eines spezifischen Fragebogens zur Depression noch besser eingeordnet werden können. Dies wurde teilweise mit den entsprechenden Skalen des Gießen-Test ermöglicht. Ein methodisches Problem kann sich durch veränderte Diagnosekriterien und Therapeutenwechsel innerhalb eines Zeitraumes von 30 Jahren ergeben. Haben Therapeuten 1970 dieselben Bewertungskriterien wie 1990 und/oder besondere Vorlieben (Stichwort: Zeitgeist) gehabt? 48 5.3 Die Unterschiede der soziodemographischen und studienspezifischen Charakteristik der Studierenden Es gibt signifikante Unterschiede in der soziodemographischen und studienspezifischen Charakteristik der Studierenden als Klientel der Beratungsstelle, im Alter der Studierenden, der Anzahl an Hochschulsemestern und der Anzahl der Langzeitstudierenden. Es zeigt sich ein kontinuierlicher Anstieg der genannten Variablen von Kohorte 1 auf Kohorte 4. Die signifikant jüngeren Studierenden in Kohorte 1 hatten wahrscheinlich eher Probleme mit der Studieneingangsphase und haben daraufhin zu einem frühen Zeitpunkt eine Beratung in Anspruch genommen. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass es in diesem Jahrgang noch keine speziellen „Eingangsangebote“ von der Universität, wie z. B. Orientierungsphasen anlässlich der Erstsemesterwoche und Tutorien gab. Somit könnte das ansteigende Durchschnittsalter im Verlauf der Untersuchung auch ein Hinweis darauf sein, dass es mittlerweile ein besseres Angebot für Studienanfänger gibt. Maßnahmen wie die Erstsemesterwoche und studentische Tutorien können die schwierige Eingangsphase erleichtern, indem sie eine Plattform für informelle Kontakte bieten und darüber hinaus persönliche Kontakte unter Studierenden fördern. Möglicherweise nehmen studienbezogene Probleme demnach erst in höheren Semestern an Bedeutung zu. Die Studierenden der Psychotherapeutischen Beratungsstelle Heidelberg sind überraschenderweise im Durchschnitt jünger als die Gesamtpopulation aller Studierenden der Universität Heidelberg (HolmHadulla und Soeder 1997). Wie bereits im Hinblick auf Kohorte 1 erwähnt lässt sich auch hier auf eine größere Zahl von Studierenden schließen, die gerade zu Studienbeginn die Beratungsstelle aufsuchen um Anpassungsprobleme und die Schwellensituation von Schule zur Universität besser bewältigen zu können. In einer Studie von der Kansas State University „Changes in Counseling Center Client Problems Across 13 Years“ (Benton et al. 2003) waren 3 von 4 Studierenden, die die Beratungsstelle aufsuchten, jünger als 25 Jahre. Ob diese Ergebnisse bezüglich des Alters vergleichbar mit einer deutschen Universität sind, ist fraglich, da in den USA Beratungsstellen viel früher eingerichtet wurden und deutlich verbreiteter sind. Folglich kann von einer größeren Akzeptanz und niedrigeren Hemmschwelle unter Studierenden ausgegangen werden (Sperling und Jahnke 1974). Fast jeder Studierende nutzt im Verlauf seines Studiums und gerade in der Eingangsphase diesen Beratungsservice. Hinzu kommt, dass Studierende in den USA generell bei Studienbeginn deutlich jünger sind als in Deutschland. Sie sind also in höheren Semestern jünger im Vergleich zu deutschen Studierenden. Dies wäre eine Erklärung für das geringere Durchschnittsalter im Vergleich zu deutschen Universitäten. Bei den Studierenden, die die Beratungsstelle in Kohorte 2, 3 und 4 aufsuchten, scheinen Probleme mit der Studieneingangsphase eher eine untergeordnete Rolle zu spielen. Die Klientel ist älter mit 49 einer höheren Anzahl an Hochschulsemestern (speziell Kohorte 4) und Anteil Langzeitstudierender (speziell Kohorte 3 und 4), welches möglicherweise auf eine Studienendphasenproblematik hinweist. Dies lässt vermuten, dass mit Zunahme der Semesteranzahl, wie auch mit Zunahme des Alters, eine größere Anzahl an Problemen und höherer Leidensdruck entsteht und daher eine Beratungsstelle aufgesucht wird (Hahne et al. 1999). Die Studienendphase kann somit genauso wie die Studieneingangsphase eine Zeit der Krise sein. Die Abschlussprüfung rückt näher, die berufliche Lebensentscheidung ist gefällt und das Arbeits- und Berufsleben mit einer Form von Endgültigkeit tritt in das Bewusstsein. Die Untersuchung von Hahne et al. (1999) zeigt einen Problemanstieg ebenso wie eine Verschiebung zu stärkerer Problembelastung, besonders ab dem 11. Semester. Leistungsprobleme, mangelndes Selbstwertgefühl, Depressive Verstimmung, Labilität und Prüfungsangst zeigen dann einen sprunghaften Anstieg. Die Zahl der Langzeitstudierenden nimmt im Verlauf unserer Untersuchung signifikant zu. In Kohorte 1 sind es 7,7% und in Kohorte 4 20,2%. Die Vergleichswerte mit der Universität zeigen ein noch höheres prozentuales Ergebnis. Die Kohorten 2, 3 und 4 inkludieren jeweils einen Anteil von über 20% an Langzeitstudierenden der Universität Göttingen. Mit 21,6% in Kohorte 2 übertrifft die Universität prozentual den Gesamtanteil der Beratungsstelle (13,7%). Dies lässt darauf schließen, dass in Kohorte 2 möglicherweise wenige Langzeitstudierende eine Beratung in Anspruch nehmen. Die Ursachen für die stetige Zunahme an Langzeitstudierenden in unserer Stichproben sind mehrschichtig. Individuelle Gründe auf Seiten der einzelnen Studierenden wie z.B. negative life events, zunehmender Druck und Überforderung im Studium, sowie Prüfungsängste können zu einer Verlängerung des Studiums führen. Dass Studierende zunehmend mit ihrem Studium überfordert sind, zeigt die Therapeuteneinschätzung in unserer Untersuchung. Innerhalb von Kohorte 3 und 4 ist das Symptom Überforderung auf 19,8% bzw. 23,7% signifikant angestiegen (p‹0,001). Somit kann das Symptom Überforderung im Zusammenhang mit dem Anstieg an Langzeitstudierenden gesehen werden. Natürlich kann sich die Studienzeit auch durch „äußere Umstände“, wie z.B. notwendige Nebenerwerbstätigkeit aufgrund finanzieller Engpässe, Schwangerschaft und Erziehung von Kindern verlängern. In einigen Fällen werden Freisemester benötigt, um Geld für das Studium und die Studiengebühren zu erwirtschaften. Die eigentliche Studienzeit verschiebt sich in solchen Fällen „nach hinten“. Wie ein sozial verträgliches und effizientes Studium auch für Erwerbstätige ermöglicht werden kann, sollte seitens der Universitätspolitik diskutiert und entsprechende Modelle etabliert werden (Jamrozinski et al. 2009). Diejenigen Langzeitstudierenden, die eine Beratung in Anspruch nehmen, möchten mit hoher Wahrscheinlichkeit an ihrer Situation etwas ändern. Dies kann, zum einen Unterstützung für bevorstehende Abschlussprüfungen sein, mit dem Ziel, das Studium endgültig zu beenden. Auf der anderen Seite ist es ebenso denkbar, dass der Langzeitstudierende gar nicht weiß, ob der Abschluss 50 sein wirkliches Ziel ist, und Unterstützung für die Entscheidung zum endgültigen Studienabbruch oder Studiengangswechsel sucht. Dieser Prozess der Entscheidung, der zu einer Veränderung im Lebenslauf führt, ist sicherlich mit vielen Verunsicherungen und einem niedrigen Selbstwertgefühl gekoppelt. Die Aussage von Kuda (Bühring 2004), „Langzeitstudierende sind genauso wie Ihre Probleme nicht homogen“, unterstreicht die Heterogenität dieser Gruppe von Studierenden. Dennoch zeigen sich Tendenzen bzw. wiederkehrende Charakteristika bei Langzeitstudierenden. Die Ergebnisse von Jamrozinski et al. (2009) zeigen, dass Langzeitstudierende häufiger männlich sind und Studierende mit mangelnder Berufsperspektive oder Fachidentifikation und/oder fehlenden Lebenszielen zu dieser Gruppe gehören. Holm-Hadulla (2001) beschreibt, dass verschiedene Variablen den Wunsch nach fachlicher psychotherapeutischer Hilfe beeinflussen, neben dem angesprochenem Leidensdruck und der Zunahme der Probleme mit steigendem Alter dürfen das Geschlecht und die Fakultätszugehörigkeit nicht unterschätzt werden. 5.3.1 Geschlechtsspezifische Aspekte Die Klientel der psychotherapeutischen Beratungsstelle Göttingen setzt sich, ähnlich wie an anderen Beratungsstellen (Holm-Hadulla 1994; Holm-Hadulla und Soeder 1997; Benton et al. 2003; KniggeIllner 2002), mehrheitlich aus Frauen zusammen. Es ist anzunehmen, dass weibliche Studierende entweder mehr Schwierigkeiten im Studienalltag entwickeln, und/oder eher bereit sind, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Frauen verfügen über eine hoch signifikant positivere Einstellung gegenüber psychotherapeutischen Angeboten (Fabian 1999). Sie scheinen gegenüber männlichen Studierenden eine geringere Hemmschwelle für entsprechende Angebote zu haben. Möglicherweise verfügen Sie über eine höhere Introspektionsfähigkeit und es ist ihnen eher möglich, sich als psychisch leidend und hilfsbedürftig anzunehmen (Fabian 1999). Frauen nehmen aus diesen Gründen ein Beratungsangebot eher an, bei ihnen bleibt es nicht nur beim Beratungswunsch, sondern sie realisieren ihn auch häufiger (HolmHadulla 1994). Ein Grund zur Entwicklung von möglicherweise größeren psychischen Schwierigkeiten bei Frauen kann in dem noch immer bestehenden geschlechtsspezifischen Handicaps der Hochschule gesehen werden. Die männlichen Werte und Hegemonien prägen laut Hornung (1999) noch immer in großen Teilen die Bildungsinstitution. Zwar ist der Anteil an weiblichen Studierenden der Universität Göttingen stetig gestiegen und beträgt in Kohorte 4 47,3%, aber nur 11,2% der Professuren an der Georg-August-Universität Göttingen sind im Jahr 2001 mit Professorinnen besetzt (Stabsstelle Controlling, Georg-August-Universität Göttingen 2010). Studentinnen sind im stärkerem Maß „Rollenkonflikten“ und Belastungen ausgesetzt als ihre männlichen Kommilitonen. Sie sollen einerseits erfolgreich an der Hochschule studieren und zukünftige Wissenschaftlerinnen sein, anderseits aber auch ihre „traditionelle Rolle“ in der 51 Gesellschaft als „umsichtige Partnerin“ bzw. „sorgende Mutter“ einnehmen (Schuergers und Kuda 1988). Als präventive Maßnahme zur Verbesserung der psychophysischen Gesundheit von Studentinnen kann im weitgefassten Sinne eine Erhöhung des Frauenanteils an den Dozentenstellen angesehen werden. Spezielle Mentoringprogramme können Frauenkarrieren fördern, indem Sie Kontakte zu berufsspezifischen Netzwerken herstellen und karrierehemmende Geschlechtssterotypen überwinden (Buddeberg–Fischer et al. 2009). Die Ermöglichung von Teilzeitstellen auf der Ebene der Professorinnen könnte die Restrukturierung, angepasst an frauentypische Biographien, einleiten, sowie neue weibliche Vorbilder hervorbringen (Hornung und Knoch 1999). Ein weiterer präventiver Ansatz wäre auch die Ermöglichung eines Teilzeitstudiums, wovon speziell Studierende mit Kindern profitieren würden. 5.3.2 Fakultätsspezifische Unterschiede Bezüglich der Fakultätszugehörigkeit zeigt sich in unserer Untersuchung in 3 von 4 Kohorten eine Mehrzahl an Studierenden der Philosophischen Fakultät, die eine Beratung in Anspruch nehmen (31,4% in Kohorte 1, 24,8% in Kohorte 2 und 26,6% in Kohorte 3). Hier kann sicherlich auch eine höhere Sensibilität gegenüber psychologischen Problemen vorausgesetzt werden und eine aufgeschlossene Haltung sowie eventuelle Vertrautheit mit psychosozialen Störungstheorien angenommen werden. Diese Hypothesen könnten eine Erklärung für unsere Ergebnisse sein und fördern durch eine entsprechende niedrigere Hemmschwelle die Beratungsaufnahme. Holm-Hadulla und Soeder (1997) führen die Überrepräsentierung von Psychologiestudierenden in ihrer Untersuchung auch auf das Interesse an Selbsterfahrung zurück, welches bei diesen sicherlich ausgeprägter ist, als bei Studierenden anderer Fachrichtungen. In unserer Untersuchung und in der Heidelberger Beratungsstelle findet sich nicht die in früheren Untersuchungen (Moeller und Naturwissenschaftsstudierenden. Scheer In 1974) Kohorte 1 oft sind erwähnte Unterrepräsentierung Studierende der Mathematik von und Naturwissenschaften mit einem Anteil von 16,6% innerhalb der Beratungsstelle vertreten. In Kohorte 4 bilden Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft mit 22,2% die größte Gruppe. Die Tendenzen haben sich mit den Jahrzehnten verändert. Die traditionell eher beratungs- und psychotherapieskeptischen Gruppen, wie Juristen, Wirtschaftswissenschaftler etc. zeigen nun einen deutlich erhöhten Zulauf zur Beratung und Therapie im Gegensatz zu Studierenden der Geisteswissenschaften (Holm-Hadulla 2001). Hier dürfen aber die Zahlen der Gesamtuniversität nicht vergessen werden, die in diesem Punkt identisch mit den Entwicklungen der Fakultätszugehörigkeit innerhalb der Beratungsstelle erscheinen. 52 Innerhalb des Zeitraumes unserer Kohortenuntersuchung ist ebenso die Gesamtanzahl der Studierenden der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät angestiegen (19,1% in Kohorte 1 auf 25,4% in Kohorte 4). Die Gesamtanzahl an Studierenden der Philosophischen Fakultät hat von 25,2% in Kohorte 1 auf 17,1% in Kohorte 4 abgenommen. Angesichts unserer Ergebnisse kann eine veränderte Wahrnehmung gerade bei Studierenden im Wirtschafts- und Sozialwissenschaftsbereich bezüglich Beratung und Unterstützung während des Studiums vermutet werden. „Coaching“ ist ein neues Konzept und wird möglicherweise nicht mehr als Schwäche sondern als Ressource wahrgenommen. In der Öffentlichkeit stehende Führungskräfte und Manager suchen zunehmend Unterstützung bei Psychologen, um ihre Ziele effektiver und schneller zu erreichen und dienen vermutlich als Vorbilder für Studierende der entsprechenden Studiengänge. Eine Studie in Zürich (Fabian 1999) zeigt hinsichtlich der Inanspruchnahme von Beratungsangeboten unter Wirtschaftswissenschaftsstudierenden genau das Gegenteil. Hier wurden Studierende nach erlebten Krisen im Studium befragt, 52,7% der Mediziner und 65,3% der Wirtschaftwissenschaftler geben eine erlebte Studien- und/oder Lebenskrise an, aber nur 4,6% der Mediziner und 1% der Wirtschaftswissenschaftler nutzen das Angebot zur Therapeutischen Beratung. (Nicht-therapeutische Beratung 4,6% Mediziner, 12,1% Wirtschaftswissenschaft). Die zwei Gruppen nehmen demnach am wenigsten Beratung in Anspruch, obwohl Sie am häufigsten Krisen erleben (Fabian 1999). Medizinstudierende sind in unserer Stichprobe, mit Ausnahme von Kohorte 1, relativ konstant mit 10% bis 14% in der Ärztlich-Psychologischen Beratungsstelle vertreten. Der Ausprägungsgrad der psychischen Belastung bzw. das Erleben einer Krise scheint nicht allein ausschlaggebend für den Wunsch nach Beratung zu sein. Personale und soziale Ressourcen der Studierenden spielen eine bedeutsame Rolle bezüglich des Erlebens von Krisen und der Inanspruchnahme von Beratungsangeboten (Fabian 1999). In Bezug auf die Fakultätszugehörigkeit soll auch auf den Einfluss der Struktur des Studienganges hingewiesen werden. Sehr strukturierte Studiengänge, die verbunden sind mit einem hohen Zeitaufwand und einem hohen Grad an Verschulung, können als Belastung wahrgenommen werden. Ebenso können Studiengänge mit einem niedrigen Grad der Strukturierung und sehr vielen Freiräumen zu Desorientierung und Selbstfindungsproblemen führen und dementsprechend auch als Belastung wahrgenommen werden (Hornung und Knoch 1999). Hornung und Knoch (1999, S.191) formulieren dieses Spannungsfeld zwischen Struktur und Freiraum als Fragen, „wann und wie ist Struktur hilfreich und gibt Orientierung und wann wirkt sie belastend und verhindert Eigeninitiative?“ und „wann ermöglicht ein geringer Strukturierungsgrad hohe individuelle Flexibilität und Freiräume und wann löst er Desorientierung und Unsicherheit aus?“ Die „Passung“ des Studienganges zur jeweiligen Persönlichkeit kann im Umkehrschluss als Ressource betrachtet werden. 53 Die personalen Ressourcen, wie z.B. Selbstwert und Selbstwirksamkeit dürfen ebenso nicht ausgeklammert werden. Es wäre möglich, dass besonders sensible Personen häufig Fächer im geisteswissenschaftlichen Bereich wählen und eine Disposition zu psychischen Beeinträchtigungen und Krisen schon vor Studienbeginn besteht (Kuda 1984). Holm-Hadulla (2001) stellte die These auf, dass von allen Faktoren das Geschlecht und die Fakultätszugehörigkeit den Wunsch nach fachlicher psychotherapeutischer Hilfe am deutlichsten beeinflussen. 5.3.3 Unterschiede in der sozialen Herkunft der Studierenden Dass die soziale Herkunft Einfluss auf die Aufnahme eines Hochschulstudiums nimmt, ist bekannt (Isserstedt et al. 2007). Jedoch ist das Ausmaß beeinflussbar durch Bildungspolitik und unterliegt somit eventuellen zeitlichen Schwankungen. Dieses Phänomen wird veranschaulicht durch die Kohorte 2. In unserer Untersuchung suchen in Kohorte 2 im Verhältnis überdurchschnittlich viele Studierende in der Beratungsstelle Rat, deren Väter Landwirte oder Arbeiter sind. Es bleibt jedoch fraglich, ob daraus geschlossen werden kann, dass Studierende aus einfachen Verhältnissen eher Probleme im Studienalltag haben. Vielmehr scheint der Zugang zur Universität auch für sozial Schwächere damals offener gewesen zu sein. Auf Universitätsebene und sogar auf Bundesebene nahm die Zahl der Studierenden aus einfachen sozialen Verhältnissen in der Zeit von 1973 bis 1982 zu (Henkel et al. 1990). Der Unterschied im Bereich der sozialen Herkunft zeigt sich in Kohorte 2 sowohl für die Klientel der Beratungsstelle, als auch in den Daten der Universität Göttingen. In diesem Zusammenhang kann auch von „Bildungsboom“ gesprochen werden. Der Trend ist seit 1982 wieder gegenläufig, sowohl im Bundesdurchschnitt als auch in Göttingen. Der Anteil der Studierenden aus einkommensschwachen Familien ist von 23% (Bund 1982) bzw. 18,6% (Göttingen 1982) auf 13% (Bund 2006) bzw. 9,8% (Göttingen 2006) gesunken, während die Quote der Studierenden aus einkommensstarken Familien von 17% (Bund 1982) bzw. 20,8% (Göttingen 1982) auf 38% (Bund 2006) bzw. 44,1% (Göttingen 2006) angewachsen ist (Studentenwerk Göttingen 2008). Am Beispiel von Göttingen kann von einer relativ „elitären“ Studentenschaft gesprochen werden. Die prozentuale Verteilung führt zu jeweils größeren Anteilen aus den höheren Schichten, welche jeweils deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegen. Ebenso liegen die Anteile aus den niedrigeren Schichten jeweils deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Der Anteil Studierender aus der Herkunftsgruppe „hoch“ steigt kontinuierlich, während sich der Prozentsatz Studierender vor allem aus den „unteren“ beiden Herkunftsgruppen reduziert (Henkel et al. 1990). Diese Ergebnisse aus der Befragung Göttinger Studierender 1988 im Auftrag des Studentenwerkes spiegeln sich auch in der prozentualen Verteilung der Klientel der Beratungsstelle wieder. Eine Tendenz der Zunahme auf Seiten der leitenden Angestellten (18,1% in Kohorte 3) und mittleren Beamten (14,1% in Kohorte 3) ist 54 feststellbar. Somit sind der Bildungsstatus der Eltern und die berufliche Stellung für den Zugang der Kinder zu den Hochschulen noch immer die entscheidenden Faktoren (Isserstedt et al. 2007). Mit einer hohen sozialen Herkunft steigen die Chancen für die Aufnahme eines Hochschulstudiums überproportional an. Werden Kinder der Herkunftsgruppe „niedrig“ mit solchen aus „gehobenen“ Schichten verglichen, so haben Letztere sechsmal so hohe Chancen auf ein Hochschulstudium wie Erstere (Isserstedt et al. 2004). Gleichzeitig zeigen unsere Ergebnisse aber auch, dass Klienten aus Akademikerelternhäusern in der Beratungsstelle mehrheitlich vertreten sind. Vermutlich stellt eine einkommensstarke Familie keine Garantie für ein krisenfreies, sorgloses Studium dar. Hohe Erwartungen, Leistungsansprüche der Eltern an die nächste Generation setzten die Studierenden möglicherweise oftmals unter Druck (Miller 1979). 5.4 Die Unterschiede in der Prävalenz von psychischen Symptomen aus Sicht der Klienten und Therapeuten In der Selbsteinschätzung der Patienten gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Kohorten. Die prägnantesten Ergebnisse sind eine geringe soziale Resonanz/Anerkennung und hoch signifikante Depressivität in Kohorte 1. Depressivität, Retentivität/Verschlossenheit und geringe soziale Kompetenz treten in Kohorte 2 auf. Die Kohorten 3 und 4 sehen sich eher unterkontrolliert und dominant. Nach Beckmann und Richter (1972) kreuzen Patienten mit psychogenen Störungen im Mittel eher in Richtung Dominanz an. Im Vergleich mit den Normwerten des Gießen-Test sind eine geringe soziale Anerkennung und depressive Grundstimmung in allen Kohorten erkennbar, welche in Kohorte 1 und 2 ausgeprägt ist. Demnach schätzen sich Patienten aus den ersten beiden Kohorten tendenziell „schlechter“ (vermehrt negative Eigenschaften) als Patienten aus Kohorte 3 und 4 ein. Worauf diese verhältnismäßig negative Selbsteinschätzung der Kohorten 1 und 2 zurückzuführen ist, ist schwer fassbar, und deshalb kommen die Klienten schließlich zur Beratung. Eine mögliche Begründung liegt darin, dass nicht allen Personen ihr psychisches Erleben gleichermaßen zugänglich ist (Hahne 1999). Neben dem Studienfach könnte der soziokulturelle Aspekt ebenfalls eine Rolle spielen. Studierende aus Kohorte 1 und 2 nahmen möglicherweise mit einer anderen Erwartungshaltung auch in Hinsicht auf Beziehungen und Kontakten ihr Hochschulstudium auf. Das Interesse an Selbstreflexion und Gruppenprozessen war unter Studierenden in den 70 er Jahren sehr ausgeprägt, so dass eine vermeintlich schlechte Selbsteinschätzung auch durch eine vermehrte Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit entstanden sein könnte. Eine überstarke Selbstkritik und ein strenges Über-Ich können aus innerem Konfliktdruck zu einer negativ verschobenen Selbsteinschätzung führen (Beckmann und Richter 1972). 55 Es war so gesehen ein anderes „psychosoziales Klima“, welches sich durch Selbstfindungsprozesse definierte (Knigge-Illner 2002). Gleichzeitig bedeutet dies für die Kohorten 3 und 4, dass eine Art Fokussierung auf Studienleistungen und Qualifizierungen verbunden mit weniger Selbstreflexion und einer „besseren“ Selbsteinschätzung von Persönlichkeitsmerkmalen, durch wenige Erfahrungen mit dieser Thematik, stattfand. Leider fehlt in der Literatur ein direkter Vergleich zwischen den Selbsteinschätzungen der Klienten einer Beratungsstelle zu einem Zeitpunkt verglichen mit anderen Klienten zu einem anderen Zeitpunkt, wie z.B. bei uns im Abstand von jeweils 10 Jahren. Die studentische Klientel wird hier meist mit unbehandelten Studierenden verglichen. Klienten der Psychotherapeutischen Beratungsstelle Heidelberg halten sich im Vergleich mit unbehandelten Studierenden der Heidelberger Feldstichprobe für weniger sozial resonant, fühlen sich depressiver verstimmt, sind in stärkerem Maße misstrauisch, verschlossen und sozial weniger kompetent als unbehandelte Studierende (Holm-Hadualla und Soeder 1997). Zusammenfassend geben sie somit ein negativeres Selbstbild als nichtbehandelte Studierende an, was als ein generelles Kennzeichen definierter Klientel interpretiert werden kann. Die Klientel der Ärztlich-Psychologischen Beratungsstelle Göttingen zeigt in der Selbsteinschätzung mittels Gießen-Test, trotz der oben beschriebenen kohortenspezifischen Unterschiede, insgesamt eine negative soziale Resonanz und ein tendenziell dominantes Verhalten. Sie sehen sich als unterkontrolliert, retentiv (verschlossen) und sozial weniger kompetent an und sind in der Grundstimmung depressiv. Unsere Ergebnisse sind somit weitgehend identisch mit denen von Holm-Hadulla und Soeder (1997). Soeder et al. (2001) führen die depressiven Selbsteinschätzungen in ihrer Untersuchung auf Schwierigkeiten mit der Identitätsfindung zurück. Um eine klinisch relevante psychische Problematik festzustellen, sollte die Expertenmeinung eingeschlossen werden. In unserer Untersuchung zeigten die Klientel in Kohorte 1 und 2 wie beschrieben eine deutlich negative Selbsteinschätzung bezüglich depressiver Grundstimmung und suizidal-depressiven Tendenzen (FBS). Die Therapeuteneinschätzung für das Symptom depressive Verstimmung sind bei 24,1% in Kohorte 1, zeigen aber für Kohorte 3 und 4 einen deutlich höheren Ausprägungsgrad 52,5% bzw. 53,8%, bei gleichzeitiger positiveren Selbsteinschätzung der Studierenden. In unserer Untersuchung zeigt sich somit eine Diskrepanz zwischen Selbsteinschätzung und Therapeuteneinschätzung (Kohorte 1 und 2 schlechtere Selbsteinschätzung, bessere Therapeuteneinschätzung; Kohorte 3 und 4 bessere Selbsteinschätzung, jedoch schlechtere Therapeuteneinschätzung). Die Therapeutenprognose bezüglich des Studienerfolges ist am günstigsten bei Kohorte 1. Wie Sperling und Jahnke (1974) es schon beschrieben, erwartet der Therapeut in Kohorte 1 eher, dass der Klient sein Studium erfolgreich abschließt, als dass er seine Störung in einer Beratung/Therapie verlieren kann. Diese Einschätzung war vermutlich damaliger „Zeitgeist“. 56 Die Einschätzung der Therapeuten weicht in unserer Untersuchung in wesentlichen Punkten von der Selbsteinschätzung der Patienten ab. Die Therapeuten schätzen den Ausprägungsgrad der Schwierigkeiten in den meisten Fällen deutlich geringer ein als die betroffenen Patienten selbst (Holm-Hadulla 1994). Therapeuten und Klienten haben zwar unterschiedliche Bewertungskriterien, aber trotzdem gilt: „subjektiv sich als behandlungsbedürftig einschätzende Studierende leiden auch nach Maßgabe standardisierter Indizes unter klinisch relevanten psychischen Beeinträchtigungen“ (Holm-Hadulla und Soeder 1997, S.424). 5.4.1 Prüfungsangst als Anlass zum Aufsuchen einer Beratungsstelle Die durch Klienten erlebte Prüfungsangst ist zu allen untersuchten Zeitpunkten gleich hoch. Prüfungsangst ist somit nach wie vor ein wichtiger Grund, um eine Beratungsstelle aufzusuchen. Prüfungen stellen ein Ritual, und ebenso einen Selektionsprozess innerhalb unserer Gesellschaft dar. Nach einer erfolgreichen Abschlussprüfung steht der Prüfling als Wissender dar, dies ist auch eine Form von Statuspassage. Prüfungen können somit den Rollenwechsel einleiten und eine neue Identitätsdefinition erforderlich machen. Die Prüfung selbst verlangt von dem Prüfling nicht nur ein fachliches Prüfungswissen, sondern ebenso ein gewisses Verhaltensrepertoire. Nach Prahl (1980), eruieren Prüfungen daher vor allem, wieweit ein gesellschaftlich definierter psychosozialer Reifungszustand erreicht, d. h. wie gut oder schlecht Sozialisation gelungen ist. Prüfungsangst steht häufig, weil die Prüfung eine spezifische soziale Situation ist, auch im Zusammenhang mit sozialer Phobie und Autoritätsängsten. Prüfungen sind ein fester Bestandteil jedes Studiums und können in einer stark leistungsorientierten Gesellschaft eine existentielle und schicksalsbestimmende Bedeutung für Studierende einnehmen. Die Angst „im alles entscheidenden Moment“ zu versagen ist im Erleben vieler Studierender allgegenwärtig (Schuergers und Kuda 1988). Sperling und Jahnke (1974) weisen auf den sozialen und familiendynamischen Hintergrund der Entstehung des Symptoms hin: „Ich kann mir keinen Studenten mit Prüfungsangst vorstellen, dessen Vater Prüfungen nicht für extrem wichtige Ereignisse im Leben hält“ (Sperling und Jahnke 1974, S.39). Die Ergebnisse von Holm-Hadulla et al. 2009 zeigen eine signifikante und klinisch relevante Zunahme von Prüfungsängsten in den letzten 15 Jahren. Im Jahr 2007/2008 geben 56% der Klienten der Psychotherapeutischen Beratungsstelle für Studierende der Universität Heidelberg an, unter ausgeprägter Prüfungsangst zu leiden. Die Autoren interpretieren ihre Ergebnisse im Hinblick auf einer Zunahme von dysfunktionalem Stress und dem „Beschneiden von Freiräumen zum Nachdenken sowie zur Pflege persönlicher Interessen“ (Holm-Hadulla et al. 2009, S.355). In unserer Untersuchung zeigte sich keine signifikante und klinisch relevante Zunahme von Prüfungsängsten. 57 Die Hypothese, dass Prüfungsangst mit der Anzahl der Prüfungen korreliert und z.B. in Fachrichtungen, die häufig zu regelmäßigen Zeitpunkten im Studium Prüfungen durchführen, schwächer ausgeprägt ist, konnte nicht belegt werden. So wird gerade von Medizin-, sowie Zahn- und Tiermedizinstudierenden deutlich häufiger Prüfungsangst angegeben (Hahne et al. 1999). In unseren Stichproben ist das Symptom Prüfungsangst unter allen Fakultäten häufig vertreten, die Korrelation zwischen Prüfungsangst und Fakultät zeigt keinen signifikanten Zusammenhang. Die Untersuchung von Schaefer et al. (2007) zur Prüfungsangst von Medizinern zeigt, dass hoch prüfungsängstliche Studierende häufiger an sozialen Ängsten und anderweitigen psychischen Störungen leiden. Die Studienleistungen waren dadurch deutlich beeinträchtigt. Prüfungsangst steht häufig im Zusammenhang mit sozialer Phobie und anderen Komorbiditäten. Selten findet sich bei der Klientel der Beratungsstelle nur eine spezielle Symptomatik. Nach Schaefer et al. (2007) könnten hoch prüfungsängstliche Studierende von einem niederschwelligen psychotherapeutischen Hilfsangebot, welches sich vor allem auf ihre sozialen Ängste fokussiert und von der Universität angeboten wird, profitieren. 5.4.2 Unterschiede in den Symptomatiken der Studierenden Die vier Jahrgangskohorten unterscheiden sich signifikant im Bezug auf die Häufigkeiten der psychischen Symptome „depressive Verstimmung“ und „vermindertes Selbstwertgefühl.“ Nach Therapeuteneinschätzungen nehmen die Symptomatiken im Verlauf unserer Untersuchung zu. Von Kohorte 1 auf Kohorte 4 hat sich die Symptomatik depressive Verstimmung von 24,1% auf 53,8% mehr als verdoppelt (p‹0,001). Diese beiden Symptomatiken haben, wie schon im Ergebnissteil beschrieben, somit eine herausragende Stellung innerhalb unserer gesamten Untersuchung und die primär studienspezifischen Probleme erscheinen im Durchschnitt über die 4 Kohorten gesehen erst im Mittelfeld der angegebenen Symptome und Probleme. Das bedeutet ebenso, dass die primär studienspezifischen Probleme nicht isoliert zu sehen sind, da die Kombination verschiedener Symptome außerordentlich häufig ist. So gehen Lern-, Arbeits- und Konzentrationsstörungen häufig mit funktionellen oder psychosomatischen Symptomen wie Kopfschmerzen und Schlafstörungen einher (Krejci 1982). Auffällig ist, dass in Kohorte 3 besonders viele Lernstörungen (31,1%) und eine Plan- und Ziellosigkeit des Arbeitsverhaltens bei 22% der Klienten von den Therapeuten diagnostiziert wurden. Krejci (2001) sieht die Gründe für eine solche Leistungsstörung in einer Verweigerungshaltung den Eltern gegenüber und/oder in der allgemeinen Ablehnung von Verantwortungsübernahme. Kompatibel mit dieser Äußerung erscheinen die niedrige wöchentliche Arbeitszeit, die Angabe keine Berufsperspektive zu haben bei 68% der Studierenden und die hohe Anzahl an Langzeitstudierenden innerhalb der Kohorte 3. 58 Schlafstörungen können als Symptom einer Depression auftreten und waren in Kohorte 3 und 4 häufig vertreten. Das Ansteigen von Schlafstörungen kann möglicherweise im Zusammenhang mit dem Anstieg an depressiver Verstimmung gesehen werden, der Chi-Quadrat-Test zeigt jedoch keinen statistisch signifikanten Zusammenhang der beiden Symptomatiken. Der Anstieg der depressiven Verstimmung und der Störung des Selbstwertgefühles innerhalb der Stichprobe kann mehrere Gründe haben. Im Laufe der Zeit haben sich die Diagnosestandards/-systeme (ICD-10 und DSM-IV Klassifikation) für psychische Störungen verändert (s. ICD-10 2006; DSM-IV 2000). Dadurch ergeben sich erheblich differenziertere Diagnosen und eine umfassendere Definition von psychischen Erkrankungen. Die höheren Prävalenzen können somit auch auf einen verbesserten Erkenntnisstand und diagnostische Sensitivität von psychischen Störungen zurückgeführt werden, so dass nun vermehrt die wahre Krankheitslast psychischer Störungen realistisch widergespiegelt wird (Jacobi 2009). Zum anderen kann eine stärkere Sensibilisierung der Therapeuten für depressive Symptomatiken und/oder aber die tatsächliche Zunahme dieser Symptomatiken unter den Studierenden im Kontext spezifischer gesellschaftlicher und hochschulspezifischer Aspekte zu den Ergebnissen geführt haben. Zudem ist es notwendig die Lebenssituation Studierender unter Berücksichtigung entwicklungspsychologischer Modelle (Laufer 1965) zu verstehen (siehe Einleitung). In dem besonderen Lebensabschnitt der Spätadoleszenz, verbunden mit dem Studiensetting, liegen Risiken und Chancen für die Identitätsentwicklung des Individuums. Epidemiologische Studien zeigen, dass psychische Störungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit in dieser Lebensphase auftreten können. Krueger (1986) ermittelte, dass 15% der befragten Studierenden über ausgeprägte, professioneller Hilfe bedürftige psychische Beschwerden klagen. Holm-Hadulla und Soeder (1997) kamen in ihrer Untersuchung „Psychische Beschwerden und Störungen von Studierenden“ zu dem Ergebnis, das sich 16% der Studierenden als gravierend psychisch beeinträchtigt einschätzt. In der zitierten Befragung dominieren depressives Syndrom, Arbeitsstörungen und interpersonelle Beeinträchtigungen. Die Sonderauswertung zur 15. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks „Studium und psychische Probleme“ (Hahne et al. 1999) ergibt, dass von 27% aller befragten Studierenden das Studium im Jahr vor der Erhebung durch psychische Probleme beeinträchtigt wurde. Jeder vierte Studierende an einer deutschen Hochschule gibt an, dass sein Studium durch psychische Beeinträchtigungen gelitten hatte. Im Problemkatalog dominieren Leistungsprobleme, mangelndes Selbstwertgefühl, depressive Verstimmung, Labilität, Prüfungsangst und allgemeine Ängste. Diese Untersuchungen verdeutlichen, wie auch unsere Untersuchung, dass psychische Probleme unter Studierenden keine Ausnahmeerscheinung sind. Jedoch sind die Arten der psychischen Probleme der Studierenden in Ihren Ergebnissen so vielfältig wie die Zahlen ihrer Prävalenzen. Die Schwankungen 59 der Ergebnisse begründen sich auf unterschiedlich eingesetzten Untersuchungsverfahren mit geringer Standardisierung und limitieren deren Vergleichbarkeit (Soeder et al.2001). Auch neuere Studien wie z.B. Bailer et al. (2008) zeigen keine Abnahme von psychischen Syndromen bei Studierenden. 22,7% der Studierenden aus der Untersuchung zur „Prävalenz psychischer Syndrome bei Studierenden einer deutschen Universität“ erfüllen die Kriterien für mindestens eines der sieben im Gesundheitsfragebogen für Patienten erfassten Syndrome, hierzu zählen Major Depression, andere depressive Syndrome, Panikstörung, andere Angstsyndrome, Somatoformes Syndrom, Alkoholsyndrom und Essstörungen. Jedoch sind all diese genannten Untersuchungen auf Befragungen der Studierenden, also anhand von Selbstauskünften und nicht auf die Befragung von Therapeuten begründet. In einer Studie aus den USA „Changes in Counseling Center Client Problems Across 13 Years“ (Benton et al. 2003) werden die Therapeuten nach abgeschlossener Therapie zu den Symptomatiken ihrer Patienten befragt. In unserer Untersuchung erfolgte die Erhebung der Symptomatiken direkt nach dem Erstgespräch. Unter anderem konnten Benton et al. (2003) feststellen, dass die Komplexität von Studentenproblemen zunimmt. Studienspezifische Probleme treten immer häufiger mit schwerwiegenderen Problemen, wie z.B. Angst, Depression, Suizidgedanken und Persönlichkeitsstörungen zusammen auf. Die Zahl der Studierenden mit einer Depression hat sich in der Zeitperiode von 1988 bis 2001 der Untersuchung verdoppelt und die Zahl der suizidalen Studenten hat sich sogar verdreifacht (Benton et al. 2003). Im Gegensatz dazu hat sich die Zahl der Klienten mit Suizidideen innerhalb unserer Untersuchung reduziert. Im Bereich depressive Verstimmung scheinen die Ergebnisse identisch mit unserem Ergebnis zu sein (Verdopplung von 24,1% in Kohorte 1 auf 53,8% in Kohorte 4), obwohl Instrumente und Zeitpunkt der Befragung voneinander abweichen. Die häufigsten Symptomatiken der vergleichenden Feldstichprobe von Holm-Hadulla et al. 2009 liegen, ähnlich wie in unserer Untersuchung, im Bereich depressive Verstimmung (44% in 2007/2008) und mangelndes Selbstwertgefühl (51% in 2007/2008). Die Häufigkeiten sind jedoch, anders als in unserer Untersuchung, in den letzten 15 Jahren relativ konstant geblieben. Die Ausnahme ist das Symptom Prüfungsangst, welches zwischen 1993 und 2008 um 51% zugenommen hat (vgl. Kapitel 5.4.1 Prüfungsangst). Die depressiven Symptome stehen in sehr verschiedenartigen psychodynamischen Zusammenhängen. Depressive Verstimmungen können eine seelische Reaktion auf Trennung und Verlust sein, z. B. hervorgerufen bei dem Ablösungsprozess aus den bisherigen familiären Bindungen. Neben möglichen Trennungs- und Verlusterlebnissen können auch Selbstenttäuschungen, Kränkungen der Selbstliebe und notwendige Korrekturen an einem illusionären Selbstbild depressive Verstimmungen verursachen (Krejci 1982). Studierende mit depressiven Störungen kennzeichnen sich durch Passivität, sowie Hilflosigkeit gegenüber Leistungsanforderungen und sozialen Erwartungen (Knigge-Illner 2002). 60 Als mögliche Erklärungen und Hypothesen für Ihre Ergebnisse sehen die US- Autoren (Benton et al. 2003) unter anderem spezifische Universitätsfaktoren, Gesellschaftsveränderungen und Medienbeeinflussung. Durch das Ansteigen der komplexen Fälle sei eine Anpassung des Personals und der allgemeinen Ressourcen von Nöten (Benton et al. 2003). Eine Studie aus Spanien zeigt ebenfalls ein erhöhtes Vorkommen der depressiven Verstimmung unter spanischen Studierenden. 554 Studierende zwischen dem 18-34 Lebensjahr wurden interviewt. Bei 81,3% der Studierenden wurde eine depressive Verstimmung diagnostiziert. Major depressive Episoden wurden bei 8,7% der Studierenden nachgewiesen, wobei Frauen signifikant (p‹0,05) häufiger betroffen waren als Männer. Die Diagnostik erfolgte nach DSM IV Kriterien (Vázquez und Blanco 2008). In unserer Untersuchung zeigt sich kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und dem Auftreten von depressiven Verstimmungen. Park (2008) konstatiert, dass Depressionen unter Studierenden durch die individuelle Vulnerabilität, Stress, soziale Unterstützung und Coping (individuelle Bewältigungsstrategien) direkt beeinflusst werden, sowie indirekt durch Selbstwirksamkeit. Er untersuchte 1640 Studierende in Seoul, Korea. Diese Studie unterstreicht den multimodalen Ansatz im Verständnis von Depressionen, der auch für unsere Untersuchung angewendet werden muss. Weitere Studien aus Pakistan (Rab et al. 2008) und Island (Sigfusdottir et al. 2008) zeigen ebenfalls ein vermehrtes Vorkommen von Depressionen und Ängsten unter Adoleszenten beziehungsweise Medizinstudentinnen. Als Risikofaktoren werden im speziellen das weibliche Geschlecht, sowie negative „life events“ gesehen. Als protektive Faktoren konnten in Pakistan Freundschaften identifiziert werden. Auch andere Studien, wie z.B. Becker (1982) und Margraf (2001) weisen darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen psychischen Wohlbefinden und sozialer Unterstützung existiert. Ein Mangel an sozialer Unterstützung begünstigt wahrscheinlich die Entwicklung psychischer Störungen. Studierende welche sich regelmäßig sportlich betätigen scheinen ein reduziertes Risiko für Depressionen und suizidales Verhalten zu haben (Taliaferro et al. 2009). Sport und soziale Unterstützung sind somit wissenschaftlich belegt protektive Faktoren für depressive Verstimmungen. Als mögliche Ursachen für die Zunahme von Depressionen unter Studierenden kommen mehrere Faktoren in Frage. Eine Reihe von Studierenden hat das Gefühl, den Anforderungen ihrer Universität nicht gewachsen zu sein. Ein möglicher Zusammenhang zwischen Überforderung und Depressivität ließ sich anhand der Daten überprüfen. Innerhalb von Kohorte 3 und 4 ist das Symptom Überforderung auf 19,8% bzw. 23,7% signifikant angestiegen (p‹0,001). Allerdings zeigt sich im ChiQuadrat-Test kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Symptom Überforderung und depressiver Verstimmung innerhalb von Kohorte 3. Für Kohorte 4 ist der statistische Zusammenhang signifikant auf dem 5% Niveau. Entgegen der möglichen Erwartung einer positiven Korrelation zeigt sich allerdings eine geringfügige negative Korrelation (r=-0,19). Der Zusammenhang stellt sich 61 folgendermaßen dar, je häufiger eine depressive Verstimmung vorliegt, desto weniger häufig wird das Symptom Überforderung diagnostiziert und umgekehrt. Studierende können Schwierigkeiten mit der Arbeitssituation in der Universität möglicherweise als persönliches Versagen und Minderwertigkeit erleben. Erfolg und Misserfolg an der Universität sind für viele Studierende der wesentliche „Markstein“ bei der Bestimmung des eigenen Selbstwertgefühles (Schuergers und Kuda 1988). Eine „unpersönliche“ Ausbildungsstruktur an den Hochschulen kann, weil Sie keine direkte Rückmeldung ermöglicht, das Gefühl der Unfähigkeit unter Studierenden mit psychischen Störungen hervorrufen oder verstärken. Laut Hahne et al. (1999) geben Studierende, die regelmäßig Gespräche mit Dozenten führen, seltener mangelndes Selbstwertgefühl an. Seminare und andere Lehrveranstaltungen sollten in kleinen Gruppen gehalten werden, um einen besseren Kontakt zum Dozenten herzustellen. Betreuung, Anleitung und Rückmeldung innerhalb von Lehrveranstaltungen im Studium sind von großer Bedeutung, um das Selbstwertgefühl des Einzelnen zu stabilisieren. Ohne diese Faktoren können positive Selbstwertgefühle selten entwickelt werden. Mangelnde positive Rückmeldungen können verhaltenstheoretisch als Verstärkerverlust aufgefasst werden, welcher in der Verhaltenstherapie für die Entwicklung von Depressionen verantwortlich gemacht wird (Hautzinger 1996). Nach Taylor (1994) ist Anerkennung ein menschliches Grundbedürfnis und er weist darauf hin, dass Individuen durch Anerkennung geformt werden. Ein Mangel an positiven Leistungsrückmeldungen kann somit einen entscheidenden Einfluss auf das Selbstwertgefühl nehmen. Genauso kann ein mangelndes Selbstwertgefühl als Auslöser oder Moderatorvariable für die Entstehung später entstehender psychischer Störungen angesehen werden (Hahne et al.1999). Bedingungen der Massenuniversität können das nicht im erforderlichen Ausmaß gewährleisten. Ebenso können negative Erfahrungen, die mit Scham besetzt sind und ein niedriger sozialer Status mit Depressionen interagieren, wie eine Forschungsgruppe aus Schweden bei Adoleszenten herausgefunden hat (Åslund et al. 2009). Die Kohorten 3 und 4 sind situiert in einer Phase des zunehmenden Effizienzdruckes auf gesellschaftspolitischer und ökonomischer Ebene. Die ökonomische Effizienz des Studiums und die spätere ökonomische Verwertbarkeit der Studierenden sind Aspekte, die in diesem Zeitraum mehr und mehr diskutiert und durch die Medien verbreitet wurden. Studium und Studierende werden stärker nach dem Leistungsprinzip beurteilt. 62 Psychosoziale Thematiken, welche in Kohorte 1 und 2 durchaus einen größeren Stellenwert hatten, da die Gründungzeit vieler psychosozialer/psychotherapeutischer Beratungsstelle Anfang der 70er Jahre war, werden zunehmend vernachlässigt. Somit können die Kohorten 3 und 4 in Zusammenhang mit einem sozialen Wandel und Wertewandel gebracht werden. Unsere Untersuchung erstreckt sich über 30 Jahre. Die Spätadoleszenz mit ihren krisenbehafteten Entwicklungsaufgaben hat sich definitionsgemäß nicht verändert, die Gesellschaft, in die es sich zu integrieren gilt, jedoch schon. Die Auseinandersetzung mit Politik und Herkunftsfamilie beschäftigte die Studentenschaft in den 70er Jahren auf breiter Ebene. Die Frage nach der eigenen Identität war ein zentrales Diskussionsthema. Gruppengespräche hatten ebenso einen hohen Stellenwert zu dieser Zeit. Es herrschte eine regelrechte Gruppeneuphorie und Experimentier-Lust (Sperling und Jahnke 1974). Die Studentenbewegung zeichnete sich somit durch eine Vielzahl selbstorganisierter Gruppen zu den verschiedensten Zielen und Inhalten aus. Neue Lebensformen zu entwickeln, wie z.B. Wohngemeinschaften und „freie“ Sexualität, alte erstarrte Formen zu sprengen, waren zentrale Wünsche in dieser Phase. „Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren“, war der wohl berühmteste öffentliche Satz diese Zeit. Die Universität war damals als Forum für jegliche theoretische Diskussion offen. Es war eine Zeit der hoffnungsvollen Aufbruchstimmung und der Reformeuphorie (Fuhrmann 1980). 10 Jahre später war dieser gewonnene Freiraum wieder deutlich eingeschränkt. Die Reformansätze blieben stecken und neue Hochschulgesetze verengten den Spielraum in der Universität. Viele Studierende zogen sich zurück in ihr Privatleben, politische Gruppen verloren an Bedeutung. Der Zulauf zur Psychotherapie erhöhte sich mit der Hoffnung, rasch und umfassend Probleme lösen zu können. Parallel war zu beobachten, dass der Konkurrenzdruck innerhalb der Universität stieg. Massenuniversität, verschärfte Prüfungsanforderungen mit höheren Durchfallquoten, ein größerer Zeitdruck, knappere Finanzierung und eingeschränkte Berufschancen verschlechterten die äußeren Bedingungen der Hochschulen und erzwungen ein „effektives trockenes Studium“ (Fuhrmann 1980). Leuzinger-Bohleber und Mahler sprechen in diesem Zusammenhang auch von einem „Durchlauferhitzer für einen guten Job“ (Leuzinger-Bohleber und Mahler 1993, S. 17). Der Bewegungsspielraum in der Universität ist objektiv kleiner geworden. Vielerorts wurden Studierende aus Planungs- und Entscheidungsgremien der Hochschulen herausgedrängt. Solche Ereignisse können Ohnmacht- und Insuffizienzgefühle fördern und auch die Chance der persönlichen Entwicklung im Sinne einer größeren Selbststeuerung und einer eigenständigen Organisierung des gesamten Lebens schmälern (Leuzinger-Bohleber und Mahler 1993). Der Aufbau stabiler Beziehungen zwischen den Studierenden kann durch den Rückgang selbstorganisierter Gruppen erschwert worden sein. Gerade in Kohorte 2 zeigt sich eine Zunahme von Kontaktschwierigkeiten und Partnerproblematik. Die genauen Werte liegen bei 37,7% für Kontaktschwierigkeiten und 41,7% bei Partnerschaftsproblemen. Zu keinem anderen Kohortenzeitpunkt konnte eine derart hohe Prozentzahl festgestellt werden. 63 Knigge-Illner (2002) weist jedoch daraufhin, dass es schwer zu eruieren sei, ob Kontaktprobleme tatsächlich abgenommen haben. Solche Probleme einzugestehen, fiel im Kontext mit der Orientierung auf Gruppendynamik und Solidarität zur damaligen Zeit eventuell leichter. Bachmann (1999) konstatiert, dass der Kontakt zu den Mitstudierenden die wichtigste soziale Ressource für Wohlbefinden und Bewältigung des Studiums ist. Somit avanciert diese Variable zur wichtigsten gesundheitsfördernden Ressource im Studium. Nicht nur bei der Bewältigung der Lernund Arbeitsaufgaben, sondern auch bei der Auseinandersetzung mit der Elterngeneration, sowie bei allgemeinen Aktivitäten kann die soziale Unterstützung unter Studierenden positive Auswirkungen haben. Dieser Punkt wird in vielen Bereichen maßlos unterschätzt. Kuda (1998) spricht von einem bedenkenlosen Zerschlagen von gewachsenen sozialen Strukturen auf Grund von heute geforderter Mobilität zur vermeintlichen Lösung von Arbeitsmarktproblemen. „Der Wert sozialer Beziehungen und damit auch sozialer Unterstützung fällt aus den Kalkulationen völlig heraus.“(Kuda 1998, S.2). Auch Senett (2000) spricht von dem Zwang zur Flexibilisierung und weist in den USA eindringlich auf die Gefahren hin. Die gravierenden Auswirkungen dieser neuen Kurzfristigkeit sieht er in Schwierigkeiten für die Entwicklung von Vertrauen, Loyalität, gegenseitiger Verpflichtung und den Aufbau von sozialen Bindungen. Fasst man diese Überlegungen zusammen, so erschwert der zunehmende Zwang zur Flexibilität die Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit. Somit kann auch der Zerfall von sozialen Strukturen, als ein Faktor von vielen, durchaus im Zusammenhang mit dem Ansteigen von Depressionen gesetzt werden. Graf und Krischke (2004) sehen Risiken und Chancen im aktuellen sozialen Wandel. Auf der einen Seite wird die Identitätsentwicklung erschwert durch den Wandel der traditionellen Werte und die Auflösung von vorgegebenen biographischen Entwurfsschablonen, die somit keine Orientierung mehr bieten. Auf der anderen Seite sehen die Autoren Chancen im sozialen Wandel, da sich vorgegebene soziale Lebensformen, auch im Zusammenhang mit sozialer Herkunft oder geschlechtsspezifischen Rollen, auflösen und sich so Raum für neue Lebensentwürfe ergibt. Sicher und wissenschaftlich bewiesen ist, dass es immer mehr verschulte Studiengänge gibt, die mit hohen Belastungen verbunden sind und den Studierenden zu formalisierten Höchstleistungen zwingen. Die Autoren der GEW Studie konstatieren, dass das Ziel einer besseren Studierbarkeit von Bachelorund Masterstudiengängen gegenüber den traditionellen Studiengängen nicht erreicht wurde. Von einer Verschlechterung kann in einzelnen Fällen sogar gesichert ausgegangen werden (Banscherus et al. 2009). Dass der Aufwand in den neuen Studiengängen gestiegen und die Studierbarkeit gesunken ist, vermerkt eine Studie an der Humboldt Universität Berlin (Projektgruppe Studierbarkeit 2007). Die hohe Abbruchquote von 30% bei Bachelorstudierenden, über alle Hochschularten und Fächergruppen hinweg, zeigt, auch bei allen Problemen, die die Interpretation der Daten auf Grund der 64 unterschiedlichen Umstellung der Studiengänge mit sich bringt, die hohe Belastung der Studierenden (Daten von Heublein et al. 2008). Studium hat vielerorts damit aufgehört eine Zeit der Selbsterprobung zu sein. Im engen Regelsystem der Gesellschaft, in der wir leben, werden jungen Menschen soziales Spiel und soziale Phantasie frühzeitig ausgetrieben, konstatiert Gottschalch (1980). Die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen hat die Verschulung von Studiengängen in Deutschland gefördert, die notwendigen Persönlichkeitsentwicklungen der Studierenden während des Studiums werden kaum thematisiert und berücksichtigt. Freiräume für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung werden nicht gesichert, im Vordergrund steht das Leistungsprinzip. Eine Studie der Techniker Krankenkasse (Meier et al. 2007) zeigt, dass Psychopharmaka fast 10% der den Studierenden insgesamt verordneten Medikamente ausmachen. Die Verschreibung der Stimmungsheber korreliert/steigt mit zunehmenden Alter der Studierenden. Leistungsdruck und Stress gehören mit allen negativen Folgen zum Unialltag. Funktionieren um jeden Preis, notfalls auch mit Hilfe von Drogen kann für unsere Gesellschaft auf Dauer nicht förderlich sein. Die daraus resultierenden psychischen und physischen Veränderungen sind vermutlich teurer als ein oder zwei verlorene Semester. Sicherlich haben Studierende vor dem Eintritt in die Universität teils mit persönlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, jedoch weisen viele Beispiele darauf hin, dass die von der Gesellschaft und der Universität vorgegebenen Lebensbedingungen problemverschärfend wirken können. Ängste und Nöte werden, durch die für Studenten fast nur über Leistungen zu erlangende Anerkennung und Bestätigung, fortgeschrieben, statt neue Entwicklungen in eine andere Richtung zu fördern (Fuhrmann 1980). Von klassischen Problemen des Studienalltags spricht Knigge-Illner (2002), die sie im Zusammenhang mit den Anforderungen der Universität auf der einen Seite und den psychosozialen Voraussetzungen, die die Studierenden mitbringen, auf der anderen Seite sieht. „Die Bedeutung dieser Probleme sollte nicht unterschätzt werden, da sie den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsbildung beeinträchtigen, wenn sie nicht frühzeitig durch Beratung und Betreuung aufgefangen werden“ (Knigge-Illner 2002, S.43). Die Zunahme des Symptoms depressive Verstimmung und vermindertes Selbstwertgefühl innerhalb unserer Untersuchung sind alarmierend. Wie bereits beschrieben konnten andere Autoren diese Tendenz ebenfalls zeigen. 65 5.5 Vergleich der Ergebnisse mit der Allgemeinbevölkerung junger Erwachsener Wittchen et al. (1998) berichten über Lebenszeitprävalenzen von depressiven Störungen und Angststörungen unter Jugendlichen und junge Erwachsenen im Alter von 14-24 Jahren, die bei 16,8% bzw. 14,4% liegen. Die Bremer Jugendstudie zeigt ein ähnliches Ergebnis für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren. Es besteht eine Lebenszeitprävalenz von 17,9% an depressiven Störungen, wobei Mädchen signifikant häufiger betroffen sind als Jungen (Essau et al. 2000). Über die Jahrzehnte ist nach Barkmann und Schulte-Markwort (2004) keine Zu- oder Abnahme psychischer Auffälligkeiten im Jugendalter ableitbar. In Ihrer vergleichenden Untersuchung wurden 29 Studien berücksichtigt und eine mittlere Prävalenz von 17,2% an psychischen Auffälligkeiten festgestellt. Die Ergebnisse des Bundesgesundheitssurveys 1998/99 (BGS 98) zeigen, dass Frauen deutlich häufiger als Männer an depressiven Störungen, Angststörungen und somatoformen Störungen leiden. Die 12 Monats Prävalenz bei 18-34 jährigen Frauen liegen bei 9,5%, 20% und 14,9%. Die Autoren interpretieren ihre Ergebnisse auch unter dem Aspekt, dass frauentypische Störungen näher untersucht wurden (Jacobi et al. 2004). Insgesamt 32,1% der Deutschen Allgemeinbevölkerung zwischen dem 18. und 64. Lebensjahr sind im Laufe des Jahres von mindestens einer psychischen Störung betroffen. Die häufigsten psychischen Störungen sind Angststörung (14,5%), depressive Störung (11,5%) und somatoforme Störung (11%), charakteristischer Weise kommt es häufig zu Komorbiditäten. (Jacobi et al. 2004). Die Fortsetzung des BGS 98 die „Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ (DEGS) wird vom Robert-Koch Institut im Zeitraum von 11/2008 bis 10/2011 durchgeführt. Ausgehend von diesen Daten, scheinen psychische Störungen bei Studierenden nicht wesentlich häufiger als in der altersentsprechenden Allgemeinbevölkerung in Deutschland aufzutreten (vgl. S.52). Die Ergebnisse aus der Beratungsstelle zeigen nach Therapeuteneinschätzungen ein häufigeres Vorkommen von depressiven Verstimmungen in Kohorte 3 und 4, so dass es vermutlich die beschriebenen spezifischen universitären Mitverursachungen gibt. 66 5.6 Ausblick Unsere Ergebnisse zeigen, dass Krisen und psychische Symptomatiken über den gesamten Zeitraum präsente Erfahrungen unter Studierenden sind. „Ein Leben als Student ist ein sehr instabiles Lebensmodell. Wenn da nicht die Familie, der Freundeskreis oder die Beziehung Halt gibt, dann überwiegen die Zweifel“ (Kuda s. Fritzsche 2007). Der Beratungsbedarf ist keinesfalls gesunken und auch die Hochschulreformen mit Bachelor- und Masterstudiengängen, sowie die weitere Internationalisierung der Hochschule, können als neue Herausforderung für die Beratungs- und Therapieeinrichtungen gesehen werden. Nicht nur der einzelne Studierende profitiert von einer Krisenberatung, auch aus ökonomischer Sicht ist eine studiennahe Beratung effektiv. Eine oft teure kassenärztliche oder öffentliche Versorgung kann durch eine frühzeitige studiennahe Beratung ersetzt werden und so Kosten im Gesundheitswesen vermeiden. Hoops (2007) fasst diesen Zusammenhang aus Sicht der Studentenwerke folgendermaßen zusammen: „Beratung der Studentenwerke heißt Beratung hin zu einem erfolgreichen Studium. Davon profitieren nicht nur die Studierenden, sondern auch die Hochschulen und letztlich auch die Gesellschaft.“ Jedes Studium ist zeit- und kostenintensiv, durch nichtbewältigte spätadoleszente Reifungskrisen und/oder einen Studienabbruch gehen dem Staat ein Teil des dringend benötigten Potentials von Akademikern verloren. Diese eher strikt auf das Leistungsprinzip und Effizienz eingehenden Äußerungen werden von Rueger (1996) und Krejci (1982) ganzheitlicher gesehen. „Das Lebensalter unserer Studierenden [...] ist mit Krisen und Entwicklungschancen in gleicher Weise verbunden. Eine Bildungsreform, die dies nicht berücksichtigt, geht über die Adressaten hinweg und kann allenfalls als Ausbildungsreform gekennzeichnet sein“ (Rueger 1996, S.9). „Wenn die Universitäten in ihrem Selbstverständnis mehr Raum für die Aufgabe der Persönlichkeitsentwicklung der Studenten schafften, wäre wohl die Notwendigkeit psychotherapeutischer Beratung an den Hochschulen in Deutschland bald keine Frage mehr. Die Hilfsbedürftigkeit der studentischen Population könnte dann vielleicht eines Tages vorurteilsfrei als Tatsache akzeptiert werden. Das wäre eine große Erleichterung für diejenigen, die individuelle psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen möchten.“ (Krejci 1982, S.78). Dieser „systemische Ansatz“ ist auch heute noch gültig und „bei der Konzipierung und Umsetzung von Studien- und Prüfungsordnungen an den Hochschulen, ist es notwendig, ein ausgewogenes Maß zwischen Strukturierung einerseits und akademischer Freiheit andererseits zu realisieren“ (Holm-Hadulla et al. 2009, S.356). 67 Für die Persönlichkeitsentwicklung sind, laut Holm-Hadulla (2007), kreative Freiräume unerlässlich und zum anderen auch leistungsfördernd. Die persönliche und die berufliche Entwicklung werden durch das Studium geprägt. Unverzichtbar sind die Beziehungs- und Lebenserfahrungen, die sich in dieser Phase entwickeln. „Partnerschaften, kulturelle Aktivitäten und Sport sind während des gesamten Lebens Gesundheitsfaktoren, die man spätestens im Studium zu gestalten lernt. Sie sind kein Müßiggang, sondern Elixiere der Arbeits- und Liebesfähigkeit“ (Holm-Hadulla 2007, S.74). Psychotherapeutische Beratungsstellen können dazu beitragen den Prozess der Identitätsfindung unter Studierenden in Richtung Kreativität statt Krankheit zu lenken. 68 6 Zusammenfassung Psychische Störungen und Probleme unter Studierenden sind häufig. Neben universitären und gesellschaftlichen Faktoren spielt die spezielle Lebenssituation in der Phase der Spätadoleszenz und die individuellen psychosozialen Voraussetzungen der Studierenden eine entscheidende Rolle im Verständnis zur/der Entstehung der psychischen Probleme/Symptomatiken unter Studierenden. Die vorliegende retrospektive Studie untersuchte vier Jahrgangskohorten (n=808) studentischer Klientel der Ärztlich-Psychologischen Beratungsstelle für Studierende der Georg-August-Universität Göttingen auf Ausprägung und Unterschiede in den sozialen und studienspezifischen Merkmalen sowie auf Unterschiede in Bezug auf Selbsteinschätzung und Therapeuteneinschätzungen der vorliegenden Symptomatiken. Bei den sozialen und studienspezifischen Merkmalen konnte ein Vergleich mit der Gesamtuniversität Göttingen erstellt werden. Im Rahmen der Eingangsdiagnostik (Erstgespräch) wurden die neuen Klienten mittels verschiedener standardisierter Fragebögen (Sozialbogen, Gießen-Test, Fragebogen zur Beurteilung der Suizidgefahr, Prüfungsangst-Fragebogen) befragt. Anschließend erfolgte eine Therapeuteneinschätzung bezüglich der Symptomatik und der Prognose. Die Kohorten setzen sich folgendermaßen zusammen. In Kohorte 1 (SS 1971 und WS 1971/72) haben sich 182 Patientinnen und Patienten neu angemeldet; in Kohorte 2 (SS 1981 und WS 1981/82) sind es 239 Klienten und in Kohorte 3 (SS 1990 und WS 1990/91) 177 Klienten. Zur Kohorte 4 (SS 2000 und WS 2000/01) gehören 210 Klienten. Hinsichtlich der soziodemographischen und studienspezifischen Charakteristik konnten als prägnante Ergebnisse die kontinuierliche Zunahme des Alters, der Anzahl der Hochschulsemester und Langzeitstudierenden über alle Kohorten festgestellt werden. Für Hochschulsemester und Langzeitstudierende waren diese Ergebnisse nahezu identisch mit den Daten der Gesamtuniversität Göttingen. Vermutlich hatten Studieneingangsprobleme in den ersten beiden Kohorten tendenziell einen höheren Stellenwert als in Kohorte 3 und 4. Eingeführte Orientierungsphasen und Tutorien können möglicherweise eine Plattform für informelle Kontakte bieten, persönliche Kontakte unter Studierenden erleichtern und somit Studieneingangsprobleme reduzieren. Die beiden letzten Kohorten weisen vermehrt Studierende mit Problemen im Kontext mit dem Studienabschluss und Langzeitstudierende auf. Zur Klientel der Beratungsstelle zählen überproportional viele weibliche Studierende und Studierende der Philosophischen Fakultät, in Kohorte 4 fiel jedoch ein deutlicher Zuwachs von Studierenden der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät auf. Die Ergebnisse bezüglich der Fakultätszugehörigkeit sind nahezu identisch mit den Daten der Gesamtuniversität. 69 In der Selbsteinschätzung ergeben sich signifikante Unterschiede im Bereich der Persönlichkeitsmerkmale. So schätzen sich Klienten der Kohorte 2 als depressiv und verschlossen ein. In Kohorte 1 werden die geringste soziale Anerkennung und die höchste Depressivität angegeben. Diese Ergebnisse müssen auch im Kontext des jeweiligen psychosozialen Klimas gedeutet werden. Gerade zu diesen Ergebnissen ergab sich eine Diskrepanz mit den Therapeuteneinschätzungen, die Therapeuten gaben in den Kohorten 3 und 4 vermehrt depressive Verstimmung und ein vermindertes Selbstwertgefühl unter den Klienten an. Klienten und Therapeuten haben dabei anscheinend unterschiedliche Bewertungskriterien. Die Klientel der Ärztlich-Psychologischen Beratungsstelle Göttingen zeigt in der Selbsteinschätzung mittels Gießen-Test, trotz der oben beschriebenen kohortenspezifischen Unterschiede, insgesamt eine negative soziale Resonanz und ein tendenziell dominantes Verhalten. Sie sehen sich als unterkontrolliert, retentiv (verschlossen) und sozial weniger kompetent an und sind in der Grundstimmung depressiv. Im Wesentlichen dominieren bei den Symptomatiken nach Therapeuteneinschätzungen depressive Verstimmungen, Störungen des Selbstwertgefühles, Kontaktschwierigkeiten und Partnerschaftsprobleme. Die studienspezifischen Probleme wie Lern- und Arbeitsstörungen folgen erst im Mittelfeld der angegebenen Symptome und Probleme. Dennoch gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Kohorten. 53,8% der Klienten in Kohorte 4 wiesen eine depressive Verstimmung auf (p‹0,001) und bei fast der Hälfte der Klientel in Kohorte 4 wurde vom Therapeuten eine Störung des Selbstwertgefühles angegeben (p‹0,01). Diese Symptomatiken haben in Kohorte 3 und 4 stark zugenommen. In Kohorte 1 und 2 wurden jeweils bei einem Drittel der Klientel Kontaktschwierigkeiten angegeben. Psychische Probleme, insbesondere depressive Verstimmung und vermindertes Selbstwertgefühl nehmen unter Studierenden der Beratungsstelle zu und können möglicherweise auch im Zusammenhang mit einem zunehmenden Effizienzdruck an Studierende in unserer Leistungsgesellschaft gedeutet werden. Psychotherapeutische Beratungsstellen spielen eine wichtige Rolle in der Versorgung von Studierenden mit psychischen Störungen. Sie bieten eine wichtige Unterstützung zur positiven Bewältigung von spätadoleszenten Reifungskrisen. Die Symptomatiken unter Studierenden haben sich teils verändert, eine Anpassung im Angebot der Beratungsstelle kann von dieser Studie abgeleitet werden. Insgesamt kann vor dem Hintergrund unserer Untersuchung eine Verbesserung der Behandlungskapazitäten bzw. Versorgungsplanung innerhalb psychotherapeutischer Beratungsstellen gefordert werden. Weitere Studien sind notwendig, um Entwicklungen strukturiert zu beobachten, und auch, um auf die speziellen Probleme von Studierenden in der Öffentlichkeit und an der Universität weiter aufmerksam zu machen. 70 7 Anhang: Untersuchungsinstrumente 7.1. Sozialbogen Sozialbogen Liebe Studierende, Sie finden beiliegend einige Fragebögen, die wir Sie bitten möchten, vollständig und so spontan wie möglich auszufüllen. Wir wissen, dass das „Paket“ recht umfangreich ist. Dies hängt damit zusammen, dass wir im Rahmen unserer Tätigkeit ständig Auswertungen, z.B. über zentrale Problembereiche und Beschwerden und deren Zusammenhang mit zwischenmenschlichen Beziehungen durchführen. Durch Ihre Mitarbeit ermöglichen Sie uns auch, den allgemeinen Bedarf an psychotherapeutischer oder beraterischer Unterstützung zu ermitteln, sowie ein angemessenes Angebot in diesem Bereich zu erarbeiten. Darüber hinaus haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Beschäftigung mit den gestellten Fragen auch für Sie selbst hilfreich sein kann. Die folgenden Angaben zur Person sind ausschließlich für den internen Gebrauch der Beratungsstelle bestimmt und werden strikt vertraulich behandelt. Die Daten werden auch wissenschaftlich statistisch ausgewertet. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Name: Vorname: Datum: Telefon: geboren am: Semesteranschrift: Heimatanschrift: Krankenversicherung: 71 Bitte Druckschrift verwenden! Bei vorgegebenen Antwortmöglichkeiten bitte entsprechende Ziffer einkreisen, z.B. 1 ledig. 1. Geschlecht: 1 männlich 2 weiblich 2. Lebensalter (in Jahren) .......... 3.Religion: 1 evangelisch 2 katholisch 3 ohne 4 sonstige ................................................................ 4. Familienstand: 1 ledig 3 geschieden 2 verheiratet 4 getrennt lebend 5. Partnerschaft: 1 in fester Partnerschaft 2 ohne Partner 3 eigene Kinder? (Anzahl .......) 6. Gegenwärtige Studienfächer (Hauptfach unterstreichen): ..................................................................... ..................................................................... 7. a) Hauptfachsemester: .......... 8. Hauptfachwechsel: 0 nein b) Hochschulsemester: .......... 1 ja, SS/WS 19.. vorher ......................................................studiert 9. Abiturnoten bzw. –punkte: Deutsch: .......... Mathe: .......... Englisch: .......... Abischnitt: .......... 10. Zwischenprüfung: Nein Ja 11. Haben Sie die Hochschulreife auf dem 2.Bildungsweg erworben? 1 ja 2 nein Bitte Rückseite beachten! 72 12. Größten Teil der Kindheit und Jugend (mehr als 10 J.) verbracht in: 1 Großstadt (üb. 150 000) 2 Großstadt (bis 150 000) 3 Mittelstadt (bis 100 000) 4 Kleinstadt (bis 15 000) 5 Dorf (bis 2 000) 13. Eltern (auf die sich folgende Angaben beziehen) a) leibliche b) Adoptiv-Eltern: 1 leben zusammen 2 leben getrennt seit 19.. 3 geschieden seit 19.. 4 Vater verstorben 19.. 5 Mutter verstorben 19.. 6 Stiefmutter seit 19.. 7 Stiefvater seit 19.. 14. Vater: Beruf: Alter: 15. Mutter: Beruf: Alter: 16. Geschwister: 0 keine m/w Gebj. Schulbildung/ggf. Studienfach und ggf. Beruf 1 m/w .... ............................................................................. 2 m/w .... ............................................................................. 3 m/w .... ............................................................................. 4 m/w .... ............................................................................. 5 m/w …. …………………………………………………. 6 m/w .... ............................................................................. 7 m/w .... ............................................................................. 17. Wohnung am Studienort: Allein: 1 priv. Untermiete Zusammen mit: 1 Eltern 2 Studentenheim 3 eigene Wohnung/App. 2 Wohngemeinschaft 3 Partner 18. Finanzierung des Studiums: 1 Eltern, Verwandte ..........% 2 Stipendium ..........% Art des Stipendiums (z.B. Bafög) ..................................... 3 eigene Mittel ..........% 4 anderes ..........% 19. Monatliche Mittel (im Schnitt ohne Studiengebühr, bei Verheir. Gemeinsame Mittel angeben) DM ............................. 20. Erwerbstätigkeit im laufenden oder letzten Semester: 0 nein 1 stundenweise 2 halbtags 3 ganztags 5 nur in den Semesterferien 4 tageweise 73 7.2 Gießen- Test (Beckmann und Richter 1972) 74 75 76 7.3 Fragebogen zur Beurteilung der Suizidgefahr – FBS (Stork 1972b) 77 78 7.4 Prüfungsangst-Fragebogen (Spitznagel 1968) 79 80 7.5 Symptombogen (Sperling und Jahnke 1974) 81 8 Literaturverzeichnis Åslund C, Leppert J, Starrin B, Nilsson K W (2009): Subjective social status and shaming experiences in relation to adolescent depression. Arch Pediatr Adolesc Med 163, 55-60. Bachmann N: Der Einfluss des Studiums und der damit verbundenen Lebensumstände auf die Gesundheit der Studierenden; in: Macht Studieren krank? Die Bedeutung von Belastung und Ressourcen für die Gesundheit der Studierenden; hrsg. v. Bachmann N, Berta D, Eggli P, Hornung R; Hans Huber, Bern 1999, 155-169. Bachmann N, Berta D, Eggli P, Hornung R: Macht Studieren krank? Die Bedeutung von Belastung und Ressourcen für die Gesundheit der Studierenden; Hans Huber, Bern 1999. Bailer J, Schwarz D, Witthöft M, Stübinger C, Rist F (2008): Prävalenz psychischer Syndrome bei Studierenden einer deutschen Universitiät. Psychother Psychosom Med Psychol 58, 423-429. Banscherus U, Gulbins A, Himpele K, Staak S: Der Bologna –Prozess zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die europäischen Ziele und ihre Umsetzung in Deutschland. Eine Expertise im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung; hrsg. v. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft; Frankfurt/M. 2009. Barkmann C, Schulte-Markwort M (2004): Prävalenz psychischer Auffälligkeit bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland - ein systematischer Literaturüberblick. Psychiatr Prax 31, 278-287. Becker P: Psychologie der seelischen Gesundheit. Band 1: Theorien, Modelle, Diagnostik; Hogrefe, Göttingen 1982. Beckmann D, Richter H E: Gießen Test - ein Test für Individual- und Gruppendiagnostik; Hans Huber, Bern 1972. Benton S A, Robertson J M, Tseng W-C, Newton F B, Benton S L (2003): Changes in Counseling Center Client Problems Across 13 Years. Prof Psychol Res Pr 34, 66-72. Biermann A: Schwierigkeiten und Möglichkeiten Studierender mit psychischer Erkrankung in Hamburg. Diplomarbeit am Fachbereich Psychologie der Universität Hamburg 2000. Boerner P: Johann Wolfgang von Goethe; Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1964. 82 Bohleber W: Spätadoleszente Entwicklungsprozesse. Ihre Bedeutung für Diagnostik und psychotherapeutische Behandlung von Studenten; in: Spätadoleszente Konflikte. Indikation und Anwendung psychoanalytischer Verfahren bei Studenten; hrsg. v. Krejci E, Bohleber W, Verlag für med. Psychologie, Göttingen 1982, 11-52. Buddeberg-Fischer, Ebeling I, Stamm M (2009): Karriereförderliche und karrierehinderliche Erfahrungen in der Weiterbildungszeit junger Ärztinnen und Ärzte – Ergebnisse einer Schweizer Longitudinalstudie. Dtsch Med Wochenschr 134, 2451-2457. Bühring P (2004): Langzeitstudierende: Größerer Bedarf an Psychotherapie. Dtsch Arztebl 2004/4, 159 DSM -IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. American Psychiatric Association, Washington 2000. Essau C A, Conradt J, Petermann F (2000): Frequency, comorbidity, and psychosocial impairment of depressive disorders in adolescents. J Adolesc Res 15, 470-481. Fabian C: Erlebte Krisen und Bedingungen der Inanspruchnahme von Therapie- und Beratungsangeboten durch Studierende; in: Macht Studieren krank? Die Bedeutung von Belastung und Ressourcen für die Gesundheit der Studierenden; hrsg. v. Bachmann N, Berta D, Eggli P, Hornung R; Hans Huber, Bern 1999, 11-16. Friebertshäusser B: Übergangsphase Studienbeginn. Eine Feldstudie über Riten der Initiation in eine studentische Fachkultur; Juventa, Weinheim und München 1992. Fritzsche L: Pimp my soul!- Jedes Jahr gehen mehr Studenten zum Psychotherapeuten. Viele haben echte Probleme und einige wollen nun auch ihre Seele fit machen für den Arbeitsmarkt; Zeit Campus, Hamburg 2007 Fuhrmann E: Auf der Suche nach dem Selbst. Beobachtungen aus einer Psychotherapeutischen Beratungsstelle für Studenten; in: Studentenleben; hrsg. v. Wolschner K; Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1980, 139-150. Gottschalch W: Studienbeginn als Identitätskrise; in: Studentenleben; hrsg. v. Wolschner K; Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1980, 124-138. Graf G, Krischke N R: Psychische Belastungen und Arbeitsstörungen im Studium. Grundlagen und Konzepte der Krisenbewältigung für Studierende und Psychologen; Kohlhammer, Stuttgart 2004. Hahne R, Lohmann R, Krzyszycha K, Österreich S, App A: Studium und psychische Probleme – Sonderauswertung zur 15. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks; hrsg. v. Deutsches Studentenwerk, Bonn 1999. Hautzinger M: Depression; in: Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 2: Störungen; hrsg. v. Margraf J; Springer, Berlin 1996, 123-136. 83 Hehn P, Sander T: Die soziale Lage der Göttinger Studierenden – Sonderauswertung für den Hochschulstandort Göttingen 16.Sozialerhebung 2000; hrsg. v. Studentenwerk Göttingen, Göttingen 2002. Hell D (1978): Psychische Störungen bei Studenten - eine Übersicht. Z Psychosom Med Psychoanal 24, 209223. Henkel A, Furtwängler M, Günther G, Herberg D: Die soziale Lage der Göttinger Studierenden. Sonderauswertung einer Umfrage des Deutschen Studentenwerks im Sommersemester 1988 für den Bereich der Universität Göttingen; hrsg. v. Studentenwerk Göttingen, Göttingen 1990. Heublein U, Schmelzer R, Sommer D: Studienabbruchstudie 2005. Die Studienabbrecherquoten in den Fächergruppen und Studienbereichen der Universitäten und Fachhochschulen; hrsg. v. Hochschulinformationssystem (HIS), Hannover 2005. Holm-Hadulla R M (1994): Psychotherapeutische Beratung und Behandlung von Studierenden im Rahmen einer psychotherapeutischen Beratungsstelle. Psychother Psychosom Med Psychol 44, 15-21. Holm-Hadulla R M: Psychische Schwierigkeiten von Studierenden und Ihre Behandlung. Ein Überblick; in: Psychische Schwierigkeiten von Studierenden; hrsg. v. Holm-Hadulla R; Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2001, 5-13. Holm-Hadulla R M (2007): Kreativität oder Karriere? Woran soll sich ein angehender Student bei der Wahl seines Ausbildungsortes orientieren? Ein Psychologe und ein Personalberater debattieren. Fokus 2007/48, 74 Holm-Hadulla R M, Soeder U (1997): Psychische Beschwerden und Störungen bei Studierenden. Psychother Psychosom Med Psychol 47, 419-425. Holm-Hadulla R M, Kiefer L, Sessar W (1997):Zur Effektivität tiefenpsychologisch fundierter Kurz und Psychotherapien. Psychother Psychosom Med Psychol 47, 271-278. Holm-Hadulla R M, Hofmann F-H, Sperth M (2009): Psychische Beschwerden und Störungen von Studierenden. Vergleich von Feldstichproben mit Klienten und Patienten einer psychotherapeutischen Beratungsstelle. Psychotherapeut Volume 54, 5, 346-356 Hoops A: Von guter Beratung profitieren Studierende, Hochschulen und letztlich die Gesellschaft. Pressemitteilung des Deutschen Studentwerkes zum Jahrestreffen der Beraterinnen und Berater der 58 Studentenwerke in Erfurt 2007; hrsg. v. Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Studentenwerk, Berlin 13. November 2007. 84 Hornung R: Leben an der Hochschule. Eine Einführung in den Problem- und Forschungsbereich; in: Macht Studieren krank? Die Bedeutung von Belastung und Ressourcen für die Gesundheit der Studierenden; hrsg. v. Bachmann N, Berta D, Eggli P, Hornung R; Hans Huber, Bern 1999, 11-16. Hornung R, Knoch D: Zusammenfassende Überlegungen und Schlussfolgerungen; in: Macht Studieren krank? Die Bedeutung von Belastung und Ressourcen für die Gesundheit der Studierenden; hrsg. v. Bachmann N, Berta D, Eggli P, Hornung R; Hans Huber, Bern 1999, 189-198. Hornung R, Fabian C: Belastungen und Ressourcen im Studium; in: Psychische Schwierigkeiten von Studierenden; hrsg. v. Holm-Hadulla R M; Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2001, 133-157. ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and related Health Problems. World Health Organisation, Genf 2006. Isserstedt W, Middendorff E, Weber S, Wolter A, Schnitzer K: Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2003. 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes durchgeführt durch Hochschul-Informations-System (HIS) ausgewählte Ergebnisse; hrsg. v. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn, Berlin 2004. Isserstedt W, Middendorff E, Fabian G, Wolter A: Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006. 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes durchgeführt durch Hochschul-Informations-System (HIS) ausgewählte Ergebnisse; hrsg. v. Bundesministerium für Bildung und Forschung; Bonn, Berlin 2007. Jacobi F (2009): Nehmen psychische Störungen zu?. Rep Psychol 34, 16-28. Jacobi F, Klose M, Wittchen H U (2004): Psychische Störungen in der deutschen Allgemeinbevölkerung: Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und Ausfalltage. Bundesgesundheitsbl-GesundheitsforschGesundheitsschutz 47, 736-744. Jamrozinski K, Kuda M, Mangholz A (2009): Langzeitstudierende als Klientel psychotherapeutischer Beratung. Psychother Psychosom Med Psychol 59, 370-375. Knigge-Illner H (2002): Psychosoziale Probleme Studierender im Wandel der Zeiten aus der Sicht Psychologischer Beratung. Gruppendynamik Organ 1, 43-56. Krampen G, Reichle B: Frühes Erwachsenalter; in: Entwicklungspsychologie, 5. vollständig überarbeitete Auflage; hrsg. v. Oerter R, Montada L; Beltz, Weinheim 2002, 319-349. Krejci E: Studentenzeit als psychosoziales Moratorium, Erfahrungen und Reflexionen aus einer Psychotherapeutischen Beratungsstelle für Studenten; in: Spätadoleszente Konflikte. Indikation und Anwendung psychoanalytischer Verfahren bei Studenten; hrsg. v. Krejci E, Bohleber W; Verlag für med. Psychologie, Göttingen 1982, 53-80. 85 Krejci E: Krisenhafte Umbrüche von Studentinnen am Studienende; in: Psychische Schwierigkeiten von Studierenden; hrsg. v. Holm-Hadulla R; Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2001, 65-88. Krueger H J, Steinmann I, Stetefeld G, Polkowski M, Haland-Wirth T: Studium und Krise; Campus, Frankfurt, New York 1986. Kuda M (1984): Suizidalität bei Studierenden: Zur Genese und Psychopathologie. Med Mensch Ges 4, 234-244. Kuda M: Beitrag zur Podiumsdiskussion, Psychotherapeutische Beratungsstelle des Studentenwerks Kassel 25jähriges Bestehen, gehalten 12.11.1998; o.Hrsg., o. Verl. Kuda M, Spitznagel A: Zur Komplexität des Konstrukts Prüfungsangst. in: Experimentelle Psychologie. Abstract der 44.Tagung experimentell arbeitender Psychologen, Technische Universität Chemnitz. 25.07 bis 27.03.2002, hrsg. Baumann M, Keinath A, Krems J F, 2002. Kuda s. Bühring P (2004). Kuda s. Fritzsche L. Kutter P: Konzentrierte Gruppenpsychotherapien in der Spätadoleszens. in: Spätadoleszente Konflikte. Indikation und Anwendung psychoanalytischer Verfahren bei Studenten; hrsg. v. Krejci E ; Bohleber W; Verlag für med. Psychologie, Göttingen 1982, 184-198. Laufer M (1965): Assesment of Adolescent Disturbances. Psychoanal Study Child 20, 99-123. Leuzinger-Bohleber M: Spätadoleszenz – Ein biografischer Kristallisationspunkt? Versuch einer pluralistischen, modellzentrierten Annäherung an spätadoleszente Entwicklungsprozesse; in: Psychische Schwierigkeiten von Studierenden; hrsg. v. Holm-Hadulla R M; Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2001, 14-39. Leuzinger-Bohleber M, Mahler E: Phantasie und Realität in der Spätadoleszenz. Gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungsprozesse bei Studierenden; Westdeutscher Verlag, Opladen 1993. Margraf J: Neue Ergebnisse zu Entstehung und Verlauf psychischer Störungen; in: 2.Workshop- Kongress für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Bern 2001. Meier S, Milz S, Krämer A, Grobe T, Dörning H: Gesund studieren. Beratungsergebnisse des Gesundheitssurvey und Auswertung zu Arzneiverordnungen, Veröffentlichung zum Betrieblichen Gesundheitsmanagment der TK, Band 16; hrsg. v. Techniker Krankenkasse, Hamburg 2007. 86 Meyer A: Manifestation und Behandlung spätadoleszenter Krisen. Zur psychosozialen/psychotherapeutischen Versorgungssituation Studierender an deutschen Hochschulen. Diplomarbeit zur Prüfung für DiplomRehabilitationspsychologen, Hochschule Magdeburg/Stendal 2005. Miller A: Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst; Suhrkamp, Frankfurt/M. 1979. Moeller M L, Scheer J W: Psychotherapeutische Studentenberatung; Thieme, Stuttgart 1974. Nunnendorf S: Wie wir wurden was wir sind. Vortrag anlässlich 30 Jahre Ärztlich-Psychologische Beratungsstelle Göttingen, gehalten 20.06.1996; o.Hrsg., o.Verl. Park K H (2008): Development of a structural equation model to estimate university students' depression. J Korean Acad Nurs 38, 779-88. Prahl H W: Prüfungen: Schlimmer als das Fegefeuer?; in: Studentenleben; hrsg. v. Wolschner K; Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1980, 186-200. Projektgruppe Studierbarkeit: Studierbarkeit an der Humboldt-Universität. Wie läuft das Experiment „Studienreform“?, Humboldt-Universität, Berlin 2007, 29. Rab F, Mamdou R, Nasir S (2008): Rates of depression and anxiety among female medical students in Pakistan. East Mediterr Health J 14(1),126-33. Reich G (1998): Familien mit Adoleszenten – Krise der Familie?. Kontext 29 (1), 42-59. Rueger U: Lebensentwürfe und Krisen Studierender. Zitiert nach Inhaltsangabe des Vortrags. Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung des 30- jährigen Bestehens der Ärztlich Psychologischen Beratungsstelle für Studierende im Sommersemester 1996. Schaefer A, Mattheß H, Pfitzer G, Köhle K (2007): Seelische Gesundheit und Studienerfolg von Studierenden der Medizin mit hoher und niedriger Prüfungsangst. Psychother Psychosom Med Psychol 57, 289-297. Schuergers G, Kuda M (1988): Psychische Probleme von Studenten. Niedersächs Ärztebl 15, 15-20. Senett R: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. 4.Auflage; Siedler, Berlin 2000. Sigfusdottir I D, Asgeirsdottir B B, Sigurdsson J F, Gudjonsson G H (2008): Trends in depressive symptoms, anxiety symptoms and visits to healthcare specialists: a national study among Icelandic adolescents. Scand J Public Health 36(4),361-8. 87 Soeder U, Bastine R, Holm-Hadulla R M: Empirische Befunde zu psychischen Beeinträchtigungen von Studierenden; in: Psychische Schwierigkeiten von Studierenden; hrsg. v. Holm-Hadulla R M; Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2001, 158-187. Sperling E, Jahnke J: Zwischen Apathie und Protest. Band 1 : Studentenprobleme und Behandlungskonzepte einer ärztlich-psychologischen Beratungsstelle; Hans Huber, Bern 1974. Spitznagel A: Prüfungsangst - Fragebogen. Unveröffentlicht, Göttingen 1968. Stabsstelle Controlling: Beschäftigte Personenzählung an der Georg-August Universität Göttingen seit 2001 (mit Medizin), Göttingen erstellt am 16.02.2010. Stork J: Fragebogen zur Beurteilung der Suizidgefahr: FBS; Müller, Salzburg 1972a. Stork J: Fragebogen zur Beurteilung der Suizidgefahr: FBS; 2. überarbeitete Auflage; Müller, Salzburg 1972b. Studentenwerk Göttingen: Die soziale Lage der Göttinger Studierenden. Sonderauswertung für den Hochschulstandort Göttingen 18. Sozialerhebung 2006, Göttingen 2008. Taliaferro L A, Rienzo B A, Pigg R M Jr, Miller M D, Dodd V J. (2009): Associations between physical activity and reduced rates of hopelessness, depression, and suicidal behavior among college students. J Am Coll Health 57,427-36. Taylor C: Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität. Suhrkamp, Fankfurt/M. 1994. Teuwsen E (1990):Autonomie und Trennungsdynamik bei Studierenden. Psychother Psychosom Med Psychol 40, 432-440. Teuwsen E: Tätigkeitsbericht Zürich. Psychologische Beratungsstelle für Studierende beider Hochschulen. Zürich 1992. Universität Göttingen: Studentenstatistik. Sommersemester 1981 und WS 1981/82; Stabsstelle DV der Zentralverwaltung der Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen 1982. Universität Göttingen: 250 Jahre Georg-August-Universität Göttingen, Studentenzahlen 1734/37 – 1987; hrsg. v. der Präsident der Georg-August-Universität, Dezernat für Planung und Statistik, Göttingen 1987. Universität Göttingen Studentenstatistik. Sommersemester 1990 und WS 1990/91; Stabsstelle DV der Zentralverwaltung der Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen 1991. 88 Universität Göttingen: Studentenstatistik. SS 2000 und WS 2000/01; Stabsstelle DV der Zentralverwaltung der Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen 2001. Vázquez F L, Blanco V (2008): Prevalence of DSM-IV major depression among Spanish university students. J Am Coll Health 57(2),165-71. Wittchen H-U, Nelson C B, Lachner G (1998): Prevalence of mental disorders and psychosocial impairments in adolescent and young adults. Psychol Med 28, 109-126. Woeller F: Psychische Störungen bei Studenten und ihre sozialen Ursachen; Beltz, Weinheim und Basel 1978 89 9 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Anzahl der neuangemeldeten Patienten innerhalb der 4 Kohorten 16 Abbildung 2: Geschlechterverteilung der Beratungsstelle pro Kohorte 18 Abbildung 3: Aufteilung der Studierenden der Gesamtuniversität nach Geschlecht 19 Abbildung 4: Aufteilung der Klienten nach der sozialen Schicht des Vaters 20 Abbildung 5: Soziale Schicht der Eltern Göttinger Studierender 22 Abbildung 6: Mittelwerte der Semesteranzahl innerhalb der 4 Kohorten im Vergleich mit der Gesamtuniversität 23 Abbildung 7: Prozentualer Anteil der Langzeitstudierenden innerhalb der 4 Kohorten im Vergleich mit der Gesamtuniversität 24 Abbildung 8: Klienten aufgeteilt nach Fakultätszugehörigkeit 30 Abbildung 9: Studierende der Georg-August- Universität aufgeteilt nach Fakultätszugehörigkeit 30 Abbildung 10: Art der Studienwahl der Klienten innerhalb der vier Kohorten 31 Abbildung 11: Gießen-Test- Profilblatt der 4 Kohorten aus Mittelwerten 33 Abbildung 12: Äußerungen zur Berufsperspektive innerhalb der Kohorten 36 Abbildung 13: Therapeuteneinschätzung zur Symptomatik der Körpersphäre innerhalb der vier Kohorten 39 Abbildung 14: Therapeuteneinschätzung zur Symptomatik im Leistungsbereich innerhalb der vier Kohorten 40 Abbildung 15: Therapeuteneinschätzung zur Symptomatik im sozialen Bereich innerhalb der vier Kohorten 41 Abbildung 16: Therapeuteneinschätzung zur psychischen Symptomatik innerhalb der vier Kohorten 43 90 10 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Alter in Jahren der Patienten (Mittelwert) 17 Tabelle 2:Geschlechterverteilung innerhalb der vier Kohorten 18 Tabelle 3: Soziale Schicht des Vaters der Klienten innerhalb der vier Kohorten (in Prozent) 20 Tabelle 4: Mittelwert und Standardabweichung der Anzahl der Hochschulsemester der Klienten innerhalb der vier Kohorten 23 Tabelle 5: Anzahl der Langzeitstudierenden unter den Klienten innerhalb der vier Kohorten 25 Tabelle 6: Klientel der Beratungsstelle aufgeteilt nach Fakultätszugehörigkeit in Prozent 29 Tabelle 7: Gießen-Test- Auswertung innerhalb der vier Kohorten 33 Tabelle 8:Mittelwert und Standardabweichung von Prüfungsangst innerhalb der Kohorten 34 Tabelle 9: Mittelwert und Standardabweichung Fragebogen zur Suizidalität 34 Tabelle 10: Mittelwert und Standardabweichung der wöchentlichen Arbeitszeit pro Kohorte 35 Tabelle 11: Mittelwert und Standardabweichung der Therapeuten-Prognosen 37 Tabelle 12: Symptomzuschreibung von Therapeuten nach Erstgespräch 44 91 Danksagung Mein Dank gilt Herrn Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. G. Reich für die Vergabe des Themas, die gute Betreuung und die Arbeitsmöglichkeiten in seiner Abteilung. Zudem danke ich Frau Dr. med. A. Mangholz und Herrn Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. M. Kuda für die stetige Gesprächsbereitschaft und fachlich inspirierende Unterstützung, besonders im schriftlichen Teil der Arbeit. Auch danke ich ihnen für die sehr zügige Durchsicht meines Manuskriptes und die konstruktiven Anregungen. Sie verstanden es, auch in schwierigen Arbeitsabschnitten, für den Erhalt meiner Motivation zu sorgen. 92