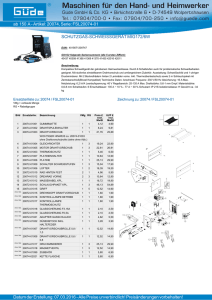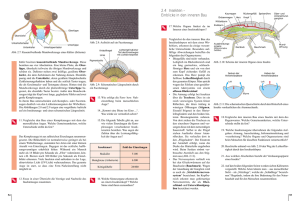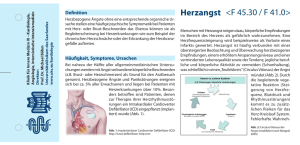Sinnesleistungen bei Tieren
Werbung

Kantonsschule Kreuzlingen Klaus Hensler 11.10 Sinnesleistungen bei Tieren 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Akkommodation .............................................................................................. Die Entwicklung zum Linsenauge ................................................................. Das Auge der Vögel ...................................................................................... Besonderheiten bei Vögeln ........................................................................... Die Augen von Oberflächenfischen ................................................................ Die Augen der Tiefseefische .......................................................................... Sehen und Tarnung bei Tintenfischen ........................................................... Beispiele für spezielle Linsenaugen bei Nicht-Wirbeltieren (Invertebraten) ... Linsenaugen und das Sehen der Spinnen ..................................................... Das Sehen mit Facettenaugen ...................................................................... Temperaturwahrnehmung – Beispiele ............................................................ Infrarotrezeption ............................................................................................ Chemische Sinne – Allgemeines .................................................................... Riechen bei den Insekten .............................................................................. Chemische Kommunikation der Insekten ...................................................... Die geruchliche Kommunikation bei Insekten ................................................ Mechanische Wahrnehmung bei Spinnen ..................................................... Das Seitenliniensystem von Fischen .............................................................. Die Ortung von Beute anhand von Oberflächenwellen .................................. Beispiele für die Kommunikation über den Boden (seismische Signale) ....... Elektrorezeption ............................................................................................. Kommunikation und Ortung mit elektrischen Feldern .................................... 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 2 Sinnesleistungen bei Tieren – optisch Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 3 Sinnesleistungen bei Tieren – optisch 4 Sinnesleistungen bei Tieren – optisch 1. Akkommodation Zweck des dioptrischen Apparates ist es, auf der Netzhaut ein scharfes Bild des Sehfeldes entstehen zu lassen. Für parallele Lichtstrahlen, ausgehend von entfernten Gegenständen, muss daher die Retina in der Bildebene der Dioptrik liegen. Für näherliegende Gegenstände würde die Bildebene aber aus dem Auge herauswandern. Durch eine Erhöhung der Brennweite können auch nahe Gegenstände auf der Retina scharf abgebildet werden, das Auge akkommodiert auf unterschiedliche Blickentfernungen. Die Gesamtbrennweite des Auges wird variiert durch: • Verschieben der Linse, • Veränderung des Krümmungsradius der Linse. In Ruhe sind die Augen auf diejenige Sehentfernung scharf eingestellt, die bei der Lebensweise . des Tieres vorherrscht, bei vielen Säugetieren und beim Menschen z.B. auf Ferne, bei Knochehfischen dagegen auf Nähe. Tiere mit kurzbrennweitigen Augen erzielen Netzhautbilder hoher Tiefenschärfe, ihr Akkommodationsbedarf hält sich daher in Grenzen. Bei den einzelnen Tierklassen gibt es unterschiedliche Akkommodationsmechanismen (Abb. 9.24): Die Augen der primitiven Rundmäuler, Cyclostomen, sind in Ruhe auf Nähe eingestellt. Bei Fernakkommodation drücken die Tiere mit einem Corneamuskel die Hornhaut nach hinten und schieben so die Linse näher an die Retina heran. Die Selachier dagegen haben als Raubfische Augen, die in Ruhe auf Ferne eingestellt sind. Durch die Kontraktion eines Ziliarringmuskels, der die Linse an ihrem Platz hält, wird die Linse nach vorne gedrückt und so auf Nähe fokussiert. Knochenfische akkommodieren auf Ferne mit Hilfe des Musculus retractor lentis, der die Linse zur Retina hin und etwas nach unten zieht. Damit wird eigentlich nur die ventrale Retinahälfte fern-akkommodiert, die das obere Sehfeld abbildet. Fische haben· meist Kugellinsen und damit keine definierte optische Achse, so dass Licht aus allen Richtungen des Sehfeldes gleich gut abgebildet wird. Schildkröten, Schlangen, Echsen Vögel haben Augen, die in Ruhe auf Ferne eingestellt sind. Sie akkommodieren auf Nähe, indem sie die Linse mit den Ziliarmuskeln nach vorne drücken und dabei so verformen, dass sich der Krümmungsradius der Linsenvorderfläche verkleinert. Das in Ruhe auf Ferne eingestellte Auge der Säuger hat einen grossen Linsen-Krümmungsradius durch die straff gespannten Zonulafasern, welche die Linsenflächen flach halten. Kontrahiert sich der Ziliarmuskel, wird die Linse entsprechend ihrer natürlichen Elastizität runder, d.h. der Linsenradius wird kleiner und das Auge akkommodiert auf die Nähe. Schliesslich gibt es noch durch Schrägstellungen der Netzhaut die Möglichkeit, einen Teil der Retina permanent auf Ferne, den anderen auf die Nähe fokussiert zu halten. Bei Säugetieren haben Weidetiere, wie z.B. das Pferd, eine schräggestellte Retina, so dass deren obere Hälfte einen weiten und die untere einen kurzen Abstand zur Linse hat. Damit wird die Weidefläche nahfokussiert auf der dorsalen Retinahälfte abgebildet und das Sehfeld über dem Horizont fernfokussiert auf der ventralen. Im Prinzip entspricht das einer Verlaufsbrille für Altersweitsichtige. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 5 6 Sinnesleistungen bei Tieren – optisch 2. Die Entwicklung zum Linsenauge Unter dem evolutiven Druck zum Bildsehen organisieren sich bei den meisten Tieren die Photorezeptoren zu einer Retina. Diese zunächst epidermalen, photosensitiven Rezeptorenraster brauchen optische Abbildungsmechanismen, um eine passable räumliche Bildauflösung zu erreichen (Abb. 9.8). Photorezeptorflächen senken sich zu einer Grube ein (Grubenaugen), verengen sich zu einer Lochkamera, verschliessen sich mit einer hyalinen Epithelschicht zu einem Blasenauge und bilden schliesslich in der Blase noch eine Linse aus (Linsenaugen) (Abb. 9.9). In der Evolution des abbildenden Systems war die Entstehung der Linse ein wichtiger Fortschritt. Bei den Tintenfischen ist z.B. das Retinabild in der linsenlosen Lochkamera des Nautilus sechsmal dunkler als das im Linsenauge anderer Tintenfische. Je enger die Öffnung für eine bessere räumliche Auflösung gemacht wird, desto lichtschwächer wird das Auge. Linsen liefern dagegen gute räumliche Auflösung bei hoher Lichtstärke. Die Linsen vieler Wassertiere sind Kugellinsen, die den Durchmesser der Beugungsscheibchen minimieren. In der Regel liefert die Kugelform allein kein scharfes Retinabild, weil ihre Brennweite für den kurzen Abstand zur Retina zu lang ist. Dieses Problem löst die inhomogene Linse mit einem von der Linsenmitte zum Rand hin kontinuierlich absinkenden Brechungsindex von ca. 1,52 auf 1,4. Dieser Linsentyp, 1877 bei Fischen von Matthiessen entdeckt, vermindert die sphärische Aberration und wirft scharfe Bilder auf die Retina. Nach der “Matthiessen-Regel” entspricht die Brennweite solcher Linsen etwa dem 2,5-fachen Linsenradius. Die “Matthiessen-Linsen” liefern bei guter Lichtstärke eine hohe räumliche Auflösung. Dieser Linsentyp entstand wenigstens siebenmal unabhängig voneinander bei Fischen, Tintenfischen, Anneliden und vier verschiedenen marinen Gastropodengruppen. Landtiere mit Linsenaugen können die Cornea zur Lichtbrechung einsetzen. Etwa 2/3 der Brechkraft kommt von der Cornea, und die Linse dient in erster Linie zur Brennweitenanpassung (Akkommodation). Die sphärische Aberration solcher Cornea-LinsenSysteme kann auf drei Wegen korrigiert werden: • • Die Brechungsindices der Cornea verlaufen inhomogen, ähnlich wie bei einer Matthiessen-Linse. Solche Augen haben eine Hauptachse exzellenter räumlicher Auflösung und eine schlechter auflösende Peripherie. Nach diesem Prinzip sind die Augen des Menschen und von Tieren mit ausgeprägtem fovealern Sehen gebaut. Die Cornea bleibt unkorrigiert, und die Linse übernimmt diese Aufgabe. Dies ergibt eine akzeptable Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 7 • räumliche Auflösung über ein weites Gesichtsfeld (z.B. das Auge der Ratten). Eine zusätzliche konkave Linse auf der Retinaoberfläche direkt vor der Fovea vergrössert das Bild durch eine bis zu 50%ige Brennweitenverlängerung. So unterschiedliche Tiere wie Adler und Springspinnen sollen eine solche negative Linse haben. Beide müssen aus grosser Entfernung eine zur eigenen Körpergrösse relativ kleine Beute detektieren und präzise lokalisieren können. Tiere, die sowohl im Wasser als auch in der Luft gut sehen wollen, müssen sich etwas einfallen lassen. Pinguine und Seehunde haben plane Corneae, die wie Fensterscheiben wirken. Die ganze Brechkraft kommt von 8 der Linse. Tauchvögel verformen ihre Linsen, womit sie die Brennweite in einem weiten Bereich von ca. 80 Dioptrien akkommodieren können. Beim Tauchen zieht der Ziliarmuskel die Linse nach vorne, so dass sie durch den starren Irisring hindurchgedrückt wird und damit einen kleinen Krümmungsradius, also eine hohe Brechkraft, erhält. Stammesgeschichtlich interessant ist das Material, aus dem die glasklaren Linsen bestehen. Es handelt sich um ca. 10 hochkonzentrierte, lösliche Proteine, die Kristalline. Diese ähneln den stammesgeschichtlich sehr alten heat-shockProteinen. Neben den Kristallinen bestehen die Linsen der Wirbeltiere bis zu 40% aus Proteinen, die in anderen Geweben als Enzyme eingesetzt werden. Sinnesleistungen bei Tieren – optisch 3. Das Auge der Vögel Mit Ausnahme der Nachtraubvögel und einiger weniger anderer Arten sind Vögel tagaktive Tiere. Dementsprechend dominiert das Sehen die Sensorik. Die Vogelaugen sind die relativ grössten unter den Wirbeltieren und nehmen ca. 50% des Kopfvolumens in Anspruch, im Gegensatz zu nur 5% beim Menschen (Abb. 9.29 a). Kleine Eulen (Strix aluco) haben ein Auge, dessen optische Achse 4,5 mm länger ist als die des Menschenauges. Da bei Vögeln auch die Pupillen relativ weiter als bei Säugern sind, schneller reagieren und einen grösseren Dynamikbereich haben (bei Tauben kann die Pupille innerhalb von 1–2 s auf maximal 1/9 verengt werden), entsteht auf der Vogelretina ein lichtstarkes und sehr scharfes Bild. Singvögel und andere Vögel, die eine weite Umgebung nach Raubfeinden absuchen, haben flache Augen mit verkürzter optischer Achse (Abb. 9.29b). Dies entspricht einem Weitwinkelsystem mit grosser Tiefenschärfe und geringer räumlicher Auflösung. Raubvögel dagegen haben kugelige bis elongierte Augen mit hoher räumlicher Auflösung. Eulen und andere Nachtraubvögel besitzen typische, grosse Nachtaugen mit weiter Cornea und Pupille und grossen Kugellinsen, die hohe Lichtstärke bei guter räumlicher Auflösung liefern. Die grossen, seitlich stehenden Vogelaugen ergeben ein weites, hauptsächlich monokulares Sehfeld, das nahezu 360° umfassen kann. Nach vorne entsteht ein schmales binokulares Feld, das je nach Lebensweise durch nach vorne gestellte Augen oder durch Augenbewegungen erweitert sein kann (Abb. 9.30). Reiher und Störche haben für ihre gezielten Schnabelhiebe ein binokulares Sehfeld von ca. 25°. Bei Eulen, die bei Nacht auf die Stereopsis (s. S. 440) für die Entfernungsbestimmung zur Beute angewiesen sind, überlappen die Sehfelder beider Augen um nahezu 50° auf Kosten eines blinden, nach hinten gerichteten Sektors von 160° (Abb. 9.31). Das frontale, binokulare Sehfeld kontrolliert die Eigenbewegungen der Vögel und spielt deshalb unabhängig von seiner Ausdehnung für das Verhalten eine grosse Rolle. Vögel sehen den grössten Teil der Umgebung monokular und können die beiden Augen getrennt auf verschiedene Entfernungen akkommodieren. Die Augen können auch unabhängig voneinander bewegt werden, so dass z.B. ein Star mit einem Auge die Schnabelumgebung am Boden und mit dem anderen den Himmel kontrollieren kann. Der Sektor des Umfeldes, den Vögel in ihrem Sehfeld betrachten, hängt mit der Ernährungsweise zusammen. Vögel, die mit dem Schnabel gezielt auf die Beute zustossen, erfassen optisch das frontale Umfeld vom Zenith bis zu den Zehen, wobei ein meridianes Band binokular gesehen wird. Raubvögel, die ihre Beute mit ihren Klauen greifen, haben ein breites, binokulares Frontal-Sehfeld, das aber nahe Bereiche, z.B. den eigenen Schnabel, nicht mehr erfasst. Vögel, welche wie die Schnepfe die Beute unterm Laub ohne Sichtkontrolle suchen, können ebenfalls ihren eigenen, langen Schnabel nicht sehen. Durch eine entsprechende Augenstellung im Kopf ist das Sehfeld der Schnepfe nach oben gedreht und erfasst monokular das gesamte Luftfeld vorne und hinten über den ganzen 360°-Umfang (Abb. 9.30). Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 9 10 Sinnesleistungen bei Tieren – Augen 4. Besonderheiten bei Vögeln Doppelte Fovea bei Vögeln Die meisten Vögel haben eine höhere Photorezeptorendichte als die Säuger und der Mensch. Der Anteil der Rezeptortypen hängt von der Lebensweise ab und schwankt von einem Stäbchen/ Zapfen-Verhältnis von 89: 11 bei Eulen bis 11: 89 bei Schwalben. Unter den Zapfen kann der Anteil der Doppelzapfen (s. S. 467) bis zu 50% betragen. Während Säuger zwei bis drei verschiedene Farbzapfen haben, sind es bei Vögeln vier bis fünf. Die meisten Vögel haben zwei Foveae, eine temporale für das binokulare und eine zentrale für das monokulare Sehen (Abb. 9.31). Die temporale ist besonders ausgeprägt bei den Raubvögeln, die ihre Beute von Bäumen aus oder aus der Luft schlagen. Eulen, für die das binokulare Sehen für die Entfernungsbestimmung bei Nacht besonders wichtig ist, haben nur eine temporale, binokulare Fovea. Beim Flug fliesst das Sehfeld kontinuierlich von temporal nach nasal über die Retina, so dass das Bild der Umgebung mit wachsender Fluggeschwindigkeit immer rascher über die Netzhaut wandert. Um im Flug nicht nur eine verwischte Umgebung zu sehen, ist die zeitliche Flimmer-Verschmelzungs frequenz bei Vögeln mit mehr als 100 Hz wesentlich höher als bei Säugern (ca. 40-60 Hz). Ein Falke kann selbst im Sturzflug mit einer Geschwindigkeit von 67 m/s einzelne Objekte räumlich klar auflösen. Das Sehsystem der Vögel ist vor allem auf neuronaler Ebene weit weniger untersucht als das der Säuger, obwohl bei dieser Tierklasse durch das Fliegen dem Sehen bei der zeitlichen und räumlichen Auflösung und generell beim Farbensehen besondere Leistungen abverlangt werden. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 11 Das Sehen bei Wasservögeln Wasservögel müssen über und unter Wasser gut sehen können. Beim Eintauchen ins Wasser verliert aber die Cornea einen Grossteil ihrer Brechkraft. Einige Arten, wie z.B. die Pinguine, verringern diesen raschen Brechkraftwechsel dadurch, dass sie die Cornea nahezu plan machen. In Luft trägt damit die Cornea wenig zur Gesamtbrechkraft des Auges bei, und in beiden Medien wirkt sie eher wie eine Fensterscheibe. Viele Tauchvögel kontrahieren beim Eintauchen ins Wasser den breiten Ziliarmuskel, wodurch die weiche Linse durch die Pupille nach vorne gedrückt wird und eine stärkere Krümmung erhält. Damit lässt sich in weniger als einer Sekunde die Brechkraft der Linse erhöhen. Ein besonderes Problem haben Reiher zu lösen, die ins Wasser schauend mit ihrem Schnabel gezielt eine Beute unter Wasser treffen müssen. Durch die Lichtbrechung an der Wasser-/Luftgrenze wird ein Objekt im Wasser an einer scheinbaren und nicht an seiner realen Position gesehen, wie Abb.9.32 zeigt. Für den Reiher ergibt sich ab einem bestimmten Augenabstand zur Beute im Wasser ein linearer Zusammenhang zwischen gesehener und realer Objektposition: reale Objekttiefe = 1,4 . scheinbare Objekttiefe -1,7 12 Sinnesleistungen bei Tieren – optisch 5. Die Augen von Oberflächenfischen Anableps, das Vierauge Wenn ein Fischauge an die Luft kommt, wird es durch die zusätzliche Brechkraft der Cornea extrem kurzsichtig. Das ist ein Problem für solche Fische, die sich dicht an der Wasseroberfläche halten und dort optisch nach Beute suchen. Das Vierauge, Anableps anableps, lebt im Brackwasser der Neotropen und ernährt sich vorwiegend von Insekten der Wasseroberfläche (Abb.9.28). Mit der oberen Augenhälfte schaut der Fisch direkt über den Wasserspiegel, während die untere im Wasser bleibt und nach unten schaut. Durch horizontale Irislappen wird verhindert, dass Streulicht von der Wasseroberfläche das Luftsehen stört. Dadurch wird die Pupille zweigeteilt, wodurch der Eindruck von jederseits zwei Augen entsteht. Die der Luft ausgesetzte Corneahälfte ist nur flach gekrümmt, erzeugt also wenig Brechkraft. Die ovale Linse kehrt dem Licht von der Wasseroberfläche ihre flache, dem Wasser ihre stark gekrümmte Seite zu. Durch die unterschiedlichen Krümmungsradii von Linse und Cornea entsteht für den dioptrischen Apparat über und unter Wasser eine ähnliche Brechkraft von 172 Dioptrien für das dorsale und 180 Dioptrien für das ventrale Auge. Die den Bereich über dem Wasserspiegel abbildende, ventrale Retina enthält doppelt so viele Zapfen wie die dorsale und erfährt eine geringere neuronale Konvergenz (5–12 Ganglienzellen pro 100 µm gegenüber 3–7 Ganglienzellen pro 100 µm in der dorsalen Retinahälfte). Andere Fischarten, die zeitweise über dem Wasser leben, z.B. Fische, die einen Teil des Tages in Felsnischen der Spritzzone zubringen, haben die Cornea zu Fensterscheiben abgeflacht. Die Cornea erzeugt keine Brechkraft mehr und dient nur noch zum Schutz des Auges. Fliegende Fische, die sich auf der Flucht aus dem Wasser katapultieren und weite Strecken in der Luft segeln können, haben Corneae, die wie dreiseitige Pyramiden geformt sind (Abb. 9.28c). Die Vorderseite schaut nach vorne oben, die Hinterseite überwacht den hinteren Luftraum gegen Raubvögel und die Unterseite der Cornea schaut nach unten auf das Wasser. Alle drei Flächen erzeugen auf der Retina ein passabel fokussiertes Bild. Abb. 9.28c Die dreiseitige Pyramidenform der Corenea bei fliegenden Fischen Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 13 Die Stielaugen des Sandfisches Wenn genügend Helligkeit zur Verfügung steht, kann man das Problem höchster räumlicher Auflösung im optischen Zielgebiet bei maximalem Sehfeld auch ganz anders lösen. Der ca. 5 cm lange Sandfisch Limnichthytes fasciatus lebt im gut durchleuchteten Flachwasser, gräbt sich in den Sand ein, so dass nur die nach oben stehenden Augen herausschauen. Wie ein Chamäleon kann dieser Fisch die Augen unabhängig voneinander in jede beliebige Richtung drehen (Abb. 9.27). Hat der Fisch eine geeignete Beute erspäht, schiesst er aus dem Sand hervor, reisst aus ca. 20 cm Entfernung sein grosses Maul auf und zieht mit dem Wassersog die Beute herein. Für diese gezielte Saugaktion braucht der Fisch eine genaue optische Entfernungsbestimmung. Diese Genauigkeit erreicht der Fisch durch ein teleskopartiges Zweilinsensystem für die foveal abgebildete Vorausrichtung (Abb. 9.27). Gegen alle Regel bei Fischen ist die Linse nicht kugelig, 14 sondern oval geformt, und die verdickte Cornea bildet eine zusätzliche Cornealinse aus mit einer Brechkraft von 200 Dioptrien. Zusammen mit der Linsenbrechkraft (500 Dioptrien) entsteht für die Hauptachse des Auges auf der Fovea ein vergrössertes Bild hoher Ortsfrequenz. Mit Cornealinse und ovaler Linse funktioniert das Auge sowohl als Zielfernrohr für foveales Hinschauen als auch als optisch gut korrigiertes Weitwinkelsystem, das den gesamten übrigen Sehbereich erfasst. Die Sandfische bestimmen die Entfernung zur Beute mit nur einem Auge. Ein besonderer Muskel kontrolliert den Krümmungsradius der Cornea. Damit kann ihre Brechkraft rasch verändert und die Optik auf unterschiedliche Sichtweiten fokussiert werden. Die Entfernung wird also aus der Scharfeinstellung der Optik und nicht, wie bei Säugern, aus binokulärer Triangulation ermittelt. Sinnesleistungen bei Tieren – optisch 6. Die Augen der Tiefseefische Für Tiere, die im Wasser leben, fällt die Cornea als lichtbrechende Fläche aus, weil ihr Brechungsindex sich kaum von dem des Wassers unterscheidet. Die Augenlinse liefert daher bei Fischen die ganze Brechkraft. Fischaugen zeichnen sich durch grosse Kugellinsen mit inhomogenen Brechungsindices (Matthiessen-Linse) aus, die über das ganze Sehfeld eine sphärisch gut korrigierte Abbildung hoher Helligkeit liefern. Die Netzhaut der Fische setzt sich aus Stäbchen, Zapfen und häufig noch aus Doppelzapfen zusammen, die ein differenziertes Farbensehen ermöglichen (s. S. 465). Fische haben vielfältige Adaptationsmöglichkeiten. Sie verfügen unter anderem über eine umfangreiche Retinomotorik, indem entsprechend der Hintergrundshelligkeit Pigmentgranula in den Pigmentzellen wandern und Sehzellen durch Myoide (Abb. 9.26) in das Pigmentepithel zurükkgezogen werden können. Erstaunlich viele Fische leben in Meerestiefen, in die kein Lichtstrahl oder nur noch spärliches Sonnenlicht vordringt. Die dunkle Welt solcher Fische ist optisch nicht oder nur noch schwach strukturiert. In der dunklen Tiefseewelt vermögen sie allenfalls kaum kontrastierende Umrisse und farbige Punkte zu sehen, die von den Leuchtorganen stammen, mit denen viele Tiefseeorganismen ausgestattet sind. In dieser zweidimensional erscheinenden, dunklen Sehwelt entsteht für räuberische Fische, die ihre Beute punktgenau lokalisieren müssen, ein Problem bei der Entfernungseinschätzung, weil wichtige Entfernungsmerkmale der Sehwelt wie relative Grösse, Teilverdeckung usw. fehlen. Tiefseefische brauchten daher lichtstarke, räumlich gut auflösende Augen (grosse Brennweite) mit einem binokularen Sehfeld, um aus der Augapfelkonvergenz die Entfernung des angepeilten Objekts bestimmen zu können. Solche Augen müssten so gross sein, dass sie im Kopf nicht mehr vernünftig unterzubringen sind. Mit der Entwicklung von Tubulusaugen (Abb. 9.25) haben sich die Tiefseefische insofern geholfen, als sie wenigstens für einen schmalen Voraussektor des Sehfeldes Binokularität mit einer grossen Brennweite verwirklicht haben. Dieses schmale binokulare Zielfeld wird auf der kleinen Hauptretina am Boden des Augentubulus fokussiert abgebildet. Das gesamte übrige Sehfeld wird von einer seitlich weit umgreif enden Cornea, in die oft ein transparentes Sklerasegment einbezogen ist, und der grossen Kugellinse im vorderen Drittel des Augentubulus erfasst und auf einer linsennahen akzessorischen Retina abgebildet. Diese Abbildung ist unscharf Und dient lediglich der optischen Überwachung der Umgebung. Dies ist der Preis, der für die Zielgenauigkeit in Vorausrichtung zu bezahlen ist. Die Netzhaut der Tubulusaugen ist in vielfältiger Weise an das spärliche Licht in der Tiefsee angepasst. Die Retinae bestehen fast nur aus Stäbchen mit sehr langen und dicht an dicht gepackten Aussengliedern und einem Sehpigment, das maximal im Blau bei 470–480 nm absorbiert. Bei einigen Arten sind die Aussenglieder der Stäbchen in bis zu sieben Lagen übereinandergeschichtet . Schliesslich reflektiert ein Tapetum lucidum Restlicht auf die Retina zurück. Bei Knochenfischen, z.B., lagert sich reflektierendes Material in die retinalen Pigmentzellen ein. Die Dichte der Ganglienzellen bestimmt die räumliche Auflösung des Auges. Sie ist im binokularen Sehfeld der Hauptretina 60-mal grösser als im peripheren. Beim Beilbauchfisch Argyropelecus, einem Räuber, der in 50–800 m Tiefe lebt, wurde eine maximale räumliche Auflösung von 6,6’ berechnet. Damit kann der Fisch zwei Punkte in 6 m Entfernung noch auflösen, wenn sie nur 1,13 cm voneinander entfernt liegen. Das Bestreben, trotz eingeengtem Sehfeld im Tubulusauge das gesamte Umfeld optisch beobachten zu können, hat nicht nur zu Nebenretinae, sondern bei einigen Fischen auch zur Entwicklung von Divertikelretinae und sogar Divertikelaugen geführt (Abb.9.25). Können Tiefseefische auch Farben sehen? Es gibt in der Regel wenige Zapfen, die stets im binokularen Retinafeld zu finden sind. Die Anzahl der Sehpigmenttypen schwankt bei Tiefseefischen von einem bis fünf. Eine Tiefseefischart hat z.B. in der Hauptretina zwei Sehpigmente mit Amax bei 507 und 445 nm, und in der Nebenretina drei mit Amax bei 503, 479 und 443 nm. Eine Fischart (Malacosteus spec.) trägt direkt unter den Augen ein Leuchtorgan, mit dem sie wie mit einem Scheinwerfer den Boden nach Krebsen absucht. Das Leuchtorgan strahlt ein Rot ab, das von Krebspanzern gut reflektiert wird, und die Fischretina besitzt ein Sehpigment, das maximal im Rotbereich absorbiert. Die Netzhaut ist noch von einem rotreflektierenden Tapetum hinterlegt. Bei der Vielzahl farbig leuchtender Biolumineszenzen in der Tiefsee ist Farbtüchtigkeit sicherlich von Vorteil, es gibt jedoch keine verlässlichen Untersuchungen hierzu. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 15 16 Sinnesleistungen bei Tieren – optisch 7. Sehen und Tarnung bei Tintenfischen Die räuberischen und schnellschwimmenden Tintenfische sind auf besonders gute Sehleistungen angewiesen. Ihr entwicklungsgeschichtlich ganz anders entstandenes Auge als das der Wirbeltiere weist zu diesem die funktionell vollkommensten Konvergenzen auf (Abb.9.15b). Unter anderem kann, wie bei Säugern, der Augapfel durch äussere Muskeln in einer Augenhöhle gedreht, die an einem Ziliarkörper aufgehängte Linse zur Scharfeinstellung des Retinabildes vor und zurückgeschoben und die Pupille durch einen Ringmuskel rasch zu einem schmalen Schlitz verengt werden. Embryonal entsteht das Auge aus einer Einstülpung des Ektoderms. An der Berührungsstelle zwischen eingesunkener Augenblase und dem Epithel bildet sich aus beiden Epithelien die Linse. Aus drei weiteren Ektodermfaltungen entstehen die Iris mit der Pupillenöffnung, die Cornea und die Augenlider. In der Retina werden die dicht an dicht gepackten rhabdomerischen Sehzellen (20000 Rhabdomere/mm2) durch Stützzellen, die eine innere und eine basale plane Membrana limitans unterhalb der Rhabdomere bilden, in einer streng geometrischen Ordnung gehalten, wobei die gegenständigen Rhabdomere der Sehzellen sich zu einem rechtwinkligen Schachbrettmuster der lichtsensiblen Mikrovilli zusammenfügen (Abb. 9.15c). Der Augapfel steht unter einem hohen Binnendruck, der von einer mechanisch festen, äusseren Bindegewebsschicht, der Sklera, aufgefangen wird. Zur Adaptation an unterschiedliche Helligkeiten tragen Pigmentwanderungen und eine Retinomotorik bei. In den Seh- und Stützzellen ist Pigmentgranula eingelagert, die bei hellem Licht linsenwärts wandert und so die einzelnen Sehzellen optisch abschirmt. Ausserdem kontrahieren sich die Sehzellen und ziehen sich in diese Pigmentschicht zurück. Die nervös gesteuerte Pupille kann auf rasche Helligkeitsänderungen reagieren. Ähnlich wie beim Menschen spiegelt die Pupillenweite aber auch Erregungszustände wider, so weitet sich die Pupille der Tintenfische bei Schreckreaktionen. Durch Linsenverschiebungen kann das Tintenfischauge Gegenstände aus verschiedener Entfernung auf der Retina scharf abbilden. Bei Fernakkommodation zieht die Kontraktion des Ziliarmuskels die Linse etwas zurück und bei Nahakkomodation kontrahieren sich äussere Augenmuskeln am Sklerarand. Sie flachen damit den Augapfel ab und schieben durch den erhöhten Binnendruck die Linse etwas von der Retina weg. Octopus kann aus Entternungen von ca. 2–4 m Entfernungsunterschiede von nur 5 cm im Simultanvergleich zwischen linkem und rechtem Auge erkennen. Es wird vermutet, dass die Tiere die Entfernung dem Akkommodationsgrad entnehmen, was bedeuten würde, dass Linsenverschiebungen von 10 µm registriert werden. Die rechtwinklige Anordnung der Mikrovilli und damit der Rhodopsinmoleküle in der Retina liess die Vermutung aufkommen, Tintenfische könnten polarisiertes Licht erkennen. Einige Verhaltenstests mit verschiedenen Tintenfischarten haben gezeigt, dass sie Muster polarisierten Lichts differenzieren können. Auch im Wasser ist das Licht, das von Objekten wie Fischen, Pflanzen, Krebsen etc. reflektiert wird, zu unterschiedlichen Graden polarisiert. Während sich die Farbigkeit von Objekten wegen der Blaufilterwirkung des Wassers mit der Wassertiefe ändert, bleibt das reflektierte Polarisationsmuster unverändert. Es könnte sich daher gut zur Objektunterscheidung in tieferen Meeresschichten eignen. . Eindeutige Beweise für die Objektunterscheidung und die optische Kommunikation mit polarisiertem Licht fehlen jedoch bislang. Die Sehleistungen sind in zahlreichen Verhaltenstests vor allem bei Octopus untersucht worden. Dieser Tintenfisch baut sich in 10–40 m Meerestiefe auf felsigem Grund eine Art Burg oder versteckt sich im Fels oder im Sand und wartet als Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 17 Wegelagerer auf vorbeischwimmende Beute. Dabei camoufliert er sich durch Farbanpassungen der Haut sehr genau in seiner Umgebung. Unter der Epidermis sitzen schwarze, gelbe und rotorange Chromatophoren, an denen neuronal gesteuerte Muskelfasern ansetzen (Abb. 9.17 a, b). Tintenfische können sich mit diesen neuro motorisch gesteuerten Chromatophoren einerseits perfekt an Helligkeit, Farbtönung und die optische Struktur der Umgebung anpassen, andererseits aber auch in Sekundenschnelle auffällige komplexe Hautzeichnungen erzeugen, die in Wellen über den Körper hinweglaufen und den Tintenfisch optisch herausheben. Diese Farb- und Musterwellen setzen die Tiere als Kommunikationsmittel in unterschiedlichen Verhaltenszusammenhängen bei der Jagd, Abwehr, allgemeiner Erregung oder bei Werbespielen zwischen den Geschlechtern ein. Die Steuerung der nahezu perfekten Anpassung an die optische Struktur der Umgebung ist bis heute ein Rätsel geblieben. Oktopus, der sich in Struktur und Farbe an seine Umgebung angepasst hat. Baby Oktopus, mit schwarzen und orangen Chromatophoren, 18 Sinnesleistungen bei Tieren – optisch 8. Beispiele für spezielle Linsenaugen bei Nicht-Wirbeltieren (Invertebraten) Pilgermuscheln (Pecten) Mollusken (Weichtiere) haben die unterschiedlichsten Lebensweisen entwickelt. Entsprechend weit gefächert reicht das Spektrum des Sehens von diffuser Lichtempfindlichkeit an den Mantelrändern und Siphonen bei Muscheln bis zu den leistungsstarken, bildsehenden Linsenaugen der Tintenfische. Die erstaunliche Vielfalt der Augen bei der kleinen Zahl untersuchter Arten lässt den Erfindungsreichtum erahnen, mit der dieser Tierstamm seine Lebensräume erobert hat. Zu Berühmtheit brachte es Pecten (Abb. 9.14), die zu den Kamm- und Pilgermuscheln gehört. Bei Beschattung – ihr ärgster Feind sind Seesterne –graben sich die Muscheln in den Sand ein oder schnellen sich durch Rückstoss (impulsartiges Schliessen der Schalen) über beachtliche Entfernungen aus der Gefahrenzone. Am Mantelrand sitzen zwischen den Tentakeln ca. 60 Linsenaugen mit jeweils Cornea, Pupille und Linse (Abb. 9.14a). Das Auge besitzt eine doppelte Retina, eine distale aus ziliären und eine proximale aus rhabdomerischen Photorezeptoren (Abb. 9.14b). Die Linse hat eine Brennweite von 1500 µm, dem steht ein Augendurchmesser von nur 1000 µm gegenüber. Somit kann auf der Retina keine optisch scharfe Abbildung entstehen. Pecten löst dieses Problem durch eine Spiegeloptik. Hinter der doppelten Retina ist aus Guaninplättchen und, mit dunklen Pigmentzellen hinterlegt, eine spiegelnde Argentea aufgebaut. Sie wirkt als Lamellenspiegel: Aufeinandergeschichtete Filme mit einer optischen Dicke (reale Dicke · Brechungsindex) von einem Viertel der Wellenlänge (A) des einfallenden Lichts reflektieren etwa 8% des Lichts. Setzt man mehrere solcher Filme in A/4 Schichten und A/4 Abständen übereinander, so kann man eine nahezu 100%ige kohärente Reflexion erzielen, allerdings nur für die Wellenlänge, die der Schichtdicke und den Schichtabständen entspricht. Schichtspiegel werden in der Teleskoptechnik als hochpolierte Metallspiegel exzellenter Güte eingesetzt. Ein solcher Lamellenspiegel stellt die Argentea von Pecten dar. Die Wellenlängenabhängigkeit soll dadurch kompensiert sein, dass die Schichtdicke und die Schichtabstände sich systematisch ändern, so dass letztlich wieder das ganze Spektrum, also weisses Licht, reflektiert wird. Die Argentea hat einen Radius von 410 µm, die Brennweite des Spiegels beträgt also 205 µm (bei Hohlspiegeln ist f = r/2). Er erzeugt in der Ebene der distalen Retina ein scharfes, inverses Bild, wie mikroskopische Bildaufnahmen gezeigt haben. Die Linse selbst ist nur mehr für eine Korrektur der sphärischen Aberration des Spiegels notwendig. Pecten besitzt also 60 gute Linsenaugen, jedes mit einer doppelten Retina und zwei getrennten Sehnerven ausgestattet, und jedes Auge verfügt über ein Sehfeld von 100°. Wieso Pecten in einem Biotop und bei einer Lebensweise, bei der andere Organismen mit einem Paar einfachen Augen auskommen, diese Information 60fach, und dabei auch noch doppelt benötigt, und wie diese sich überlappenden Sehinformationen aus den 60 Augen zu einem kohärenten neuronalen Bild der Umgebung zusammengefügt werden, wären lohnenswerte Fragen für eine vergleichende Neurobiologie. Oben: Schalen von Pilgermuscheln Unten: Augenreihen entlang der Schalenränder. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 19 Sinnesleistungen bei Tieren – optisch Wie augenlose Schlangensterne sehen Echinodermen haben keine Augen; man schrieb ihnen bisher einen diffusen Hautlichtsinn zu. Ophiocomiden, langarmige kleine Schlangensterne, leben im tropischen Flachwasser. Um den Raubdruck von Fischen zu mindern, verstecken sich die Tiere tagsüber in Fels- und Geröllspalten. Es gibt Schlangensterne, die auf Licht kaum reagieren und andere, die lichtempfindlich sind. Diese Arten meiden Licht und suchen den Schatten und dunkle Spalten auf. Schlangensterne schützen die Armgelenke mit dorsalen Armschilden, die aus maschenartigen Kalkspatkristallen (Stereomen) bestehen. Betrachtet man die Kalkschilde unter dem Mikroskop, so sieht man zwischen beiden Schlangensterngruppen einen feinen Strukturunterschied: während die Kalkoberfläche bei lichtunempfindlichen Arten die Struktur von Eierkartons hat, besteht sie bei einer lichtsensiblen Art (Ophiocoma wendti) aus einem Raster von 40–50 µm weiten Halbkugeln, welche die typische Struktur von Doppellinsen aufweisen (Abb. 9.8b,c). Im Experiment zeigt sich, dass jede dieser Kalkspatkugeln wie eine Mikrolinse wirkt und Licht auf Nervenfasern fokussiert, die längs der Arme genau in der Brennebene der Kalklinsen verlaufen. Neurophysiologische Versuche haben gezeigt dass diese Nervenfasern lichtempfindlich sind, wenngleich der direkte Nachweis von Photopigmenten in den Nervenbündeln noch aussteht. Der Öffnungswinkel der Mikrolinsen beträgt etwa 10°, so dass jede Linse der gewölbten Schildoberfläche in eine andere Richtung schaut. Optisch verhält sich jeder dorsale Armschild wie ein flach gewölbtes Facettenauge. Da die Schlangensterne auf jedem Arm mehrere dorsale Armschilde tragen und die fünf Arme beweglich sind, können sie ihre gesamte Umgebung optisch gut erfassen und aktiv in unterschiedliche Richtungen schauen. Im hellen Tageslicht bedecken Fortsätze von Chromatophoren die Linsen und adaptieren somit die Lichtempfindlichkeit der dorsalen Armschilde. Die Schlangensterne sehen daher bei Tag einheitlich braun aus. Bei Nacht ziehen sich die Chromatophoren zurück, und das Tier erscheint grau-schwarz gebändert. Dieser Adaptationsmechanismus und die optische Präzision der Mikrolinsen aus Kalkspat belegen, dass bei diesen Schlangensternen von einem primitiven Hautlichtsinn keine Rede sein kann. Das Beispiel der Linsenflächen auf den Armschilden von Schlangensternen zeigt eindrucksvoll, wie in der Evolution durch eine einzige, kleine Änderung, hier durch den Einbau der kugelförmigen Kalkspatkristalle, eine Skelett- und Schutzstruktur eine zusätzliche und gänzlich andere Funktion bekommen kann. 20 Sinnesleistungen bei Tieren – optisch 9. Linsenaugen und das Sehen der Spinnen Obwohl die Vorfahren der Spinnen noch ein Paar Facettenaugen und ein Paar Ocelli (Linsenaugen) hatten, besitzen die rezenten Spinnen nur noch Linsenaugen, ein Paar nach vorne schauende Hauptaugen, mit denen die Beute im Nahfeld lokalisiert und fixiert wird, und zwei bis drei Paar Nebenaugen, die zur Detektion und zur allgemeinen Orientierung nahezu das gesamte Umfeld erfassen (Abb.9.19a,b). Die vorderen Nebenaugen (antero-lateral) schauen nach vorne unten, die posteromedianen nach oben und die postero-lateralen seitlich und nach hinten. Bei den tagaktiven Springspinnen (Salticidae), die ihre Beute gezielt anspringen, dominieren die Hauptaugen, während bei den Nachtjägern (Dinopidae) und den Wolfsspinnen (Lycosidae), die herumschweifend jagen, die nach hinten bzw. zur Seite schauenden Nebenaugen besonders gross sind. Die Retina der Nebenaugen ist mit einem mehrschichtigen Tapetum aus Guaninkristallen (Dicke pro Schicht 100 nm) hinterlegt, das als farbselektiver Interferenzspiegel vor allem grün reflektiert. Mit den Nebenaugen entdeckt die Spinne in einem weiten Sehfeld Beute, die sich bewegt. Die Spinne dreht sich, bis das Objekt von den Hauptaugen erfasst wird, die den Sehgegenstand identifizieren und lokalisieren. Spinnen sind kleine Tiere, und entsprechend klein fallen die Linsenaugen aus. Daraus entsteht ein Problem, weil die Lichtempfindlichkeit und das räumliche Auflösungsvermögen von der Augengrösse abhängen. Wenn ein Auge hohe räumliche Auflösung braucht (grössere Brennweite, kleiner Rezeptorabstand), muss es Lichtempfindlichkeit aufgeben und umgekehrt. Beides zusammen ist nur mit grossen Augen zu haben. Je nach Jagd- und Lebensweise sind die Augen der Spinnen auf eine der beiden Sehfunktionen optimiert. Das zeigt sich schon in der Netzhautstruktur. Die Retinae bestehen aus etwa 1000–10 000 rhabdomerischen Sehzellen, Wie schon erwähnt, ist hohe räumliche Auflösung mit guter Lichtempfindlichkeit nur mit grossen Augen zu haben. Die teleskopartigen Hauptaugen der Springspinnen sind eigentlich solche grossen Augen, die aus Platzmangel in dem kleinen Prosoma auf ein schmales Segment mit einem engbegrenzten 0 Blickwinkel von nur 4–5 reduziert wurden (Abb.9.19b). Zum Ausgleich für diesen Sehfeldverlust kann die schmale, hantelförmige Retina durch sechs Muskeln bewegt werden und damit interessierende Objekte im vorderen Blickfeld der beiden anterolateralen Augen durch horizontale und vertikale Retinabewegungen optisch abtasten. Portia erreicht seine perfekte räumliche Auflösung durch schmale Sehzellen mit einem Durchmesser von nur 1,4 µm und einer Brennweite von 2 mm, obwohl die Linse selbst nur eine Brennweite von 1,27 mm aufweist. Vor der Retina gibt es jedoch noch eine lichtbrechende, konkave Fläche, die als zweite, negative Linse die Brennweite verlängert. Nach diesem Prinzip, mit einer positiven und einer räumlich davon getrennten negativen Linse, werden auch die Telelinsen für Photoapparate gebaut. Je nach Grösse der Hauptaugen bei verschiedenen Arten liegt die maximale räumliche Auflösung zwischen 2,3 und 5,6’. Arten, die im Wald leben, erreichen in den Hauptaugen nur noch Auflösungen von 5,8–17’, aber eine höhere Empfindlichkeit. Das Verhalten der Springspinnen ist weitgehend visuell gesteuert. Die lateralen Nebenaugen dienen als Bewegungsdetektoren in einem weiten Sehraum. Die vorderen Nebenaugen kontrollieren das Jagdverhalten, wobei die beiden Hauptaugen innerhalb des Sehfelds der vorderen Nebenaugen das Nahfeld bedienen. Sie leisten die Objektunterscheidung und steuern die Zupackmanöver. Bewegt sich etwas irgendwo im Gesamtsehfeld, so orientiert sich die Spinne auf das Objekt zu, wenn es sich schnell bewegt und nicht doppelt so gross wie die Spinne selbst ist. Sich schnell nähernde Objekte lösen Flucht aus. Die Hauptaugen verfolgen (trakking) das Objekt, die Jagd wird jedoch von den vorderen Nebenaugen aus gesteuert, die nach vorne ein binokulares Sehfeld bilden. Das Objekt wird im binokularen Sehfeld gehalten und die Entfernung zur Spinne bestimmt. Erst im Nahfeld wird mit Hilfe der Abtastbewegungen der Retinae in den Hauptaugen das Objekt identifiziert und als potentielle Beute, oder aber als Partner klassifiziert. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 21 22 Sinnesleistungen bei Tieren – Augen 10. Das Sehen mit Facettenaugen Sowohl so grosse Tiere wie Elefanten als auch so kleine wie Spinnen kommen mit einem Linsenauge zurecht. Wieso gibt es dann bei Arthropoden ein ganz anders gebautes Auge, das zusammengesetzte Facettenauge, das aus vielen gleichartigen Einzelaugen, den Ommatidien, besteht? Kleine Tiere haben ein Problem, weil die wichtigsten Leistungsparameter des Auges, hohe Lichtempfindlichkeit und gute räumliche Auflösung, mit der Grösse des Auges korrelieren. Bei kleinen Linsenaugen wird die Augengrösse genauso wie bei Facettenaugen weitgehend von der Länge der Sehrezeptoren bestimmt (Abb. 9.101d). Bei gleicher Leistungsfähigkeit muss das Linsenauge durch eine kleine Linse das gesamte Sehfeld erfassen, mit dem Ergebnis, dass nur das mittlere Sehfeld scharf gesehen wird, die seitlichen Gebiete aber, wegen der unumgänglichen Abbildungsfehler an den Rändern einer Linse, weniger scharf sein werden. Dieses Problem haben Facettenaugen nicht, weil sie das gesamte Sehfeld mit einem Satz von Einzelaugen abbilden, mit einer Vielzahl von Linsen gleicher Qualität also, die das periphere Sehfeld genauso gut darstellen wie seine Mitte. Das Facettenauge liefert bei gleich kleiner Augengrösse das bessere Gesamtbild als das Linsenauge. (Spinnen mit ihren Ein-Linsen-Augen lösten das Problem, indem sie mehrere Augenpaare in unterschiedliche Richtungen schauen lassen) Nur für kleine Augen ist das Facettenauge eine gute Lösung. Aufgrund ihrer Grösse sind die Linsenaugen der Wirbeltiere erheblich leistungsfähiger. Das menschliche Auge erreicht z.B. eine räumliche Auflösung von 10–2 Winkelgraden, eine Fliege aber nur von 2°. Die schlechtere Sehschärfe kleiner Tiere bleibt allerdings bedeutungslos, weil kleine Tiere nur einen engen Aktionsraum abbilden müssen und daher kleine Objekte in relativer Nähe genauso gut auflösen wie grosse Tiere mit ihrem viel grösseren Aktionsradius entferntere, grössere Gegenstände. Ommatidien Die Facettenaugen bestehen aus gleichartigen Einzelelementen, den Ommatidien (Abb. 9.101b). Jedes Ommatidium hat einen eigenen dioptrischen Apparat. Er besteht aus einer cuticulären, extrazellulären Cornealinse mit hohem Brechungsindex von ca. 1,5 und aus einem von vier Zellen gebildeten Kristallkegel. Der Kristallkegel kann als Linsenzylinder ausgebildet sein, der den Strahlengang modifiziert, oder optisch homogen sein und lediglich als Glaskörper wirken (Abb. 9.104). Jedes Ommatidium enthält kreisförmig angeordnet meist 7–9 (maximal 12) langgestreckte Retinulazellen, deren rhodopsinhaltige Rhabdomere nahe der Längsachse des Ommatidiums angeordnet sind. Die Gesamtheit dieser Rhabdomere bezeichnet man als Rhabdom. Bei den meisten Insekten liegen die Rhabdomere so eng aneinander, dass sie funktionell einen gemeinsa men Lichtleiter, das fusionierte Rhabdom, bilden. Bei Crustaceen sind die Rhabdomere sogar ineinandergeschachtelt. Der gemeinsame Lichtleiter führt jedoch nicht zu einer gemeinsamen Erregungsbildung. Jede Retinulazelle erzeugt ihre eigene Erregung und leitet sie über ihr Axon ins ZNS. Da die Rhabdomere Rhodopsine unterschiedlicher Absorptionsspektren enthalten, ermöglicht schon das Einzelommatidium eine Farbanalyse. Jedes Ommatidium wird optisch von seinen Nachbarn durch Pigmentgranula in den Retinulazellen und durch drei Typen von Pigmentzellen abgeschirmt. Augentypen Die in ein Ommatidium einfallenden Lichtstrahlen bilden auf das distale Ende des lichtleitenden Rhabdoms einen Lichtpunkt ab, und die Gesamtheit der Ommatidienausgänge stellt eine konvexe Retina dar, die ein aufrechtes Bild liefert. Die Körnigkeit dieses Gesamtbildes hängt von der Anzahl von Ommatidien und deren Winkel zueinander, dem Interommatidienwinkel ab (Abb. 9.101c). Die Anzahl der Ommatidien korreliert mit der Grösse des Tieres und hängt von den Anforderungen an das Sehen im Verhalten ab. Bei Libellen bilden bis zu 30000 Ommatidien ein Facettenauge; die sich optisch orientierenden Bienen und Wespen rastern ihre Umgebung mit 4000–5000, Ameisen mit maximal 1200 Ommatidien. Bei intraspezifischem Polymorphismus wächst die Ommatidienzahl mit der Körpergrösse: kleine Ameisen, die Innendienste im Nest leisten, kommen mit 600 Ommatidien aus, während ihre grösseren Nestgenossen, die zur Futtersuche ausschwärmen, doppelt so viele besitzen. Wie beim Linsenauge müssen auch beim Facettenauge zwei sich widersprechende Leistungsanforderungen, Sehschärfe und Empfindlichkeit, gegeneinander abgewogen werden. Hohe Lichtausbeute verlangt einen breiten Öffnungswinkel (∆r in Abb. 9.101c). Er gibt den Lichteinfallswinkel relativ zur Ommatidienachse an, bei der die Empfindlichkeit des Rhabdoms auf 50% gesunken ist. Grosse Corneadurchmesser und viel Rhodopsin, also dicke Rhabdome, erhöhen die Sehkraft. Das bringt weite Interommatidienwinkel ∆F und damit eine schlechte räumliche Auflösung mit sich. ∆F hängt vom Facettendurchmesser und dem Augenradius ab: ∆F = D/R D: Corneadurchmesser, R: Augenradius (Abb. 9.101c). Ein hochauflösendes Facettenauge verlangt also möglichst lange (R) und schmale (D) Ommatidien, was deren Lichtempfindlichkeit schmälert. Allerdings ist der Verschlankung der Ommatidien zugunsten der Sehschärfe aus zwei Gründen eine absolute Grenze gesetzt: Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 23 Abb. 9.101 a–d. Das Facettenauge der Insekten. a Schematisches Blockbild eines Facettenauges mit gleichförmigen Ommatidien. b Der Aufbau eines Ommatidiums im Längsschnitt. Darunter: Die Anordnung der Retinulazellen eines nicht fusionierten Rhabdoms im Querschnitt. c Die wichtigsten optischen Eigenschaften eines Facettenauges. d Der Vergleich zwischen Facettenauge und Linsenauge ungefähr gleicher Grösse. Von rechts stellt der Halbkreis ein Facetten-, von links ein Linsenauge dar mit gemeinsamer Rezeptorzone (dunkelblau). Was das Linsenauge mit einer einzigen kleinen Linse abbildet, bildet das Facettenauge mit vielen Linsen ab. a Aus Czihak 1981, b nach Gardiner 1972, d nach Kirschfeld 1976. • Jeder Lichtpunkt wird durch die Linsen als Beugungsscheibchen abgebildet, dessen Durchmesser zunimmt, wenn der Corneadurchmesser verringert wird. Die optisch mögliche Grenze ist etwa bei einem Corneadurchmesser von 0,5° erreicht. Im Mittel betragen die Interommatidienwinkel 1–3° (0,7° bei Libellen, bis 7° bei bestimmten Käfern), und die Rhabdome sind durchschnittlich 100 µm lang. Bei dieser Länge werden beim Absorptionsmaximum des Sehfarbstoffs etwa 50% der einfallenden Lichtquanten absorbiert, 100% würden erst bei einer Länge von 1 mm erreicht. 24 • Wie schon betont, sind die Rhabdome Lichtwellenleiter, je dünner diese Lichtleiter sind, desto mehr Lichtenergie fliesst nicht im Leiter, sondern ausserhalb des lichtabsorbierenden Rhabdoms. Um diesem Effekt zu entgehen, sollten die Rhabdome nicht dünner als 1 µm sein. Tatsächlich beträgt der Rhabdomquerschnitt nie weniger als 2–3 µm; was auch dem der Aussenglieder von Stäbchen und Zapfen entspricht. Sinnesleistungen bei Tieren – Temperatur 11. Temperaturwahrnehmung – Beispiele Allgemeines Temperaturrezeptoren bei Wirbeltieren Alle Lebensvorgänge sind temperaturabhängig. Temperatursensoren vermitteln Informationen über die eigene Körperwärme und die Aussentemperaturen. Wirbeltiere besitzen auf der Haut und im Körperinnern (z.B. in Wänden von Blutgefässen) Kälte- und Wärmerezeptoren, die auf entsprechende Abweichungen von einer Indifferenztemperatur (z.B. bei menschlicher Haut ca. 30 °C) mit erhöhten Entladungsraten antworten. Bei den Temperaturrezeptoren handelt sich um freie Nervenendigungen, die auf der Haut unmittelbar unter oder in der Epidermis kleine rezeptive Felder bilden. Ihr Arbeitsbereich liegt zwischen 5–10 °C und 45 °C. Bei Arthropoden sitzen die Kälte- und Wärmesensoren als einzelne Sinneszellen, verschwistert mit einem Hygro-, Mechano- oder Geruchsrezeptor, in der Basis porenloser Sensillen. Schon Einzeller können anhand von Temperaturgradienten einen für sie günstigen Temperaturbereich aufsuchen (Thermotaxis). Parasitische Nematoden finden warmblütige Wirte u.a. durch Wärmegradienten von nur 0,02 °C/cm. Infektiöse Stadien des Hunde-Hakenwurms (Ancylostoma canium) richten ihre Vorderenden auf und bewegen sie suchend hin und her, wenn sie durch Bodenvibrationen erregt werden. Sie heften sich an Hundehaaren fest und wandern entlang des Wärmegradienten zur Haut, die sie durchbohren, um schliesslich in der Darmschleimhaut Blut zu schmarotzen. Kälte- und Wärmerezeptoren der Wirbeltiere kodieren nicht die absolute Temperatur, sondern negative bzw. positive Abweichungen von der art-bzw. organspezifischen Soll- oder Indifferenztemperatur, die zentralnervös kontrolliert werden kann. Die Rezeptoren sind spontan aktiv, antworten auf Temperaturänderungen phasisch mit hoher Empfindlichkeit und adaptieren rasch und lang anhaltend. So, wie die Netzhaut lokale Helligkeitsänderungen durch On- und Off-Kanäle kodiert, werden Temperaturänderungen sowohl von Kälte- als auch Wärmerezeptoren rezipiert (Abb. 3.2). Solche push-pull-Systeme erhöhen die Empfindlichkeit für kleine Reizänderungen. Das interne, thermische Rauschen in Thermorezeptoren ist mit 10–6 °C extrem niedrig, was eine hohe Empfindlichkeit zulässt. Temperaturänderungen von nur 0,1 °C (Mensch) können wahrgenommen werden. Da Wärme im Cytoplasma langsam diffundiert und Thermorezeptoren oft einige 100 µm unter der Körperoberfläche liegen, verläuft Thermorezeption langsam. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 25 Sinnesleistungen bei Tieren– Temperatur Käfer, die auf Waldbrände spezialisiert sind Unter den Prachtkäfern gibt es eine Gattung, Melanophila, die von Waldbränden aus einem Umkreis von bis zu 50 km angezogen werden. Diese Käfer brauchen Waldbrände, weil sich ihre Engerlinge nur in frisch angebranntem Holz entwickeln können. Die Käfer werden nicht durch den Brandgeruch oder Feuerschein zum Waldbrand geführt, sondern durch ein Paar kleiner Gruben, die im Coxaring des mittleren Beinpaares liegen. In der Grube sitzen 50–100 Sensillen, deren jeweiliges Dendritenende ähnlich wie bei campaniformen Sensillen in die Basis einer Cuticulaschale eingeklemmt ist (Abb. 3.5). In die Cuticulaschale hängt an einem Stiel eine Endocuticulakugel, die Infrarot im Wellenbereich von 2500–4000 nm sehr schnell absorbiert. Dies ist der Wellenbereich, der bei Waldbränden abgestrahlt wird. Reizt man die Grubenorgane mit Infrarot solcher Wellenlängen, so genügt schon eine Intensität von 60 µW/cm2 um eine Verhaltensreaktion auszulösen. Phasenkorrelierte neuronale Antworten der Sensillen auf kurze Infrarotimpulse erhält man mit Wiederholfrequen- 26 zen bis zu 100 Hz. Experimente ergaben jedoch, dass die Sensillen auch auf mechanische Deformationen reagieren. Daraus wurde geschlossen, dass die Grubenorgane der Käfer als Infrarot-Wärme-Mechanotransformer arbeiten: Erreicht die Infrarotstrahlung eines Waldbrands das Grubenorgan, so werden die Endocuticulakugeln in Bruchteilen von Sekunden erwärmt und dehnen sich aus. Sie wölben damit die sie umfassende Cuticulaschale aus, die nun ihrerseits, wie bei campaniformen Sensillen, auf den dazwischengeklemmten Dendriten drückt. Der unmittelbare adäquate Reiz für die Transduktion ist also nicht Infrarot sondern der mechanische Druck der Cuticulaschale. Die Existenz von Käfern! die für ihre Fortpflanzung auf verbranntes Holz angewiesen sind, beweist, dass es auch in prähistorischer Zeit genügend Waldbrände gab. Worin allerdings der Selektionsvorteil einer solchen ausgefallenen Spezialisierung liegen soll, ist schwer auszumachen. Sinnesleistungen bei Tieren– Temperatur 12. Infrarotrezeption In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde am American Museum of Natural History in New York beobachtet, dass Schlangen, die zwischen Nase und Auge ein Grubenorgan besitzen, eingeschaltete Glühbirnen ansteuerten, während sie ausgeschaltete ignorierten. Dieses Verhalten verschwand, wenn man das Grubenorgan abdeckte. Blinde Schlangen konnten eine punktförmige Wärmequelle, z.B. einen Lötkolben, auf 5° genau lokalisieren. Es stellte sich heraus, dass diese Grubenorgane Infrarotrezeptoren enthalten. Etwa 10% der Schlangenarten, die Crotaliden (Grubenottern) und einige Boiden, besitzen ein solches Infrarotorgan. Die Grubenorgane der Schlangen bilden die räumlichen Verteilungsmuster der Infrarotstrahlung ihrer Umgebung auf einer dünnen Membran ab und wandeln sie in entsprechende lokale Temperaturerhöhungen dieser Membran um (Abb. 3.3). Dieses “Temperaturbild” wird von freien Nervenendigungen in der Membran rezipiert. Durch eine pupillenartige, kleine Öffnung funktioniert das Grubenorgan wie eine Lochkamera für Infrarot. Die Membran, die Infrarotstrahlung in Wärme wandelt, ist nur 10–15 µm dünn, ca. 30 mm2 gross und in der mit Luft gefüllten Grube so aufgehängt, dass sie von der Körperwärme isoliert bleibt. Etwa 3500 Nervenfasern versorgen diese Membran. Jeder Nerv deckt ein Feld von etwa 40 µm Durchmesser ab, mit wenig Überlappung zu benachbarten Neuronen. Man kann sich das Ganze als eine Fläche vorstellen, die mit 60 ¥ 60 Temperaturdetektoren bestückt ist. Durch die Richtcharakteristik der Grubenöffnung erfasst ein Neuron einen Einfallswinkel von 45–60°. Die dünne Membran wird wegen ihrer geringen thermischen Masse schnell durch Infrarotstrahlung erwärmt. Temperaturänderungen der Membran von nur 0,003 °C in 100 ms werden detektiert. Durch ein dichtes Blutkapillarnetz wird die Membranwärme rasch abgeführt, so dass keine Infrarot-Nachbilder entstehen können. Nach jüngsten Untersuchungen beruht die Temperaturempfindlichkeit der Nervenendigungen im Grubenorgan auf einer sehr hohen Konzentration von Mitochondrien, die als Ca++-Speicher dienen. Durch die Mitochondriendichte enthalten die Nervenendigungen eine hohe Proteinkonzentration von ca. 80%. Proteine absorbieren Infrarot und erhöhen die Temperatur in den Endigungen. Dabei fliessen aus dem Mitochondrien-Speicher in das Cytoplasma vermehrt Ca++-Ionen, die Ca++-abhängige Ionenkanäle öffnen und so die Membran depolarisieren. Die Nervenfasern sind spontanaktiv und antworten auf Infrarot phasisch, beim Einschalten mit einer Erhöhung und beim Ausschalten mit einem Absinken der Feuerrate gegenüber der Spontanaktivität. Sie kodieren daher Temperaturänderungen, weshalb bevorzugt bewegte Objekte detektiert werden. Entsprechend dieser bimodalen Innervation findet man im Tectum Neurone, die innerhalb ihres rezeptiven Feldes sowohl auf Infrarot als auch auf einen Sehreiz ansprechen. Die Infrarot und Seheingänge sind auf dem Tectum unterschiedlich miteinander verknüpft. Folgende Neuronklassen wurden gefunden (Abb. 3.4): • and-Neurone antworten maximal, wenn beide Eingänge aktiviert sind (sichtbare, warmblütige Beutetiere). • or-Neurone antworten, wenn einer der beiden Eingänge aktiv ist. • visual-enhanced Infrarotneurone antworten auf eine sichtbare Beute nur, wenn sie warmblütig ist. • infrared-enhanced Sehneurone: keine Antwort auf Infrarotreiz alleine. • visual-depressed Infrarotneurone antworten gut auf versteckte Wärmequellen. • infrared-depressed Sehneurone antworten gut auf sichtbare, kalte Beute, z.B. auf einen Frosch. Mit diesem Satz infrarot/optischer neuronaler Filter und dem feinen vomeronasalen Geruchssinn können Schlangen auch versteckte Beute zu jeder Tageszeit erfolgreich aufspüren und lokalisieren. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 27 28 Sinnesleistungen bei Tieren – chemisch 13. Chemische Sinne – Allgemeines Das Leben beruht auf biochemischen Prozessen. In jeder Zelle laufen vielfältige Reaktionen von Enzymketten ab, in denen Moleküle miteinander kommunizieren. Jede Zelle ist daher sensibel für ein Spektrum von Molekülen, die ihren Stoffwechsel und ihre Strukturen beeinflussen. Schon Einzeller und frühe Metazoen haben daraus ein allgemeines chemisches Umweltsensorium entwickelt, mit dem sie im Wasser bestimmte Substanzen erkennen können. Mit der wachsenden Fähigkeit, auf wechselnde Umgebungsbedingungen flexibel und differenziert reagieren zu können, entwickelt sich bei den höheren Metazoen der nach aussen gerichtete chemische Sinn zu zwei getrennten Modalitäten: • dem Schmecken, das im direkten Kontakt Nahrung überprüft, • dem Riechen, das vor allem bei den Landtieren für die Fernwahrnehmung und Orientierung grosse Bedeutung gewinnt. Diese chemischen Sinne unterscheiden sich durch: • unterschiedliche Sinneszellen und -organe, • die Empfindlichkeit für unterschiedliche Stoffe, • ihre Funktion: Geruchsstoffe sind lipophile, flüchtige Stoffe mit einem Molekulargewicht von 26–300 Da. Sie dienen der Identifizierung und Lokalisierung von Nahrungsquellen, von Sozialpartnern oder Fressfeinden. Chemische Kommunikation spielt bei vielen sozialen Tieren, besonders bei kolonienbildenden Insekten für die Sozialstruktur und die Orientierung eine tragende Rolle. Geschmacksstoffe sind meist hydrophile Substanzen in wässriger Lösung. Sie dienen der Verträglichkeitsprüfung der Nahrung. Schmecken erfüllt eine zwar lebenswichtige, aber begrenzte Funktion. Bei Wassertieren lässt sich Geruchs- und Geschmacksfunktion nicht immer klar trennen. Riechen Natürlich vorkommende Düfte bestehen in der Regel aus einem Gemisch. So setzt sich z.B. Jasminduft aus 21 Komponenten zusammen, wovon nur 3 jasminspezifisch sind (Abb. 4.1). Der Geruchseindruck hängt nicht nur von der Art der beteiligten Stoffe ab, sondern auch vom Mengenverhältnis und der Konzentration. Gerüche, die in geringen Konzentrationen als angenehm empfunden werden, können in hohen Konzentrationen widerlich riechen, z.B. Moschusduft. Viele Tiere und der Mensch strömen artspezifische und individuelle Düfte aus, die den Duftsender eindeutig identifizieren. Das Riechorgan der Wirbeltiere ist die Nase (Abb. 4.2). Bei Fischen gibt es zwischen Maulspitze und Augen paarige Riechgruben, die passiv von der Wasserströmung durchspült werden, die bei Kiemen- und Mundbewegungen entsteht. Wasser führt im Vergleich zu Luft wenig Duftstoff mit sich. Mit dem Übergang zum Landleben wurde die Nase auch zum Atemweg, und die geruchsbeladene Luft umspült dadurch mit jedem Atemzug das mit einer Schleimschicht feucht gehaltene Riechepithel in der Nasenhöhle. Bis heute hat sich eine nicht klar definierte Einteilung der Tierwelt gehalten: Makrosmaten sind Arten, wie die meisten Säugetiere, die hochsensibel und differenziert Gerüche erkennen und identifizieren können. Bei den Säugetieren breiten sich im hinteren Teil des zwischen den Augenhöhlen ausgeweiteten Nasenraums auf reich gefalteten Knochenlamellen, den Turbinalia, grosse Riechepithelflächen aus (Abb. 4.2). So bestehen z.B. die langen Schnauzenschädel von Hunden hauptsächlich aus Nasenhöhlen. Mikrosmaten können für bestimmte Duftstoffe empfindlich sein, aber ihre Geruchspalette ist viel kleiner und ihre Nase spricht für viele Duftstoffe erst bei höheren Konzentrationen an. das gilt für die meisten Fische und bei den Säugetieren z.B. für Primaten und den Menschen. Arthropoden haben haar- und kegelförmige Riechsensillen auf exponierten Körperteilen, meist auf den Antennen. Die Kutikula vieler Riechhaare ist mit Poren durchlöchert, durch welche Duftstoffe zu den Sinneszellen gelangen können. Die neuronalen Strukturen, die Gerüche verarbeiten, weisen bei Wirbeltieren und Wirbellosen auffallende Gemeinsamkeiten auf: Viele Wirbeltiere und Wirbellose haben jeweils zwei getrennte Riechsysteme, ein allgemeines, das für ein unbegrenztes Spektrum von Gerüchen zuständig ist, ein spezifisches, das hochempfindlich und spezifisch auf einige wenige Geruchsstoffe der eigenen Spezies, auf Pheromone, reagiert. Diese “Sexnase” dient u.a. der Lokalisierung von Sexualpartnern und der Stimulierung des Sexualverhaltens. Schon einmalige Geruchseindrücke können bei Insekten und Wirbeltieren lang anhaltend, oft lebenslang, im Gedächtnis gespeichert und mit speziellen Verhaltensweisen assoziiert werden. Geschmack Die Geschmackssensorik dient der chemischen Kontrolle der Nahrung. Im süddeutschen und schweizerischen Sprachraum bezieht sich das Wort “schmecken” nicht nur auf den Geschmack, sondern auch auf Gerüche. Diese begriffliche Ungenauigkeit trifft präzise die Wahrnehmungsrealität, weil der Wohlgeschmack einer Speise aus dem Zusammenspiel von Geschmacks- und Geruchseindrücken entsteht. Auch mechanische Informationen über Konsistenz, Grösse und Lage der Speise im Mundraum gehen in die Bewertung ein. Geschmackssinnesorgane finden sich häufig im Mundbereich. Bei kleinen Insekten oft auch auf den Tarsen der Beine, die ständig den Untergrund nach Fressbarem überprüfen können, aber auch am Legestachel von Insekten, die ihre Eier in Nahrungsquellen für die schlüpfenden Raupen ablegen. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 29 Fische, denen gelöste Geschmacksstoffe durch das Wasser über den ganzen Körper zugeführt werden, haben zusätzlich Geschmackssinneszellen auf Barteln am Maul und auf der Körperhaut. Es gibt 4 Geschmacksqualitäten, aber bei vielen Tieren gibt es noch eine zusätzliche für Wasser. • Süss signalisiert den Gehalt an Zucker und zukkerähnlichen Kohlehydraten. • Salzig sind Kationen, vor allem Na+, aber auch Anionen tragen zur Salzempfindung bei. • Sauer entspricht der H+-Ionenkonzentration, wobei bei organischen Säuren auch das Anion den Sauergeschmack beeinflusst. • Bitter schmecken viele sekundäre Pflanzenstoffe, wie Alkaloide, Glykoside, Diterpene usw. Generell reagieren Geschmackssinneszellen um Zehnerpotenzen weniger empfindlich als Riechzellen. Die Schwelle für Bitterstoffe ist am niedrigsten, da viele dieser Stoffe für Tiere giftig sind (Tabelle). Besonders hoch ist die Schwelle für süsse Substanzen, bei denen weniger die Qualität “süss” als vielmehr auf hohen Zuckergehalt geprüft wird. Fische reagieren sehr empfindlich auf Aminosäuren. 30 Sinnesleistungen bei Tieren – chemisch 14. Riechen bei den Insekten Die meisten Insekten tragen auf ihren Antennen bis zu zigtausend von Riechsensillen und reagieren schon auf geringste Duftkonzentrationen. Einige Insektenarten, vor allem unter den Schmetterlingen, fächern ihre Antennen auf (Abb. 4.6 a) und fischen mit dem engen Netz des Antennenfächers Duftmoleküle aus dem Luftstrom. Die Maschenweite des Fächers ist so gewählt, dass unter natürlichen Luftstrombedingungen eine maximale Zahl von Molekülen an den Antennenhaaren hängen bleibt. Die haarförmigen Sensillen enthalten zilienartige Dendriten von 1–3 Riechneuronen (Abb. 4.6, 4.7); bei plattenförmigen Sensillen können es bis zu 30 Neurone sein. Die Dendriten sind von einer K+-reichen Lymphe umspült. Die Cuticula der Sensillen wird von zahllosen Poren durchlöchert, von denen Tubuli die Duftstoffe auf die Dendritenmembranen führen. Enzyme in der Sensillenlymphe bauen Duftstoffe rasch ab und begrenzen damit die Reizzeit. Ein Riechhaar kann auf verschiedene Duftstoffe gegensätzlich reagieren. So löst z.B. bei einem Totengräber-Käfer Aasgeruch an Geruchssensillen ein depolarisierendes Rezeptorpotential aus. Propionsäure führt jedoch beim gleichen Sensillum zu einer hemmenden Hyperpolarisation (Abb.4.7). Der gleiche Duftstoff kann bei einem Riechneuron Erregung, beim anderen Hemmung auslösen. Generell nimmt der Anteil eng abgestimmter Sensillen zu, je mehr eine Spezies zum Nahrungsspezialisten geworden ist. Neben den vorherrschenden Generalisten unter den Riechzellen gibt es auch Nahrungs-Spezialisten, die vorwiegend oder sogar ausschliesslich auf Geruchskomponenten artspezifischer Futterpflanzen bzw. Beute reagieren. Rüsselkäfer, die unter der Borke von Nadelbäumen minieren, haben z.B. neben Generalisten auch Sensillen, die nur auf spezifische Duftstoffe von Nadelbäumen, die Pinene, antworten (Abb.4.8b). Die Sensilla coeloconica der Heuschrecken antworten bevorzugt auf spezifische Gras-Duftkomponenten, das sind 6-kettige Karbonsäuren, bzw. die entsprechenden Aldehyde und Alkohole (Abb. 4.8 a). Auch bei der Eiablage helfen spezifische Geruchssensillen den Weibchen, die richtigen Futterpflanzen für das Gelege zu finden, von denen sich später die schlüpfenden Raupen ernähren. Ist eine Pflanze schon von Raupen dicht besetzt, so verhindern sie durch einen spezifischen Geruch die Eiablage weiterer Weibchen. Die Raupen selbst prüfen Pflanzen ebenfalls geruchlich mit je drei Riechsensillen und insgesamt 32 Riechzellen auf ihren kurzen, dreigliedrigen Antennen. Im Gegensatz zu solchen Nahrungsspezialisten besuchen Nektar- und Pollen-sammelnde Insekten die Blüten unterschiedlichster Pflanzen. Bienen erinnern eine ergiebige Nektartracht u. a. durch deren Geruch. Im Laufe eines Sommers müssen Sammlerinnen viele verschiedene Gerüche identifizieren und sich einprägen. Die Unterscheidung der Blütendüfte beginnt in den Glomeruli der Antennenloben. Bei der Honigbiene gelang es, einen Teil der 160 Glomeruli zu identifizieren. Im Experiment erzeugten die meisten Gerüche Erregungsmuster, die aus vielen schwach und einigen stark aktivierten Glomeruli bestehen. Jeder Geruch erregt eine spezifische Kombination von Glomeruli (Abb. 4.9). Dieser multiglomeruläre Kombinationskode gewährleistet, dass die Düfte unterschiedlicher Blütentrachten sicher erkannt und im Gedächtnis gespeichert werden können. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 31 32 Sinnesleistungen bei Tieren – chemisch 15. Chemische Kommunikation der Insekten Das spezifische Pheromon-Riechsystem der Insekten fand das besondere Interesse der Biologen. Der Begriff Pheromon wurde 1959 von Karlsson geprägt, als im Labor von A. Butenandt der Lockstoff des Seidenspinnerweibchens, Bombykol (Hexadecadienol) identifiziert wurde. Pheromone bezeichnen Duftstoffe, die Tiere zur arteigenen Kommunikation ausströmen. Schon im 19. Jahrhundert hatte der Schweizer Arzt August Forel beobachtet, dass ein leerer Käfig, in dem er Seidenspinnerweibchen gehalten hatte, mit magischer Kraft die Männchen anzog. Die Weibchen vieler, vor allem nachtaktiver Schmetterlinge erzeugen in subkutikulären Drüsen, den Sacculi, LockPheromone. Diese Sacculi sind umgewandelte Intersegmentalmembranen, die ausgestülpt werden können. Viele geruchliche Kommunikationsstoffe sind unverzweigte, ungesättigte Alkohole, Aldehyde und Säuren mit Kettenlängen bis zu 20 C. Manche Arten benutzen auch Epoxide und Alkaloidderivate (Abb. 4.10). Für die Intensität der Chemotaxis sind drei Faktoren massgebend: • Im Experiment wirkt nur intermittierende Reizung, bei kontinuierlichem Duftstrom rührt sich das Insekt nicht vom Fleck. Bei Schmetterlingen sind Reizpulse im Zeitabstand von ca. 0,6 s am wirksamsten. Dies korreliert mit der natürlichen Reizsituation, da die vom Luftstrom mitgenommenen Düfte in diskontinuierlichen Molekülpaketen windababwärts getragen werden andererseits adaptieren Riechzellen bei Dauerreizung sehr rasch. • Die Pheromonkonzentration korreliert nicht immer linear mit der Suchreaktion. Oft wirkt eine niedrige Konzentration stimulierender als eine hohe (Abb.4.12b). • Die Qualität des Lockstoffes. Die Weibchen senden Lockdüfte aus, die meist aus einem Gemisch von 2–7 Pheromonen bestehen, z.B. beim Seidenspinner aus Bombykol und Bombykal. Nicht nur von der Art, sondern auch vom Mischungsverhältnis der Moleküle hängt ab, wie sehr der Duft das Männchen stimuliert. Die Weibchen des Schwammspinners (Lymantra dispar) und des Nonnenspinners (L. monacha) locken mit dem gleichen Pheromon disparlure, das in optisch rechts und links drehenden Isomeren vorkommt. Beim Nonnenspinner beträgt das Mischungsverhältnis 90% links- zu 10% rechtsdrehendem disparlure, während das Weibchen des Schwammspinners nur rechtsdrehendes Pheromon abgibt. Dieser Unterschied reicht, um jeweils nur das arteigene Männchen anzulocken. Pheromonrezeptoren der Insekten Die Pheromonrezeptoren erreichen die höchstmögliche molekulare Spezifität. Sie antworten nur auf eine einzige Molekülart maximal und unterscheiden auch zwischen Enantiomeren, also spiegelbildlichen Molekülen. Die Rezeptormoleküle auf der Riechdendritenmembran sind allerdings noch nicht identifiziert worden. Beim Seidenspinnermännchen antwortet eines der beiden Riechneurone in einem Sensillum trichodeum nur auf Bombykol (A-Zelle), das andere (BZelle) nur auf Bombykal (Abb. 4.11 b). Die Rezeptoren binden von den vier möglichen Isomeren des Hexadecadiens die vom Weibchen erzeugte transcis-Form am besten. Für die anderen Isomere ist die Erregungsschwelle um 3 Zehnerpotenzen höher. Bei Manduca sexta reagiert die A-Zelle nur auf 10-12Hexadecadienal und die B-Zelle nur auf das andere Pheromon des Weibchens, 10-12-14-Hexadecatrienal. Da die Duftdrüsen der Weibchen nur geringe Mengen von 0,1–1 µg des Pheromons enthalten, enthält auch der Luftstrom nur geringste Mengen von Pheromonmolekülen. Beim Seidenspinner genügt z.B. ein Treffer von einem Bombykolmolekül, um in der A-Zelle ein Aktionspotenzial auszulösen, und das chemotaktische Suchverhalten wird initiiert, wenn wenigstens 200 Bombykolriechzellen simultan aktiv sind. Exkurs Wird im Experiment ein Schmetterlingsmännchen 1 s lang von einem Luftstrom mit 1000 Pheromonmolekülen/cm3 und einer Windgeschwindigkeit von 60 cm/s angeblasen, so löst dies einen Suchflug windaufwärts aus. Das Männchen tastet chemisch mit einem Zick-Zack-Kurs die Geruchsfahne ab, kehrt immer wieder in den Luftstrom höchster Duftmoleküldiehte zurück und findet so das Weibchen (Abb. 4.11a). Durch diese Chemotaxis oder Anemotaxis kann ein Männchen aus 1 km Entfernung in 12 min ein Weibchen finden. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 33 34 Sinnesleistungen bei Tieren – chemisch 16. Die geruchliche Kommunikation bei Insekten Ameisenstaaten. Die Cuticula ist bei sozialen Insekten ein hochreguliertes Informationsorgan, über welches verschiedene chemische Botschaften gesendet werden können. Chemische Kommunikation ist hochgradig differenziert. Als Beispiel seien einige Kommunikationswege bei Ameisen beschrieben, die diesbezüglich am besten untersucht sind. Ameisen kommunizieren über Duftstoffe sowohl innerhalb einer Kolonie als auch zwischen Kolonien derselben oder anderer Arten. Sie benutzen Duftspuren, um zu Nahrungsquellen und wieder nach Hause zu finden, und spezifische Pheromone veranlassen Ameisen, Futter an Artgenossen abzugeben. Das dichte Netz chemischer Kommunikationswege macht es für andere Insektenarten lohnend, sich als Signalschmarotzer in das Kommunikationssystem der Ameisen einzuschleichen und deren soziale Leistungen zum eigenen Vorteil umzulenken. Ameisen sind “wandelnde Duftstoff-Batterien” mit mehr als 10 verschiedenen Drüsen, die chemische Signalstoffe produzieren. Die Drüsen produzieren in der Regel nicht nur einen Duftstoff, sondern eine Mischung von Substanzen (Abb. 4.14). Die Pheromone werden in Speichern in Mengen von nur 0,1 bis ca. 3 µg vorgehalten. Die Pheromon-Rezeptoren sind oft hochspezifisch. So reagiert die Blattschneiderameise auf das optisch rechtsdrehende Alarmpheromon 100- bis 200-mal empfindlicher als auf das linksdrehende. Am empfindlichsten wird auf Spursubstanzen reagiert, die den Weg zu einer Nahrungsquelle und zurück zur Kolonie markieren und nur in geringsten Mengen abgegeben werden: Eine Arbeiterin von Blattschneiderameisen enthält nur 0,3–3,3 ng Spurpheromon. Es wurde errechnet, dass 1 µg der Spursubstanz eine Blattschneiderameisenkolonne dreimal um die Welt führen könnte. Die ausgelöste Verhaltensweise hängt oft von der Pheromon-Konzentration ab. So löst das Alarmpheromon der Blattschneiderameise in geringer Konzentration eine Attraktion, aber in hoher einen Alarm bis hin zur Panik und Angriffsbereitschaft aus. Die Mischungen von Pheromonen identifizieren eine Art oft genauer als morphologische Merkmale. So sind z.B. die europäischen Ameisenarten Tetramorium ‘caespitum und Tetramorium impurum morphologisch kaum zu trennen. Die Dufourdrüse von Tetramorium caespitum produziert unverzweigte C13–C17 Kohlenhydrat-Ketten (KH-Ketten) mit einer Mischung von Pentodekanen. Dagegen produziert die Dufourdrüse von Tetramorium impurum hauptsächlich Pentodekane und ein Terpenoid. Verschiedene Mischungen von Pheromonen ergeben verschiedene Botschaften. Oft wird die Botschaft einer Substanz von vielen Arten verstanden. Erst die Ergänzung durch weitere Substanzen ergibt eine artspezifisch codierte Botschaft. Undekan,z.B., ist das Alarmpheromon bei den meisten FormicinaeArten, doch die Zumischung anderer KH-Ketten ver- Abb. 4.14a, b Pheromone bei Ameisen. a Zwei der wichtigsten Pheromondrüsen bei Ameisen (Acanthomyops claviger), die Mandibel- und die Dufour-Drüse und ihre Pheromongemische. Undekan ist der eigentliche Spurstoff, die anderen Komponenten der Dufourdrüse sind Modulatoren. b Als chemische Spur wirkt bei der Ameise Tetramorium caespitum eine spezifische Mischung zweier Pyrrazine am besten. Zum Vergleich die Spurwirkung des vom Tier aus der Giftdrüse abgegebenen Pyrrazingemischs (blaue Säule). Nach Hölldobler u. Wilson 1990 leiht der chemischen Botschaft Artspezifität. Eine hohe Anzahl von Modulationen ist durch solche Mischungsverhältnisse denkbar. So haben Kolonien Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 35 derselben Art unterschiedliche Koloniendüfte, an denen die Zugehörigkeit einer artgleichen Ameise zu einer anderen Kolonie sofort erkannt werden kann. Die Komplexität der ausgelösten Verhaltensweisen zeigt sich am Beispiel einer afrikanische Myrmiciden-Art, die in der Nähe einer Beute einen Tropfen aus der Giftdrüse absetzt. Der Tropfen enthält verschiedene Pheromone: • b-Pinene in dem Tropfen locken weiträumig Nestgenossen an • Limonene lösen in der Nähe des Tropfens kreisendes Verhalten aus, so dass sich die Arbeiter gleichförmig um die Beute verteilen. • Ein drittes Pheromon löst schliesslich den Angriff auf die Beute aus. Das bislang komplexeste chemische Kommunikationssystem wurde bei Weberameisen gefunden: • Rekrutierung zu neuen Futterquellen durch eine Geruchsspur, die Wegweiserameisen aus der Rektaldrüse legen. • Rekrutierung auf ein neues Territorium durch andere Pheromone, die ebenfalls aus der Rektaldrüse stammen. • Emigration zu einem neuen Platz unter Führung spezifischer Geruchsspuren aus der Rektaldrüse. • Rekrutierung zu Eindringlingen durch eine Duftspur aus der Sternaldrüse. • Rekrutierung zu entfernten Eindringlingen durch spezifische Duftspuren aus der Rektaldrüse. Sklaventreiberameisen sprühen über das Nest, das sie versklaven wollen, Säuren aus der Dufourdrüse. Dies lockt weitere Koloniegenossen an und alarmiert gleichzeitig die Arbeiterinnen des überfallenen Nestes so stark, dass sie in Panik auseinander rennen und die Verteidigung aufgeben. Diese Vielfalt chemischer Kommunikation im Ameisenstaat, bei der verschiedene Pheromone in verschiedenen Mischungsverhältnissen ganz unterDuftcamouflage bei Wespen Aus der chemischen Kommunikation sozialer Insekten versuchen oft andere Arten Profit zu schlagen. Ein eindrucksvolles Beispiel liefert die Papierwespe Polistes atrimandibularis, die weder Arbeiterinnen hat noch ein Nest bauen kann und daher obligatorisch am Nest und der Arbeiterschaft von Polistes biglumis parasitiert. Wie gelingt es der Nest usurpierenden Königin, die aggressiven Nestbesitzer in wenigen Tagen so zu besänftigen, dass die parasitierende Königin in Ruhe ihre Eier ins fremde Nest legen und ihre Brut von den fremden Arbeiterinnen aufziehen lassen kann? Beide Arten kennzeichnen sich geruchlich durch ca. 80 verschiedene Kohlehydratketten der Cuticula mit Kettenlängen von C23 bis C37. Die parasitierende Art gibt ein Geruchsbouquet mit vielen ungesättigten, der Gastgeber ausschliesslich mit gesättigten Kohlehydraten ab. Unmittelbar nachdem eine Parasitenkönigin ein Nest besetzt hat, verlieren sich ihre spezifischen ungesättigten Pheromone und in relativ kurzer Zeit sind die Geruchs-Kennkarten der Gast- und Parasitenkönigin ununterscheidbar. Gegen 36 schiedliche Verhaltensweisen auslösen, wirft Fragen nach der neuronalen Verarbeitung auf. Wird dieses umfangreiche Kommunikationssystem von Pheromonen z.B. ebenfalls nur vom spezifischen olfaktorischen System, den Makroglomeruli betreut? Bei Honigbienen unterdrückt das z.B. das‘ Pheromon “Königinnensubstanz” die Entstehung eines fruchtbaren Weibchen bei den Arbeiterinnen, die keine Makroglomeruli besitzen. Wenn unterschiedliche Mischungen von Substanzen unterschiedliche Botschaften bedeuten, wie wird die Abgabe der Mischungsverhältnisse kontrolliert? Hier ist ein weites Forschungsfeld für neuroethologen. In einer Ameisen-Kolonie gibt es etwa 10 bis 20 verschiedene chemische Signale. Tabellarisch seien die wichtigsten chemischen Kommunikationswege zusammengefasst (Tabelle 4.1). Tabelle 4.1. Chemische Kommunikationswege in Ameisenkolonien (aus Hölldobler u. Wilson 1990) A. Von Arbeiterin zu Arbeiterin 1. Koloniengeruch 2. Kastengeruch 3. Körperattraktionspheromon für gegenseitige Körperpflege 4. Futterabgabe, teilweise chemisch induziert 5. Spursubstanzen, lockt Nestgenossen zu Futterquellen zu 6. Hilferufesubstanzen aus Dufour-Drüse holen Kolonie genossen herbei 7. Alarmsubstanz aus Kopfdrüse 8. Oleinsäure und Oleate lösen das Wegschaffen toter Ameisen aus (Nekrophorverhalten) B: Von Königin zur Arbeiterin 9. Königin-Erkennungspheromon C: Von Königin zu Königin 10. Inhibitionspheromon, das Flügelabstossung bei jungfräulichen Königinnen verhindert D: Von Arbeiterin zur Brut 11. Futterabgabe 12. Giftabgabe durch Winken mit aufgestelltem Abdomen, Abwehr von Mikroorganismen E: Von Brut zur Arbeiterin 13. Erkennungspheromone, zeigen den Entwicklungsstand der Brut an: Ei, mehrere Larvenstadien, Puppe, Schlüpfen Ende des Sommers verlässt die Wirts-Königin das Nest, während die parasitierende im Nest bleibt und von den “Fremdarbeitern” ihre eigene Brut zusammen mit der eigenen Brut der gastgebenden Kolonie aufziehen lässt. Die Naturgeschichte sozialer Insekten bietet viele andere Beispiele der raffinierten Informationspiraterie und des Informationsbetrugs. Sinnesleistungen bei Tieren – mechanisch 17. Mechanische Wahrnehmung bei Spinnen Arthropoden stecken in einem harten und starren Panzer aus Chitin. Mechanische Aussenreize mussen den Rezeptoren daher durch Cuticulastrukturen zugeführt werden. Entsprechende Mechanosensillen sind in unterschiedliche Funktionszusammenhänge eingebaut, und entsprechend verschiedenartig sind die reizkoppelnden und -filternden Cuticulastrukturen gestaltet. Die filiformen oder Fadensensillen reagieren hochempfindlich auf Strömungen des Mediums, bei Arthropoden also meist auf Luftbewegung. Bei Arachniden heissen diese Sensillen Trichobothrien, weil die Fäden aus einem Cuticulabecher (griech.: bóthrion = Grube) entspringen. Trichobothrien Arachniden tragen Trichobothrien auf den Beinen und Pedipalpen. Die mittelamerikanische nachtaktive Jagdspinne Cupiennius salei z.B., die auf Blättern sitzend Insekten auflauert, besitzt auf jedem Bein ca. 100 Trichobothrien, die grösste bislang bei irgendeiner Spinne festgestellte Zahl. Die feinen (Ø = 5–15 µm) Fäden ragen nur 100–1500 µm aus der Cuticulafläche heraus. Sie sind durch eine dünne Membran so in die Cuticula eingelenkt, dass sie sich durch geringste Luftbewegungen auslenken lassen. Die Erregungsschwelle liegt bei Luftgeschwindigkeiten kleiner als 1 mm/s oder 6 cm/min und nimmt mit wachsender Fadenlänge ab. Der Becherrand begrenzt den Auslenkungswinkel auf etwa 24–30°. Entsprechend ihrer Masse (Dichte 1,1 g/mm3), ihrem Reibungswiderstand gegen Luft und der Torsionskräfte im Gelenk haben die Sensillen eine bestimmte Resonanzfrequenz. Trichobothrien können Luftvibrationen bis etwa 600 Hz folgen, wie sie z.B. fliegende Insekten erzeugen. Niedere Frequenzen werden umso besser übertragen, je länger die Fadenhaare sind. Über die Haarlänge wird die Schwingungsempfindlichkeit an den für die Lebensweise wichtigen Frequenzbereich anpasst. Lange Trichobothrien lassen sich nahezu gleich gut in alle Richtungen auslenken. Lediglich unter den kurzen gibt es Richtungsselektivität. Basis und unterer Teil von Trichobothrien. Die Jagdspinne Cupiennius. Die Kraft wird von den Luftpartikeln auf das Haar viskös übertragen, d.h. die Reibung der Luftpartikel am Haarschaft nimmt das Haar mit. Feine Fiederungen am Haar befördern diese Kraftübertragung durch Reibung. Das Amplitudenverhältnis Haarauslenkung/Luftpartikelbewegung beträgt bei den meisten Trichobothrien 0,5–1. Es gibt auch einzelne Trichobothrien, bei denen die Haarauslenkung grösser ist als die Luftpartikelbewegung. Die Haarauslenkung korreliert mit der Luftpartikelgeschwindigkeit, auch Schallschnelle genannt, und mit der Schallbeschleunigung. Die Schallschnelle nimmt mit der Entfernung rasch ab und ist daher nur im Nahfeld detektierbar, realistischerweise in einem Umkreis von ca. 30 cm. Bezogen auf die geringe Körpergrösse einer Spinne ist dies ein ausreichender sensorisch erfasster Raum, er entspräche beim Menschen einem Radius von 60 m. Mit diesen Hunderten von Vibrationssensoren, die durch unterschiedliche Haarlängen insgesamt einen weiten Bereich von Luftschwingungsstärken und -frequenzen rezipieren, kann die Jagdspinne Cupiennius Beute detektieren. Die Spinne kann sogar fliegende Insekten aus der Luft fangen. Eine summende Fliege wird noch aus 30 cm Entfernung entdeckt (Abb. 5.19), und ihre Flügelschläge lösen sogar noch aus 70 cm Entfernung Haarauslenkungen aus. Auf den Blättern herumlaufende Insekten, die Hauptnahrung dieser Spinnen, erzeugen in der Nähe Luftströmungen, die von Trichobothrien detektierbar sind und der angreifenden Spinne die Orientierung zur Beute hin erleichtern. Aber auch nah vorbeifliegende Insekten können Jagdspinnen entdecken und aus der Luft greifen. Spaltsinnesorgane Laufende Beute wird jedoch von Spinnen meist durch Substratvibrationen entdeckt. Pflanzenblätter übertragen Vibrationssignale in einem grossen Frequenzbereich mit geringer Dämpfung. Sensoren für Substratvibrationen sind die Spaltsinnesorgane (Abb. 5.21), die auf den Spinnen- Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 37 beinen in der Nähe von Gelenken sitzen. Die Spaltsinnesorgane reagieren schon auf Schwingungsamplituden der Tarsen von 1 bis 10 nm. Wenn mehrere, bis über 20 Spaltsinnesorgane parallel ausgerichtet zu einem gemeinsamen Organ, dem lyriformen Organ, zusammengefasst sind (Abb. 5.21), erhöht sich die Vibrationsempfindlichkeit. Einzelne Spaltsinnesorgane können auf unterschiedliche Frequenzen abgestimmt sein. Die acht Spinnenbeine sitzen auf dem Substrat wie Fühler, die das Umfeld in einem Kreis von 360° abtasten. Bei der Jagdspinne Cupiennius hat dieser Abtastkreis einen Durchmesser von 10 cm, was zu deutlichen Amplituden- und Zeitunterschieden zwischen diagonal positionierten Beinen führt. Das am stärksten bzw. als erstes vibrierende Bein zeigt der Spinne die Richtung zur Reizquelle an. Netzspinnen 0 können sich auf 3–4 genau zur Vibrationsstelle hin 38 ausrichten. Die Signale enthalten offensichtlich auch Entfernungsinformationen. Spinnen nutzen mit Hilfe der Spaltsinnesorgane die Blätter als Informationsquelle zur Detektion und groben Lokalisierung von Beute, aber auch zur Kommunikation durch Klopfsignale. Spinnen müssen daher den Frequenzgehalt von Substratvibrationen unterscheiden können: Durch Wind erzeugte Blattvibrationen werden von den Sensoren nicht rezipiert. Vibrationen laufender Beute, z.B. Schaben, enthalten hohe Frequenzen (600 Hz) und sind breitbandig. Es gibt Insekten, die beim Laufen so schwache und niederfrequente Vibrationen auslösen, dass die Spinnen sie nicht entdecken. Auch gibt es Insekten, die sich so “vorsichtig” bewegen, dass sie von Spinnen nicht entdeckt werden und als Kleptoparasiten im Spinnennetz leben. Sie schleichen sich an die Beute der Spinne heran und schneiden sie vorsichtig aus dem Netz heraus. Schliesslich benutzen Spinnen, z.B. die Jagdspinne Cupiennius, Substratvibrationen zur Werbekommunikation zwischen Männchen und Weibchen (Abb. 5.22). Das Männchen “ruft” mit Klopfsignalen, sobald es auf eine Pheromonspur eines Weibchens trifft. Die Klopfantwort führt das Männchen aus bis zu 1,5 m Entfernung zum Weibchen hin. Die Männchen klopfen eine Salve von Silben, während das Weibchen nur mit einem Silbensignal antwortet. Die Silbenlänge entscheidet u.a., ob das Weibchen auf das Werben des Männchens eingeht. Sinnesleistungen bei Tieren – mechanisch 18. Das Seitenliniensystem von Fischen Wasser ist ein dichtes Medium. Es leitet mechanische Signale daher über weite Strecken. Jede Bewegung im Wasser erzeugt Strömungen und Druckwellen. Bei Fischen und bei ständig im Wasser lebenden Amphibienarten nimmt das Seitenliniensystem Wasserbewegungen relativ zum Körper wahr. Das Seitenliniensystem besteht aus • Kanälen, die in die Haut versenkt und über Poren mit dem Aussenwasser verbunden sind (Abb. 6.1), • aus Neuromasten, die in Reihen angeordnet frei auf der Haut stehen (Abb. 6.2). Fische besitzen sowohl Seitenlinien als auch freie Neuromasten, wobei der jeweilige Anteil von der Lebensweise abhängt. Bei Fischen, die vorwiegend in ruhigen Gewässern stehen überwiegen Neuromasten. Fische, die ständig schwimmen oder in schnell fliessenden Gewässern leben, haben dagegen Kanäle, die sich in der Kopfregion verzweigen und als lange Seitenlinie beidseitig entlang des Rumpfes bis zum Schwanz ziehen. Schwarmfische, wie Heringe und Sardinen, verkürzen das Kanalsystem zugunsten eines reich verzweigten Kanalnetzes am Kopf. Die Sinneszellen des Seitenliniensystems sind die Haarzellen. Zusammen mit Stützzellen bilden mehrere Haarzellen ein längliches Polster, aus dem nur die 0,5–5 µm langen 40–50 Stereozilien jeder Haarzelle und das bis zu 40 µm lange Kinozilium herausragen (Abb. 6.2b). Alle Zilien eines Sinnespolsters sind in einer Gallertfahne, der Cupula, zu einem einheitlichen, reizaufnehmenden Organ, dem Neuromasten, zusammenfasst. Die Polarität der Zilien ist so angeordnet, dass die Haarzellen nur auf Bewegungen in Längsrichtung der Cupula ansprechen: ein Teil der Haarzellen auf Wasserbewegungen, die vom Kopf her kommen, der andere auf die Gegenbewegung vom Schwanz her. Die Nervenfasern feuern im Ruhezustand mit einer regelmässigen Spontanaktivität, die durch die Auslenkung der Cupula richtungsabhängig moduliert Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 39 wird. Die Differenz zwischen Körper- und Wasserbewegung lenkt die Cupula aus. Die Cupula hat ein spezifisches Gewicht von 1,0, stellt dem Wasserstrom also kaum Trägheits-Widerstand entgegen. Die Cupula wird vielmehr durch visköse Reibungskräfte von der Wasserbewegung mitgenommen. Die Erregung korreliert mit der Geschwindigkeit der Wasserbewegung. Dies gilt vor allem für kleine Cupulae und langsame, niederfrequente Reize von bis zu einigen 10 Hz. Bei höheren Reizfrequenzen und langen Cupulae gewinnen bei der Reizankopplung Trägheitsmomente das Übergewicht, womit der Reiz durch die Beschleunigung der Wasserbewegung zustande kommt. Dies trifft auf die Kanalorgane zu. Das viskös gekoppelte System ist sehr empfindlich. Schon eine relative Wasserbewegung um 0,1 µm bzw. eine Verschiebung der Cupula um ca. 2 nm führt zu einer Erregung. Während die freien Neuromasten unmittelbar der Wasserströmung ausgesetzt sind, werden Kanalorgane nur gereizt, wenn sich das Wasser im Kanal relativ zur Kanalwand bewegt. Solche Bewegungen des Kanalwassers entstehen durch lokale Druckdifferenzen über benachbarten Kanalporen. Deshalb stehen die Kanalorgane in der Mitte zwischen zwei Porenöffnungen. Die Kanäle erzeugen eine enge Richtungsspezifität, denn nur Wasserbewegungen ±8° in Längsrichtung der Kanäle führen zu Cupulaverschiebungen. Durch eine entsprechende gerichtete Anordnung der Kanäle in der Kopfregion können Fische sehr genaue Richtungsinformationen über Bewegungsquellen im Wasser erhalten. Aufgrund der Anordnung der Neuromasten und Kanäle über den ganzen Kopf und entlang des Rumpfes bildet das Seitenliniensystem die Verteilung lokaler relativer Wasserbewegungen bzw. die Verteilung der Druckgradienten über den ganzen Körper ab. Die Haut als Ganzes wirkt als omnidirektionaler Wasserbewegungs-Sensor. Alles, was sich im Wasser bewegt, die Schwimmbewegungen von kleinen Krebsen ebenso wie die periodischen Flossenbewegungen von Nachbarfischen, erzeugt einen inkompressiblen Wasserfluss unmittelbar an der Reizquelle und eine Wasserdruckwelle. Da der Wasserfluss mit 1/λ3 (λ: Wellenlänge des Reizes) mit dem Abstand von der Reizquelle abnimmt, steht diese Information nur in nächster Nähe zur Verfügung. Druckwellen nehmen aber nur mit 1/λ ab, reichen also weiter. Die Detektionsreichweite des Seitenliniensystems ist daher begrenzt auf einen Radius, der sich nur bis zur 3–5-fachen Fischlänge erstreckt. Warum verstecken Fische, die in ständiger Wasserbewegung leben, ihre Bewegungsdetektoren in Ka- 40 nälen? Die Kanäle wirken als Frequenzfilter, die niederfrequente Reize, z.B. Brandungswellen, herausfiltern. Wasser wirkt generell als Tiefpassfilter, daher kennzeichnen niedere Frequenzen ferne Reizquellen, die für den Fisch weniger interessant sind. Solch niederfrequentes Hintergrundsrauschen wird durch die Kanäle weggefiltert. Freistehende Neuromasten antworten am besten auf niederfrequente Reize zwischen 10 und 60 Hz, Kanalorgane dagegen erst ab 50 Hz bis mehrere hundert Hz. Je nach Lebensweise der Fische können die Kanäle unterschiedlich gestaltet sein und damit unterschiedlich stark als Hochpassfilter wirken (Abb. 6.4). Die Kanalorgane variieren in • der Weite des Kanals (0,1–7 mm) und der Elastizität der Kanalwand, • der Zahl, Weite und Verteilung der Kanalporen, • der Grösse und Form der Cupulae. Je enger der Kanal und je starrer die Kanalwand, desto mehr wirkt der Kanal als Hochpassfilter. Bei sehr weiten Kanälen stehen die Sinnespolster oft quer im Kanal und die grosse Cupula füllt den ganzen Kanalquerschnitt aus. Fische mit weiten Kanälen leben bevorzugt sedentär im unbewegten Wasser. Weite Kanäle haben Barsche, die am Boden leben und nachtaktiv sind, während Fische mit engen Kanälen in schnell fliessenden Gewässern zu finden sind und oft bei Tag visuell gesteuert ihre Beute suchen. Das Seitenliniensystem funktioniert im Nahfeld einer Reizquelle, optimal im Umkreis von 1 bis 1,5 Fischlängen. Fische, aber auch andere Wassertiere, setzen das Seitenliniensystem bei der Nahorientierung überall dort ein, wo die optischen Informationen nicht mehr ausreichen. Arktische Fische, die lange Perioden im Dunkel unter dicken Eisschichten leben, können mit ihren Seitenlinien Amphipoden lokalisieren (Abb. 6.6). Bei Fischen, die in grossen Schwärmen schwimmen, liefert das Seitenliniensystem Informationen über den Abstand zu benachbarten Fischen und deren Schwimmweise und Richtung. Viele Fische stellen sich in die Strömung und halten schwimmend ihre Position. Diese rheotaktische Reaktion wird u.a. von den freien Neuromasten auf der Fischhaut gesteuert, die am besten auf langsame Strömungen von 3–9 m/s antworten. Fische erzeugen durch ihre Flossenbewegungen um sich herum ein Flussfeld, das von Gegenständen in der Nähe reflektiert wird. Aus solchen reflektierten Stauwellen-Störungen im selbst erzeugten Feld können Fische Informationen über Gegenstände in der Nähe erhalten. Blinde Höhlenfische nutzen diese Möglichkeit zur aktiven mechanischen Ortung aus. Sinnesleistungen bei Tieren – mechanisch 19. Die Ortung von Beute anhand von Oberflächenwellen Eine Wasseroberfläche verhält sich aufgrund der van der WaaI’schen Kräfte wie eine elastische Membran. Oberflächenwellen entstehen durch scherende Windkräfte, durch die Anziehungskräfte zwischen Mond und Erde (Gezeiten), aber auch lokal durch herabfallende Objekte und Bewohner des Wasserspiegels. Da Wasser nicht komprimierbar, reibungsarm und homogen ist, pflanzen sich Oberflächenwellen kaum in die Wassertiefe fort. Es gibt eine Reihe von Fischen, Amphibien, Insekten und Spinnen, die Wasseroberflächen bejagen. Während vom Wind erzeugte Wellenfronten eine Frequenz von etwa 1,4 Hz aufweisen und 10 Hz nie übersteigen, produzieren auf dem Wasser zappelnde Insekten kurze und längeranhaltende (10–60 s) konzentrische Wellen im Frequenzbereich von 5–100 Hz mit Amplituden von 2–80 µm. Diese Oberflächenwellen breiten sich mit frequenzabhängiger Geschwindigkeit aus: bis 13 Hz nimmt die Geschwindigkeit auf 23,1 cm/s ab und steigt für höhere Frequenzen wieder kontinuierlich an (z.B. 140 Hz, v = 40,37 cm/s; Abb. 6.8a). Fällt also ein Insekt auf das Wasser, so entsteht ein Klickartiger Wellenimpuls, der sich konzentrisch als frequenzabwärtsmoduliertes Signal ausbreitet, weil die hohen Frequenzen mit höherer Geschwindigkeit wandern. Gleichzeitig wirkt die Wasseroberfläche als Tiefpassfilter, da bei der Ausbreitung die Amplituden mit steigender Frequenz rapide abnehmen. Der Frequenzgehalt einer Oberflächenwelle birgt also Informationen über den Abstand zum Wellenmittelpunkt. Es gibt Fische, die ihr Seitenliniensystem auf die Detektion und Ortung von Oberflächenwellen spezialisiert haben. Ein Modellfisch hierfür ist Aplocheilus spec. Dieser Fisch steht so an der Wasseroberfläche, dass sein abgeflachter Kopf mit dem Wasserspiegel abschliesst. Die Seitenlinien auf der planen Kopffläche sind kurze Kanalstücke, die im rechten Winkel zueinander angeordnet sind. Bewegt sich ein Insekt auf der Wasserfläche, so schwimmen diese Fische aus bis zu 50 cm Entfernung gezielt auf das Insekt zu und versuchen es zu schnappen. Ihre Kopfseitenlinien reagieren auf hohe Frequenzen besonders gut, bei Aplocheilus beträgt die Schwelle für 100–140 Hz nur 20 nm und bei Pantodon für 150 Hz sogar nur 0,7 nm. Die Fische entnehmen den Wellen genaue Informationen über Richtung und Entfernung des Wellenmittelpunktes. Ausschaltversuche haben gezeigt, dass die Fische die Richtung aus Phasen- und lntensitätsdifferenzen zwischen entsprechenden Kopfkanälen der linken und rechten Seite ermitteln. Reduziert man das Seitenliniensystem des Kopfes auf einen Neuromasten, werden die Fische desorientiert. Verhaltensversuche mit künstlich erzeugten Oberflächenwellen definierten Frequenzgehalts haben gezeigt, dass die Fische die Entfernung zum Wellenmittelpunkt aus dem Frequenzgehalt entnehmen (Abb. 6.8c). Reizt man Fische mit einem frequenzmodulierten Signal, das einer Welle aus 15 cm Entfernung entspricht, so schwimmen sie über die in 7 cm Entfernung liegende Reizquelle hinaus (Abb. 6.8 c). Die Fische können Frequenzen von Wellen auf 1,5–2 Hz genau auflösen. Der Krümmungsradius wird als zusätzliches Kriterium herangezogen. Sie errechnen den Krümmungsradius aus der unterschiedlichen Ankunftszeit einer Welle an den verschiedenen Neuromasten des Kopfes. Diese Messmethode setzt allerdings eine neuronale Zeitauflösung im µs-Bereich voraus. Da sie die Entfernung auch mit einem einzigen Seitenlinienorgan richtig abschätzen, ist die Bestimmung des Krümmungsradius für die Distanzbestimmung nicht notwendig. Oberflächenwellen können auch zur Kommunikation benutzt werden. Bei Gefahr ,,ruft“ z.B. das Männchen des Kampffisches Betta spiendens seine Jungen zu sich, indem es sich schräg an die Wasseroberfläche hängt und mit der Brustflosse zitternde Bewegungen macht, welche Oberflächenwellen auslösen. Im Umkreis von 40 cm schwimmen alle Jungfische zu ihm hin. Man kann das Verhalten auch mit einer künstlichen Reizquelle von 8–10 Hz und einer Amplitude von 13 µm auslösen und innerhalb einer Minute alle Fische um die Reizquelle versammeln. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 41 42 Sinnesleistungen bei Tieren – mechanisch 20. Beispiele für die Kommunikation über den Boden (seismische Signale) Amphibien Wenn Frösche im Ufergebüsch rufen, erzeugen sie manchmal nicht nur Luftschall, sondern auch Vibrationen im Boden, die entstehen, wenn die sich aufblähende Schallblase fast explosionsartig auf dem Boden aufschlägt. Diese Bodenvibrationen werden als seismische Reize oder Substratschall bezeichnet. Der mittelamerikanische Weisslippenfrosch (Lepto dactylus albilabris) sitzt halb im Schlamm und erzeugt bei seinen Werbe- und Angriffsrufen niederfrequenten Bodenschall (Spitzenfrequenz ca. 50 Hz), der sich mit ca. 100 m/s flächig ausbreitet und in 1 m Entfernung noch eine Beschleunigung von 2·10–3 g aufweist (Abb. 5.39). Sacculus-Nervenfasern ant- Säugetiere Säugetiere, die in unterirdischen Gängen oder auf Sanddünen leben, trommeln mit den Hinterbeinen, um zu kommunizieren (Abb. 5.40a). Der grosse, blinde Kap-Blessmull (Georhychus capensis; Gewicht 180–360 g) lebt einzeln in bis zu 130 m langen Gangsystemen. Zu Nachbarn halten die Tiere beim Graben ihrer Gänge ca. 1 m Abstand. Diese Einzelgänger kommunizieren beim Werben um ein worten auf solchenBodenschall besonders empfind lich (Schwelle für 10–80 Hz bei 10–6 g. Aber auch niederfrequent abgestimmte Hörnervenfasern aus der Amphibienpapille mit besten Frequenzen <500 Hz reagieren auf seismische Reize. Substratschall nutzen Froschmännchen u.a. um sich beim Werbechor mit ihren Rufen in die Rufpausen einzuklinken. Bei einem malayischen Baumfrosch (Polypedores) sitzen die Weibchen auf Schilfstengeln und Blättern und trommeln mit den Zehen ihrer Hinterbeine. Diese Substratsignale locken Männchen, die auf benachbarten Halmen sitzen, zur Kopulation an. W e i b chen durch Fusstrommeln. Die Sequenzen solcher Bodenschallsignale sind nicht nur geschlechtsspezifisch, sondern auch individuell unterschiedlich und könnten den Sender zu erkennen geben. Die Ohren der blinden Mullarten sind an den niederfrequenten Bereich des Bodenschalls angepasst. Der Malleus des Mittelohres ist mächtig und Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 43 wiegt z.B. bei Emeritalpa 45 mg, ist also um mehr als 17 mg schwerer als der des ungleich grösseren Menschen. Der Graumull (Crypromys) bildet auf der Basilarmembran des Innenohrs das Frequenzband von 0,6 bis 1 kHz gespreizt in einer Hörfovea ab. Die kleinen, blinden Goldmulle (Eremitalpa granti der Namibwüste scheinen Bodenschall zum Beutefang zu nutzen (Abb. 5.40b). Sie gehen nachts auf den Sanddünen auf Insektensuche, wobei sie es vor allem auf Termiten abgesehen haben. Sie trippeln rasch über den Sand, wobei sie immer wieder den Kopf kurz in den Sand stecken oder streckenweise regelrecht im Sand unmittelbar unter der Oberfläche schwimmen. Dabei steuern die blinden Tiere zielge- 44 richtet Termitenhügel an, die sie über Bodenschall lokalisieren: wenn der Nachtwind über die meist mit Gras bewachsenen Termitenhügel streicht, entsteht Bodenschall, der bei 300 Hz um 30 dB stärker ist als der Wind-erzeugte Bodenschall auf der Dünenoberfläche. Den auf den Hügeln erzeugten Bodenschall hören die Tiere beim Sandschwimmen ab oder wenn sie den Kopf in den Boden stecken. Er führt sie zielgerichtet aus bis zu 20 m Entfernung an die Hügel heran. Ab etwa 1 m Entfernung vom Hügel signalisieren Bodengeräusche der Termiten, ob der Hügel bewohnt ist oder nicht. Die Tiere nutzen also sehr geschickt den homogenen Wüstensand als Detektionsmedium für Bodenschall, der sie mit hoher Sinnesleistungen bei Tieren – elektrisch 21. Elektrorezeption Zu den “Wundern der Natur” zählten seit alters her elektrische Fische, Welsarten und Zitterrochen, die mit besonderen, aus Muskeln oder Nerven entstandenen, elektrischen Organen Spannungspulse entladen können. Die Entladungen von bis zu 350 V sind wirksame Abwehrwaffen, eignen sich aber auch zum Betäuben von Beutefischen. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden Fische entdeckt, die elektrische Entladungen von so geringer Spannung abgeben, dass sie als Waffe nicht in Frage kommen. Zum andern wusste man seit langem, dass es bei elektrischen, aber auch nicht-elektrischen Fischen in der Haut Sinnesorgane gibt – Ampullen, Knollenorgane, Mormyromasten –, deren Funktion unbekannt war. Ein klassischer Verhaltensversuch löste das Rätsel: Haie, die in ihrer Haut zahllose Ampullenorgane besitzen, können im Sand eingegrabene, lebende Schollen entdecken und lokalisieren. Der Hai schwimmt jedoch achtlos über die Scholle hinweg, wenn diese in einem elektrisch isolierenden Plastikkasten lag, der die biogenen elektrischen Felder abschirmte. Vergrub man im Sand anstelle der Scholle zwei geladene Elektroden, suchte der Hai fieberhaft über diesem elektrischen Feld nach Futter, selbst dann, wenn daneben zerhakktes Schollenfleisch aus dem Sand herausduftete. Elektrosensitivität gibt es bei bestimmten Gruppen von Knorpel- und Knochenfischen, bei Neunaugen und bei aquatisch lebenden Amphibien. Die Elektrorezeptoren haben sich stammesgeschichtlich aus den Seitenliniensystemen entwickelt. Dafür sprechen: • die Repräsentation der Elektrorezeptoren in den Gehirnzentren des Seitenliniensystems, • die Rezeptoren, die den Haarzellen der Seitenlinienorgane gleichen. Die Wahrnehmung elektrischer Felder wird in verschiedenen Zusammenhängen eingesetzt. Elektrische wie nicht-elektrische Fische benutzen ampulläre Rezeptoren zur Detektion und Lokalisierung lebender Objekte. Die schwachelektrischen Fische erzeugen lange puls- oder wellenförmige Entladungsfolgen mit art- und geschlechtsspezifischen Frequenzen von 0,1 bis 10 kHz und Feldstärken von 1 µV/cm bis 100 mV/cm. Diese schwachen Wechselfelder benutzen die Fische zur Elektroortung und zur Kommunikation. Es gibt zwei grosse Familien schwachelektrischer Fische, die Mormyriden oder Nilhechte aus schlammreichen Flüssen Afrikas und die Gymnotiden oder Messeraale aus den Schwarzwasserflüssen Südamerikas. Die meisten Mormyriden entladen pulsartige Signale mit breitbandeigem Spektrum in unregelmässiger Folge von einigen bis 100 Hz. Viele Gymnotiden sind „wave-type“ Entlader, die kontinuiertlich sinusähnliche Signale mit schmalbandigem Spektrum und Frequenzen von etwa 40–2000 Hz aussenden (Abb. 7.1). Elektrorezeptororgane Ampullenorgane sind die stammesgeschichtlich ältesten Elektrorezeptoren, die in der Haut aller elektrosensitiven Fische vorkommen. Durch Epidermisinvagination sind sie in die Tiefe der Haut versenkt und stehen nur über Schleim-gefüllte Kanäle mit dem Wasser in Verbindung (Abb.7.3). Die Kanalgallerte hat einen elektrischen Widerstand von nur 25–30 Ohm·cm2, die Haut dagegen 3 kOhm·cm2. Sie dient als Ionenpuffer, der die K+-angereicherte Ampulle gegen das Aussenmedium schützt. Die Kanalwände isolieren elektrisch gut. Mit ihrer Membrankapazität schliessen sie hochfrequente Signale kurz (Abb. 7.3) und wirken so umso mehr als Tiefpassfilter für die Rezeptoren, je länger die Kanäle sind. Am Grunde einer Ampulle sitzen drei oder vier bis mehrere 100 Elektrorezeptoren von Stützzellen umgeben so tief in der Ampullenwand, dass nur das apikale Membranende mit dem Kanallumen Kontakt hat. Die in die Haut eingebetteten Zellwände sind mit den Nachbarzellen ionendicht verknüpft, so dass nur durch die apikale Membranfläche Strom fliessen kann. Gleichzeitig wirkt die kleine Membranfläche als Filter, das nur auf Wechselfelder niederer Frequenz, bis ca. 50 Hz, antwortet. Dadurch wird das System vor Gleichspannungen des eigenen Körpers geschützt. Externe Gleichspannungsquellen können gleichwohl erkannt werden, wenn die Fische sich mit ihren Elektrorezeptoren durch das externe elektrische Feld bewegen. Diese Struktur macht Ampullenrezeptoren zu hochempfindlichen Spannungsdetektoren, die schon auf Spannungsgradienten von 0,1–5 µV/cm ansprechen (Abb. 7.2). Durch die Rezeptoren fliesst ein ständiger Ruhe-Gleichstrom, der sie tonisch aktiviert (Abb. 7.2c). Elektrische Spannungsgradienten über der Haut modulieren diese gleichförmige Ruheentladung je nach Polarität nach oben oder unten. Insgesamt besteht eine hohe Empfindlichkeit für kleinste Spannungsgradienten in beide Richtungen, die aber rasch adaptiert (Abb. 7.2). Im Zentralnervensystem werden die Eingänge von Ampullenorganen zusammengeschaltet, wodurch die Empfindlichkeit gegenüber dem Rezeptorniveau um Zehnerpotenzen erhöht wird. In Verhaltenstests reagieren Z.B. Haie und Rochen noch auf Spannungsgradienten von 5 nV/cm. Das hochempfindliche Ampullensystem dient der Elektrolokation. Alle lebenden Organismen erzeugen mit ihren Zellaktivitäten schwache, niederfrequente elektrische Felder, auf die das Ampullensystem anspricht. Damit lassen sich unbewegliche, im Wassergrund oder der Vegetation versteckte Tiere lokalisieren (Abb. 7.4). Die Dichte der Ampullen in der Haut verrät, wie sehr eine Fischart auf einen solchen Nahrungserwerb angewiesen ist. Die empfindlichen Ampullen der Elasmobranchier können die Vektoren des Erdmagnetfelds an den winzigen elektrischen Strömen erkennen, welche die Fische durch ihre eigene Bewegung im Magnetfeld induzieren. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 45 Tubulusorgane Die schwach elektrischen Fische besitzen zusätzliche Elektrorezeptoren, die auf ihre eigenen, hochfrequenten elektrischen Entladungen abgestimmt sind. Diese Tubulusorgane sitzen ebenfalls tief in der Haut versenkt (Abb. 7.3). Sie sind zum Wasser hin durch Schichten von Deckzellen abgeschlossen und dadurch kapazitiv mit dem Wasser gekoppelt. Tubuläre Organe wirken daher wie Hochpassfilter und antworten nur auf hochfrequente Wechselfelder. Der Rand des Organs wirkt durch wie eine elektroundurchlässige Umfassung, so dass die Deckzellen unmittelbar über dem Tubulusrezeptor wie eine elektrische Linse die Spannungsgradienten auf das Tubulusorgan lenken. Abb. 7.1a,b. Die elektrischen Entladungen schwach elektrischer Fische. a Formen elektrischer Entladungen (EOD electric organ discharge) und ihre häufigsten Frequenzen bei den unterschiedlichen Fischgruppen. b Schematische Darstellung einer pulsförmigen (pulse-type EOD) von und einer wellenförmigen Entladung (wave-type EOD). Rechts: Jeweils das zugehörige Frequenzspektrum. a nach Bullock u. Heiligenberg 1986; b nach Metzner u. Viete 1996 Abb. 7.2. a Schematische Darstellung der Lage des elektrischen Organs und der Elektrorezeptoren in der Haut (Rezeptorareale) beim Mormyriden Gnathonemus petersii. b Schema eines ampullären Elektrorezeptors, der ionendicht in die Haut eingebettet ist. Der elektrische Widerstand der apikalen Membran ist geringer als der der basolateralen Rezeptormembran. ‚ Der spontan aktive, afferente Nerv des Rezeptors (1) ist sehr empfindlich für Ströme, die nach innen (2, Erregung) und nach aussen (3, Hemmung) durch den Rezeptor fliessen. Aus Eckart -Randall 1986 46 Abb. 7.3. Schematische Darstellung von Elektrorezeptortypen. Ampullenorgane gibt es auch bei nicht-elektrischen Fischen, Tubulusorgane bei Gymnotiformen. Aus Bullock u. Heiligenberg 1986 und Metzner u. Viete 1996 Sinnesleistungen bei Tieren – elektrisch 22. Kommunikation und Ortung mit elektrischen Feldern Kommunikation bei schwach elektrischen Fischen Durch die Parallelverarbeitung wichtiger Parameter – wie Phase, ansteigende oder abnehmende Amplitude (Tubulusorgane), Gleichspannungsanteile (Ampullenorgane) – und deren neuronale Verstärkung und Kombination in höheren Hirnzentren können die Mormyriden und Gymnotiden die Form von elektrischen Wechselfeldern genau differenzieren. Sie nutzen diese Fähigkeit aus, um anhand der Entladungsformen und Wiederholraten Artgenossen von Artfremden und innerhalb der Art Individuen, z.B. Geschlechtspartner, zu unterscheiden (Abb. 7.10). Fremdentladungen können grundsätzlich an den entgegengesetzten Vorzeichen über Rezeptoren der linken und rechten Körperseite erkannt werden (Abb. 7.11). Es ergab sich, dass selbst Individuen aufgrund des Zeitverlaufs, der relativen Amplitude und des Spektrums identifiziert werden können. Beim Messerfisch Eigenmannia (Gymnotide) variiert die Entladefrequenz individuell zwischen 150 und 600 Hz, wobei dominante Männchen die niedrigsten, und dominante Weibchen die höchsten Entladefrequenzen haben. Die elektrischen Signale dienen also auch der sozialen Interaktion. Bei der Balz und Aggression zerhacken Männchen von Eigenmannia ihre kontinuierlichen Entladungen zu kurzen Salven (chirps). Dazwischen liegen bis zu 2 s lange Pausen mit einem Gleichspannungsfeld (Kopf negativ gegenüber Schwanz). Die chirps werden von den Tubulusorganen, die Gleichspannungskomponente von den Ampullenorganen kodiert (Abb. 7.11). Im Mittelhirn finden sich Neurone, die von Tubulusund Ampullensystem Eingänge erhalten und spezi- Abb. 7.10 Artund Geschlechtsspezifität der Entladungsformen des elektrischen Organs (EOD) adulter Individuen von zehn Mormyridenarten. Positive Entladungen sind nach oben gerichtet. Nach Alves-Gomes 1997 Abb. 7.11 Elektrokommunikation. Für die soziale Kommunikation sendet Eigenmannia spec. (Gymnotidae) kurze Salven elektrischer Entladungen (chirps) aus. In den Pausen bleibt die Spannung negativ. Während Elektrorezeptoren der linken und rechten Seite des Senders diese chirps mit gleichem Vorzeichen rezipieren (Pfeile), nehmen die Elektrorezeptoren eines benachbarten Fisches (blau) als Empfänger des Fremdsignals die chirps links und rechts mit entgegengesetztem Vorzeichen wahr (blau). Unten: Die chirps werden durch das Tubulussystem als Hochpassfilter analysiert, während das Ampullensystem als Tiefpassfilter die Umhüllende der chirpsSequenzen kodiert. Nach Metzner u. Viete 1996 fisch auf solche chirps antworten. Weibchen dieser Fische laichen nur, wenn sie längere Zeit solchen elektrischen chirps balzender Männchen ausgesetzt waren. Aggressionsbereitschaft wird oft durch Erhöhen der Sendefrequenz signalisiert. Feldbeobachtungen an diesen nachtaktiven oder in trüben Gewässern lebenden Fischen sind schwierig, deshalb gibt es noch keine verlässlichen Daten, in welchem Ausmass elektrische Signale das Sozialverhalten der schwach elektrischen Fische steuern. In jedem Fall beschränkt sich Elektrokommunikation auf den Nahbereich, bei 20 cm langen Mormyriden z.B. auf einen Umkreis von maximal 1 m. Elektroortung bei schwach elektrischen Fischen Wenn ein Gymnotide oder Mormyride nahe an Gegenständen vorbeischwimmt, erzeugen deren elektrische Eigenschaften lokale Amplituden- und Phasenmodulationen des vom Fisch erzeugten Wechselfelds (Abb. 7.12). Objekte mit geringerem elektrischem Widerstand als das Wasser verdichten das lokale elektrische Feld, solche mit höherem Widerstand dünnen es aus. Auf der elektrosensorischen Hautfläche werden die Objekte mit einem schmalen antagonistischen Umfeld abgebildet (Abb. 7.12c). Da das elektrische Feld mit der Entfernung vom Fisch rasch abnimmt Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 47 Abb. 7.12a–c Elektrodetektion. a Gegenstände verändern das vom Fisch erzeugte elektrische Feld. Gute elektrische Leiter, wie Tiere und Pflanzen, verdichten Feldlinien; schlechte Leiter, wie Steine, werden von den Feldlinien umflossen. b Amplitudenmodulation des elektrischen Feldes durch einen guten (Metall) und einen schlechten Leiter (Plastik) in Abhängigkeit von der Entfernung (cm-Angaben). Durch diese Modulationen wird der Gegenstand auf der elektrosensorischen Haut repräsentiert. c Das Elektrobild eines Gegenstandes hat ein antagonistisches Umfeld (äusserer, negativer Ring), das den Kontrast erhöht. Die Grösse des Elektrobildes auf der Haut hängt von der Entfernung des Objektes ab. Nach v. d. Emde 1999a. eignet sich die Elektrolokation nur für die nächste Umgebung; eine Faustregel besagt, dass die Reichweite etwa der halben Fischlänge entspricht. Ausserdem sind die Modulationen gering. Ein exzellenter elektrischer Leiter, z.B. ein Messingstab von 11 mm Durchmesser, erzeugt in 4 cm Entfernung von der Fischhaut eine Amplitudenmodulation von nur 1%. Schwachelektrische Fische explorieren daher Gegenstände, indem sie nahe daran vorbeischwimmen und die lokalen Differenzen der Feldmodulationen neuronal auswerten (Abb. 7.12c). Die elektrische Abbildung ist begrenzt, und die “Elektrobilder” sind verschwommen. Die Fische setzen die Elektrolokation bei der Nahrungssuche als Hilfsmittel ein. Mormyriden leben u.a. von Zuckmückenlarven. Solange sie ihre Beute sehen können, dominiert bei der Suche das Auge und erst in der Dunkelheit spielt Riechen zusammen mit Elektrolokation eine grössere Rolle. Mit der Leitfähigkeit des Wassers nimmt die Amplitude des elektrischen Feldes rasch ab. Im Experiment konnten Fische Gegenstände nicht mehr elektrisch lokalisieren, wenn die Leitfähigkeit des Wassers 1 mS/cm überstieg, vermutlich weil die Feldstärken in gut leitendem Wasser zu gering wurden. Gymnotiden sind in ihren Flüssen Wasserleitfähigkeiten von 0,1 mS/cm in der Trockenzeit, und bis ca. 1–10 µS/cm in der Regenzeit ausgesetzt. Die in Laborversuchen nachgewiesenen Abbildungsmöglichkeiten des elektrosensitiven Systems sind erstaunlich differenziert. Da es jedoch nur im unmittelbaren Nahbereich funktioniert, ist es fraglich, ob die Elektrolokation im Leben dieser Fische eine so grosse Rolle spielt. 48 Elektroortung bei Säugetieren Ein eindrucksvolles Beispiel für konvergente Evolution liefert die Elektrosensitivität beim Schnabeltier. Bei Ornithorhynchus anatinus, dem australischen Schnabeltier, wurden auf dem Hornschnabel, mit dem das Tier das Wasser nach Kleinlebewesen (z.B. Krebsen) durchsucht, an den Rändern Elektrorezeptoren entdeckt und in Verhaltensversuchen gezeigt, dass das Schnabeltier Gleich- und Wechselstromquellen orten kann. Dieses Elektrorezeptionssystem ist de novo aus dem somatosensorischen System entstanden. Die Detektionsschwellen liegen beim Schnabeltier bei ca. 50 µV/cm. Freie Nervenendigungen in Schleimdrüsen des Schnabelrandes bilden die Elektrorezeptoren. Jede Schleimdrüse enthält im Schnitt 16 freie Nervenendigungen, die ringförmig miteinander verbunden sind und so vermutlich das Signal-/Rauschverhältnis verbessern.. Das Schnabeltier lebt in trüben Gewässern und schliesst die Augen und die Nasenöffnungen, wenn es unter Wasser jagt. Elektrorezeptoren liefern im Nahbereich wahrscheinlich die wichtigsten Informationen, um Beute erfolgreich fangen zu können. Chemische Signale: Pheromone Kommunikation und Wegweisung mittels chemischer Signale gibt es schon bei Einzellern Kommunikation über chemische Stoffe ist die evolutionsgeschichtlich älteste Form der Informationsübermittlung zwischen den Mitgliedern einer Fortpflanzungsgemeinschaft. Chemische Signale tauschen schon Bakterien und Einzeller aus. Mit der Entfaltung der vielzelligen Organisation wurden solche Signalsubstanzen, insoweit sie Botschaften innerhalb des vielzelligen Verbandes vermittelten, zu Hormonen und Transmittern. Andererseits blieb auch chemische Kommuni kation zwischen verschiedenen vielzelligen Verbänden über das Aussenmedium Wasser oder Luft erhalten. Beispielsweise dienen chemische Signale auf mehreren Ebenen der sexuellen Fortpflanzung. Unbewegliche, mit materiellen Resourcen vollbeladene weibliche Gameten (Makrogameten, Eier) senden flüchtige Stoffe aus, um die kleineren, beweglichen Gameten (Mikrogameten, Spermien) anzulocken. Man nennt solche zwischen Gameten wirksame Sexuallockstoffe Gamone. Gamone wiederum zählen zu den Pheromonen. Zu diesen zählen auch die Sexuallockstoffe, die ein Rendesvouz zwischen den Produzenten der Gameten vermitteln. Lüfte fliegen soll, sollte flüchtig sein. Flüchtig sind niedermolekulare, lipophile (apolare oder gering polare) Substanzen. Die Mehrzahl der bisher identifizierten Pheromone sind Fettsäuren, flüchtige Derivate von Fettsäu ren oder KohlenwasserstoffKetten mit Doppelbindungen an dieser oder jener Stelle. Pheromone vermitteln Botschaften zwischen den Mitgliedern einer Art Die Pheromone der Insekten bilden eine wortreiche chemische Sprache Definition: Pheromone sind Signalsubstanzen, die von einem Individuum nach aussen abgegeben werden und bei anderen Individuen der gleichen Art spezifische, vorprogrammierte Reaktionen auslösen. Pheromone können • instinktive (angeborene) Verhaltensweisen auslösen; dies tun z. B. Sexuallockstoffe, die Männchen und Weibchen zusammenführen; • hormonale Wirkungen haben; dies tun z.B. Pheromone, die Fortpflanzungszyklen synchronisieren; dies tut auch die Königinsubstanz der Honigbiene, die dafür sorgt, dass keine Konkurrentin herangezogen wird. • Pheromone können auch Alarmfunktion haben und Artgenossen vor Fressfeinden warnen (z, B. Schreckstoffe verletzter Fische). Das erste chemisch identifizierte Pheromon mit verhaltenssteuernder Wirkung war der Sexuallockstoff des Seidenspinners Bombyx mori (isoliert und identifiziert aus Tonnen von weiblichen Faltern durch Adolf Butenandt und Mitarbeiter. 1959). Die Substanz, Bombykol, zeigt in ihrer chemisch-physikalischen Struktur (Abb. 24.2) die Charakteristik vieler solcher Signalsubstanzen. Was durch die In Insektenstaaten (Termiten, Ameisen, Bienen) sind derart viele chemische Signalsubstanzen im Gebrauch, dass man von einer chemischen Sprache sprechen kann. Einer einzigen Ameise stehen schätzungsweise an die 30 Pheromone zur Verfügung, mit denen sie Botschaften an ihre Genossinnen übermitteln kann. Wenn man optischen und akustischen Signalen Symbolcharakter zuschreiben kann, warum nicht auch chemischen Signalen, die Botschaften vermitteln wie “Folge mir”, “Hau ab”? Zu den Pheromonen der staatenbildenden Insekten gehören auch jene Substanzgemische, die den besonderen Stock- bzw. Familienduft einer Kolonie ausmachen. Säuger: Während im Körperinneren Hormone herrschen, haben in den sozialen und sexuellen Beziehungen der Individuen untereinander Pheromone das Sagen Die Mehrzahl der Säugetiere in unseren geographischen Breiten verfolgt eine Überlebensstrategie. die sichert, dass Junge zeitig im Frühjahr zur Welt kommen. Das Fortpflanzungsverhalten muss in die Quelle: W. Müller (2004) Tier- und Humanphysiologie, 2. Auflage. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Jahreszeit eingepasst werden. In seinen groben Zügen wird der Jahreszyklus der Fortpflanzung von der Photoperiode gesteuert. Doch auch Pheromone sind im Spiel, wenn es um die Feinregulation und die exakte Synchronisation geht. Häufig beobachtet man folgende Sequenz: Die Männchen erobern sich ein Revier und grenzen es mit Duftmarken ab. Solche Duftstoffe dürfen nach ihrer Funktion als Pheromone klassifiziert werden. Ein Männchen, das sich ein Revier eingerichtet hat, verlockt mit der besonderen Qualität seines Pheromonduftes Weibchen, in sein Revier einzuwandern (männliche Sexuallockstoffe), Das männliche Parfum kann darüber hinaus die Damen des angeworbenen Harems dazu bringen, zeitig Eier in den Ovarien heranreifen zu lassen. Das follikelstimulierende Hormon FSH vermittelt zwischen Geruchssinn und Ovar: Das stimulierte Riechorgan sendet Signale ins Zwischenhirn. dieses regt seinerseits mittels ReleasingNeurohormone die Hypophyse an. FSH in die Blutbahn zu entlassen. Das Weibchen demonstriert schliesslich seine Bereitschaft, es gerne mit sich geschehen zu lassen, nicht nur mit Gebärden, sondern auch mit Wohlgerüchen, die dem Herrn ihren Östrus anzeigen. Östrus (“Hitze, Läufigkeit”) ist jene Phase im Sexualzyklus, in der ein Eisprung (Freisetzung des Eis aus dem Ovar in den Eileiter) bevorsteht oder eben gerade stattgefunden hat. 1st schliesslich ein Junges geboren, gerät nicht nur das Kind, sondern auch die Mutter in eine Phase der Prägbarkeit. Der Individualduft des Kindes und der Individualduft der Mutter werden zum bleibenden Bindeglied zwischen Mutter und Kind. 50 Im Staat der Bienen Bienen verdienen unser Interesse und unseren Respekt nicht bloß als fleissige Honigsammlerinnen. Angesichts der perfekten Organisation eines Bienenstaates und den unwahrscheinlichen Leistungen ihrer Augen und ihres kleinen Gehirns kann man nur in ehrfürchtiges Staunen geraten. Als erstes wird von der Königin die künftige soziale Rolle eines neuen Mitgliedes festgelegt. Dabei spielen chemische Signale eine Rolle Kurz bevor die Königin ein Ei legt, entscheidet sie erst einmal über das genetische Geschlecht des Nachkommen. Ein unbefruchtetes Ei wird zum haploiden Drohn, ein befruchtetes zum genetischen Weibchen. Doch solange sie selbst ihres Amtes waltet, gute und viele Eier produziert und das Volk noch nicht an Platzmangel im Stock leidet, soll keines dieser Weibchen zur Konkurrentin werden. Sie sollen sich fügen und als Arbeiterinnen den Nachwuchs der Königin pflegen. Die geschäftig herumkrabbelnden Arbeiterinnen sind keine Konkurrentinnen. Sie sind irreversibel auf ihre dienende Rolle festgelegt. Wohl könnte es den Arbeiterinnen einfallen, eine neue große Königinzelle (Weiselzelle) anzulegen und darin mit ihrer Ammenmilch eine neue Königin hochzuziehen. Damit dies nicht geschieht, sondert die Königin eine Königinsubstanz (queen substance) ab: eine Kollektion von ungesättigten Fettsäuren mit 10 Kohlenstoffatomen und einer Ketooder einer Hydroxygruppe am Kohlenstoffatom Nr. 9. Die Königinsubstanz ist ein Pheromon mit hormonaler Wirkung und zugleich eines der seltenen Pheromone, das im Empfanger nicht über ein Geruchsorgan wirksam wird. Die Substanz bzw. das Substanzgemisch wird über die Mandibulardrüse ausgepresst. Die Arbeiterinnen lecken das Sekret auf. Es verhindert in ihnen die Auslösung eines instinktiven Verhaltensprogramms, das zur Aufzucht einer neuen Königin führen würde. Larven, deren Schicksal es sein soll, Arbeiterin zu werden, bekommen nur drei Tage lang reine “Ammenmilch”. Dann werden Pollen und Honig zugemischt und der Gehalt an Hexosezuckern wird von 35% auf 10% reduziert. Vermutlich werden dem Futter auch noch Pheromone zugemischt. So großgezogene Bienen erheben keinen Anspruch auf den Thron. Sie werden als Arbeiterinnen ihr ganzes Leben damit verbringen, selbstlos den Nachwuchs ihrer königlichen Mutter (oder Schwester) zu pflegen. Ist die Königin zu alt, um ausreichend Königinsubstanz zu produzieren, oder ist das Volk zu groß, so dass nicht mehr alle Arbeiterinnen ausreichend von dem drogenversetzten Trank mitbekommen, werden wach gewordene Arbeiterinnen Königinnenzellen (Weiselzellen) anlegen. Das geschieht auch, wenn beim Schwärmen im Frühjahr die alte Königin mit einem großen Teil der Arbeiterinnenschar ihre Heimat verlässt. Das zurükkbleibende Volk legt Weiselzellen an. Künftige Königinnen werden mit purer Ammenmilch (jetzt Gelee royale genannt) aufgezogen. Geschäftstüchtige Imker haben gutgläubige Kunden überzeugt, teures Gelee royale verhindere Altern. Eine junge Königin macht durch Gesänge auf sich aufmerksam; ihre Gefolgschaft antwortet im Chor Aufnahmen mit moderner Tontechnik haben ein erstaunliches Konzert für unser Ohr hörbar gemacht: Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 51 Eine junge Königin meldet sich mit einem besonderen Sologesang. Mittels ihrer Flugmuskulatur erzeugt sie Vibrationen, die sich als Substratschall über die Bienenwabe ausbreiten. Dem “Tüten” der Königin antwortet die Arbeiterinnenschar mit “Quaken”, Ob die Königin auch potentielle Freier anlockt? Jedenfalls geht es bald auf den Hochzeitsflug. Ist er erfolgreich, werden Eier produziert. Bald wird der erste eigene Nachwuchs der Königin zu Dienste stehen. Ein Arbeitskalender bestimmt den Lebenslauf Eine Arbeiterin übernimmt in den ersten 30 Tagen ihres Lebens in geregelter Reihenfolge mehrere verschiedene Arbeitsdienste, vom Reinigungsdienst bis zur Sammeltätigkeit im Außendienst (Abb.24.3). Von dieser Dienstlautbahn kann im Bedarfsfall abgewichen werden. Wenn allzuviele Sammlerinnen der Unbill des Wetters oder Räubern zum Opfer gefallen sind, kürzen Jungbienen den Innendienst ab. Kommen andererseits die Ammen mit dem Füttern der Larven nicht mehr nach, können Sammlerinnen ihre Ammendrüsen reaktivieren und beim Füttern behilflich sein. Vermutlich geschieht die bedarfsorientierte Feinregulierung der Dienstzeiten über chemische Kommunikation. Nach dem Ableisten des Innendienstes folgt endlich der befreiende Erstflug zu den Honigtöpfen. Man fliegt berauscht von Blume zu Blume; doch wie findet man zurück? 52 Orientierung und Tanzsprache der Bienen Sonnenkompass, innere Uhr, Tanzsprache: ein erster Überblick Der aus dem Salzburgischen Land stammende, als Professor für Zoologie in München lehrende Karl von Frisch (Nobelpreis 1973; zusammen mit K. Lorenz und N. Tinbergen) wusste aus seinen Forschungen immer wieder Erstaunliches zu erzählen: • Bienen können bei ihren Flügen einen bestimmten Winkel zur Sonne einhalten (Sonnenkompass; allgemein: Menotaxis = bleibende Winkeleinstellung zur Informationsquelle). Bei dieser Winkeleinstellung kommt es vor allem auf den Azimut an; das ist der Winkel auf dem Horizontkreis zwischen der Sonne und dem Anflugsziel. Im Bedarfsfall, wenn der Zielpunkt beispielsweise auf einer Bergwand oder unter dem Dachfirst liegt, kann auch ein bestimmter Höhenwinkel eingehalten werden. Zum Rückflug kann jeder Winkel um 180° gedreht werden. • Die Biene weiß jedoch auch, dass man nicht den ganzen Tag den gleichen Winkel zur Sonne einhalten darf, wenn man das Ziel nicht verfehlen will. Hat die Biene morgens eine ergiebige Tracht gefunden, findet sie diese auch am späten Nachmittag, selbst wenn sie mittlerweile wegen Sturm und Regen im dunklen Stock warten musste. Sie kennt den Lauf der Sonnenbahn. Sie “weiß” (wahrscheinlich gänzlich unbewusst), dass die Sonne auf ihrer Kreisbahn über den Himmel sich pro Stunde um 15° weiterbewegt. • Um im dunklen Stock die Sonnenwanderung entlang dem Azimut vorausberechnen zu können, braucht die Biene eine präzise innere Uhr, Verlässt die Biene am Nachmittag wieder den dunklen Stock, weiß sie, welchen neuen Winkel beim Abflug sie einhalten muss, um das am Morgen entdeckte Ziel wiederzufinden. Einer der vielen einfallsreichen Versuche von Karl von Frisch war folgender: Einer Biene wird nach längerer winterlicher Hungerzeit gegen Abend eine ergiebige Futterquelle angeboten. Sie will diese Entdeckung unbedingt ihren Kolleginnen im Stock mitteilen und tanzt die ganze Nacht; dabei dreht sie synchron mit dem Stundenzeiger der Uhr ihre Tanzrichtung, so dass morgens ihre Anweisung direkt zum Ziel führt. Schwänzeltanz und Transposition. Die Entdeckung und Entschlüsselung der Tanzsprache durch Karl von Frisch ist damals zu Recht als Sensation ersten Ranges empfunden worden. Bienen haben eine Symbolsprache, die es ihnen erlaubt, im dunklen Stock ihren Genossinnen mitzuteilen, wo eine ergiebige Futterquelle (Tracht in der Sprache der Imker) zu finden ist. Die Kommunikationsmittel der Biene sind von unterschiedlichem Komplexitätsgrad, je nach erforderlicher Präzision. In der höchsten Stufe der Kommunikation, verwirklicht im Schwänzeltanz, teilt die Biene mit, in welchem Winkel zur Sonne man fliegen muss, um ein angepriesenes Ziel anzusteuern; dabei macht die Biene etwas Unglaubliches: Da sie im dunklen Stock nicht direkt auf die Sonne zeigen kann transponiert die Biene den Winkel zur Sonne in einen Winkel zur Schwerkraft. • Im Verlauf ihres Schwänzeltanzes teilt die tanzende Biene auch mit, in welcher Entfernung die angepriesene Futterquelle liegt und wie hoch der zu erwartende Trcibstoffverbrauch ist; wie gut sich also nach ihrem Dafürhalten ein Flug lohnt. Und dafür benutzt sie eine akustische Sprache – wie Delphin und Mensch. Einzelne dieser aufgelisteten Leistungen betrachten wir im Folgenden näher, Bei nahen Zielen genügen der werbende Rundtanz, Duftproben und Duftmarken Fündige Suchbienen bringen eine Duftprobe mit, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und um es den Genossinnen, die sie anwerben will, zu ermöglichen, die angepriesene Futterquelle per Geruchsinn zu identifizieren, Um die Ortung des Ziels zu erleichtern, hat sie nicht nur eine Duftprobe mitgebracht, sondern umgekehrt vor ihrem Heimflug besonders ergiebige Blumen mit einer eigenen Duftmarke versehen, Diese Marke ist definitionsgemäß ein Pheromon; chemisch ist es der Terpenalkohol Geraniol. Ist die Tracht nicht mehr als 100 m weit, begnügt sich die Heimkehrerin mit einem einfachen, werbenden Rundtanz, um weitere Sammlerinnen zu rekrutieren. Sie dreht Kreise mit plötzlichen Kehrtwendungen (Abb. 24.4). Die mitgebrachte Duftprobe und die ausgebrachten Duftmarken genügen in der Regel den ausfliegenden Sammlerinnen, die Tracht zu finden. Mitunter fliegt die Vortänzerin auch los und geleitet persönlich nachfolgende Sammlerinnen zur Futterquelle. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 53 Es gibt eine zweite Situation, bei der der Rundtanz gezeigt wird: nach der erfolgreichen Suche einer Nisthöhle. Ein Schwarm. der den Heimatstock verlassen hat, hängt wartend als Traube an einem BaumasI, um die neue Königin geschart. Suchbienen schwärmcn aus, um nach einer geeigneten Nisthöhle Ausschau zu halten, Haben sie eine mögliche Unterkunft entdeckt. teilen sie dies, auf der Oberfläche der Schwarm traube tanzend, anderen Bienen mit. Diese sollen ihnen nachfliegen und den Platz ebenfalls inspizieren. Sind ausreichend viele Bienen von der Qualität der potentiellen Nisthöhle überzeugt, regt ihr gemeinschaftlicher lebhafter Tanz den Schwarm an, ihnen zur neuen Heimat zu folgen. Der Schwänzeltanz: eine komplexe Symbolsprache, bei der Tanz und Gesang Richtung und Entfernung einer Tracht angeben. Zur korrekten Interpretation der Sprache braucht man auch noch eine Uhr Wie kann man auf einer lotrecht hängenden Wabe anderen mitteilen, in welcher Himmelsrichtung eine entfernte, ergiebige Tracht zu finden ist? Wir sehen uns erst die Grundfigur des Tanzes an. Grundfigur des Schwänzeltanzes. Die tanzende Biene durchläuft eine Achterfigur (Abb. 24.5). Zuerst durchläuft sie eine gerade Strecke; dabei schwänzelt sie mit ihrem Hinterleib (Abdomen) hin und her. Am Ende der Gerade biegt sie ab und läuft im Halbkreis ohne zu schwänzeln zum Startpunkt zurück. Nun durchläuft sie die gerade Strecke ein zweites Mal, wieder schwänzelnd. Wenn sie dann erneut zum Startplatz zurückJäuft, wählt sie die Gegenseite. War sie das erste Mal nach rechts abgebogen und im Uhrzeigersinn zurückgelaufen, kehrt sie nun auf dem linken Halbkreis zurück. Bei jeder vollen Tanzfigur wird also nur die gerade Mittelstrecke zweimal durchlaufen und nur auf dieser Mittelgeraden wird geschwänzelt. Direkte Richtungsangabe auf der horizontalen Tanzfläche. Befindet sich vor dem Flugloch eine horizontale Start- und Landebahn, kann die Biene die Flugrichtung relativ einfach durch die WinkelsteIlung der Mittelstrecke anzeigen. Man soll im Flug den gleichen Winkel zur Sonne einhalten, den die Mittelgerade der Tanzfigur vorzeichnet. Transposition auf der vertikalen Wabe. Transposition nennt man die Umcodierung von Botschaften in eine Symbolsprache, Die tanzende Biene transponiert die Richtung zur Sonne in eine Richtung zur Schwerkraft. Bei jeder Tanzfigur des vertikalen Schwänzeltanzes hat die Mittelgerade den gleichen Winkel nun eben nicht zur unsichtbaren Sonne, sondern zur Lotrechten, Tanzrichtung nach oben heißt: fliegt geradewegs Richtung Sonne; Tanzrichtung nach unten heißt: fliegt geradewegs so, dass ihr die Sonne exakt im Rücken habt. Die genaueren Regeln sind in den Abbildungen (Abb. 24.5) erläutert. Die Richtung der Schwerkraft wird mittels Tasthaaren festgestellt. Wenn die Biene einen Winkel zur Lotrechten läuft, werden die nicht von 54 Beinen gestützten, beweglich aufgehängten Körperteile (Kopf und Abdomen) gegenüber dem beingestützten Thorax abgelenkt. Diese Ablenkung wird von Tasthaaren registriert. Entfernungsangabe. Um eine Stelle im entfernten Gelände zu kennzeichnen, genügt eine Angabe der Richtung nicht. Als zweites muss die Entfernung angegeben werden. Bienen messen Entfernungen nicht in Metern, sondern nach der Menge “Flugbenzin”, das man bis zum Zielort verbraucht. Die Tanzbiene kalkuliert Gegenwind oder Rückenwind mit ein. Je weniger Treibstoff gebraucht wird, um hin-und zurück zu fliegen, desto näher, d. h. lohnender, wird das Ziel angepriesen. Die Angaben über die Entfernung und den zu erwartenden Kraftstoffverbrauch kann der menschliche Spion aus folgenden Beobachtungen entziffern: • Man zählt, wie oft pro Zeiteinheit eine Biene die Mittelstrecke durchläuft, wie oft sie also eine vollständige Tanzfigur vorführt (Tabelle 24.1). • Man ermittelt die Häufigkeit, mit der die Tanzbiene beim Durchlaufen der Mittelstrecke pro Zeiteinheit “schwänzelt”, d.h. mit dem Abdomen hin und her wackelt. • Man nimmt mit Mikrofon und Tonträger die schnarrende Laute auf, die die Biene beim Schwänzeln erzeugt. Tabelle 24.1. Korrelation zwischen der Entfernung einer Tracht und der Anzahl der Tanzfiguren im Zeitraum von 15 s. n Durchläufe 10 6 4 3 Entfernung 100 m 500 m 1000 m 5000 m Akustische Signale. Wie können die Folgebienen in der Dunkelheit des Stockes überhaupt die Tänzerin wahrnehmen und ihr Schritt um Schritt folgen? Früher glaubte man, sie würden die Bewegungen ihrer Vortänzerin ertasten. Heute ist nachgewiesen, dass die Folgebienen ihre Vortänzerin abhören. Während des Schwänzelns schwirrt die Tanzbiene mit den Flügeln und erzeugt leise, niederfrequente Laute von 250 bis 300 Hz. Die Folgebienen strecken ihre Fühler nahe an die Schallquelle. Ihre Fühler enthalten im zweiten Antennenglied ein Gehörorgan (Johnston-Organe). Es funktioniert als Schallschnelle-Empfanger (s. Kap. 19). Macht man die Tänzerin durch Verkleben der Flügel stumm, bleibt eine entfernte Tracht ohne Besucher. Der Bedeutungsumfang der Laute wird noch erforscht (Kirchner u. Towne 1994). Rückfragen und Bitten der Folgebienen. Ein Bienentanz ist keine akademische Vorlesung. Die Nachtänzerinnen dürfen unterbrechen und nachfragen, Gelegentlich klopfen sie unter Abgabe eines Piepstones auf die Unterlage. Das Vibrationssignal mahnt die Tanzbiene innezuhalten und aus ihrem Mund eine Kostprobe des gesammelten Futters herauszugeben. Die interessierten Folgebienen wissen dann, wie der angepriesene Nektar duftet und schmeckt. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 55 56 Die Welt mit anderen Augen sehen - Das Insektenauge Auch der Nichtzoologe kann fasziniert sein von den vielfältigen technischen Lösungen, die der Natur bei der Konstruktion von Sinnesorganen eingefallen sind, und vom Leistungsvermögen solcher Organe. Dies gilt beispielsweise für den Sehsinn einer Biene. Hinsichtlich des Formensehens müssten wir radikal umdenken: Die Form muss aus Bewegungsmustern erschlossen werden Wenn eine ruhende Biene mit ihren 2x5600 Miniäuglcin (Ommatidien) in die Umwelt blickt (Abb. 22.17 u. 22.18), könnte sie allenfalls ein grobes Raster von Helligkeitspunkten oder Farbtupfern sehen. Es gibt Hinweise darauf, dass das ruhende Insekt in der ruhenden Umwelt gar nichts sieht. Der Sehnerv ist bei konstantem Umfeld nahezu stumm, und das Tierchen reagiert nur auf bewegte Objekte. Wenn ein Objekt sich jedoch bewegt, feuern die Nervenfasern mit hohen Frequenzen. Optokinetische Reaktion als Indikator für Bewegungssehen. Man kann ein Insekt in eine Arena setzen und eine Wand mit senkrechten SchwarzWeißStreifen langsam um diese Arena rotieren lassen (Abb. 22.19). Das Insekt versucht, durch Drehen seines Körpers seine optische Umwelt konstant zu halten und das Streifenmuster auf seinem Auge zu fIxieren. Freilich ist das Insekt am Stab eines Torsionsmeters fixiert, sodass es sich nicht mit der Arenawand drehen kann und die Streifen an seinen Augen vorüberziehen. Gleichzeitig registriert der Elektrophysiologe vom Kopf des Insektes das Elektroretinogramm (ERG). Das ERG ist ein Summenpotential ähnlich dem EKG (s. Kap. 16). Ein ERG ist jedoch nur zu registrieren, wenn das Auge eine Bewegung wahrnimmt. Ob man die Wendereaktion des Insekts mit dem Torsionsmeter registriert oder ob man das ERG mit einem Voltschreiber aufzeichnet, man kommt zur gleichen Erkenntnis: Das miserable räumliche Auflösungsvermögen wird wettgemacht durch ein exzellentes zeitliches Auflösungsvermögen. Wenn Schwarz-Weiß-Streifen am Auge vorbeiziehen, flacker t das ERG auf und ab. Es verschmilzt erst zu einem Kontinuum, wenn die Streifen mit einer Geschwindigkeit vorbeihuschen. bei der wir längst keine Streifen mehr unterscheiden können, sondern nur noch eine öde graue Fläche sehen. Im Kino würde eine Biene noch Einzelbilder sehen, wenn bei uns die Bildfolgen schon längst zu kontinuierlichen Bewegungen verschmelzen. Erst bei hohen Bildfrequenzen verschmilzt auch beim Insekt das rhythmische ERG zu einem Kontinuum. Ein rotierendes Schwarz-Weiß-Streifenmuster löst dann wie eine einheitlich graue Wand keine optokinetische Wendereaktion mehr aus. Formensehen. Insekten werten zentralnervös Hell-Dunkel-und Farbkontraste aus, die übers Auge huschen. Die Form wird aus der Bewegung von Konturen rekonstruiert. Was Insekten sehen, wissen wir nicht. Jedenfalls hat die Biene nicht selten Probleme, im Wahlversuch beim Anflug zwei Formen zu unterscheiden, die für uns sehr verschieden aussehen. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 57 Manche Formen hingegen, die uns eher ähnlich vorkommen, lernt sie recht gut, im Anflug zu unterscheiden. 58 Wahrnehmung von polarisiertem Licht Bienen und Ameisen sehen am blauen Himmel ein Polarisationsmuster; sie können daraus die Himmelsrichtungen ablesen Es war eine der bewundernswerten Leistungen des Altmeisters Karl von Frisch (1886–1982) bemerkt und nachgewiesen zu haben, dass Bienen Sinnesfunktionen besitzen, die uns fremd sind und an die deshalb zunächst niemand denkt. Bienen haben einen Magnetkompass, Bienen haben einen Sonnenkompass, Bienen haben die Fähigkeit, das Polarisationsmuster des Lichtes am Himmel wahrzunehmen, und diese Fähigkeit ergänzt ihren Sonnenkompass. Das Polarisationsmuster am Himmel ist ein Muster, das sich ergibt, wenn das Sonnenlicht an den Luftmolekülen der Erdatmosphäre gestreut wird (siehe Box). Am stärksten gestreut wird Licht kürzer Wellenlänge, weshalb uns der Himmel blau erscheint. Folglich tragen UV/Blau Polarisiertes Licht Licht als elektromagnetischer Wellenzug lässt sich in zwei senkrecht zueinander schwingende Felder zerlegen, in das elektrische Feld (E-Vek tor) und in das magnetische Feld (M-oder B-Vektor). Um eine modellmäßige Vorstellung zu gewinnen, kann man sich entlang eines Licht strahls zwei Wellenzüge denken, die im rechten Winkel zueinander stehen (Abb. 22.21). Das natürliche Licht besteht aus vielen Wellenzügen, die unabhängig voneinander entstanden sind (inkohärentes Licht). Die Schwingungsrichtun gen in diesen Wellenzügen sind nicht koor diniert und daher regellos von Wellenzug zu Wellenzug wechselnd. Wird die Amplitude des E-Feldes in einer Raum richtung unterdrückt, erhält man partiell oder vollständig polarisiertes Licht. In allen Photonen sind dann die Schwingungsrichtungen gleich. Das kann passieren, wenn Licht an einer spie gelnden Fläche reflektiert wird, beispielsweise auf einer Wasseroberfläche (eine vollständige Polarisierung tritt nur beim Einfall unter einem bestimmten Winkel auf). am stärksten zu diesem Muster bei. Die Wahrnehmung dieses Musters, kurz Polarisationssehen genannt, ermöglicht es der Biene (und anderen Arthropoden), die Himmelsrichtungen und den momentanen Sonnenstand ausfindig zu machen, auch wenn die Sonne hinter Wolken versteckt ist. Ein Fleck blauen Himmels sollte allerdings sichtbar sein. Bei total wolkenverhangenem Himmel fliegen Bienen höchst ungern, trotz des Magnetkompasses, der ihnen für eine grobe Orientierung noch bleibt. Wenn ein Ausschnitt des Polarisationsmusters (Abb. 22.22) an einem blauen Himmelsfleck zur Orientierung genügt, besagt dies, dass die Biene Kenntnis des Gesamtmusters haben muss und in der Lage ist, das gesehene Puzzle in das irgendwie gespeicherte Gesamtbild einzuordnen. Sie muss eine interne Himmelskarte besitzen) die es ihr ermöglicht, nicht nur den momentanen Sonnenstand zu Eine partielle Polarisierung geschieht aber auch am blauen Himmelszelt dank der Reflexion und Streuung an Luftmolekülen und feinsten Partikeln (Tyndall-Effekt). Das für den Laien Unerwartete ist nun, dass sich am Himmelszelt ein makroskopisches Muster der vorherrschenden Polarisationsrichtungen einstellt (s. Abb. 22.22). Dieses Muster ist abhängig vom Sonnenstand. Man kann das Phänomen mit dem Regenbogen vergleichen. Obwohl sich im Regenvorhang die Brechung des Sonnenlichts in kleinen Wassertröpfchen vollzieht, sieht man einen riesigen Regenbogen über den ganzen Himmel gespannt. Und der Regenbogen verrät den Sonnenstand. Blickt man geradeaus auf den Regenbogen, hat man die Sonne garan tiert im Rücken. Um den Regenbogen zu sehen, muss man Farben sehen können, also Photorezeptoren haben, die bevorzugt Photone eines bestimmten Fre quenzbereichs absorbieren. Um das Polarisati onsmuster am Himmel zu sehen, kann man Polarisationsfolien in verschiedenen Richtungen vor das Auge halten, die je nach der Schwingungsrichtung des elektrischen Feldes unterschiedlich viel Licht absorbieren oder hindurch lassen (wir sehen dann Helligkeitsmuster). Oder man baut, wie die Insekten, solche Analysatoren ins Auge ein. Polarisationsfolien sind im Insektenauge aus rhodopsinbestückten Membranen hergestellt. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 59 orten, sondern auch die Himmelsrichtungen richtig zu interpretieren. Es lag nahe anzunehmen, diese Himmelskarte sei im Gedächtnis gespeichert. Das ist aber wohl nicht so. Wo die Karte deponiert ist, verrät der folgende Abschnitt. Bienen und Ameisen haben in ihrem Auge eine Himmelskarte, die sie mit dem gesehenen Muster am Himmel vergleichen Wenn Insekten neben Helligkeit und Farbe einen dritten Parameter des Lichtes auswerten und dem Gehirn mitteilen wollen, müssen sie besondere Rezeptoren abstellen, die sich auf das Polarisationssehen spezialisieren. Als Analysator für die Schwingungsrichtung des Lichtes eignen sich Photorezeptoren, deren Mikrovilli über die ganze 60 Länge des Rhabdoms exakt parallel ausgerichtet sind. In großen Bereichen des Insektenauges ist diese Vorbedingung nicht erfüllt. Die Sehzellen sind um ihre Längsachse verdrillt (twisted). In einem schmalen Feld entlang der oberen Augenregion, POL-Region oder DRA (dorsal rim areal genannt, sind die Sehzellen aber nicht verdrillt. Alle Mikrovilli einer Retinulazelle sind gerade und alle in die gleiche Richtung ausgerichtet. Weil auch die Rhodopsinmoleküle in den Membranen der Mikrovilli alle gleichartig ausgerichtet sind, gewinnen die Mikrovilli bzw. Rhabdomere (MikrovilliLängsreihen) die Eigenschaft eines Analysators. Wie eine Polarisationsfolie absorbieren solche Mikrovilli Licht nnr einer bestimmten Schwingungsrichtung mit maximaler Effizienz (s. Abb. 22.21). In einem einzelnen Ommatidium sind die Mikrovilli in zwei Richtungen ausgerichtet, die senkrecht zueinander stehen (s. Abb. 22.17). Wenn die eine Gruppe der Mikrovilli (Rhabdomer) Licht mit maximaler Effizienz einfängt, absorbiert die andere minimal. Das reicht nicht aus, um ein komplexes Muster am Himmel zu erkennen. Nun enthält das Bienenauge jeder Körperseite 5600 Ommatidien. Die POL-Region umfasst zwar nur 2,5% davon; doch das sind immerhin 140 Ommatidien, und die haben unterschiedliche Vorzugsrichtungen. Insgesamt sind die dorsalen POL-Felder der Augen also Raster von Analysatoren, welche die e-Vektoren des Himmelslichtes (Abb. 22.22) festzustellen erlauben. Sie bilden zusammen einen Apparat, mit dem sie ihren Sonnenkompass einjustieren können. Rüdiger Wehner fand aufgrund von Verhaltensversuchen, dass bei Bienen und Ameisen die Vorzngsrichtungen aller Ommatidien der POL-Region ein Muster bilden, das (in groben Zügen) das Polarisationsmuster am Himmelszelt widerspiegelt. Linkes und rechtes Auge sind spiegelbildlich angeordnet, und ebenso ist der Himmel beidseitig des Himmelsmeridians sviee:elbildlich “emustert. Wenn sich die Tierchen drehen bis ihr augeninternes Muster sich mit dem Himmelmuster deckt, wissen sie, dass sie die Sonne im Rücken haben (Abb. 22.24), ebenso wie wir wissen, dass die Sonne hinter unserem Rücken steht, wenn wir zum Regenbogen schauen. Einmal mehr wird eine hohe Sinnesleistung dadurch erreicht, dass Rezeptoren mit unterschiedlichen Spezialfunktionen betraut werden und das Gehirn dann die Einzelmeldungen auswertet und zu einern Gesamtbild zusammensetzt. Im Gehirn wird die Hauptarbeit verrichtet. Das kleine Gehirn ist unglaublich leistungsfahig; denn das POL-Muster des Himmels ist nicht ortsfest, sondern wandert mit der Sonne von Sonnenaufgang über den Zenith bis zum Sonnenuntergang am Himmel. Die Biene hat ein ,Wissen’ über diesen Tagesgang, sie hat eine präzise innere Uhr und sie hat einen leistungsfahigen, gut programmierten Computer in ihrem Gehirn. So kann sie berechnen, wo zu jeder Tageszeit Nord und Süd, Ost und West ist. Sie nutzt dies, um den Weg zur der ergiebigen Blumenwiese (und zurück zum Stock) zu finden, die sie selbst (z. B.) am Vortag entdeckt hat oder auf die sie eine Kollegin mit ihrem Schwänzeltanz hingewiesen hat. Quelle: G. Heldmaier, G. Neuweiler (2003) Vergleichende Tierphysiologie, Band 1. Springer Verlag Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Bio10_Sinne_NeuweilerHeldm QX 61