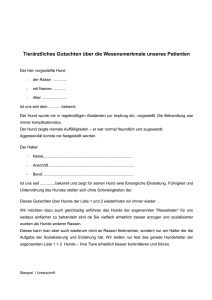Die Menschenversteher
Werbung

Die Menschenversteher Von Juliette Irmer Hunde. Warum der Canis lupus familiaris (der «Familienhundwolf») dem Menschen näher steht als jedes andere Tier. Hunde legen keine Eier und geben keine Milch. Dennoch war der Hund das erste Tier, das der Mensch domestizierte. Seit mindestens 15000 Jahren begleitet er den Menschen und ist, evolutionsbiologisch betrachtet, damit extrem erfolgreich: Geschätzte 500 Millionen Hunde bevölkern den Erdball, denn überall wo Menschen leben, leben auch sie. Selbst die Wissenschaft entdeckt den Hund für sich. Denn Hunde scheinen im Verlauf ihrer Evolution bestimmte sozial-kognitive Fähigkeiten des Menschen übernommen zu haben. Das macht sie zu idealen Kandidaten, um etwa die Evolution von Kommunikationsverhalten zu erforschen. Den Zeigefinger verstehen So verstehen Hunde Zeigegesten. Wenn Frauchen oder Herrchen den Arm ausstrecken und mit dem Finger auf etwas zeigen, wissen sie, dass es sich lohnt, dort nachzuschauen. Dort könnte ja ein Leckerli oder Stöckchen liegen. Was für Hundehalter selbstverständlich klingt, ist in Wirklichkeit staunenswert. Menschenaffen etwa scheitern an solchen Gesten: Zeigt ein Mensch auf versteckte Obststücke, reagieren die Affen nicht. Sie sind schlicht nicht in der Lage, den Hinweis zu deuten. Lange Zeit verbuchte man diese Art der nonverbalen Kommunikation also als rein menschliche Gabe. Doch schon Welpen folgen dem Wink. Hunden ist diese Fähigkeit also angeboren, und: Sie entwickelten sie während ihres Zusammenlebens mit dem Menschen. Denn Versuche mit Wölfen, die von Menschen aufgezogen wurden, zeigten, dass auch sie nichts mit solchen Gesten anzufangen wissen. «Hunde sind extrem gut an den Menschen und seine Umwelt angepasst», sagt Marie Nitzschner, Expertin für Hunde-Kognition am Max-Planck-Institut (MPI) in Leipzig. Der Mensch wurde zu ihrem «Lebensraum». Wer den Zweibeiner «lesen» konnte, sich ihm mitzuteilen wusste, hatte klare Vorteile: Er wurde gefüttert, gepflegt und wenn alles gut lief: geliebt. Zornige Zweibeiner meiden Deswegen entwickelten sich Hunde zu verblüffend guten Menschenkennern: Sie wissen, ob Frauchen sie beobachtet oder nicht und klauen im richtigen Augenblick das verbotene Stück Wurst. Erst kürzlich zeigte eine Studie aus Österreich, dass Hunde zwischen fröhlichen und wütenden Menschengesichtern unterscheiden. Die Forscher nehmen an, dass die Hunde auch die Bedeutung des Gesichtsausdrucks verstehen: Die Hunde, die auf wütende Gesichter trainiert wurden, lernten nämlich deutlich langsamer als die Vierbeiner, die sich fröhliche Gesichter merken durften. Wahrscheinlich, weil die Tiere aus Erfahrung wissen, dass man sich von zornigen Zweibeinern besser fernhält. Die Kunst des «Fast Mapping» Hunde interpretieren aber nicht nur Gesten und Gesichtsausdrücke, sie verstehen uns auch im wörtlichen Sinn: Berühmt wurde der Border Collie Rico, der über 200 Objekte namentlich unterscheiden konnte. Hunde lernen neue Begriffe durch das sogenannte «Fast Mapping» – ein Ausschlussverfahren, das auch Kleinkinder beim Sprechen lernen nutzen. So erkannte Rico, dass das unbekannte Wort «Giraffe», nur das Stofftier sein konnte, dass fremd inmitten seiner gewohnten Spielzeuge lag. Wahrscheinlich wird die Beziehung von Hund und Mensch sogar hormonell gestärkt: Schauen sich Hunde und ihre Besitzer in die Augen, steigt bei beiden die Konzentration des Hormons Oxytocin an. Das berichten Forscher in einer aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Science. Das sogenannte Kuschelhormon festigt auch die Beziehung von Mutter und Kind. Auch dort spielt der Blickkontakt eine zentrale Rolle: Schauen sich Mutter und Kind in die Augen, löst es bei beiden ein Belohnungsgefühl aus. Dieses bewirkt die Ausschüttung von Oxytocin, was wiederum die Bindung stärkt. Die Forscher nehmen an, dass diese positive Rückkopplungsschleife auch bei Hund und Mensch existiert. Und, dass sie die tiefe Bindung von Hund und Mensch ermöglicht hat. Die Schlussfolgerung ist allerdings umstritten: Oxytocin ist bei allen Säugetieren aktiv und wirkt nicht nur bei Hund und Mensch über die Artgrenze hinweg: «Sobald ein Tier das menschliche Fürsorgeverhalten anspricht – was etwa beim Aufziehen von Jungtieren geschieht – ist mit der Ausschüttung von Oxytocin zu rechnen», sagt der Verhaltensfor- scher Àdám Miklósi, renommierter Hundeexperte der Eötvös Universität in Budapest, gegenüber der «Nordwestschweiz». Verstehen und Ausdruck Der Ursprung der Mensch-Hund-Beziehung liegt – hormonell gesteuert oder nicht – in ihrer sehr lange währenden, gemeinsamen Evolution: Der Hund wurde wie kein anderes Tier zum Menschenversteher. Und brachte zudem die Gabe mit, sich uns ausdrucksstark mitzuteilen: bellen, knurren, winseln, wedeln – das Repertoire ist vielfältig und für uns leicht verständlich. «Hunde verzeihen alles, sind kooperativ und suchen unseren Blickkontakt», sagt Miklósi. «Wir können mit ihnen eine Beziehung eingehen, die sich mit einer Freundschaft vergleichen lässt.» Und wer kam einst auf wen zu? Vieles spricht dafür, dass der Hund auf den Menschen zukam. Wahrscheinlich lungerten die Hundevorfahren um die Lagerplätze der Menschen herum und frassen Abfälle. Die Menschen merkten bald, dass die Tiere sie vor Feinden warnten und begannen, sie gezielt zu füttern. Später halfen sie beim Jagen. Auch als der Mensch vor rund 10000 Jahren sesshaft wurde, und Ziegen, Schafe und Rinder domestizierte, fand der Hund seinen Platz: Als Hetzjäger eignete er sich ideal dazu, die Herden zusammenzuhalten. Der Mensch bevorzugte wohl von Anfang an die ihm zugewandten Tiere. Mit der Zeit fand er Gefallen an allen möglichen und unmöglichen Eigenschaften und so entstand die bunte Mischung aus Pekinesen, Pudeln und Co. Alles in allem aber bekam dem Hund die menschliche Gesellschaft. Seinem nächsten Verwandten hingegen, der sich dem Menschen nicht anschloss, ihn gar das Fürchten lehrte, erging es schlechter: In der Schweiz leben heute maximal 30 Wölfe. Verglichen mit rund 500000 Hunden. Sind Hunde intelligenter als Menschenaffen? «Das kann man nicht vergleichen. Hunde und Menschenaffen sind an unterschiedliche Lebensräume angepasst, weswegen unterschiedliche kognitive Fähigkeiten ausgeprägt sind. Ein Hund versteht kommunikative Hinweise vom Menschen deutlich besser, als ein Menschenaffe – eben weil der Menschenaffe, im Gegensatz zum Hund, in seiner natürlichen Umgebung nicht auf menschliche kommunikative Hinweise angewiesen ist. Deshalb ist er nicht dümmer. Menschenaffen schneiden in Versuchen über das Verständnis von kausalen Zusammenhängen deutlich besser ab. Denn Hunde verlassen sich bei solchen Sachen auf den Menschen.» Marie Nitzschner, Expertin für Hunde-Kognition, Max-Planck-Institut Leipzig Quelle Quelle: Oltner Tagblatt, 15.05.2015 Quelle: loco photography