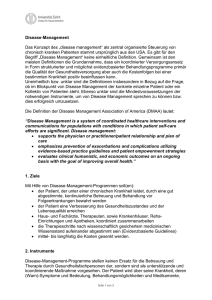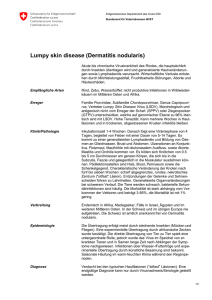Disease Management Programme und ihre Bedeutung für
Werbung

efh-papers Veröffentlichungsreihe der Evangelischen Fachhochschule Hannover Blumhardt Verlag ISSN 1612-2054 P05-001 Disease Management Programme und ihre Bedeutung für Krankenhäuser Doreen Boniakowsky Februar 2005 Publications series of the Protestant University of Applied Sciences Hannover Blumhardtstraße 2, D-30625 Hannover www.efh-hannover.de E-mail: veroeffentlichungsreihe @efh-hannover.de Anregungen, Anmerkungen und Kritik bitte direkt an die Autorin: [email protected] Vorwort.............................................................................................................................................. Abstract............................................................................................................................................1 1 Einleitung .....................................................................................................................................2 2 Defizite der Gesundheitsversorgung im ‚Zeitalter chronischer Erkrankungen’ ................5 2.1 Mängel der Gesundheitsversorgung als Ausgangspunkt für Vernetzungsbemühungen.........................................................................................................6 2.2 Integration der Versorgung: Ein Lösungsansatz?..........................................................13 2.2.1 Merkmale und Funktion Integrierter Versorgung..................................................15 3 disease management: Ziele und Konzeption.........................................................................22 3.1 Disease Management Programme als Folge der Neuordnung des Risikostrukturausgleichs .........................................................................................................24 3.2 Zielsetzung von Disease Management Programmen....................................................26 3.2.1 Verbesserung der Versorgung chronisch Kranker .....................................................27 3.2.2 Kostenstabilisierung....................................................................................................30 3.3 Disease Management Programme und ihre Entwicklung............................................33 3.3.1 Rahmenbedingungen für die Implementierung von Disease Management Programmen in Deutschland..............................................................................................36 3.3.2 Evidence-based Medicine und evidenzbasierte Leitlinien ....................................38 3.3.3 Akkreditierung von Disease Management Programmen......................................42 3.4 Aufbau von Disease Management Programmen ...........................................................44 3.4.1 Einschreibemodul........................................................................................................45 3.5 Datenmanagement oder die „mentale Integration“ ......................................................51 3.6 Disease Management Programme – eine kritische Sicht ..............................................53 3.7 Chancen für Integration durch Disease Management?.................................................57 4 Krankenhäuser unter dem Einfluss von Disease Management Programmen in der künftigen Gesundheitsversorgung ............................................................................................62 4.1 Ausgangssituation der Krankenhäuser als Partner für die Umsetzung von Disease Management Programmen .....................................................................................................63 4.1.1 Die Entstehung von Kompetenzzentren ..................................................................64 4.1.2 Die Rolle des Koordinations-Krankenhauses..........................................................66 4.2 Überlegungen zum Aufbau integrierter Versorgungsstrukturen durch Disease Management Programme aus Sicht des Krankenhauses ....................................................67 4.3 Die Neuorientierung im Wertesystem eines Krankenhauses ......................................70 4.3.1 Kooperation im Krankenhaus als der koordinierenden Institution innerhalb von Disease Management Programmen ...................................................................................72 4.3.2 Das Krankenhaus im Dienste der Patientenorientierung ......................................75 5 zusammenfassende Betrachtung.............................................................................................79 6 Literaturverzeichnis ..................................................................................................................82 7 Abbildungsverzeichnis.............................................................................................................93 8 Abkürzungsverzeichnis............................................................................................................94 VORWORT Mit dem vorliegenden Paper erscheint erstmals ein Beitrag aus der Studentenschaft der Evangelischen Fachhochschule Hannover als efh-paper. Grundlage des Papers ist eine hervorragende Diplomarbeit zur Bedeutung der Disease-Management-Programme für Krankenhäuser, die für Zwecke der Veröffentlichung überarbeitet und gekürzt wurde. Diese Erweiterung der Veröffentlichungsreihe efh-papers um studentische Arbeiten soll fortgeführt werden mit weiteren geeigneten sehr guten Studienarbeiten und Diplomarbeiten bzw. zukünftig Bachelor- und Masterarbeiten. Die vorliegende Arbeit entstand im Jahr 2004 als Diplomarbeit im berufsbegleitenden Studiengang Pflegemanagement und zeigt in besonders gut gelungener Weise die Vorzüge berufsbegleitender Studiengänge. Studierende können nicht nur auf langjährige Berufserfahrung zurück greifen, sondern auch während des Studiums die Entwicklungen der Praxis ‚vor Ort’ beobachten, sie vor dem Hintergrund erworbenen Wissens reflektieren und wissenschaftliche Erkenntnisse bereits während des Studiums unmittelbar auf die berufliche Praxis anwenden. Nicht von ungefähr gelten berufsbegleitende Studiengänge in der gegenwärtigen bildungspolitischen Diskussion als Zukunftsmodelle, da sie die Verbindung von Theorie und Praxis, von Hochschulen und Betrieben in besonderem Maße fördern und ermöglichen. Dass sie dabei in ihren Ergebnissen keineswegs den Vergleich mit Universitäten scheuen müssen, dafür kann insbesondere auch die vorliegende Arbeit als Beleg gelten: Die zu Grunde liegende Diplomarbeit wurde in einem bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb mit dem BKK-Inovationspreis 2004 ausgezeichnet. Prof. Dr. Michael Simon Wissenschaftliche Leitung der Veröffentlichungsreihe efh-papers ABSTRACT Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Einführung von Disease Management Programmen in Deutschland und der Frage, welche Chancen für Krankenhäuser mit der Teilnahme an solchen Programmen verbunden sein können. Zunächst werden die Gründe für die Notwendigkeit strukturierter Behandlungsprogramme herausgearbeitet, indem die Defizite des deutschen Versorgungssystems – vor allem die Fragmentierung und der allgemein konstatierte Mangel an Kooperation und Koordination – mit den veränderten Anforderungen durch den Wandel des Krankheitsspektrums konfrontiert werden. Die Darstellung der zahlreichen Schnittstellenprobleme und Kooperationsdefizite bietet die Grundlage für die darauf aufbauende Ableitung der Anforderungen an die Versorgung chronisch Kranker, die wiederum als Bezugsrahmen für die weitere Analyse der bereits beschlossenen Anforderungsprofile der Disease Management Programme Diabetes mellitus Typ 2 und Brustkrebs dient. Da Disease Management Programme in Deutschland eng mit dem Risikostrukturausgleich der gesetzlichen Krankenversicherung verbunden sind und diese Verknüpfung zu Problemen in der Umsetzung führen kann, erfolgt zunächst eine kurze Erörterung dieses Zusammenhanges, woran sich die Beschreibung und Diskussion der Ziele und Konzeption von Disease Management Programmen anschließt. Auf Grundlage der vorhergehenden Analysen werden die Anforderungen und Chancen für Krankenhäuser, die sich aus einer Beteiligung an Disease Management Programmen ergeben, diskutiert. Die Analyse und Diskussion der Bedeutung der Disease Management Programme für Krankenhäuser arbeitet heraus, dass die Beteiligung an diesen Programmen einen Kulturwandel im Krankenhaus erfordert, der zu einer Abkehr vom naturwissenschaftlich-akutmedizinischen Paradigma und deutlich besseren Kooperation der verschiedenen Berufsgruppen im Krankenhaus führen muss. 1 7 1 EINLEITUNG Der demographische Wandel bringt eine Veränderung des Krankheitspanoramas mit sich. Chronische Erkrankungen, Multimorbidität und Pflegebedürftigkeit entwickeln sich zusehends. Diesem Spektrum der Multimorbidität kann das fragmentierte deutsche Gesundheitssystem kaum durch ein entsprechendes Versorgungsangebot begegnen. Während Deutschland über eine hervorragende Qualität in der Akutmedizin verfügt, gilt die Versorgung der chronisch Kranken als verbesserungsbedürftig. So sieht der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (SVRKAiG) in seinem Gutachten (vgl. 2000/2001 Bd. III) bei den untersuchten Krankheitsbildern erheblichen Bedarf zur Verbesserung der Versorgungskette. Vor diesem Hintergrund besteht die Notwendigkeit, die Qualität der Versorgung chronisch Kranker zu verbessern. Auf dieses Defizit reagiert die Gesundheitspolitik mit der Implementierung von Disease Management Programmen in die Strukturen der Regelversorgung. Mit Disease Management Programmen wird die Möglichkeit eröffnet, verbindliche und integrale Behandlungs- und Betreuungsprozesse über ganze Krankheitsverläufe und institutionelle Grenzen hinweg zu schaffen. Durch die Einführung dieser Programme bietet sich die Chance, das bislang nicht erreichte Ziel, die Umsetzung des Konzeptes der Integrierten Versorgung, neu zu aktivieren. Diese strukturierten Behandlungsprogramme spielen in der Reform des Risikostrukturausgleichs (RSA) eine zentrale Rolle. Mit dem Reformvorschlag, die Morbidität der Versicherten im Rahmen des RSA besser abzubilden, wird bis zum 01.01.2007 die Erfassung der Morbiditätsunterschiede im RSA eingeführt. Der Gesetzentwurf zur Reform des RSA sieht Ausgleichszahlungen für die Krankenkassen vor, die eine qualitativ hochwertige Versorgung für chronisch Kranke anbieten. Die Maßnahmen des Gesetzes sollen faire Wettbewerbschancen unter den gesetzlichen Krankenversicherungen schaffen und somit die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Kassenwettbewerb verbessern. Es werden Anreize geschaffen, durch verstärkte Bemühungen um chronisch Kranke und durch ein verstärktes Versorgungsmanagement Fehlversorgung zu reduzieren und somit Wirtschaftlichkeitspotenziale in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu erschließen. Disease Management Programme kommen in Deutschland als Folge der 2 Neuordnung des RSA zum Einsatz. Der bisherige RSA vermag das Morbiditätsrisiko eines Versicherten nur ungenügend abzubilden. Die Transfers spiegeln nicht die tatsächlichen Kostenunterschiede wider. Der Gesetzgeber beschloss daher, den RSA grundlegend zu reformieren, um auf der einen Seite die Morbidität besser abzubilden und auf der anderen Seite die Krankenkassen mit optimalen Versorgungsprogrammen zu unterstützen. Die Erstattung der Mehrkosten für die Versorgung chronisch kranker Versicherter wird an die Teilnahme des Versicherten an einem Disease Management Programm gekoppelt. Auf den ersten Blick scheint das Thema Disease Management den Bereich der Krankenhausversorgung kaum zu berühren, doch bei genauerer Betrachtung lassen sich auch hier entscheidende Auswirkungen erkennen. Ausgehend von der Annahme, dass über Disease Management Programme das Konzept der Integrierten Versorgung umzusetzen ist, soll dieser Aspekt daher insbesondere für die Institution Krankenhaus analysiert werden. Die nachstehenden Ausführungen folgen dem Gedanken, dass sich die Bedeutung von Disease Management Programmen für Krankenhäuser anders darstellt, als sie sich für Krankenkassen annehmen lässt. Für Krankenhäuser sind Disease Management Programme, und das ist die zentrale These dieser Arbeit, ein Schritt in Richtung Integrierte Versorgung. Dies geht einher mit der Abwendung vom Paradigma der Akutmedizin hin zur Neuorientierung in der Versorgung chronisch Kranker. Geht man davon aus, dass Integrierte Versorgungssysteme keine nur umzusetzenden statischen Konstrukte sind, sondern Prozesse, die aus Veränderungen bestehen, kann sich für Krankenhäuser durch die Implementierung von Disease Management Programmen der sukzessive Übergang in eine dem Versorgungsbedarf angepasste Arbeitskultur ergeben. Nachfolgend werden daher die Bedeutung der Disease Management Programme für die GKV, deren Funktionsweise sowie die Analyse ihrer tatsächlichen Integrationspotenziale erörtert. Darauf aufbauend erfolgt die Betrachtung des Einflusses der Programme auf die stationäre Krankenhausversorgung. Der Unterschied in der Bedeutung der Disease Management Programme für Krankenkassen und für Krankenhäuser wird deutlich. Für die GKV ist davon auszugehen, dass Disease Management Programme durch die Kopplung an den RSA eher von monetärer Bedeutung 3 sind. Dahingegen können sie für Krankenhäuser die Abwendung von den gegenwärtigen Leitgedanken der Gesundheitsversorgung hin zur Neuorientierung in der Versorgung chronisch Kranker darstellen. Es sei darauf hingewiesen, dass an dieser Stelle die Disease Management Programme nicht auf ihre korrekte medizinische inhaltliche Ausgestaltung untersucht werden, sondern vor allem die integrativen Aspekte im Vordergrund stehen. Die Arbeit wird zunächst eingeleitet mit der Darstellung der Versorgungsstruktur des deutschen Gesundheitssystems. Die Desintegration der Leistungserbringung im deutschen Versorgungssystem und die Probleme im Gesundheitswesen werden diskutiert. Mit der Gesundheitsreform 2000 reagierte der Gesetzgeber auf diese Diskussionen und schuf die Voraussetzung, um das Konzept der Integrierten Versorgung in die Regelversorgung einzuführen. Anhand der bisherigen Umsetzung des Versorgungskonzeptes soll gezeigt werden, wie hoch die Erfolgschancen eines sektorenübergreifenden Leistungsangebotes sind. Im Kapitel 3 wird zunächst die Bedeutung der Programme für Krankenkassen deutlich. Darauf aufbauend werden Disease Management Programme hinsichtlich ihrer Zielsetzung, ihrer Voraussetzungen und ihres Aufbaus konkretisiert, um abschließend zu analysieren, welche Komponenten in Disease Management Programmen vorhanden sind, die dem Integrationsprinzip gerecht werden. Hierzu werden das Anforderungsprofil an strukturierte Behandlungsprogramme für Diabetes mellitus Typ 2 gemäß der Anlage 1 der Vierten Verordnung zur Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung (RSAV) vom 27.06.2002 und das Anforderungsprofil an strukturierte Behandlungsprogramme für Brustkrebs gemäß der Anlage 3 der Vierten Verordnung zur Änderung der RSAV vom 27.06.2002 zugrunde gelegt. Anschließend wird im Kapitel 4 der Einfluss von Disease Management Programmen für die Institution Krankenhaus analysiert und denkbare Entwicklungen skizziert. Die Notwendigkeit einer Neuorientierung in der Versorgung chronisch Kranker durch neue Leitbilder und Werte soll verdeutlicht werden. Die Disease Management Programme werden hinsichtlich neuer Bestimmungen untersucht, die den gegenwärtigen Ansatz der Gesundheitsversorgung ablösen. Hieraus werden die künftigen An- 4 forderungen an ein Krankenhaus unter Berücksichtigung der besonderen Situation chronisch Kranker abgeleitet. Der Unterschied in der Bedeutung der Disease Management Programme für die GKV auf der einen Seite und für die Institution Krankenhaus auf der anderen Seite wird sichtbar. 2 DEFIZITE DER GESUNDHEITSVERSORGUNG IM ‚ZEITALTER CHRONISCHER ERKRANKUNGEN’ Schwachstellen der Gesundheitsversorgung werden innerhalb der Gesundheitsprofessionen und in der Öffentlichkeit zunehmend diskutiert. Die Gesundheitsversorgung in den europäischen Ländern ist gekennzeichnet durch ein hohes Qualitätsniveau und durch Erkenntnisse, die sich auf dem aktuellen Stand befinden. Das deutsche Gesundheitssystem galt jahrzehntelang international als vorbildlich. Hervorzuheben sind hier eine hohe medizinische Qualität, die Leistungsgewährung nach Bedarf unabhängig vom Einkommen sowie der freie Leistungszugang ohne Wartezeit. Das Gutachten des SVRKAiG (2000/2001 Bd. III) stellt jedoch die bisher geltende Auffassung von einer durchgängig hochwertigen Versorgung in Frage. Eine Vielzahl von Qualitätsmängeln in der Krankenversorgung sowie ein Entwicklungsrückstand des deutschen Gesundheitswesens im Vergleich zu anderen wohlhabenden Ländern lassen sich nachweisen. Behandlungsergebnisse entsprechen im internationalen Vergleich nicht dem Stand, den aktuelle Erkenntnisse in Medizin, Pflege oder Gesundheitswissenschaft zulassen. Zudem sind Fehlsteuerungen im Gesundheitswesen zu verzeichnen, die zu Über-, Unter- und Fehlversorgung führen (vgl. SVRKAiG 2000/2001 Bd. III, S. 65). Der SVRKAiG (2000/2001 Bd. III, S. 31 ff.) definiert Über-, Unter- und Fehlversorgung folgendermaßen: Überversorgung resultiert aus der Ausweitung des Leistungsangebotes, ist eine fachgerechte oder uneffiziente Versorgung über die Bedarfsdeckung hinaus. Jede Versorgung, durch die ein vermeidbarer Schaden entsteht, wird als Fehlversorgung bezeichnet. Bei der Unterversorgung werden die Versorgungsleistungen teilweise oder gänzlich nicht fachgerecht erbracht, trotz eines anerkannten individuellen, wissenschaftlichen, professionellen oder gesellschaftlichen Bedarfs. Im Falle der Über- und Fehlversorgung kommt es zu einer 5 Verschwendung von finanziellen und sonstigen Ressourcen sowie zu einer Belastung für Patienten durch teilweise unnötige und riskante Diagnostik, wobei die Wahrscheinlichkeit des Auftretens iatrogener Schäden ansteigt. Unter- und Fehlversorgung hingegen lassen Qualitätsmängel in der Erbringung der Versorgungsleistungen erkennen. Der SVRKAiG (2000/2001 Bd. III, S. 43 ff.) hat eine erste Analyse in Deutschland zur Versorgung bei verschiedenen ausgewählten Krankheitsbildern durchgeführt, die sich aus Befragungen von 300 wissenschaftlichen Organisationen, Körperschaften und Selbsthilfegruppen des Gesundheitswesens ergab. Im Ergebnis dieser Befragung von Betroffenenorganisationen sind neben Überversorgung sehr viele Bereiche mit Unterversorgung zu verzeichnen. Die Analyse bemängelt als zentrale zu Unterund Fehlversorgung führende Schwachstelle die Fragmentierung des Versorgungssystems und die damit einhergehende mangelnde Kooperation und unzureichende sektorenübergreifende Versorgung. Der durch den demographischen Wandel wachsende Anteil älterer und multimorbider Menschen bringt eine Veränderung der Versorgungsnachfrage mit sich. Die Zahl der an der Behandlung von Patienten Beteiligten steigt und somit deren Koordinationsbedarf. Für das deutsche, durch wechselseitige Abgrenzung der Versorgungsbereiche gekennzeichnete Gesundheitswesen erwächst hieraus die Aufgabe übergreifender gesundheitlicher Versorgung. Diese Aspekte lassen erkennen, dass zahllose Mängel nicht auf Finanzierungseffekten beruhen, sondern Organisations- und Systemprobleme im Vordergrund stehen, die im Folgenden beschrieben werden. 2.1 Mängel der Gesundheitsversorgung als Ausgangspunkt für Vernetzungsbemühungen Das stark fragmentierte Gesundheitssystem mit den einzelnen Leistungssektoren der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung, denen sich im Rahmen der institutionellen Abgrenzung die Träger der Finanzierung zuordnen, arbeitet weitgehend unabhängig voneinander. Die Finanzierung von Pflege- und Gesundheitsleistungen erfolgt in Deutschland aus unterschiedlichen Systemen. Die Kosten für medizinische Behandlung durch niedergelassene Ärzte und im Krankenhaus sowie die Pflege im Krankenhaus wird fast vollständig von der Krankenversicherung übernommen. Liegt diese nicht vor, trägt der Sozialhilfeträger die 6 Kosten. Indessen werden im Unterschied zu heilbaren Erkrankungen die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit von der Pflegeversicherung mitfinanziert. Hierzu zählen die ambulante Pflege in der Häuslichkeit und die stationär oder teilstationär erbrachten Leistungen in Pflegeheimen oder Tagespflegeeinrichtungen. Patienten sind im Zuge der Kostendämpfungsgesetze im Krankheitsfall zu einem Selbstkostenanteil an den Krankenhaus-, Pflege- und Medikamentenkosten verpflichtet. Die Pflegeversicherung ist vom Grundprinzip als Teilversicherung konzipiert (vgl. Dieffenbach/Landenberger/von der Weiden 2002, S. 33). Grundlage für die Abgrenzung der Versorgungssektoren bildet die gesetzliche Zuweisung des ambulanten Sicherstellungsauftrags an die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) und des stationären Sicherstellungsauftrags an die Länder. Die Anfang der neunziger Jahre durch das Sozialgesetzbuch (SGB) V festgelegte Beziehung zwischen ambulantem und stationärem Sektor ist gekennzeichnet durch „strikte Abschottung“ (Rosenbrock/Gerlinger 2004, S. 227). Die starren organisatorischen Grenzen zwischen den Leistungsanbietern bergen Koordinations- und Kooperationsprobleme mit Vernetzungsbedarf. Kritisch sind vor allem die Schnittstellen über alle Stufen des Gesundheitswesens hinweg. Durch die abgegrenzten Zuständigkeiten der Leistungserbringer entstehen Versorgungsbrüche bei der Inanspruchnahme hausärztlicher und fachärztlicher Versorgung im ambulanten Bereich, beim Übergang von ambulanter zu stationärer Versorgung und zurück, beim Übergang von akutmedizinischer zu rehabilitativer Versorgung und im Zusammenwirken aller betreuenden Berufsgruppen. Die Struktur des segmentierten Gesundheitswesens behindert eine bedarfsgerechte Versorgung der Patienten, da eine fehlende Zusammenarbeit und Koordination zwischen ambulantem und stationärem Sektor zu verzeichnen ist. „Statt dessen haben die Dienstleister ihre eigenen Kulturen entwickelt und versuchen, wenn überhaupt, die Prozesse jeweils aus ihrer Sicht zu optimieren“ (Szathmary 1999, S. 39). Die Desintegration der Versorgung wird begünstigt durch die Entwicklung der modernen Medizin, die durch fortschreitende Spezialisierungen gekennzeichnet ist. Die Fragmentierung aufgrund der Spezialisierung medizinischer Versorgung zeigt sich im ambulanten Bereich in Form der Facharztdifferenzierung und im stationären Bereich durch die Entstehung hoch technisierter Spezialkliniken. Beim Durchlaufen mehrerer Institu- 7 tionen während eines Krankheitsgeschehens liegt das Problem im reibungslosen und effizienten Ineinandergreifen der Behandlung, die ein Patient erfährt (vgl. Feuerstein 1996, S. 233). Die Fortschritte der Medizin bringen einen Wissenszuwachs in verschiedenen Fachdisziplinen mit sich, der von Einzelnen nicht mehr beherrschbar ist. Dies führt zur Etablierung von speziellen Fachdisziplinen und zur Ausbildung von Fachkompetenzen in entsprechenden Tätigkeitsfeldern in den Gesundheitsberufen. Die Fortschritte und die damit einhergehenden mittlerweile unverzichtbaren Möglichkeiten in Diagnostik und Therapie von Krankheiten entwickelten ein inzwischen stark angewachsenes, weit verzweigtes und überwiegend kurativ ausgerichtetes Gesundheitswesen. Dies ist gekennzeichnet durch Arbeitsteilung, Ausrichtung auf einzelne Krankheitsepisoden, einzelne Organe, einzelne Bereiche der Behandlung und durch die Konzentration auf somatische Probleme sowie technische Lösungen. Die dominierende naturwissenschaftlich auf Organschädigung ausgerichtete Sichtweise führt zur Vernachlässigung psychischer und sozialer Ursachen von Krankheiten und begünstigt die Medikalisierung sozialer Probleme. Somit wird die Entwicklung von Selbsthilfepotenzialen unterdrückt. Die vorherrschende Dominanz der Medizin gegenüber den anderen Gesundheitsberufen, insbesondere der Pflege und Sozialarbeit, führt zu einer Unterentwicklung der Kooperation zwischen diesen Gruppen. Das historisch gewachsene Bild vom Arzt als dem leitenden Berufsbild der Krankenversorgung und der gesamten Gesundheitssicherung brachte für die Pflege, anders als in den USA oder den skandinavischen Ländern, die Beschränkung ihres Status und das Aufgabenprofil des ärztlichen Assistenten mit sich (vgl. Rosenbrock/Gerlinger 2004, S. 37 ff.). Die Mängel der Gesundheitsversorgung werden nachstehend anhand der Parameter Kultur, Organisation und Personal diskutiert (vgl. Mühlbacher 2002, S. 52 ff.). Kulturelle Ausgestaltung Das deutsche Gesundheitswesen weist eine Vielfalt von Leistungserbringern auf. Der stationäre Sektor umfasst Krankenhäuser, Vorsorgeund Rehabilitationseinrichtungen und Altenpflegeheime. Der ambulante Sektor gliedert sich in den Bereich der niedergelassenen Ärzte, die sich wiederum spezialisieren in Fach- und Hausärzte, sowie den Bereich der ambulanten Pflegedienste und Sozialstationen. Andere Berufsgruppen, wie Hebammen, Physiotherapeuten oder Logopäden, arbeiten in freier 8 Praxis. Bestimmendes Merkmal der Leistungserbringung ist die relativ starre Trennung zwischen dem stationären und dem ambulanten Sektor (vgl. Szathmary 1999, S. 36). Die unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen und Zielvorstellungen der einzelnen Leistungsanbieter fördern eine Desintegration der Versorgung. Einzelinteressen und Optimierung von Teilbereichen kennzeichnen die Arbeitskultur. Die Kommunikation zwischen den Versorgungsbereichen gestaltet sich schwierig und ist eher vom Konkurrenzdenken als vom Kooperationswillen geprägt. Eine weitere Leitbildproblematik ergibt sich in der Auseinandersetzung zwischen medizinischer und ökonomischer Logik (vgl. Schrappe 2003, S. 85). Organisatorische Ausgestaltung Entsprechend der Entwicklung medizinischer Erkenntnisse und Behandlungsmöglichkeiten entwickelten sich die räumlichen und personellen Aspekte der Versorgung. Aufgrund der hohen Spezialisierung und der damit verbundenen räumlichen Trennung ergeben sich vielfältige Schnittstellen, die sich hinderlich auf die Koordination des Leistungsprozesses auswirken und Therapiemaßnahmen unterbrechen. Transparenz einzelner Behandlungsschritte ist nicht gegeben, jeder Leistungserbringer überblickt nur seinen Ausschnitt des Behandlungsverlaufes. Für die Institution Krankenhaus, in der traditionell verrichtungsorientierte Strukturen vorherrschen, lassen sich beispielsweise folgende organisatorische Schnittstellen belegen: zwischen der Krankenhausverwaltung und dem medizinischen und pflegerischen Bereich, zwischen unterschiedlichen Fachstationen, zwischen bettenführenden Stationen allgemein und Funktionsabteilungen, zwischen medizinischem Sektor und Labor (vgl. Feuerstein 1996, S. 218 ff.). Zwischen den Komponenten der stationären Versorgung entstehen Brüche, die Effizienzprobleme und Qualitätsverluste mit sich bringen. Die Nachteile funktional organisierter Unternehmen liegen im „Ressort-Egoismus“ (Schrappe 2003, S. 81), der Neigung Ergebnisse einzelner Ressorts über die Ergebnisse des Gesamtunternehmens zu stellen. Bei einzelnen Mitarbeitern ist ein Motivationsdefizit als Konsequenz der Arbeitszergliederung zu verzeichnen, da das Ziel der Anstrengung, das fertige Produkt nicht erlebt wird. Insbesondere an den Schnittstellen einzelner Systemkomponenten entstehen vermeidbare Risiken des Versorgungssystems z. B. dort, wo der Patient sich durch ständigen Wechsel der arbeitsteilig handelnden Personen oder im Übergang unterschiedlicher Funktionsbereiche anpassen muss, ohne ausreichend 9 Unterstützung zu erhalten. Die Schnittstellen von Organisationseinheiten werden überbrückt mit Arztbriefen, Überweisungen oder Befunden, die sich jedoch auf ausgewählte Informationen reduzieren. Informationsbarrieren sind Hindernisse für behandlungsübergreifende Kommunikation, woraus sich eine Diskontinuität der Behandlung ableitet. Personelle Ausgestaltung Spezialisierte Organisationseinheiten mit funktionaler Aufteilung von Fach- und Aufgabenbereichen kennzeichnen die personelle Ausgestaltung des Gesundheitswesens. Hoch technisierte, von Kompliziertheit geprägte Leistungsbereiche verlangen ein spezifisches Fachwissen und eine zunehmende Spezialisierung von den dort Beschäftigten und führen somit zur verstärkten Arbeitsteilung, zu Schnittstellen innerhalb einzelner Professionen (vgl. Feuerstein 1996, S. 230 f.). Beispiele hierfür sind Bereiche modernster Diagnostik, wie Katheterlabore oder Röntgenabteilungen, die zum Zweck des ökonomischen Ressourceneinsatzes allein dem Prinzip der optimalen Auslastung folgen. Daher durchbrechen diese innerprofessionellen Arbeitsteilungen häufig die Arbeitsabläufe behandelnder Professionen und stellen dann ein Problem für die Behandlungskontinuität und für das Erleben des Patienten dar. Eine weitere Schwierigkeit der interprofessionellen Schnittstellen liegt im Informationstransfer. Dies soll am Beispiel bildgebender Verfahren verdeutlicht werden. Der Arzt, der die Untersuchung, die per Fragestellung kommuniziert wird und nur begrenzte Informationen über den Patienten enthält, durchführt und deutet, ist nicht dieselbe Person, die dann diesen Befund im kompletten klinischen Zusammenhang werten muss. Beides Experten in ihrem Bereich, besitzen sie jedoch jeweils entweder wenig Kenntnis über die Grenzen und Möglichkeiten der technischen Geräte oder aber über die Besonderheiten, Symptome oder das psychosoziale Verhalten des Patienten. Entscheidungen werden getroffen mit Hilfe fremder Evidenz (vgl. Mannebach 1993, S. 186). Die Trennung von Disziplinen und Fachrichtungen findet sich in Funktions- und Arbeitsteilungen nicht nur innerhalb der Professionen der Gesundheitsberufe wieder, sondern auch zwischen diesen, die berufsübergreifende Kooperationen stark behindern können. Die Arbeitsteilung zwischen Pflegenden und Ärzten, woraus sich zwei eigenständige Berufs- 10 bilder entwickelten, scheint auf der einen Seite sinnvoll zu sein, bringt andererseits aber professionsübergreifende Kooperationshindernisse hervor. Es entstanden Berufsidentitäten, die sich unter anderem durch die Abgrenzung gegenüber der jeweils anderen definieren. Obgleich beide Berufsgruppen letztlich dieselben Ziele verfolgen, die Betreuung und Behandlung kranker Menschen, ist ihr Zusammenwirken durch strenge Funktionsteilung gekennzeichnet (vgl. Greulich/Berchthold/Löffel 2002, S. 6). In Anbetracht der im Vorfeld beschriebenen Problematik der Zielkonflikte der Leistungsanbieter unter dem Gesichtspunkt der kulturellen Ausgestaltung stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie sich die Arbeitsbeziehung dieser beiden Akteursgruppen darstellt. Die Schnittstellen zwischen den Professionen im Krankenhaus können die professionsübergreifenden Kooperationsbeziehungen kritisch gestalten. Organisationsmängel, unklare Kompetenzen, Abhängigkeiten, Rollenkonflikte, unangemessene Kommunikationsformen und Führungsdefizite bergen Konfliktpotenzial. Pflegende sind aufgrund ihrer beruflichen Stellung gegenüber Ärzten in einer nachteiligen Position, was im Umgangston, provozierten Arbeitserschwernissen oder in einseitiger ignoranter Interaktion zum Ausdruck kommt. Pflegende reagieren darauf mit eigens entwickelten Abwehrstrategien, die auf der einen Seite für das Handeln und die Situation der beteiligten Akteure Folgen haben können und die auf der anderen Seite konträr zur Patientenorientierung pflegerischen Handelns stehen. Beispielhaft sei hier das `Auflaufenlassen` von Ärzten mit ihren Fehlern und Versäumnissen, das Unterlassen von Korrekturen, `Meideverhalten` oder das `Fallenstellen` genannt. Dieses Bewältigungshandeln wirkt kontraproduktiv, da sich die Konflikte in letzter Konsequenz auch negativ auf die Patienten auswirken können (vgl. Feuerstein 1996, S. 227 ff.). Badura und Feuerstein (1996, S. 11 f.) vertreten die Auffassung, dass die Differenzierung des Versorgungsangebots innerhalb der Akutmedizin und die Entstehung neuer Behandlungsmöglichkeiten sowie neuer Einrichtungen und Berufe maßgeblich gesteuert wird durch Entwicklungen in Naturwissenschaft und Technik auf der Grundlage medizinischer Leitbilder. Hierin sehen sie die eigentliche Ursache für die Krise im Gesundheitswesen, für die Diskrepanz zwischen gesellschaftlichen Versorgungsbedürfnissen und dem tatsächlichen Versorgungsangebot. Die Versorgungsbedürfnisse dagegen werden bestimmt durch eine gestiegene 11 Lebenserwartung und die Veränderung des Krankheitsspektrums: „[...] eine Handvoll chronischer Krankheiten haben die Infektionskrankheiten abgelöst als Hauptursache für körperliches Leid und vorzeitigen Tod“ (Badura/Feuerstein 1996, S. 10). Von allen ambulant und stationär behandelten Patienten in Deutschland leiden schätzungsweise 40 Prozent an einer chronischen Erkrankung (vgl. SVRKAiG 2000/2001 Bd. III, S. 61). Sie verursachen einen erheblichen Teil der direkten, aber insbesondere der indirekten Krankheitskosten, die z. B. durch Lohnersatzleistungen, Produktionsausfälle oder Rentenzahlungen entstehen. Die Leistungsausgaben für Versicherte mit chronischen Erkrankungen betragen in Abhängigkeit vom Komplikationsstatus das Zwei- bis Zehnfache der Leistungsausgaben durchschnittlicher Versicherter (vgl. Lauterbach/Stock 2001, S. 1935). Die Versorgung dieser Bevölkerungs-gruppe vollzieht sich innerhalb hoch differenzierter Versorgungsketten. Der Patient gerät in der Regel über den Hausarzt in ein Akutkrankenhaus, wenn erforderlich weiter in ein Spezialzentrum, wieder zurück in die Akutklinik oder in eine Rehabilitationseinrichtung und anschließend wieder zum Hausarzt. Dieser Prozess, in dem sich einzelne Leistungsanbieter phasenweise mit Teilausschnitten der Gesundheitsproblematik chronisch Kranker beschäftigen, ist gekennzeichnet durch unzureichende Absprachen mit den vor- und nachgelagerten Versorgungseinrichtungen. Die Verantwortung einer Einrichtung beginnt mit der Aufnahme der Patienten und endet mit deren Entlassung. Der Mangel an Koordination sowie das Fehlen einer Gesamtverantwortung, der die Vielfalt zuständiger Trägerorganisationen entgegensteht, stellen wesentliche Probleme in der Versorgung chronisch Kranker dar (vgl. Badura 1996 a, S. 301 f.). Die angemessene Versorgung dieser Patienten stellt für das Gesundheitssystem die größte Herausforderung dar. Der SVRKAiG (2000/2001 Bd. III, S. 65 ff.) bescheinigt der derzeitigen Versorgungssituation von Chronikern homogene, krankheitsübergreifende Muster von Über-, Unter- und Fehlversorgung. Es besteht ein deutliches Missverhältnis zwischen einer Überversorgung im kurativen Bereich und einer Unterversorgung im präventiven und rehabilitativen Bereich bei der Versorgung chronisch Kranker. Diese Fehlentwicklungen lassen sich insbesondere auf überholte Paradigmen und Versorgungsgewohnheiten zurückführen, die einer angemessenen Versorgung chronisch Kranker entgegenstehen. Hierzu zählen die Wahrung des akutmedi- 12 zinischen Paradigmas mit seiner Struktur und der Qualifikation sowie Sozialisation seiner Leistungserbringer, die somatische Fixierung des Systems, mangelnde interdisziplinäre und wenig flexible Versorgungsstrukturen und das Abweichen von Grundsätzen evidenzbasierter Versorgung. Des Weiteren werden Chroniker als passive Empfänger von Versorgungsleistungen betrachtet und entsprechend einem passiven Behandlungskonzept Reparatur, Kur und Schonung in den Mittelpunkt gestellt. Der Patient und seine Bezugspersonen werden unzureichend informiert, geschult und einbezogen. Diese speziellen Versorgungsbedürfnisse chronisch Kranker bleiben in der Qualifikation und Sozialisation in den Gesundheitsberufen unzureichend berücksichtigt. Auch deplatzierte Anreizsysteme machen den Chroniker aufgrund seiner Leistungsausgaben zu einem hohen Risiko für Leistungserbringer und Krankenkassen. Diese aufgezeigten Schwachstellen des Systems verweisen auf die Grenzen konventioneller Versorgungsformen mit dem zugrunde liegenden, vorwiegend biomedizinisch ausgerichteten Wissenschaftsverständnis und zwingen zu Anpassungen im gesundheitlichen Versorgungssystem. Es wird deutlich, dass die Notwendigkeit zum Aufbau eines integrierten Versorgungssystems in erster Linie aus der nachfrageseitigen Veränderung aufgrund des Altersaufbaus der Bevölkerung und des sich ändernden Krankheitspanoramas sowie aus dem medizinischen Fortschritt und der damit verbundenen Arbeitsteiligkeit und Spezialisierung resultiert. „Integration, Kooperation und Koordination sind lediglich die Kehrseite der fortschreitenden und im wesentlichen auch unvermeidlichen Arbeitsteiligkeit und Spezialisierung“ (Kühn 2001, S. 13). Inwieweit Integration als Lösung dieser Problematik anzusehen ist, wird nachfolgend diskutiert. 2.2 Integration der Versorgung: Ein Lösungsansatz? Angesichts der im vorigen Abschnitt aufgezeigten Schwachstellen des deutschen Gesundheitssystems lassen sich in Anlehnung an das Gutachten des SVRKAiG (2000/2001 Bd. III, S. 62 ff.) folgende Anforderungen an die gesundheitliche Versorgung und speziell an die Versorgung chronisch Kranker formulieren: Berücksichtigung von Biografie und Lebenswelt 13 Chronisch Kranke bedürfen einer anhaltenden Langzeitversorgung und Beobachtung, die sich jedoch nicht allein auf den körperlichen Zustand beschränkt, sondern auch die sozialen, lebensweltlichen und biografischen Bezüge berücksichtigt. Institutions- und professionsübergreifende Versorgung Die Betrachtung einer chronischen Erkrankung als langfristig hoch komplexes Geschehen, erfordert die Einbindung zahlreicher Versorgungseinrichtungen und Berufsgruppen einschließlich der Beteiligung der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Die Prävention und Rehabilitation sowie Gesundheitsförderung, Information und Schulung erhalten eine zentrale Rolle in der gesundheitlichen Versorgung. Multidimensionalität Die bedarfsgerechte Versorgung chronisch Kranker berücksichtigt den multidimensionalen Charakter der Erkrankung und die Multimorbidität. Umfassende Kompetenzen der Leistungserbringer Die biomedizinische Kompetenz der Leistungserbringer ist gekoppelt an entsprechende psychische und soziale Kompetenzen. Partizipation Betroffene und ihre Bezugspersonen sind aktive Partner im Behandlungsprozess und somit in Entscheidungen und Zielfindungen integriert. Evidenz Die Behandlung basiert auf der besten zur Verfügung stehenden Evidenz im Abgleich der individuellen Besonderheiten des Patienten und der ärztlichen Erfahrung innerhalb des gemeinsamen Entscheidungsprozesses. Versorgungsstrukturen Die Versorgungslandschaft zeichnet sich aus durch ein breit angelegtes Spektrum an abgestuften flexiblen Versorgungsstrukturen, in denen alle an der Versorgung beteiligten Akteure wie Institutionen mit dem Ziel einer individuellen und effizienten Gesundheitsbehandlung unter Einbeziehung modernster Informationstechnologien eng zusammenarbeiten. 14 Anreizsysteme Um einer Ausgrenzung von chronisch Kranken durch Kostenträger und Leistungserbringer entgegenzuwirken, sind Anreize zu schaffen, die eine Selektion zu Ungunsten der Chroniker verhindern und die Optimierung der Versorgung für diese attraktiv machen. Ein anhaltender Abbau von Über-, Unter- und Fehlversorgung und ein ausgewogenes Verhältnis präventiver, kurativer und rehabilitativer Versorgung von Chronikern erfordert eine grundlegende Änderung von Strukturen, Anreizen, Wissen und Werten im Gesundheitssystem, getragen von einer ziel- und gestaltungsorientierten stetigen Gesundheitspolitik, die veränderte Verantwortlichkeiten und Arbeitsstile ihrer professionellen Akteure und Institutionen verlangt. Der Aufbau eines integrierten Versorgungssystems stellt das Gesundheitssystem vor seine wohl größte Herausforderung (vgl. Rosenbrock/Gerlinger 2004, S. 226). Was unter Integrierter Versorgung zu verstehen ist und wo sich Möglichkeiten, aber auch Grenzen zeigen, wird in den beiden folgenden Abschnitten erörtert. 2.2.1 Merkmale und Funktion Integrierter Versorgung Derzeit kann auf keine allgemein gültige Definition zur Integrierten Versorgung zurückgegriffen werden. Eine soziologische Betrachtung versteht Integration als Prozess der Bildung von Ganzheiten aus Teilen (vgl. Schäfers 1998, S. 151). Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen stellt die enge Zusammenarbeit von mindestens einer Krankenkasse und mindestens zwei Leistungsanbietern unterschiedlicher Sektoren dar (vgl. Conrad 2001, S. 1 ff.). Sie leistet funktionsübergreifende, patientenorientierte, rationelle Versorgung über den gesamten Prozess von Gesundheitsbedürfnissen und ist verantwortlich für eine umfassende, koordinierte und kontinuierliche Leistungserbringung verschiedener Einrichtungen (vgl. Mühlbacher 2002, S. 63) über den gesamten Versorgungsweg von der Primärversorgung bis zur Rehabilitation (vgl. Rosenbrock/Gerlinger 2004, S. 227). Im weiteren Zusammenhang mit Integrierter Versorgung findet sich auch der Begriff der Vernetzung, der für das Ineinandergreifen verschiedener Arbeitsformen und das Erstellen gegenseitiger Verbindlichkeiten der institutionellen und systemischen Zu- 15 sammenarbeit auf der Grundlage eines gemeinsamen Problemverständnisses steht (Dieffenbach/Landenberger/von der Weiden 2002, S. 54). Ein komplexerer Ansatz stellt integrierte gesundheitsbezogene Interventions- und Versorgungssysteme als Prozesse dar, die Veränderungen in den sozialen Beziehungen und institutionellen Strukturen neben Modifikationen der beruflichen Kompetenzen sowie einem Wandel des Status und der Einkommensrelationen umfassen (vgl. Kühn 2001, S. 7 ff.). Ziel der Integration sei ein umfassendes, koordiniertes und kontinuierliches Leistungsangebot. Dieses Angebot erstreckt sich über institutionelle Grenzen hinweg und ist langfristig konzipiert. Analog zur soziologischen Definition wird Integration beschrieben als „die Synthese von Einheiten zu einem neuen Ganzen“ (Kühn 2001, S. 10). Eine Differenzierung des Gesundheitswesens, die in Spezialisierungen und Arbeitsteilungen deutlich wird, ist als unvermeidbare Konsequenz des medizinischen Fortschritts anzusehen. Die entsprechende Reaktion hierauf bedeutet keine Reduzierung der Behandlungsfortschritte, sondern einen gesundheitspolitisch zu organisierenden Prozess der Integration, der die Zerlegung des Zusammenhangs wieder aufhebt. Integration betont die Neuordnung der Organisation. Ziel ist der Aufbau von Unternehmensnetzwerken über den gesamten Versorgungszusammenhang und die Reduktion von Schnittstellen, um Doppeluntersuchungen, Vernachlässigung von Prävention, überflüssige Diagnostik, Brüche im Behandlungsprozess sowie Konflikte und Konkurrenzen zwischen Leistungsanbietern zu vermeiden. Im Gegensatz zum Begriff der Integration betont der Begriff der Verzahnung die Existenz mehrerer getrennter Identitäten. Die bestehenden Einheiten werden lediglich miteinander in Beziehung gesetzt, verzahnt. Verzahnungen, die im Hinblick auf Integration entstehen, können sich förderlich auf den Prozess auswirken (vgl. Mühlbacher 2002, S. 64). Integrierte Versorgung soll als Instrument effektiver und effizienter Nutzung der eingesetzten Mittel zur Verbesserung der Lebens- und Versorgungsstrukturen der Patienten genutzt werden. Integration stellt eine gesellschaftliche Investition in verbesserte Lebensqualität dar (vgl. Kühn 2001, S. 69). Ziel der Integrierten Versorgung ist die Aufhebung der bisherigen sektoralen Trennung in ambulante und stationäre Versorgung. Sie folgt somit dem Gedanken einer integrierten Versorgungskette, die be- 16 reits Badura (1996 a, S. 290) in seinen Ausführungen zur Gestaltung stationärer Versorgung favorisiert. Neben den stationären und ambulanten Einrichtungen sind die Pflege- und andere Heilberufe als Leistungsanbieter in die Integrierte Versorgung einzubeziehen. Die verschiedenen Fachdisziplinen der Medizin, Pflege, Sozialarbeit etc. arbeiten interdisziplinär zusammen. Integrierte Versorgungsformen lassen sich in die indikationsspezifische Versorgung und die nicht indikationsspezifische Versorgung unterteilen, wobei sich die erstere auf Versorgungsketten für Versicherte mit speziellen chronischen und versorgungsintensiven Erkrankungen bezieht. Die zweitgenannte befasst sich mit der umfassenden Behandlung aller Versicherten. Die Idee des Versorgungskonzeptes, eine bessere Koordination der Dienstleistungen und Kooperation der Beteiligten, setzt eine funktionierende Kommunikation voraus. Hierzu zählen die Information der Nutzer eines Dienstes, Informationen über Behandlungsschritte an alle an der Leistungserbringung Beteiligten sowie ein verbindlicher Handlungsrahmen für Vereinbarungen. Grundlage hierfür ist eine informelle Vernetzung, ein Informationssystem, das entlang der Versorgungskette den Leistungserbringern sowie den Kostenträgern und Patienten die nötigen Informationen zur Verfügung stellt. Dem Informationssystem kommt im Prozess der Integration eine zentrale Rolle zu (vgl. Kühn 2001, S. 64; Mühlbacher 2002, S. 69). 2.2.2 Möglichkeiten und Grenzen Integrierter Versorgung Bestrebungen zur Überwindung der sektoralen Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung lassen sich bereits seit zwanzig Jahren beobachten. Mit der Öffnung der Krankenhäuser für ambulante Operationen und der Möglichkeit zu vor- und nachstationärer Behandlung wurde 1992 der politisch weitreichendste Ansatz realisiert. Die im Reformansatz 1997 konzipierte Verzahnung von ambulantem und stationärem Sektor trat mit dem Scheitern dieser Entwürfe in den Hintergrund. Seither sind Verzahnungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten den Selbstverwaltungen überlassen. In der Folge wurden Modellvorhaben und Strukturverträge entwickelt und eingeführt (vgl. Dieffenbach/Landenberger/von der Weiden 2002, S. 58 f.). Durch Strukturverträge wird die Gewährleistung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der vertragsärztlichen Versorgung an Hausärzte oder Praxisnetze übertragen. Ziel von Modellvorhaben ist die Verbesserung 17 von Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Versorgung. Modellvorhaben sind auf höchstens acht Jahre begrenzt, Strukturverträge auf Dauer angelegt. Neben zeitlichen Abgrenzungskriterien zeigen sich Unterschiede in der Partizipation der Versicherten. Während die Modellvorhaben finanzielle Anreize in Form von Bonussystemen ermöglichen, sehen die gesetzlichen Grundlagen für Strukturverträge keine finanziellen Anreize für Versicherte vor (vgl. Amelung/Schumacher 2000, Kap. 5). Mit der GKV-Gesundheitsreform 2000 setzte der Gesetzgeber neue Schwerpunkte auf die sektorenübergreifende Versorgung. Das Reformvorhaben konnte nur teilweise realisiert werden, da wesentliche Punkte durch die Ablehnung im Bundesrat scheiterten. Durch die Streichung des Globalbudgets blieb es beim Erhalt der sektoralen Budgets, und auch die Krankenhausinvestitionen verblieben in Länderzuständigkeit. Seit dem 01.01.2000 waren mit den §§ 140 a – h SGB V eine Vielzahl an Kooperations-möglichkeiten gegeben, ohne jedoch konkrete Optionen oder Strukturen vorzuschreiben. Die gesetzlichen Möglichkeiten, neue Versorgungskonzepte als Modellvorhaben oder Strukturverträge zu erproben, lösten im ambulanten Bereich zunächst zahlreiche Initiativen aus. Dennoch fällt die Zwischenbilanz eher enttäuschend aus. Die Diskrepanz zwischen den Zielsetzungen und der bisherigen Situation integrierter Versorgungsansätze beruht auf unzureichenden gesetzlichen Rahmenbedingungen und ungelösten Planungs- und Managementproblemen der jeweiligen Netzbetreiber. Der SVRKAiG (2003, S. 509) benennt in seiner Untersuchung zur Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen die gesetzlichen Rahmenbedingungen als Hindernisse für Integrationsansätze. So schließen beispielsweise Strukturverträge die Mitwirkung von Krankenhäusern, von Arzneimittelherstellern und Anbietern von medizintechnischen Leistungen aus. Zusammenfassend ist festzustellen, dass außer einigen fragmentarischen Bestimmungen keine umfassenden gesetzlichen Vorschriften zur Integrierten Versorgung vorliegen und die konkrete Ausgestaltung der Selbstverwaltung überlassen ist, die wiederum ihre Handlungsmöglichkeiten bisher nicht nutzte (vgl. Rosenbrock/Gerlinger 2004, S. 230). Da sich Integration nicht als Ergebnis von Gesetzesbeschlüssen im Selbstlauf einstellt, sondern Integration Prozesscharakter besitzt, der ökonomische, soziale und kulturelle Prozesse einschließt, ist es allein mit Re- 18 formen, der Umlenkung von finanziellen Ressourcen, neuen Vertragsmöglichkeiten oder monetären Anreizen nicht getan. Zu berücksichtigen sind zudem alle am Prozess beteiligten Personen sowie die zur Verfügung stehenden sächlichen Ressourcen wie Technologie, Wissen und Informationen. Integrative Prozesse bestehen aus Veränderungen der sozialen Beziehungen, der beruflichen Kompetenzen, der Einkommensrelationen und des Status sowie der institutionellen Strukturen und ihrer Kultur (vgl. Kühn 2001, S. 7 ff.). Ein Blick in Richtung Wirtschaft lässt erkennen, dass hier breit angelegte Diskussionen vor dem Hintergrund des Konzeptes Lean Management über Grundsätze der Arbeits- und Personalgestaltung geführt werden und der Produktionsfaktor Arbeit, also das Personal und die Organisation wieder in den Vordergrund rücken. Nach dem Lean Management Ansatz ist der menschliche Faktor ausschlaggebend für den Wettbewerb, die Kreativität der Beschäftigten, Flexibilität und Effizienz der Produktionsorganisation sowie Qualität und Umweltfreundlichkeit der Produkte. Somit verlagert sich der Fokus von der Naturwissenschaft und Technik auf Kreativität in der Gestaltung der Arbeitsorganisation. Drei Gestaltungsprinzipien des Lean Managements werden – soweit es überhaupt möglich ist, Prinzipien marktorientierter Industrieproduktionen auf die Erbringung personenbezogener Dienstleistungen zu übertragen – für das Gesundheitswesen näher skizziert. Das wichtigste Kennzeichen ist die Gruppenarbeit, die gegenseitige Unterstützung fördert, die Arbeitsvielfalt erhöht und die Verantwortung an den Ort der Leistungserbringung zurückverlagert. Für die Institution Krankenhaus würde dadurch die Identifikation mit der eigenen Arbeitsgruppe größer werden als die mit der eigenen Berufsgruppe. Eine besondere Schwierigkeit liegt jedoch darin, dass im Krankenhaus Gruppenarbeit stets Arbeit in Gruppen bedeutet, deren Mitglieder bezüglich Qualifikation und Vergütung differieren. Neben der Einführung von Gruppenarbeiten ist die Vernetzung mit Dritten ein wesentliches Gestaltungsprinzip des Konzeptes, was dem Gesundheitswesen zunehmende Effektivität und Effizienz sichert. Eine wesentliche Gestaltungsaufgabe, die im Bereich des personenbezogenen Dienstleistungsbereichs besteht, liegt in der Systemgestaltung des Gesundheitswesens in der Verbesserung der Patientenorientierung durch Patientenpartizipation. Die Betrachtung des Patienten als ernst zu nehmendes Subjekt sollte bei der Gestaltung des Leistungsgeschehens im Gesundheitswesen Einzug halten (vgl. Badura 1996 a, S. 255 ff.). 19 Bisherige Diskussionen zur Integration wurden im Kontext gefährdeter Beitragssatzstabilität geführt und somit dem Druck unmittelbar wirksam werdender Kostenentlastung ausgesetzt. Innovative Versorgungsformen aber sind mit Risiken und Mehraufwand verbunden (vgl. Conrad 2001, S. 5). Integrationsbemühungen gehen mit Investitionen zur Anpassung der Strukturen in den Einrichtungen bzw. Praxen einher, denen ein unsicherer erst künftiger Nutzen gegenübersteht. Je breiter das Integrationsspektrum ist, desto größer wird die Zeitspanne zwischen den Investitionen und den durch sie erzielten Erträgen. Nach Meinung des SVRKAiG (2003, S. 510) benötigen Integrationskonzepte ein Startkapital bzw. eine Anschubfinanzierung. Im Zuge der Integration bisher klar abgegrenzter Sektoren entwickelte sich das Problem des Konkurrenzkampfes um die Patienten an den Schnittstellen (vgl. Szathmary 1999, S. 64). Die Verzahnungsversuche durch die wechselseitigen Öffnungen des stationären wie des ambulanten Sektors für den jeweils anderen Bereich brachten den dem erwünschten entgegengesetzten Effekt mit sich und verdeutlichen die Verteilungskonkurrenz. Einem Bericht zufolge (vgl. Bruckenberger 1997, S. 354) sind vier Millionen zusätzliche ambulante Operationen in Praxen zu verzeichnen, die jedoch keine verringernde Auswirkung auf die Zahl der Krankenhausoperationen mit sich brachten, sondern vermehrend hinzutraten. Dieses Beispiel unterstreicht obige Darlegung, dass allein per Gesetz Integration nicht zu regeln ist. Die beispielsweise per Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) beschlossene Öffnung von Krankenhäusern für ambulante Operationen wird vom SVRKAiG als Weg zur Überwindung der jahrelang beklagten Trennung von ambulantem und stationärem Sektor und generell zur flexibleren Handhabung der Schnittstellen zwischen Akutkrankenhaus und der Versorgungsumwelt gewürdigt (vgl. Badura 1996 a, S. 287). Verzahnungen, die im Kontext kurzfristiger Kostendämpfungen stehen, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt, wohingegen mittel- und langfristige Integrationsstrategien Einsparpotenziale vermuten lassen. „Integration ist primär keine Kostendämpfung“ (Kühn 2001, S. 76). Die Wettbewerbsordnung in der GKV steht der Implementierung von integrativen Versorgungsprojekten in zwei Punkten entgegen. Auf der einen Seite werden derartige Projekte aufgrund betriebswirtschaftlicher 20 Aspekte von Krankenkassen abgelehnt, da spezielle Programme zur Versorgungsverbesserung einen Zulauf von teuren Versicherten für die Kassen bedeuten können. Auf der anderen Seite werden in Modellprojekten gewonnene Erkenntnisse verzögert, nur zum Teil oder gar nicht transparent gemacht, um sich Wettbewerbsvorteile gegenüber den Konkurrenten zu sichern (vgl. Rosenbrock/Gerlinger 2004, S. 233 f.). Eine Verknüpfung von Integration und wirtschaftlichem Wettbewerb und damit einhergehender Konkurrenz birgt die Gefahr, dass sich die Beteiligten als konkurrierende Einzelunternehmen verhalten. Im Ergebnis lässt sich daher annehmen, dass sich das Versorgungssystem nichtökonomischen Zielen verschließt (vgl. Kühn 2001, S. 7 ff.). Blickt man auf die Erfahrungen anderer Länder, so ist davon auszugehen, dass Integration ein Prozess geprägt von Makeln und Fehlpässen ist, die es gilt zu erkennen und zu lernen, dass sich ergebende Revisionen selbstverständlich sind. Integrationsbemühungen setzen Handlungsweisen voraus, die vom Verständnis für die Komplexität und Vielschichtigkeit der Integrationsprozesse geprägt sind, orientieren sich an Teilzielen und werden mit einer langfristigen gesundheitspolitischen Perspektive verknüpft. Demnach stehen weder Sparpotenziale oder Qualitätsverbesserungen als Erstes auf der Tagesordnung, sondern das Management umfassender Lernprozesse, das Sammeln von Erfahrungen mit sich ändernden Strukturen und Institutionen sowie die Entwicklung entsprechender Informationsstrukturen. Die Integrationsperspektive erfordert eine Vielzahl inhaltlicher Veränderungen der Arbeit und besteht wesentlich aus Lernprozessen innerhalb sich wandelnder Strukturen und Organisationen. So müssen Ärzte beispielsweise lernen, in Teams zu arbeiten und zu kooperieren, systematisch und ergebnisorientiert zu denken, nach Standards zu arbeiten und ihre Autonomie mit anderen zu teilen (vgl. Kühn 2001, S. 8). In der Diskussion um Integration und Sicherstellungsauftrag wird auf einen für die Integration attraktiven Aspekt aufmerksam gemacht (vgl. Kühn 2001, S. 70 f.). Bei Übernahme des Sicherstellungsauftrages für die medizinische Versorgung durch die Krankenkassen als Finanzträger erhalten diese die Möglichkeit, Verträge mit ausgewählten Leistungsanbietern für das Spektrum der Kassenleistungen abzuschließen. Dieses Modell, als Einkaufsmodell bekannt, bedarf einer weitgehenden 21 Vertragsfreiheit zwischen Kassen und Leistungserbringern. Vor dem Hintergrund Integrierter Versorgung läge hier die Chance, dass Kassen mit integrierten Netzwerken Versorgungsverträge vereinbaren können. Zu weiteren Integrationsansätzen (vgl. Schrappe 2003, S. 84 f.) zählen Institutionelle Leitlinien und Clinical Pathways, die der Abstimmung inhaltlicher und organisatorischer Schnittstellenprobleme dienen. Sie sind die aktuellen Strategien, Integrationsdefiziten innerhalb von Krankenhäusern zu begegnen. Die organisatorische Zusammenführung von Abteilungen, die Bildung von Zentren fördert die Kooperation insbesondere von Fächern. Interprofessionelle Teams, die berufsübergreifend zusammenarbeiten, bilden eine Form horizontaler Integration. Abseits der hierarchischen Zuordnung wird vor Ort eine den Notwendigkeiten entsprechende sachbezogene Kooperation installiert. Entscheidungsgrundlagen ärztlich-diagnostischer und therapeutischer sowie pflegerischer Herangehensweisen sind evidenzbasiert. Erst nach Klärung der Wirksamkeitsfrage ist die Klärung der ökonomischen Machbarkeit und einer rationalen Entscheidung über Mittelzuwendungen möglich. Mit der Einführung von Disease Management Programmen sind erste Schritte eingeleitet, um über Sektorengrenzen hinwegreichende Versorgungsformen zu schaffen. Insbesondere Krankenkassen richten ihr Interesse darauf, da sie im Zuge der Reform des RSA die Wettbewerbsposition der Kassen aufgrund erwarteter finanzieller Umverteilungen beeinflussen können. Das folgende Kapitel erörtert den Einzug des Disease Managements in das deutsche Gesundheitssystem sowie deren Bedeutung für die Versorgung chronisch Kranker. 3 DISEASE MANAGEMENT: ZIELE UND KONZEPTION In den 80er Jahren entstand in den USA im Kreis von Managed Care Institutionen mit Unterstützung großer pharmazeutischer Firmen das Konzept des Disease oder Krankheits-Managements. In der Literatur existiert keine einheitliche Definition von Disease Management, woraus sich höchst unklare Erwartungen an dieses Konzept ergeben. Ein Großteil der Krankenkassen hofft, von den Finanztransfers zu profitieren, wohingegen die Kassenärztlichen Vereinigungen ihre Definitionsmacht bedroht sehen 22 und Ärzte fürchten zu Erfüllungsgehilfen der Krankenkassen gemacht zu werden. Daher scheint es notwendig, den Begriff näher zu betrachten. Disease Management ist ein Steuerungsinstrument in der Gesundheitsversorgung, das als ganzheitlicher Ansatz eine Vernetzung der verschiedenen an der Therapie beteiligten Versorger und Maßnahmen anstrebt. Es handelt sich um einen kontinuierlichen und koordinierten Prozess, um den Gesundheitszustand einer definierten Population über den gesamten Verlauf einer Erkrankung zu managen und zu verbessern. An die Stelle der bisherigen fragmentierten Versorgung, die auf einzelne Krankheitsepisoden und einzelne Leistungserbringer fokussiert ist, tritt eine integrale Betrachtung effizienter und effektiver Behandlungs- und Betreuungspfade (vgl. Greulich/Berchthold/Löffel 2002, S. 26). Die Umsetzung von Disease Management erfolgt in Form von Programmen, die eine Zusammenstellung mehrerer, aufeinander abgestimmter Maßnahmen beinhalten. Disease Management umfasst solche Programme, die eine langfristige, evidenzbasierte und sektorenübergreifende Versorgung bestimmter Erkrankungen koordinieren. Disease Management Prozesse unterliegen nicht den Beschränkungen institutioneller Grenzen, sondern verknüpfen sämtliche Maßnahmen von der Prävention über Diagnostik und Behandlung bishin zur Nachsorge zu einem kohärenten Prozess. Chronische Erkrankungen erfordern im Gegensatz zur Akutmedizin Programme, die der fragmentierten, episodenhaften und sektoral begrenzten Versorgung entgegenwirken. Die Versorgung großer Bevölkerungsgruppen mit chronischen Erkrankungen umfasst Prävention, Therapie und Verlaufskontrolle und wird über verschiedene Versorgungseinrichtungen und Krankheitsstadien koordiniert. Im Mittelpunkt stehen solche Behandlungen, die erwiesenermaßen das Fortschreiten der Krankheit und das Entstehen von Komplikationen günstig beeinflussen. Um dies zu erreichen, wird das Selbstmanagement der Erkrankung durch den Patienten gestärkt. Das geschieht durch verstärkten Informationsaustausch, Schulungsprogramme und eine gezielte Kontaktaufnahme mit dem Patienten. Wichtige Voraussetzung für den Erfolg jedes Disease Management Programms ist die Einbindung des Patienten in Entscheidungsprozesse und die Mitgestaltung der Therapie durch ihn. Das Bestreben von Disease Management ist die standardisierte Behandlung eines gesamten Krankheitsbildes (vgl. Schönbach 2003, S. 217). Disease Management versucht eine allgemeine Verbesserung der 23 Gesundheitsversorgung zu erzielen. Unter Einbezug dieser Ansprüche wird folgende Arbeitsdefinition für Disease Management in Deutschland zugrunde gelegt: „Disease Management ist ein systematischer, sektorenübergreifender und populationsbezogener Ansatz zur Förderung einer kontinuierlichen, evidenzbasierten Versorgung von Patienten mit chronischen Erkrankungen über alle Krankheitsstadien und Aspekte der Versorgung hinweg. Der Prozess schließt die kontinuierliche Evaluation medizinischer, ökonomischer und psychosozialer Parameter sowie eine darauf beruhende kontinuierliche Verbesserung der Versorgungsprozesse auf allen Ebenen ein“ (Lauterbach o. J., S. 23). In diesem Sinne bedeutet Disease Management für alle Gesundheitsfachberufe einen Paradigmenwechsel von einem traditionellen Betreuungsverständnis hin zu neuen Inhalten und Funktionen. Da Disease Management Programme in Deutschland eng mit einer Reform des RSA der GKV verbunden sind, schließt sich zunächst ein kurze Erörterung des RSA und die Notwendigkeit seiner Reform, deren wesentlicher Bestandteil die Förderung von Disease Management Programmen ist, an. 3.1 Disease Management Programme als Folge der Neuordnung des Risikostrukturausgleichs Die Aufgabe des RSA in der GKV besteht darin, die beiden Strukturprinzipien Solidarität und Wettbewerb miteinander zu verbinden. Das Konzept des RSA geht davon aus, dass die Strukturen der Krankenkassen von Parametern bestimmt werden, die die einzelne Kasse nicht oder nur beschränkt beeinflussen kann. Daher werden nach § 266 SGB V als maßgebliche Risikofaktoren die beitragspflichtigen Einnahmen, die Anzahl der Familienversicherten, das Alter und Geschlecht der Versicherten sowie die Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrentner im Ausgleichsverfahren berücksichtigt. Bei der Definition der Risikobelastungen der Krankenkassen hat der Gesetzgeber bewusst nur die Belastungsunterschiede der Kassen berücksichtigt, die auf die genannten Unterschiede in den Versichertenstrukturen zurückzuführen sind. Dadurch wird das Interesse der Krankenkassen an der wirtschaftlichen Gestaltung der Leistungserbringung gestärkt. Ausgabenunterschiede, die auf unterschiedliche Versorgungsstrukturen, auf unterschiedliche Verwaltungskosten oder auf unterschiedliche Vergütungsabschlüsse im Vertragsbereich zurückzuführen sind, werden 24 im RSA nicht berücksichtigt. Diese Belastungen werden ausschließlich über den Beitragssatz der Krankenkassen finanziert. Durch den RSA soll sichergestellt werden, dass die Beitragssatzdifferenzen nicht die unterschiedlichen Risikostrukturen der Versicherten widerspiegeln, sondern die Unterschiede in der Wirtschaftlichkeit der Kassen in Bezug auf die Leistungserbringung. Dadurch sollen die Beitragssätze zu Wettbewerbsparametern werden. Die Idee des RSA liegt darin, alle Kassen finanziell so zu stellen, als ob ihre Versicherten die durchschnittliche Risikostruktur der gesetzlichen Kassen aufwiesen. Krankenkassen mit einer überdurchschnittlich günstigen Risikostruktur hinsichtlich der Risikofaktoren leisten Finanztransfers an Krankenkassen mit einer überdurchschnittlich nachteiligen Risikostruktur. Dementsprechend entlastet der RSA seit 1994 Krankenkassen mit ungünstigen Risikostrukturen zu Lasten der Kassen, die aufgrund des Alters, Geschlechts und der Familien- oder Einkommenssituation der Versicherten günstigere Versichertenstrukturen haben (vgl. Stegmüller 1996, S. 111 f.). Aktuelle Analysen (vgl. IGES/Cassel/Wasem 2001; Lauterbach/Wille 2001) ergaben übereienstimmend, dass sich der RSA einerseits tendenziell bewährt hat, andererseits jedoch erhebliche Defizite aufweist, die eine Weiterentwicklung der Ausgestaltung des RSA erfordern. Der lediglich finanzielle Ausgleich zwischen den Krankenkassen bietet keinerlei Anreize zur Verbesserung der Versorgungsqualität. Insbesondere die Versorgung chronisch Kranker leidet darunter, da sich Kassen der spezifischen Versorgungsbedarfe dieser Versicherten unzureichend angenommen haben (vgl. Jacobs 2003, S. 209). Diese Zurückhaltung lässt sich darauf zurückführen, dass Kassen bei Bemühungen um eine verbesserte Versorgung chronisch Kranker einen Zulauf dieser Versicherten befürchten, da diese in aller Regel überdurchschnittliche Ausgaben verursachen. Chronische Erkrankungen verursachen einen beträchtlichen Teil der Krankheitskosten: Die Leistungsausgaben für chronisch kranke Versicherte liegen um ein Vielfaches höher als die Leistungsausgaben durchschnittlicher Versicherter. Da diese durchschnittlichen Mehrkosten im RSA jedoch nicht ausgeglichen werden, stellen Chroniker ungünstige Risiken dar. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse trat zum 01.01.2004 das Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs in der GKV in Kraft. In der Konsequenz soll dies dazu führen, dass der Beitragsbedarf, der jeder Kasse zugerechnet 25 wird, ab 01.01.2007 auf der Grundlage direkter Morbiditätsindikatoren ermittelt wird. Die Reform zielt darauf ab, die Morbidität der Versicherten im Rahmen des RSA besser abzubilden, weil die bisherigen Ausgleichsfaktoren Alter, Geschlecht sowie der Bezug einer Erwerbsminderungsrente die Morbiditätsunterschiede nicht genügend berücksichtigen. Als Einstieg in die direkte Morbiditätsorientierung des RSA erfolgt bereits ab 01.07.2002 eine gesonderte Berücksichtigung der Versicherten, die sich in akkreditierte Disease Management Programme eingeschrieben haben. Hierdurch soll der Wettbewerb um gesunde Versicherte durch einen Wettbewerb um Versorgungsqualität und Versorgungseffizienz ersetzt werden. Die angemessene Versorgung chronisch Kranker kann gefährdet werden, wenn die Behandlung dieser Patientengruppen aufgrund schlechter Rahmenbedingungen für die Krankenkassen und Leistungsanbieter in Bezug auf Chroniker mit finanziellen Risiken und Einkommenseinbußen behaftet ist. Weiterhin läuft die segmentierte, episodenhafte und sektoral zergliederte Versorgung in der GKV den Bedürfnissen der chronisch Kranken zuwider. Die Implementierung von qualitätsgesicherten Disease Management Programmen eröffnet insbesondere für chronisch Kranke neue Perspektiven. 3.2 Zielsetzung von Disease Management Programmen Die Einführung von Disease Management Programmen in das System der GKV wurde in erster Linie durch zwei Entwicklungen im deutschen Gesundheitswesen beeinflusst. Zum einen soll die Versorgung chronisch Kranker verbessert werden. Zum anderen zielt der Gesetzgeber mit Disease Management Programmen darauf ab, die Finanzsituation der Kassen mit hohem Anteil chronisch Kranker zu konsolidieren und somit die Beitragssatzunterschiede zwischen den Kassen zu verringern. Disease Management soll Über-, Unter- und Fehlversorgung in der Versorgung chronisch Kranker abbauen. Dies soll im medizinischen Bereich zu verbesserten Outcomes und im ökonomischen Bereich zur Kostenstabilisierung führen. Diese Aspekte werden nachstehend dargelegt. 26 3.2.1 Verbesserung der Versorgung chronisch Kranker Die derzeitige Versorgung chronisch Kranker ist gekennzeichnet durch ein Nebeneinander an Über-, Unter- und Fehlversorgung (vgl. SVRKAiG 2000/2001 Bd. III). Die Ursachen hierfür liegen vor allem in der starren Trennung der Versorgungssektoren und den noch immer fehlenden einheitlichen evidenzbasierten Therapieempfehlungen. Dies führt zu Mehrfachinterventionen in Diagnostik und Therapie, zu unterschiedlichen Therapieansätzen bei einem Versicherten und zur Diskontinuität der Versorgung. Die Einführung der Disease Management Programme soll der Implementierung einer sektorenübergreifenden Regelversorgung zur Sicherung der Versorgungsqualität dienen. Disease Management als ein systematischer Behandlungsansatz organisiert für chronisch Kranke eine kontinuierliche und qualitativ hochwertige Versorgung auf Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Um dieses Ziel zu erreichen, ist insbesondere der Abbau von Über-, Unter- und Fehlversorgung vonnöten. Entsprechend werden im Rahmen der Einführung von Disease Management Programmen zunächst die im Gutachten des SVRKAiG (2000/2001 Bd. III) beschriebenen Bereiche von Über-, Unter- und Fehlversorgung berücksichtigt. Eine ausschließliche Fokussierung auf die Unterversorgung könnte dazu führen, dass die Defizite der Regelversorgung lediglich durch die Erbringung zusätzlicher Leistungen in Randbereichen kompensiert werden. Dies würde das Ziel der Versorgungsoptimierung verfehlen und gleichzeitig zu einem Kostenschub führen (vgl. Rebscher 2001, S. 4). Angenommen die Verbesserung der Versorgungssituation chronisch Kranker, bedeutet eine hochwertige Versorgung in ihrem Sinne, eine patientenorientierte Versorgung chronisch Kranker, ergeben sich demnach zentrale Ausgestaltungspunkte für Disease Management Programme, um dieser Zielsetzung gerecht zu werden. Die klinische Akutmedizin als dominierende Versorgungsform unserer Zeit begründet die Fragmentierung der Gesundheitsversorgung und die Ausrichtung des Versorgungsgeschehens auf akute und episodenhafte Krankheiten, die jedoch den Erfordernissen einer chronischen Erkrankung nicht gerecht wird. Die Konsequenzen für eine bedürfnisorientierte Versorgungsgestaltung lassen sich 27 anhand von fünf Aspekten (vgl. Müller-Mundt und Schaeffer 2003, S. 143 ff.) beschreiben: Ausrichtung des Versorgungsgeschehens auf Probleme, die das Leben mit chronischer Krankheit aufwirft Die Berücksichtigung der Bedeutung der Erkrankung für den Betroffenen im Lebensalltag und somit die Ausrichtung des Versorgungsgeschehens auf Probleme, die das Leben mit einer chronischen Erkrankung mit sich bringen, sind Kernstücke der Versorgungsqualität. Das Aufgeben sozialer Rollen, Statusverlust, Verlust an Handlungsautonomie sowie die Angewiesenheit auf Unterstützung als einige zu nennende subjektive Bewältigungserfordernisse bringen weitreichende Konsequenzen für die Versorgungsgestaltung mit sich. Die Versorgung muss sich an den für den Betroffenen zentralen Problemen orientieren und sich nicht einzig auf das Krankheitsgeschehen konzentrieren. Der Fokus der Professionellen auf somatische Episoden führt zu einer Perspektivungleichheit, da diese Probleme aus Sicht der Betroffenen meist sekundär sind. Die unzureichende Beachtung von Begleiterscheinungen der Erkrankung sowie die zuvor beschriebene Perspektivungleichheit könnten zu Interventionen führen, die nicht die gewünschten Effekte zeitigen (vgl. Müller-Mundt/Schaeffer 2003, S. 144). Badura fasst in einem Satz treffend zusammen: „Krankheitsbewältigung (Perspektive der Patienten und ihrer Angehörigen) beinhaltet mehr und anderes als Beherrschung somatischer Prozesse (Perspektive der Biomedizin)“ (Badura 1996 a, S. 262). Beachtung der Komplexität der Bewältigungs-herausforderungen bei chronischer Krankheit Der Komplexität und Vielschichtigkeit der Bewältigungsherausforderungen bei chronischer Krankheit, die sich aus der wechselseitigen Durchdringung der Probleme auf biografischer, sozialer und beruflicher Ebene ergeben, gilt besondere Beachtung. Die mit der Erkrankung zunehmend schwindenden Ressourcen zur Aufrechterhaltung der für Chroniker essenziellen Autonomie erfordert in der Versorgungsgestaltung die Stärkung individueller Bewältigungskompetenzen (vgl. MüllerMundt/Schaeffer 2003, S. 145). Sicherung sozialer Ressourcen Der Sicherung sozialer Ressourcen sowie der Einbeziehung und der Unterstützung des sozialen Netzes in das Versorgungsgeschehen kommt 28 während der Bewältigung einer chronischen Erkrankung besondere Bedeutung zu. Familien erbringen beachtliche Anpassungsleistungen, die zum Teil mit der Übernahme von Anteilen der Rolle des Erkrankten einhergehen und auf Dauer zu Überbeanspruchung führen können. Zugleich erleben sich Betroffene im Krankheitsverlauf auf ihr primäres soziales Netzwerk beschränkt. „Da gingen ganz viele Freundschaften daran kaputt, weil die das ja nicht nachvollziehen konnten“ (Müller-Mundt/Schaeffer 2003, S. 145). Milderung von Unsicherheit Vor dem Hintergrund des nicht absehbaren Verlaufes der Erkrankung und der Symptomlage, ist das Leben der Betroffenen geprägt von Unsicherheit und Unplanbarkeit, was die Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe massiv einschränkt. Unsicherheit beinhaltet in diesem Sinne zum einen die Unberechenbarkeit des Krankheitsverlaufes und zum anderen den Verlust von Handlungs- und Funktionsfähigkeit, was zu immensen Belastungen und Beeinträchtigungen des emotionalen Wohlbefindens in all seinen Facetten führen kann. Professionelles Handeln soll den Betroffenen Rückhalt geben und erfordert ein hohes Maß an Sensibilität (vgl. Müller-Mundt/Schaeffer 2003, S. 145 f.). Unterstützung bei der Versorgungsnutzung Das Gesundheitssystem Deutschlands ist für Patienten oft undurchsichtig und erfordert daher deren Unterstützung bei der Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen. Gerade zu Beginn einer Erkrankung gestaltet sich der Weg durch die Versorgungslandschaft oft als Odyssee. Im weiteren Verlauf einer chronischen Erkrankung werden neben der medizinischen Behandlung rehabilitative und psychosoziale Hilfen sowie vielfach professionelle Pflege notwendig. Monetäre Belastungen infolge der gesundheitlichen Einschränkungen, die vielfach nicht aus eigenen Mitteln ausgeglichen werden können, erfordern Informationen und Orientierungshilfen zu finanziellen Ansprüchen. Hierzu zählen Leistungen unterschiedlicher Bereiche der Sozialversicherung. Eine Beratung kann zudem Hilfestellungen beim zielgerichteten Vorgehen und der Leistungsauswahl beinhalten. Fehlende Informationen über Zugangsmöglichkeiten oder die mühsam erscheinende Beantragung führen dazu, dass Betroffene finanzielle Hilfen teilweise nicht in dem Ausmaß nutzen, wie sie ihnen zustehen. Um Versorgungslücken und Abwege durch das Gesundheitssystem zu vermeiden, sind direkte 29 Angebote zur Information und Beratung in einer für Patienten nutzbaren Weise nötig (vgl. Müller-Mundt/Schaeffer 2003, S. 146). Die Verbesserung der Versorgungssituation chronisch Kranker, als eine Zielsetzung der Disease Management Programme, setzt ein umfassendes Versorgungskonzept voraus, welches die Betroffenen und ihr soziales Umfeld bei der Bewältigung der vielfältigen Probleme langfristig unterstützt. Angesichts der langjährig gewachsenen Desintegration der Versorgung bedarf es einer Unterstützungsleistung in Form einer Begleitung durch das Versorgungssystem. Die Bemühungen der Systemgestaltung im Gesundheitswesen müssen die Situation und Problemsicht der Betroffenen in den Mittelpunkt der Bestrebungen stellen sowie der Komplexität und dem Prozesscharakter ihrer Krankheit gerecht werden. So dürfen beispielsweise die wachsende Anzahl biotechnisch ausgebildeter Kardiologen und die technologisch hoch spezialsierten Herzzentren nicht die einzig angemessene Antwort auf die koronaren Herzkrankheiten als häufigste Todesursache sein (vgl. SVRKAiG 2000/2001 Bd. III, S. 86). Für eine dem tatsächlichen Bedarf der Betroffenen angepasste Gestaltung der Versorgung ist die Betrachtung der Versorgungsprobleme und Bewältigungserfordernisse aus ihrer Sicht und der ihrer Angehörigen fundamental (vgl. Badura 1996 a, S. 262). Unter der Voraussetzung, dass Disease Management Programme nicht allein das Krankheitsmanagement fokussieren, sondern auch die vielfältigen subjektiven Dimensionen der Bewältigung des Lebens mit einer chronischen Erkrankung in gleichem Maße berücksichtigen, können diese den Problemlagen der wachsenden Gruppe chronisch Kranker gerecht werden. 3.2.2 Kostenstabilisierung Das zweite Ziel der Disease Management Programme, die Kosteneffizienz, wird in der Literatur vielfach diskutiert. Bei der Umsetzung des Konzepts des Disease Managements und der damit verbundenen sektoralen Verknüpfung ist davon auszugehen, dass sich der bisherige Finanzbedarf nicht reduziert, sondern dass sich die Ausgabenströme im Gesundheitswesen verändern werden. Der stationäre Sektor wird seine Rolle als dominierender Sektor einbüßen (vgl. Greulich/Berchthold/Löffel 2002, S. 7). Im Positionspapier zum Disease Management Programm Diabetes mellitus Typ 2 (vgl. Landgraf et al. 2004, S. 8) wird deutlich, dass mit der Ein- 30 führung der Programme mit einem deutlichen Anstieg der Verwaltungskosten bei den Krankenkassen zu rechnen sei, die auf breit angelegte Werbe- und Rekrutierungskampagnen zurückzuführen sind. Ferner ließe sich nicht abschätzen, mit welchem finanziellen Aufwand die Disease Management Programme umgesetzt werden können. Neben den Mitteln für die Werbung von Versicherten stehen die Kosten für die Organisation des Datenaustausches, für die Evaluation der Programme, die Kosten für die Honorierung der Dokumentationsleistungen sowie für die Ausbildung von Kassenangestellten zu Fallmanagern. Die Hoffnung der Vertreter dieses Positionspapiers liegt darin, dass sich diese Ausgaben durch die niedrigeren Folgekosten, die sich aus der besseren Versorgung eines am Disease Management Programm teilnehmenden Chronikers ergeben, refinanzieren. Außerhalb dieser ökonomischen Betrachtung steht der erhoffte Gewinn an Lebensqualität, den alle Beteiligten als Wert an sich anstreben sollten. Präziser zeigt eine detaillierte Analyse (vgl. Lauterbach o. J., S. 281) zur Kosteneffizienz von Disease Management Programmen, dass sich die Kosten für die Programme aus verschiedenen Komponenten, den einmaligen und den laufenden Kosten zusammensetzen. Zu den einmaligen Kosten zählen die Einführungskosten, die Werbekosten und die Akkreditierungskosten. Die laufenden Kosten ergeben sich aus den Verwaltungskosten inklusive der Kosten für ein erweitertes Datenmanagement, den Schulungskosten für die Patienten, den Kosten für zusätzliche über bisherige Untersuchungen hinausgehende Behandlungen der Patienten sowie den Kosten der Mehrbehandlung aufgrund der Lebensverlängerung der Patienten in Disease Management Programmen. Dem stehen jedoch die durch evidenzbasierte Medizin vermiedenen Kosten gegenüber, zu denen der Abbau nicht indizierter Leistungen, vermiedene Krankenhauseinweisungen sowie der Abbau von Überversorgung und Fehlversorgung mit Arzneimitteln zählen. Der Leitgedanke des Disease Managements liegt in der Maximierung der Effektivität der Gesundheitsversorgung unter Optimierung der dabei verwendeten Ressourcen (vgl. Szathmary 1999, S. 170 f.). Unter Kosteneinsparung oder zumindest einer Begrenzung der Ausgabensteigerung wird das Ziel der Verbesserung der Versorgungsqualität verfolgt. Die Lebensqualität der Patienten soll steigen wie auch die Zufriedenheit mit der allgemeinen Gesundheitsversorgung durch die optimierte Behandlung. Der Anteil unkoordinierter, ineffizienter und unwirtschaftlicher Untersu- 31 chungen soll sinken. Diese Ziele werden jedoch aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Interessen generiert ernsthafte Probleme für die Entwicklung und Durchführung von Disease Management Programmen. Die Patienten werten die Verbesserung ihres Gesundheitszustandes als Erfolg, während für Ärzte die Optimierung klinischer Parameter im Vordergrund steht. Ein Kostenträger hingegen verfolgt zuerst seine ökonomischen Ziele. Folglich können Disease Management Programme nur dann erfolgreich sein, wenn sie so gestaltet sind, dass sich alle Beteiligten mit ihren Zielen darin wiederfinden können. Obwohl der medizinische Nutzen der Programme und die im Übrigen durchschnittlich bessere medizinische Behandlung der Patienten im Disease Management Programm unbestritten ist im Vergleich zu nicht eingeschriebenen Patienten, sind noch keine Aussagen zu treffen, ob es ökonomisch sinnvoll ist, Disease Management Programme einzuführen. Hierzu ist es nötig, die Kosten und den Nutzen der Programme zu bestimmen. Dabei ergibt sich wieder das Problem der eingenommenen Sichtweise beispielsweise des Patienten oder der Krankenkasse. Liegt der monetäre Nutzen über den verursachten Kosten, ergibt sich eine positive Kosteneffizienz und die Programme sind ökonomisch sinnvoll. Gegenteiliges würde sich als ökonomisch widersinnig herausstellen, muss jedoch nicht zwangsläufig das Ende der Disease Management Programme bedeuten. Die zwar für die Kasse negative Kosteneffizienz ist aber für den Patienten aufgrund der medizinisch verbesserten Versorgung vorteilhaft. Eine Hoffnung läge dann darin, dass das Ansehen bei den Beitragszahlern so hoch ausfällt, dass sie bereit sind, die Mehrkosten zu tragen. Demnach würde ein negatives Ergebnis bei der Kosteneffizienz zu einer vertiefenden Diskussion der Vorzüge für den Beitragszahler führen. Um Vergleichbarkeit herzustellen, sollte der Nutzen eines Disease Management Programms in monetären Größen bewertet werden. Andererseits lassen sich jedoch Lebensqualität oder gewonnene Lebensjahre sowie Werbeeffekte und Kundenbindungen an die Krankenkasse nicht in Finanzen ausdrücken. Folglich wirft nicht jedes Disease Management Programm einen direkten ökonomischen Nutzen für die Krankenkasse ab (vgl. Lauterbach o. J., S. 279 ff.). 32 Die Zusammenfassung der Ergebnisse wissenschaftlicher Studien aus den USA, der Schweiz, Schweden oder den Niederlanden, die die Kosteneffizienz von Disease Management Programmen untersuchen, zeigt, dass aus gesamtgesellschaftlicher Sicht eine ausreichend hohe Evidenz vorhanden ist. Neben der ausschließlichen Betrachtung der Ausgaben und Einsparungen der Krankenkasse kommt insbesondere der Qualität der Programme größte Bedeutung zu. Die Orientierung an evidenzbasierter Medizin, der Einsatz geschulter Fachkräfte und die stetige Evaluation der Wirksamkeit sind entscheidende Komponenten. Insgesamt rechtfertigen und belegen die Vermeidung von Krankenhauseinweisungen, die Nutzung preiswerter Arzneimittel und die systematische Einführung von evidenzbasierten Leitlinien in die Routineversorgung, die zur Vermeidung von Folgeerkrankungen führen und somit kurz- und langfristige Einsparpotenziale hervorbringen können, die Kosteneffizienz der Programme. Der vorherrschende Zustand des Nebeneinanders von Über- wie Unterversorgung lässt vermuten, dass sich möglicherweise kostendeckende neben nicht kostendeckenden Disease Management Programmen etablieren (vgl. Lauterbach o. J., S. 292). Es bleibt jedoch davor zu warnen, übertriebene und einseitige Hoffnungen besonders von Seiten der Kostenträger, kurzfristig Kosten zu sparen, mit Disease Management Programmen zu verbinden. In Anbetracht des Zeit- und Personalaufwandes beim Aufbau derselben wäre das eine illusorische Annahme. Eventuell vorhandene Rationalisierungspotenziale und mögliche Einsparungen sind erst nach der Implementierung und Evaluation auszumachen. Eine ausschließliche Kostenorientierung wirkt nachteilig, hat das Scheitern von Disease Management Programmen zur Folge und verhindert den Fokus auf den Patienten und seine Versorgung. In den folgenden Abschnitten wird die Entwicklung und die Implementierung der Disease Management Programme im deutschen Gesundheitssystem bis hin zur Akkreditierung der Programme dargestellt. 3.3 Disease Management Programme und ihre Entwicklung Zum Abbau der Über-, Unter- und Fehlversorgung bei chronischen Krankheitsbildern setzt die Gesundheitspolitik auf Disease Management 33 Programme. In diesem Zusammenhang kommt dem Koordinierungsausschuss eine besondere Bedeutung zu. Der Koordinierungsausschuss setzt sich aus der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), der Bundesärztekammer (BÄK), den Spitzenverbänden der Krankenkassen mit Ausnahme der SKK, den Vorsitzenden der Bundesausschüsse Ärzte und Krankenkassen und der Zahnärzte und Krankenkassen sowie dem Vorsitzenden des Ausschusses Krankenhaus zusammen. Der Koordinierungsausschuss stellt das Beschlussgremium zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 137 e Absatz 3 und § 137 f Absatz 1 und 2 SGB V dar (vgl. Bronner 2003, S. 227). Seine Mitglieder hatten den gesetzlichen Auftrag, dem BMG bis zu sieben chronische Krankheiten zu empfehlen, für die Disease Management Programme in Frage kommen. Des Weiteren empfiehlt er dem BMG für die RSAV die Anforderungen für die Ausgestaltung der Disease Management Programme. Mit dem 01.01.2002 trat die RSA-Reform in Kraft, worauf bereits am 28.01.2002 der Koordinierungsausschuss folgende chronische Erkrankungen für die Einführung von Disease Management Programmen empfahl: Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2, Koronare Herzkrankheit (KHK), chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen und Brustkrebs. Der Koordinierungsausschuss wählte die zu empfehlenden chronischen Erkrankungen nach folgenden Kriterien (vgl. SVRKAiG 2003, S. 534) aus: Zahl der von der Krankheit betroffenen Versicherten Möglichkeiten zur Verbesserung der Qualität der Versorgung Verfügbarkeit von evidenzbasierten Leitlinien sektorenübergreifender Behandlungsbedarf Beeinflussbarkeit des Krankheitsverlaufs durch Eigeninitiative des Versicherten hoher finanzieller Aufwand der Behandlung Nach Bekanntgabe der vier benannten Krankheiten gemäß § 266 SGB V durch das BMG am 07.02.2002 setzte das BMG dem Koordinierungsausschuss Mitte März ein Frist von vier Wochen für die Erarbeitung der An- 34 forderungen zur Ausgestaltung der strukturierten Behandlungsprogramme. Angesichts des knappen Zeitrahmens und der Komplexität der Thematik erarbeitete der Ausschuss Empfehlungen zu allgemeinen Anforderungen an die strukturierten Behandlungsprogramme, die für alle Diagnosen gelten und von speziellen diagnosespezifischen Anforderungen zu unterscheiden sind. Diese speziellen Anforderungen sollen die allgemeinen für die einzelnen Krankheitsbilder konkretisieren. Insbesondere sind Anforderungen zu benennen für (vgl. SVRKAiG 2003, S. 534): die Behandlung nach evidenzbasierten Leitlinien unter Berücksichtigung des jeweiligen Versorgungssektors durchzuführende Qualitätssicherungsmaßnahmen Voraussetzungen und Verfahren für die Einschreibung des Versicherten in ein Programm, einschließlich der Dauer der Teilnahme Schulungen der Leistungserbringer und der Versicherten Dokumentation Bewertung der Wirksamkeit und der Kosten und die zeitlichen Abstände zwischen den Evaluationen eines Programms sowie die Dauer seiner Zulassung Am 13.05.2002 einigte sich der Koordinierungsausschuss mit der vom Gesetzgeber geforderten Einvernehmlichkeit der Beschlüsse von Kassenund Ärztevertretern auf das Anforderungsprofil für ein Disease Management Programm Diabetes mellitus Typ 2, gefolgt am 13.06.2002 von den Anforderungen an ein Disease Management Programm Brustkrebs. Nach der Beschlussfassung fand dann am 17.06.2002 die Anhörung von Verbänden der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie der Selbsthilfegruppen im BMG statt. Mit dem 01.07.2002 trat die Vierte Verordnung der RSAV als Stichtag für die Einführung der Disease Management Programme in Kraft (vgl. Bronner 2003, S. 227 ff.). 35 Der hier dargestellten Entwicklung der Disease Management Programme stand von vielen Seiten brüske Kritik gegenüber, die bereits an dieser Stelle erwähnt werden soll. Der Präsident der BÄK Hoppe hält die Hektik bei der Ausgestaltung der Disease Management Programme für bedenklich. Die strukturierten Behandlungsprogramme für chronisch Kranke müssen hohen Qualitätsstandards genügen und sollten nicht aus politischen Gründen zum 01.07.2002 erzwungen werden, kritisiert Hoppe (vgl. Rabbata 2002, S. 893). Völlig unrealistische Zeitvorgaben und politischer Aktionismus werden der Gesetzgebung vorgeworfen (vgl. Landgraf et al. 2004, S. 5; Bronner 2003, S. 228). Der SVRKAiG (2003, S. 539) bescheinigt der Verabschiedung der ersten beiden Anforderungsprofile einige Schwächen beim Konsensbildungsverfahren im Koordinierungsausschuss. Zu bemängeln sei die Anhörung von Verbänden, die Einbindung von Fachgesellschaften, die Besetzung von Arbeitsgruppen und die Auswahl der hinzugezogenen Experten. Alle Beteiligten bemängelten den von der Politik veranlassten Zeitdruck, selbst der Koordinierungsausschuss verabschiedete in seiner Sitzung am 13.06.2004 eine Resolution, aus der hervorgeht, dass es für den Koordinierungsausschuss nicht vertretbar sei, die Anforderungsprofile unter einem derartigen Zeitdruck zu erarbeiten. 3.3.1 Rahmenbedingungen für die Implementierung von Disease Management Programmen in Deutschland Mit der Reform des RSA ist vom Gesetzgeber die Einführung von Disease Management Programmen geregelt, die bisher im Sinne der Arbeitsdefinition für Disease Management des Kapitels 4 in Deutschland so noch nicht vorherrschen. Durch die Verknüpfung der Disease Management Programme mit dem RSA soll sich der Wettbewerb in der GKV auf die Implementierung von qualitativ hochwertigen Programmen konzentrieren und die Versorgungsqualität chronisch Kranker verbessern. Parallel soll durch die Berücksichtigung der in Disease Management Programme eingeschriebenen Betroffenen im RSA die Risikoselektion zu Gunsten gesunder und junger Versicherter an Attraktivität verlieren. Für die gesetzlichen Krankenkassen ergeben sich somit neue strategische Positionierungen im Gesundheitswesen. Wichtige Voraussetzungen für Disease Management in Deutschland hat der Gesetzgeber bereits mit neuen Versorgungsmodellen wie den Modell- 36 vorhaben nach §§ 63 – 65 SGB V, den Strukturverträgen nach § 73 a SGB V oder der Integrierten Versorgung nach §§ 140 a – h SGB V geschaffen. Eine Auswahl an Projekten (vgl. Lauterbach o. J., S. 39 ff.) auf Grundlage dieser Gesetzgebungen zeigt eine Umsetzung solcher Konzepte. Derzeitige Modellprojekte und Strukturverträge in der Diabetesversorgung werden beispielsweise schon als erfolgreiche Disease Management Programme deklariert, enthalten jedoch nur einzelne Komponenten eines Disease Management Programms und entsprechen nicht umfassend der Idee des Disease Managements (vgl. Lauterbach o. J., S. 42). Der Einsatz evidenzbasierter Leitlinien ist vertraglich nicht festgelegt und wird von den Vertragspartnern nicht zur Verfügung gestellt. In den Strukturverträgen ist keine Evaluation vorgeschrieben, sodass ohne Evaluation der Prozessund Ergebnisqualität Fehlentwicklungen und Problembereiche unerkannt bleiben. Ebenso ist die Herstellung von Transparenz durch Benchmarking in Strukturverträgen oder Modellvorhaben nicht berücksichtigt, wodurch der Anreiz zur Qualitätsverbesserung durch die Veröffentlichung der Ergebnisse verloren geht. Implementierungsstrategien wie der Einsatz von Remindern, Fortbildungen, Informationssystemen oder Entscheidungsunterstützungen verbessern die Anwendung von Leitlinienempfehlungen, finden jedoch bei Strukturverträgen oder Modellvorhaben keine systematische Anwendung. Da in bestehenden Modellprojekten wesentliche Komponenten eines qualitätsgesicherten Disease Managements fehlen, empfiehlt es sich, diese unter Beachtung der Anforderungen an Disease Management Programme zu modifizieren und zu strukturieren. Eine systematische flächendeckende Qualitätsverbesserung in der Versorgung chronisch Kranker durch die derzeit regional begrenzten Modellprojekte sei nicht zu erwarten und so genanntes „Schein-Disease Management“ (Lauterbach o. J., S. 45) würde die Über-, Unter- und Fehlversorgung eher intensivieren. Unabhängig von der Gesetzgebungsentwicklung zur Einführung von Disease Management Programmen hat dieses Thema wichtige strategische Auswirkungen auf dem Markt der privaten Krankenversicherungsanbieter. Die Einführung von Disease Management Programmen für die Versicherten kann den privaten Krankenversicherungen als den Erstanbietern von Disease Management Programmen Wettbewerbsvorteile bringen und gewinnt somit oberste Priorität. Da private Krankenversicherer chronisch Kranke als Versicherte ablehnen können oder entsprechende Prämien 37 verlangen, besteht die Gefahr des Wettbewerbsnachteils durch die Attrahierung weiterer chronisch Kranker nicht. Somit liegt die Bedeutung des Disease Managements für die privaten Krankenversicherungen neben der Erhöhung der Lebensqualität ihrer Versicherten in erster Linie in der eigenen Unternehmensentwicklung. Die Entwicklung im Servicebereich auf dem deutschen Gesundheitsmarkt lässt ebenfalls auf große Chancen durch Disease Management schließen. Kommerzielle Dienstleister bieten vornehmlich als Betreiber von Call Centern oder Online-Gesundheitsservices ihre Dienste an. Der Kundenkreis der Serviceanbieter erstreckt sich vom Kostenträger über die Leistungserbringer bis hin zum Patienten selbst. Zu den Aufgaben, die von Gesundheitsdienstleistern als Kooperationspartner im Rahmen von Disease Management Programmen übernommen werden können, zählen u. a. die Information von Patienten und Ärzten über Disease Management Programme, die Bereitstellung von Online-Datenbanken, die Entwicklung, Implementierung und Unterhaltung von Informations- und Remindersystemen, die Bereitstellung von Produkten zur Stärkung der Patientencompliance, das Datenmanagement von Programmen, die Entwicklung von Prozessabläufen für die am Disease Management Programm Beteiligten, die Betreuung von Patienten oder Ärzten über Call Center oder die Mithilfe bei der Aufbereitung und Verteilung von Leitlinien an beteiligte Ärzte und Patienten. Diese Anbebote sind als unterstützend zu den Leistungen der Ärzte und Krankenkassen anzusehen. Da die Entwicklung geeigneter Umsetzungsstrategien wie Schulungen, Fortbildungen oder Erinnerungsschreiben hohe medizinische Kompetenz erfordert, ist die Entwicklung der Inhalte des Disease Managements „eine ärztliche Aufgabe“ (Lauterbach o. J., S. 50). Die hier getätigte Beschränkung allein auf die ärztliche Profession lässt den Integrationscharakter als eigentliche Idee der Programme gänzlich vermissen. 3.3.2 Evidence-based Medicine und evidenzbasierte Leitlinien Die historische Entwicklung evidenzbasierter Leitlinien, die heute in vielen Industrieländern zum Standard gehören, lässt sich in den angloamerikanischen Sprachraum zurückverfolgen. Die systematisch entwickelten Entscheidungshilfen für Ärzte und Patienten, als international anerkannte Definition von Leitlinien in der Medizin sollen eine individuell angemessene gesundheitliche Versorgung ermöglichen (vgl. 38 Lauterbach o. J., S. 99). Dieser Darstellung liegt das Verständnis der Evidence-based Medicine (EbM) zugrunde. Der englische Internist David L. Sackett gilt als Begründer der EbM-Bewegung. Er fordert, ärztliche Entscheidungen nicht auf individuelle Erfahrungen, auch als Internal Evidence bezeichnet, zu stützen, sondern primär auf Erkenntnisse aus systematischen klinischen Studien, die so genannte External Evidence (vgl. Ulrich 2002, S. 28). Für Sackett (2002) ist EbM „[...] der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten externen, wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Patienten. Die Praxis der EbM bedeutet die Integration individueller klinischer Expertise mit der bestmöglichen externen Evidenz aus systematischer Forschung“ (Sackett 2002, S. 9). Die klinische Expertise meint das Können und die Urteilskraft, die Ärzte durch ihre Erfahrung und klinische Praxis erwerben. Das ärztliche Handeln wird also bestimmt durch individuelles Können und Erfahrung sowie Regelwissen. Dieses Regelwissen setzt sich aus unterschiedlichsten Informationen zusammen und ist die Grundlage für die konkrete individuelle ärztliche Entscheidung (vgl. Sawicki 2002, S. 27). Die Ursprünge der Methodik, unterschiedliche Behandlungsformen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen, lassen sich auf Archibald Cochrane, einen englischen Epidemiologen, zurückführen. Cochrane forderte 1972 in einer Veröffentlichung vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen im britischen National Health Service epidemiologische Wirksamkeitsvergleiche (vgl. Sauerland/Galandi 2001, S. 84). Diese Idee wurde 1992 in Ontario, Kanada, an der McMaster University von Sackett et al. weiterentwickelt zur Umsetzung von EbM. Evidenzbasierte Leitlinien stellen im Gegensatz zur EbM eine Evidenzquelle unter vielen dar, wie z. B. Studien oder Übersichtsarbeiten. Die Autoren von Leitlinien bedienen sich der Methode der EbM, um die Empfehlungen nachvollziehbar auf die beste vorliegende Evidenz zu stützen. Die Entwicklung von Leitlinien legitimiert sich aus folgenden Gründen: Übliche Evidenzquellen wie Studien oder Übersichtsberichte befassen sich in der Regel nur mit einzelnen Aspekten ärztlichen Handelns. Es gestaltet sich für einen Arzt äußerst schwierig, Recherchen und Bewertungen für alle Behandlungsschritte nach der Methode der EbM durchzuführen, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Leitlinien hingegen können ausgehend vom Krankheitsbild ganze Behandlungsverläufe evidenzbasiert nachvollziehen. Sie geben konkrete Handlungsempfehlungen, wo publizierte Studien und Übersichtsarbeiten 39 größtenteils Untersuchungsergebnisse präsentieren und diskutieren. Das Zurückgreifen auf evidenzbasierte Leitlinien stellt für viele praktisch tätige Ärzte eine willkommene Alternative zu der mühsamen Bewertung von Studien auf Grundlage der EbM dar, die zudem Kenntnisse in der klinischen Epidemiologie, im Umgang mit englischsprachiger Originallektüre und computergestützter Literaturrecherche erfordert (vgl. Helou/Perleth 2002, S. 71 ff.). Der Rückgriff auf internationale Leitlinien resultiert aus den im deutschsprachigen Raum kaum zur Verfügung stehenden evidenzbasierten Leitlinien. Probleme bei der Implementierung dieser internationalen Leitlinien ergeben sich hinsichtlich anderer struktureller Rahmenbedingungen und Wertvorstellungen des deutschen Gesundheitssystems (vgl. Sawicki 2002, S. 27; Lauterbach o. J., S. 106; Helou/Perleth 2002, S. 75). Im Rahmen von Disease Management Programmen zählen evidenzbasierte Leitlinien zu den wesentlichsten Komponenten. Sie sind Grundlage für Versorgungsalgorithmen im Krankenhaus, für Reminder- und Feedbacksysteme, für Entscheidungsunterstützungen und Schulungsinhalte. Die systematisch entwickelten Darstellungen und Empfehlungen unterstützen Ärzte wie Patienten bei der Entscheidung für nützliche Maßnahmen von der Prävention über Diagnostik und Therapie bis hin zur Nachsorge (vgl. Schmacke 2002, S. 13). Die Bedeutung der Leitlinien liegt in der Qualitätssicherung und -verbesserung der medizinischen Versorgung, die sich durch hohe traditionelle Variabilität auszeichnet (vgl. Greulich/Berchthold/Löffel 2002, S. 79). Durch die Verringerung der Variationsbreite der Therapien lassen sich medizinische und ökonomische Ergebnisse verbessern. Zur Verbesserung der Versorgungsqualität und Sicherung der Kosteneffektivität ist die Umsetzung evidenzbasierter Therapien von entscheidender Bedeutung, da hohe Folgekosten in der Versorgung chronisch Kranker häufig durch Leistungen verursacht werden, deren Wirksamkeit nicht gesichert ist. Insbesondere den unwirksamen und nicht kosteneffektiven Interventionen gilt es, auf evidenzbasierter Grundlage entgegenzutreten (vgl. Lauterbach/Wille 2001, S. 139). Die Versorgung auf der Basis evidenzbasierter Therapien soll im Bereich der chronischen Erkrankungen die identifizierten Versorgungsdefizite systematisch ausgleichen. Durch ein multidisziplinäres Team aus Experten für die definierte Erkrankung und benachbarter Fachdisziplinen sowie in der Bewertung von 40 Studien versierte Ärzte, Epidemiologen und Gesundheitsökonomen erfolgt die praktische Entwicklung von Leitlinien. Datenbanken werden nach definierten Suchstrategien auf Publikationen mit erforderlichen Daten und Informationen untersucht. Diese werden zusammengetragen, entsprechend ausgewertet und nach der in Abbildung 1 dargestellten allgemein anerkannten Evidenzklassifikation bewertet. Level Evidenz-Typ Ia Metaanalyse randomisierter kontrollierter Studien Ib mindestens eine randomisierte kontrollierte Studie IIa gut geplante, nicht randomisierte kontrollierte Studie IIb gut geplante, quasi experimentelle Studie III gut geplante, nicht experimentelle deskriptive Studie IV Expertenmeinung, Konsensuskonferenz Abbildung 1: Hierarchie wissenschaftlicher Evidenz Quelle: Helou/Perleth 2002, S. 76 In Disease Management Programmen erfolgt die Verbreitung von evidenzbasierten Leitlinien zum einen über die Entwicklung von Programmen auf Basis evidenzbasierter Leitlinien und zum anderen dienen sie der medizinischen Profession und den Patienten als Anwendungs- und Entscheidungsunterstützung. Im Disease Management stellen sie den Rahmen für die Umsetzung einer evidenzbasierten Regelversorgung dar (vgl. Lauterbach o. J., S. 105 f.). Dennoch ist im Zusammenhang mit Disease Management Programmen der Begriff der evidenzbasierten Leitlinien Gegenstand zahlreicher Kontroversen. So kritisiert beispielsweise BÄK-Präsident Hoppe die Checklistenmedizin, die sich manch Gesundheitswissenschaftler oder Kassenfunktionär vorstellt. Dieser Weg führe seines Erachtens in die Unterversorgung. Erhalten die Kassen die Steuerungsmacht, seien weitere Mangelverwaltung, Anonymisierung und Deprofessionalisierung nicht aufzuhalten. Hoppe sieht mit der Checklistenmedizin die individuelle Therapiefreiheit der Ärzte in Gefahr (vgl. Rabbata 2002, S. 893). Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet vom Ärztetag, deren Vertreter ebenfalls die Autonomie der Ärzteschaft durch die Einführung 41 verbindlicher Leitlinien massiv bedroht sehen. Zudem gefährden zu eng gefasste Leitlinien die individuelle Behandlung eines Patienten und zerstören die Vertrauensbasis zwischen Arzt und Patient. Neben der Bevormundung werde das Vertrauensverhältnis außerdem durch die Übermittlung von Arzt- und Patientendaten an die Krankenkasse gestört, worunter die Qualität der Behandlung leide (vgl. FAZ 2002, S. 15). Dass EbM keine Checklistenmedizin ist, liegt darin begründet, dass dem Konzept der EbM ein Bottom-up Ansatz zugrunde liegt (vgl. Sackett 2002, S. 10 f.). Dieser verbindet die beste zur Verfügung stehende externe Evidenz mit der individuellen Expertise und den Patientenpräferenzen. Externe klinische Evidenz kann individuelle Expertisen ergänzen, aber niemals ersetzen. Die individuelle Expertise entscheidet, ob die externe Evidenz auf den Einzelnen anwendbar ist und wie sie in die Entscheidung integriert werden kann. Aus diesem Grund ist das Konzept der EbM nicht mit einem Kochrezept zur Patientenbehandlung vergleichbar. Zusammenfassend lassen sich hieraus die drei Grundprinzipien der EbM ableiten: die wissenschaftliche Beweisführung die Expertise oder Erfahrung die Patientenpräferenzen in der jeweiligen Situation Mit der EbM hat sich eine Denk- und Arbeitsrichtung etabliert, die die Fähigkeit zur eigenständigen Fortbildung unter Nutzung modernster Informationsquellen und -methoden fördert. Der individuellen klinischen Erfahrung wird ebenso großer Stellenwert beigemessen wie der kritisch bewertenden Haltung gegenüber der Fachliteratur (vgl. Perleth 2002, S. 13 f.). Für die praktische Realisierung kommt hinzu: „Die Umsetzung evidenz-basierter Medizin erfordert häufig eine Verhaltensänderung der therapierenden Ärzte“ (Lauterbach/Wille 2001, S. 139). 3.3.3 Akkreditierung von Disease Management Programmen Die Akkreditierung eines Disease Management Programms bedeutet die Prüfung der Übereinstimmung der Programme mit den definierten Anforderungen und die Bewertung des Programmkonzeptes bezüglich der Erhebung krankheitsspezifischer Indikatoren und der sich aus dem 42 Ergebnis ableitenden Qualitätssicherungsmaßnahmen. Das Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs in der GKV vom 01.01.2002 legt die Zuständigkeit des Bundesversicherungsamt (BVA) als Zulassungsbehörde für diese Programme fest. Die Zulassung durch das BVA gewährleistet eine bundesweit einheitliche Verfahrensweise und die neutrale Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen. Zur dauerhaften Sicherstellung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Disease Management Programme sollen von Beginn an regelmäßige Evaluationen der Programme beitragen, die der Frage nachgehen, ob die Ziele der Programme in der Umsetzung auch tatsächlich erreicht werden. Die Zulassung wird aufgrund der gesetzlichen Vorgaben immer nur befristet erteilt, im Regelfall für drei Jahre. Eine Verlängerung der Zulassung ist dann zukünftig von den Ergebnissen der Evaluation der einzelnen Disease Management Programme abhängig. Nach In-Kraft-Treten der Vierten Verordnung zur Änderung der RSAV vom 27.06.2002, die die Anforderungen für die Zulassung von Disease Management Programmen für Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und für Patientinnen mit Brustkrebs festgelegt hat, sind inzwischen seitens verschiedener Krankenkassen Anträge auf Zulassung von Disease Management Programmen für diese Bereiche beim BVA eingereicht worden. Nach intensiver Überprüfung der einzelnen Anträge und notwendigen Überarbeitungen konnten mittlerweile die ersten Disease Management Programme für drei Jahre zugelassen werden (vgl. BVA 2003). Neben den Programmen sind auch die zu ihrer Durchführung geschlossenen Verträge mit den Leistungserbringern zur Akkreditierung vorzulegen. Wegen der Kopplung der Disease Management Programme an den RSA ist die Berechtigung zur Antragstellung ausschließlich auf die Kassen beschränkt. Im folgenden Abschnitt der vorliegenden Arbeit wird die Struktur der Disease Management Programme abgebildet und die Funktionen der einzelnen Komponenten erläutert. Da ein anhaltender Erfolg der Programme einen Datenaustausch zwischen den verschiedenen Leistungserbringern voraussetzt, schließt dann die Betrachtung des Datenmanagements im Abschnitt 4.4 an. 43 3.4 Aufbau von Disease Management Programmen Einschreibemodul Das Ablaufschema in Abbildung 2 zeigt modellhaft, wie die einzelnen Komponenten eines Disease Management Programms zusammengeführt werden. Einschreibekriterium erfüllt: Standardisiertes Programm zur Diagnosestellung Statuserhebung Risikostratifizierung und Zuteilung zu einer entsprechenden Gruppe Basismodul Gruppe 1: Zielwert erreicht entsprechend der evidenzbasierten Leitlinie Gruppe 2: Mindestens ein Zielwert nicht entsprechend der evidenzbasierten Leitlinie erreicht Gruppe 3: Komplikationen/Begleiterkrankungen entsprechend der evidenzbasierten Leitlinie Bestehend aus: - Krankheits-Koordinator - Screening - Patientenschulung - Benchmarkingdatensatz - evidenzbasierte Leitlinien - Selbsthilfegruppen - Individueller Patientenbehandlungsplan - Follow-up - Entscheidungsunterstützung (z. B. Disease-Management-Zirkel) Ergänzungsmodule Individuelle Basistherapie Individuelle Basistherapie Individuelle Basistherapie Therapie der Risikofaktoren Therapie der Risikofaktoren Komplikationstherapie Klinischer Zustand Individuelles Patientenmanagement nach Risikostratifizierung Abbildung 2: Ablaufschema eines Disease Management Programms Quelle: SVRKAiG 2003, S. 547 44 Psychosoziale Faktoren Wie aus Abbildung 2 hervorgeht, werden zum Aufbau eines Disease Management Programms drei spezifische Modultypen unterschieden: das Einschreibemodul, das Basismodul sowie die Ergänzungsmodule zur spezifischen Therapie der Risikofaktoren und der Komplikationen. In Abbildung 3 wird die Verknüpfung der Module dargestellt. Daran schließt sich die detaillierte Beschreibung der einzelnen Module an. Modultyp Beschreibung Aufgabe Einschreibemodul Das Einschreibemodul spezifiziert die medizinischen Einschreibekriterien auf dem Boden evidenzbasierter Leitlinien. Das Einschreibemodul beinhaltet auch das Einschreibeverfahren mit Einteilung der Patienten in eine von drei Disease Management-Gruppen (nach Risikostratifizierung) Qualitätssicherung, Sicherung der Kosteneffektivität, Risikostratifizierung der Patienten Das Basismodul umfasst die Komponenten eines Disease Managements für die Basistherapie einer Erkrankung. Je nach Risikostratifizierung werden diese Komponenten einzeln oder in unterschiedlichen Kombinationen eingesetzt. Sicherung von Qualität, Diagnose und Kosteneffektivität der Versorgung durch Umsetzung evidenzbasierter Leitlinien in die Regelversorgung, Entscheidungsunterstützung, individuelle Therapieempfehlungen und Reminder, Schulung des Patienten und Unterstützung des Selbstmanagements, Datenerhebung Basismodul Ergänzungsmodul Das Ergänzungsmodul, welches das Basismodul spezifiziert, unterteilt sich in „Therapie der Risikofaktoren“ und „Komplikationstherapie“. Spezifische Therapie Zielt auf die Reduktion einzelner Risikofaktoren (Sekundärprävention) Komplikationstherapie Dieses Modul ergänzt die komplikationsspezifische Therapie Sicherung von Qualität und Kosteneffektivität der Versorgung durch spezifisch auf Risikofaktoren, Folgeerkrankungen und Komplikationen zugeschnittene Interventionen Abbildung 3: Modultypen im Disease Management Programm Quelle: Lauterbach o. J., S. 188 f. 3.4.1 Einschreibemodul Das Einschreibemodul ist die Eintrittspforte für Patienten in das Disease Management Programm. Es dient der Diagnosestellung, der Statuserhebung, der Qualitätssicherung und der Risikostratifizierung. Auf 45 der Grundlage evidenzbasierter Leitlinien werden Einschreibekriterien definiert, die manipulationssicher, einfach prüfbar und leicht durch den Arzt zu erheben sein sollten. Als alleiniges Einschreibekriterium ist die Diagnose der manifesten Erkrankung maßgeblich. Die Diagnose ergibt sich aus der Klinik und dem Labor. Ist eine Diagnose erstellt, die zur Einschreibung berechtigt, füllt in der Regel der Hausarzt mit Einverständnis des Patienten die von der Krankenkasse zur Verfügung gestellten Formulare aus und sendet diese an die Kasse zurück. Der Arzt und der Patient erhalten je einen Durchschlag für ihre Dokumentation. Die Einschreibung in ein Disease Management Programm ist freiwillig. Der Patient wird über Ziele und Inhalte des Programms sowie über die Verwendung der Befunddaten bei der Krankenkasse schriftlich aufgeklärt. Der Hausarzt koordiniert entsprechend den Empfehlungen des Disease Management Programms die Versorgung und handelt in enger Kooperation mit Spezialisten und Krankenkasse. Bei ausgewählten Erkrankungen wie beispielsweise Brustkrebs kann diese Kooperation aus einem in der Klinik angesiedelten oder in die Klinik integrierten Zentrum bestehen. Neben der Diagnosesicherung gehört zur Einschreibung die dokumentationspflichtige Statuserhebung. Diese beinhaltet die Erhebung der ausführlichen Anamnese, körperliche und laborchemische Untersuchungen sowie weitere Untersuchungsergebnisse konsultierter Fachärzte. Empfehlenswert ist es, die zu erhebenden Parameter auf Grundlage der analysierten Bereiche der Über-, Unter- und Fehlversorgung der jeweiligen Erkrankung festzulegen sowie einheitlich und verbindlich für Deutschland zu regeln (vgl. Lauterbach o. J., S. 190). Dem Ablaufschema in Abbildung 2 gemäß, erfolgt auf Grundlage der gewonnenen Daten aus der Statuserhebung die Zuteilung des Patienten in eine der drei Disease Management Gruppen durch den behandelnden Arzt. Ausgehend hiervon werden vom Arzt und der Krankenkasse die weiteren Disease Management Module veranlasst. So erhalten Patienten der Gruppe 1 das Basismodul, Patienten der Gruppe 2 das Basismodul und das Ergänzungsmodul ‚Therapie der Risikofaktoren’ und Patienten der Gruppe 3 das Basismodul einschließlich der Ergänzungsmodule ‚Therapie der Risikofaktoren’ und ‚Komplikationstherapie’. Die Zuteilung in Disease Management Gruppen auf der Grundlage von Zielwerten ergibt eine Risikostratifizierung, die das therapeutische Vorgehen und die 46 Schnittstellen im Versorgungsablauf definiert und patientenindividuelle unterstützende Interventionen anbietet. Ergibt sich beispielsweise für einen Patienten die Zuteilung in Gruppe 2, enthält das Basismodul der Gruppe 2 einen Vorschlag evidenzbasierter Therapie, die Definition der Schnittstelle, wann z. B. an eine Schwerpunktpraxis zu überweisen oder entscheidungsunterstützend ein anderer Arzt zu konsultieren ist, sowie Empfehlungen zu unterstützenden Maßnahmen wie Schulungen oder der Einbeziehung von Selbsthilfegruppen. Das Veranlassen der unterstützenden Maßnahmen kann dem Arzt überlassen werden oder die Krankenkasse selbst wird aktiv. Sie kann beispielsweise Krankheitskoordinatoren, gezielte Informationen oder Remindersysteme einsetzen (vgl. Lauterbach o. J., S. 190 ff.; SVRKAiG 2003, S. 546 ff.). 3.4.2 Basismodul Entsprechend der Risikogruppenzugehörigkeit gestalten sich die Versorgungsstrukturen in unterschiedlichen Stufen. Das Basismodul, das bei allen drei Disease Management Gruppen zur Anwendung kommt, enthält generelle Versorgungs- und unterstützende Komponenten. Deren Einsatz und Ausprägung ergibt sich aus der Risikostratifizierung. Zu den Versorgungskomponenten zählen Therapie nach evidenzbasierten Leitlinien, Screening, Schulung und Follow-up. Unterstützende Instrumente sind Remindersysteme, Informationssysteme, Krankheitskoordinator, Entscheidungsunterstützung, Selbsthilfegruppen, Kommunikationsplattform und zeitnahes Qualitätsmanagement. Nachstehende Übersicht stellt die einzelnen Versorgungskomponenten des Basismoduls dar. 47 Versorgungskomponente Beschreibung Therapie nach evidenzbasierten Leitlinien Der Behandlung einer Erkrankung im Rahmen von Disease Management Programmen liegt ein mehrstufiges Therapiemanagement zugrunde. Die Reduzierung bzw. Vermeidung von Risikofaktoren wird anfänglich angestrebt. Wird hierdurch keine Normalisierung der Befunde erreicht, folgen in der Regel medikamentöse Strategien. Das Vorgehen wird durch die krankheitsbezogene Leitlinie festgelegt. Screening Screening soll zur Vermeidung möglicher Komplikationen, Begleiterkrankungen und Rezidiven beitragen. Schulungen für Patienten unter Berücksichtigung lerntheoretischer Methoden Sie vermitteln Informationen und unterstützen das Einüben von Techniken des Selbstmanagements in Kleingruppen. Follow-up Neben zeitnahen, am individuellen Krankheitsverlauf orientierten Untersuchungen erfolgen in definierten Zeitabständen Kontrollen wichtiger Verlaufs-, Outcome- und Risikostratifizierungsparameter. Es wird ermittelt, ob z. B. weitere Schulungen nötig sind oder spezialärztliche Untersuchungstermine wahrgenommen werden sollten. Abbildung 4: Versorgungskomponenten des Basismoduls Quelle: Eigene Darstellung nach Lauterbach o. J., S. 194 und SVRKAiG 2003, S. 551 ff. Die beschriebenen Versorgungskomponenten des Basismoduls werden durch weitere Disease Management Komponenten unterstützt und ergänzt. Folgende Zusammenstellung zeigt unterstützende Instrumente der jeweiligen Versorgungskomponenten und erläutert deren Wirksamkeit. 48 Therapie nach evidenzbasierten Leitlinien Evidenzbasierte Leitlinien für Ärzte vermitteln evidenzbasierte Empfehlungen für eine Erkrankung und ihre Folgeerkrankungen. Evidenzbasierte Leitlinien für Patienten vermitteln evidenzbasierte Empfehlungen für eine Erkrankung und ihre Folgeerkrankungen in einer für Patienten verständlichen Form. Individuelle Patientenbehandlungspläne stellen individuell zugeschnittene Therapieempfehlungen mit einer Beschreibung des persönlichen Risikoprofils bereit. Entscheidungsunterstützung bei der Neustrukturierung von Behandlungsabläufen und bei der Integration evidenzbasierter Empfehlungen in den Therapieablauf Screening Leitlinien zur Spezifizierung und Durchführung des Screenings Reminder für Arzt und Patient zur Erinnerung an Screeningtermine Entscheidungsunterstützung durch z. B. evidenzbasierte Leitlinien, Fortbildung, Coaching Schulungen für Patienten Selbsthilfegruppen können Verhaltensänderungen initiieren und unterstützen Patientenleitlinien als Arbeitsblätter oder Patientenselbstverträge zur Erarbeitung selbstgesteckter Ziele, um Schulungseffekte langfristig zu stabilisieren Informationssysteme vermitteln Patienten und Angehörigen Informationen über die Schulungsinhalte hinaus und dienen der Auffrischung von Schulungsinhalten Reminder erinnern an Schulungsinhalte und selbst gesteckte Ziele und tragen somit zur Konsolidierung der Schulungsinhalte bei Follow-up Der Krankheitskoordinator (spezialisierte Pflegekräfte, Ärzte, Call Center) bietet eine abgestufte persönliche Betreuung des Patienten in definierten Situationen. Schulungen zur effektiven Unterstützung des Selbstmanagements Reminder zur Erinnerung an Zielvereinbarungen, Schulungsinhalte, Kontrollen etc. Patientenleitlinien/Informationsmaterial helfen dem Patienten, Gründe und Durchführung von Maßnahmen des Selbstmanagemtens zu verstehen und ihre Bedeutung zu erkennen Abbildung 5: Versorgungs- und unterstützende Komponenten des Basismoduls Quelle: Eigene Darstellung 49 Die dargestellten Komponenten des Basismoduls stehen dem Arzt und der Krankenkasse zur Verbesserung der Patientenversorgung und Patientencompliance zur Verfügung. Ärztliche Fortbildungen, Datenbanken für alle am Disease Management Beteiligten und die genaue Definition von Schnittstellen zur Überweisung auf andere Versorgungsebenen dienen außerhalb des Basismoduls der Umsetzung evidenzbasierter Therapieschemata. In Abhängigkeit von nicht erreichten Zielwerten sieht ein Disease Management Programm für Patienten der Disease Management Gruppen 2 und 3 Ergänzungsmodule vor. 3.4.3 Ergänzungsmodule Liegen bei einem Patienten Risikofaktoren vor, die mit den Maßnahmen des Basismoduls nicht ausreichend beeinflusst werden können, wird vom Disease Manager dem Basismodul das spezifische Modul ‚Therapie der Risikofaktoren’ hinzugefügt und die darin vorgesehenen Interventionen veranlasst. Dies schließt alle Maßnahmen zur Reduktion von Risikofaktoren ein, die sonst zu Folgeerkrankungen oder Komplikationen führen könnten. Zu diesen Maßnahmen zählt das verstärkte Selbstmanagement durch Schulungen und Anleitungen zur Übernahme von Eigenverantwortung für die Gesundheit. Ferner erfährt der Patient ein spezifisches Monitoring, das sich individuell an den vorhandenen Risikofaktoren orientiert. Eine über das Basismodul und das Ergänzungsmodul ‚Therapie der Risikofaktoren’ hinausgehende Behandlung erhält ein Patient, wenn Komplikationen der Grunderkrankung auftreten oder diese bereits bei der Einschreibung in das Programm vorliegen. Diese komplikationsorientierte Behandlung im Rahmen des Ergänzungsmoduls ‚Komplikationstherapie’ gibt das Programm vor. Sie orientiert sich an den jeweils typischen Komplikationsmustern, die sich vorwiegend auf bestimmte Organsysteme beziehen. Die Prüfung zur Minderung der Risikofaktoren durch das Ergänzungsmodul ist ebenfalls einzuschließen. Auch die Ergänzungsmodule setzen evidenzbasierte Leitlinien, Screeninguntersuchungen, Schulungen, Informationssysteme, Selbsthilfegruppen und Remindersysteme ein (vgl. SVRKAiG 2003, S. 554). Das erfolgreiche Management eines Patienten sollte, wie in Abbildung 2 abschließend dargestellt, neben der klinischen Risikostratifizierung auch den aktuellen klinischen Zustand des Patienten, wie z. B. die 50 Stabilisierungsphase nach dem Klinikaufenthalt und die psychosozialen Faktoren wie u. a. das häusliche Umfeld und die Fähigkeit der Selbstsorge, berücksichtigen. Darauf basierend erfolgt beispielsweise die Planung der Weiterbetreuung und der Einsatz eines speziellen Krankheitskoordinators oder eines häuslichen Pflegedienstes. Für chronisch Kranke führen Weiterbetreuungskonzepte nach der Klinikentlassung zu signifikanten Kosteneinsparungen und verbesserter Compliance. Durch die Festlegung einheitlicher Module und Komponenten soll verhindert werden, dass Programme nur ein oder zwei Komponenten oder nur ein Modul definieren und implementieren (vgl. Lauterbach o. J., S. 193). 3.5 Datenmanagement oder die „mentale Integration“ Der nachhaltige Erfolg von Disease Management Programmen setzt einen Wandel im integrierten und vernetzten Denken aller Beteiligten voraus (vgl. Greulich/Berchthold/Löffel 2002, S. 106 ff.). Sie müssen bereit sein, unternehmensübergreifend in Prozessen zu denken und zu handeln. Dieser mentale Wandel schließt die Bereitschaft zur Herstellung von Datentransparenz ein. Leistungserbringer sowie Kostenträger stehen sich skeptisch gegenüber und geben nur die notwendigsten Informationen weiter. Der KBV-Vorsitzende Richter-Reichhelm sieht in den Disease Management Programmen grundsätzlich einen Schritt in die richtige Richtung, befürchtet aber, dass die Krankenkassen die Chance erhalten, sich in die ärztliche Behandlung einzumischen. Daher spricht sich die KBV dafür aus, den Kassen nur die notwendigen Daten zu übermitteln, die sie für den RSA benötigen. Sollten die Kassen in Fragen Datenschutz nicht kompromissbereit sein, werde keine KV zur Zusammenarbeit bereit sein, betonte Richter-Reichhelm (vgl. Gerst 2002, S. 901). Einer weiteren Diskussion zufolge (vgl. Ärzte Zeitung 2002 Nr. 28, S. 4) will die ärztliche Selbstverwaltung verhindern, dass versichertenbezogene Behandlungs- und Abrechnungsdaten den Kassen in die Hände gelangen. Sollten die Kassenärztlichen Vereinigungen jedoch bei strittigen Datenfragen nicht kooperieren, würden die Krankenkassen diese bei konkreten Verträgen für Disease Management Programme übergehen. Zwar wollen die Versicherer mit der ärztlichen Selbstverwaltung zusammenarbeiten, um die Programme schnell und flächendeckend einzuführen, würden aber auch über andere Vertragspartner nachdenken, warnt der Chef der VdAK Rebscher. 51 Die Leistungserbringer sind ebenfalls kaum bereit, patientenbezogene Daten untereinander auszutauschen, da sie Wettbewerbsnachteile befürchten. Hier gilt es, stärkere Anreize zur Kooperation und Integration zu setzen, die motivieren, mit Daten unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Patienten transparenter umzugehen. Der Nutzen, den Einzelne durch die Zurückhaltung von Daten haben könnten, darf gegenüber dem Nutzen, den das Gesamtsystem durch Offenlegung hätte, nicht dominieren. Insbesondere Vergütungsmodelle, die Einsparungen in einem Netzwerk honorieren und somit Anreize für vernetztes, kostenbewusstes Handeln gewähren, bieten eine Chance, die „mentalen Barrieren“ (Greulich/Berchthold/Löffel 2002, S. 106) aufzuweichen. Neben der Schaffung von Datentransparenz in einem vernetzten System ist die Standardisierung für die systematische Auswertung der Daten Voraussetzung. Dafür wiederum bedarf es einheitlicher Behandlungspfade mit entsprechenden Leitlinien. Für Disease Management Programme ist es von entscheidender Bedeutung, dass Daten zeitnah zur Verfügung gestellt werden, um auf der Grundlage einer systematischen und standardisierten Dokumentation, Bereiche von Über-, Unter- und Fehlversorgung in der Versorgung chronisch Kranker zu identifizieren und abzubauen. Die Dokumentation dient der Datensammlung in den Disease Management Programmen und dem Patientenmanagement. Sie sollte einheitliche Zielwerte und Behandlungsziele sowie die Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität erfassen. Diese systematische und standardisierte Dokumentation kann in einem Datensatz erfolgen, der auch zum Benchmarking der Programme verwendet werden kann (vgl. Lauterbach o. J., S. 155). Die Indikatoren der Prozessqualität erfassen die Regelmäßigkeit krankheitsspezifischer, evidenzbasierter erhobener Laborwerte, durchgeführte Schulungen und Fortbildungen sowie den Einsatz von Remindern. Die Fragen der Ergebnisqualität beziehen sich auf krankheitsspezifische Folgekomplikationen, die innerhalb einer systematischen Qualitätsverbesserung der Versorgung chronisch Kranker rückläufig werden sollten. Die krankheitsspezifischen Zielwerte werden entsprechend der Risikostratifizierung der Patienten festgelegt. Dabei ist Einheitlichkeit innerhalb der GKV anzustreben, um zu vermeiden, dass Versicherte unterschiedlicher Kassen unterschiedliche Zielwerte erreichen sollen. Der Datensatz ist regelmäßig an die Kasse zur Datenerfassung weiterzuleiten und sollte von der Kasse zentral erfasst werden. Durch diese zentrale Erfassung und Sammlung der 52 Daten bei der Kasse als Programmanbieter lässt sich das Datenmanagement effizient und effektiv gestalten. Die erhobenen Daten werden in Disease Management Datenbanken aufgenommen, ausgewertet, gespeichert und gepflegt. Die Weitergabe von Daten, die sich auf Versicherte und Leistungserbringer beziehen, an die Krankenkasse ist Voraussetzung für ein funktionierendes Disease Management (vgl. Lauterbach o. J., S. 163). Daher kann ein Disease Management Programm nur zugelassen werden, wenn es vorsieht, dass der Versicherte seine Teilnahme freiwillig erklärt und darüber informiert ist, dass zur Durchführung des Programms die nötigen Befunddaten an die Krankenkasse übermittelt werden und diese die Daten zur Betreuungsunterstützung weiterverarbeitet. Zugriff auf die Daten haben nur Personen, die Aufgaben im Rahmen der Betreuung Versicherter in Disease Management Programmen wahrnehmen und hierfür besonders geschult wurden (vgl. Vierte Verordnung zur Änderung der RSAV 2002, § 28 d Abs. 1 Satz 3; § 28 f Abs. 1 Satz 2). Neben den kontroversen Diskussionen um das Datenmanagement, die zum Teil interessengeleitet sind, werden die Disease Management Programme von weiteren kritischen, nicht zu vernachlässigenden Debatten begleitet, die im Folgenden zusammengefasst werden. 3.6 Disease Management Programme – eine kritische Sicht Bei der Einführung von Disease Management Programmen, die ganz wesentlich auf die Gutachten zur Reform des RSA (vgl. Lauterbach/Wille 2001; IGES/Cassel/Wasem 2001) zurückgehen, liegt die Hoffnung der Gesundheitspolitik darin, „gleich zwei Fliegen auf einen Schlag zu treffen“ (Felder 2003, S. 237). Zum einen sollen die Defizite im Kassenwettbewerb behoben werden und zum anderen die Mängel in der medizinischen Versorgung reduziert werden. Es stellt sich die Frage, ob diese zwei Ziele, Kassenwettbewerb und Versorgung, miteinander zu verbinden sind, was auch als der Geburtsfehler der Disease Management Programme angesehen wird. So stehen beispielsweise den recht eindeutigen Erkenntnissen der evidenzbasierten Medizin über den Nutzen und den Erfolg eines Disease Management Programms Hypertonie mehrere Probleme insbesondere in der GKV gegenüber. Das Interesse der Akteure konzentriert sich auf kurzfristige Ziele, die raschen Einnahmen aus dem RSA, wobei zu erzielende mittel- 53 bis langfristige Einsparungen durch die Versorgungsoptimierung chronisch Kranker vernachlässigt werden (vgl. Derdzinski/Hecke/Ziegenhagen 2003, S. 323). Generell erscheint die skizzierte RSA-Reform als sinnvoller Schritt, da ein morbiditätsorientierter RSA die Anreize zur Risikoselektion mindert (vgl. Lauterbach/Wille 2001, S. 15). Indem die Transfers nicht mehr ausschließlich von finanziellen, sondern zusätzlich von Versorgungsgesichtspunkten geleitet werden, ist eine Verbesserung der Versorgungsqualität zu erwarten. Mit der Einführung der Disease Management Programme soll das Interesse der Krankenkassen auf die verbesserte Versorgung chronisch Kranker gerichtet werden und für die Versorgung dieser Patientengruppen neue Perspektiven eröffnen. Somit unterstützt der RSA die bessere Vernetzung und die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtete Versorgung. Dennoch lassen sich in der Kopplung der Disease Management Programme an den RSA und somit die Einbettung in den Kassenwettbewerb einige Fehlanreize erkennen. Durch die Verknüpfung der Disease Management Programme mit dem RSA stehen die wirtschaftlichen Interessen bei vielen Krankenkassen im Vordergrund. Die Krankenkassen müssen möglichst viele Teilnehmer für die Behandlungsprogramme gewinnen, um Ausgleichszahlungen aus dem RSA zu erhalten. Da die Behandlung aber möglichst wenig kosten sollte, werden die Anforderungen an die Programme gering sein und den wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht genügen. Eine Versorgungsverbesserung ist daher kaum zu erwarten (vgl. Aktuelles 2002, S. 1). Ein ökonomisch rationelles und anreizkonformes Handeln der Kassen ist als solches erst einmal nicht kritikwürdig, sofern die beabsichtigte Verbesserung der Versorgung damit einhergeht (vgl. SVRKAiG 2003, S. 542). Problematisch ist auch, dass vor allem das Verhalten und nicht wie bisher nur objektiv zuschreibbare Kriterien im RSA zum Tragen kommen. Der Finanztransfer steht in Abhängigkeit zum Verhalten des Versicherten und des Arztes. Dies wiederum birgt hohes Manipulationspotenzial. Von der Entscheidung des Versicherten hängt es ab, ob seiner Kasse der normale Beitragsbedarf oder der höhere Chronikersatz zuerkannt wird. Die von der Kasse zu tragenden Behandlungskosten bleiben währenddessen dieselben. Dem Arzt obliegt die Aufgabe, den Versicherten über Inhalte und Ziele der Disease Management Programme zu informieren. Von sei- 54 ner Empfehlung wird unter anderem abhängen, ob sich der Versicherte für eine Einschreibung entscheidet. Somit beeinflusst auch der Arzt die Finanzmittelaustattung der Kassen. Das macht deutlich, dass die Verknüpfung von RSA und Disease Management Programmen Anreize für Manipulationsbündnisse zwischen Ärzten und Krankenkassen schafft (vgl. Landgraf et al. 2004, S. 7). Der SVRKAiG (2003, S. 542 ff.) betont ebenfalls, dass die Verknüpfung von RSA und Disease Management Programmen einige Risiken birgt und greift auch die Manipulationsgefahren, die sich aus dem gleich gerichteten Interesse der Kassen und Ärzte an der möglichst hohen Einschreiberquote ergeben. Überdies erstrecken sich Disease Management Programme bisher nur auf einen Teil, nämlich vier vorgesehene chronische Erkrankungen. Daraus ergibt sich zum einen bis zur Ausdehnung der Programme auf alle relevanten Indikationen eine Vernachlässigung von Patienten mit anderen chronischen Erkrankungen (vgl. SVRKAiG 2003, S. 543). Zum anderen werden sich wiederum nur ein Teil der indizierten Patienten in die vorgesehenen Programme einschreiben. Somit wird der größte Teil der Kassenausgaben von den Disease Management Programmen und seinen Umverteilungswirkungen unberührt bleiben. Ferner findet die Umverteilung der Finanzen im RSA durch Patienten, die in Disease Management Programme eingeschrieben sind, nur zwischen den Versicherten einer Altersgruppe statt. So steht für eine Anzahl von Personen einer Altersgruppe, beispielsweise Frauen im Alter von 60 Jahren, ein entsprechender Betrag im RSA zur Verfügung. Von diesem Betrag erhält dann die jeweilige Krankenkasse einen höheren Beitragsbedarf für die Anzahl der Versicherten, die in eines der vorgesehenen Disease Management Programme eingeschrieben sind. Daraus ergibt sich dann, dass der Beitragsbedarf für die verbleibenden Versicherten dieser Altersstufe sinkt. Es ist davon auszugehen, dass vor allem ältere Menschen an chronischen Erkrankungen leiden. Da die Kassen mit einem hohen Beitragssatz viele ältere Versicherte aufweisen und Kassen mit eher niedrigen Beiträgen meist junge Personen, findet die Umverteilung über die Disease Management Programme in den älteren Altersgruppen und damit zwischen den Kassen wie der AOK oder der Barmer statt und tangiert die Krankenkassen mit niedrigen Beitragssätzen in einem vergleichsweise geringen Umfang. Zudem lässt sich vermuten, dass durch die Einführung von Disease Management Programmen der Anreiz zur Risikoselektion nicht gänzlich zu vermeiden ist, da wegen der geringen Bedeutung der 55 Programme für die gesamten Leistungsausgaben einer Kasse diese auch künftig von einer günstigen Risikogruppe profitiert (vgl. Rosenbrock/Gerlinger 2004, S. 240 f.). Trotz der Argumente, die gegen die Verknüpfung von RSA und Disease Management Programmen sprechen, werden hierdurch ökonomische Anreize gesetzt, Versorgungsformen einzuführen, die die Leistungsfähigkeit haben, die Versorgung chronisch Kranker zu verbessern. Ohne diesen Anreiz wäre eine solche Entwicklung nicht voranzutreiben. Diese Schlussfolgerung lassen die Erfahrungen zu, die mit der praktischen Umsetzung der Integrierten Versorgung gesammelt wurden. Zweifelsohne muss sichergestellt sein, dass ein verstärktes Engagement von Krankenkassen für chronisch Kranke nicht dazu führt, dass diese Wettbewerbsnachteile erfahren wegen der überdurchschnittlichen zu erwartenden Leistungsausgaben bei so genannten schlechten Risiken. Daher ist es zu begrüßen, den RSA zu einem direkt morbiditätsorientierten RSA weiterzuentwickeln. Dennoch bleibt zu prüfen, inwiefern der Finanzausgleich an das Verhalten von Versicherten bzw. Ärzten zu koppeln ist oder ob er vom überprüfbaren manipulationssicheren Morbiditätsstatus eines Versicherten abhängen sollte. Disease Management gilt als ein Instrument zur Steuerung der Behandlung und Betreuung von Patienten mit definierten Gesundheitsstörungen über ganze Krankheitsverläufe und institutionelle Grenzen hinweg (vgl. Greulich/Berchthold/Löffel 2002, S. 1). Der zentrale Ansatz von Disease Management Programmen liegt in der sektorenübergreifenden Steuerung der Versorgung (vgl. Schönbach 2003, S. 218 f.). Da sich für Disease Management Programme der Behandlungsbedarf aus den Patientenproblemen ergibt und nicht die sektorale Kompetenzverteilung der Leistungsanbieter Bezugspunkt für die Versorgung ist, stellen sich Disease Management Programme als sektorenübergreifendes Konzept dar (vgl. Rosenbrock/Gerlinger 2004, S. 239). Disease Management als integrativer Ansatz fördert die Koordination der Versorgung über Sektoren und Krankheitsstadien hinweg (vgl. Lauterbach/Wille 2001, S. 13). Doch wie gestaltet sich die Umsetzung des vom Integrationscharakter geprägten Konzeptes des Disease Managements tatsächlich? Dieser Frage geht der folgende Abschnitt nach und versucht hierauf eine Antwort zu geben. 56 3.7 Chancen für Integration durch Disease Management? Nach Angaben des SVRKAiG (2003, S. 539 ff.) werden die Regelungen des dem Disease Management zugrunde liegenden Konzeptes der sektorenübergreifenden Versorgung nur eingeschränkt umgesetzt. Bisher werden weder Prävention und Rehabilitation, noch Pflege oder stationäre Versorgung in Disease Management Programme einbezogen oder die Schnittstellen zu diesen Bereichen nur vage oder gar nicht definiert. Daraus ergibt sich eine Vernachlässigung der außerhalb der akutmedizinischen Versorgung liegenden Ressourcen und der Integration der Sektoren. Eine Ursache für die mangelnde Beteiligung von Prävention, Rehabilitation und Pflege liegt in deren teilweiser Zugehörigkeit zu anderen Rechtsbereichen (SGB V, SGB IX, SGB XI) oder in der unterschiedlichen Kostenträgerschaft entsprechender Maßnahmen. Diese Problematik wurde bereits im Abschnitt 2.1 unter der Überschrift ‚Mängel der Gesundheitsversorgung als Ausgangspunkt für Vernetzungsbemühungen’ thematisiert und dürfte auch den Akteuren im Gesundheitswesen hinlänglich bekannt sein. Hier bedarf es einer Klärung von Seiten des Gesetzgebers, inwieweit innerhalb von Disease Management Programmen der GKV Leistungsansprüche formuliert werden, die in der Zuständigkeit anderer Kostenträger liegen. Im Hinblick auf die noch zu erstellenden Anforderungsprofile für Asthma bronchiale/COPD (chronic obstruktive pulmonary disease) und KHK bieten sich beispielsweise Ansatzpunkte, rehabilitative Maßnahmen, die von Rehabilitationseinrichtungen erbracht werden können, in Disease Management Programme einzubeziehen. Bereits in seinem Gutachten 2000/2001 hat der SVRKAiG (2000/2001 Bd. III, S. 108 ff.) darauf hingewiesen, dass die Versorgung in der Prävention, Kuration und Rehabilitation von Asthmapatienten verbesserungsdürftig ist. Ungenutzte präventive Potenziale, Unterdiagnostik chronisch obstruktiver Lungenerkrankungen und eine nicht ausreichende Verzahnung stationärer Rehabilitationsmaßnahmen mit der Akutversorgung kennzeichnen die Versorgung der an Asthma bronchiale oder COPD erkrankten Personen in Deutschland. Daher fordert der SVRKAiG (2000/2001 Bd. III, S. 113) die Integration rehabilitativer Behandlungselemente in Disease Management Programme und die Möglichkeit der Direkteinweisung in hoch qualifizierte Rehabilitationskliniken. Auch die Versorgungssituation der KHKPatienten zeigt eine Vernachlässigung der Prävention und Rehabilitation 57 gegenüber der interventionellen Kuration (vgl. SVRKAiG 2000/2001 Bd. III, S. 94). Den bestehenden Defiziten sollte durch auf sektorenübergreifende Versorgung ausgerichtete Disease Management Programme entgegengewirkt werden. Verhaltensmodifizierende Maßnahmen beeinflussen die KHK und damit die Lebensqualität der Betroffenen, wobei die Ressourcen der Rehabilitationseinrichtungen zu nutzen sind. Die Einführung der Disease Management Programme soll eine Verbesserung der Versorgung chronisch Kranker bewirken, indem die sektoren-, institutions- und professionsübergreifende Behandlung einer Erkrankung ermöglicht wird (vgl. Arbeitskreis PatientInnenrechte und -information 2003). Das wiederum bedeutet: eine enge Verzahnung ambulanter und stationärer ärztlicher Behandlung sowie der Arznei-, Heil- und Hilfsmittelversorgung die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Gesundheitsberufe Diese drei Punkte wurden bereits im Abschnitt 2.1 als Aspekte der unbefriedigenden Versorgungssituation in Deutschland identifiziert, die in den organisatorischen, finanziellen und informellen Grenzen zwischen den Sektoren, Institutionen und Professionen begründet ist. Anhand dieser verbesserungsdürftigen Aspekte werden die Anforderungsprofile an strukturierte Behandlungsprogramme für Diabetes mellitus Typ 2 und Brustkrebs gemäß den Anlagen 1 und 3 der Vierten Verordnung zur Änderung der RSAV vom 27.06.2002 in Abbildung 6 auf bestehende Potenziale in Richtung Integration analysiert. Die Darstellung basiert legiglich auf den für die Programme formulierten Anforderungen und erhebt nicht den Anspruch, die Umsetzung bereits implementierter Programme in der Praxis zu beurteilen. 58 Sektorenübergreifend: Verzahnung ambulanter und stationärer ärztlicher Behandlung sowie der Arznei-, Heil- und Hilfsmittelversorgung Anforderungsprofil Diabetes mellitus Typ 2 Anforderungsprofil Brustkrebs Parameter für: Überweisung zum qualifizierten Facharzt, Überweisung in diabetologische Schwerpunktpraxis bzw. diabetologisch spezialisierte Einrichtung, Überweisung in eine auf die Behandlung des diabetischen Fußes spezialisierte Einrichtung, Einweisung in ein Krankenhaus Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln als integraler Bestandteil, ambulante bzw. stationäre Palliativtherapie und Schmerztherapie Institutionsübergreifend: Indikation für die Durchführung rehabilitationsspezifische und Zusammenarbeit der untereiner Rehabilitationsmaßnahme sozialmedizinische Maßnahmen schiedlichen Einrichtungen des sind zu prüfen als integraler Bestandteil Gesundheitswesens Professionsübergreifend: Zusammenarbeit der unterschiedlichen Gesundheitsberufe Indikationen für die Durchführung psychologischer, psychopsychosoziale Betreuung als intherapeutischer, verhaltensmetegraler Bestandteil dizinischer Maßnahmen sind zu prüfen Abbildung 6: Integrationspotenziale der Anforderungsprofile für Disease Management Programme Diabetes mellitus Typ 2 und Brustkrebs Quelle: Eigene Darstellung Abbildung 6 zeigt, dass das Anforderungsprofil für das Disease Management Programm Diabetes mellitus Typ 2 die Vernetzung zwischen ambulantem und stationärem Sektor regelt. Die Überweisungskriterien im ambulanten Bereich wie auch für die Einbindung der stationären Versorgung sind im Anforderungsprofil direkt beschrieben. An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass hier nicht die Inhalte der Anforderungsprofile auf medizinisch-fachliche Korrektheit bewertet werden, ob also beispielsweise die Indikationen für die Einschaltung einer diabetologischen Schwerpunktpraxis weiter gefasst werden sollten oder ob die Verbindung zwischen einer Stoffwechselentgleisung und einer obligatorischen Einweisung ins Krankenhaus nachvollziehbar ist. Dies ist an anderer Stelle zu diskutieren. Schwerpunkt dieser Ausführungen ist die Betrachtung von Disease Management Programmen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeiten, die Versorgung chronisch Kranker in ein integratives System einzubetten. Während die Schnittstellen zwischen ärztlich ambulantem und stationärem Sektor durch Überweisungskriterien geregelt sind, bleibt die Heilund Hilfsmittelversorgung unberücksichtigt, die gerade in der Prävention und bei fortschreitenden Komplikationen des Diabetes mellitus von entscheidender Bedeutung ist. Der institutionsübergreifende Gedanke 59 beschränkt sich auf die Rehabilitationseinrichtungen, deren Einbeziehung aber nur vage geregelt ist. Weitere Institutionen des Gesundheitswesens wie stationäre Pflegeeinrichtungen, denen eine Unterversorgung (vgl. Lauterbach o. J., S. 203 f.) aufgrund einer nicht leitliniengerechten Versorgungsform für Diabetiker bescheinigt wird, bleiben unberücksichtigt. Im Bereich der professionsübergreifenden Arbeit beschränkt sich das Anforderungsprofil in einer zudem sehr dehnbaren Auslegung auf psychotherapeutische Maßnahmen. In der Betrachtung dieser Berufsgruppen ist festzustellen, dass diese eine akademische Ausbildung genossen. Andere Berufsgruppen wie beispielsweise die Pflegeberufe, die den Weg einer akademischen Qualifizierung bisher nicht gehen oder damit in den Anfängen stecken, bleiben in der Diskussion professionsübergreifender Arbeit unberücksichtigt. Auf den unterschiedlichen Stellenwert der einzelnen Berufsgruppen, insbesondere der Pflege und Medizin zueinander, wird im Abschnitt 4.3.1 noch explizit eingegangen. Die Einbeziehung von beispielsweise professionell Pflegenden in stationären oder ambulanten Einrichtungen ist laut Anforderungsprofil nicht zwingend erforderlich. In Anbetracht der etwa drei Millionen Typ-2-Diabetiker in Deutschland, von denen mehr als die Hälfte über 65 Jahre alt ist, die zu 50 Prozent der sozialen Unterschicht angehören und deutlich erhöhte Prävalenzraten für einen Zustand nach Apoplex, Myocardinfarkt oder Amputation (vgl. IGES 2003) aufweisen, ist neben einer ärztlichen Behandlung ebenso von einer ambulanten oder stationären pflegerischen Betreuung auszugehen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass sich die Optimierung der Versorgungssituation nicht nur allein durch die Verbesserung der ärztlichen Behandlung einstellt, sondern weitere Professionen zum Einsatz kommen müssen, die Patienten unterstützen, durch z. B. verhaltensorientierte Veränderungen ihres Lebensstils die Versorgungssituation zu verbessern. Das Anforderungsprofil für das Disease Management Programm Brustkrebs enthält keine aussagekräftigen Angaben zur integrierten Versorgung zwischen Praxis und Klinik. Das Behandlungskonzept muss eine interdisziplinäre, professions- und sektorenübergreifende Betreuung gewährleisten. Die Überweisungserfordernisse stehen in Abhängigkeit von dem Krankheitsstadium der Betroffenen, der Qualifikation des behandelnden Arztes sowie den regionalen Versorgungsstrukturen. Jedoch ist die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln integraler Bestandteil der Betreu- 60 ung wie auch rehabilitationsspezifische Maßnahmen und die psychosoziale Betreuung. Beide Anforderungsprofile lassen die präventiven Maßnahmen bzw. die Früherkennung vermissen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass Disease Management Programme die Kooperation der medizinischen Fachdisziplinen und Leistungserbringer in den Vordergrund stellen, diese fordern und fördern. Der Zusammenarbeit der verschiedenen Einrichtungen des Gesundheitswesens wird durch die Einbeziehung der Rehabilitationseinrichtungen in sehr kleinen Schritten Anschub verliehen. Der weitere Ausbau ist zu begrüßen. Bedauerlicherweise scheinen Disease Management Programme, was die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Gesundheitsberufe betrifft, bisher nicht denen in den Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 herausgearbeiteten Merkmalen zu folgen und berücksichtigen nur die Vertreter psychologischer, psychosozialer und psychotherapeutischer Maßnahmen. Wie bereits angedeutet, wird dem Bereich der Pflege bisher in Disease Management Programmen unzureichende Beachtung beigemessen. Dies gilt sowohl für die Einbeziehung der Pflegekräfte bzw. von deren Fachwissen als auch für die Einbindung der ambulanten und stationären Pflege. In Anbetracht der für die Disease Management Programme zu erwartenden Versichertenpopulation ist dies ein bedauernswerter Zustand. Im nächsten Kapitel werden der Einfluss von Disease Management Programmen, insbesondere des Disease Management Programms Brustkrebs, für die Institution Krankenhaus analysiert und denkbare Entwicklungen skizziert. Der Unterschied in der Bedeutung der Disease Management Programme auf der einen Seite für die GKV, die im Vorfeld erarbeitet wurde, und auf der anderen Seite für die Institution Krankenhaus soll dargelegt werden. 61 4 KRANKENHÄUSER UNTER DEM EINFLUSS VON DISEASE MANAGEMENT PROGRAMMEN IN DER KÜNFTIGEN GESUNDHEITSVERSORGUNG Mit In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) zum 01.01.2004 ergeben sich für den Krankenhausbereich in Bezug auf die Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen wichtige Neuregelungen, die hier in Anlehnung an das GMG nur überblicksartig aufgezählt und nicht weiter gedeutet werden. Vor dem Hintergrund der Überwindung sektoraler Grenzen bei der medizinischen Versorgung wird der Wettbewerb zwischen verschiedenen Versorgungsformen mit dem Ziel einer patientenindividuellen Versorgung autorisiert. Zudem soll dieser Wettbewerb Innovationen ermöglichen und Effizienzreserven freisetzen. Konkret werden hierzu medizinische Versorgungszentren zugelassen, die den Patienten eine Versorgung durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit ärztlicher und nichtärztlicher Heilberufe anbietet. Freiberufler und Angestellte können in diesen Zentren tätig sein (vgl. § 95 SGB V). Um die Integrierte Versorgung weiterzuentwickeln, werden über die Anschubfinanzierung zwischen 2004 und 2006 von bis zu 1 Prozent der jeweiligen Gesamtvergütung und der Krankenhausvergütung in den KV-Bezirken zusätzliche Anreize zur Vereinbarung integrierter Versorgungsverträge gegeben (vgl. § 140 a – e SGB V). Mit der Einbeziehung der Krankenhäuser in die ambulante Versorgung in unterversorgten Gebieten wird für diese eine Teilöffnung zur ambulanten Versorgung sowie eine weitere Möglichkeit der Sicherstellung ärztlicher Versorgung geschaffen (vgl. § 116 a SGB V). Die Öffnung der Krankenhäuser für den ambulanten Bereich erstreckt sich zudem darauf, dass für hoch spezialisierte Leistungen, seltene Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen die ambulante Leistungserbringung durch das Krankenhaus möglich ist. Außerdem erhalten die Krankenkassen zur Durchführung ihrer strukturierten Behandlungsprogramme, der Disease Management Programme, die Möglichkeit, Krankenhäuser in die ambulante Leistungserbringung einzubeziehen (vgl. § 116 b SBG V). In den folgenden Abschnitten wird dieser Aspekt, also die Rolle der Krankenhäuser bei der Durchführung von Disease Management Programmen, erörtert. Im Besonderen soll der Integrationscharakter der 62 beiden größten Berufsgruppen der Medizin und Pflege innerhalb der Institution Krankenhaus vor dem Hintergrund defizitärer Kooperationsstrukturen, die einer Umsetzung von Disease Management Programmen entgegen stehen, analysiert werden. 4.1 Ausgangssituation der Krankenhäuser als Partner für die Umsetzung von Disease Management Programmen Die bisher stark reglementierte und fast ausschließlich auf den niedergelassenen Arzt beschränkte ambulante Behandlung wurde durch den Gesetzgeber verändert. Krankenhäuser können sich aktiv beim Aufbau von Disease Management Programmen beteiligen. Die Bedeutung der Programme wird von diesen allgemein als hoch eingeschätzt. Ergebnisse der Umfrage des Krankenhaus-Barometers 2003 belegen, dass 72 Prozent der Häuser durch die Teilnahme an Disease Management Programmen mit einer positiven Auswirkung auf die Belegung rechnen und 36 Prozent sogar mit einer positiven Auswirkung aufs Budget. Über die Hälfte der Häuser plant eine Teilnahme an diesen Programmen, wobei bis jetzt aber lediglich 1,4 Prozent im Disease Management Programm Diabetes mellitus Typ 2 und 9,7 Prozent im Disease Management Programm Brustkrebs vertraglich eingebunden sind. 45 Prozent der Krankenhäuser gehen davon aus, dass sich ihr Leistungsspektrum für die bisher bekannten Programme nicht eignet (vgl. DKG 2003). Die Analyse der eigenen Leistungsfähigkeit ist der erste Schritt, auf deren Grundlage dann die Strategien festgelegt werden. Krankenhäuser sollen sich auf die Disease Management Programme konzentrieren, für die sie entsprechend gute Voraussetzungen mitbringen. Die Idee der strukturierten Behandlungsprogramme geht von der Bündelung der Patienten in solchen Einrichtungen aus, die über eine ausreichende Fallzahl, ausreichendes Erfahrungswissen der beteiligten Abteilungen, transparente evidenzbasierte Behandlungsabläufe und über Kooperationen mit dem ambulanten Sektor verfügen. Die gegenseitige Abstimmung von Spezialisierungen der Häuser fördert die lokale Kooperation, ist jedoch von bestimmten Interessenlagen abhängig (vgl. Lauterbach 2002, S. 40). Mit der gemeinsamen Empfehlung der DKG und GKV zur Umsetzung der Vierten RSAV-Änderung für die Einführung von Disease Management Programmen Brustkrebs werden Krankenhäuser zum Herzstück der 63 Versorgung und sind primärer Ansprechpartner der Krankenkassen für den Aufbau der Programme. Der Abschluss von Verträgen zwischen Krankenkassen oder ihren Verbänden und dem Krankenhausbereich ist zwingende Voraussetzung für die Akkreditierung von Disease Management Programmen Brustkrebs. Anders gestaltet sich das beim Disease Management Programm Diabetes mellitus Typ 2, bei dem sich überwiegend Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen als Vertragspartner gegenüberstehen (vgl. Renzewitz 2003, S. 212). Im gesamten Behandlungsverlauf von Brustkrebs ergeben sich häufig Wechsel zwischen ambulanter und stationärer Versorgung sowie zwischen unterschiedlichen Fachdisziplinen. Durch eine stärkere Vernetzung dieser Versorgungsbereiche soll eine Verbesserung der Behandlung der betroffenen Frauen erzielt werden. Die Therapie findet im Allgemeinen in einer Klinik statt, die durch ihre Struktur und den fachlichen Hintergrund sowie die Breite an Behandlungsdienstleistungen auf Kompetenzvorteile verweisen kann. Daher sollten sich Teile des Versorgungsprozesses am Krankenhaus konzentrieren. Um einen koordinierten und strukturierten Behandlungsablauf zu gewährleisten und Informationslücken und Doppeluntersuchungen zu vermeiden, sollen durch Konzentration und Kooperation Kompetenznetzwerke entstehen. 4.1.1 Die Entstehung von Kompetenzzentren Am Beispiel des Rahmenvertrages zur Durchführung des strukturierten Behandlungsprogramms von Brustkrebspatientinnen zwischen der AOK und anderen Krankenkassen Hessens mit dem Koordinationskrankenhaus des Brust-Kompetenzzentrums (vgl. AOK Hessen 2003) sowie dem DMPBrustkrebsvertrag zwischen den Berliner Krankenkassen und der CharitéUniversitätsmedizin (vgl. Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Berlin 2003) wird die Bedeutung und Funktion der Bildung von Kompetenzzentren dargelegt. Im Hinblick auf die Optimierung der Versorgung von Patientinnen mit Brustkrebs wird die indikationsgesteuerte und systematische Koordination der Behandlung, insbesondere die interdisziplinäre Kommunikation und Kooperation aller Leistungserbringer in Form von Kompetenzzentren, angestrebt. Ein Brust-Kompetenzzentrum beispielsweise ist eine Vernetzung interdisziplinärer Versorgungsstrukturen und besteht aus einem Koordinations-Krankenhaus, ggf. mehreren Kooperationskrankenhäusern und kooperierenden Vertragsärzten für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, den so genannten DMP- 64 Vertragsärzten im Krankenhausversorgungsgebiet. Die Teilnahme von Krankenhäusern an Disease Management Programmen ist freiwillig, ebenso für die Vertragsärzte. Das ‚Disease Management Programm Brustkrebs Berlin’, an dem neben der Charité auch niedergelassene Ärzte teilnehmen, verzahnt die Behandlung über verschiedene Sektoren in einem interdisziplinären Brustzentrum, in dem die psychosoziale Betreuung fester Bestandteil ist. Die Charité und alle teilnehmenden Ärzte verpflichten sich zu hohen Qualitätsstandards während des Behandlungsprogramms. Grundlage sind die durch die Europäische Gesellschaft für Brustkrebs entwickelten Qualitätskriterien. Danach müssen unter anderem jährlich mindestens 150 neu an Brustkrebs erkrankte Frauen an einem Standort operiert werden und der zuständige Facharzt mindestens 50 Erstoperationen im Jahr nachweisen. Der Rahmenvertrag Hessens definiert geregelte Vertragsvoraussetzungen und Aufgaben für die stationären und ambulanten Vertragspartner des Brust-Kompetenzzentrums. Die DMPVertragsärzte sind teilnahmeberechtigt, wenn sie die im Rahmenvertrag festgelegten Strukturvoraussetzungen erfüllen, dem sie auch ihre Aufgaben entnehmen können. Die stationären Einrichtungen haben ebenfalls festgelegte Anforderungen an die Strukturqualität, die sich auf Regelungen zur fachlichen Qualifikation des Personals und der räumlichen, technischen sowie apparativen Ausstattung beziehen, zu erfüllen. Zu den Aufgaben der stationären Einrichtungen eines Kompetenzzentrums zählen beispielsweise die Beachtung geregelter Versorgungsinhalte, der Qualitätsziele, die Zusammenarbeit mit den DMP-Vertragsärzten und die Information, Einschreibung und Dokumentation von Versicherten. Die Benennung eines Krankenhausfacharztes und dessen Vertreters dient der Delegation der DMP-Aufgaben innerhalb der Einrichtung. Er ist Ansprechpartner für die in dieser Einrichtung betreuten DMP-Patienten und für die Krankenkassen. Insbesondere obliegt ihm die Koordination der stationären Behandlung der Versicherten und die Sicherstellung der vollständigen Dokumentation und fristgerechten Weiterleitung der Daten. Dem Koordinations-Krankenhaus kommt eine besondere Stellung im Kompetenzzentrum zu, die im folgenden Abschnitt in Anlehnung an den Rahmenvertrag der AOK und anderer Krankenkassen Hessens mit dem 65 Koordinationskrankenhaus des Brust-Kompetenzzentrums (vgl. AOK 2003) gesondert erörtert wird. Über die Teilnehmer des Kompetenzzentrums legen die teilnehmenden Krankenkassen ein so genanntes Leistungserbringerverzeichnis an und stellen dieses allen Leistungserbringern regelmäßig aktualisiert zur Verfügung. Zudem steht das Verzeichnis den teilnehmenden Versicherten zur Verfügung, dem BVA bei Antrag auf Zulassung und in der Folge quartalsweise. Die Vergütung der allgemeinen Leistungen sowie die Vergütung von Koordinations-, Dokumentationsund Kooperationsleistungen im Rahmen von Disease Management Programmen leiten sich aus den Rahmenverträgen ab. 4.1.2 Die Rolle des Koordinations-Krankenhauses Das Koordinations-Krankenhaus übernimmt innerhalb des Kompetenzzentrums eine Koordinationsfunktion für alle weiteren Krankenhäuser, die Kooperations-Krankenhäusern und die DMP-Vertragsärzte. Es ist alleiniger Vertragspartner des Rahmenvertrages. Die Teilnahme des Koordinations-Krankenhauses am Programm beginnt nach Prüfung und Genehmigung der Strukturqualitätskriterien durch die teilnehmenden Krankenkassen mit dem Unterschreiben des Rahmenvertrages. Die Teilnahme des Kooperations-Krankenhauses und der DMP-Vertragsärzte am Programm beginnt ebenfalls nach Prüfung und Genehmigung der Strukturqualitätskriterien durch die teilnehmenden Krankenkassen mit der Unterschrift unter der Teilnahmevereinbarung. Im Beispiel des Rahmenvertrages der AOK und anderer Krankenkassen Hessens mit dem Koordinationskrankenhaus des Brust-Kompetenzzentrums verpflichtet sich dieses, über die bereits benannten Aufgaben hinaus weitere zu übernehmen. Hierzu zählen die Koordination übergreifender Fragestellungen zum Disease Management Programm innerhalb des Kompetenzzentrums. Des Weiteren ist es Ansprechpartner für die Krankenkassen. Als Initiator regelmäßiger Tumorkonferenzen und Qualitätszirkel mit allen Teilnehmern des Brust-Kompetenzzentrums ist das Koordinations-Krankenhaus verantwortlich für die Erstellung des Protokolls und die Erbringung des Nachweises über die Teilnehmenden an die Krankenkassen. 66 4.2 Überlegungen zum Aufbau integrierter Versorgungsstrukturen durch Disease Management Programme aus Sicht des Krankenhauses In Anbetracht der gemeinsamen Umsetzungsempfehlung der DKG und GKV für die Umsetzung der Disease Management Programme Brustkrebs sprechen die DKG und die Spitzenverbände der GKV Krankenhäusern eine gute Ausgangsposition für die Umsetzung der Programme und somit integrierter Versorgungsformen zu. Es ist davon auszugehen, dass Kliniken über erforderliche infrastrukturelle und organisatorische Voraussetzungen verfügen, um integrative Versorgungskonzepte zu koordinieren und umzusetzen. Schon Badura (1996 a) sieht das Akutkrankenhaus als „[...] die von Wissensexplosion und Technisierung am stärksten betroffene Versorgungseinrichtung. Wegen der Ausdifferenzierung der Versorgungslandschaft fällt ihm in der Zukunft vielleicht eine besondere Koordinationsfunktion für die gesamte Versorgungskette chronisch Kranker zu“ (Badura 1996 a, S. 287). Kliniken sind heute im Zeitalter der Diagnosis Related Groups (DRG) mehr denn je darauf angewiesen, ihren Leistungsumfang zu konzentrieren und sich ökonomisch sinnvoll zu spezialisieren, um Wettbewerbsvorteile zu erreichen. Der Kostendruck wird nicht nur auf die internen Strukturen eines Hauses Einfluss nehmen, sondern erzwingt den Blick über die bisher als unverrückbar geltenden Grenzen. Die Wirksamkeitssteigerung des eigenen Tuns verlangt die Kooperation mit anderen Leistungsanbietern (vgl. Knorr 2003, S. 679). Nach Badura (1996 a, S. 287 ff.) ergeben sich für Krankenhäuser dabei drei Optionen, die im Folgenden kurz skizziert und der Ausgestaltung von Disease Management Programmen gegenübergestellt werden sollen. Die erste Option beschreibt die zunehmende Spezialisierung der Häuser auf bestimmte Leistungen oder Krankheitsbilder. Badura (1996 a, S. 287) geht hierbei der Frage nach, wie eine spezialisierte Versorgung chronisch Kranker in Zusammenarbeit zwischen Akutversorgung und niedergelassenen Ärzten praktisch zu realisieren ist. Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Verdichtung und Umgestaltung der Kooperation von ambulanter und stationärer Versorgung, was eine Reihe arbeitsorganisatorischer und personeller Veränderungen im Krankenhaus voraussetzt. Hierzu zählt die Herstellung persönlicher Arbeitsbezie- 67 hungen zwischen Krankenhausärzten und den externen Kooperationspartnern. Im Beispiel des Disease Management Programms Brustkrebs, welches die Spezialisierung der Einrichtung auf das Krankheitsbild Brutkrebs impliziert, werden diese Arbeitsbeziehungen durch regelmäßige Tumorkonferenzen und Qualitätszirkel aller Teilnehmer des Brust-Kompetenzzentrums hergestellt. Des Weiteren ist in der Klinik die Vorhaltung einer Stelle vonnöten, deren Inhaber sich ganz auf die Versorgung dieser Patientengruppe mit dem speziellen Krankheitsbild konzentriert. Ausgehend von Abschnitt 5.1.1 erfolgt innerhalb von Disease Management Programmen die Benennung eines Krankenhausfacharztes und dessen Vertreters, der die DMP-Aufgaben innerhalb der Einrichtung koordiniert. Das zusätzliche, bisher im Arbeitsalltag der Kliniken und Praxen meist unberücksichtigte Patientenmanagement mit dem Ziel schnittstellenüberwindender Versorgung chronisch Kranker erfordert besondere Anstrengungen. Das Akutkrankenhaus als Zentrum für die Versorgung chronisch Kranker stellt neben einem systematischen Entlassungsmanagement die Kontinuität in der Versorgung, Beratung und Steuerung der Patienten, auch über die stationäre Versorgung hinaus, in den Mittelpunkt der Bemühungen. In Disease Management Programmen stehen hierfür Instrumente wie Reminder, Krankheitskoordinatoren, Schulungen oder Leitlinien zur Verfügung. Disease Management Programme als Konzepte der Spezialisierung auf ein Krankheitsbild sind ein Beispiel, wie durch die innerhalb der Programme entstehende Arbeitskultur die Schnittstelle zwischen Akutkrankenhaus und ambulanter medizinischer Versorgung überwunden werden kann. Mit der zweiten Option für Krankenhäuser greift Badura (1996 a, S. 290) die Strategie der Diversifizierung, der Aufgabenausweitung, auf. Diese kann sich auf den Beitrag des Krankenhauses zur Gesundheitsförderung und Prävention und zur Rehabilitation und Langzeitversorgung beziehen. Das qualifizierte Personal einer Klinik mit seinen Kompetenzen und Fähigkeiten ist prädestiniert, solche Aufgabenstellungen zu übernehmen. Im Bereich der Gesundheitsberatung, die sich innerhalb von Disease Management Programmen auf die Schulungen beziehen und eine Versorgungskomponente der Programme darstellen, können beispielsweise Aufgaben für Krankenhäuser liegen. Badura (1996 a, S. 291) macht zudem darauf aufmerksam, dass ein verstärktes Beratungsangebot das Erscheinungsbild einer Klinik in der Öffentlichkeit verbessert und somit einen Beitrag zur 68 Beseitigung des beklagten Beratungsdefizites leistet, welches im Gutachten des SVRKAiG (2000/2001 Bd. III, S. 83) unter anderem als ein Merkmal unzureichender Versorgung chronisch Kranker herausgearbeitet wird. Die dritte Option der stationären Versorgung sieht Badura (1996 a, S. 291 f.) in der Dehospitalisierung, der Umwandlung kleiner Häuser in Ambulatorien mit eingeschränkter oder ganz wegfallender stationärer Versorgung. Die mit dieser Option beschriebene Strategie lässt keinen Rückschluss auf die Anwendung in Disease Management Programmen zu. Abschließend ist festzustellen, dass sich die Charakterzüge der beiden erstgenannten Optionen zur künftigen Gestaltung der stationären Versorgung vor dem Hintergrund einer koordinierten Versorgungskette für chronisch Kranke strategisch in Disease Management Programmen wiederfinden. Bedingt durch den Wandel im Patientenaufkommen, der sich in erster Linie durch hochbetagte Menschen mit chronischen Erkrankungen, Mehrfacherkrankungen oder progredient verlaufenden Krankheitsprozessen und durch die abnehmenden Anteile akut erkrankter Patienten aufgrund neuer Behandlungsmethoden vollzieht, ist zu prüfen, inwieweit die Orientierung am Paradigma der Akutmedizin eine brauchbare Handlungsoption darstellt (vgl. Stratmeyer 2002, S. 13). Disease Management Programme geben Kliniken eine Neuorientierung in der Versorgung chronisch Kranker. Dennoch lassen sich die strukturellen und organisatorischen Probleme in der Versorgung dieser Patienten nicht allein durch innovative Versorgungsmodelle wie Disease Management Programme beheben. Der Erfolg von Disease Management hängt nicht nur von der Planungs- und Umsetzungsqualität sowie technischen und professionellen Rahmenbedingungen ab, sondern bedarf grundsätzlich neuer Regeln, die die gegenwärtigen Leitgedanken der Gesundheitsversorgung verändern und ablösen müssen (vgl. SVRKAiG 2000/2001 Bd. III, S. 80 f.). Anknüpfend an diesen Abschnitt, der die Notwendigkeit einer Neuorientierung in der Versorgung chronisch Kranker durch neue Leitbilder und Werte fordert, wird nachfolgend in Anlehnung an den SVRKAiG (2000/2001 Bd. III) analysiert, welche neuen Regelungen in Disease Ma- 69 nagement Programmen Anwendung finden, die den gegenwärtigen Ansatz der Gesundheitsversorgung ablösen sollen. 4.3 Die Neuorientierung im Wertesystem eines Krankenhauses Abbildung 7 stellt das bisherigen Verständnis von Gesundheitsversorgung dem Verständnis von Gesundheitsversorgung gegenüber, das aus der Umsetzung der Disease Management Programme resultiert. gegenwärtiger Ansatz der Gesundheitsversorgung neue Regeln der Gesundheitsversorgung durch DMP auf Besuchen basierende Versorgung kontinuierliche Versorgung einer chronischen Erkrankung über alle Krankheitsstadien und Aspekte der Versorgung hinweg, umgesetzt durch Follow-up und individuelles Patientenmanagement durch professionelle Autonomie verursachte Variabilität der Versorgung auf Werte und Bedürfnisse des Patienten zugeschnittene Behandlung durch individuelle Behandlungspläne, Risikostratifizierung, Berücksichtigung psychosozialer Faktoren und des klinischen Zustandes Profession kontrolliert die Versorgung Patient ist aktiver Partner und Manager seiner Krankheit durch effektive Unterstützung des Selbstmanagements, Reminder und evidenzbasierte Leitlinien für Patienten Informationen stehen allen an Disease Management ProInformation ist eine passive, unbewegligrammen beteiligten Leistungserbringern und Patienten che Akte zur Verfügung durch Informationssysteme, Datensätze Geheimhaltung ist notwendig Transparenz wird hergestellt durch Qualitätsberichte, Benchmarkingdatensätze auf Training und Erfahrung basierende Entscheidungen Entscheidungen sind evidenzbasiert durch EbM und evidenzbasierte Leitlinien, Entscheidungsunterstützung Vermeidung von Schäden liegt im Bereich individueller Verantwortlichkeit Sicherheit durch den Abbau von Fehlversorgung durch die Anwendung von Disease Management Programmen Kostenreduktion wird angestrebt Überversorgung wird kontinuierlich abgebaut durch die Anwendung von Disease Management Programmen Rollenbilder der Gesundheitsberufe sind wichtiger als das System professionsübergreifende Kooperation hat Priorität Abbildung 7: Neue Regeln der Gesundheitsversorgung durch Disease Management Programme Quelle: Eigene Darstellung nach SVRKAiG (2000/2001 Bd. III, S. 22) Nicht nur der SVRKAiG erfordert eine Abkehr vom Paradigma der Akutmedizin, die durch die technikintensive Medizin und die Beherrschung somatischer Prozesse geprägt ist und die Lebenssituation und Problemsicht der Betroffenen meist unberücksichtigt lässt. Auch Badura (1996 70 a, S. 261) kommt in Anlehnung an Strauss und Corbin zu dem Schluss, dass die Prävalenz chronischer Erkrankungen einen grundlegenden Wandel der Gesundheitsdienste erzwingt. Die Gründe, warum ein Wandel geboten ist, zeigten bereits die Abschnitte 2.1 und 4.1.1; Grundideen und die Erarbeitung neuer Versorgungssysteme wurden mit Disease Management Programmen geboren. Die Umsetzung dieses Ansatzes bedarf jedoch eines Paradigmenwechsels in allen Gesundheitsfachberufen vom gegenwärtigen Ansatz der Versorgung hin zu einer Gestaltung des Gesundheitswesens, das der Situation und Problemsicht der zu Versorgenden sowie der Komplexität und dem prozessualen Charakter ihrer Erkrankung gerecht wird. Doch „Vor dem Wandel in der Praxis steht der Wandel im Denken, das diese Praxis prägt“ (Badura 1996 a, S. 261). Der Umgang mit chronischen Erkrankungen ist bisher geprägt von der Orientierung am Leitbild der Akutmedizin und in eine vom Denken und Handeln biotechnischer Experten bestimmte Versorgung eingebettet. Die Übersicht der Abbildung 7 stellt deutlich dar, dass die Annahme und Umsetzung der Ziele und Inhalte von Disease Management Programmen eine Veränderung der Grundeinstellung der beteiligten Akteure voraussetzt. Am Beispiel von EbM und evidenzbasierten Leitlinien oder des Datenmanagements ist bereits dargestellt worden, wie schwierig es sich gestaltet, historisch gewachsene Herangehensweisen mit neuen Zielen, Interessen und Bedürfnisse in Einklang zu bringen. Sind Krankenhäuser bereit, sich dem Wandel im Patientenaufkommen zu stellen und sich diesem anzupassen, kann durch die Annahme der Disease Management Instrumente der Prozess der Neuorientierung in der Versorgung chronisch Kranker durch neue Leitbilder und Werte unterstützt werden. Überdies werden sie der Grundidee des Disease Managements, der integrativen Versorgung gerecht. Fordern Disease Management Programme von Kliniken, die koordinierende Funktion für die Versorgung über das eigene Haus hinaus zu übernehmen, sollte dies bereits über eigene funktionierende integrative Strukturen verfügen. Bisher bedeutet jedoch die professionsübergreifende Arbeit für den Klinikalltag immer noch eine große Herausforderung. Zahlreiche Autoren befassen sich in der wissenschaftlichen Literatur (vgl. Stratmeyer 2002; Badura/Feuerstein 1996; Hüper 2004) mit den Problemen der Zusammenarbeit der beiden größten Berufsgruppen im Gesundheitswesen: der Medizin und der Pflege. Der folgende Abschnitt gibt einen Einblick in die Diskussion. 71 4.3.1 Kooperation im Krankenhaus als der koordinierenden Institution innerhalb von Disease Management Programmen Ärzte und Pflegekräfte gehören nicht nur unterschiedlichen Berufsgruppen an, sondern sind auch durch unterschiedliche Kulturen geprägt. Ihr Denken, Fühlen und Handeln folgt unterschiedlichen Deutungen, Werten und Bindungen, was zu Kommunikationsproblemen und Meinungsverschiedenheiten führt (vgl. Badura 1996 b, S. 48). Die Schnittstelle zwischen den Berufsgruppen der Ärzte und Pflegekräfte wird als die wohl bedeutendste organisatorische Schnittstelle im Krankenhaus angesehen. Sie gilt als das Ergebnis tradierten beruflichen Handelns (vgl. Stratmeyer 2002, S. 17). Pflegerisches Handeln im deutschen Gesundheitswesen unterliegt der Weisungspflicht des Arztes und schließt mehr oder minder alle therapeutischen Bereiche des Krankenhauses mit ein. Gemäß den Untersuchungsergebnissen empirischer Studien liegen die Ursachen für die Kooperationsdefizite der beiden Berufsgruppen in den unterschiedlichen und Qualifizierungsund Professionalisierungsgraden Sozialisationsverläufen (vgl. Hüper 2004, S. 71). Die ungleiche gesellschaftliche Stellung und Anerkennung sowie das historisch gewachsene hierarchische Verhältnis sind den unterschiedlichen Professionalisierungsgraden geschuldet. Die Entscheidungsleistung als Einzelleistung von Ärzten und der Fokus auf die Pathologie durch die Bindung an das biomedizinische Modell auf der einen Seite und die gemeinschaftliche Problemlösung der Pflegekräfte unter Einbeziehung psychosozialer Aspekte auf der anderen Seite kennzeichnen die unterschiedlichen Qualifizierungs- und Sozialisationsverläufe. Eine Analyse der unterschiedlichen Ausbildungen von Medizin- und Pflegeakteuren lässt im Hinblick auf die Kooperationsbildungen dieser Berufsgruppen deutlich erkennen, dass sie als Kooperationspartner wenig geeignet erscheinen (vgl. Stratmeyer 2002, S. 81 ff.). Die Gestaltung der ärztlichen Ausbildung fördert ein naturwissenschaftlich-technisch geprägtes Verständnis von Gesundheit und Krankheit und bereitet die Mediziner nicht angemessen auf eine patientengerechte und bedürfnisorientierte Versorgung vor. Das vom medizinischen Wissenschaftsverständnis geprägte Handlungsmodell lässt Verantwortungsteilung weder mit anderen Berufsgruppen noch mit Patienten zu. Berufsübergreifende Kooperation gar mit einer statusschlechteren Berufsgruppe ‚erniedrigt’ in diesem Selbstverständnis die Person des Mediziners und lässt sie daher 72 als Kooperationspartner für die Pflege als wenig geeignet erscheinen. Die Vorbehalte der Pflegenden gegenüber der Medizin manifestieren sich bereits sehr frühzeitig während der Ausbildung zu einem Feindbild von der Medizin. Dieses setzt sich aus einem Gemisch von Überforderung und psychischer Belastung, Unterlegenheitsgefühlen, mangelnder Anerkennung der Arbeit und nicht kommunizierbaren Ansprüchen an eine ganzheitliche Patientenversorgung zusammen und wird in eine kapitulierende, gefühlsmäßig aufgeladene Sprachlosigkeit der Pflegenden kanalisiert, was neben der Durchsetzung pflegerischer Perspektiven einen fachübergreifenden Diskurs mit der Medizin behindert. Das bringt Pflegekräfte in eine ungünstige Position als Kooperationspartner mit den Ärzten. In der stationären Versorgung zwingen die fortschreitende Spezialisierung und Technisierung akutmedizinischer Aufgabenstellungen Ärzte dazu, sich auf den „harten Kern“ (Badura 1996 b, S. 49) ihrer Arbeit, die Notfallbekämpfung und die Kontrolle pathogener Prozesse, zu konzentrieren. Die übrigen Tätigkeiten wie Gefühlsregulierung, Lebensorientierung oder Beratung, Linderung von Schmerzen, von körperlichem und seelischem Leid fallen auf die anderen Berufsgruppen, besonders auf Pflegekräfte zurück. Im Ergebnis der Technisierung der gesamten Krankenhausarbeit und permanenter Personal- und Zeitknappheit konkurrieren technikintensive und interaktionsintensive Leistungen miteinander. Dabei beanspruchen die der ärztlichen Verantwortung unterliegenden technikintensiven Leistungen zur Beherrschung somatischer Prozesse größtenteils den Vorrang vor den interaktionsintensiven Leistungen zur Linderung körperlicher und seelischer Not. Das von der Akutversorgung geprägte Selbstverständnis der Beschäftigten in weiten Teilen der Krankenhausarbeit beinhaltet ein bestimmtes Patientenbild und ein bestimmtes Verständnis ihrer Arbeit und Prioritäten. Nicht der kranke Mensch ist Gegensand der Arbeit, sondern Art und Verlauf seiner körperlichen Schädigung. Die Identifikation und Beherrschung pathogener Prozesse bis zur Entlassung oder Weiterleitung an andere Versorgungseinrichtungen sind das Ziel. Dabei genießt die technikintensive Bekämpfung von Gefährdungen der vitalen Funktionen höchste Priorität, wohingegen interaktionsintensive Maßnahmen zur Linderung, Beseitigung oder Vermeidung negativer Gedanken und Gefühle, Angst, Hilflosigkeit, Unsicherheit, Ungewissheit oder depressiver Zustände die letzte Stellung auf der Prioritä- 73 tenliste einnehmen. Die Technisierung scheint die in unterschiedlichen Krankheitsvorstellungen, Behandlungskonzepten und Statusdifferenzen begründeten Konflikte der Hauptberufsgruppen des deutschen Gesundheitswesens weiter zu verschärfen (vgl. Badura 1996 b, S. 34 ff.). Die Beziehung beider Gruppen hat sich statt zu einem Kooperationsgefüge „zu einem konkurrenzvollen Arrangement“ (Stratmeyer 2002, S. 10) entwickelt. Die sich abzeichnende Veränderung der stationären Versorgung durch das „Zeitalter chronischer Erkrankungen“ (Badura/Feuerstein 1996, S. 11) bedeutet für die Akteure im Krankenhaus eine verstärkte Konfrontation mit psychosozialen Problemen der Patienten wie Sorge, Elend, Hoffnungslosigkeit und Leid, die mit der Bewältigung einer chronischen Krankheit verbunden sind. Der damit einhergehende Bedarf an professioneller Interaktionsarbeit wird sichtbar und lässt die Orientierung am Paradigma der Akutmedizin als Handlungsoption in den Hintergrund treten. Da bisher das Thema Chronizität als komplexes und prozesshaftes Geschehen in der medizinischen Forschung und Ausbildung vernachlässigt wurde, steckt die Entwicklung von Versorgungskonzepten für chronisch Kranke noch in den „Kinderschuhen“ (Badura 1996 a, S. 296). Auszurichten sind diese Versorgungskonzepte an Leistungsangeboten, die die Verhaltensmodifikation ausbauen mit dem Ziel der Erhaltung und Rückgewinnung von Lebensqualität und Leistungsfähigkeit, was eine Integration zahlreicher Versorgungseinrichtungen und Berufsgruppen voraussetzt. Die Ziele und Inhalte von Disease Management Programmen versuchen dem zu entsprechen. Die wesentliche Schwierigkeit der Krankenhäuser als einer Institution in dieser Versorgungskette liegt im unterschiedlichen Selbstverständnis der Medizin und Pflege, was zu differierenden Handlungsweisen führt. Ein Krankenhaus wird diese Schwierigkeiten nur überwinden können, wenn beide Berufsgruppen zur selbstkritischen Handlungsüberprüfung bereit sind und sich auf einen gemeinsamen Handlungsrahmen verständigen (vgl. Stratmeyer 2002, S. 10). Wenn „Kooperation Handlungsfähigkeit bewirkt, die entsteht, indem sich die Handlungspartner an gemeinsamen Werten und Zielen orientieren und ihre Handlungspläne auf gemeinsame Ziele hin koordinieren“ (Hüper 2004, S. 81), lässt sich im Rückschluss vermuten, dass Disease Management Programme einen Handlungsrahmen definieren, in dem sich die Handlungspartner an gemeinsamen Werten orientieren, ihre Handlungspläne auf gemeinsame 74 Ziele hin koordinieren und folglich kooperative Handlungsfähigkeit fördern. Im anschließenden Abschnitt sollen die künftigen Anforderungen an ein Krankenhaus im Sinne der Patientenorientierung unter Berücksichtigung der besonderen Situation chronisch Kranker aufgezeigt werden. Dabei sollen aus den sich ergebenden Silhouetten einer patientenorientierten Einrichtung die Zukunftsanforderungen für Medizin und Pflege im Kontext kooperativer Zusammenarbeit abgeleitet werden. 4.3.2 Das Krankenhaus im Dienste der Patientenorientierung Rückgreifend auf das Konzept des Lean Managements macht Badura (1996 a, S. 255 ff.) deutlich, dass Modelle moderner Unternehmensführung in der Organisationsentwicklung auf mehr Patientenorientierung auszurichten sind. Hierbei bedeutet Patientenorientierung die „Erforschung der ‚wirklichen’ Patientenbedürfnisse“ (Badura 1996 a, S. 262), die Betrachtung der Versorgungsprobleme und der Erfordernisse zu deren Bewältigung aus Sicht der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Insbesondere die Situation chronisch Kranker setzt die Betrachtung der Krankheitsverläufe und -interventionen im lebensgeschichtlichen und sozialen Kontext voraus. Der durch Beständigkeit gekennzeichnete Schaden einer chronischen Erkrankung und die sich daraus ergebende Beständigkeit der Behandlung und Bewältigungsleistungen erfordern ebenso beständige soziale und seelische Anpassungsleistungen. Das Versorgungssystem bedarf daher kontinuierlicher und flexibler, der Situation des Einzelfalls gerecht werdender Behandlung und Nachsorge unter Beobachtung und Behandlung des körperlichen Zustandes sowie der Förderung der Anpassungsleistungen und Selbsthilfepotenziale der Betroffenen (vgl. Badura 1996 a, S. 265). Für ein patientenorientiertes Krankenhaus ergibt sich daraus, die Behandlung von Patienten mit chronischen Erkrankungen als eine Episode im Krankheitsverlauf zu betrachten und nicht als abgeschlossenes Geschehen. Chronische Erkrankungen erfordern neben der langanhaltenden Behandlung oft eine weitreichende und beständige Neuordnung des Alltagslebens und des Verhaltens, wozu der Patient befähigt werden muss. Die Partizipation von Patienten bedeutet daher mehr als die bloße Information und Zustimmung zum Behandlungsgeschehen. Sie äußert sich 75 in einer aktiven Beziehungsgestaltung zur verbesserten Krankheitsbewältigung auf der Grundlage von Arbeitsbündnissen und Aushandlungsprozessen zwischen Patienten und therapeutischem Team. Sie bedeutet die Abkehr vom paternalistischen Paradigma, das den Patienten verpflichtet, die Verantwortung in die Hände des Experten zu legen und dessen Anweisungen zu befolgen, um die Patientenrolle möglichst bald wieder zu verlassen. Dem paternalistischen Paradigma folgend, befreite die Patientenrolle von allen üblichen sozialen Rollenverpflichtungen und von der Verantwortung für den eigenen Zustand. Aspekte der Prävention oder Gesundheitsförderung blieben demnach unbeachtet. Partizipation von Patienten hingegen erweitert die Rollen der Patienten und der Professionellen. Anstelle des passiven Empfängers von professionellen Leistungen, dessen Beitrag sich auf Compliance begrenzt, erwächst die selbstverantwortliche Mitarbeit eines aktiven Partners. Das Ziel von gezielter Vermittlung und Übertragung von Wissen und Informationen zwischen den Patienten und Akteuren des Gesundheitswesens liegt in der Hilfe zur Selbsthilfe. Diese Wissensübermittlung bedarf der aktiven Rolle beider Interaktionspartner. Professionelle geben Wissen weiter, Patienten nehmen dies an und verarbeiten es weiter (vgl. Forster 2003, S. 75 ff.). Die Umsetzung der Partizipation der Patienten soll hier am Beispiel der Disease Management Programme erläutert werden. Im Disease Management kommt dem Patienten eine aktive Rolle in der Behandlung seiner Erkrankung zu. Das beginnt bei der Einschreibung der Patienten in Disease Management Programme auf freiwilliger Basis. Innerhalb von Disease Management Programmen soll der Betroffenen unter anderem im Selbstmanagement seiner Erkrankung unterstützt und gefördert werden. Hierzu tragen die Reminder für Patienten in den Programmen bei. Reminder oder Erinnerungssysteme sind alle Feedback-Mechanismen, mit denen dem Patienten, darüber hinaus auch dem Arzt, Informationen zu den Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität vermittelt werden können. Sie können postalischer, telefonischer oder computergestützter Natur sein. Reminder erinnern beispielsweise an Untersuchungs- und Kontrolltermine beim Arzt oder fördern verhaltensändernde Maßnahmen durch gewisse Empfehlungen. So können z. B. Ratschläge zur Ernährung, Gewichtsreduktion oder Raucherentwöhnung zur Verringerung der Risikofaktoren übermittelt werden. Ebenso erinnern sie an selbst gesteckte Therapieziele. Die aktive Rolle des Patienten wird im Disease 76 Management des Weiteren durch die Aufbereitung und Bereitstellung evidenzbasierter, für Laien verständlicher Leitlinien gefördert. Die Einhaltung der Patientenleitlinien kann durch den systematischen und gezielten Einsatz von Remindern unterstützt werden. So kann dem Patienten Rückmeldung über häuslich durchzuführende Blutzuckerselbstmessungen entsprechend der Leitlinie gegeben werden. Mit Hilfe der Erinnerungsunterstützung wird der Patient im Rahmen seiner Behandlung über seine medizinischen Werte und Risiken informiert (vgl. Lauterbach o. J., S. 122 ff.). Für ein Krankenhaus mit einem Grundverständnis der oben beschriebenen Partizipation von Patienten erfolgt die Messung der Erfolgsparameter hinsichtlich des Beitrages zur verbesserten Krankheitsbewältigung und lässt sich nicht auf die Anzahl erfolgreicher therapeutischer Verfahren reduzieren. Die zukünftige Entwicklung von Krankenhäusern wird sich in zwei unterschiedlichen Ausrichtungen darstellen. Für die Orientierung am Paradigma der Akutversorgung steht das schlanke Krankenhaus, das hoch spezialisierte Zentrum der HighTech-Medizin. Für die Orientierung an den Bedürfnissen chronisch Kranker steht das „Krankenhaus ohne Mauern“ (Stratmeyer 2002, S. 294), das sich durch stationäre und teilstationäre Angebote zur Gesundheitsförderung, Prävention, Akutversorgung und Rehabilitation in der primären Versorgung auszeichnet. Chronisch Kranke benötigen Leistungen, die neben dem körperlichen Zustand auch ihre seelischen und sozialen Voraussetzungen berücksichtigen. Die Wechselwirkung zwischen sozialen, seelischen und somatischen Vorgängen beschreiben Badura und Feuerstein folgendermaßen: „Mensch und Umwelt, Seele und Körper sind durch Wechselwirkungen auf das engste miteinander verbunden. [...] Soziale, seelische und physiologische Vorgänge hängen – das bleibt festzuhalten – sehr viel enger miteinander zusammen, als wir bisher angenommen haben“ (Badura/Feuerstein 1996, S. 18). Sie schreiben diesen Erkenntnissen die Revolution nicht nur in der Gesundheitsförderung und Prävention, sondern auch in der Versorgung chronisch Kranker zu und leiten daraus folgende Konsequenzen für die Veränderung klinischer Arbeit ab: eine Aufwertung interaktionsintensiver Leistungen und der sozialen Kompetenz der Beschäftigten 77 eine Aufwertung vor allem der Pflegetätigkeit und schließlich eine Aufwertung der Beiträge der Erkrankten selbst und ihrer Angehörigen zur Akutversorgung, Frührehabilitation und Langzeitbewältigung einer chronischen Krankheit Die Anerkennung interaktionsintensiver Leistungen ist verbunden mit der Aufwertung der Pflegetätigkeit, die nur durch größere Selbstständigkeit der Pflegenden und ihre Professionalisierung umzusetzen ist. Die Neuorientierung eines Krankenhauses hin zu interaktionsorientierten Handlungen bedarf zudem der Neuorientierung des ärztlichen Selbstverständnisses, da Ärzte das Leistungsgeschehen des Hauses im Wesentlichen bestimmen, weil Patienten in erster Linie wegen einer ärztlichen Behandlung in die Klinik kommen. Die Zukunft eines Hauses hängt demnach stark von der Veränderungsfähigkeit der Medizin ab. Visionär ließe sich patientenorientierte Krankenhaustätigkeit folgendermaßen formulieren: Pflege, dem Verständnis als einer der Krankenhausmedizin beigeordneten und sie ergänzenden Krankenhausarbeit folgend, bietet die wissenschaftlich fundierte kritische Instanz ärztlichen Handelns. Ärzte reflektieren ihr Handeln auf der Grundlage einer intersubjektiven Beziehung mit dem Patienten und seiner lebensweltlich-biografischen Zusammenhänge unter Einbeziehung der Ansichten der Pflege und anderer Gesundheitsberufe (vgl. Stratmeyer 2002, S. 308). Dieses Verständnis von Pflege unterstreicht die Aufwertung der Pflegetätigkeit und formt eine Vernetzung von Medizin und Pflege im Krankenhaus. Im Interesse der bedarfsgerechten Versorgung chronisch Kranker ist eine Arbeitsweise anzustreben, die die jeweils eigene Sichtweise der verschiedenen Spezialisten zu einer teamorientierten interdisziplinären Arbeit zusammenfinden lässt. Um Versorgungsbrüche zu vermeiden, sind die Grenzen des institutionsbezogenen Handelns zu überwinden und nachgelagerte Prozesse frühzeitig einzubinden. Die Basis patientenorientierter Medizin und Pflege ist Kooperation, die sowohl die Arbeitsbeziehungen der Behandlungsteams als auch die Beziehung zum Patienten bestimmt (vgl. Hüper 2004, S. 81). Die herkömmliche Arbeitsteilung zwischen Medizin in Richtung Technikzentrierung und Pflege mit interaktionsorientiertem Ansatz können diesen Anforderungen jedoch nicht gerecht werden. 78 Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch hier nochmals deutlich wird, dass Integration Prozesscharakter besitzt und diese integrativen Prozesse einhergehen mit Veränderungen sozialer Beziehungen, beruflicher Kompetenzen, des Status sowie der institutionellen Strukturen einschließlich ihrer gewachsenen Kulturen. Es ist offensichtlich geworden, dass Disease Management Programme für Krankenhäuser eine andere Bedeutung haben als für die GKV. Sie können für Krankenhäuser den behutsamen Beginn der Abwendung von den gegenwärtigen Leitgedanken der Gesundheitsversorgung hin zur Neuorientierung in der Versorgung chronisch Kranker darstellen. Dahingegen ist für die GKV davon auszugehen, dass Disease Management Programme durch die Kopplung an den RSA eher von monetärer Bedeutung sind. 5 ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG Ein wesentliches Problem des deutschen Gesundheitswesens ist die starre Abschottung zwischen den einzelnen Sektoren und auch Sozialleistungszweigen. Angesichts der heutigen Herausforderungen – veränderte Alterstruktur mit einer Zunahme chronischer Erkrankungen und Mehrfacherkrankungen sowie bestehende Über-, Unter- und Fehlversorgung und die Notwendigkeit, mit begrenzten Mitteln das bestmögliche Ergebnis zu erzielen – müssen die Abschottung und Abgrenzung zwischen den einzelnen Sektoren überwunden werden. Dieses Ziel verfolgt die Integrierte Versorgung. Bisherige Bestrebungen zur Umsetzung dieses Konzeptes führten jedoch nicht zu gewünschten Ergebnissen. Eine Ursache dafür ist, dass Diskussionen zur Integration bislang im Kontext gefährdeter Beitragssatzstabilitäten geführt wurden und somit dem Druck unmittelbar wirksam werdender Kostenentlastung ausgesetzt sind. Die Einführung von Disease Management Programmen in das System der GKV wurde im Wesentlichen durch zwei Entwicklungen im deutschen Gesundheitswesen beeinflusst. Zum einen soll die medizinische Versorgung chronisch Kranker verbessert werden und zum anderen sollen alle gesetzlichen Krankenkassen in finanzieller Hinsicht möglichst so gestellt werden, als ob sie annähernd gleiche Versichertenstrukturen aufwiesen. Durch die Aufnahme der Disease Management Programme in den RSA soll eine gerechtere Verteilung der Lasten bei der Versorgung 79 chronisch Kranker auf alle Kassen erfolgen. Krankenkassen, die diese Programme auflegen und ihre chronisch Kranken hierfür gewinnen, erhalten Finanztransfers. Die finanziellen Anreize sollen einen Wettbewerb zur optimalen Versorgung chronisch Kranker auslösen. Doch bestehen berechtigte Zweifel, ob eine Kombination von Disease Management und RSA sinnvoll ist. Krankenkassen verbessern mit Disease Management Programmen ihre Position im RSA. Wenn weniger die Verbesserung der Gesundheitsversorgung im Mittelpunkt steht, sondern die Auswirkungen auf die Position der Krankenkassen im RSA vordergründig sind, drohen die Disease Management Programme zu scheitern. Es ist hier an die Verantwortlichen zu appellieren, der Idee des Disease Managements, der Versorgungsverbesserung durch standardisierte und integrierte Behandlungskonzepte, nachzukommen und nicht einer kurzfristigen Kostenminimierung zu unterwerfen. Hierzu bedarf es aber offenkundig einer Ausgestaltung der Disease Management Programme, die dem tatsächlichen Integrationscharakter entspricht und eine sektoren-, institutions- und professionsübergreifende Arbeit ermöglicht. Die Untersuchung der beiden momentan vorliegenden Anforderungsprofile für Disease Management Programme Diabetes mellitus Typ 2 und Brutkrebs lässt hier Defizite erkennen. Bedingt durch den Wandel im Patientenaufkommen wird deutlich, dass die Orientierung am Paradigma der Akutmedizin keine brauchbare Handlungsoption darstellt, um der zunehmenden Versorgung chronisch Kranker gerecht zu werden. Es bedarf einer Neuorientierung in der Versorgung dieser Patientengruppe, die mit neuen Leitbildern und Werten einhergeht und den gegenwärtigen Ansatz der Gesundheitsversorgung ablöst. Die Implementierung von Disease Management Programmen erzwingt einen grundlegenden Wandel der Gesundheitsdienste. Die Annahme und Umsetzung der Ziele und Inhalte der strukturierten Behandlungsprogramme setzt eine Veränderung der Grundeinstellung der beteiligten Akteure voraus. Dies lässt sich mit dem Verständnis von Integration begründen, das integrierte Versorgungssysteme als Prozesse beschreibt, die aus Veränderungen sozialer Beziehungen, beruflicher Kompetenzen und institutioneller Strukturen einschließlich ihrer Verhaltensorientierung und Kultur bestehen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit dieses Verständnis eingebettet 80 in das Disease Management eine neue Perspektive in Richtung Integrierte Versorgung darstellt oder ob sich dieses gerade als unüberwindbare Grenze herauskristallisiert. Stellen sich Krankenhäuser dem Wandel im Patientenaufkommen und sind bereit, sich diesem anzupassen und den Bedürfnissen chronisch Kranker zu folgen, kann durch die Annahme der Disease Management Instrumente der Prozess der Neuorientierung in der Versorgung chronisch Kranker durch eine neue Kultur innerhalb der Institution unterstützt werden. Die künftigen Anforderungen an ein Krankenhaus unter Berücksichtigung der besonderen Situation chronisch Kranker lassen das Profil einer patientenorientierten Einrichtung erkennen, woraus sich unter anderem die Zukunftsanforderungen an Medizin und Pflege im Kontext kooperativer Zusammenarbeit ableiten. Es ist zu hoffen, dass es Krankenhäusern gelingt, das in Disease Management Programmen liegende Potenzial für sich zu nutzen und der im Wesentlichen auch unvermeidlichen Arbeitsteiligkeit und Spezialisierung mit dem Prozess der Integration entgegenzuwirken. 81 6 LITERATURVERZEICHNIS Aktuelles 2002: Das Disease Management Programm Diabetes bringt kaum Fortschritte für die Behandlung. http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/news/diseasemanagm.htm Datum: 17.11.2002 Amelung, V. E./Schumacher, H. 2000: Managed Care - Neue Wege im Gesundheitsmanagement. Wiesbaden: Gabler AOK Hessen 2003: Rahmenvertrag zur Durchführung des strukturierten Behandlungsprogramms nach § 137 f SGB V von Brustkrebspatientinnen auf der Grundlage des § 63 Abs. 1 und § 64 Abs. 1 SGB V in Verbindung mit der RSAV. https://www.dmp-aok.de/hess/rd/pdf/Vertrag_brustkrebs_blanko.pdf Datum: 16.12.2003 Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Berlin 2003: Bessere Versorgung für Patientinnen – Charité und Krankenkassen schließen ersten DMP-Brustkrebsvertrag in Berlin. http://www.aok-bv.de/imperia/md/content/aokbundesverband/dokumente/pdf/gesundheitsversorgung/dmp_bk_berlin.pdf 82 Datum: 27.11.2003 Arbeitskreis PatientInnenrechte und –information (Hrsg.) 2003: DiseaseManagement-Programme (DMP). Wer – Wie – Was. Übersicht zu einem neuen Instrument im Gesundheitswesen. 2., überarbeitete Version. Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen e. V. Ärzte Zeitung 2002: Müssen Ärzte künftig Krankenkassen mit Patientendaten füttern? http://www.aerztezeitung.de/docs/2002/04/24/076a0102.asp?cat Datum: 24.04.2002 Badura, B. 1996 (a): Patientenorientierte Systemgestaltung im Gesundheitswesen. In: Badura, B./Feuerstein, G. (Hrsg.): Systemgestaltung im Gesundheitswesen. Zur Versorgungskrise der hochtechnisierten Medizin und den Möglichkeiten ihrer Bewältigung. 2. Auflage. Weinheim, München: Juventa, S. 255 - 310 Badura, B. 1996 (b): Arbeit im Krankenhaus. In: Badura, B./Feuerstein, G. (Hrsg.): Systemgestaltung im Gesundheitswesen. Zur Versorgungskrise der hochtechnisierten Medizin und den Möglichkeiten ihrer Bewältigung. 2. Auflage. Weinheim, München: Juventa, S. 21 - 82 Badura, B./Feuerstein, G. 1996: Krisenbewältigung durch Systemgestaltung. In: Badura, B./Feuerstein, G. (Hrsg.): Systemgestaltung im Gesundheitswesen. Zur Versorgungskrise der hochtechnisierten Medizin und den Möglichkeiten ihrer Bewältigung. 2. Auflage. Weinheim, München: Juventa, S. 9 - 20 83 Bronner, D. 2003: Die Rolle des Koordinierungsausschusses bei den Disease-Management-Programmen: Wie geht es weiter? In: Pfaff, H./Schrappe, M./Lauterbach, K. W./Engelmann, U./Halber, M. (Hrsg.): Gesundheitsversorgung und Disease Management. Grundlagen und Anwendungen der Versorgungsforschung. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber, S. 227 - 231 Bruckenberger, E. 1997: Die mythologische Kostendämpfung - Krankenhauspolitik um die Jahrtausendwende. In: Krankenhaus Umschau, 5/1997, S. 350 ff. Bruckenberger, E. 2000: Integrierte oder integrante Versorgung - Die „Daseinsfürsorge“ weicht dem Wettbewerb, KU-Sonderheft 12/2000 Networks - Integrierte Versorgung. Kulmbach: Baumann BVA 2003: Zulassung der Disease Management Programme (DMP) durch das Bundesversicherungsamt (BVA). www.bundesversicherungsamt.de Datum: 16.12.03 Conrad, H.-J. 2001: Integrierte Versorgung - Möglickeiten und Grenzen der Umsetzung. In: Hellmann, W. (Hrsg.): Management von Gesundheitsnetzen. Theoretische und praktische Grundlagen für ein neues Berufsfeld. Stuttgart: Kohlhammer Derdzinski, B. F./Hecke, T./Ziegenhagen, D. J. 2003: Disease-ManagementProgramme „Arterielle Hypertonie“ - Erwartungen der Kostenträger an Implementation und Evaluation. In: Pfaff, H./Schrappe, M./Lauterbach, 84 K. W./Engelmann, U./Halber, M. (Hrsg.): Gesundheitsversorgung und Disease Management. Grundlagen und Anwendungen der Versorgungsforschung. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber, S. 321 327 Dieffenbach, S./Landenberger, M./ von der Weiden, G. (Hrsg.) 2002: Kooperation in der Gesundheitsversorgung - Das Projekt „VerKet“ - praxisorientierte regionale Versorgungsketten. Neuwied, Kriftel: Luchterhand DKG 2003: Ergebnisse der Umfrage 2003 des Krankenhaus-Barometers. http://www.dkgev.de/1_pol/pol-2003_RS-345_Krankenhausbarometer2003.htm Datum: 16.12.2003 FAZ 2002: Ärztetag lehnt “Checklisten-Medizin“ ab. FAZ 31.05.2002 (123) Felder, S. 2003: Disease-Management-Programme: Eine kritische Sicht. In: Pfaff, H./Schrappe, M./Lauterbach, K. W./Engelmann, U./Huber, M. (Hrsg.): Gesundheitsversorgung und Disease Management. Grundlagen und Anwendungen der Versorgungsforschung. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber, S. 237 - 241 Feuerstein, G. 1996: Schnittstellen im Gesundheitswesen – Zur (Des-) Integration medizinischer Handlungsstrukturen. In: Badura, B./Feuerstein, G. (Hrsg.): Systemgestaltung im Gesundheitswesen. Zur Versor- 85 gungskrise der hochtechnisierten Medizin und den Möglichkeiten ihrer Bewältigung. 2. Auflage. Weinheim, München: Juventa, S. 211 - 254 Forster, R. 2003: PatientInnenorientierung und Patientenbeteiligung - von der Rhetorik zur Realisierung? In: Meggeneder, O. (Hrsg.) Unter-, Über- und Fehlversorgung. Vermeidung und Management von Fehlern im Gesundheitswesen. Frankfurt am Main: Mabuse, S. 75 - 90 Gerst, T. 2002: Datentransparenz. „Gläserne DMP-Patienten“ verhindern. In: Deutsches Ärzteblatt, Jg. 99, Heft 14, A 901 Greulich, A./Berchthold, P./Löffel, N. (Hrsg.) 2002: Disease Management. Patient und Prozeß im Mittelpunkt. 2., überarb. Auflage. Heidelberg: UTB Gesundheitswissenschaften Helou, A./Perleth, M. 2002: Bewertung von Leitlinien für die klinische Praxis. In: Perleth, M./Antes, G. (Hrsg.): Evidenzbasierte Medizin. Wissenschaft im Praxisalltag. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. München: Urban und Vogel Hüper, C. 2004: Belastende Intensivpflege oder vom Nutzen der Kooperation. In: Henze, K. H./Piechotta, G. (Hrsg.): Brennpunkt Pflege. Beschreibung und Analyse von Belastungen des pflegerischen Alltags. Frankfurt am Main: Mabuse, S. 67 - 85 IGES 2003: Voraussetzungen für ein effektives und effizientes Disease-Management für Typ-2-Diabetiker und seine adäquate Finanzierung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung. 86 http://www.iges.de/content/e72/e251/e1174/Endfassunginkl.TitelundUmschlagseite_ger.pdf Datum: 18.01.2004 IGES/Cassel, D./Wasem, J. 2001: Zur Wirkung des Risikostrukturausgleichs in der gesetzlichen Krankenversicherung. Eine Untersuchung im Auftrag des Bundesministerium für Gesundheit. Endbericht. http://www.iges.de/content/e72/e251/e254/RSA-Gutachten2001_ger.pdf Datum: 18.01.2004 Jacobs, K. 2003: Zur Verknüpfung von Risikostrukturausgleich und Disease-Management-Programmen - Anmerkungen aus ordnungspolitischer Sicht. In: Pfaff, H./Schrappe, M./Lauterbach, K. W./Engelmann, U./Halber, M. (Hrsg.): Gesundheitsversorgung und Disease Management. Grundlagen und Anwendungen der Versorgungsforschung. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber, S. 207 - 211 Knorr, G. 2003: Probleme der Grundversorgungskrankenhäuser im DRGSystem – Spezialisierung als Ausweg? In: Das Krankenhaus, 9/2003, S. 679 ff. Kühn, H. 2001: Integration der medizinischen Versorgung in regionaler Perspektive - Dimensionen und Leitbild eines politisch-ökonomischen, sozialen und kulturellen Prozesses. Berlin: Arbeitsgruppe Public Health Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Landgraf, R. et al. 2004: Positionspapier. Disease-Management-Programm (DMP) „Diabetes mellitus Typ-2“ in Verbindung mit der Risikostruk- 87 turausgleichs-verordnung (RSAV) von Diabetologen der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG), Berufsverband Deutscher Diabetologen, Vertretern des Deutschen Diabetiker Bundes LV Niedersachsen (DDB), Arbeitgebern und Versichertenvertretern der Selbstverwaltung von BKK, Vorständen von BKK. http://ddg.pconnect.net/redaktion/mitteilungen/Disease-Politbrief-Endfassung.pdf Datum 09.03.2004 Lauterbach K. W. 2002: Disease Management: Chancen für das Krankenhaus. In: f&w, Heft Nr. 1, Jg. 19, S. 38 ff. Lauterbach K. W. o. J.: Disease Management in Deutschland – Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, Faktoren zur Entwicklung, Implementierung und Evaluation. Gutachten im Auftrag des VdAK und AEV. http://www.vdak.de/dmp/dmp-gutachten.pdf Datum: 17.11.2002 Lauterbach K. W./Stock, S. 2001: Reform des Risikostrukturausgleichs. Disease Management wird aktiviert. In: Deutsches Ärzteblatt, Jg. 98, Heft 30, A 1935 Lauterbach K. W./Wille E. 2001: Modell eines fairen Wettbewerbs durch den Risikostrukturausgleich. Endgutachten 2/2001. http://www.bmgesundheit.de/themen/gkv/risiko/risiko.htm 88 Datum: 04.05.2002 Mannebach, H. 1993: High-Tech Medizin versus Patientenorientierung: von der Diagnose zur Therapie. In: Badura, B./Feuerstein, G./Schott, Th. (Hrsg.): System Krankenhaus. Arbeit, Technik und Patientenorientierung. Weinheim, München: Juventa Mühlbacher, A. 2002: Integrierte Versorgung: Management und Organisation. Eine wirtschaftswissenschaftliche Analyse von Unternehmensnetzwerken der Gesundheitsversorgung. 1. Auflage. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber Müller-Mundt, G./Schaeffer, D. 2003: Patientenorientierte Versorgung chronisch Kranker. In: Pfaff, H./Schrappe, M./Lauterbach, K. W./Engelmann, U./Halber, M. (Hrsg.): Gesundheitsversorgung und Disease Management. Grundlagen und Anwendungen der Versorgungsforschung. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber, S. 143 - 148 Perleth, M. 2002: Evidenzbasierte Medizin: eine Einführung. In: Perleth, M./Antes, G. (Hrsg.): Evidenzbasierte Medizin. Wissenschaft im Praxisalltag. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. München: Urban und Vogel Rabbata, S. 2002: Disease Management. Bedenkenträger. In: Deutsches Ärzteblatt, Jg. 99, Heft 14, A 893 Rebscher, H. 2001: Disease Management – Qualitätsstrategien für die Versorgung chronisch Kranker. Einführungsstrategien für Disease Management bei den Ersatzkassen. VdAK/AEV – Pressegespräch am 17.Oktober 2001 in Berlin. http://www.vdak.de/pe/vdak/presse60.htm 89 Datum: 09.03.2004 Renzewitz, S. 2003: Disease-Management-Programme (DMP). DKG/GKVUmsetzungsempfehlung für DMP Brustkrebs rückt Krankenhäuser ins Zentrum der Versorgung. In: Das Krankenhaus, 3/2003, S. 212 ff. Rosenbrock, R./Gerlinger, T. 2004: Gesundheitspolitik. Eine systematische Einführung. 1. Auflage. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 2000/2001: Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit. Bd. III Über-, Unter- und Fehlversorgung. Gutachten 2000/2001 Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 2003: Finanzierung, Nutzenorientierung und Qualität. Bd. I Finanzierung und Nutzenorientierung. Bd. II Qualität und Versorgungsstrukturen. Gutachten 2003 Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 1990: Herausforderungen und Perspektiven der Gesundheitsversorgung. Gutachten 1990 Sackett, D. L. 2002: Was ist evidenzbasierte Medizin? Perleth, M./Antes, G. (Hrsg.): Evidenzbasierte Medizin. Wissenschaft im Praxisalltag. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. München: Urban und Vogel Sauerland, S./Galandi, D. 2001: Cochrane Collaboration und Cochrane Library. Lauterbach, K. W./Schrappe, M. (Hrsg.): Gesundheitsökonomie, Qualitätsmanagement und Evidence-based Medicine. Eine systematische Einführung. Stuttgart: Schattauer 90 Sawicki, P. T. 2002: Evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen – Wege zum „besten Wissen“ für die Praxis. http://www.aok-bv.de/imperia/md/content/aokbundesverband/dokumente/pdf/service/gug_spezial_dmp.pdf Datum: 26.02.2002 Schäfers, B. (Hrsg.) 1998: Grundbegriffe der Soziologie. Opladen: Leske und Budrich Schmacke, N. 2002: Leitlinienorientierung, evidenzbasierte Versorgung und Vertrauen in die Medizin: Voraussetzungen für die Entwicklung von strukturierten Behandlungsprogrammen. http://www.aok-presse.de/htdig/suche_aokbundesverband.html Datum: 26.02.2002 Schönbach, K. H. 2003: Qualität und Wirtschaftlichkeit durch Disease-Management-Programme in der GKV. In: Pfaff, H./Schrappe, M./Lauterbach, K. W./Engelmann, U./Halber, M. (Hrsg.): Gesundheitsversorgung und Disease Management. Grundlagen und Anwendungen der Versorgungsforschung. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber, S. 213 - 225 Schrappe, M. 2003: Wandel der stationären Versorgung. In: Pfaff, H./Schrappe, M./Lauterbach, K. W./Engelmann, U./Halber, M. (Hrsg.): Gesundheitsversorgung und Disease Management. Grundlagen und 91 Anwendungen der Versorgungsforschung. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber, S. 79 - 86 Schulz, E./Kifmann, M./Breyer, F. 14/01: Risikostrukturausgleich am Scheideweg - Senkung der Wirtschaftlichkeitsreize für Krankenkassen sollte vermieden werden. DIW- Wochenbericht 14/01. http://www.diw.de/deutsch/publikationen/wochenberichte. Datum: 04.05.2002 Stegmüller, K. 1996: Wettbewerb im Gesundheitswesen. Konzeption zur „dritten Reformstufe“ der Gesetzlichen Krankenversicherung. Frankfurt (Main): Verlag für Akademische Schriften Stratmeyer, P. 2002: Das patientenorientierte Krankenhaus. Eine Einführung in das System Krankenhaus und die Perspektive für die Kooperation zwischen Pflege und Medizin. Weinheim, München: Juventa Szathmary, B. 1999: Neue Versorgungskonzepte im deutschen Gesundheitswesen. Disease und Case Management. Neuwied, Kriftel: Luchterhand Ulrich, G. 2002: Zur Rationalität der „Evidenz basierten“ Medizin. In: Dr. med Mabuse, Heft 137, S. 28 ff. 92 7 ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abbildung 1: Hierarchie wissenschaftlicher Evidenz.............................. 41 Abbildung 2: Ablaufschema eines Disease Management Programms . 44 Abbildung 3: Modultypen im Disease Management Programm........... 45 Abbildung 4: Versorgungskomponenten des Basismoduls.................... 48 Abbildung 5: Versorgungs- und unterstützende Komponenten des Basismoduls ...................................................................... 49 Abbildung 6: Integrationspotentiale der Anforderungsprofile für Disease Management Programme Diabetes mellitus Typ 2 und Brustkrebs................................................................................. 59 Abbildung 7: Neue Regeln der Gesundheitsversorgung durch Disease Management Programme ...................................................... 70 93 8 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS BÄK BMG BV BVA COPD DKG DMP DRG EbM EU FAZ GKV GMG KBV KHK KV RSA RSAV SGB SOEP SVRKAiG VdAK Bundesärztekammer Bundesministerium für Gesundheit Bundesverband Bundesversicherungsamt chronic obstruktive pulmonary disease Deutsche Krankenhausgesellschaft Disease Management Programm Diagnosis Related Groups Evidence-based Medicine Erwerbsunfähigkeit Frankfurter Allgemeine Zeitung Gesetzliche Krankenversicherung Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung Kassenärztliche Bundesvereinigung Koronare Herzkrankheit Kassenärztliche Vereinigung Risikostrukturausgleich Risikostruktur-Ausgleichsverordnung Sozialgesetzbuch Sozio-ökonomisches Panel Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen Verband der Angestellten-Krankenkasse 94