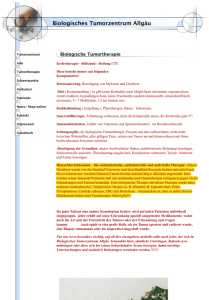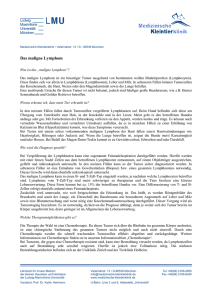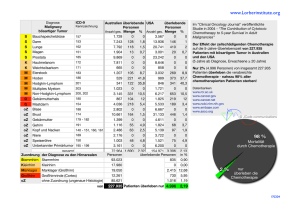Den Krebs bekämpfen: Therapien im Überblick
Werbung

5. Den Krebs bekämpfen: Therapien im Überblick Sobald die definitive Diagnose und das Tumorstadium inklusive aller prognostischen Erwägungen gestellt werden konnte, ist der Zeitpunkt der therapeutischen Planung gekommen. Bestand die Aufgabe des Arztes bei der Diagnostik vor allem darin, die vorliegende Erkrankung anhand einer sinnvollen Abfolge der diagnostischen Maßnahmen – d. h. Vermeidung von stark invasiven zugunsten weniger invasiver Methoden – sicher nachzuweisen, geht es bei der Entscheidung für die therapeutischen Maßnahmen um eine genau so sinnvolle und stringent geplante Sukzession der therapeutischen Maßnahmen. Der Tumor soll – entsprechend dem diagnostizierten Stadium und den Präferenzen des Patienten – mit der effektivsten Therapie angegangen werden. Für gewöhnlich stehen zur Behandlung einer Tumorerkrankung verschiedene Therapieangebote zur Verfügung. Idealerweise ist der Patient über sämliche Therapieeffekte und Nebenwirkungen der verschiedenen in Frage kommenden Therapien aufgeklärt und entscheidet gemeinsam mit seinem Arzt, welche davon für ihn die beste ist. Die beste Therapie ist nicht unbedingt die mit der besten Überlebensrate (um es extrem auszudrücken). Nein, ein Betroffener „darf“ sich bei seiner Entscheidung auch vom Nebenwirkungsspektrum, von der zu erwartenden Lebensqualität oder sonstigen Therapiezielen leiten lassen. Es ist immerhin seine Therapie, für seinen Tumor und seine Situation. Wie bereits häufiger angeführt, besteht die ärztliche Aufgabe darin, den Patienten mit jenen Informationen zu versorgen, die er für seine Entscheidungsfindung benötigt. Im folgenden Kapitel möchte ich die verschiedenen Therapieoptionen zur Behandlung von Krebserkrankungen vorstellen und ihre klinischen, technischen und biologischen Voraussetzungen erläutern. Durch die enormen Forschungsaufwendungen und -aktivitäten der vergangenen Jahrzehnte haben sich insbesondere die medikamentösen Therapiemöglichkeiten deutlich ausgeweitet und sind wesentlich differenzierter geworden. Die Basis jeglicher Krebsbehandlung stellt in der Großzahl der Fälle aber immer noch die chirurgische, also operative Therapie dar. Daher möchte ich meine Ausführungen mit dieser Therapieoption beginnen. 5.1 Operative Therapien: Entfernen des Tumors Die Operation ist – zumindest bei den soliden Tumoren (Organtumoren wie z. B. Colonkarzinom, Mammakarzinom oder Prostatakarzinom) – ein fester und schon traditioneller Bestandteil der onkologischen Therapie. Verschiedene Konzepte kommen bei der operativen Krebstherapie zur Anwendung. Meistens wird dabei der Primärtumor entfernt, was bei einer frühzeitigen Diagnose des Tumors mit kurativer (heilender) Intention durchgeführt wird. Des Weiteren werden auch Metastasen operativ entfernt; auch bei Komplikationen der Erkrankung (wenn beispielsweise Transportwege für Körperflüssigkeiten, etwa die Harnleiter oder Blutgefäße, durch das Tumorwachstum verlegt sind) oder bei Schmerzen (die beispielsweise als Folge von Nervenkompressionen auftreten können) wird häufig eine operative Therapie gewählt. Diese Operationskonzepte sind – im Gegensatz zu der operativen Entfernung des organbegrenzten Primärtumors – als Palliativtherapien anzusehen, was bedeutet, dass eine Heilung der Krebserkrankung durch diese Maßnahmen nicht erreicht werden kann, wohl aber eine Verbesserung der Lebensqualität und eine Verlängerung der Überlebenszeit des Betroffenen. Chirurgische Therapien werden keineswegs nur von Chirurgen, sondern auch von anderen Fachärzten sogenannter operativer Fächer – wie z. B. Orthopäden, Urologen, Gynäkologen, HNO-Ärzten oder Neurochirurgen – durchgeführt. Sie alle operieren dabei Tumorerkrankungen, die in „ihren“ Organbereich fallen. Die Gynäkologen entfernen also Mamma-, Gebärmutter- und Ovarialtumoren, die Urologen Prostata-, Nieren-, Hoden- und Blasentumoren und die Orthopäden Knochentumoren und Metastasen in den Knochen. Dabei bedienen sich die Operateure verschiedener Operationsmethoden (auch Operationstechniken genannt). Die am längsten praktizierte operative Technik ist die offene Operation, bei der über einen Hautschnitt ein Zugang für die Hände des Operateurs geschaffen wird. Bei der noch relativ neuen laparoskopischen Operation wird der übliche den Zugang schaffende Schnitt durch mehrere kleine Schnitte ersetzt, welche das Einführen einer Optik (also einer kleinen Kamera) und mehrerer kleiner Operationsinstrumente erlauben. Sowohl die Optik als auch die Operationsinstrumente werden vom Operateur (und seinen Assistenten) direkt bedient und ersetzen im Körperinneren die Hände des Operateurs. Dadurch wird eine bessere Bewegungsfreiheit im Körperinneren erreicht. Eine erst seit etwa zehn Jahren verwendete Weiterentwicklung der laparoskopischen Operation ist die roboterassistierte laparoskopische Operation. Hierbei werden Optik und Instrumente nicht mehr vom Operateur gehalten, sondern über einen zwischengeschalteten Roboter bedient, der wiederum mithilfe von Joysticks vom Operateur gelenkt wird. Besonders in den letzten zehn bis zwanzig Jahren ging der operative Trend weg von der offenen Operation und hin zu den laparoskopischen und roboterassistierten Verfahren. Dies ist insofern erstaunlich, als dass bisher für keines dieser modernen Verfahren ein wesentlicher therapeutischer Vorteil gegenüber der konventionellen Operation nachgewiesen werden konnte. Fakt ist jedoch, dass Kliniken, welche über diese modernen Operationsapparaturen verfügen, einen deutlich höheren Patientenzustrom verzeichnen. Es ist anzunehmen, dass mit den zunehmenden Informationsmöglichkeiten für den Einzelnen (z. B. im Internet) auch Marketingkampagnen nachweisliche Effekte im Medizinbetrieb zeigen, und zwar dahingehend, dass Betroffene sich gezielt Kliniken aussuchen, die roboterassistierte Operationsverfahren anbieten. Meine Einstellung zu dieser Entwicklung ist die Folgende: Ein Chirurg, der mit einem Messer und seinen eigenen Händen nicht operieren kann, der kann genauso wenig mit einem Laparoskop oder einem robotergeführten Laparoskop glänzen. Die Operation ist ein Handwerk, das durch mehr oder weniger Ausbildung und Übung (je nach Fähigkeiten des Arztes) erlernt werden muss. Ein Operateur beherrscht nur dann eine Operation, wenn er sie häufig und regelmäßig durchführt – also mindestens 150 bis 200 pro Jahr. Da aber die Spezialisierung heutzutage auch in der operativen Medizin Einzug gehalten hat, muss beispielsweise ein Operateur, der sich auf dem Gebiet der Darmoperationen hervorgetan hat, noch lange keine Spezialist für Magen- oder Bauchspeicheldrüsenoperationen sein, obwohl diese Organe zum gleichen Fachgebiet, nämlich der Abdominalchirurgie gehören. Und da es bisher auch keine wesentlichen Unterschiede in der Effektivität und im Nebenwirkungsspektrum zwischen offenen und laparoskopischen oder roboterassistierten Operationsverfahren gibt, sollte ein Patient jener Methode den Vorzug geben, die der ausgewählte Operateur am besten beherrscht. Mit anderen Worten: Nicht die Operationsmethode sollte sich der Betroffene aussuchen, sondern immer den Operateur. Obwohl Operationen schon seit Tausenden von Jahren durchgeführt und in den vergangenen fünfzig bis hundert Jahren deutlich verbessert wurden, ist die Standardisierung und Überwachung der Operationsmethoden vergleichsweise schlecht entwickelt. Auf der einen Seite ist die für die Entwicklung und für den Einsatz beim Menschen erforderliche Zulassung von Medikamenten95 ein extrem aufwendiger, überwachter, standardisierter und teurer Prozess, der durch Gesetze geregelt und durch entsprechende Behörden kontrolliert wird. Ähnlich verhält es sich auch mit der Entwicklung und Zulassung von medizintechnischen Geräten und Produkten. Auf der anderen Seite werden operative Methoden häufig von einzelnen Chirurgen erdacht und entwickelt bzw. verändert und dann in medizinischen Zeitschriften oder operativen Lehrbüchern veröffentlicht. Einen den pharmakologischen Wirkstoffen vergleichbaren Zulassungsprozess gibt es dabei nicht. Kontrollinstanzen, welche das Einhalten der Operationsmethoden überwachen, fehlen ebenfalls. Allerdings ist es auch relativ schwierig, einen Operateur hinsichtlich des Einhaltens einer bestimmten Operationsmethode zu kontrollieren. Operationen sind ein Handwerk, und dieses Handwerk zu kontrollieren würde so absurd anmuten, als wenn man einem Maurer sagen würde, in welcher Hand er den Hammer zu halten hat. Im Bereich Hygiene werden die Operationsräumlichkeiten, die Aufbereitung des Operationsinstrumentariums und die Operationsvorbereitung vor gewisse Anforderungen gestellt, welche von Hygieneabteilungen (die zumeist an den Kliniken angesiedelt sind) und Regierungspräsidien (das sind die staatlichen Mittelbehörden, die den Ministerien unterstellt sind und in deren Auftrag arbeiten) streng kontrolliert werden. Operativ tätige Fachärzte erlernen ihr Handwerk im Rahmen der Facharztausbildung, in deren Verlauf ein dem Fach entsprechender Operationskatalog96 zu erbringen ist. Diese Kataloge sind zumeist recht überschaubar, da der Großteil der Absolventen der entsprechenden Facharztausbildung nicht im aktiven Operationsbetrieb verbleibt, sondern in den ambulanten Praxisbereich wechselt, wo in der Regel nicht oder nur wenig operiert wird. Am Ende der Facharztausbildung steht eine Facharztprüfung, für welche die Einreichung des absolvierten Operationskataloges Bedingung ist. Die Erfüllung des Operationskataloges wird vom Ausbildungsleiter (für gewöhnlich der Chefarzt der Ausbildungsklinik) bestätigt. Die Facharztprüfung wird dann allerdings in rein theoretischer Form durchgeführt; die operativen Techniken und Fertigkeiten des Arztes sind nicht Gegenstand der Beurteilung. Die nach dem Abschluss der Facharztprüfung im operativen Betrieb (als Oberärzte oder spätere Chefärzte einer Klinik) verbleibenden Fachärzte erlernen das große operative „Geschäft“ in der Regel erst nach Abschluss der Facharztausbildung und dem Eintritt in die Oberarzttätigkeit. Diese Umstände zeigen deutlich, dass eine externe Qualitätskontrolle von Operationsleistungen zu keinem Zeitpunkt – weder während noch nach der Ausbildung – stattfindet. Die beschriebenen Tatsachen sollten einen Betroffenen jedoch nicht entmutigen, denn trotz wenig Standardisierung und Qualitätskontrolle gibt es in jedem Fach brillante Operateure. Den besten und geeignetsten Chirurgen ausfindig zu machen ist zugegebenermaßen eine schwierige Aufgabe und eine Herausforderung für Patienten und ihre Berater – allerdings sind die operativen Koryphäen eines Faches zumeist bekannt und können häufig in entsprechend ausgerichteten und qualifizierten Zentren (siehe Qualitätsmanagement und Zertifizierung: Der Weg zur besseren Krebsmedizin?) gefunden werden. Verbesserungen in dieser Hinsicht wären natürlich möglich. Wenn das operative Geschick des Operateurs auch keiner Qualitätskontrolle unterworfen werden kann, so wäre es meiner Meinung nach wichtig, die verschiedenen operativen Methoden hinsichtlich ihrer Effektivität miteinander zu vergleichen. Hierzu gibt es noch keine allgemein zugreifbaren Quellen; es wäre sehr zu wünschen, dass den Betroffenen in naher Zukunft diesbezüglich verlässliche Instrumente zur Verfügung gestellt werden. Von der Primärtumoroperation zur Metastasen- und Komplikationschirurgie Das Grundprinzip einer onkologisch-chirurgischen Therapie besteht in einer kompletten Entfernung des Primärtumors unter Einhaltung eines Sicherheitsabstandes zum Normalgewebe. Früher wurde häufig das gesamte tumortragende Organ entfernt; in den letzten Jahren ist bei zahlreichen Tumorarten ein eindeutiger Trend zu weniger ausgedehnten Operationen erkennbar. Die Devise lautet: Funktionalität vor Radikalität – also möglichst weitgehender Erhalt des tumortragenden Organs und seiner Funktionen. Um die Ausmaße der Operation so gering wie möglich zu halten, werden heutzutage begleitende Maßnahmen wie Bestrahlung oder Chemotherapie – manchmal schon während der Operation – eingesetzt. Diese Entwicklung lässt sich gut am Mammakarzinom nachvollziehen. Vor gut hundert Jahren wurde die radikale operative Entfernung der tumortragenden weiblichen Brust entwickelt. In der Folge wurde diese Methode immer weiter „radikalisiert“, d. h., die Operationsgrenzen wurden ausgedehnt: Angrenzendes Fettgewebe, Lymphknoten, Teile des Brustmuskels und sogar Rippen wurden in den operativen Umfang eingeschlossen. Erst nach und nach erkannte man, dass eine so ausgedehnte Operation keine Vorteile (z. B. geringere Metastasierungshäufigkeit oder längere Überlebenszeit) im Vergleich zu einem weitaus geringeren operativen Eingriff, der sogenannten Lumpektomie97, aufzuweisen hatte. Wobei man allerdings ganz klar sagen muss, dass beide Methoden eher als gleich schlecht denn als gleich gut zu bezeichnen waren. Heutzutage erreicht man mit einem multimodalen (also vielgestaltigen) Vorgehen, das häufig aus einer relativ kleinen operativen Maßnahme in Kombination mit Bestrahlungs- und/oder Chemotherapie und eventuell einer Hormontherapie besteht, deutlich bessere Überlebensergebnisse. Es hat jedoch viele Jahrzehnte und den enormen Einsatz einzelner enthusiastischer Ärzte gebraucht, bevor sich die Operateure von dem eingeschlagenen Weg der zunehmenden Ausdehnung der Operationsgrenzen abbringen ließen. Auch beim Nierenzellkarzinom, bei dem es noch vor zehn Jahren gang und gäbe war, die tumortragende Niere mit der Nebenniere und den umliegenden Lymphknoten zu entfernen, beschränkt sich die operative Maßnahme gegenwärtig häufig auf eine Tumornukleation (das Herausschneiden des Tumors aus dem Organ) oder eine partielle Entfernung der Niere (z. B. eine Ober- oder Unterpolresektion). Mangels weiterer wirksamer Therapiemaßnahmen wird in der Primärtherapie des Nierenzellkarzinoms zum jetzigen Zeitpunkt auch von einer zusätzlichen Chemo- oder Strahlentherapie abgesehen und stattdessen lediglich eine engmaschige Nachsorgekontrolle durchgeführt. Andererseits ist bei Tumorentitäten wie dem Prostatakarzinom oder dem Pankreaskarzinom auch heute noch die komplette Organentfernung üblich – zumeist unter Einbeziehung der in der engen Umgebung des Organs gelegenen Lymphknoten. Bei der Metastasenchirurgie handelt es sich – wie schon öfters erwähnt – um ein palliatives Konzept. Auch hier gilt: Der Erhalt der Funktionalität des betroffenen Organs ist wichtiger als die radikale Entfernung des Tumors und seiner Umgebung. Wenn eine Metastase eines Primärtumors vorliegt, muss man in der Regel davon ausgehen, dass es sich um eine systemische Erkrankung handelt. „Systemisch“ bedeutet in diesem Fall, dass der Tumor das Ursprungsorgan verlassen hat und sich über das Lymphsystem, den Blutkreislauf und/oder durch kontinuierliches Wachstum im gesamten Körper verteilt hat. Für das systemische Stadium einer Tumorerkrankung ist es charakteristisch, dass die durch die bildgebenden Verfahren sichtbar gewordenen Manifestationen der Erkrankung (Metastasen in unterschiedlichen Organen) nur einen kleinen Teil der verstreuten Tumormasse ausmachen, so dass lokal begrenzte Maßnahmen wie eine Operation oder eine lokale Bestrahlungstherapie (auch wenn sie an mehreren Stellen gleichzeitig durchgeführt werden sollten) nicht mehr kurativ sein können. Typischerweise kommt es nach solchen Metastasenresektionen oder -bestrahlungen zu erneuten Manifestation von Metastasen an anderer Stelle, die sich aus zuvor mikroskopischen (also nicht sichtbaren) Tumorherden (Mikrometastasen) entwickelt haben. Ausnahmen gibt es aber immer wieder: In einigen wenigen Fällen – etwa beim Auftreten einer einzelnen Lungenmetastase eines vor mehr als zwei Jahren operierten Nierenzellkarzinoms – kann auch eine solche Metastasenresektion kurativ sein. Dann sollte die operative Entfernung der Metastase unbedingt den anderen palliativen Therapieoptionen vorgezogen werden. Beim metastasierten Hodenkarzinom geht man hingegen häufig so vor, dass die nach erfolgter Chemotherapie zurückbleibenden Residuen (Überbleibsel) operativ beseitigt werden. Hier handelt es sich aber im Vergleich zur zumeist palliativen Metastasenresektion eher um einen diagnostischen Eingriff – man will in erster Linie herausfinden, ob nach der Chemotherapie noch lebendes Tumorgewebe oder ausschließlich Nekrose (abgestorbenes Tumorgewebe) vorhanden ist, was sich aktuell durch bildgebende Verfahren nicht eindeutig klären lässt. Eine besonders aufwendige Operationsart stellt das sogenannte Debulcking dar. Es handelt sich hierbei um einen chirurgischen Eingriff, durch den bei spät diagnostizierten großen Tumoren und/oder bei großen Metastasen die Tumormasse vor anderen geplanten Therapiemaßnahmen – wie Bestrahlung und Chemotherapie – erst einmal operativ reduziert wird. Auf eine komplette Tumorentfernung wird hierbei bewusst verzichtet; durch die Reduzierung der Tumormasse erhofft man sich jedoch eine bessere Effektivität der Gesamttherapie. Auch umgekehrte Therapieansätze werden häufig praktiziert: Findet sich ein ausgedehnter Primärtumor, von dem man weiß, dass er im Allgemeinen sehr Strahlen- und/oder Chemotherapiesensibel ist, wird zur Verkleinerung des Tumors eine sogenannte neoadjuvante (vorgeschaltete) Strahlen- oder Chemotherapie durchgeführt und so versucht, die Operabilität des Tumors zu verbessern. Metastasenresektionen und Debulcking sind – anders als Primärtumorresektionen – in keinem Fall standardisierte Eingriffe und gehören daher in die Hände besonders geübter und erfahrener Operateure. Noch weniger standardisiert als die Metastasenchirurgie ist die Komplikationschirurgie, also die chirurgische Behandlung von Beschwerden und Schmerzzuständen, für die z. B. das Einwachsen von Tumoren in Nervengeflechte, Kompressionen von Strukturen98 oder akute Blutungen bei der Arrosion (dem „Annagen“) von Blutgefäßen durch den Tumor verantwortlich sind. Welche die in diesen Fällen beste Vorgehensweise ist, kann man überhaupt nicht verallgemeinern – zu unterschiedlich sind die Einzelsituationen. Was ich aber nachdrücklich empfehlen möchte: Sofern man in einer derartigen Situation Zeit hat, den behandelnden Arzt auszuwählen, sollte es der erfahrenste Operateur sein, den man bekommen kann. Mir ist durchaus bewusst, dass es sich gerade in solch schwierigen Situationen häufig um Notoperationen handelt und man nicht lange warten kann. Zumindest sollte jedoch die Klinik, an die man sich wendet, nach Möglichkeit eine Klinik der Maximalversorgung sein (das ist meistens die größte Klinik am Ort). Die gängigen operativen Maßnahmen für jede einzelne Tumorentität hier zu beschreiben würde den Rahmen dieses Buches bei weitem sprengen. Ich möchte aber noch einmal betonen, dass zum aktuellen Zeitpunkt der Trend hin zu deutlich kleineren Operationen und zur Institutionalisierung einer multimodalen Therapie geht. Als normalerweise wichtigste Therapiemaßnahme bei soliden Tumoren sollte eine Operation auch unbedingt unter Berücksichtigung des vorliegenden Tumorstadiums geplant werden. Die onkologischen Leitlinien (siehe in Kap. 2 Hilfe für Ärzte: Leitlinien), die für nahezu jede Tumorart existieren, geben den stadienadaptierten Umfang und den optimalen Zeitpunkt der operativen Maßnahme sowie weitere Therapieoptionen vor. Natürlich sollten all diese Entscheidungen zusätzlich auf den individuellen Tumor und den Patienten „zugeschnitten“ werden. 5.2 Bestrahlungstherapien: Bekämpfung durch Energie Am 8. November 1895 entdeckte der deutsche Physiker Wilhelm Konrad Röntgen die nach ihm benannte Röntgenstrahlung. Röntgen selbst nannte die Strahlung „X-Strahlung“, und in den Vereinigten Staaten wird weiterhin dieser Name – „x-ray“ – verwendet. Mithilfe der neu entdeckten Strahlung wurden bereits im selben Jahr Menschen zu diagnostischen Zwecken durchleuchtet. Im Folgejahr, 1896, berichteten die Ingenieure G. Stevens und O. Leppin unabhängig voneinander von sonnenbrandähnlichen Schädigungen der Haut nach solchen Durchleuchtungen. Die offensichtlich zerstörerische Wirkung der Röntgenstrahlung führte bald zu der Idee, sie bei der Behandlung von oberflächlichen Krebserkrankungen einzusetzen. Bereits 1899 führten die schwedischen Ärzte Thor Stenbeck und T. Sjögren die erste erfolgreiche Bestrahlungstherapie99 eines oberflächlichen Plattenepithelkarzinoms durch. Seit damals hat sich die Bestrahlungstherapie bösartiger Tumoren in vielen kleinen Schritten bis zum heutigen Standard entwickelt. Ihr Prinzip ist jedoch immer noch das Gleiche – Zerstörung von Krebszellen durch die Einstrahlung hochenergetischer Strahlung in den Tumorbereich. Wie bereits im Kapitel zur radiologischen Diagnostik erwähnt, führen energiereiche Strahlen zu Schäden am Erbgut. Diese Nebenwirkung der diagnostischen Radiologie wird in der Strahlentherapie therapeutisch genutzt. Tumorzellen teilen sich nämlich häufiger als normale Körperzellen, sind also von einer DNS-Schädigung auch stärker betroffen. Während der Zellteilung ist die DNS nämlich besonders anfällig für Störfaktoren; zusätzlich sind in dieser Phase zahlreiche Enzyme aktiv, die durch die Strahleneinwirkung ebenfalls Schaden nehmen. Außerdem haben die Tumorzellen deutlich schlechtere Reparaturmechanismen als normale Körperzellen und können eine energiereiche Bestrahlung nur schlecht kompensieren. Sie werden teilungsunfähig, und ihr Stoffwechsel wird lahmgelegt. Häufig werden die so geschädigten Tumorzellen dann vom Immunsystem erkannt und zerstört, oder sie leiten sogar ihren „Selbstmord“ 100 ein, von dem im Kapitel über die Stammzellen schon die Rede war. Eine Strahlentherapie wird von einem Strahlentherapeuten – also einem Arzt, der eine Weiterbildung zum Facharzt für Strahlentherapie absolviert hat – in Zusammenarbeit mit Medizinphysikern und medizinisch-technischen Assistenten durchgeführt. Strahlentherapeutische Abteilungen sind aufwendig und teuer; nicht jedes Krankenhaus verfügt über die erforderliche Ausstattung. Für gewöhnlich gibt es strahlentherapeutische Abteilungen nur an Universitätskliniken oder großen kommunalen Krankenhäusern101. Trotz der Anbindung der strahlentherapeutischen Abteilungen an eine Klinik werden die meisten Bestrahlungstherapien ambulant durchgeführt. Bestrahlungstherapien unterscheiden sich einerseits hinsichtlich der angewandten Strahlung: Man verwendet Röntgenstrahlung, Gammastrahlung, Elektronenstrahlung, Protonenstrahlung und Ionenstrahlung. Aber auch die Applikation der Strahlen kann auf unterschiedliche Weise stattfinden: Zumeist wird sie perkutan (also durch die Haut) durchgeführt – d. h., dass die Strahlen von außen auf die Tumorregion gelenkt werden. Diese Art der Therapie wird als Teletherapie bezeichnet. Gelegentlich werden jedoch auch interne Bestrahlungen durchgeführt – z. B. bei der Brachytherapie (radioaktive Quellen werden in den Tumor eingebracht und dort belassen), der Afterloadingtherapie (das ist eine hochdosierte Bestrahlung, wobei operative Hülsen in die Tumorregion eingebracht werden, die postoperativ nur kurzzeitig mit starken Strahlenquellen beschickt und anschließend komplett wieder entfernt werden), der intraoperativen Bestrahlung (dabei wird z. B. das Tumorbett während einer Operation mit einer mobilen Bestrahlungseinheit bestrahlt) oder, wie bereits bei der nuklearmedizinischen Diagnostik102 beschrieben, als intravenöse Verabreichung von Radiopharmaka. Die häufigste heutzutage in der Therapie maligner Tumoren verwendete Strahlenart ist die „ultraharte“ Röntgenstrahlung, auch als Photonenstrahlung bezeichnet. Photonen haben den Vorteil, dass sie Gewebe gut durchdringen können, so dass die energiereiche Strahlung auch tiefer gelegene Gewebeschichten erreichen kann – häufig liegen die Tumoren ja tief im Körperinneren. Der Nachteil von Photonenstrahlung liegt in der Gewebeschädigung der vor und hinter dem Tumor liegenden Bereiche. Um dies zu vermeiden, kann man entweder das Strahlenfeld durch bewegliche Blenden (Kollimatoren) einengen – in diesem Fall handelt es sich um eine sogenannte Konformationsbestrahlung – oder eine intensitätsmodulierte Strahlentherapie (IMRT) durchführen: Hierbei rotiert die Bestrahlungsquelle um den Patienten, und auch die Unterlage, auf welcher der Patient platziert wird, ist beweglich, so dass die Energieeinstrahlung aus verschiedenen Richtungen kommt. Bei einem solchen Vorgehen befindet sich der Tumor die ganze Zeit im Strahlenfokus – das benachbarte Gewebe bekommt jedoch deutlich weniger Strahlung ab. Die IMRT sollte heute absoluter Bestrahlungsstandard sein – ein Betroffener tut sicherlich gut daran, eine Klinik aufzusuchen, die solche modernen Bestrahlungsverfahren anbietet. Eine Weiterentwicklung der IMRT stellt die IGRT (Image Guided Radiotherapy) dar. Hierbei wird der Linearbeschleuniger (so wird das Gerät bezeichnet, welches die energiereiche Strahlung produziert) mit einer Röntgendurchleuchtung kombiniert, so dass das Bestrahlungsfeld und die Lage der umliegenden Organe unmittelbar vor und auch während der Bestrahlungstherapie kontrolliert werden können. Diese modernen Vorgehensweisen machten es möglich, dass die applizierten Strahlendosen in den letzten Jahren deutlich erhöht werden konnten, ohne dass sich die Nebenwirkungen der Therapie verstärkt hätten. Gängiges Prinzip der perkutanen Strahlentherapie mit Photonen ist bereits seit vielen Jahren die sogenannte fraktionierte Bestrahlung (eine in kleinen Einzeldosen applizierte Gesamtdosis). Soll ein Tumor beispielsweise mit 70 Gray bestrahlt werden, so wird diese Dosis nicht innerhalb einer einzigen Sitzung appliziert, sondern in kleine Fraktionen von 1,8 bis 2,5 Gray pro Tag „aufgeteilt“ – und aus Praktikabilitätsgründen meistens von Montag bis Freitag mit Pause am Wochenende verabreicht. Diese Therapie dauert mehrere Wochen lang. Die Fraktionierung hat den großen Vorteil, dass das im Strahlengang befindliche Normalgewebe weniger geschädigt wird (es regeneriert sich schneller als das „getroffene“ Tumorgewebe). Nur so ist es möglich, mit der perkutanen Bestrahlung Gesamtdosen einzustrahlen, die zu einer Tumorvernichtung ausreichen. Die Fraktionierung ist allerdings nicht bei allen Strahlenarten sinnvoll – bei einer Neutronenstrahlung hätte sie beispielsweise keinen gewebeschonenden Effekt. Gammastrahlung ist ebenfalls eine Art ionisierender Strahlung, die beim radioaktiven Zerfall verschiedener Nuklide (das sind bestimmte radioaktive Atomkerne) entsteht. Bei dieser Bestrahlungstherapie werden zumeist Cobalt-60-Nuklide und Telecobaltgeräte verwendet. Bis vor etwa 40 Jahren waren diese Geräte für die meisten strahlentherapeutischen Behandlungen in Verwendung. Da die Gammastrahlung eine vergleichsweise niedrige Energie aufweist und nur wenige Millimeter ins Gewebe eindringen kann, wird sie heute in erster Linie zur Behandlung von oberflächlich gelegenen Tumoren angewendet. Bei der Bestrahlung tiefer liegender Tumoren werden heute besser eindringende Bestrahlungsarten – z. B. mit Photonen – verwendet. Elektronenstrahlung (in der Medizin häufig auch als Betastrahlung bezeichnet) ist ein Teilchenstrom aus Elektronen, die ebenfalls in einem Linearbeschleuniger erzeugt werden und hier ihre hohe Energie erhalten. Der große Vorteil von Elektronenstrahlung besteht darin, dass relevante Energiemengen erst ab einer bestimmten Eindringtiefe der Strahlung im Gewebe abgegeben werden. Nach der maximalen Energieabgabe – idealerweise im Tumorzentrum – fällt die Energieabgabe ans Gewebe steil ab. Dies bedeutet, dass ein tiefliegender Tumor sehr gezielt bestrahlt werden kann und die vor und hinter ihm liegenden Gewebeanteile auch ohne Anwendung einer IMRT gut geschont werden können. Protonenstrahlung besteht aus den positiv geladenen Kernen von Wasserstoffatomen, deren Elektronenhülle entfernt wurde. Ähnlich verhält es sich bei der Ionenstrahlung (auch Schwerionenstrahlung genannt), die aus den Kernen von schwereren Atomen (z. B. Helium, Kohlenstoff oder Sauerstoff) besteht. Protonen- sowie Schwerionenstrahlung geben ihre maximale Energie, genau wie die Elektronenstrahlung, in bestimmten Gewebetiefen ab. Allerdings sind diese Strahlungsarten nicht leicht zu erzeugen und daher sehr kostspielig; ihr Einsatz ist nur in wenigen Großkliniken möglich (z. B. an der Universitätsklinik in Heidelberg). Bei der intraoperativen Bestrahlung wird im Rahmen einer Tumoroperation nach der Resektion (d. h. nach der Entfernung) des eigentlichen Tumors die Region, in der sich der Tumor befand (das „Tumorbett“), kurzzeitig hochdosiert bestrahlt. Durch dieses Vorgehen kann die in den meisten Fällen vorgesehene postoperative Strahlentherapie verkürzt werden, denn der normalerweise eingeplante, etwa fünf bis sieben Tage dauernde „Boost“ (die hochdosierte, fokussierte Bestrahlung) auf das Tumorbett entfällt. Dieses Vorgehen kommt beim Mammakarzinom der Frau häufig zur Anwendung. Manche Publikationen vermerken eine verringerte Rate von Lokalrezidiven (so wird das Wiederauftreten des Tumors am Ort seines ersten Erscheinens bezeichnet) sowie eine Reduktion der Nebenwirkungen bei dieser Art der Strahlentherapie. Bei der Brachytherapie103 wird die Strahlenquelle (meistens kurzstreckige Gammastrahler mit kurzer Halbwertszeit wie Iridium-192) – anders als bei der Telebestrahlung – direkt in den Tumor eingebracht und dort belassen, was auch als „Spickung“ bezeichnet wird. Durch die kurzstreckige Abgabe hoher Strahlendosen kann der Tumor punktgenau zerstört werden. Da die verwendeten Strahlenquellen nur eine kurze Halbwertszeit haben, können sie auch problemlos im Gewebe verbleiben. Allerdings sollte in den ersten Tagen nach einer Brachytherapie enger Körperkontakt mit anderen Personen (insbesondere mit Kindern und Schwangeren) vermieden werden. Die Afterloadingtherapie ist eine der Brachytherapie ähnliche Bestrahlungsart. Durch eine Operation werden Hülsen an mehreren Stellen der Tumorregion eingebracht, in die dann starke Strahlenquellen platziert werden. Nach einer intensiven Bestrahlung der Tumorregion (in der Regel nur wenige Minuten) werden sowohl die Strahlenquellen als auch die Hülsen wieder entfernt. Anschließend findet häufig noch eine ergänzende Teletherapie statt, die um den oben beschriebenen Boost reduziert werden kann. 5.3 Medikamentöse Therapien: Bekämpfung durch Gifte Die medikamentöse Therapie stellt den einzigen systemischen, das heißt über den gesamten Körper wirkenden Therapieansatz zur Bekämpfung von Krebs dar. Eine systemische Therapie ist immer dann notwendig, wenn der Tumor seinen Ursprungsort verlassen und in andere Organe (z. B. in Leber oder Lunge) oder Strukturen (z. B. in die Lymphknoten) expandiert ist. Lokalisierte Therapien wie Operationen oder Strahlentherapien, die immer nur am Applikationsort wirksam sind, können in solchen Fällen nur zur Behandlung von Symptomen (z. B. Schmerzen) oder als unterstützende Maßnahme einer Gesamttherapie sinnvoll eingesetzt werden. Zur Kuration führt eine isolierte lokale Maßnahme im systemischen Stadium der Erkrankung nicht. Noch bis vor wenigen Jahren beschränkte sich das Angebot medikamentöser Krebstherapien auf die Gabe von Hormonen bzw. Antihormonen (Wirkstoffe, die die Aktivität bestimmter Hormone hemmen) sowie von Chemotherapeutika. Im Laufe der letzten zehn bis fünfzehn Jahre hat die Krebsforschung neue, spezifischere medikamentöse Ansätze mit Antikörpern und kleinen synthetischen Molekülen104 zur Beeinflussung bestimmter Stoffwechselwege der Tumorzellen entwickelt. Insbesondere in der Weiterentwicklung dieser spezifischen Therapeutika scheint die Zukunft der Krebstherapie zu liegen. Im Folgenden möchte ich kurz darlegen, wie die verschiedenen medikamentösen Therapien funktionieren. Eine kleine Geschichte der Chemotherapie Am Anfang der Entwicklung der Chemotherapie stand der chemische Kampfstoff Schwefellost (Senfgas), der im Ersten Weltkrieg als Kampfgas eingesetzt wurde. Über die Wirkungsweise des tödlichen Gases war vorher nicht viel bekannt gewesen. Am 2. Dezember 1943 bombardierte die deutsche Luftwaffe den Hafen von Bari in Italien. Dabei wurde der mit Senfgasgranaten beladene US-amerikanische Frachter John Harvey getroffen und versenkt. Mehr als 1.000 Menschen waren dabei dem Kampfgas ausgesetzt und kamen zu Tode. Dr. Stewart Francis Alexander, ein amerikanischer Militärarzt und Experte in chemischer Kriegsführung, der den Zwischenfall untersuchte, nahm Autopsien105 der Opfer vor und stellte fest, dass es zu einem extremen Abfall der weißen Blutkörperchen (Leukozyten) im Blut und Knochenmark der Verstorbenen gekommen war. In seinem Bericht stellte Dr. Alexander die Theorie auf, dass Senfgas die Teilung von Körperzellen, die sich besonders schnell vermehren – was bei den Leukozyten der Fall ist – hemmt. Alexander äußerte in seinem Bericht nebenbei die Einschätzung, dass der chemische Kampfstoff aufgrund dieses Wirkmechanismus eventuell auch bei der Hemmung von sich schnell teilenden Tumorzellen effektiv sein könnte. Die amerikanischen Pharmakologen Louis S. Goodman und Alfred Gilman führten daraufhin Experimente mit dem weniger reizenden Stickstoff-Lost durch. In Zusammenarbeit mit dem Thoraxchirurgen Gustav Linskog verabreichten sie Patienten mit Lymphdrüsenkrebs (Lymphomen) Infusionen mit Chlormethin (einem flüssigen Stickstofflost-Derivat). Schon nach wenigen Gaben des Giftes zeigte sich ein dramatischer Rückgang der Lymphome. Allerdings wurde bereits während dieser ersten Untersuchungsreihe mit 66 Patienten deutlich, dass der Therapieeffekt nur von kurzer Dauer war und die Tumoren schnell in Form von Rezidiven wiederkehrten. Diese Rezidive sprachen nicht mehr auf die zuvor wirksame Therapie mit Chlormethin an – sie waren also gegen die Chlormethin-Therapie resistent geworden – und die Patienten verstarben an ihrer Tumorkrankheit. Goodman und sein Team veröffentlichten 1946 die Therapieerfolge der Behandlungsserie in einem wissenschaftlichen Artikel – die Chemotherapie war geboren. Parallel zu den Untersuchungen von Goodman, Gilman und Linskog versuchte der amerikanische Pathologe Sidney Faber im Children’s Hospital in Boston, eine Therapie für leukämiekranke Kinder zu entwickeln. Mit seinem Freund, dem Chemiker Yellapragada Subbarao, behandelte Faber im Sommer 1946 leukämiekranke Kinder mit Folinsäure, einer Substanz des Vitamin-B-Komplexes; dabei kam es zu einer deutlichen Verschlechterung ihrer Blutwerte. Die leukämischen Zellen im Blut waren keinesfalls reduziert worden, im Gegenteil: Es war zu einem schnellen und starken Anstieg der bösartigen Zellen und einer Verschlechterung des Zustands der jungen Patienten gekommen. Faber mutmaßte daraufhin, dass die Leukämiezellen sich eventuell durch einen Gegenspieler der Folinsäure – einem sogenannten Antifolat – in ihrem Wachstum hemmen ließen. Er bat Subbarao, der in seinem Labor über zahlreiche verschiedene Antifolate verfügte, ihm entsprechende Wirkstoffe für weitere Therapieversuche zur Verfügung zu stellen. Am 6. September 1947 begann Faber, den zweijährigen Leukämiepatienten Robert Sandler mit Pteroyl-Asparaginsäure, einem Antifolat, zu behandeln – ohne Erfolg. Der nächste Versuch mit dem Antifolat Aminopterin, den Faber am 28. Dezember desselben Jahres begann, führte innerhalb weniger Tage zu einer deutlichen Reduktion der Leukämiezellen im Blut des kleinen Patienten. Parallel zu diesem Abfall von Leukämiezellen kam es zu einer starken Verbesserung seines Allgemeinzustandes. Leider zeigte sich nach kurzer Zeit – wie vorher schon bei Goodmans Experimenten –, dass auch die Leukämiezellen rezidivierten und dann eine Resistenz gegen die Antifolat-Therapie entwickelten. Robert Sandler verstarb im Frühjahr 1948 nach nur wenigen Wochen des Ansprechens auf die neue Therapie. Nichtsdestotrotz hatten Goodman und Faber unabhängig voneinander und mit unterschiedlichen Substanzen etwas in der bisherigen Geschichte der Medizin Einmaliges erreicht: Das bösartige Wachstum von Tumoren konnte im gesamten Körper zumindest zeitweise durch die Applikation von chemischen Substanzen aufgehalten und sogar zurückgedrängt werden. Sidney Faber war von diesem Ansatz so überzeugt, dass er seine Forschungsarbeiten weiterhin der Entwicklung der Chemotherapie widmete. Trotz der zunächst nur kurzfristigen Erfolge der Chemotherapie entwickelte sich in den darauffolgenden Jahren eine aktive Forschung und mit ihr ein Milliardenmarkt für die aufblühende Pharmaindustrie. Zahlreiche Wirkstoffe mit zytotoxischer (die Krebszellen tötenden) und zytostatischer (das Zellwachstum der Krebszellen stoppenden) Wirkung wurden identifiziert und entwickelt – und meistens einzeln verabreicht, obwohl bereits in den ersten Veröffentlichungen zur Chemotherapie darauf hingewiesen wurde, dass die Gabe eines einzelnen chemotherapeutischen Wirkstoffes (also eine Monotherapie) den Krebs nicht heilen konnte, sondern allenfalls eine lebensverlängernde Wirkung hatte. Gewissheit in dieser Hinsicht gewann man erst gut zwanzig Jahre später. In den 1950er Jahren bildeten sich in den USA nationale Kooperationen zur Durchführung und wissenschaftlichen Evaluation von Krebstherapien. Berühmte Kliniken wie beispielsweise das National Cancer Institute in Bethesda, Roswell Park in Buffalo und die Children’s Hospitals in Buffalo und Boston schlossen sich für groß angelegte Studien zusammen. Erfahrene Onkologen wie Sidney Faber, Emil Freireich, Gordon Zubrod, Emil Frei, James Holland und Vincent De Vita, um nur einige zu nennen, planten umfangreiche Studien und behandelten die Patienten an den unterschiedlichen Kliniken nach einem genau vorgegebenen Schema. So konnten die Daten und Ergebnisse aller Patienten und Therapieformen zusammengefasst und ausgewertet werden. 1957 wurde erstmals eine Kombinationstherapie mit zwei verschiedenen Chemotherapeutika (6-Mercaptopurin und Methotrexat) an Kindern mit akuter lymphatischer Leukämie (ALL) durchgeführt. Zwei Arbeitsgruppen um Vincent De Vita und James Holland entwickelten 1963 und 1965 Kombinationsschemata mit mehreren unterschiedlichen Chemotherapeutika (also eine Polychemotherapie), die in einer bestimmten Abfolge appliziert wurden. Trotz der enormen Steigerung der Toxizität durch die Behandlung mit zwei oder mehreren Chemotherapeutika (was mit vielen Nebenwirkungen verbunden war) verzeichnete man in vielen Fällen langfristige Erfolge – erste Patienten überlebten den Krebs. Seit Ende der 1960er Jahre hat die Chemotherapie in erster Linie von den Verbesserungen der sogenannten supportiven (unterstützenden) Therapiemaßnahmen profitiert. Mit diesen Maßnahmen gelang es, belastende und teilweise tödliche Nebenwirkungen der Chemotherapie wie Übelkeit und Erbrechen, Anämie106, Gerinnungsstörungen des Blutes und eine übermäßige Infektanfälligkeit aufgrund von Beeinträchtigungen des Abwehrsystems effektiver zu behandeln. Durch die Verbesserung der supportiven Therapien konnten auch die chemotherapeutischen Substanzen stärker dosiert sowie die Anzahl der verabreichten Therapiezyklen erhöht werden.107 Dies führte in den vergangenen vierzig bis fünfzig Jahren zu effektiveren Chemotherapien, ablesbar an den besseren Überlebenszeiten und der besseren Lebensqualität der behandelten Patienten. Wie beschrieben, fußten diese Erfolge allerdings weniger auf der Entwicklung neuer Substanzen – das 1979 zugelassene Cisplatin und die Gruppe der sogenannten Taxane, deren erster Vertreter Paclitaxel 1993 zugelassen wurde, bildeten Ausnahmen – sondern eher auf der Verbesserung der unterstützenden Maßnahmen. Bei der Weiterentwicklung der Polychemotherapie etablierten sich neue Medikamentenkombinationen, die teilweise leicht verbesserte Ansprechraten, häufiger jedoch – ebenfalls begrüßenswert – eine im Vergleich zu älteren Kombinationen deutliche Reduktion der Nebenwirkungen zeigten. Auch bei den Erfolgen der Polychemotherapie war die Entwicklung neuer Substanzen also selten ausschlaggebend. Diese ernüchternde Tatsache ist dadurch zu erklären, dass es sich bei der Chemotherapie um eine sehr unspezifische Therapie handelt. Die Wirkstoffe greifen in unterschiedliche Prozesse der Zellteilung ein, so dass sie hauptsächlich Zellen zerstören, die sich durch eine schnelle Teilungsrate charakterisieren. Dieses Charakteristikum ist aber nicht nur Tumorzellen eigen, sondern auch vielen anderen, wichtigen Zelltypen unseres Körpers (z. B. Gerinnungsplättchen im Blut (Thrombozyten), Abwehrzellen (Leukozyten), Schleimhautzellen des Verdauungstraktes etc. Außerdem besteht ein bösartiger Tumor nicht ausschließlich aus Zellen, die sich schnell und häufig teilen – zumindest nicht zu jedem Zeitpunkt ihres Daseins. Jene Tumorzellen, die sich zur Zeit der Applikation der Chemotherapie in „Teilungsruhe“108 befinden, „überleben“ die chemische Attacke häufig unbeschadet, so dass aus ihnen zu einem späteren Zeitpunkt ein Rezidiv der Tumorerkrankung entstehen kann. Aufgrund ihrer hohen Mutagenität (der Neigung zu Mutationen), welche den normalen Körperzellen fehlt, entwickeln Tumorzellen wie bereits demonstriert häufig Resistenzen gegen die applizierten Chemotherapeutika. Wird derselbe Wirkstoff oder dieselbe Wirkstoffkombination bei der Rezidivbehandlung verwendet, ist seine zerstörerische Wirkung auf die Tumorzellen deutlich schwächer oder gar nicht mehr vorhanden – die Schädigung der normalen Körperzellen ist jedoch dieselbe wie bei der Erstgabe des Wirkstoffes. Aus diesem Grund wurden für zahlreiche Tumorarten sogenannte Erst-, Zweit- und Drittlinientherapien entwickelt, die aus immer neuen Wirkstoffkombinationen bestehen. Um auch die in Teilungsruhe befindlichen Tumorzellen mit der Chemotherapie zu „erreichen“, wurde außerdem das Therapiekonzept der sogenannten Erhaltungstherapie entwickelt. Hierbei werden nach der intensivierten Polychemotherapie (der sogenannten Induktionstherapie), welche in der Regel nur wenige Wochen oder Monate dauert, über einen viel längeren Zeitraum (wir sprechen von Monaten bis Jahren) kleine Dosen eines Chemotherapeutikums verabreicht, um früher oder später auch die quiescenten Tumorzellen (die irgendwann in den Teilungszyklus eintreten) zu zerstören. Durch dieses Vorgehen konnte die Chemotherapie in den vergangenen Jahrzehnten viele zusätzliche Erfolge verbuchen. Ein weiteres sehr wirksames Konzept ist die sogenannte adjuvante Chemotherapie. Nachdem ein solider Tumor operativ entfernt wurde, wird er histologisch klassifiziert. Zeigt sich dabei ein Stadium, welches erfahrungsgemäß (d. h. auf der Basis der statistischen Auswertung vieler Krankheitsverläufe) häufig mit lokalen oder systemischen Rezidiven einhergeht, wird nicht erst die Entstehung des Rezidivs abgewartet, sondern ohne Nachweis von weiteren (z. B. mikroskopischen) Tumormanifestationen eine Chemotherapie verabreicht. Dieses Konzept erwuchs aus der Vorstellung, eine kleine Anzahl von Tumorzellen (eine kleine „Tumorlast“) effektiver mit einer Chemotherapie (insbesondere wenn diese Chemotherapie-naiv sind) behandeln zu können. Nachteil dieses Vorgehens ist es, dass ein gewisser Teil der Patienten quasi umsonst behandelt wird, da überhaupt keine Tumorabsiedlungen vorliegen – statistische Daten treffen eben nicht auf jeden zu. Da sich jedoch die Prognose bei den riskanten Tumorstadien durch dieses Vorgehen verbessert hat, ist ein solches Vorgehen gerechtfertigt und sinnvoll. Hier muss aber unbedingt wieder der aufgeklärte und informierte Betroffene, der über sein Rezidivrisiko mit und ohne adjuvante Behandlung (natürlich immer auf Basis von statistischen Auswertungen) informiert ist, eine selbstbestimmte Entscheidung treffen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Chemotherapie durch neue Applikationskonzepte, durch bessere Supportivmaßnahmen und durch eine Vielzahl unterschiedlicher (jedoch nicht unbedingt neuer) Wirkstoffe eine effektive Therapie der metastasierten und fortgeschrittenen Krebserkrankungen darstellt. Trotzdem stehen Heilungen metastasierter Tumorerkrankungen durch Chemotherapie weiterhin nicht an der Tagesordnung; bei vielen Tumorerkrankungen im metastasierten Stadium kann aber eine deutliche Verlängerung der Überlebenszeit erreicht werden. Steht eine Entscheidung für oder gegen eine Chemotherapie an, sollte der Betroffene in erster Linie darüber aufgeklärt werden, ob sie mit kurativem oder palliativem109 Ziel verabreicht werden soll. Dieses Ziel ist für den Betroffenen der wichtigste Aspekt seiner Entscheidungsfindung und muss im Gespräch mit dem Arzt ausdrücklich festgehalten werden. Ist das nicht der Fall und hat der Patient also falsche Erwartungen, stellt die Einleitung einer aggressiven, potentiell lebensbedrohlichen Therapie meiner Meinung nach eine Körperverletzung dar. Hier müssen sich die Ärzte bewusst in ihrem „Therapieeifer“ zurücknehmen und ihren Patienten mehr mit Rat als mit Tat zur Seite stehen. Das genaue Wissen über das zu erwartende Ergebnis der Therapie in Verbindung mit den begleitenden Risiken ist die einzige akzeptable Basis, aufgrund derer ein Betroffener eine rationale Entscheidung treffen kann. Wie schon öfters betont, gibt es fast in jeder Situation mehrere Therapieoptionen. Eine weniger aggressive, dafür oft auch weniger effiziente Behandlungsmöglichkeit bei systemischen Krebserkrankungen bestimmter Tumorarten ist die Hormontherapie – sie wird gleich anschließend vorgestellt. Hormontherapie: Dem Tumor das Benzin abdrehen Schon vor Einführung der Chemotherapie wurde die Hormonabhängigkeit bestimmter Tumorarten erkannt und therapeutisch genutzt. Klassische Beispiele für homonabhängige Tumoren sind das Prostatakarzinom und das Mammakarzinom. Von vornherein sei gesagt, dass diese Tumoren hormonabhängig sein können, es jedoch nicht in jedem Fall sein müssen. Das bedeutet, dass die Hormonabhängigkeit des Tumors im Einzelfall untersucht und definiert werden muss – was für Pathologen heutzutage keine große Herausforderung darstellt. Ist ein Tumor hormonabhängig, so ist die Hormonbehandlung ein erfolgversprechender therapeutischer Ansatz. Den Effekt von Hormonen auf hormonabhängige Tumoren kann man sich etwa so vorstellen, dass jemand Benzin ins „Feuer“ des Tumorwachstums gießt: Das Tumorwachstum wird durch das entsprechende Hormon deutlich stimuliert. Durch den Entzug der Hormons bzw. dessen Blockade wird das Feuer zwar nicht gelöscht, es brennt jedoch mit kleinerer Flamme. Beim Prostatakarzinom ist in der Regel das männliche Sexualhormon Testosteron involviert. Schon im Jahre 1941 therapierten die amerikanischen Chirurgen C. Huggins und C. Hodges Patienten mit metastasierten Prostatakarzinomen, indem sie ihr Testosteron hemmten. Im Jahre 1966 erhielt Huggins für diese Untersuchungen den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin110. Bis heute bildet die Hemmung des Testosterons einen festen Bestandteil der Behandlung metastasierter Prostatakarzinome. Der Therapiealgorithmus111 beim Mammakarzinom beinhaltet die Hemmung der weiblichen Geschlechtshormone (Ö strogen und/oder Progesteron). Welche Geschlechtshormone medikamentös beeinflusst werden, richtet sich nach der präoder postmenopausalen112 Lebensphase der Patientin und nach der Hormonrezeptorausprägung im Tumorgewebe, welches nach Entnahme des Tumors vom Pathologen immunhistologisch untersucht wird. Auch zahlreiche andere Tumorarten wie z. B. das Schilddrüsenkarzinom oder das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs) sind hormonabhängig – und damit einer Hormontherapie zugängig, die meistens von weitaus weniger Nebenwirkungen begleitet wird als beispielsweise eine Chemotherapie. Wie ich schon schrieb, lohnt der hormonelle Therapieansatz aber nur, wenn eine entsprechende Hormonabhängigkeit des Tumors nachgewiesen ist. Da der Therapieeffekt einer Hormontherapie ausschließlich in einer Reduktion der Teilungsrate der Tumorzellen besteht (das Feuer brennt weniger heftig), kann bei alleiniger Hormontherapie nicht mit einer Heilung der Erkrankung gerechnet werden. Analog zur Resistenzentwicklung bei der Chemotherapie kann ein hormonabhängiger Tumor ab einem gewissen Zeitpunkt eine Hormonresistenz entwickeln: Die Tumorzellen sind durch Mutation nun in der Lage, selbst hormonähnliche Substanzen zu produzieren, oder sie benötigen schlichtweg das Hormon nicht mehr, um ein schnelles Wachstum aufrechtzuerhalten. In diesem Fall wachsen sie trotz Hormontherapie rasch weiter. Diesen Zeitpunkt gilt es zu identifizieren, damit rechtzeitig mit einer Ersatztherapie begonnen werden kann. Zielgerichtete Therapien: Kleinmolekulare Wirkstoffe für den großen Kampf Der Name dieser medikamentösen Therapie ist etwas irreführend, da im Prinzip jede Therapie zielgerichtet, also gegen eine bestimmte Erkrankung gerichtet ist. Hier ist aber etwas anderes gemeint: In den Krebszellen selbst wird ein bestimmtes Ziel definiert, auf das sich die zerstörerische Wirkung der verwendeten Substanz richtet. Krebszellen sind, wie bereits ausgeführt, entartete Körperzellen. Das bedeutet, dass auch Krebszellen ihre Wahrnehmung (aufgrund von Signalvermittlung), ihren Stoffwechsel, ihr Wachstum und ihre Ausbreitung mit den „Werkzeugen“ einer normalen Zelle bewerkstelligen. Diese Werkzeuge sind einerseits Signalübertragungswege (auch Signaltransduktionswege, engl.: signaling pathways) und andererseits Stoffwechselwege (Stoffwechsel = Metabolismus, engl.: metabolic pathways). Die Signaltransduktionswege sind definierte Abfolgen von Eiweißaktivierungen – häufig unter Einbeziehung eines Katalysators113 –, die zu bestimmten Stoffwechselreaktionen der Zelle führen. Häufig ist es das Schlüssel-SchlossPrinzip, mit dem wichtige Abläufe, z. B. bei der Signalübertragung vom Zelläußeren ins Zellinnere, vom Zellinneren in den Zellkern oder zwischen verschiedenen Zellen, ermöglicht werden. Den Schlüssel bezeichnet man in der Biologie als Ligand, das Schloss als Rezeptor. Die „Angriffsorte“ der zielgerichteten Therapien sind meistens diese Liganden und/oder Rezeptoren. Seit Jahrzehnten untersuchen Biochemiker, Molekularbiologen und viele andere Spezialisten die Abfolgen innerhalb der Signal- und Stoffwechselwege bei Tumorzellen und vergleichen sie mit den Abfolgen in Normalzellen.114 Wenn dabei bisher auch kein krebsspezifischer pathway gefunden wurde, so konnten doch Signal- und Stoffwechselwege identifiziert werden, die besonders wichtig für das Tumorzellenwachstum und dessen Ausbreitung im Körper sind und häufig auch eine gewisse Veränderung aufweisen. Besonders in den vergangenen fünf bis zehn Jahren wurde damit begonnen, die veränderten pathways von Tumorzellen als potentielle „Ziele“ einer medikamentösen Therapie zu etablieren. Die neuen Therapieoptionen, die aus diesen Bemühungen entstanden, werden deshalb als „zielgerichtete Therapien“ (englisch: „targeted therapy“) bezeichnet. Diese Therapieansätze haben es vor allem auf jene Signal- und Stoffwechselwege der Tumorzellen abgesehen, welche ihr Wachstum unterstützen. Durch sie werden zentrale Zellfunktionen unterbunden – etwa die Bildung neuer Blutgefäße zur Sauerstoffversorgung des Tumors (Angiogenese), die Prozesse des Zellwachstums und der Zellteilung (Proliferation) oder die Möglichkeit der Tumorzellen, durch das Ablösen von Zellverbindungen aus dem Zellverbund auszuscheren (Adhäsion)115 und Metastasen zu bilden. Ziel einer targeted therapy kann aber auch die Herstellung erhöhter „Aufmerksamkeit“ des Immunsystems für die Tumorzellen oder die Behinderung der „Abfallentsorgung“ in den Tumorzellen sein. In den vergangenen Jahrzehnten konnten zahlreiche veränderte pathways identifiziert werden, mit der Folge einer Vielzahl von vielversprechenden zielgerichteten Therapien. Die Wirkstoffe dieser Therapieform sind von unterschiedlichster Bauart. Hauptvertreter sind die weiter oben genannten kleinmolekularen Wirkstoffe116 (zumeist synthetisch hergestellte kleine Moleküle, die mit bestimmten Proteinen eines pathways reagieren) oder Antikörper (in diesem Fall ebenfalls zumindest teilweise synthetisch hergestellte, auf bestimmte Eiweiße der Reaktionswege fokussierende Immunglobuline). Für die kleinmolekularen Wirkstoffe hat sich die Namensendung -nib (erkennbar z. B. in Sorafinib, Pazopanib, Imatinib etc.) eingebürgert; für die therapeutisch genutzten Antikörper die Endung -mab (z. B. in Bevacizumab, Rituximab, Trastuzumab etc.). Mit der Entwicklung der zielgerichteten Therapien wollte man neben einer effektiveren Heilungswirkung vor allem die extremen Nebenwirkungen der nicht so zielgerichtet arbeitenden Chemotherapie vermeiden. Leider ist es so, dass sich das Nebenwirkungsspektrum zwar deutlich verschoben hat, jedoch weiterhin starke und behandlungsbedürftige Nebenwirkungen auftreten. Dies ist wahrscheinlich darin begründet, dass einerseits die als Zielscheibe ausgewählten Signal- und Stoffwechselwege für die Tumorzellen „lebenswichtig“ sein müssen, damit man durch ihre Blockierung den Tumor schwächen kann, dass andererseits jedoch die gleichen Signal- und Stoffwechselwege auch für die normalen Körperzellen wichtig sind und diese dadurch auch geschädigt werden. Aus diesem Grund haben die zielgerichteten Therapien bisher leider noch nicht den durchschlagenden Therapieerfolg erbracht, den man sich von ihnen versprochen hatte. In den letzten Jahren ist es aber bei vielen Tumorentitäten, bei denen zielgerichtete Therapieeinsätze in die Therapiekonzepte eingeflossen sind, häufig zu einer Verlängerung und Verbesserung des Therapieerfolges gekommen, wenn auch in den seltensten Fällen allein durch diese spezifischen Therapeutika. Daher werden die zielgerichteten Therapien heute häufig mit herkömmlichen Chemotherapeutika kombiniert. Diese Kombinationen führen insgesamt zu einer deutlichen Verbesserung der Therapieeffekte, allerdings mit dem Nachteil eines beträchtlichen, teilweise sogar erweiterten Nebenwirkungsspektrums. Hoffnung besteht aber weiterhin, denn die zielgerichtete Therapie von Tumorerkrankungen ist eine sehr junge Therapiemodalität, die meiner festen Überzeugung nach eine Menge Potential bietet. Daher ist es überaus sinnvoll, dass sich, trotz aller Schwierigkeiten, viele Wissenschaftler und Ärzte dieser vielversprechenden Forschungsrichtung widmen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die medikamentöse Therapie der unterschiedlichen Krebserkrankungen in den vergangenen zehn Jahren deutliche Fortschritte erzielt hat, auch wenn die erstmals vor über hundert Jahren von Paul Ehrlich117 eingeforderte „Magic Bullet“ – ein Wirkstoff, der dem Patienten nicht schadet, die Krankheit aber besiegt – noch immer nicht entdeckt wurde. Die voranschreitende Erforschung der Tumorbiologie lässt jedoch auf eine Steigerung der Wirkung medikamentöser Therapien in der näheren Zukunft hoffen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann man nur aus dem Repertoire der verfügbaren zielgerichteten Therapien schöpfen. Ihre Vor- und Nachteile, ihr Nebenwirkungsspektrum und die individuelle Situation des Betroffenen machen sie mehr oder weniger geeignet für den Betroffenen, und dieser muss sich völlig im Klaren darüber sein, welche Faktoren den Therapieerfolg bedingen und wie groß der zu erwartende Therapieerfolg überhaupt sein kann. Von der medikamentösen Therapie metastasierter und fortgeschrittener Tumorerkrankungen darf man sich aktuell noch keinerlei Wunder erhoffen – ich bin aber zuversichtlich, dass sich schon in naher Zukunft bedeutende Erfolge auf diesem Gebiet einstellen werden.