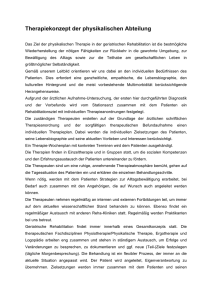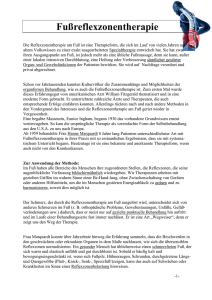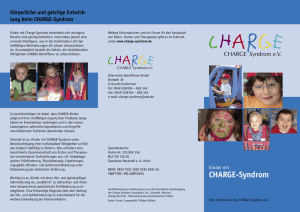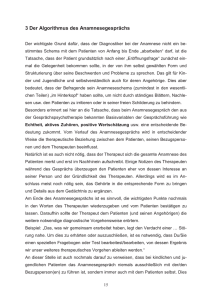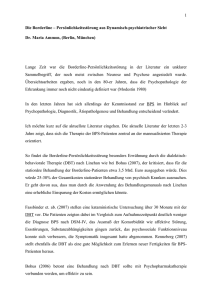Psychotherapiewissenschaftliche Forschung
Werbung

PSYCHOTHERAPIEWISSEN-SCHAFTLICHE FORSCHUNG AN DER SFU WIEN S CHWERPUNKTE , P ROFIL UND P ROJ EKTE Michael B. Buchholz Zusammenfassung: In einem ersten Schritt wird das psychotherapiewissenschaftliche Profil der SFU als Kombination von quantitativer und qualitativer Forschung beschrieben. Dies ergibt sich aus einer knappen Darstellung der Forschungslage. Sodann werden qualitative Methoden und ihr präziser Wert für die Untersuchung von therapeutischer Konversation, Narration und Metapher unter Hinweis auf Literatur dargestellt. In einem dritten Schritt wird beschrieben, wie die an der SFU bestehenden Ressourcen (Ambulanz, Studierende, Lehrende, externe Therapeuten und Experten) in das SFU spezifische Forschungsprofil kostengünstig eingebunden werden können. Zentral e Organisationspunkte bilden Forschungsgruppen, deren Zusammensetzung und Aufgaben herausgestellt werden. Das quantitative Forschungsziel wird am Projekt einer gesundheitsökonomischen Forschungsgruppe knapp präzisiert; das qualitative Forschungsziel wird umfangreich bei einem Projekt zur BorderlineKommunikation verdeutlicht. P SYCHOTHERAP IEWISSENS CHAFTLICHE F ORSCHUNG Seit mehreren Jahren artikulieren Stimmen prominenter Forscher in der Psychotherapie, zwischen qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden müsse verstärkt ein Gleichgewicht hergestellt werden, wolle man wirklich verstehen, was den therapeutischen Prozeß und das Zustandekommen therapeutischer Effekte ausmache. Strupp (1996) hatte die Rückkehr zu Einzelfallstudien gefordert, Henry (1998) – Mitautor der großen Vanderbilt-Studien in den USA – sah sogar die Gefahr einer Zerstörung therapeutischer Kompetenzen, falls die bestehende therapeutische Profession ausschließlich von evidenz-basierter Forschung dominiert werden sollte. Ähnlich äußerte sich kürzlich Jürgen Kriz (2004), Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie bei der deutschen Bundesregierung. Franz Caspar, Schüler von Grawe, formulierte in seinem bislang unveröffentlichten Beitrag auf dem Psychotherapeutentag in Giessen (September 2004) eine grundlegende Kritik an den Forschungsstrategien der „randomized controlled trials“ (RCT), wovon ein Punkt hieß, die RCT-überprüfbaren Variablen erfassten nicht mehr als etwa 20% der Varianz dessen, was in psychotherapeutischen Sitzungen geschehe. Ein anderer Kritikpunkt ist, daß die RCT-Strategie eine immer weiter gehende Manualisierung therapeutischer Methoden im Interesse der Aufrechterhaltung interner Validität fordere, während damit zugleich therapeutische Kompetenz, der „klinische Blick“ und die selbständige Entscheidungsbefugnis des Praktikers eingeschränkt, ja sogar nachweislich verschlechtert werde; der so geschaffene Konflikt zwischen interner und externer Validität mache deutlich, daß eine ausschließliche Orientierung an empirischen Standards den Anforderungen einer professionellen Praxis nicht genügen könne. Manualisierungen könnten nicht die Lösung sein, sondern sorgfältige Ausbildungen von Therapeutenpersönlichkeiten. In den USA ist eine heftige Diskussion zu dieser Frage entbrannt; die Strategie, therapeutische Methoden nur dann anzuerkennen, wenn sie „empirically supported“ (EST) seien, wird vehement und mit sehr guten Argumenten in Zweifel gezogen (Überblick bei Buchholz 2000). Ein Beispiel ist der Furore machende Beitrag von Drew Westen et al. (2004), auf den sich Caspar auch verstärkt bezog. Westen und seiner Mitautorinnen vertreten mit Nachdruck, daß eine 2 experiment-analoge Forschung in der Psychotherapiewissenschaft ihren Vorherrschaftsanspruch zugunsten von Forschung in „natural settings“ zurückzustellen habe. Der deutsche „Sachverständigenrat für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen“ (SVR) stellte bereits in seinem Bericht an die Bundesregierung (1999, S. 79) fest, daß selbst in der Medizin „nur etwa 4% aller ambulant und stationär erbrachten Dienstleistungen dem Anspruch auf belastbare Evidenz genügen, 45% genügen einfacheren Evidenzkriterien und für den ‚Rest’ (rechnerisch 51%) gibt es heute keine wissenschaftliche Evidenz“ (SVR 1999, S. 79). Der SVR schlug jedoch nun keineswegs eine Erhöhung der Prozentrate evidenzbasierter Dienstleistungen vor, sondern war zu der Einschätzung gelangt, wonach „das ätiologische Krankheitsverständnis einer Revision zugunsten eines konditionalen Krankheitsverständnisses, nach dem Krankheit wesentlich von den Lebensumständen, vom Lebensstil und der patientenseitigen Interpretation abhängt“ (SVR 1999, S. 68) Zwei Arten des Krankheitsverständnisses werden hier gleichberechtigt nebeneinander gestellt: ein ätiologisches, das sich an den naturwissenschaftlich erforschbaren Zusammenhängen des menschlichen Körpers orientiert und ein konditionales Krankheitsverständnis, das die Person des Patienten mit ihren Sinndeutungsregistern einbezieht. Es ist demnach nicht mehr sinnvoll, diese beiden Zugangsweisen gegeneinander auszuspielen, sie befinden sich vielmehr in einem komplementären Ergänzungsverhältnis. Innerhalb der Forschungsmethoden entspricht dem die Unterscheidung von quantitativer und qualitativer Forschung. Um sein Verständnis dieser Zusammenhänge noch prägnanter zu vertreten, hat der SVR ganz klar gestellt, dass evidenzbasierte Medizin der Ergänzung durch eine – wie es dort heißt – „narrative-based medicine“ (nbM) bedarf. Sie stützt sich nicht auf naturwissenschaftliche Evidenz, sondern auf Auslegung und Phänomenologie. Die Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse erhalte „ihren Sinn“ nämlich „erst in einem System völlig anderer Denk- und Bewertungsstrukturen, nämlich dem Leben des individuellen Patienten und dem gesellschaftlichen Umfeld“ (SVR, 1999, S. 66). Die Fähigkeit zu einer sinnvollen Integration von Erkenntnissen aus beiden Zugängen wird vom SVR als „case expertise“ beschrieben und deren Ausbildung bei Ärzten gefordert, nicht also nur die einseitige Ausrichtung auf naturwissenschaftliche Medizin. Zur „case expertise“ gehöre nicht nur „EBM“, also evidenzbasierte Medizin, sondern auch eine narrativ basierte Medizin, die als NbM abgekürzt wird. NbM muß v.a. die subjektiven Krankheitstheorien von Patienten berücksichtigen, weil diese Einfluß auf Krankheitsverhalten, compliance (Buchholz 2004) und Kooperation mit dem Arzt haben. „In der NbM wird ärztliches Handeln als ein deutender Vorgang betrachtet, der narrative Fähigkeiten erfordert, um die ‚Geschichten’ der Patienten und der Kliniker mit objektivierbaren medizinischen Befunden (z.B. Testergebnissen) zu verbinden. Die Akkumulation fallbezogener Erfahrungen (case expertise) befähigt den klinisch tätigen Arzt, bei der klinischen Entscheidungsfindung die angemessenste medizinische Maxime auszuwählen. Unter case expertise ist hierbei die Fähigkeit des Arztes zu verstehen, die Geschichten und die ‚Krankheitsskripte’ (aber auch die klinischen Anekdoten der Kollegen) zu verstehen und zutreffend zu deuten. Schwierigkeiten der Ärzte, wissenschaftliche Erkenntnisse im Kontext der klinischen Begegnung mit den Patienten angemessen umzusetzen, entstehen aus der Sicht der NbM vor allem dann, wenn das narrativ-deutende Paradigma aufgegeben wird und sich klinisches Handeln ausschließlich auf externe wissenschaftliche Evidenz stützt“ (SVR 1999, S. 67) Dieser deutlichen Forderung nach Ergänzung der Evidenzbasierung durch einen narrativverstehenden Zugang - wie er in verschiedenen Studien (Bauer-Wittmund 1996, Konitzer 1999, Schachtner 1999) mit qualitativen Mitteln am Beispiel der Untersuchung ärztlicher Aktivitäten belegt wurde - hat der Sachverständigenrat seinem nächsten Bericht noch einen weiteren prägnanten Akzent verliehen: "Angesichts der in vielen Studien belegten und erfahrungsgestützten Beobachtung, daß Deutungen, Erwartungen, Wunsch- und Zielvorstellungen des Patienten sowie weitere psychosoziale Faktoren im Informations- und Deutungsaustausch zwischen Patient und Arzt den Krankheitsverlauf maßgeblich mitsteuern, ist eine stärkere Beachtung der personalen Interaktion als Qualitätskriterium ärztlicher Interventionen erforderlich." (SVR 2000/2001) 3 Was hierfür die Medizin und ärztliche Praxis als erforderlich angesehen wird, darf wohl problemlos auch für eine im Entstehen befindliche Psychotherapiewissenschaft übernommen werden: Die Erforschung biographischer Narrative von Patienten ebenso wie die Fallgeschichten von Therapeuten und das sorgfältige Studium therapeutischer Interaktionen in naturalistischen settings muß einen Schwerpunkt einer psychotherapiewissenschaftlichen Forschung bilden, die sich auf der Höhe der Zeit bewegt. Hinzu kommt eine Evaluation therapeutischer Maßnahmen, die sich partiell standardisierter Methoden der quantitativen Forschung bedienen muß, um Zusammenhänge zwischen Prozeß und outcome feststellen zu können. Auch eine Kooperation mit neurowissenschaftlichen Methoden etwa zur Synchronisation von neuronalen Erregungsmustern bei Therapeut und Patient gehört in das breite Spektrum einer psychotherapiewissenschaftlichen Forschungsgesamtkonzeption. Das kann hier im Detail nicht beschrieben werden, der Schwerpunkt soll hier zunächst bei der knappen Darstellung qualitativer Methoden liegen. QUALITATIVE METHODEN Diese Methoden haben neuerdings erheblichen Rückhalt in der community der Psychotherapieforschung erhalten. Überblicksarbeiten konnten zeigen (Frommer, Langenbach, Streeck 2004; Rennie 2004, Streeck und Frommer 2003, Frommer und Rennie 2001), daß qualitative Forschungsmethoden erhebliche Erkenntnisgewinne in verschiedenen Sektionen der Psychotherapieforschung ermöglichten. Insbesondere bei der Untersuchung bestimmter therapeutischer Aktivitäten wie der Deutung und deren Vorbereitung hat eine qualitative Arbeit (Peräkylä 2004) beachtliche Befunde ermitteln können, indem der Autor zeigte, wie der Therapeut Strukturgleichheiten aus Kindheit, aktueller Übertragungsbeziehung und Schilderungen der außertherapeutischen Beziehungen zusammen“schaut“, diese Strukturgleichheiten heraushebt und sie dann dem Patienten gegenüber als eine Deutung seiner eigenen Aktivität formuliert. Auch hier kam es dem Autor auf den methodischen Dreischritt von Äußerung des Patienten – Reaktion des Therapeuten – Antwort des Patienten an. Diese finnische Studie, mit den methodischen Mitteln der sog. Konversationsanalyse betrieben zeigt, daß die Vorbereitung einer Deutung geschieht, indem der Therapeut Strukturgleichheiten zwischen drei verschiedenen Situationen herstellt: der narrativen Schilderung einer Beziehung des Patienten zu einer Figur der außertherapeutischen Welt, zu einer Kindheitsbegebenheit und zur aktuellen Beziehung in der therapeutischen Sitzung selbst. Fallen diese drei Momente zusammen, kann eine therapeutische Wirkung mit gleichsam geringem Kraftaufwand erreicht werden. Das ist bemerkenswert deshalb, weil hier das von Menninger beschriebene „Dreieck der Einsicht“ gefunden wird und zugleich mit dem Begriff einer „Szene“ gearbeitet wird, wie ihn Alfred Lorenzer (1970) symbol- und sprachtheoretisch entwickelte. Es ist anzunehmen, daß finnische Behandler die Texte von Lorenzer nicht kennen, aber umso beachtlicher, daß ihre Praxis dem entspricht. Beachtlich ist auch, daß „interaktive Szenen“ in Studien, die die Entwicklung von Primatenbabies mit menschlichen Babies vergleichen, als Grundlage für Spracherwerb und „kulturelle Vererbung“ (Tomasello 2002, Donald 1990) angesehen werden. Interaktion und ihre Verdichtung bzw. Weiterentwicklung hin zu höheren Niveaus der Intersubjektivität ist das Ziel einer jeden Psychotherapie, wie der prominente Säuglingsforscher Daniel Stern (2004) in seiner Theorie des „present moment“ nachhaltig unterstreicht. Zu deren Untersuchung bietet die Video-Technik erhebliche Vorteile, die einem Quantensprung in der Forschung gleichkommen; es ist wahrscheinlich kein Zufall, daß „baby-watcher“ wie Trevarthen, Stern, Tronick, Beebe und Lachmann und viele andere zu ihren bahnbrechenden Befunden erst kommen konnten, nachdem sie von dieser Technologie Gebrauch machten, die andererseits in einem anderen Feld, der Methodologie der Konversationsanalyse, ebenfalls in Gebrauch gekommen war. Konversationsanalyse ist eine im Gefolge von Harvey Sacks (Jefferson 1992, Silverman 1998) seit den 1970er Jahren entwickelte präzise Beobachtung konversationeller Abläufe, die sich zunächst mit Fragen der Gesprächsorganisation befasste – wie wird das Rederecht („turn- 4 taking“) übergeben (Atkinson und Heritage 1984), wie werden Gespräche beendet oder eröffnet, wie werden gemeinsame thematische Relevanzen festgelegt. Die baby-watcher würden hier von „shared focal attention“ sprechen. Kurz, es geht darum, wie gemeinsame „Welten“ durch „Konversation“ hergestellt werden und wie beständig im Gespräch darauf verwiesen wird, daß man sich noch „im gleichen Film“ befindet. Diese Forschungsmethodik ist auf psychiatrische Interviews und Gesprächsführungspraxis (Bergmann 1980, 1985) angewandt worden und auf viele andere therapeutisch relevante Gebiete, etwa auf die Übermittlung von Diagnosen (Heath 1992) im Fall von körperlichen Erkrankungen, auf die Handhabung des Widerstands (Buchholz 1992, Streeck 1995), auf die Vermittlung moralischer komplexer Standpunkte in Beratungskontexten (Bergmann, Goll, Wiltschek 1998), auf die Mitteilung von Träumen (Buchholz 2000). Methodisch ähnelt sie den Beobachtungsmethoden der baby-watcher. Während die konversationsanalytischen Autoren ihren Schwerpunkt eher auf formale Abläufe der Interaktionsorganisation legen, heben die Arbeiten zur therapeutischen Narration die Bedeutung sowohl biographischer Lebensinhalte als auch subjektiver Krankheitstheorien hervor. Die Arbeiten dazu sind Legion und können hier nicht im Einzelnen aufgeführt werden. Mehr und mehr hat sich jedoch herausgestellt, daß in solchen Narrativen einer rhetorischen Figur, der Metapher, eine besondere Bedeutung zukommt. Metaphern wirken als „Attraktoren“, ihnen kommt eine mächtige organisierende, handlungsleitende, affektregulierende und identitätsbestimmende Kraft zu. Es macht einen Unterschied, ob jemand zum Ausdruck bringt, daß er sein Leben als Last oder als Spiel metaphorisiert. Es macht einen Unterschied, ob er AIDS als „Risiko“ oder als „Gefahr“ auffasst, denn einmal kann er selbst Einfluß nehmen, das andere mal ist er eher hilflos ausgesetzt (Hahn, Eimbter, Jacob 1996). Es macht einen Unterschied, ob jemand seine Ehe als eine Art geschäftliches Unternehmen oder als spirituelle Reise auffasst und wenn Menschen mit solchen unterschiedlichen metaphorischen Konzepten sich begegnen, sind Konflikte programmiert (Eckert, Hahn, Wolf 1989, Quinn 1982, Quinn, Newfield, Protinsky 1985). Die sich in Metaphern artikulierende kognitive Welt- und Selbstauffassung hat die Aufmerksamkeit der kognitiven Linguistik (Lakoff und Johnson 1998, 1999) gefunden, die einen erheblichen Einfluß auf therapeutische Konzeptualisierungen nahmen (Buchholz 1996/2003, Cox und Theilgaard 1987). Mit den neuartigen Konzeptualisierungen durch die Kognitive Linguistik konnten weltweit erstmalig therapeutische Metaphern analysiert werden und dies auch an einem größeren Textkorpus (Buchholz und von Kleist 1997). Eigene Arbeiten mit der neu entwickelten Metaphernanalyse an konkretem Transkriptmaterial (Buchholz 1996/2003) therapeutischer Dialoge sowie an den Transkriptionen von Supervisionssitzungen (Buchholz und Hartkamp 1997) und an Interviews mit stationären Patienten und ihren Therapeuten (Buchholz und v. Kleist 1997) machten, ebenso wie die metaphernanalytischen Untersuchungen an Therapietranskripten deutlich, daß hier empirisch vieles genau „unter die Lupe“ (Wolff 1994) gelegt werden kann und so in den Blick gerät, was kategorialen Auswertungsverfahren (wie ZBKT, SASB) entgeht. Ein Vergleich dieser kategorialen Verfahren mit den genannten qualitativen Methoden am Beispiel ein und desselben Therapietranskripts (Buchholz 1995) ergab sogar, daß die kategorialen Verfahren „aufgeben“ mussten, weil sie die Komplexität des Geschehens in einer Supervisionsgruppe im SASB-System nicht abbilden konnten. Dies wurde von den Vertretern der entsprechenden Verfahren während mehrerer Tagung zur Qualitativen Psychotherapieforschung erfreulicherweise umstandslos zugestanden. Mit qualitativen Methoden - zur Konversation, Narration und zur Metapher - liegen also bereits erhebliche Erfahrungen vor. Qualitative Verfahren erweisen sich als die Methode der Wahl, will man Narration und Interaktion untersuchen. Auch hier stehen verschiedene Varianten zur Verfügung, über die hervorragende Handbücher (Flick, v. Kardorff et al. 1991, König und Zedler 1995, Meloy 1994) praxisnah informieren. Solche Verfahren haben vor allem einen Vorteil (Buchholz und Streeck 1999): sie werden als kliniksnah empfunden, sensibilisieren enorm für die subtilen Feinheiten 5 interaktiver Abstimmungen bzw. von deren Scheitern und erweisen auf diese Weise gleichsam „nebenbei“ einen beachtlichen Nutzen bei der Ausbildung von angehenden Therapeuten. Zugleich werden diese in einer anerkannten Forschungsmethode geschult, was den Studenten der neuen Universität helfen sollte, ihre Abschlussarbeiten in qualitativer Empirie anzufertigen. GRUNDLAGEN DER FORSCHUNGSPRAXIS AN DER SFU WIEN Ein so ausgerichtetes psychotherapiewissenschaftliches Forschungsprofil der SFU muß v.a. dafür Sorge tragen, daß die entsprechenden Materialien erhoben werden können. Zwei Arten von Daten müssen miteinander kombiniert werden: Quantitative und qualitative Daten. Quantitative Daten sollten im Rahmen der Ambulanz, wo Studierende ihre Behandlungen unter Supervision ausführen, routinemäßig erhoben werden. Dazu gehört eine umfangreiche Eingangsdiagnostik mit einem zu entwickelnden Dokumentationsbogen (enthält Daten zum Überweisungskontext, Beruf, Alter, Mit- und Vorbehandlern, Diagnose nach ICD oder DSM, eine Einschätzung der Schwere der Störung). Hier könnte auf vorhandene Erfahrungen zurückgegriffen werden; ich habe ein Dokumentationssystem bereits mitentwickelt (Sachsenröder et al. 1993). Weiter sollten die Patienten einen Beschwerdebogen (v. Zerssen) und die Symptom-Check-List (SCL-90) ausfüllen; über weitere Instrumente sollten unter Gesichtspunkten der Forschungsökonomie und der Zumutbarkeit für Patienten spätere Entscheidungen getroffen werden. Diese Daten dienen der Erfassung des Ausgangszustandes vor Behandlungsbeginn und sie sollten am Ende der Behandlung, ggf. zu späteren Katamneseuntersuchungen herangezogen werden können. Qualitative Daten sind in erster Linie textlicher Natur, aber auch Videographien. Zur Produktion textlicher Daten werden Studierende verpflichtet, wenigstens 8 von ihnen selbst durchgeführte therapeutische Sitzungen vom Tonband abzuschreiben; die Überprüfung der Genauigkeit erfolgt durch einen zweiten Studierenden, der gegenzeichnet. Die so entstehenden Transkripte werden in eine Text-Datenbank analog zu der in Ulm bestehenden eingespeist und stehen verschiedenen Forschungsgruppen sowohl der SFU als auch von außerhalb zur Verfügung, gegen Dokumentationsnachweis und datenrechtliche Sicherheitsverpflichtungen. Jedes Transkript wird mit Signen unter Trennung von Klar- und Codenamen der Patienten und Therapeuten versehen, so daß es unter „Stichworten“ wieder aufgefunden werden kann. Dazu gehören mindestens das Datum der Aufzeichnung, Transkribent und Gegenleser, Diagnose, eine kurze Zusammenfassung der Stunde, die Anzahl der therapeutischen Sitzung und weitere, im einzelnen noch zu bestimmende Merkmale. Hier wird die Zusammenarbeit mit Erhard Mergenthaler von der Ulmer Textbank wünschenswert und möglich sein. Um auch Transkripte von therapeutischen Sitzungen mit erfahrenen Therapeuten zu erhalten, werden diese zu Kooperationen gebeten. Sie können an Forschungsgruppen teilnehmen, wenn sie wenigstens zwei (den genannten Bedingungen entsprechende) Transkripte in die Datenbank einspeisen. Die Zustimmung ihrer Patienten zu organisieren, liegt in ihrer Hand. Vergleichbare Überlegungen gelten für die videographierten Daten. Hier ist lediglich die Anschaffung der technischen Voraussetzungen (Videoanlage) erforderlich sowie die besondere schriftliche Zustimmung der Patienten, denn auf dem Video bleiben sie identifizierbar. Größere rechtliche Probleme sollten sich hier nicht ergeben. Grundsatz muß sein: wer von den Patienten sich nicht aufzeichnen lassen möchte, kann und wird nicht dazu gezwungen. FORSCHUNGSGRUPPEN Die Auswertung der Daten erfolgt in verschiedenen Forschungsgruppen, die sich mit je bestimmten Zielen zusammensetzen und über längere Zeit, teils mit Drittmitteln unterstützt, organisieren. An Forschungsgruppen nehmen teil 6 Studierende, insbesondere jene, deren Behandlungen untersucht werden; aus ihrer Teilnahme sollen Abschlussarbeiten entstehen - Lehrende Methodiker – qualitativ und/oder quantitativ. Aus ihrer Teilnahme sollen Forschungsberichte entstehen - Erfahrene Therapeuten aus dem Umfeld der SFU, die sich durch Einbringen eigener Transkripte zur Teilnahme berechtigt haben. Aus ihrer Teilnahme sollen klinisch anregende Berichte an die therapeutische Profession gelangen - Zusätzliche „Berater“, über deren Teilnahme jede Forschungsgruppe im einzelnen entscheidet. Aus ihrer Teilnahme sollen Kooperationen mit externen Institutionen entstehen. Forschungsgruppen konstituieren sich mit spezifischen, aber durchaus weit gefassten Aufgaben für längere Zeit; Studierende müssen dabei evtl. wegen ihres Abschlusses ausgewechselt werden können. - EIN QUANTITATIVES PROJEKT Ein Projekt aus dem Bereich der quantitativen Daten, das von einer Forschungsgruppe initiiert werden sollte, kann hier nur grob skizziert werden: Bekannt ist, daß gesundheitsökonomische Daten über die Wirkungen von Psychotherapie fast nicht verfügbar sind. Die Studie der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigungn (DPV) unter der Federführung von Leuzinger-Bohleber hat kürzlich mit ersten Veröffentlichungen dazu begonnen (Leuzinger-Bohleber, Stuhr et al. 2001, Beutel, Rasting et al. 2004). Die erheblichen Schwierigkeiten bei der Erfassung und Abgleichung von Versicherten-Daten bei den Kassen erhellt daraus, daß bei der ursprünglichen Datenerhebung der DPV-Studie 1201 Patienten im screening einbezogen waren, letztendlich aber nur von 41 Patienten vollständige VersichertenDatensätze erhoben werden konnten. Es wäre außerordentlich verdienstvoll, wenn hier eine Kooperation zwischen der SFU und Experten der Versicherungen langfristig aufgebaut und gesichert werden könnte, die endlich verlässlich die ökonomischen Wirkungen von Psychotherapie erfassen könnte. Dazu gehören Veränderungen der Inanspruchnahme von ärztlichen Kontakten durch Versicherte vor und nach Psychotherapie, Reduzierung von Arbeitsausfalltagen, Medikamentengebrauch, Krankenhausaufenthalte (nicht unfallbedingt) sowie weitere Variablen. Die Forschungsgruppe sollte diese Daten nach Möglichkeit diagnosespezifisch erheben. Die Details eines solchen Projekts sind von immenser statistischer, aber auch rechtlicher Komplexität, das sie hier nicht ausgearbeitet werden können. Aber ein Forschungsschwerpunkt an der SFU sollte durchaus hier liegen. Ein qualitatives Projekt soll im folgenden freilich in den Details beschrieben werden. Es dient so konkret wie möglich der Veranschaulichung der ins Auge gefassten Forschungsstruktur an der SFU. Es bezieht sich auf Borderline-Kommunikation, kann aber in analoger Weise auf andere Problemstellungen therapeutischer Interaktion übertragen werden. EIN QUALITATIVES PROJEKT: BORDERLINEKOMMUNIKATION Zur Ausgangslage: Das klinische Bild der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) ist gekennzeichnet von einem durchdringenden Muster der schwierigen Affektregulierung, scheiternder Impulskontrolle, hoher Instabilität in menschlichen Beziehungen und einem schwankenden Selbstbild. Die DSM-IV-Definition bezieht sich auf „a pervasive pattern of instability of mood, interpersonal relationships, self-image and affects and marked impulsivity“ (APA 1994). Nach dem DSM-III müssen von 9 Kriterien der BPS wenigstens 5 erfüllt sein. Skodol et al. (2002) haben darauf hingewiesen, daß auf diese Weise 151 Kombinationen entstünden, während es rein rechnerisch hingegen 256 Kombinationen sind (Bateman und Fonagy 2004). Das hat zur Folge, 7 daß die gleiche Diagnose an Personen vergeben werden kann, die überhaupt nur ein einzelnes gemeinsames Merkmal aus dieser Liste haben, eine Situation, die jeden Diagnostiker zutiefst unbefriedigt lassen muß. Auch ist dieser hohe Grad an Heterogenität ein Hindernis für die psychopathologische Forschung, die nicht mehr sicher sein kann, was miteinander verglichen wird. Kernberg (1977) hat dieser Situation mit dem „Strukturellen Interview“ abzuhelfen versucht, doch liegen keine Reliabilitätsstudien dazu vor. Die Prävalenzrate der BPS schwankt nach unterschiedlichen Angaben zwischen 0,2% und 1,8% (bezogen auf die Gesamtbevölkerung); die meisten Studien stammen hierzu aus den USA. Eine norwegische Studie (Torgersen et al. 2001) erbringt hingegen nur 0,7%. Bezogen auf klinische Institutionen liegen die Prävalenzraten jedoch wesentlich höher. Unter den ambulant behandelten Patienten wird diese Diagnose nach unterschiedlichen Befunden an 8-11% der Patienten vergeben, bei stationär aufgenommenen Patienten sind es 14-20%, von forensischen Patienten erhalten 60-80% diese Diagnose (Blackburn et al. 1990, Dolan und Coid 1993). Das klinische Bild wird meist in einer charakteristischen Weise beschrieben, indem auf „Weltsicht“ und „Kognition“ dieser Patienten eingestellt wird: Borderline-Patienten denken in Schwarz-Weiß-Schemata, sie halten die Welt für gefährlich und böswillig, sich selbst für machtlos und gefährdet. Eine ihr Selbstkonzept deutlich prägende Überzeugung ist die, wertlos und total unannehmbar zu sein. Von ihrer Biographie teilen sie typischerweise mit, in Gefahren gelebt zu haben (Schläge, Unfälle), sich immer noch als kleines Kind zu fühlen und nicht genügend versorgt worden zu sein: „niemand war für mich da“. Hier gibt es eine beachtliche Koinzidenz der Befundlage aus Kognitions- und Bindungsforschung. Die Behauptung nämlich, „niemand war für mich da“, wird durch die Bindungsforschung gestützt. Nickell et al. (2002) fanden, daß ein charakteristisches Muster bestehend aus Fehlen von Besorgtheit, bei gleichzeitiger „overprotection“ durch die Mutter und ein ängstlich-ambivalentes Bindungsmuster – am meisten mit der Borderline-Diagnose kovariierte. Da die Bindungstheorie für frühkindlich erworbene Bindungsmuster eine hohe Stabilität über die Zeit postuliert, sollte man erwarten, daß hier ein stabiler Befund erhoben sei. Dem ist mitnichten so. Denn dem steht wiederum entgegen, daß andere Autoren die BorderlineDiagnose als eine charakteristische Ausweitung an sich „normaler“ Persönlichkeitsmerkmale ansehen, wie z.B. Feindseligkeit, Narzißmus, emotionale Dysregulation, Abhängigkeit von Belohnungen, Unlustvermeidung usw. Untersucht man die Stabilität der Diagnosen über mehrere Jahre (McDavid und Pilkonis 1996), muß man feststellen, dass die Stabilität der Diagnose selbst mit den Erhebungsmethoden stärker variiert als einem lieb sein kann. Bateman und Fonagy (2004, S. 9) schreiben: „In general, the stability of BPD has a strong inverse relationship with the length of follow-up“. Je später der zweite Meßzeitpunkt erfolgt, umso weniger stabil ist die Diagnose. Es ist deshalb kein Wunder, daß manche Forscher zum Borderline-Phänomen seufzen, die Störung sei ebenso instabil wie die Befundlage zu ihrer Erforschung. DIE THERAPEUTISCHE PRAXIS Dennoch bleibt bei erfahrenen Klinikern das Gefühl, einen Borderline-Patienten unabhängig von diagnostischen Kategorien oder Dimensionen gleichsam „riechen“ zu können. Spricht man mit ihnen über ihre Erfahrungen mit solchen Patienten, dann teilen sie relativ homogen mit, daß sie unter Streß geraten, daß sie sich vor der nächsten Sitzung leicht ängstigen, nicht wissen, ob sie ihre Wut, die sie zugleich als deutlich induziert erleben, beherrschen können und ob sie überhaupt etwas werden ausrichten können. Borderline-Patienten scheinen demnach ein hohes interaktives Potential anderen Menschen gegenüber zu haben. Diese Beobachtung legt es nahe, den beschriebenen diagnostischen Unschärfen abzuhelfen, indem man sich auf die interaktive Praxis von Borderline-Patienten auch von der Forschungsseite her verstärkt einstellt. Dazu soll das hier vorgeschlagene Projekt dienen. In Umkehrung der gewohnten Praxis könnte man meinen, Borderline-Patienten sind versierte, aber verdeckte „Streß-Interviewer“; es ist nicht der Therapeut, der seinen Patienten unter Streß 8 setzt, um verdeckte Persönlichkeitsanteile hervorkommen zu sehen, sondern es ist umgekehrt der Borderline-Patient, der seinen Therapeuten unter Streß setzt und bei diesem die Angst auslöst, nicht „gut“ zu sein, daß also seine negativsten Eigenschaften hervor gekitzelt werden könnten. Charakteristisch aber für solche Gespräche mit therapeutischen Kollegen ist auch, daß diese meist nicht anzugeben wissen, wie eigentlich ein Patient dies macht. Therapeuten können zwar über diese Effekte berichten oder ihre Techniken des Selbst- und Affektmanagement darstellen (Kernberg empfahl einmal in einem Vortrag, man solle sich getrost vorstellen, wie man seinen aggressiven Patienten „aus dem Fenster wirft“, damit man weiter ruhig zuhören könne; dabei allerdings ließ er offen, wie eine solche imaginative Selbstberuhigungstechnik, so hilfreich sie sein mag, mit einer gleichzeitig geforderten Gegenübertragungsanalyse zu vereinbaren sein könnte). Die Wirkungen beim oder auf den Therapeuten sind, so scheint es, immer klar – aber wie sie erzielt werden, was der Patient genau sagt, wie er es sagt und auf welche Weise er den Therapeuten in Verwirrung und komplizierte Affektlagen stürzt, bleibt in den meisten Fällen dubios und kaum zu eruieren. Hinzu kommt, daß Therapeuten deshalb auch meist nicht zu berichten wissen, was sie ihren Patienten eigentlich gesagt haben. Mitchell (1997) hat die einschlägigen Fallberichte gesichtet und dabei lediglich Formeln der Art gefunden, daß dem Patienten „sein Verhalten gedeutet“ oder „mit ihm darüber gesprochen“ worden sei. Nie wird genau beschrieben, wie behandelt wurde. Auch dieser Befund verweist auf einen beträchtlichen Mangel bei der Wahrnehmung und Handhabung des interaktiven Potentials des Boderline-Patienten. Hier gibt es eine echte Forschungslücke. Das ist deshalb interessant, weil eine Arbeit von Shaw (2004) neuerdings gezeigt hat, daß Therapeuten über ihre körperlichen Reaktionen sehr genaue Auskunft geben können und diese als „receiver“ für latente Botschaften ihres Patienten einzusetzen vermögen. Aber über das interaktive Geschehen während der Sitzung wissen sie, wie auch Meyer (1990) schon auffiel, wenig. Luborsky (2001) hatte gezeigt, daß Therapeuten nur geringe Prozentanteile dessen erinnern und als relevant schildern können, was verglichen mit einem Tonbandmitschnitt tatsächlich während einer Stunde geschehen ist. Diese sowieso schmale Fähigkeit zur präzisen Erinnerung an das interaktive Geschehen scheint unter dem Streß der Borderline-Interaktion weitgehend verloren zu gehen und muß deshalb als passagère, therapeutenseitige Symptombildung aufgefaßt werden. Das ist Therapeuten unter dem Streß nicht vorzuwerfen. Vielmehr scheinen sie sich in einer double-bind-ähnlichen Beziehungsfalle zu befinden. Wenn sie emotional engagiert bleiben, geraten sie unter immensen Streß, wenn sie sich emotional distanzieren, können sie kaum noch hilfreich sein. Die Beforschung der interaktiven Potenz des Borderline-Patienten muß deshalb danach trachten, Lösungen für die therapeutische Praxis insbesondere dieser Beziehungsfalle zu erreichen. Die klinischen Konzepte sind bislang nicht unbedingt geeignet, hier hilfreich weiter zu wirken. Insbesondere kann das, was mit „projektiver Identifizierung“ beschrieben wird, als Phänomen wohl nicht bestritten werden; immer wieder macht jeder Kliniker die Erfahrung, daß er höchst intensiv einen Affektzustand erlebt, von dem sich nach und nach herausstellt, daß es sich um einen einst dissoziierten Selbstzustand seines Patienten handelt, den dieser beim Therapeuten „deponiert“ hatte. Auch hier freilich bleibt vollkommen unklar, wie und auf welche Weise genau das eigentlich geschieht. Denn ein Selbstzustand ist kein „Ding“, das man beim anderen tatsächlich „deponieren“ könnte; diese anschauliche Metaphorik ist in diesem Fall eher Ausdruck der beobachtenden Hilflosigkeit, die nicht anzugeben vermag, was auf der interaktiven Ebene genau geschieht. Wer dieser Lage abhelfen möchte, tut danach gut daran, sich von einer immer verfeinernden Diagnose individueller Persönlichkeitsanteile nicht mehr die Lösung zu erhoffen, sondern eher von einer sorgfältigen und genauen Beachtung der Borderline-Interaktion und BorderlineKommunikation. 9 ZIELE Die Ziele des hier zu skizzierenden Forschungsprogramms ergeben sich aus dieser Befundlage: 1. Sicherung des Befundes: Interviews mit Therapeuten über ihre Erfahrungen mit Borderline-Patienten. Dieses Ziel gehört zu den Vorarbeiten. 2. Genaue und umfangreiche Materialsicherung von typischen Borderline-Äußerungen, Schilderungen und kommunikativen Verwirrungen durch Transkription therapeutischer Sitzungen 3. Registrierung der transkribierten therapeutischen Reaktionen 4. Registrierung der Antworten des Patienten auf die therapeutischen Reaktionen. 5. Anhand der Antworten des Patienten kann ein Überblick erlangt werden, welche therapeutischen Reaktionen welche Wirkungen erreichen und wie sie diese erreichen. Ein Borderline-Interaktiosmuster (BIM) besteht somit aus drei interaktiven „Zügen“ bzw. Komponenten: a) Äußerung des Patienten, b) Reaktion des Therapeuten c) Antwort des Patienten. 6. Aufstellung eines Inventars von verschiedenen BIMs und deren klinische Bewertung 7. Sensibilisierung von auszubildenden Therapeutinnen und Therapeuten für diese Interaktions- und Kommunikationsmuster (BIM) durch geeignete Fortbildungsangebote 8. Evaluation, ob so ausgebildete Therapeuten diese Muster rascher erkennen und sie als typisch wahrnehmen mit der Folge, gelassener darauf reagieren und therapeutisch handeln zu können METHODE An der Ausbildungsinstitution der Sigmund-Freud-Privatuniversität werden von Auszubildenden auch Borderline-Patienten unter Supervision behandelt. Das sichert die Diagnose; Patienten von Auszubildenden werden meist auch von erfahrenen Behandlern interviewt. Die Auszubildenden werden verpflichtet, im Rahmen ihrer Ausbildung, nicht nur Protokolle ihrer Behandlungssitzung anzufertigen, sondern genaue Transkripte von Tonbandaufzeichnungen ihrer therapeutischen Gespräche. Auf diesem Wege sollten pro Jahr etwa 40 Transkripte angefertigt werden können. Erfahrene Kollegen können ihrerseits gebeten werden, solche Transkripte anzufertigen, die mit denen der Ausbildungsteilnehmer in einen Text-Datenpool zusammen fliessen, wobei jedes Transkript individuell mit einem Signum des Behandlers, des Patienten und dem Aufnahmedatum sowie weiteren Kennzeichen versehen wird. Eine Forschungsarbeitsgruppe – bestehend aus - den Therapeuten, die das jeweilige Transkript angefertigt haben, den Weiterbildungsteilnehmern, die sich an diesem Projekt beteiligen sowie Anleitern, die über Erfahrung in der Textanalyse verfügen Und erfahrenen Klinikern macht sich mit den Methoden der Qualitativen Forschung (s.o.) bekannt. Voraussetzung der Teilnahme für Studenten an einer Forschungsarbeitsgruppe ist, daß entsprechende Kurse im Studium absolviert wurden. Sind etwa 40 transkribierte Sitzungen hinsichtlich der Suche nach den drei Komponenten der BIM in der Arbeitsgruppe analysiert, wird vermutlich ein Sättigungsgrad erreicht sein; das bedeutet, neue Befunde scheinen sich nicht zu ergeben. An diesem Zwischenstopp hat die Gruppe die Aufgabe, die gefunden Muster zu sammeln und den Versuch zu machen, sie zu ordnen. 10 MÖGLICHE ERGEBNISSE So gewonnene Ergebnisse haben naturgemäß ein anderes Format als in der quantitativen Forschung, die ihre Befunde in Form von statistischen Clustern präsentieren kann. In der qualitativen Forschung sieht die Befunddarstellung anders aus, hier werden Muster (der Interaktion, des Narrativs, des Metapherngebrauchs) beschrieben und untersucht, ob und inwieweit sie eine Ordnung oder ein Ordnungssystem bilden. Eine solche Ordnung kann etwa die Definitionsmacht des Borderline-Patienten beschreiben und insbesondere die Art und Weise, wie er sie beansprucht. Dazu liegt bereits eine Studie von Streeck (2001) vor. Ein anderes Muster kann den Kampf um das Rederecht beschreiben, wer wem in welcher Weise ins Wort fällt und dabei zugleich dem anderen die „Schuld“ für die „Unhöflichkeit“ zuweist. Ein weiteres Muster könnte Rechtfertigungsstrategien beschreiben oder die Eskalation zur gegenseitigen Schuldzuweisung, die in solchen Behandlungen nicht selten ist. Auf therapeutischer Seite könnten Strategien der Vermeidung, der ungewollten Eskalation, des ängstlichen Rückzugs, der Erpressbarkeit, der Beruhigung usw. beobachtet und in ihren interaktiven Feinheiten genau beschrieben werden. Dabei kommt es hier an dieser Stelle noch nicht darauf an, diese therapeutischen Reaktionen bereits vollständig aufzulisten, sondern hier muß eine Anschauung von der Art der zu erwartenden Ergebnisse genügen in der Erwartung, daß auch noch ganz andere therapeutische Reaktionen gefunden werden können. In einem weiteren Schritt werden die gefundenen Muster zu einer übergeordneten Theorie gebündelt; dieser Schritt entspricht der axialen Codierung in der „Grounded Theory“. WEITERE PRÜFSCHRITTE Der nächste Schritt überprüft diese Theorie und die Muster an neuem Transkriptionsmaterial von etwa 20 therapeutischen Sitzungen. Sollte sich ergeben, daß neue Muster gefunden werden, muß die Theorie modifiziert und die selektive Codierung, die der Ermittlung der BIM dient, fortgesetzt werden. Wenn die Theorie hingegen „gesättigt“ ist, also vorläufig keine neuen Muster gefunden werden können, sondern lediglich neue Beispiele für bekannte Muster, beginnt der nächste Schritt. Therapeuten werden mit dieser Theorie und ihren Beispiel-Mustern vertraut gemacht; dabei werden sie zunächst um Stellungnahmen gebeten. Wenn sie ihrerseits solche Muster validieren können und in ihnen einen Wert für die klinische Praxis erkennen können, beginnt die Arbeit einer weiteren Gruppe (die z. T. aus den Mitgliedern der qualitativen Forschungsgruppe bestehen kann), ein Fortbildungsprogramm zu entwerfen, damit jüngere therapeutische Kolleginnen und Kollegen darin geschult werden können. Im letzten Schritt werden die von den so geschulten Therapeuten durchgeführten Therapien mit Borderline-Patienten einer Evaluation unterzogen. Diese Evaluation kann mit StandardMeßmethoden der Psychotherapieforschung erfolgen. Dem Vorschlag von Westen et al (2004) folgend, kann eine Gruppe von Therapeuten eine speziell für die Beobachtung von BIMs ausgerichtete Supervision erhalten, eine andere Gruppe von Therapeuten arbeitet ohne diese Supervision. Aus dem Vergleich beider Gruppen resultiert dann eine Ermittlung der speziellen Effektstärke von BIM-geschulten Therapeuten. Ein solches vergleichendes design soll auch Auskünfte darüber geben, ob eher BIM-spezifische oder unspezifische Interventionen für die erzielten Effekte verantwortlich zu machen sind. Zusätzlich wären wiederum von den supervidierten und nicht-supervidierten Therapiesitzungen Transkripte anzufertigen, die einer weiteren qualitativen Analyse unterzogen werden können. 11 LITERATUR Atkinson, J.M.;Heritage, J. (Hrsg.): Structures of Social Action New York (Cambridge University Press (Auflage von 1992)) 1984. Bateman, A.;Fonagy, P.: Psychotherapy for Borderline Personality Disorder Oxford/New York (Oxford University Press) 2004. Bauer-Wittmund, T.: Lebensgeschichte und subjektive Krankheitstheorien Frankfurt (Verlag für akademische Schriften) 1996. Bergmann, J.R.: Interaktion und Exploration: Eine konversationsanalytische Studie zur sozialen Organisation der Eröffnungsphase von psychiatrischen Aufnahmegesprächen Konstanz (Unveröff.Diss.) 1980. Bergmann, J.R.: Flüchtigkeit und methodische Fixierung sozialer Wirklichkeit: Aufzeichnungen als Daten der interpretativen Soziologie Aus: Bonß, W.;Hartmann, H. (Hrsg.): Entzauberte Wissenschaft. (Sonderband 3 der `Sozialen Welt') Göttingen 1985. Bergmann, J.R.;Goll, M.;Wiltschek, S.: Sinnorientierung durch Beratung? Funktionen von Beratungseinrichtungen in der pluralistischen Gesellschaft Aus: Luckmann, T. (Hrsg.): Moral im Alltag. Sinnvermittlung und moralische Kommunikation in intermediären Institutionen Gütersloh (Bertelsmann) 1998. Beutel, M.E.;Rasting, M.;Stuhr, U.;Rüger, B.;Leuzinger-Bohleber, M.: Assessing the Impact of Psychoanalytic and Long-Term Psychoanalytic Therapies on Health Care Utilization and Costs In: Psychotherapy Research, 14. Jg. (2004), S. 146-160. Blackburn, R.;Crellin, M.;Morgan, E.;Tulloch, R.: Prevalence of personality disorders in a special hospital population In: Journal of forensic psychiatry, 1. Jg. (1990), S. 43-52. Buchholz, M.B.: Arbeit am Widerstand. Eine qualitative Analyse kommunikativer Codes In: Forum Psychoanal, 8. Jg. (1992), S. 217-237. Buchholz, M. B.: Psychotherapeutische Interaktion. Qualitative Studien zu Konversation und Metapher, Geste und Plan Opladen (Westdeutscher Verlag) 1995. Buchholz, M.B.: Metaphern der `Kur'. Qualitative Studien zum therapeutischen Prozeß (2. Auflage) Giessen (Psychosozial Verlag) 1996/2003. Buchholz, M.B.: Die Traumerzählung in der familientherapeutischen Sitzung In: Psychother. Soz., 2. Jg. (2000), S. 129-141. Buchholz, M. B.: Effizienz oder Qualität? Was in Zukunft gesichert werden soll In: Forum der Psychoanalyse, 16. Jg. (2000), S. 59-80. Buchholz, M.B.;Hartkamp, N. (Hrsg.): Supervision im Fokus - Polyzentrische Analysen einer Supervision Opladen (Westdeutscher Verlag) 1997. Buchholz, M.B.;Kleist, C.v.: Szenarien des Kontakts - Eine metaphernanalytische Untersuchung in der stationären Psychotherapie Gießen (psychosozial) 1997. Buchholz, M. B.; Streeck, U.: Qualitative Forschung und professionelle Psychotherapie In: Psychother. Soz., 1. Jg. (1999), H. 1, S. 4-30. Cox, M.;Theilgaard, A.: Mutative Metaphors in Psychotherapy. The Aeolian Mode London/New York (Tavistock Publications) 1987. Dolan, B.M.;Coid, J.: Psychopathic and Antisocial Personality Disorders: Treatment and Research Issues London (Gaskell) 1993. Donald, M.: Origins of the Modern Mind. Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition Cambridge, Mass./London (Harvard University Press) 1991. Eckert, R.;Hahn, A.;Wolf, M.: Die ersten Jahre junger Ehen. Verständigung durch Illusionen Frankfurt/New York (Campus) 1989. Flick, U.;Kardorff, E.v.;Keupp, H.;Rosenstiel, L.v.;Wolff, S. (Hrsg.): Handbuch Qualitative Sozialforschung München (Psychologie Verlagsunion) 1991. Frommer, J.;Langenbach, M.;Streeck, J.: Qualitative Psychotherapy Research in German-Speaking Countries In: Psychotherapy Research, 14. Jg. (2004), S. 57-76. Frommer, J.;Rennie, D.L. (Hrsg.): Qualitative Psychotherapy Research. Methods and Methodology Lengerich (Pabst) 2001. Hahn, A.;Eirmbter, W. H.;Jacob, R.: Krankheitsvorstellungen in Deutschland. Das Beispiel AIDS Opladen (Westdeutscher Verlag) 1996. Heath, C.: The delivery and reception of diagnosis in the general-practice consultation Aus: Drew, P.;Heritage, J. (Hrsg.): Talk at Work. Interaction in institutional settings Cambridge (University Press) 1992. Henry, W.P.: Science, Politics and the Politics of Science: The Use and Misuse of Empirically Validated Treatment Research In: Psychotherapy Research, 8. Jg. (1998), S. 126-140. Jefferson, G. (Ed.): Harvey Sacks - Lectures on Conversation Oxford/Cambridge (Blackwell) 1992. Kernberg, O.F.: Boundaries and Structure in Love Relations In: J. Amer. Psychoanal. Assoc., 25. Jg. (1977), S. 81114. 12 König, E.;Zedler, P. (Hrsg.): Bilanz Qualitativer Forschung. Band I: Grundlagen qualitativer Forschung Weinheim (Deutscher Studien Verlag) 1995. Konitzer, M.: Zur interaktiven Bedeutung der komplementären Verfahren in der hausärztlichen Praxis Frankfurt/Berlin/New York (Peter Lang) 1999. Kriz, J.: Methodologische Aspekte von "Wissenschaftlichkeit" in der Psychotherapieforschung In: Psychother. Soz., 6. Jg. (2004), S. 6-32. Lakoff, G.;Johnson, M.: Leben in Metaphern - Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern Heidelberg (CarlAuer) 1998. Lakoff, G.;Johnson, M.: Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought New York (Basic Books) 1999. Leuzinger-Bohleber, M.;Stuhr, U.;Rüger, B.;Beutel, M.: Langzeitwirkungen von Psychoanalysen und Psychotherapien, Eine multiperspektivische, repräsentative Katamnesestudie Aus: Bohleber, W.;Drews, S. (Hrsg.): Die Gegenwart der Psychoanalyse - die Psychoanalyse der Gegenwart Stuttgart (Klett-Cotta) 2001. Lorenzer, A.: Sprachzerstörung und Rekonstruktion. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1970. Luborsky, L.;Diguer, L.;Andrusyna, T.;Friedmann, S.;Tarca, C.;Popp, C.A.;Ermold, J.;Silberschatz, G.: A Method of Choosing CCRT Scores In: Psychotherapy Research, 14. Jg. (2004), S. 127-134. McDavid, J.D.;Pilkonis, P.A.: The stability of personality disorder diagnosis In: Jorunal of Personality Disorders, 10. Jg. (1996), S. 1-15. Mitchell, St. A.: Influence and Autonomy in Psychoanalysis Hillsdale, NJ (The Analytic Press) 1997. Nickell, A.D.;Wandby, C.J.;Trull, T.J.: Attachment, parental bonding and borderline personality disorder features among young adults In: Jorunal of Personality Disorders, 16. Jg. (2002), S. 148-159. Peräkylä, A.: Making Links in Psychoanalytic Interpretations: A Conversation Analytical Perspective In: Psychotherapy Research, 14. Jg. (2004), S. 289-307. Quinn, N.: Commitment in American marriage: A cultural analysis In: American Anthropologist, 9. Jg. (1982), S. 775-798. Quinn, W.H.;Newfield, N.A.;Protinsky, H.O.: Rites of Passage in Families with Adolescents In: Family Process, 24. Jg. (1985), S. 101-111. Rennie, D.L.: Anglo-North American Qualitative Counseling and Psychotherapy Research In: Psychotherapy Research, 14. Jg. (2004), S. 37-56. Sachsenröder, R.; Seidler, G. H.; Schöttler, B.; Buchholz, M. B.; Streeck, U.: Die Erfassung relevanter Daten in der psychoanalytisch orientierten stationären Psychotherapie - das Tiefenbrunner Dokumentationssystem In: PPmP Psychother. Psychosom. med. Psychol., 43. Jg. (1993), S. 133-139. Schachtner, C.: Ärztliche Praxis. Die gestaltende Kraft der Metapher Frankfurt (Suhrkamp) 1999. Shaw, R.: The Embodied Psychotherapist: An Exploration of the Therapists' Somatic Phenomena Within the Therapeutic Encounter In: Psychotherapy Research, 14. Jg. (2004), S. 271-288. Silverman, D.: Harvey Sacks - Social Science and Conversation Analysis New York (Oxford University Press) 1998. Skodol, A.E.;Gunderson, J.G.;Pfohl, B.;Widiger, T.A.;Livesley, W.J.;Siever, L.J.: The borderline diagnosis I: psychopathology, comorbidity and personality and personality structure In: Biological Psychiatry, 51. Jg. (2002), S. 936-950. Stern, D.N.: The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life New York/London (W.W. Norton & Company) 2004. Streeck, U.: Die interaktive Herstellung von Widerstand In: Zsch. psychosom. Med., 41. Jg. (1995), S. 241-252. Streeck, U.;Frommer, J.: Qualitative Forschung in der Psychotherapie im deutschsprachigen Raum In: Z Psychosom med Psychoanal, 49. Jg. (2003), Strupp, H. H.: Nachhaltige Lektionen aus der psychotherapeutischen Praxis und Forschung In: Psychotherapeut, 41. Jg. (1996), S. 84-87. Tomasello, M.: Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens. Zur Evolution der Kognition Frankfurt (Suhrkamp) 2002. Torgersen, S.;Kringlen, E.;Cramer, V.: The prevalence of personality disorders in a community sample In: Archives of General Psychiatry, 58. Jg. (2001), S. 590-596. Westen, D.;Novotny, C.M.;Thompson-Brenner, H.: The Empirical Status of Empirically Supported Psychotherapies: Assumptions, Findings, and Reporting in Controlled Clinical Trials In: Psychol. Bull., 130. Jg. (2004), S. 631-663. Wolff, S.: Innovative Strategien qualitativer Sozialforschung im Bereich der Psychotherapie Aus: Buchholz, M.B.;Streeck, U. (Hrsg.): Heilen, Forschen, Interaktion. Psychotherapie und qualitative Sozialforschung Opladen (Westdeutscher Verlag) 1994.