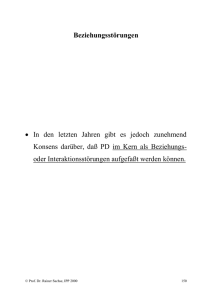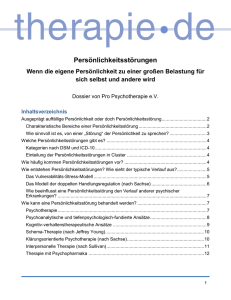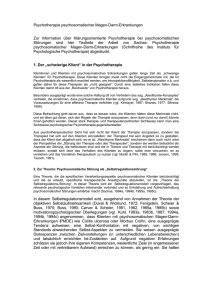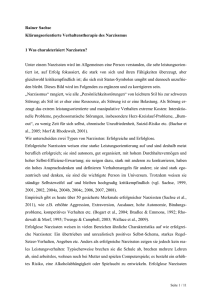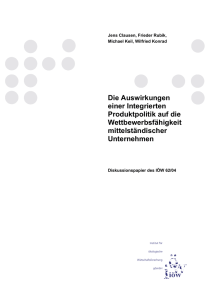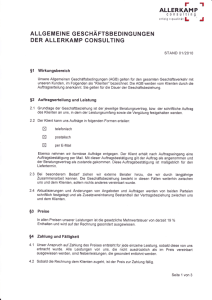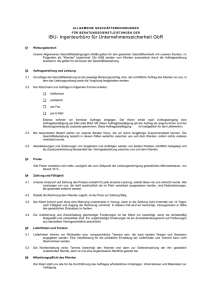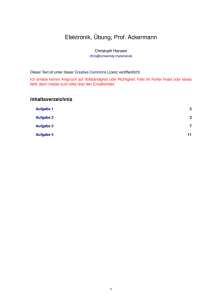Störung
Werbung

Einführung 1. Grundsätzliches zu Persönlichkeitsstörungen © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 1 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? Persönlichkeitsstörungen (PD) sind im DSM auf Achse II codiert. Das macht schon deutlich, dass PD ganz andere Arten von Störungen sind als z.B. Ängste oder Depressionen. Wie wir sehen werden, müssen Therapeuten auch ganz andere Arten von Interventionen und Strategien anwenden, um PD effektiv zu behandeln. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 2 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? Persönlichkeitsstörungen (PD) lassen sich allgemein definieren als Beziehungsstörungen. Personen mit PD weisen bestimmte Arten von – Beziehungsmotiven, – Beziehungs-Schemata, – dysfunktionalem Interaktionsverhalten, – manipulativem Interaktionsverhalten auf. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 3 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? Personen mit PD weisen komplexe Verarbeitungsund Handlungsmuster auf. Man kann jedoch davon ausgehen, dass der Kern der Störung eine Störung auf der Beziehungsebene ist. Daher ist der Ausdruck „Persönlichkeitsstörungen“ auch nicht mehr zeitgemäß. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 4 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? Personen mit PD zeigen ein charakteristisches Interaktionsverhalten. Dieses Interaktionsverhalten haben sie in ihrer Biographie erworben. Dieses Interaktionsverhalten bringen die Klienten auch in die therapeutische Beziehung ein. Dieses Interaktionsverhalten ist auch charakteristisch anders als das von „Achse-IKlienten“. Dieses Interaktionsverhalten stellt sehr hohe Anforderungen an Therapeuten und macht Klienten mit PD zu „schwierigen Klienten“. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 5 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? So kann es z.B. sein, dass Klienten mit PD – dem Therapeuten Verantwortung für ihre Veränderungen übergeben; – dem Therapeuten „Doppelbotschaften“ senden, z.B.: „Helfen Sie mir – lassen Sie mich in Ruhe.“ – den Therapeuten in eine (nicht-therapeutische) Beziehung verwickeln oder – den Therapeuten massiv auf Distanz halten. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 6 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? Die Interaktionsschwierigkeiten der Klienten manifestieren sich dabei auf unterschiedliche Weise: – Es sind Klienten, die sich (meist von Anfang an) anders verhalten als Klienten mit Achse-IStörungen des DSM, also z.B. Klienten mit Angststörungen, mit affektiven Störungen usw. – Es sind Klienten, die Therapeuten oft an die Grenzen ihrer therapeutischen Fähigkeiten führen. – Es sind Klienten, die Therapeuten oft auch an die Grenzen ihrer persönlichen Belastbarkeit führen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 7 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? – Es sind Klienten, die oft hohe Ansprüche an die Therapie und den Therapeuten stellen, ohne aber dem Therapeuten deutlich zu machen, was denn genau in der Therapie passieren soll. – Es sind Klienten, die oft dem Therapeuten deutlich machen, dass er ganz schnell etwas tun soll, denen es aber nicht recht ist, wenn er etwas tut. – Es sind Klienten, die Therapeuten oft hilflos machen, verärgern, an ihren Fähigkeiten zweifeln lassen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 8 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? – Es sind Klienten, für die Therapeuten oft nicht gut genug und nicht richtig ausgebildet sind. – Und es sind oft Klienten, mit denen bestimmte Therapeuten gar nicht arbeiten sollten, weil diese Klienten ständig eigene Schemata des Therapeuten aktivieren und die dem Therapeuten deshalb unsympathisch, unerträglich u.ä. sind und auf die sich der Therapeut daher gar nicht einstellen kann. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 9 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? Klienten mit PD sind Klienten, die im Wesentlichen Interaktionsprobleme aufweisen und die diese Interaktionsprobleme in die Therapie mitbringen. Sie haben diese Interaktionsprobleme also nicht „für den Therapeuten erfunden“. Da die Klienten Interaktionsprobleme aufweisen und der Therapeut ein Interaktionspartner ist, wird der Therapeut schnell von einem Experten zu einem Teil des Problems. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 10 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? Darauf sind Therapeuten aber oft nicht vorbereitet und viele Therapieformen enthalten gar keine Regeln dafür, wie man als Therapeut mit einer solchen Situation umgeht. So sind nicht nur die Klienten schwierig, sondern es sind auch die Therapeuten schlecht vorbereitet: Zu einem Interaktionsproblem gehören immer (mindestens) zwei! © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 11 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? Deutlich wird dabei auch: Die Therapeuten/Therapeutinnen haben mit diesen Klienten – „technische Probleme“: Sie wissen nicht, wie sie mit diesen Klienten umgehen sollen, sie finden keine Arbeitsaufträge, keine Ziele, keine wirksamen Interventionen; die Klienten machen die Therapeuten/Therapeutinnen hilflos. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 12 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? – „persönliche Probleme“: Therapeuten/Therapeutinnen fühlen sich durch Klienten mit PD belastet; sie ärgern sich oft über diese Klienten, fühlen sich ausgenutzt, o.ä. Therapeuten/Therapeutinnen haben oft den Eindruck, in einer double-bind-Situation zu stecken; sie erhalten zwei gegenteilige Botschaften, die sich gegenseitig ausschließen: 1. Hilf mir, tu was, rette mich und tue es schnell! 2. Lass mich in Ruhe, taste mich nicht an, komm mir nicht zu nahe. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 13 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? Therapeuten haben damit den Eindruck, dass der Klient eine Botschaft sendet von: „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.“ Dies macht Therapeuten oft sowohl hilflos als auch ärgerlich. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 14 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? Dadurch kommt es im Therapieprozess oft zu einem interaktionellen Teufelskreis, der die therapeutische Beziehung drastisch verschlechtert und zu einem Abbruch der Therapie führt: 1. Der Klient kommt in die Therapie und spezifiziert ein Problem (oft recht unklar und unspezifisch). Dabei definiert der Klient aber keinen klaren Arbeitsauftrag. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 15 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? 2. Der Therapeut macht ein bestimmtes therapeutisches Angebot. 3. Der Klient setzt dieses therapeutische Angebot nicht um: Er folgt dem Therapeuten nicht (macht z.B. keine Hausaufgaben, er beantwortet Fragen nicht, sagt, die Therapie sei „zu schwierig“ usw.). © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 16 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? 4. Daraufhin verstärkt der Therapeut sein Engagement (realisiert also die „Lösung: Mehr desselben“): Er macht neue Angebote, verstärkt den Druck auf den Klienten usw. 5. Der Klient reagiert daraufhin mit geringerer Compliance: Er arbeitet noch weniger mit, fängt an, den Therapeuten zu kritisieren, ist mit der Therapie unzufrieden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 17 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? 6. Der Therapeut betrachtet diese Reaktion des Klienten auf seine verstärkten Bemühungen als Sabotage: Er fängt an, sich über den Klienten zu ärgern, macht noch mehr Druck, verhält sich nicht mehr empathisch usw. 7. Dieses Therapeuten-Verhalten macht den Klienten noch reaktanter, 8. was den Therapeuten noch mehr ärgert usw. 9. Bis entweder der Klient die Therapie abbricht oder der Therapeut aufgibt und dem Klienten mitteilt, dass er ihm nicht weiterhelfen kann. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 18 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? Persönlichkeitsstörungen sind bestimmte Arten des Erlebens und Verhaltens und insbesondere der Beziehungsgestaltung und Interaktion. Es sind relativ konstante, oft unflexible Arten des Erlebens, Verhaltens und der Interaktion, d.h.: Eine Person mit einer bestimmten PD neigt dazu, bestimmte Situationen immer wieder auf die gleiche Weise zu interpretieren und sich in ähnlicher, charakteristischer Weise zu verhalten. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 19 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? Da diese Verhaltensweisen immer wieder vorkommen und in unterschiedlichen Situationen auftreten, erscheinen sie wenig flexibel, oft situationsinadäquat und erzeugen bei Interaktionspartnern oft Unverständnis und Ärger. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 20 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? In Beziehungen entstehen daher immer wieder Probleme. Dies kann man als „Interaktions-Kosten“ betrachten. Diese Interaktions-Kosten, die immer wieder auftreten, sind ein Hauptmerkmal der PD. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 21 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? Der Begriff „Persönlichkeitsstörungen“ ist ein Oberbegriff für eine Reihe von Störungen, die alle gemeinsam haben, dass es sich um Beziehungs- oder Interaktionsstörungen handelt und dass sie zu unflexiblem Erleben und Verhalten führen, die im Detail jedoch sehr unterschiedlich sind. Teilweise sind die gezeigten Verhaltensweisen von zwei verschiedenen PD sehr unterschiedlich, wie z.B. die einer histrionischen und schizoiden Störung: Personen mit einer histrionischen Störung suchen Aufmerksamkeit und Nähe, Personen mit einer schizoiden Störung suchen Distanz und vermeiden es, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 22 / 323 Was sind Persönlichkeitsstörungen? Daher ist es wesentlich, die Eigenheiten der einzelnen PD gut zu kennen, denn die unterschiedlichen Arten des Erlebens und Verhaltens, vor allem die unterschiedlichen Arten der Beziehungsgestaltung erfordern z.T. unterschiedliche therapeutische Vorgehensweisen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 23 / 323 DSM-IV Das DSM-IV unterscheidet drei Gruppen von PD: Gruppe A: – Paranoide PD – Schizoide PD – Schizotypische PD – (Passiv-aggressive PD) Gruppe B: – Histrionische PD – Narzisstische PD – Borderline PD – Antisoziale PD Gruppe C: – Selbstunsichere PD – Dependente PD – Zwanghafte PD – (Passiv-aggressive PD) – (Depressive PD) © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 24 / 323 DSM-IV Die Einteilung des DSM ist keine Einteilung aufgrund einer empirischen Analyse. Die Einteilung erscheint auch eher willkürlich und unzweckmäßug. Das DSM definiert Persönlichkeits-Störungen, also solche Ausprägungen von „Personen-eigenheiten“, die psychologisch als problematisch gelten können. Dabei ist der „Grenzwert“, von dem an von einer „Störung“ gesprochen werden kann, recht willkürlich. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 25 / 323 Stil und Störung Tatsächlich muss man aber annehmen, dass Persönlichkeitsausprägungen ein Kontinuum bilden von leicht bis ausgeprägt, von flexibel bis unflexibel, von Stil zu Störung. Oldham & Morris (1995) haben auf dieses Kontinuum zwischen Persönlichkeitsstil und Persönlichkeitsstörung aufmerksam gemacht. „Stil“ ist dabei eine leichte Ausprägung derjenigen Persönlichkeitseigenarten, die in massiver Ausprägung als „Störung“ erscheinen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 26 / 323 Stil und Störung Solange eine Persönlichkeitseigenart ein „Stil“ ist, ist sie auch – durchaus flexibel: der Stil ist nicht dominant und nicht ständig aktiviert; die Person ist nicht ständig auf bestimmte Erlebens- und Verhaltensweisen festgelegt; – eher eine Ressource als ein Problem: die Person kann sich in bestimmter Weise verhalten, fühlt sich dann aber nicht gezwungen: sie kann sich verführerisch und sexy, sie kann sich aber auch distanziert und vorsichtig verhalten; sie kann entscheiden, wie sie sich verhalten will; © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 27 / 323 Stil und Störung – die Personen sind prinzipiell zur MetaKommunikation über ihre Stile bereit und in der Lage; sie empfinden eine leichte Ausprägung einer Persönlichkeitseigenart nicht als ehrenrührig oder als problematisch. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 28 / 323 Stil und Störung Den Autoren gelingt es so, auf die Tatsache aufmerksam zu machen, dass Persönlichkeitseigenarten in gewisser Ausprägung praktisch auf alle Menschen zutreffen und es deshalb völlig unsinnig ist zu glauben, solche Eigenheiten seien ehrenrührig: Damit distanziert man sich von Abwertungen wie „Charakterstörung“, „unreifer Charakter“ u.ä. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 29 / 323 Stil und Störung Daher erscheint es auch dringend angebracht, zu „entpathologisieren“: Persönlichkeitsstörungen sind Arten von Problemen, die als „Lösungen“ für problematische biographische Bedingungen entstehen und die im Erwachsenenzustand nicht mehr günstig sind und die ein Klient aufgrund der nun damit verbundenen hohen Kosten revidieren kann und sollte (falls er sich dazu entscheidet). PD sind daher keine „schweren Charakter-Defizite“ oder „maligne“ Störungen, über die man „entsetzt“ sein müsste; PD sind vielmehr „Extremausprägungen“ von Stilen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 30 / 323 Stil und Störung Die Autoren machen auch darauf aufmerksam, dass Persönlichkeitseigenheiten unter bestimmten Umständen keine Probleme, sondern sogar Ressourcen sein können. Das ist der Fall, wenn – die Person diese Eigenheiten kennt; dies ist die Voraussetzung, sie steuern zu können. – die Person diese Eigenheiten flexibel steuern, also einsetzen aber auch nicht-einsetzen kann; – die Person diese Eigenheiten akzeptiert, also keine internalen Konflikte aufweist. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 31 / 323 Stil und Störung Stil Störung gewissenhaft, sorgfältig zwanghaft ehrgeizig, selbstbewusst narzisstisch expressiv, emotional histrionisch wachsam, misstrauisch paranoid sprunghaft, spontan Borderline anhänglich, loyal dependent zurückhaltend, einsam schizoid kritisch, zögerlich passiv-aggressiv selbstkritisch, vorsichtig selbstunsicher ahnungsvoll, sensibel schizotypisch abenteuerlich, risikofreudig antisozial © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 32 / 323 Einführung 2. Das „Stigmatisierungsproblem“ © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 33 / 323 Stigmatisierungsproblem Insbesondere Fiedler (z.B. 1999, 2000) macht auf das sog. Stigmatisierungsproblem aufmerksam. Stigmatisierung bedeutet, dass ein Diagnostiker einem Klienten durch die Vergabe einer Diagnose „Persönlichkeitsstörung“ ein abwertendes Etikett zuschreibt, das eine Reihe von Problemen nach sich ziehen kann. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 34 / 323 Stigmatisierungsproblem Denn gerade in psychoanalytischer Literatur, aber auch in anderer, wird der Begriff „Persönlichkeitsstörung“ gleichgesetzt mit „sehr schwere Störung“, „Charakterdefekt“, „Störung der Gesamtpersönlichkeit“ u.a. Solche Assoziationen können beim Klienten und bei anderen Personen leider immer noch ausgelöst werden. Diese Arten von Interpretationen von PD sind es, die einen Stigmatisierungseffekt auslösen (das Verständnis als „Beziehungsstörungen“ ist dagegen überhaupt nicht stigmatisierend!). Das „Stigmatisierungsproblem“ kann in einige unterschiedliche Teilprobleme aufgeteilt werden, die man getrennt betrachten kann. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 35 / 323 Offizielle Diagnostik Als Therapeut/Therapeutin muss man immer unterscheiden zwischen – der Diagnose als Arbeitshypothese: Dies ist eine Diagnose, die man selbst stellt, um eine Arbeitshypothese für die Therapie zu entwickeln: Es ist eine interne Diagnose, die man mit dem Supervisor oder einer Supervisionsgruppe diskutiert, also mit Personen, die genau wissen, was diese Diagnose bedeutet, was man mit dieser Diagnose will und wie man damit umgeht und die keine Information weitergeben. Diese Arbeitshypothese impliziert keine Bewertung und schon gar keine Abwertung: Sie dient lediglich als sachliche Information für den Therapeuten, als Heuristik zur Orientierung. Sie ist damit notwendig, damit der Therapeut sich auf den Klienten einstellen kann. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 36 / 323 Offizielle Diagnostik – der Diagnose als offizielle Stellungnahme: In diesem Fall geht die Diagnose als offizielle Stellungnahme an einen Klienten, eine Versicherung, einen Richter u.ä. Dies bedeutet immer, – dass der Adressat oft nicht weiß, was die Diagnose genau bedeutet und wozu sie in der Therapie dient – dass es sein kann, dass der Adressat eine abwertende Interpretation vornimmt – und dass man daher in der Regel nicht vorhersehen kann, wie er sie interpretiert und was er aus ihr macht – und dass man nicht weiß, ob die Information weitergegeben wird und man nicht weiß wie, wofür oder wogegen sie verwendet wird. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 37 / 323 Offizielle Diagnostik Das Stigmatisierungsproblem resultiert damit eindeutig – aus einer falschen Interpretation des Problems der PD; – aus einer bewertenden und zwar abwertenden Interpretation. Nochmals: Aus einer Interpretation von PD als „Beziehungsstörung“ und als „Extremisierung von normalen Beziehungsstilen“ resultiert keine Stigmatisierung. Stigmatisierung ist damit kein notwendiger Aspekt dieser Diagnose! © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 38 / 323 Offizielle Diagnostik Es gilt aber auch: – Interne Arbeitshypothesen sind vollständig anders zu betrachten als offizielle DiagnoseStellungen! Eine Persönlichkeitsstörungs-Diagnose als interne Arbeitshypothese zu stellen, ist m.E. völlig unproblematisch, wenn die Therapeuten/Therapeutinnen wissen, was genau damit gemeint ist und wozu es in der Therapie dient! Und solche Diagnosen sind notwendig, damit der Therapeut richtige Indikationsentscheidungen treffen kann. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 39 / 323 Offizielle Diagnostik Ein/e Therapeut/in kann sich m.E. sogar auf keinen Fall leisten, diese Diagnose nicht zu stellen (ob man die Störung dabei Persönlichkeitsstörung nennt oder anders, ist dabei völlig sekundär: Man muss das Problem erfassen!): Denn die Analyse des Interaktionsproblems ist von entscheidender therapeutischer Bedeutung. Denn vom Verständnis dieses Problems hängt entscheidend ab, ob sich der Therapeut bereits früh in der Therapie angemessen auf den Klienten einstellen kann! © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 40 / 323 Offizielle Diagnostik Eine Persönlichkeits-Störung-Diagnose offiziell zu stellen, ist jedoch oft nicht unproblematisch. Eine solche Diagnose kann zu einem bleibenden Etikett für einen Klienten werden, das dem Klienten durchaus schaden kann (je nachdem, wer die Diagnose wie interpretiert). Als Therapeut/in weiß man nicht, was bestimmte Institutionen mit solchen Diagnosen machen. Daher sollte man m.E. mit der offiziellen Herausgabe heikler Informationen als Therapeut/in immer sehr vorsichtig sein. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 41 / 323 Stigmatisierung Ein weiteres Teilproblem der Stigmatisierung kommt dadurch zustande, dass trotz neuerer Forschungsansätze mit dem Begriff „Persönlichkeitsstörungen“ immer noch sehr negative und abwertende Implikationen verbunden sind (vor allem in psychoanalytischer Literatur). Diese Implikationen, das möchte ich sehr deutlich betonen, haben z.T. mit alten theoretischen Ansätzen und z.T. mit psychoanalytischen Ansätzen zu tun; sie sind keine notwendiger Bestandteil der Forschung oder Therapie von Persönlichkeitsstörungen! Insbesondere in psychoanalytischer Literatur werden abwertende Begriffe benutzt, die die Diagnose für Klienten z.T. zu einer Beleidigung machen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 42 / 323 Stigmatisierung Implikationen älterer und psychoanalytischer Literatur sind z.B.; – Eine PD zu haben, ist ein furchtbarer Schicksalsschlag, denn: – die „Gesamtpersönlichkeit“ ist gestört; – die Störung ist „tiefgreifend“, „früh“; – die Störung ist extrem schwer behandelbar. – Eine PD zu haben, ist ehrenrührig, denn – es ist eine Charakterstörung; – es ist Ausdruck eines „unreifen Charakters“; – es ist eine maligne Störung. – Eine PD zu haben, ist hoffnungslos, denn – die Störung ist langandauernd; – es gibt keine geeigneten Therapien. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 43 / 323 Stigmatisierung Es ist klar: Erhält ein Klient derartige Informationen zusammen mit einer Diagnose, dann ist die Therapeut-KlientBeziehung sofort tiefgreifend gestört. Als Klient kann man eigentlich nur beleidigt sein und den Kontakt zum Therapeuten abbrechen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 44 / 323 Implikationen der Stigmatisierung Und es ist klar: Therapeuten, die eine solche Einstellung Klienten gegenüber haben, werden sich schwer tun, den Klienten respektvoll und empathisch zu begegnen. Sie werden es schwer haben, das aufzubauen, was bei diesen Klienten das zentralste therapeutische Agens überhaupt ist: Eine vertrauensvolle Therapeut-Klient-Beziehung. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 45 / 323 Implikationen der Stigmatisierung Es ist jedoch keineswegs nötig, Störung und Klienten so zu sehen. Man kann vielmehr – sehen, dass die Klienten zwar in der Interaktion sehr schwierig sind, sie sich das Problem aber nicht ausgesucht haben und es nicht entwickelt haben, um Therapeuten zu ärgern; – sehen, dass Klienten teilweise Lösungen gefunden haben für hoch pathologische Umweltbedingungen, in denen sie aufgewachsen sind und dass diese Lösungen Leistungen sind, dass aber die Lösungen heute nicht mehr gut funktionieren; – sehen, dass „Störungen“ hohe Ressourcen aufweisen können, wenn die Klienten lernen, anders mit ihren Schemata umzugehen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 46 / 323 Implikationen der Stigmatisierung Kurz: Man kann „Persönlichkeitsstörungen“ – hochgradig entpathologisieren, – unter interaktioneller Perspektive sehen, – unter Ressourcen-Perspektive sehen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 47 / 323 Schwierige Klienten Und: – Schwierige Klienten sind eine Aufgabe für Therapeuten/Therapeutinnen. – Wenn Therapeuten/Therapeutinnen mit schwierigen Klienten nicht fertig werden, dann ist das ein Problem der Therapeuten/Therapeutinnen, nicht der Klienten. – Wenn Therapeuten/Therapeutinnen versagen, ist es nicht gerechtfertigt, den Klienten „maligne Probleme“ anzuhängen. – Die Klienten sind nicht dazu da, die Therapeuten/Therapeutinnen zu erheitern: Die Therapeuten/Therapeutinnen sind dazu da, auch schwierigen Klienten effektiv zu helfen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 48 / 323 Einführung 3. Schema-Theorie © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 49 / 323 Terminus Es ist klar, dass der Terminus „Persönlichkeitsstörungen“ heute – unpassend – unglücklich – problematisch – inhaltlich nicht mehr zutreffend ist. Ich hoffe, dass er verändert wird; solange er aber offiziell gilt, sollte man verstehen, was er meint, und sich nicht durch antiquierte Konzepte verschrecken lassen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 50 / 323 Relevanz Denn ohne jeden Zweifel ist es für die therapeutische Praxis von entscheidender Bedeutung, ist es für den Fortschritt des Klienten von essentieller Relevanz, dass Therapeuten mit diesen Konzepten und den therapeutischen Möglichkeiten vertraut sind. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 51 / 323 Relevanz Deutlich ist aber, dass Therapeuten, die mit Klienten arbeiten, die eine PD aufweisen, den Klienten in bestimmter Weise entgegenkommen sollten: – Sie sollten die Probleme des Klienten verstehen und verstehen, dass es sich um eine Art von Lebensdefinition handelt, um eine Identitätsdefinition, die man nicht abwerten darf, sondern die man respektieren sollte als eine Art von Lösung, – allerdings auch als eine Lösung, die modifiziert, überarbeitet, verändert werden muss, wenn der Klient seine Lebensqualität erhöhen will. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 52 / 323 Relevanz Daher sollte der Therapeut auch ein weitgehendes Verständnis haben für die tiefen inneren Konflikte von Klienten, ihre Zerrissenheit, die daraus resultierenden, manchmal skurrilen Lösungen, die aber dennoch ein Aspekt der Person des Klienten sind. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 53 / 323 Schema-Theorie Der Begriff „Persönlichkeits-Störung“ impliziert den Begriff „Persönlichkeit“. Ich möchte den Begriff „Persönlichkeit“ schematheoretisch definieren und damit auch immer interaktions-theoretisch. Jede Person erwirbt in ihrer Lerngeschichte verschiedene Arten von Schemata. Schemata lassen sich auffassen als (mehr oder weniger) generalisierte Schlussfolgerungen aus persönlichen Erfahrungen. Diese Schlussfolgerungen verdichten sich zu Annahmen und Imperativen, die bei der Steuerung des Verhaltens eine wesentliche Rolle spielen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 54 / 323 Schema-Theorie Erfahrungen verdichten sich z.B. zu Selbstschemata, also Aussagen-Systemen über sich selbst, z.B. über eigene Kompetenzen: – ich habe ein gutes Gedächtnis – ich kann schlecht Mathe oder zu Aussagen über eigene Attraktivität, z.B.: – ich sehe gut aus – ich habe anderen wenig zu bieten. Erfahrungen verdichten sich auch zu motivationalen Schemata, also Aussage-Systemen über eigene Ziele, Werte, z.B.: – ich möchte für andere wichtig sein – ich möchte anerkannt werden usw. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 55 / 323 Schema-Theorie Schemata beziehen sich damit z.B. auf – das Selbst: - eigene Kompetenzen - eigene Attraktivitäten u.ä. – das Motivsystem: - eigene Ziele, Werte - eigene Motive - eigene Intentionen u.ä. – das Überzeugungssystem: - Annahmen über Effekte eigenen Handelns - Annahmen über eigene Kontrollmöglichkeiten - Annahmen über „Realität“ u.ä. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 56 / 323 Schema-Theorie Schemata bestimmen in einem bottom-up/top-downVerarbeitungsprozess die Informationsverarbeitung, einschließlich der affektiven Verarbeitung. Daher kann man – kognitive Schemata und – affektive Schemata unterscheiden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 57 / 323 Schema-Theorie Situation Verarbeitung Schemata Reaktionen / Handlungen Schlussfolgerungen Konsequenzen © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 58 / 323 Schema-Theorie Jede Person bringt nun bestimmte Schemata, die sie aus ihrer Biographie erworben hat, in eine bestimmte Situation mit ein. Diese Schemata sind personenspezifisch, sie sind spezifisch für diese spezifische Person mit diesen spezifischen Erfahrungen. Diese Schemata vermitteln damit eine personenspezifische, idiosynkratische Verarbeitung der Situation. Beispiel: Einladung zur Pressekonferenz © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 59 / 323 Interaktionelle Theorie Diese Schemata sind dispositionelle Strukturen, d.h. – sie sind relativ zeitstabil: Sie werden zwar durch Erfahrungen auch (in der Regel!) weiterhin modifiziert, jedoch nur sehr langsam, sodass sie als zeitstabil gelten können. – sie sind situationsübergreifend: Verschiedene Situationen, die bestimmte Charakteristika aufweisen, aktivieren diese Schemata. – sie sind zuverlässig: Auslösende Situationen aktivieren entsprechende Schemata immer wieder (mit hoher Wahrscheinlichkeit). © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 60 / 323 Interaktionelle Theorie Schemata werden durch Situationen getriggert ( bottom-up-Verarbeitung) und steuern dann die weitere Verarbeitung der Situation in hohem Maße ( top-downVerarbeitung) Personen bringen also personenspezifische, idiosynkratische Schemata und damit systematische Verarbeitungs-Voreingenommenheiten in eine bestimmte Situation ein. Damit hat jede Informationsverarbeitung in jeder Situation einen personenspezifischen Anteil. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 61 / 323 Interaktionelle Theorie Jede Verarbeitung hat aber auch einen situationsspezifischen Anteil, denn – nicht jede Situation löst relevante Schemata aus, d.h. etliche Situationen werden relativ „unvoreingenommen“ verarbeitet; – nicht jede Situation triggert ein relevantes Schema im gleichen Ausmaß: Je besser eine Situation auf ein Schema „passt“, desto stärker ist die Schema-Aktivierung. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 62 / 323 Interaktionelle Theorie Schemata führen zu einer „voreingenommenen“ Verarbeitung: Schema-konsistente Information wird schneller, leichter und „tiefer“ verarbeitet als Schema-widersprechende Information. Information, die Schemata widerspricht, kann völlig „ausgefiltert“ werden. Situationen sind komplex und können eine Vielzahl von Schemata gleichzeitig aktivieren; dabei variiert die „Zusammensetzung“ der aktivierten Schemata von Situation zu Situation. Schemata können sehr leicht und schnell oder nur sehr schwer aktivierbar sein. Je leichter ein Schema aktivierbar ist, desto stärker determiniert es die Verarbeitung. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 63 / 323 Interaktionelle Theorie Schemata können sehr eng definiert sein (z.B.: „Ich kann Latein nicht.“) oder sehr weit generalisiert sein (z.B.: „Ich kann gar nichts.“). Je weiter ein Schema generalisiert ist, desto stärker determiniert es die Verarbeitung. Schemata können zu einer „allergischen“ Verarbeitung führen: Z.B. kann eine Person mit sehr negativen Selbstschemata schon auf leichte Kritik sehr schnell sehr heftig (= allergisch) reagieren. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 64 / 323 Interaktionelle Theorie Schemata sind exekutive Strukturen. Schemata sind kein Teil des episodischen Gedächtnisses Sie determinieren, sobald sie aktiviert sind, die Informationsverarbeitung, die emotional-affektive Verarbeitung und die Steuerung der Handlung. Die Aktivierung von Schemata determiniert somit den „state of mind“. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 65 / 323 Interaktionelle Theorie Schemata werden zum großen Teil durch Situationsaspekte automatisch aktiviert. Damit sind Schemata der Person meist nicht bewusst, nicht repräsentiert. Auch die Aktivierung der Schemata geschieht meist nicht bewusst. Die Schema-Aktivierung geschieht nicht intentional. Personen können die Schema-Aktivierung in aller Regel nicht kontrollieren. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 66 / 323 Interaktionelle Theorie Wesentlich ist auch die Dominanz eines Schemas. Eine Person kann im Hinblick auf einen Situationskomplex eine Reihe von gleich bedeutsamen, gleich leicht aktivierbaren Schemata aufweisen (z.B. auf einer Party: „Ich will Aufmerksamkeit“ und „Ich will mich amüsieren“ und „Ich will Leute kennenlernen“ und „Ich will wissen, wie es meinen Freunden geht“ usw. In diesem Fall bleiben Verarbeitung und Handlung flexibel. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 67 / 323 Interaktionelle Theorie Eine Person kann jedoch im Hinblick auf den Situationskomplex auch nur ein dominantes Schema aufweisen (z.B.: „Ich will Aufmerksamkeit und sonst gar nichts.“). In diesem Fall werden Verarbeitung und Handlung rigide: Die Person nimmt Situationen immer in ähnlicher Weise wahr und verhält sich in ähnlicher Weise. Eine solche Rigidität ist typisch für solche Schemata, die bei PD eine Rolle spielen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 68 / 323 Interaktionelle Theorie Dies macht deutlich: – Jede Verarbeitung hängt von personenspezifischen (d.h. schemaspezifischen) und von situationsspezifischen Faktoren ab. – Situationsspezifische Faktoren spielen immer eine Rolle, da Schemata durch sie (in unterschiedlichem Ausmaß) getriggert werden. – Personenspezifische Faktoren spielen in dem Ausmaß eine Rolle, in dem relevante Schemata getriggert werden. – Dies kann in geringem Umfang geschehen: Dann sind Verarbeitung und Handlung der Person wenig voreingenommen und flexibel. – Dies kann jedoch in hohem Maße geschehen: Dann werden Verarbeitung und Handlung der Person voreingenommen und unflexibel. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 69 / 323 Interaktionelle Theorie Weist eine Person ein leicht aktivierbares und/oder hoch generalisiertes und/oder dominantes Schema auf, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, – dass dies in vielen Situationen aktiviert wird, – dass dies sehr häufig die Verarbeitung und Handlung determiniert, – dass es die Selbstregulation der Person stark stört und die Person in ihrer Verarbeitung und Handlung unflexibel macht. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 70 / 323 Interaktionelle Theorie Eine solche Unflexibilität ist aber kein alles-odernichts-Phänomen: Es reicht von leichten Voreingenommenheiten bis zu völliger Unflexibilität des Handelns. Eine Person mit leicht negativem Selbstschema kann dazu neigen, jede Rückmeldung als Kritik aufzufassen, kann dies aber schnell wieder relativieren. Eine Person mit stark negativem Selbstschema fasst dagegen jede Rückmeldung als Kritik auf und kann sich davon kaum selbst distanzieren. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 71 / 323 Interaktionelle Theorie Dies impliziert auch eine ganz wesentliche Erkenntnis: Wann ein Schema oder wann eine SchemaAusprägung „noch günstig“ oder „schon ungünstig“ ist, wann sie noch „funktional“ oder bereits „dysfunktional“ ist, kann nicht objektiv und allgemein entschieden werden. Es kann vielmehr nur individuell im Kontext des Einzelfalls entschieden werden. In der Regel ist es nicht schwierig, die Extreme zu definieren: Man kann große Flexibilität leicht als unproblematisch erkennen und leicht sehen, dass eine Person mit großer Inflexibilität in Schwierigkeiten geraten wird. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 72 / 323 Interaktionelle Theorie Den „Übergang“ zu bestimmen, die Grenze zwischen funktional und dysfunktional, das ist jedoch kaum möglich. Daher sollte man annehmen, – dass Schema-Ausprägungen auf einem Kontinuum von funktional (d.h. für die Person günstig, positiv) bis dysfunktional (d.h. für die Person ungünstig, kostenintensiv) angeordnet sind, – dass die Extremwerte des Kontinuums meist gut definierbar sind, – dass der „Grenzwert“ des Übergangs von funktional zu dysfunktional jedoch nicht klar bestimmt werden kann und – dass dieser Grenzwert idiosynkratisch, zeitinstabil und bewertungsabhängig ist. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 73 / 323 Einführung 4. Ich-Syntonie © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 74 / 323 Ich-Syntonie Wesentlich für ein Verständnis von Persönlichkeitsstörungen ist die Unterscheidung zwischen - Ich-Syntonie und - Ich-Dystonie (Vaillant & Perry, 1988; Fiedler, 1994) © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 75 / 323 Ich-Syntonie Ein bestimmtes Verhalten und Erleben (z.B. Angst) ist dann ich-dyston, – wenn die Person es als nicht-zu-sich-gehörig erlebt; – es als fremd, störend und beeinträchtigend erlebt; – es „los sein will“, unter dem Erleben oder Verhalten leidet. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 76 / 323 Ich-Syntonie Ein bestimmtes Erleben oder Verhalten (z.B. die Suche nach Aufmerksamkeit) ist dann ich-synton, – wenn die Person es als zu-sich-gehörig erlebt, als Teil der eigenen Person, u.U. sogar als Teil der eigenen Identität („das bin ich“); – wenn die Person es nicht als fremd und störend, sondern als vertraut, u.U. sogar als angenehm erlebt; – wenn die Person unter dem Erleben und Verhalten selbst gar nicht leidet, sondern höchstens unter den Konsequenzen oder „Kosten des Verhaltens“. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 77 / 323 Ich-Syntonie Die mit Persönlichkeitsstörungen verbundenen Erlebens- und Verhaltensweisen sind in der Regel ich-synton: Die Personen erleben diese „als Teil ihrer Persönlichkeit“ und nicht als störend. Dies hat eine wesentliche therapeutische Konsequenz: Die Personen sind nicht motiviert, ihr Erleben oder Verhalten zu modifizieren, sie sind nicht änderungsmotiviert. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 78 / 323 Ich-Syntonie Derksen (1995, S. 5) schreibt: Viele Personen [mit PD] leiden nicht direkt unter ihrer Persönlichkeitsstörung. Daher suchen sie auch nicht spontan therapeutische Hilfe. Im allgemeinen äußern sie aber, z.B. Hausärzten gegenüber, vage Beschwerden, Probleme auf der Arbeit oder in Beziehungen oder allgemeine AnpassungsSchwierigkeiten. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 79 / 323 Ich-Syntonie Aufgrund der Ich-Syntonie der PD kommen die Personen oft in Therapie – ohne klare Problem-Definition und ohne dass man eine klare DSM-Diagnose zu Therapiebeginn (!) vergeben könnte; – ohne klaren Arbeitsauftrag, also ohne Definition, woran und mit welchem Ziel in der Therapie überhaupt gearbeitet werden kann (und sollte); – mit einem (oft wenig spezifischen) Auftrag, „Kosten zu reduzieren“ (wie: „Machen Sie mich wieder fit!“, „Meine Beziehung muss besser werden!“, „Meine Gesundheit ist angeschlagen.“). © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 80 / 323 Ich-Syntonie Diese Aufträge bereiten wegen ihrer Unkonkretheit den Therapeuten oft große Probleme: Man weiß oft gar nicht, was psychologisch überhaupt getan werden kann. Therapeuten geraten oft in die Rolle von Ehe-, Rechts- oder Gesundheitsberatern, oft sogar von Finanzberatern, was ihrer Aufgabe jedoch überhaupt nicht entspricht. Therapeuten haben bei Klienten mit PD oft den Eindruck, sie wissen nicht, was der Klient überhaupt in der Therapie will: – Wozu kommt er? – Was hat er überhaupt für ein Problem? – Woran will er arbeiten? – Was will er erreichen? © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 81 / 323 Ich-Syntonie Das Rätsel für den Therapeuten verstärkt sich dadurch, dass der Klient in der Therapie kaum mitarbeitet, dennoch immer wieder kommt. Daraus resultiert die hoch interessante und hoch relevante Frage: „Wenn der Klient nicht in die Therapie kommt, um sich oder sein System zu ändern, warum kommt er dann?“ © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 82 / 323 Charakterisierung Zusammenfassend kann man also sagen, dass Klienten mit PD – meist hoch generalisierte, negative Schemata aufweisen; – Schemata aufweisen, die sehr leicht zu „triggern“ sind und damit eine hochgradig voreingenommene, allergische Verarbeitung erzeugen; – Rigide, nur schwer modifizierbare Schemata aufweisen; © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 83 / 323 Charakterisierung – ihre Probleme jedoch meist nicht als ihre Probleme erkennen, sondern bezüglich ihrer Schemata und Überzeugungen eine hohe IchSyntonie aufweisen; – deshalb im Hinblick darauf kaum änderungsmotiviert sind und meist keinen Arbeitsauftrag aufweisen; – in die Therapie kommen, um „Kosten“ zu reduzieren oder um sich ihre Sichtweise vom Therapeuten bestätigen zu lassen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 84 / 323 Epidemiologie 5. Epidemiologie und Co-Morbiditäten © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 85 / 323 Prävalenz Nach Maier et al. (1992) liegt die Prävalenzrate von PD in unbehandelten Bevölkerungsgruppen bei 1012%, also sehr hoch. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 86 / 323 Co-Morbiditäten Für die therapeutische Praxis ist jedoch gar nicht so sehr die Prävalenz-Rate in der unbehandelten Bevölkerung relevant. Relevant ist vor allem die Rate der Co-Morbidität. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 87 / 323 Co-Morbiditäten Co-Morbidität bedeutet das gleichzeitige Auftreten von zwei verschiedenen psychischen Störungen. Zwei Arten von Co-Morbiditäten sind relevant: – Co-Morbidität zwischen PD und Achse-IStörungen – Co-Morbiditäten von PD untereinander. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 88 / 323 Co-Morbiditäten Co-Morbiditäten mit PD sind deshalb relevant, weil das Vorliegen einer PD – das Interaktionsverhalten eines Klienten im Therapieprozeß sehr stark verändern kann und damit zu völlig anderen Anforderungen an den Therapeuten führt – die Behandlung einer Achse-I-Störung, z.B. einer Angststörung, stark beeinträchtigen kann. – oft ganz andere therapeutische Vorgehensweisen erfordert als bei Achse-I-Störungen, und zwar von Beginn der Therapie an. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 89 / 323 Co-Morbiditäten Aus diesem Grund ist es wesentlich zu wissen, ob neben einer Achse-I-Störung auch noch eine PD vorliegt. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 90 / 323 Co-Morbiditäten Wesentlich ist es auch zu wissen, ob bei einer Person mehrere PD vorliegen, da, wie ausgeführt, unterschiedliche PD z.T. zu sehr unterschiedlichen Erlebensweisen und zu unterschiedlichem Interaktionsverhalten führen, auf die der Therapeut auch sehr unterschiedlich reagieren muss. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 91 / 323 Co-Morbidität mit Achse-I In verschiedenen Studien liegt die Co-MorbiditätsRate, d.h. der Prozentsatz von PD bei behandelten Klienten im Mittel bei 52% (Fydrich et al., 1996): – bei ambulant behandelten Klienten zwischen 38 – 81%; – bei stationär behandelten Klienten zwischen 26 – 92%. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 92 / 323 Co-Morbidität mit Achse-I Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass ein Klient, der wegen einer Achse-I-Störung in Therapie kommt, auch eine PD aufweist. Es lohnt sich daher grundsätzlich zu analysieren, ob bei einem Klienten eine PD vorliegt. Dazu mehr unter dem Aspekt „Interaktions-Rating“. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 93 / 323 Co-Morbidität mit Achse-I Co-Morbiditäten von PD bei Klienten mit: – Angststörungen 52% – affektiven Störungen 56% – somatoformen Störungen 26,8% – Essstörungen 43,8% (Fydrich et al., 1996) © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 94 / 323 Co-Morbidität mit Achse-I In der „Bad Dürkheimer-Cormorbiditäts-Studie“ ergaben sich bei Patienten mit unterschiedlichen Achse-I-Störungen (Angststörungen, affektive Störungen, somatoforme Störungen und Essstörungen) unterschiedliche Prävalenzraten für die einzelnen PD. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 95 / 323 Co-Morbidität mit Achse-I Paranoide 8,2 Schizotypische 2,7 Schizoide 3,8 Histrionische 3,8 Narzisstische 0,5 Borderline 7,1 Antisoziale 0,5 Selbstunsichere 39,0 ! Dependente 20,9 ! Zwanghafte 10,4 Passiv-aggressive 0,5 © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 96 / 323 Diagnostik 6. Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 97 / 323 Diagnostik Bei der Diagnostik von PD geht es um zwei Aufgaben: 1. Feststellen, ob bei einem Klienten überhaupt eine PD vorliegt. 2. Feststellen, welche PD bei einem Klienten vorliegt. Diese beiden Aufgaben sind manchmal, aber nicht immer getrennt: Manche Verfahren erfassen sofort die Art der Störung und beantworten damit gleichzeitig Frage 1. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 98 / 323 Diagnostik Methodisch gibt es vier Zugänge zur Diagnostik von PD: 1. Kategorial-prototypische Diagnostik als Experten-Rating 2. Interview-Verfahren 3. Fragebogen-Verfahren 4. Rating von Interaktions-Prozessen © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 99 / 323 Kategorial-prototypische Diagnostik Kategorial-prototypische Diagnostik bedeutet, dass es Definitionen der Persönlichkeitsstörungen gibt, denen ein Beurteiler bei der Einschätzung eines Klienten folgen soll. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 100 / 323 Kategorial-prototypische Diagnostik Es gibt heute zwei große Diagnostik-Systeme, die (u.a.) Definitionen von PD geben, die bei der Einschätzung von Klienten beachtet werden sollen: – das DSM IV – das ICD 10 Hier soll etwas näher auf das DSM eingegangen werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 101 / 323 DSM-Diagnostik Das DSM IV wählt im Grunde eine kategoriale Art der Diagnostik. Eine Persönlichkeitsstörung wird durch eine Auflistung von Merkmalen definiert. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 102 / 323 DSM-Diagnostik Diese Merkmale muss der Diagnostiker mit seinen Beobachtungen eines realen Klienten vergleichen und entscheiden, welche und wie viele der aufgelisteten Merkmale jeweils zutreffen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 103 / 323 DSM-Diagnostik Das DSM definiert für jede einzelne Störung, wie viele der angegebenen Merkmale mindestens zutreffen müssen, damit die entsprechende Diagnose vergeben werden kann. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 104 / 323 DSM-Diagnostik So sind z.B. die diagnostischen Kriterien einer histrionischen PD nach DSM IV: 1. Die Person fühlt sich unwohl in Situationen, in denen sie nicht im Mittelpunkt steht. 2. Ihre Interaktion mit anderen ist häufig bestimmt durch ein übertrieben sexuell-verführerisches oder provokantes Verhalten. 3. Die Person zeigt schnell wechselnde und oberflächlich wirkende Emotionen. 4. Die Person nutzt durchgängig die eigene äußere Erscheinung, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 105 / 323 DSM-Diagnostik 5. Die Person hat einen übertrieben impressionistischen Sprachstil, der keine Details kennt. 6. Die Person liebt Selbstdarstellung und Theatralik, sowie einen übertriebenen Ausdruck von Gefühlen. 7. Die Person ist suggestibel, d.h. leicht durch andere Personen oder Umstände zu beeinflussen. 8. Die Person hält Beziehungen gewöhnlich für intimer, als sie in Wirklichkeit sind. Mindestens fünf der acht Kriterien müssen erfüllt sein. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 106 / 323 DSM-Diagnostik Einige Aspekte der DSM-Diagnostik sollen verdeutlicht werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 107 / 323 Prototypische Definitionen Das DSM gibt eine Liste von Definitionsmerkmalen an, von denen eine bestimmte Anzahl zutreffen muß (jedoch nicht alle zutreffen müssen). Dies wird als prototypische Definition bezeichnet und von einer streng kategorialen Definition (bei der alle Merkmale zutreffen müssen) unterschieden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 108 / 323 Prototypische Definitionen Der Vorteil dieses Vorgehens ist eine größere Flexibilität der Diagnose: Man trägt der Tatsache Rechnung, dass PD komplexe Störungen sind, und dass nicht alle Aspekte, die bei einer Störung vorkommen können, immer bei jeder individuellen Störungsausprägung vorkommen müssen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 109 / 323 Prototypische Definitionen Das Problem dabei ist, dass die Kriterien arbiträr sind, es also keine empirischen Belege dafür gibt, warum man z.B. gerade beim Vorliegen von fünf Kriterien die Diagnose stellen soll. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 110 / 323 Prototypische Definitionen Deutlich wird damit auch, dass es völlig unterschiedliche Kriterien-Kombinationen z.B. innerhalb der histrionischen PD geben kann, d.h. also, völlig unterschiedliche Arten, histrionisch zu sein. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 111 / 323 Prototypische Definitionen Dies wird der Realität schon gerecht, in der es wirklich eine riesige Gestaltungsbreite einer einzelnen Störung gibt; das macht aber auch deutlich, dass man es bei einer definierten Störung keineswegs mit einem klar und eng umgrenzten Feld von Erlebens- und Verhaltensweisen zu tun hat. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 112 / 323 Prototypische Definitionen Und das wiederum macht bereits klar, dass eine Diagnose in der Praxis weit schwieriger zu stellen sein wird, als ein erster Blick in die Kriterien dies nahe legt. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 113 / 323 Kriterien-Ähnlichkeit Im DSM wird deutlich, dass die Definitionskriterien der einzelnen Störungen ähnlich sind. So wird z.B. das Kriterium „hat keine engen Freunde oder Bekannte“ sowohl als Definitionskriterium bei der schizoiden PD, der schizotypischen PD als auch bei der selbstunsicheren PD benutzt. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 114 / 323 Kriterien-Ähnlichkeit Und selbst wenn die Kriterien nicht identisch formuliert sind, so sind sie doch oft ähnlich formuliert. So wird z.B. deutlich, dass sowohl Klienten mit histrionischer als auch Klienten mit narzisstischer PD nach Aufmerksamkeit und Bewunderung streben. Das entspricht der Empirie, denn bestimmte Arten von Merkmalen kommen tatsächlich bei mehreren Störungen vor: Insofern sind diese Definitionen völlig berechtigt. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 115 / 323 Kriterien-Ähnlichkeit Es ist andererseits aber klar, dass solche Kriterienüberlappungen oder Kriterien-Ähnlichkeiten es dem Diagnostiker erschweren, zwei Störungen exakt voneinander zu trennen. Dies macht sich dann auch in einer Senkung der Reliabilität bemerkbar (die Störung X kann einmal eher als histrionisch, einmal eher als narzisstisch erscheinen). Deutlich ist auch, dass eine Störung niemals anhand eines einzelnen Merkmals definiert werden kann, sondern immer anhand eines Syndroms. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 116 / 323 Kriterien-Ähnlichkeit Man muss jedoch sehen, dass dieses Problem faktisch nicht vermeidbar ist: Wenn ein Kriterium X bei zwei verschiedenen Störungen vorkommt, dann muss es auch als Kriterium aufgeführt werden, völlig unabhängig davon, ob sich Kriterien überlappen oder nicht. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 117 / 323 Kriterien-Ähnlichkeit Das Problem liegt auch nicht so sehr in der „Überlappung von Kriterien“, sondern darin, dass die DSM-Diagnostik zu oberflächlich und zu wenig systemorientiert ist. Die DSM-Kriterien definieren isolierte, oberflächliche Kriterien; unklar ist, wie diese Kriterien interagieren, welche Relevanz jedes einzelne Kriterium hat, usw.. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 118 / 323 Kriterien-Ähnlichkeit Das ist zugleich ein Vorteil und ein Nachteil des DSM: Man will nur beobachtbare Kriterien anführen, und so „theoriefrei wie möglich sein“. Das belastet zum einen die Indikatoren nicht mit theoretischen Spekulationen und ist insofern sehr gut. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 119 / 323 Kriterien-Ähnlichkeit Andererseits lassen sich viele Indikatoren aber erst in ihrer Interaktion mit anderen Indikatoren verstehen, die Herstellung von Zusammenhängen erfordert aber wiederum eine Störungstheorie: Ganz theoriefrei zu diagnostizieren ist eine Illusion. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 120 / 323 Kriterien-Ähnlichkeit Beispiel: „Hat keine engen Freunde oder Bekannte“. Die Gründe dafür, warum ein Klient keine engen Freunde oder Bekannte hat, sind z.B. bei schizoiden und selbstunsicheren Klienten deutlich verschieden: – Selbstunsichere hätten gerne Bekannte und Freunde, trauen sich aber nicht, Kontakt herzustellen aus Angst vor Ablehnung. – Schizoide zeigen dagegen gar kein Interesse an Freunden und Bekannten. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 121 / 323 Kriterien-Ähnlichkeit Oberflächlich sind die Kriterien ähnlich, tatsächlich sind die Kriterien aber mit ganz unterschiedlichen psychischen Faktoren verbunden. D.h.: Die oberflächlich ähnlichen Kriterien haben in verschiedenen Störungen eine unterschiedliche Bedeutung. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 122 / 323 Kriterien-Ähnlichkeit Eine ganz wesentliche Folgerung daraus ist: Zum Diagnostizieren sind die DSM-Kriterien hilfreich; um aber valide und reliabel diagnostizieren zu können, reichen DSM- (genauso: ICD-) Kriterien nicht aus; der Diagnostiker / Therapeut muss vielmehr eine Störungstheorie besitzen, er muss verstehen, was die einzelnen Kriterien im Kontext der Störung bedeuten. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 123 / 323 Kriterien-Ähnlichkeit So bedeutet z.B. das „Streben nach Bewunderung“ bei Histrionikern und Narzissten unterschiedliches: – Ein histrionischer Klient möchte wegen des Aussehens bewundert werden, dafür, wie interaktionell kompetent er ist u.a., er will Aufmerksamkeit; das zentrale Motiv ist Wichtigkeit. – Ein narzisstischer Klient will wegen seiner Leistung bewundert werden, will als Person anerkannt werden, das zentrale Motiv ist Anerkennung. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 124 / 323 Kriterien-Ähnlichkeit Versteht ein Diagnostiker nicht nur die Oberflächenmerkmale, sondern auch die zentralen Motive, die Schemata und die Zusammenhänge, dann kann er Histrioniker und Narzissten wieder voneinander unterscheiden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 125 / 323 Expertise-System Im Grunde ist das DSM ein Expertise-System: Der Diagnostiker kann das System nur dann anwenden, wenn er seht viel Zusatzwissen (= Expertenwissen) darüber hat, was genau mit den einzelnen Begriffen gemeint sein soll und welche Indikatoren eigentlich auf was hinweisen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 126 / 323 Expertise-System Beispiel: Nehmen wir als Beispiel das erste Kriterium der histrionischen PD: „Die Person fühlt sich unwohl in Situationen, in denen sie nicht im Mittelpunkt steht“. Wie kann ein Diagnostiker wissen, wann und ob dieses Kriterium zutrifft? © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 127 / 323 Expertise-System In der Regel teilt ein Klient dem Diagnostiker dies nicht direkt mit. Und wenn der Diagnostiker direkt fragt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Klient nicht valide, sondern nach sozialer Erwünschtheit antwortet. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 128 / 323 Expertise-System Also muss der Diagnostiker indirekte Informationen des Klienten erhalten, Erzählungen auswerten und Schlüsse ziehen. Dazu muss er aber Vorstellungen davon haben, was für einen Klienten denn „unwohl“ heißt, was es heißt, „im Mittelpunkt zu stehen“, usw.. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 129 / 323 Expertise-System Alle diese allgemeinen Begriffe muss der Diagnostiker mit den Informationen des Klienten füllen. Dazu muss er eine Reihe, z.B. hoch komplexer Schlussfolgerungen ziehen. Wann hat ein Klient einen „impressionistischen Sprachstil“? Wann zeigt er „eine oberflächlich wirkende Emotion“? © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 130 / 323 Expertise-System Um dies überhaupt beurteilen zu können, muss ein Diagnostiker über sehr viel Wissen verfügen, in der Lage sein, sein Wissen und seine Schlussfolgerungen zu reflektieren usw., d.h. der Diagnostiker muss ein klinisch-psychologischer Experte sein. Nicht das DSM stellt Diagnosen: Ein Diagnostiker stellt Diagnosen aufgrund der DSM-Kriterien und aufgrund seines Wissens, mit dem er die Kriterien überhaupt erst anwenden kann! © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 131 / 323 Expertise-System PD sind komplexe Störungen; daher werden komplexe Diagnostik-Strategien wohl unumgänglich sein. Komplexe diagnostische Strategien sind aber nur von Personen zu leisten, die über eine hohe Expertise verfügen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 132 / 323 Cluster-Analyse Saß et al. 1995 führten auf der Basis umfangreichen Diagnosematerials hierarchische Clusteranalysen zur Bestimmung von Ähnlichkeitsrelationen zwischen den einzelnen Diagnosen durch. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 133 / 323 Cluster-Analyse Dabei ergab sich folgende Cluster-Lösung: schizotypisch paranoid zwanghaft schizoid dependent selbstunsicher narzisstisch histrionisch Borderline antisozial passiv-aggressiv © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 134 / 323 Cluster-Analyse Damit wird deutlich, dass die DSM-Einteilungen von PD keine empirischen Einteilungen sind. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 135 / 323 Vergleich Vergleicht man die DSM-Gruppen mit den empirischen Clustern, so zeigt sich: I DSM Empirische Cluster - paranoide I - schizotypisch - schizoide - paranoid - schizotypische - zwanghaft - schizoid II - histrionische II - narzißtische - dependent - selbstunsicher - borderline - antisoziale III - narzißtisch - histrionisch III - selbstunsichere IV - borderline - dependente - antisozial - zwanghafte - passiv-aggr. - passiv-aggressive © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 136 / 323 Strukturierte Interviews 7. Strukturierte Interviews © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 137 / 323 Strukturierte Interviews Strukturierte Interviews sind solche, bei denen ein Interviewer dem Klienten genau vorgeschriebene Fragen in genau vorgeschriebener Reihenfolge stellt. Die Interviews basieren dabei auf dem DSM (wie z.B. das SKID II) oder auf dem ICD. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 138 / 323 Beispiel Ein Beispiel für ein strukturiertes Interview ist das IPDE („International Personality Disorder Examination“) von Mombour et al. (1993), das auf dem ICD 10 basiert. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 139 / 323 Strukturierte Interviews Diese Art der Diagnostik ist nicht völlig unproblematisch. Zwar garantiert sie, dass der Diagnostiker alle Kriterien tatsächlich erhält, und dass er dies strukturiert und damit standardisiert tut. Dennoch sind die Fragen z.T. leicht durchschaubar und können Klienten leicht veranlassen, nach sozialer Erwünschtheit zu antworten. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 140 / 323 Strukturierte Interviews Wenn man ernst nimmt, dass PD Beziehungsstörungen sind, dann hat dies auch eine bedeutende Konsequenz für die Diagnostik. Die Erhebung jeder vertraulichen, unangenehmen, peinlichen oder intimen Information setzt eine vertrauensvolle Beziehung voraus, wenn man valide Daten erhalten will. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 141 / 323 Strukturierte Interviews Ohne vertrauensvolle Beziehung muss man mit Antworten nach sozialer Erwünschtheit rechnen: Die Klienten werden, wenn sie es peinlich finden, dem Interviewer nicht sagen: „Klar, ich muss immer im Mittelpunkt stehen, sonst fühle ich mich nicht wohl!“. Was aber schon für Klienten ohne PD zutrifft, trifft für Klienten mit PD noch in höherem Ausmaß zu. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 142 / 323 Strukturierte Interviews Daher machen solche Interviews wahrscheinlich nur dann Sinn, wenn zwischen Klient und Diagnostiker bereits eine vertrauensvolle Beziehung besteht. Ist das nicht der Fall, kann man Validität und Reliabilität der Daten trotz der Strukturierung oft bezweifeln. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 143 / 323 Externe Folien an dieser Stelle einlegen!!! © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 144 / 323 Fragebögen 8. Fragebögen © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 145 / 323 Fragebogen-Verfahren Man kann die DSM-Kriterien (oder andere) auch in Fragebogen-Items umsetzen. Kuhl und Kazen (1996) haben aufgrund einer spezifischen Theorie der Persönlichkeitsstörung von Kuhl (1995), dem sog. „STAR-Modell“, einen Fragebogen entwickelt: Das „Persönlichkeitsstil-undStörungs-Inventar“ (PSSI). © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 146 / 323 PSSI Das Problem von Fragebögen ist prinzipiell das Gleiche wie das von Interviews: Klienten können geneigt sein, nach sozialer Erwünschtheit zu antworten. Diese Tendenz ist beim PSSI meiner Einschätzung nach wegen der meist positiven Frageformulierungen so gering wie bei keinem anderen Instrument (Interview oder Fragebogen). © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 147 / 323 PSSI Der PSSI eignet sich in der Praxis für ein erstes Screening, um auf eventuell vorliegende PD aufmerksam zu werden. Es sollte jedoch immer mit einer klinischen Diagnose verstanden werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 148 / 323 Diagnostik-Fragebogen: PSSI 1 Persönlichkeits-Stil- und Störungs-Inventar PSSI von Kuhl: Skalierung vierstufig: (trifft gar nicht zu <---> trifft ausgesprochen zu) paranoid – Viele Menschen nützen es aus, wenn man Schwäche zeigt. – Ein gewisses Misstrauen gegenüber anderen ist oft angebracht. schizoid – Intimität zu anderen Menschen ist mir eher unangenehm. – Ich wahre immer die Distanz zu anderen Menschen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 149 / 323 Diagnostik-Fragebogen: PSSI 2 schizotypisch – Ich habe schon öfter Eingebungen gehabt. – Ich spüre die Bedürfnisse anderer oft eher, als sie sie selbst bemerken. – Ich glaube, dass andere manchmal meine Gefühle spüren, auch wenn sie sich anderswo aufhalten. – Ich glaube, dass Strahlungen das Denken und Fühlen der Menschen beeinflussen. – Es gibt viele Dinge, die man mit dem Verstand nicht erklären kann. – Ich glaube an Gedankenübertragung. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 150 / 323 Diagnostik-Fragebogen: PSSI 3 antisozial – Jeder ist sich selbst der Nächste. – Meine Bedürfnisse lebe ich aus, auch wenn andere zurückstecken müssen. borderline – Ich spüre oft eine innerliche Leere. – Oft kann ich selbst bei kleinen Enttäuschungen meine Wut kaum noch kontrollieren. histrionisch – Ich kann Menschen für mich einnehmen, wenn ich es will. – Ich kann sehr charmant sein. – Ich habe auf das andere Geschlecht eine besondere Anziehungskraft. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 151 / 323 Diagnostik-Fragebogen: PSSI 4 narzisstisch – Wenn andere nicht auf meine Wünsche eingehen, kann ich böse werden. – Ich habe ein ausgeprägtes Gefühl für das Besondere. selbstunsicher – Viele Seiten von mir zeige ich nicht, weil ich befürchte, dass ich die Sympathie mancher Menschen verlieren würde. – Wenn mir eine Schwäche bewusst wird, kann mich das eine ganze Zeit belasten. abhängig – Wenn ich ganz allein bin, fühle ich mich oft hilflos. – Ich lehne mich gern an eine starke Person an. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 152 / 323 Diagnostik-Fragebogen: PSSI 5 zwanghaft – Ich bin ein Mensch mit festen Gewohnheiten. – Es stört mich sehr, wenn andere meinen geregelten Tagesablauf durcheinanderbringen. negativistisch – Ich fühle mich von anderen oft missverstanden. – Viele Menschen haben es nicht verdient, dass sie im Leben so viel Glück haben. – Ich bin in meinem Leben oft ungerecht behandelt worden. – Bei Menschen, die zunächst sympathisch wirken, sehe ich sehr schnell auch die negativen Seiten. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 153 / 323 Diagnostik-Fragebogen: PSSI 6 depressiv – Ich fühle mich oft niedergeschlagen und kraftlos. – Mir schwindet oft die Hoffnung, dass Dinge, die mir nicht gefallen, je anders werden. selbstlos – Ich fühle mich wohl, wenn ich für jemanden sorgen kann. – Wenn andere mich brauchen, bin ich immer zum Helfen bereit. aggressiv – Wenn Leute sich gegen mich wenden, kann ich sie fertigmachen. – Ich greife lieber an, als mich angreifen zu lassen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 154 / 323 Diagnostik-Fragebogen: PSSI 1 rhapsodisch – Auch langweilige Arbeiten kann ich mir meist durch irgendwas Schönes versüßen. – Ich finde fast alle Menschen, die ich kenne, einfach wunderbar. – Ich kann mich jeden Tag für irgendwelche Dinge oder Menschen begeistern. – Mein Optimismus ist unbesiegbar. – Es bringt nichts, wenn man sich in schwierige Gefühle vertieft. – Ich interessiere mich für alles, was mir nette Leute über sich erzählen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 155 / 323 Externe Folien an dieser Stelle einlegen!!! © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 156 / 323 Rating 9. Rating des Interaktionsprozesses © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 157 / 323 Rating des Interaktionsprozesses Rating-Verfahren des Interaktionsverhaltens sind nicht-reaktive Messverfahren. Sie werden angewandt auf Material, das nicht explizit zu Diagnose-Zwecken erhoben worden ist. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 158 / 323 Rating des Interaktionsprozesses So kann man mit einem Rating-Verfahren z.B. eine Therapiestunde einschätzen, in der Therapeut und Klient über irgendwelche Themen sprechen. Vorteil dieser Verfahren ist vor allem, dass das tatsächliche Interaktionsverhalten des Klienten erfasst werden kann und nicht ihre Einschätzung oder Darstellung ihres Interaktionsverhaltens. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 159 / 323 Rating des Interaktionsprozesses Dadurch kann auch die Tendenz, im Sinne sozialer Erwünschtheit zu reagieren, stark reduziert werden. Im Therapieteil der Vorlesung wird ein InteraktionsRating vorgestellt werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 160 / 323 Reliabilitäten 10. Reliabilitäten © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 161 / 323 Reliabilitäten Eine wesentliche Frage für die Beurteilung der Güte der Diagnostik von PD ist die nach der Reliabilität: – Re-Test-Reliabilität – Inter-Rater-Reliabilität © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 162 / 323 Reliabilitäten A priori muss man bei PD-Diagnose-Verfahren damit rechnen, dass die Reliabilitäten niedriger ausfallen werden als bei der Diagnose anderer Störungen, und zwar weil – PD ein sehr komplexes und damit schwer zu erfassendes Phänomen ist; – die Störung sich direkt auf die Diagnostik auswirkt. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 163 / 323 Reliabilitäten Persönlichkeitsstörungen umfassen sehr viele Bereiche des Denkens, Fühlens und Handelns; wie ausgeführt, genügt es auch im Grunde nicht, Oberflächenmerkmale „abzufragen“. Dies macht die Diagnostik von PD zu einem komplexen Vorgang, der hohe Expertise erfordert. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 164 / 323 Reliabilitäten Anders als andere Klienten bringen Klienten mit Interaktionsstörungen ihr Problem unmittelbar in die diagnostische Situation mit ein. Ein Klient, dessen Problem Misstrauen ist, wird auch in der diagnostischen Situation misstrauisch sein; ein Klient, der das Bedürfnis hat, sich als „toll“ darzustellen, wird sich auch dem Diagnostiker als „toll“ darstellen usw.. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 165 / 323 Reliabilitäten Wenn der Diagnostiker dieses Verhalten direkt erfassen kann, kann er damit sogar ZusatzInformationen erhalten (er „sieht“ das Misstrauen des Klienten unmittelbar). Wenn das diagnostische Instrument aber nur auf Beantwortung von Fragen vertraut, können die Antworten sehr verzerrt werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 166 / 323 Reliabilitäten Die Reliabilitäten von DSM- oder ICD-basierter Diagnostik sind wesentlich davon abhängig, ob das diagnostische Vorgehen strukturiert-systematisch oder unstrukturiert erfolgt. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 167 / 323 Reliabilitäten Unstrukturierte Inter-Rater Rate-Re-Rate .46 - .61 .54 .78 .55 Interviews Strukturierte Interviews © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 168 / 323 Reliabilitäten Test-Retest-Reliabilitäten – Personality Diagnostic .40 - .47 Questionnaire (Hyler et al. 1983) – SCID II : Structural .20 - .28 Clinical Interview for DSM III-R (Spitzer et al., 1987) – Personality Disorder .40 - .47 Examination (Looranger, 1987) – Internationale Checklisten .38 - .52 für Persönlichkeitsstörungen (Bronisch et al., 1992) © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 169 / 323 Co-Morbidität mit Achse-I Man muss berücksichtigen, dass die relativen Ausprägungen der einzelnen Störungen in einer Stichprobe sehr stark von der Art der Stichprobe abhängen, z.B. davon, ob es sich um eine ambulante oder eine stationäre Stichprobe handelt. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 170 / 323 Modell der Doppelten Handlungsregulation Das „Modell der Doppelten Handlungsregulation“ ist eine allgemeine Theorie über das Funktionieren von PD. Die einzelnen Komponenten des Modells müssen dann noch für einzelne PD spezifiziert werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 171 / 323 Das Modell der doppelten Handlungsregulation (Sachse, 1997) MOTIV-EBENE: Authentische Bedürfnisse Motive Interaktionelle Ziele SCHEMA-EBENE: Annahmen / Erwartungen Beziehungsschemata Verarbeitungskompetenzen Handlungskompetenzen Handlungen in Situationen Konsequenzen Selbstschemata SPIEL-EBENE: Images und Appelle Interaktionelle Ziele / Vermeidungsziele Verarbeitungskompetenzen Handlungskompetenzen Diskrepanz Strategisches Handeln Testverhalten Kurzfristige Konsequenzen Langfristige Konsequenzen Beziehungsmotive Beziehungsmotive sind die Grundmotive der authentischen Regulationsebene. Auf der höchsten Hierarchieebene sind sie sehr allgemein gefasst. Auf der Ebene der interaktionellen Ziele sind die konkret operationalisiert. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 173 / 323 Beziehungsmotive Die sechs Beziehungsmotive, die hier behandelt werden sollen, sind: – Anerkennung – Wichtigkeit – Verlässlichkeit – Solidarität – Autonomie – Territorialität/Grenzen © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 174 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Motiv nach „Anerkennung, Zuwendung, Liebe“ Es ist ein Motiv, – von Interaktionspartnern als Person gemocht und geschätzt zu werden; – von Interaktionspartnern als Person geachtet und respektiert zu werden; – von Interaktionspartnern als Person positiv definiert zu werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 175 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Operationalisierungen können sein: – Anerkennung bekommen – Lob bekommen – akzeptiert werden – positive Rückmeldung erhalten – freundlich behandelt werden – liebevoll behandelt werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 176 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Positive Rückmeldungen sind z.B.: – Du bist ok. – Wir mögen Dich. – Wir akzeptieren Dich als Person. – Du kannst XY. – Wir trauen Dir etwas zu. – Wir sind stolz auf Dich. – Du hast positive Eigenschaften. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 177 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Bei positiver Rückmeldung kann es sich durchaus um realistische positive Rückmeldung handeln, die mit respektvoller Kritik und auch negativem Feedback kombiniert werden kann. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 178 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Negative Rückmeldungen sind z.B.: – Du bist nicht ok. – Du bist nicht so ok, wie Du bist. – Du bist als Mädchen / als Junge nicht ok. – Du bist ein Versager. – Wir trauen Dir nichts zu. – Wir schämen uns für Dich. – Wir verachten Dich. – Du blamierst uns. – Du bist völlig scheiße. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 179 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Wie bei allen Beziehungsmotiven muss die Rückmeldung nicht in erster Linie verbal erfolgen; sie kann stark non-verbal oder para-verbal erfolgen oder dadurch, dass Informationen nicht gegeben werden (z.B. zeigt das Kind den Eltern stolz ein Bild; die Eltern reagieren aber gar nicht darauf). © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 180 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Auch müssen die Rückmeldungen nicht massiv erfolgen. Es kann auch schwach negative Rückmeldungen über einen langen Zeitraum hinweg konsistent geben. Solche konsistent negativen Rückmeldungen führen ebenfalls zu einem negativen, manchmal sogar zu einem sehr negativen Selbst-Schema. Klienten haben hier oft falsche Such-Modelle. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 181 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Positive Rückmeldungen führen zu positiven Einträgen im Selbst-Schema, z.B.: – ich bin ok; – ich verfüge über bestimmte Fähigkeiten; – ich bin erfolgreich; – ich bin liebenswert; – ich kann mir etwas zutrauen; – ich werde Aufgaben bewältigen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 182 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Personen mit positiven Interaktionserfahrungen sind demnach solche, die sich selbst positiv sehen und sich selbst positiv und akzeptierend gegenüberstehen. Personen mit einem positiven Selbst-Schema nehmen auch an, dass sie von anderen positiv eingeschätzt werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 183 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Positive Rückmeldungen führen auch zu positiven Einträgen ins Beziehungs-Schema: Beziehungen sind angenehm, förderlich; in Beziehungen werde ich geliebt und geachtet; in Beziehungen werde ich respektiert, nicht abgewertet. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 184 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Personen mit diesen positiven Interaktionserfahrungen sind demnach solche, die auch Beziehungen positiv einschätzen: Sie erwarten, dort Zuwendung und Liebe zu finden, Respekt und Akzeptierung. Sie haben damit ein Konzept, dass sich Beziehungen lohnen. Und: Dass Beziehungen nicht Selbstwert-bedrohlich sind. Und sie haben ein Konzept, dass sie sich auf Beziehungen einlassen können. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 185 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Negative Rückmeldungen bezüglich dieses Motivs führen zu negativen Einträgen ins Selbst-Schema: – ich bin nicht ok; – ich bin nicht liebenswert; – ich bin ein Versager; – ich kann nichts; – ich kann Aufgaben nicht bewältigen; – ich werde scheitern. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 186 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Personen mit diesen negativen Interaktionserfahrungen zeigen damit eine negative Selbsteinschätzung: sie trauen sich selbst wenig zu, finden sich nicht akzeptabel, halten sich selbst für Versager u.a.; oft können sie sich selbst auch nicht leiden, werten sich selbst ab u.a. Und sie nehmen auch an, dass sie von anderen negativ eingeschätzt und bewertet werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 187 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Personen mit negativem Selbst-Schema reagieren oft auch hyper-allergisch auf Kritik: Denn Kritik aktiviert das negative Schema und führt zu einem negativen „state of mind“. Solche Personen vermeiden dann oft auch negative Rückmeldungen, Kritik oder Situationen, in denen sie scheitern könnten. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 188 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Negative Rückmeldungen führen auch zu negativen Einträgen im Beziehungskonzept, z.B.: – in Beziehungen erhalte ich keine Anerkennung; – Beziehungen sind nicht förderlich; – in Beziehungen wird man abgewertet; – wenn man eine enge Beziehung hat, ist man verletzlich; – Beziehungen sind (potentiell) Selbstwertbedrohlich. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 189 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Personen mit dieser Interaktionserfahrung haben damit auch eine eher zurückhaltende bis ablehnende Haltung Beziehungen gegenüber: Beziehungen werden als nicht erforderlich angesehen, in massiven Fällen sogar als bedrohlich. Oder die Personen lassen sich nicht völlig auf Beziehungen ein, behalten in hohem Maße Autonomie, öffnen sich nur zögerlich, gehen Bindungen nur unter Vorbehalt ein. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 190 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Sie lassen oft auch nur solche Beziehungspartner an sich heran, die „sicher“ sind, von denen sie sicher annehmen, dass sie nicht abgewertet werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 191 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Oft bilden sich hier weitere Überzeugungen aus wie: – man muss autonom bleiben; – man kann sich nur auf sich selbst verlassen; – am besten bleiben Beziehungen unverbindlich; – man muss eine Beziehung jederzeit auch wieder verlassen können. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 192 / 323 Beziehungsmotiv: Anerkennung Die Personen können auch die Überzeugung entwickeln, dass sie etwas aktiv tun und leisten müssen, um anerkannt werden zu können. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 193 / 323 Beziehungsmotiv: Wichtigkeit Motiv nach Wichtigkeit Es ist das Motiv, – im Leben eines Interaktionspartners als Person von Bedeutung zu sein, eine Rolle zu spielen; – für einen Interaktionspartner als Person eine Bereicherung seines Lebens zu sein; – für eine andere Person einen Wert zu haben, wertvoll und wichtig zu sein. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 194 / 323 Beziehungsmotiv: Wichtigkeit Operationalisierungen sind: – wichtig sein – ernst genommen werden – Aufmerksamkeit erhalten – respektiert werden – andere hören zu und setzen sich mit der Person auseinander – zugehörig sein. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 195 / 323 Beziehungsmotiv: Wichtigkeit Positive Rückmeldungen sind z.B.: – ich bin gern mit Dir zusammen; – ich habe Zeit für Dich; – ich spiele gerne mit Dir; – Du bist eine Bereicherung für mein Leben; – Deine Anwesenheit erzeugt bei mir positive Gefühle. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 196 / 323 Beziehungsmotiv: Wichtigkeit Negative Rückmeldungen sind z.B.: – ich habe keine Zeit für Dich; – ich bin nicht gern mit Dir zusammen; – Du störst mich; – Du bist eine Last für mich; – wenn Du nicht wärst, hätte ich Karriere machen können; – seit Du da bist, bin ich krank; – wir haben leider vergessen, Dich rechtzeitig abzutreiben. – Du wirkst toxisch auf mich. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 197 / 323 Beziehungsmotiv: Wichtigkeit Positive Rückmeldungen bezüglich dieses Motivs führen zu positiven Einträgen im Selbst-Schema, z.B.: – ich bin wichtig; – ich habe anderen Personen etwas zu bieten; – ich habe positive Eigenschaften, die von anderen geschätzt werden. – Ich bereichere das Leben anderer. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 198 / 323 Beziehungsmotiv: Wichtigkeit Personen mit positiven Interaktionserfahrungen haben damit Selbst-Schemata, die sie im Hinblick auf ihren „Wert für andere“ oder ihre Chancen auf eine Beziehung optimistisch stimmen: Die Person schätzt Ihren „Marktwert“ der Beziehungen hoch ein. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 199 / 323 Beziehungsmotiv: Wichtigkeit Positive Rückmeldungen bezüglich dieses Motivs führen auch zu positiven Einträgen ins BeziehungsSchema, z.B.: – andere finden mich attraktiv; – ich habe anderen etwas zu bieten; – ich kann im Leben anderer Personen eine wichtige Rolle spielen; – ich werde ernst genommen; – in Beziehungen wird man respektiert; – in Beziehungen wird einem zugehört; – man erhält Aufmerksamkeit. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 200 / 323 Beziehungsmotiv: Wichtigkeit Personen mit positiver Interaktionserfahrung schätzen damit auch Beziehungen positiv ein: Sie erwarten, ernst genommen zu werden, sie erwarten, dass der Partner mit ihnen glücklich ist u.ä. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 201 / 323 Beziehungsmotiv: Wichtigkeit Negative Rückmeldungen bezüglich dieses Motivs führen zu negativen Einträgen im Selbst-Schema: – ich bin nicht wichtig; – ich habe anderen Personen nichts zu bieten; – ich habe Eigenschaften, die andere abstoßen; – im Extremfall: Ich bin toxisch. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 202 / 323 Beziehungsmotiv: Wichtigkeit Personen mit diesen negativen Interaktionserfahrungen zweifeln daran, anderen Personen in Beziehungen etwas zu bieten zu haben: Sie glauben, dass sie keine Eigenschaften aufweisen, die sie für Interaktionspartner wichtig machen könnte. Oder sie glauben sogar, dass sie Eigenschaften haben, die andere abstoßen. Sie nehmen dann auch häufig an, dass sie etwas aktiv tun und leisten müssen, um wichtig zu sein. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 203 / 323 Beziehungsmotiv: Wichtigkeit Negative Rückmeldungen führen auch zu negativen Einträgen im Beziehungs-Schema, z.B.: – ich habe keine Bedeutung im Leben anderer; – andere finden mich nicht attraktiv; – ich bin für andere ein Störfaktor; – ich bin in Beziehungen toxisch; – ich belästige andere; – ich kann von anderen nicht ernst genommen werden; – keiner respektiert mich; – niemand hört mir zu; – ich erhalte keine Aufmerksamkeit. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 204 / 323 Beziehungsmotiv: Wichtigkeit Personen mit diesen negativen Interaktionserfahrungen zweifeln daran, dass sich vom Partner aus positive Beziehungen entwickeln werden: Sie nehmen an, dass der Partner sie nicht wichtig nehmen wird, sie nicht ernst nehmen wird, ihnen nur wenig Aufmerksamkeit und Zeit widmen wird u.ä. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 205 / 323 Beziehungsmotiv: Wichtigkeit Auch Personen mit solchem Schema können hyperallergisch reagieren, wenn – sie ignoriert werden; – sie nicht respektiert werden; – man ihnen nicht zuhört; – man sie ausschließt. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 206 / 323 Beziehungsmotiv: Verlässliche Beziehung Motiv nach verlässlicher Beziehung Es ist das Motiv, – dass eine Beziehung zu einem wichtigen Interaktionspartner verlässlich ist: dass sie auch morgen noch existiert, wenn sie heute besteht. – dass die Beziehung nicht „kündbar“ ist; – dass die Beziehung belastbar ist, nicht durch Krisen in Frage gestellt werden kann. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 207 / 323 Beziehungsmotiv: Verlässliche Beziehung Positive Rückmeldungen sind z.B.: – ich bin bei Dir; – die Beziehung zu Dir ist mir wichtig; – Krisen erschüttern die Beziehung nicht, stellen sie nicht in Frage; – Kritik erschüttert die Beziehung nicht; – man kann sich streiten, ohne die Beziehung zu gefährden; – wenn man eine Zeit lang getrennt war, beeinträchtigt das die Beziehung nicht. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 208 / 323 Beziehungsmotiv: Verlässliche Beziehung Negative Rückmeldungen sind z.B.: – wenn Du nicht spürst, kommst Du ins Heim / ins Internat; – jetzt mag ich Dich nicht mehr, wenn Du xy tust (Bestrafung durch „Liebesentzug“)!; – jetzt ist der Ofen aber aus!; – wenn Du Dich so verhälst, bist Du nicht mehr meine Tochter / mein Sohn! © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 209 / 323 Beziehungsmotiv: Verlässliche Beziehung Positive Rückmeldungen haben vor allem positive Einträge ins Beziehungs-Schema zur Folge, z.B.: – Beziehungen sind verlässlich; – Beziehungen sind stabil; – Beziehungen sind belastbar; – Beziehungen sind wichtiger als Auseinandersetzungen; – Beziehungen sind wichtiger als Normen und Regeln; – Beziehungen sind eine verlässliche Grundlage für eine Lebensgestaltung. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 210 / 323 Beziehungsmotiv: Verlässliche Beziehung Eine Person mit dieser positiven Interaktionserfahrung kann in Beziehungen eine angemessene Streitkultur entwickeln: Sie kann ihre Meinung äußern, auch wenn diese negativ ist, weil sie weiß, dass die Beziehung einen Streit aushalten wird. Sie zweifelt auch nicht bei Krisen daran, dass die Beziehung stabil bleiben wird. Sie kann sich damit auch (ohne Vorbehalte) auf eine Beziehung einlassen, eine Bindung eingehen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 211 / 323 Beziehungsmotiv: Verlässliche Beziehung Negative Rückmeldungen bezüglich dieses Motivs führen zu negativen Einträgen ins BeziehungsSchema: – Beziehungen sind nicht verlässlich; – jeder Streit stellt die Beziehung in Frage; – wenn ich meine Bedürfnisse äußere, kann das schon die Beziehung gefährden. – Beziehungen können jederzeit gekündigt werden, manchmal sogar ohne Vorwarnung. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 212 / 323 Beziehungsmotiv: Verlässliche Beziehung Personen mit dieser negativen Interaktionserfahrung haben keine Streitkultur: Sie trauen sich nicht, eigene Meinungen zu äußern, aus Angst, damit die Beziehung in Frage zu stellen; oder sie passen sich den Wünschen des Interaktionspartners an, um die Beziehung nicht zu gefährden. Sie können sich auch nie völlig auf Beziehungen einlassen: Man kann sich nicht wirklich binden, wenn man jederzeit verlassen werden kann. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 213 / 323 Beziehungsmotiv: Verlässliche Beziehung Auch dieses Schema kann zu hyper-allergischen Reaktionen führen: – Jede Beziehungskrise kann starke Ängste auslösen, verlassen zu werden. – Jede Unzufriedenheit des Partners kann zur Angst führen, dass der Partner die Beziehung verlässt. Diese Ängste können zu einem kompensatorischen Verhalten führen, indem die Personen aktiv versuchen, etwas zu tun, was die Partner an sie bindet. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 214 / 323 Beziehungsmotiv: Solidarität Motiv nach solidarischer Beziehung Es ist das Motiv, – dass sich jemand um mich kümmert, für mich da ist, wenn ich ihn brauche; – dass ich Hilfe bekomme, wenn ich welche brauche, weil ich krank bin, in der Klemme stecke, es mir schlecht geht usw. – dass ich Schutz und Unterstützung erhalte, wenn ich angegriffen werde. Das Motto heißt: Wenn ich Dich brauche, dann kommst Du. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 215 / 323 Beziehungsmotiv: Solidarität Positive Rückmeldungen sind z.B.: – wenn ich krank bin, nimmt sich der Interaktionspartner Zeit und kümmert sich; – wenn ich vom Lehrer kritisiert werde, dann werde ich verteidigt; – wenn ich Probleme habe, ist jemand da, der mir zuhört und der mir hilft; – wenn es mir schlecht geht, dann ist jemand da, um mich zu trösten usw. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 216 / 323 Beziehungsmotiv: Solidarität Negative Rückmeldungen sind z.B.: – ich muss ins Krankenhaus und niemand besucht mich; – mir geht es schlecht, aber niemand kümmert sich um mich; – ich habe Probleme, aber niemand unterstützt mich (ich bekomme z.B. keine Unterstützung, wenn ich Probleme in der Schule habe); – ein Lehrer kritisiert mich und mein Vater sagt: Wenn der nicht spurt, hauen Sie ihm richtig eins um die Ohren; – die Nachbarin beschwert sich über mich und ich bekomme Stubenarrest, ohne dass meine Meinung überhaupt nur gehört wird u.ä. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 217 / 323 Beziehungsmotiv: Solidarität Positive Rückmeldungen führen zu positiven Einträgen ins Beziehungs-Schema, z.B.: – ich kann mich darauf verlassen, dass ein Partner mir hilft, wenn ich Hilfe brauche; – ich werde Schutz bekommen, wenn ich angegriffen werde; – wenn es mir schlecht geht, ist jemand für mich da; – ich kann mich darauf verlassen, dass mein Partner für mich da ist, wenn ich ihn brauche. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 218 / 323 Beziehungsmotiv: Solidarität Personen mit solchen positiven Interaktionserfahrungen fühlen sich in Beziehungen geborgen und aufgehoben: Sie haben das Gefühl, nicht allein zu sein, das Gefühl, dass der Partner im Ernstfall an ihrer Seite steht. Und sie haben nicht den Eindruck, dass sie sich nur auf sich selbst verlassen können. Diese Überzeugung erhöht die Intention, sich auf Beziehungen einzulassen, sich zu binden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 219 / 323 Beziehungsmotiv: Solidarität Negative Rückmeldungen führen zu negativen Einträgen ins Beziehungs-Schema, z.B.: – wenn ich jemanden brauche, ist keiner da; – ich kann mich auf niemanden verlassen; – ich werde keine Hilfe erhalten; – ich kann mich nur auf mich selbst verlassen; – ich muss auch dafür sorgen, dass ich mich auf mich verlassen kann. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 220 / 323 Beziehungsmotiv: Solidarität Personen mit diesen negativen Interaktionserfahrungen fühlen sich in Beziehungen nicht geborgen; sie haben den Eindruck, dass ihr Partner sich nicht um sie kümmern wird, wenn sie Hilfe brauchen. Das führt zu einem Vorbehalt gegenüber der Beziehung: Man muss immer ein gewisses Ausmaß an Autonomie bewahren, um sich im Ernstfall selbst helfen zu können. Man muss daher immer Autonomie aufrechterhalten. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 221 / 323 Beziehungsmotiv: Autonomie Motiv nach Autonomie und nach persongerechter Förderung der eigenen Autonomie Es ist ein Motiv – danach, selbst zu bestimmen: die Freunde, die Kleidung, die Freizeit; ein Bedürfnis, eigene Entscheidungen zu treffen und das Leben selbst zu gestalten. – danach, als Kind oder Jugendlicher so viel Autonomie zu erhalten, wie man will und verkraften kann, also weder unter- noch überfordert zu werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 222 / 323 Beziehungsmotiv: Autonomie Positive Rückmeldungen sind, in Übereinstimmung mit dem Selbstbestimmungs-Bedürfnis, dem Kind oder Jugendlichen Autonomie-Bereiche einzuräumen, z.B.: – sich alleine anzuziehen; – sich Freunde selbst zu wählen; – die eigene Kleidung selbst zu bestimmen; – die Einrichtung des eigenen Zimmers zu bestimmen u.ä. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 223 / 323 Beziehungsmotiv: Autonomie Negative Rückmeldungen sind: – das Kind einzuschränken (Over-Protectiveness): Dem Kind eigene Kleidung, Freunde u.a. vorzuschreiben, obwohl das Kind das nicht mehr will; – das Kind zu kontrollieren: das Kind ständig zu überwachen, in seiner Bewegung einzuschränken; – dem Kind zu viel Autonomie zu geben /z.B. eigenen Schlüssel haben und Essen selber kochen, obwohl sich das Kind davon überfordert fühlt). © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 224 / 323 Beziehungsmotiv: Autonomie Positive Rückmeldungen führen auch zu positiven Einträgen ins Beziehungs-Schema: – ich bin ein „origin“: ich bestimme über mein Leben; – ich habe Entscheidungsfreiheit; – ich habe Handlungsspielsraum; – in Beziehungen habe ich eigenen Entscheidungsraum. – selbst wenn ich eine Beziehung eingehe, kann ich noch wichtige Aspekte meines Lebens selbst bestimmen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 225 / 323 Beziehungsmotiv: Autonomie Personen mit positiven Interaktionserfahrungen zeigen damit eine internale Kontrollüberzeugung: Sie sehen sich als „origin“ ihrer Taten und können so auch Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Damit muss man auch eine Beziehung nicht als bedrohliche Einschränkung wahrnehmen; man kann auch freiwillig Entscheidungsbereiche abgeben und Kompromisse machen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 226 / 323 Beziehungsmotiv: Autonomie Personen mit dieser Interaktionserfahrung fühlen sich in Beziehungen nicht eingeschränkt; sie reagieren aber auf reale Einschränkungen oft auch mit einer Verteidigung ihrer Freiheiten. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 227 / 323 Beziehungsmotiv: Autonomie Negative Rückmeldungen bezüglich dieses Motivs führen zu negativen Eintragungen ins Selbst-Schema: – ich kann nicht über mein Leben bestimmen; – ich werde von außen kontrolliert; – ich werde fremdbestimmt; – Beziehungen schränken ein. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 228 / 323 Beziehungsmotiv: Autonomie Personen mit dieser negativen Interaktionserfahrung weisen damit eine starke externale Kontrollüberzeugung auf: Sie fühlen sich fremdbestimmt und das führt oft auch dazu, wenig Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 229 / 323 Beziehungsmotiv: Autonomie Negative Rückmeldungen führen auch zu negativen Einträgen im Beziehungskonzept, z.B.: – ich werde vom Partner kontrolliert; – ich werde vom Partner eingeschränkt; – eine Beziehung einzugehen bedeutet, seine Freiheit zu verlieren, u.ä. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 230 / 323 Beziehungsmotiv: Autonomie Überforderungen im Bereich Autonomie können zu Schemata führen wie: – ich muss alles allein machen; – ich muss dafür sorgen, dass ich unabhängig bleibe; – ich darf meine Autonomie niemals aufgeben; – ich kann mich nie ganz auf eine Beziehung einlassen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 231 / 323 Beziehungsmotiv: Autonomie Personen mit derart negativen Interaktionserfahrungen fühlen sich in Partnerschaften oft eingeengt, kontrolliert, fremdbestimmt oder sie sehen Partnerschaften als unverbindlich an: In jedem Fall zeigen sie damit aber Vorbehalte gegen eine engere Bindung. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 232 / 323 Beziehungsmotiv: Grenzen Motiv nach eigener Domäne oder der Unverletzlichkeit der eigenen Grenzen Es ist ein Motiv, – eine eigene Domäne, ein eigenes Territorium definieren zu können; – über das man selbst verfügt und bei dem man bestimmen kann, wer eintreten darf und wer nicht; – und dessen Grenzen sicher sind und von anderen respektiert werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 233 / 323 Beziehungsmotiv: Grenzen Positive Rückmeldungen sind z.B.: – wenn das Kind seinen Schreibtisch als seine Domäne definiert, dass niemand daran geht; – dass eigene Bereiche wie Briefe, Tagebücher, Aufzeichnungen nicht eingesehen werden; – dass Erwachsene klopfen, wenn sie das Zimmer betreten; – dass die Grenzen des eigenen Körpers vollständig respektiert werden; – dass Grenzen von Interaktionspartnern respektiert werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 234 / 323 Beziehungsmotiv: Grenzen Negative Rückmeldungen sind z.B.: – Mama räumt den Schreibtisch des Kindes auf; – Mama liest Briefe oder Tagebücher; – Mama schmeißt ohne Zustimmung des Kindes Stofftiere weg; – Vater verübt sexuellen Missbrauch; – Vater schlägt das Kind (Gewalt-Missbrauch). © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 235 / 323 Beziehungsmotiv: Grenzen Positive Rückmeldungen führen zu positiven Eintragungen im Selbstkonzept, z.B.: – ich bestimme selbst über meine Domäne; – ich kann meine Grenzen gut verteidigen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 236 / 323 Beziehungsmotiv: Grenzen Positive Rückmeldungen führen auch zu positiven Eintragungen ins Beziehungskonzept: – meine Grenzen werden von anderen respektiert; – andere nehmen meine Grenzen wahr. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 237 / 323 Beziehungsmotiv: Grenzen Personen mit dieser Interaktionserfahrung halten ihre Domäne damit auch in Beziehungen für sicher: Sie gehen davon aus, dass Partner Grenzen respektieren, sie vertrauen dem Partner diesbezüglich. Notfalls können sie ihre Grenzen dann aber auch wirklich effektiv verteidigen. Daher sind sie bezüglich ihrer Grenzen nicht in „Alarmbereitschaft“. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 238 / 323 Beziehungsmotiv: Grenzen Negative Rückmeldungen führen zu negativen Einträgen im Selbst-Schema, z.B.: – ich kann meine Grenzen nicht verteidigen; – ich kann meine Domäne nicht schützen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 239 / 323 Beziehungsmotiv: Grenzen Personen mit solchen Interaktionserfahrungen sind unsicher, was ihre Kompetenzen zum Schutz ihrer Grenzen betrifft; sie sind daher sehr sensibel gegen alle Anzeichen von Grenzverletzung und reagieren auf vermeintliche Grenzüberschreitungen allergisch. Eine Konsequenz kann auch sein, auf Grenzverletzungen sofort sehr massiv zu reagieren, weil man glaubt, dass man nichts mehr tun kann, wenn der „Feind“ erst einmal eingedrungen ist. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 240 / 323 Beziehungsmotiv: Grenzen Negative Rückmeldungen führen auch zu negativen Einträgen ins Beziehungs-Schema, z.B.: – mein Partner wird meine Grenzen nicht respektieren; – jeder übertritt meine Grenze und – jede Grenzüberschreitung ist mit Abwertung, Verletzung, Kränkung u.a. verbunden; – Interaktionspartner gehen über Grenzen und richten im Territorium Schaden an. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 241 / 323 Beziehungsmotiv: Grenzen Personen mit dieser Interaktionserfahrung sind daher Partnern gegenüber sehr misstrauisch, lassen sich nicht „in die Karten gucken“, verteidigen ihre Grenzen absolut und bestehen oft kleinlich auf der Einhaltung von Grenzen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 242 / 323 Beziehungsmotiv: Grenzen Negative Erfahrungen führen häufig zu einem hyperallergischen Schema: Jede kleine Grenzverletzung kann dann schon als massive Kränkung, massive Unverschämtheit empfunden werden, woraufhin die Person massiv aggressiv reagieren kann. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 243 / 323 Beziehungsmotiv: Grenzen Ganz besonders traumatisierend wirkt die Überschreitung der körperlichen Grenzen durch Gewalt-Missbrauch oder sexuellen Missbrauch. Dies führt in der Regel zu massiven Traumatisierungen und zu Schemata wie: – ich bin hilflos; – ich bin ausgeliefert; – ich kann mich nicht wehren, u.ä. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 244 / 323 Kompetenzen Um durch Handeln zu einer Befriedigung der Beziehungsmotive gelangen zu können, muss die Person effektiv handeln. Und um effektiv handeln zu können, benötigt die Person Kompetenzen. Es lassen sich unterscheiden: – Verarbeitungs-Kompetenzen – Handlungs-Kompetenzen © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 245 / 323 Verarbeitungs-Kompetenzen Verarbeitungskompetenzen sind solche Wissensstrukturen, mit deren Hilfe man effektiv Situationen analysieren und verstehen kann. Eine wichtige Kompetenz ist Empathie (im sozialpsychologischen Sinne): Die Fähigkeit, sich in andere Personen hineinzuversetzen und zu rekonstruieren, – was die wollen; – was denen wichtig ist; – welche Motive die haben; – was sie erwarten; – was sie verabscheuen usw. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 246 / 323 Verarbeitungs-Kompetenzen Wichtig ist auch: – die Fähigkeit, die Stimmung des Gegenübers einzuschätzen; – zu beurteilen, wo der andere Stärken und Schwächen hat, wie er sich selbst einschätzt; – und wahrzunehmen, wie der Partner gerne gesehen und eingeschätzt werden möchte. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 247 / 323 Verarbeitungs-Kompetenzen Kann man dies rekonstruieren, dann – kann man sich komplementär verhalten; – kann man einen guten Eindruck machen; – kann man das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tun; – kann man es vermeiden, in Fettnäpfchen zu treten. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 248 / 323 Verarbeitungs-Kompetenzen Wichtig ist auch die Fähigkeit zu rekonstruieren, wie man von anderen wahrgenommen wird, was andere von einem denken und halten. In dem Fall kann man auch versuchen, negative Einschätzungen systematisch zu korrigieren. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 249 / 323 Verarbeitungs-Kompetenzen Wesentlich ist auch die Fähigkeit, Situationen zutreffend einzuschätzen und zu wissen, um welche Art von Situation es sich im Augenblick handelt. Das ermöglicht es dann, passende Strategien zu realisieren (und unpassende Handlungen zu vermeiden). © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 250 / 323 Handlungs-Kompetenzen Handlungskompetenzen beziehen sich zum einen auf ein Wissen – über angemessene soziale Regeln; – über angemessenes soziales Verhalten; – darüber, welche Verhaltensweisen in welchen Situationen angemessen sind und welche nicht. Dies sind sehr grundlegende Aspekte „sozialer Kompetenzen“. Es gibt Klienten, die bereits auf diesem Niveau Defizite aufweisen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 251 / 323 Handlungs-Kompetenzen Die Kompetenz bezieht sich aber auch auf die Verfügbarkeit von sozialen Handlungsstrategien, z.B. – eine Strategie, Kontakt herzustellen; – einer Strategie zu flirten; – einer Strategie, smalltalk zu führen; – Strategien der Gesprächsführung; – Strategien der Konfliktbewältigung; – Strategien der Selbstdarstellung u.ä. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 252 / 323 Handlungs-Kompetenzen Es gibt Personen, die nur über wenige, rigide Strategien verfügen. Es gibt auch Personen, die über eine Vielzahl von Strategien verfügen, die hoch elaboriert, verzweigt und hoch flexibel sind. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 253 / 323 Beziehungsschemata Beziehungsschemata sind Annahmen darüber, wie Beziehungen im Allgemeinen funktionieren oder darüber, wie andere Personen Beziehungen der Person gegenüber gestalten werden. – Z.B.: „Beziehungen sind nicht verlässlich.“ – Z.B.: „In Beziehungen werde ich angewertet.“ © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 254 / 323 Beziehungsschemata Personen mit PD weisen in der Regel negative bis massiv negative Beziehungsschemata auf. Diese Schemata kommen, wie ausgeführt, durch Erfahrungen mit zentralen Bezugspersonen in der Biographie zustande. Diese negativen Schemata führen zu entsprechenden Vermeidungszielen auf der Strategie-Ebene. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 255 / 323 Selbst-Schemata Selbst-Schemata sind Annahmen und Überzeugungen über sich selbst. Sie können sich auf unterschiedliche Selbst-Aspekte beziehen: – auf Fähigkeiten, – auf Eigenschaften, – auf Attraktivität u.ä. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 256 / 323 Selbst-Schemata Personen mit PD weisen in der Regel negative bis massiv negative Selbst-Schemata auf. Auch diese Schemata kommen durch biographische Erfahrungen mit wichtigen Beziehungspersonen zustande. Auch sie führen zu Vermeidungszielen auf der Strategie-Ebene. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 257 / 323 Schemata Schemata führen zu einer voreingenommenen Informationsverarbeitung. Bilden sich in der Biographie erste Schemata heraus, dann können diese bereits die weitere Informationsverarbeitung verzerren. Dies hat zur Folge, – dass bereits leicht negative, aber konsistent negative Rückmeldungen zu massiv negativen Schemata führen können; – die Schemata die tatsächliche biographische Situation keineswegs valide abbilden müssen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 258 / 323 Lösungen für das Dilemma Die Bildung von PD hat immer mit der Frustration wichtiger, zentraler Beziehungsmotive zu tun. Eine Person bemerkt, dass sie als Person, für ihr authentisches Handeln, keine Anerkennung, Wichtigkeit usw. erhält. Die wichtigen Bezugspersonen „verweigern“ somit die Befriedigung dieser Motive oder frustrieren sie aktiv. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 259 / 323 Lösungen für das Dilemma Diese Frustrationen führen zum einen dazu, dass das authentische Verhalten eingestellt wird: Das Verhalten wird „gelöscht“, da es nicht zu den erwünschten Effekten führt. Es kann, wenn es bestraft wird, sogar aversiv werden: Die Person kann sich dann gar nicht mehr authentisch verhalten bzw. sogar eine Angst davor entwickeln, sich authentisch zu verhalten. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 260 / 323 Lösungen für das Dilemma Diese Tatsache muss therapeutisch berücksichtigt werden: Klienten können sich dann auch als Erwachsene kaum noch oder gar nicht mehr authentisch verhalten. Daher muss das authentische Verhalten erst wieder aufgebaut werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 261 / 323 Lösungen für das Dilemma Die Frustration der Beziehungsmotive führt außerdem, wie ausgeführt wurde, zu negativen Selbst- und Beziehungs-Schemata. Diese Schemata führen dadurch, dass sie eine voreingenommene Verarbeitung zur Folge haben, zu einer Stabilisierung des Systems. Die negativen Schemata müssen daher in der Therapie dringend und unbedingt modifiziert werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 262 / 323 Lösungen für das Dilemma Mit der Bildung negativer Schemata ist der Entwicklungsprozess aber keineswegs abgeschlossen. Die Person, das Kind oder der Jugendliche verharrt in der Regel nicht untätig in der ungünstigen Position und lässt die Frustration passiv über sich ergehen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 263 / 323 Lösungen für das Dilemma Diese Frustrationen wichtiger Motive stellen für die Person eine Problem-Situation dar. Sie führt zu ungünstigen Konsequenzen, sie fordert aber auch eine aktive Lösung heraus. Menschen ertragen in der Regel nicht passiv einen aversiven Zustand. Sie versuchen vielmehr, mit diesem Zustand aktiv umzugehen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 264 / 323 Lösungen für das Dilemma Man muss vielmehr annehmen, dass Personen eine starke Motivation aufweisen werden, für dieses Problem eine Lösung zu finden. Sie werden versuchen, die Frustrationen zu vermindern und sie werden versuchen, das, was sie brauchen, auf andere Weise zu bekommen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 265 / 323 Lösungen für das Dilemma Die Person wird versuchen für das Dilemma, Bedürfnisse nicht befriedigt zu bekommen, die aber von zentraler Bedeutung sind, eine Lösung zu finden. Und die daraus resultierenden Lösungen sind m.E. der Kern oder der zentrale Aspekt der Persönlichkeitsstörungen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 266 / 323 Lösungen für das Dilemma Es muss eine Lösung sein, die in dem jeweiligen (Familien-)System auch funktioniert, d.h. die Lösung muss positive Effekte erzeugen. Und das System wird sehr wahrscheinlich immer nur bestimmte Arten von Lösungen zulassen und andere Arten nicht. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 267 / 323 Lösungen für das Dilemma Von der Art der gefundenen Lösung hängt dann wesentlich die Art der entwickelten PD ab. Und die Art der Lösung hängt wesentlich vom System ab, davon, welche Art von Lösung im gegebenen System möglich ist. Damit ist eine PD nicht nur eine individuelle Lösung, sondern es ist immer auch eine soziale Lösung. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 268 / 323 Lösungen für das Dilemma Damit kann man PD auch positiv konnotieren: Als Lösungen für dysfunktionale Umweltbedingungen. Diese Lösung führt zwar heute zu Problemen, sie war aber in der Biographie wichtig, vielleicht sogar notwendig, und sie war eine Leistung der Person. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 269 / 323 Strategisches Handeln Das Problem besteht nun darin, zu versuchen, wichtige Interaktionspartner, die die Befriedigung zentraler Motive „verweigern“, dazu zu veranlassen, doch so zu handeln, dass ein gewisses Ausmaß an Befriedigung erreicht wird. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 270 / 323 Strategisches Handeln Damit muss die Person aber Personen, die bestimmte Handlungen nicht von sich aus ausführen, die keine intrinsische Motivation für diese Handlungen haben, durch bestimmte Strategien zu diesem Handeln veranlassen. Und das bedeutet: Die Person muss strategisch handeln, sie muss so handeln, dass sie ihre Ziele erreichen kann. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 271 / 323 Strategisches Handeln Was man nicht freiwillig bekommt, muss man sich aktiv holen; was man durch authentisches Handeln nicht bekommt, muss man sich durch strategisches Handeln holen; was man als Person nicht bekommt, bekommt man für bestimmtes Verhalten. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 272 / 323 Strategisches Handeln Um zu bekommen, was man braucht, muss man somit die Interaktionspartner dazu veranlassen, etwas zu tun, was sie von sich aus (ohne besondere „Aufforderung“) gar nicht tun würden. Das bedeutet aber: Um das zu erreichen, muss man einer Strategie folgen, man muss strategisch handeln. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 273 / 323 Strategisches Handeln In dieser Situation, in der man nicht „von selbst“ das bekommt, was man braucht, – muss man überhaupt handeln: Man muss etwas tun, man muss aktiv werden (man bekommt es ja nicht mehr „einfach so“, als Person, ohne etwas dafür zu tun, „unconditional“); – man muss in bestimmter Weise aktiv werden, man muss genau das tun, was die Beziehungspartner zu bestimmten Reaktionen (z.B. Lob, Anerkennung, Aufmerksamkeit, u.ä.) veranlasst. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 274 / 323 Strategisches Handeln Strategisch handeln bedeutet also, – dass man überhaupt handeln muss; – dass man falsch handeln kann; – dass man in bestimmter Weise handeln muss, um Effekte zu erzielen; – dass man wissen muss, mit welchen Handlungen man positive Effekte erzielt; – dass man deshalb gezielt handeln muss; – dass die Handlung deshalb auch immer auf das Erzielen dieser Effekte aus ist. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 275 / 323 Strategisches Handeln Dies hat Konsequenzen: 1. Da man handeln muss, ist der Effekt auch immer auf die Handlung bezogen. Man bekommt damit aber die erzielte (positive) Rückmeldung nicht mehr ad personam (unconditional), sondern immer (nur) für bestimmte Handlungen. Das schränkt natürlich den Wert der erzielten Rückmeldungen (stark) ein: Es ist das Handeln gemeint und nicht (ohne weiteres) die Person! © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 276 / 323 Strategisches Handeln 2. Man muss gezielt und strategisch handeln, also genau das tun, was die positiven Effekte erzeugt: Damit kann man aber nicht mehr genau das tun, was man möchte, man kann nur noch das tun, was wirkt. Das schränkt den Handlungsspielraum ein. Und man kann auch nicht mehr alle Ziele verfolgen, sondern nur noch die Ziele, die sich im System erreichen lassen. Damit sind bestimmte Motive oder Motivaspekte gar nicht mehr zu befriedigen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 277 / 323 Strategisches Handeln 3. Da man strategisch handelt, geht der erzielte Effekt nicht nur auf das Handeln zurück, sondern auch noch auf ausgesuchtes, besonderes Handeln: Das schränkt dann den Wert der erhaltenen Rückmeldung noch weiter ein („Der andere tut das ja nur, weil...“). © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 278 / 323 Strategisches Handeln 4. Wenn man für das Handeln gezieltes Wissen einsetzt, auf was der Interaktionspartner reagiert, dann handelt man nicht nur strategisch, sondern sogar manipulativ: Das kann den Wert der Rückmeldung noch weiter einschränken („Ich habe mir Lob erschlichen.“). © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 279 / 323 Strategisches Handeln 5. Da die Handlung immer auf die Erzielung von Effekten aus ist, ist sie per definitionem extrinsisch motiviert. Es ist daher wahrscheinlich, dass diese Handlungen selbst nicht bekräftigend, nicht befriedigend wirken. Eine intrinsische Motivation ist kaum herzustellen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 280 / 323 Strategisches Handeln Das strategische Handeln hat damit Vorteile: Es erzeugt Effekte und ohne dieses Handeln hätte man gar nichts. Es erzeugt jedoch nicht in gleichem Ausmaß positive Effekte wie authentisches Handeln, die positiven Effekte sind mehrfach „gedämpft“. Die Effekte, die man dadurch erzielen kann, sind besser als gar nichts, aber sie sind nicht so positiv wie die Effekte authentischen Handelns. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 281 / 323 Strategisches Handeln Die entsprechenden Strategien können Kinder schon früh lernen. Sie lernen sie – durch Versuch und Irrtum; – durch Modelllernen; – dadurch, dass das System ihnen Strategien empfiehlt („Wenn Du das und das tätest, dann würde ich Dich loben.“). © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 282 / 323 Strategisches Handeln Als Strategien kommen im Wesentlichen zwei Strategien in Frage. Die erste Strategie besteht darin, Erwartungen zu erfüllen. Die zweite Strategie besteht darin, den Interaktionspartner zu bestimmtem Verhalten zu „zwingen“. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 283 / 323 Strategisches Handeln Erwartungen erfüllen: Man kann Interaktionspartner dazu veranlassen, einen zu loben, anzuerkennen usw., wenn man sich so verhält, wie sie es erwarten, z.B. – wenn man erfolgreich ist und damit „vorzeigbar“; – wenn man sich an Regeln und Normen hält; – wenn man für sie da ist, ihre Wünsche erfüllt usw. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 284 / 323 Strategisches Handeln Diese Strategie erscheint auf den ersten Blick wenig problematisch, aber genaugenommen ist sie unoffen und manipulativ: Man verhält sich ja nicht deshalb so, weil man das Verhalten selbst gut fände oder weil man die Erwartungen der Bezugspersonen teilen würde. Man verhält sich vielmehr deshalb so, weil das Verhalten bestimmte Effekte erzielt. Man will mit dem Verhalten jemanden dazu bekommen, etwas Bestimmtes zu tun: Und damit ist das Verhalten manipulativ. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 285 / 323 Strategisches Handeln Es ist manipulativ, weil – die tatsächlichen Verhaltensziele nicht offen dargelegt werden; – der Betroffene damit über die Absichten getäuscht wird; – der Betroffene damit keine Wahl hat, sondern sich erwartungsgemäß verhält. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 286 / 323 Strategisches Handeln Mit dem Begriff „manipulativ“ soll jedoch nur ein Fakt ausgedrückt werden, keine Wertung. Wir alle sind gelegentlich manipulativ. Daher ist manipulativ nur eine Beschreibung einer Strategie, keine Abwertung! © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 287 / 323 Strategisches Handeln Eine andere Strategie besteht darin, den Beziehungspartner zur Reaktion zu zwingen, z.B. – erhält man Aufmerksamkeit, wenn man vorgibt, Kopfschmerzen zu haben; – erhält man Hilfe, wenn man vorgibt, etwas nicht zu können usw. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 288 / 323 Strategisches Handeln Aufgrund des Handelns ist die Bezugsperson aufgrund eigener Normen und Regeln oder aufgrund sozialen Drucks veranlasst oder gezwungen zu reagieren. Diese Strategie ist hochgradig unoffen und manipulativ! © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 289 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Wie aufgezeigt wurde, unterscheidet sich das Handeln auf der Strategie-Ebene sehr deutlich von Handeln auf der authentischen Ebene. Zu dem strategischen Handeln gehören nun auch andere interaktionelle Ziele. Auf der strategischen Ebene verfolgt die Person damit andere interaktionelle Ziele als auf der authentischen Ebene. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 290 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Ein sehr wichtiger Grund dafür liegt darin, dass sich ganz einfach nicht alle Ziele durch Strategien verfolgen lassen: Man kann Interaktionspartner durch Verhalten dazu bewegen, einen zu loben aber nur schwer dazu bewegen, einen zu mögen; man kann sie dazu bewegen, einem Aufmerksamkeit zu geben, aber nur schwer dazu, einem eine Bedeutung für das eigene Leben zu geben usw. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 291 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Die Konsequenz davon ist, dass auf der Strategieebene bezüglich positiver Ziele nur noch „erreichbare“, „umsetzbare“, „herstellbare“ Ziele verfolgt werden. Und das bedeutet auch: Viele Ziele, vor allem alle ad personam definierten Ziele, werden gar nicht mehr verfolgt. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 292 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Damit werden aber auch per definitionem bestimmte Motive auch gar nicht mehr verfolgt und damit auch gar nicht mehr befriedigt. Wir haben schon gesehen, dass die Besonderheiten des strategischen Handelns die Wirkungen der Effekte dämpfen: Der durch strategisches Handeln erzielte Effekt ist kaum noch als persönlich-positive Rückmeldung zu interpretieren. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 293 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Und das bedeutet auch: Der hergestellte Effekt befriedigt die zentralen Beziehungsmotive kaum noch, der Effekt kommt kaum noch „bei den Motiven an“. Außerdem wirken dann auch noch die negativen Schemata wie Filter: Erhält die Person z.B. die Rückmeldung, wichtig zu sein, hat aber das Schema „ich bin nicht wichtig“, dann lässt das Schema die Information kaum noch durch, die Rückmeldung kommt also „bei den Motiven nicht an“. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 294 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Und: Die durch strategisches Handeln hergestellten Effekte kommen auch deshalb nicht bei den zentralen Beziehungsmotiven an, weil diese auf der strategischen Ebene auch gar nicht mehr verfolgt werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 295 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Damit wird aber deutlich: Aus drei Gründen führen die durch strategisches Handeln hergestellten positiven Effekte nicht zu einer Befriedigung der Beziehungsmotive selbst. Durch diese Strategie sind die zentralen Beziehungsmotive gar nicht zu befriedigen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 296 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Es gilt aber: Nicht befriedigte Motive bleiben hoch in der Motiv-Hierarchie. Wie schon in der Biographie vorher, so werden auch durch die Strategien die zentralen Motive nicht befriedigt. Daher bleiben sie weiter hoch in der Hierarchie und es kommt zu einem permanenten Defizit-Erleben: Ein Gefühl permanenter Unzufriedenheit stellt sich ein! © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 297 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Und diese Unzufriedenheit erzeugt stark eine Tendenz zu „mehr desselben“, da alternative Strategien ja nicht zur Verfügung stehen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 298 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Ganz anders ist die Situation bezüglich der interaktionellen Ziele auf der Spielebene: Diese werden durch das strategische Handeln sehr wohl bekräftigt! Und daher gibt es auch durch das Handeln immer wieder C+, das Handeln wirkt permanent verstärkt! © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 299 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Da die zentralen Motive jedoch nicht befriedigt werden und da die negativen Schemata immer wieder Zweifel sähen, werden auch hier die positiven Effekte immer wieder schnell „geschreddert“! Der positive Effekt der erzielten positiven Rückmeldung hält nicht lange an, er verschwindet wieder und muss damit immer wieder durch neues Verhalten erneut hergestellt werden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 300 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Das Bedürfnis ist damit „unstillbar“. Eine Klienten mit histrionischer Persönlichkeitsstörung sagte mal: „Wenn ich mich so verhalte und Aufmerksamkeit bekomme, ist das immer wieder so, als wäre man durstig und würde etwas Leckeres zu trinken bekommen.“. Es ist angenehm und schmeckt auch gut, aber es macht nicht wirklich satt. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 301 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Auf der strategischen Ebene bildet sich, anders als auf der authentischen Ebene, noch eine zweite Art von Zielen: Vermeidungsziele. Diese sind auf der Strategie-Ebene von besonders großer Bedeutung. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 302 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Vermeidungsziele kommen zustande durch die negativen Schemata. Hat eine Person z.B. ein negatives Selbst-Schema, in dem z.B. steht „Kritik ist furchtbar“, dann resultieren daraus Vermeidungsziele: Es wird zu einem zentralen Ziel, Kritik unter allen Umständen zu vermeiden. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 303 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Ein Vermeidungsziel kann z.B. lauten: – „Vermeide Kritik!“ – „Vermeide Situationen, in denen Du kritisiert werden könntest!“ © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 304 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Hat eine Person z.B. ein Schema der Art „In Beziehungen wird man nicht respektiert, dann kann ein Ziel resultieren: – „Vermeide Beziehungen, in denen Du keinen Respekt erhälst.“ oder – „Teste Interaktionspartner genau daraufhin, ob sie Dich auch wirklich respektieren.“ © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 305 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Eine besondere Art von Vermeidungszielen sind „Kompensationsziele“. Dies sind Ziele, die darauf ausgelegt sind, negative Annahmen zu kompensieren. Diese Ziele sind scheinbar positiv definiert, als scheinbar positive Ziele; tatsächlich dienen sie aber nicht der Herstellung eines positiven Zustandes, sondern der Vermeidung eines negativen Zustandes. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 306 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Hat z.B. jemand ein Schema „Ich bin ein Versager“, dann heißt z.B. das Kompensationsziel: „Beweise, dass Du kein Versager bist, beweise, dass Du toll bist!“. Das Ziel heißt dann: „Strebe danach, überragend zu sein!“ Oft wird der Vermeidungscharakter des Ziels erst deutlich, wenn klar wird, dass das Ziel aus einem negativen Schema resultiert. Z.B. führt auch die Annahme „ich bin nicht wichtig“ zu dem Ziel: „Versuche, die Wichtigste zu sein!“ © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 307 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Kompensationsziele sind daher als „Negation“ negativer Annahmen gemeint, sie dienen deshalb auch nicht dazu, etwas Positives zu erreichen, sondern etwas Negatives zu widerlegen. Um das zu können, sind Kompensationsziele oft übertrieben, extrem, definiert. Z.B.: – „Sei toll!“ – „Sei besser als alle anderen!“ – „Sei die Wichtigste!“ usw. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 308 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Jemand mit einem Schema „ich bin nicht wichtig“ hat z.B. das Kompensationsziel: – „Ich muss für alle Bezugspersonen die wichtigste Person sein.“ oder – „Ich will unter allen Umständen von jedem uneingeschränkte Aufmerksamkeit.“ © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 309 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Es ist wichtig zu verstehen, wie Kompensationsziele wirken. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 310 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Positive Ziele setzen an einem positiven Punkt des Spektrums an und dienen dazu, den Zustand (durch Handeln) noch positiver zu machen: positiver Endzustand + Handeln + AusgangsZustand 0 © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 311 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Haben Personen dies erreicht, dann – fühlen sie sich gut, – sind stolz, – sind zufrieden, – genießen sie den Zustand. Dieser Zustand der Zufriedenheit hält eine ganze Weile an. Personen sind während dieser Zeit nur wenig motiviert, weiterhin zu handeln. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 312 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Bei Kompensationszielen setzt der Ausgangspunkt aufgrund der negativen Definition des negativen Schemas schon im Minus an: Der Zustand wird als defizitär wahrgenommen. Die Handlung dient dann auch nicht primär dazu, den Zustand positiv zu machen, sondern den Zustand zumindest auf Null zu bringen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 313 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene + 3 4 2 Schema - 1 1 Der Ausgangspunkt ist negativ aufgrund der Definition des negativen Schemas. 2 Die Handlung bringt den Zustand auf Null oder nur wenig in den positiven Zustand © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 3 Seite 314 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Darüber hinaus macht das negative Schema den erreichten Effekt auch sofort wieder zunichte 4 : Es „schreddert“ den Erfolg. Die Person kann deshalb mit dem Erfolg nicht lange zufrieden sein, kann den Erfolg nicht genießen. Daher muss der Effekt immer wieder und immer wieder erneut durch neues Handeln wiederhergestellt werden. Eine echte „Kompensation“ ist deshalb mit dieser Strategie überhaupt nicht möglich. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 315 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Kurzfristig und kurzzeitig wird jedoch immer wieder ein Kompensationseffekt erzielt: Und dadurch wird das Handeln auch immer wieder (doch) bekräftigt und dadurch in seiner Auftretenswahrscheinlichkeit erhöht. Einen veränderten Einfluss auf die negativen Schemata oder gar einen Effekt bezüglich der Befriedigung der Beziehungsmotive hat der Effekt jedoch nicht. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 316 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Man muss davon ausgehen, dass auf der strategischen Ebene ein großer Teil der Ziele (nicht alle!) Vermeidungsziele und Kompensationsziele sind. Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei allen übertrieben und extrem formulierten Zielen um Kompensationsziele. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 317 / 323 Interaktionelle Ziele auf der Strategie-Ebene Dies gilt auch für Ziele wie: – „Ich muss mein Territorium um jeden Preis schützen.“ – „Ich muss unter allen Umständen meine Autonomie aufrechterhalten.“ – „Ich darf auf keinen Fall verlassen werden.“ – „Ich darf keiner Person vertrauen.“ usw. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 318 / 323 Kompetenzen auf der Strategie-Ebene Auch für das (strategische) Handeln auf der Strategie-Ebene benötigt eine Person Verarbeitungsund Handlungskompetenzen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 319 / 323 Verarbeitungskompetenzen Wichtige Verarbeitungskompetenzen sind (neben denen, die schon auf der authentischen Ebene wichtig waren) die Fähigkeit der Person, einen Interaktionspartner oder potentiellen Interaktionspartner daraufhin einzuschätzen, ob er sich komplementär zum strategischen Handeln verhalten wird. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 320 / 323 Verarbeitungskompetenzen Davon kann auch die Partnerwahl abhängen: – Ist zu erwarten, dass der potentielle Partner auf bestimmte Strategien positiv (komplementär) reagieren wird, dann kommt er als Partner in die engere Wahl. – Ist zu erwarten, dass er gar nicht oder negativ reagieren wird, dann wird er ausgeschlossen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 321 / 323 Handlungskompetenzen Manche Klienten mit PD verfügen über sehr viele, sehr elaborierte (und hoch manipulative) Handlungsstrategien. Sie können dadurch lange erfolgreich agieren. Ihr Handeln ist dann auch nicht leicht und nicht schnell als strategisch und manipulativ zu durchschauen. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 322 / 323 Handlungskompetenzen Manche Klienten mit PD verfügen dagegen nur über wenige und/oder rigide Handlungsstrategien. Die Strategien sind dann oft leicht und schnell durchschaubar. Diese Strategien wirken dann nicht sehr effektiv und vor allem nicht sehr lange effektiv. © Prof. Dr. Rainer Sachse IPP 2004 Seite 323 / 323