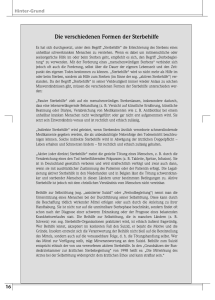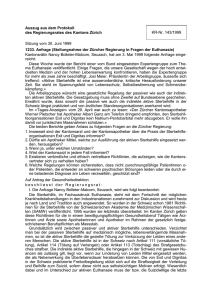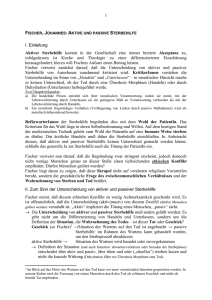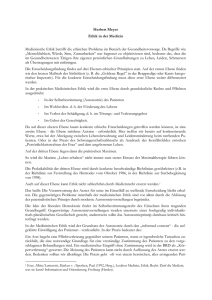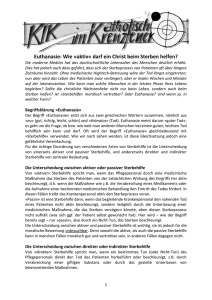Wernstedt - Evangelische Akademie Tutzing
Werbung

Thela Wernstedt M. A. Zentrum für Anästhesiologie, Rettungs- und Intensivmedizin Universität Göttingen Aktiv – Passiv – Indirekt , Tun oder Unterlassen Hilfreiche oder eher verwirrende Unterscheidungen ? 1. Einleitung 2. Beobachterperspektive und praktische Erfahrungen 3. Definitionen aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe 4. Die allgemeinere Unterscheidung: Tun und Unterlassen 5. Schlußfolgerung 1. Einleitung In der Philosophie gehört es zur guten Tradition bei der Beschäftigung mit einem Problem zunächst die Ausgangsbedingungen zu skizzieren und dann die verwendeten Begriffe zu definieren, um einen möglichst hohen Grad an Klarheit in der Argumentation und Gedankenführung zu erreichen. Die Begriffsdefinition ist Hauptthema dieses Vortrages, die Einbettung dieser Definitionen geschieht jedoch unter dem speziellen Blickwinkel meiner ärztlichen Erfahrung in der Chirurgie und der Anästhesie. Dieses Erfahrungsspektrum schließt Arbeit und Verantwortungsübernahme auf Normal- und Intensivstationen, im Operationssaal auf beiden Seiten des grünen Tuches, bei Notfalleinsätzen, in der stationären und ambulanten Schmerztherapie, der stationären und inzwischen auch ambulanten Palliativmedizin mit ein. Es ist kein internistischer, onkologischer, neurologischer oder allgemeinmedizinischer Blickwinkel. Probleme der Sterbehilfe, sei sie aktiv, passiv oder indirekt, kommen in den genannten Fachrichtungen in unterschiedlicher Intensität vor und werden auch anders behandelt. Es gibt in der Praxis keinen allgemeingültigen guten Weg. Im folgenden Vortrag wird nach Darstellung meiner Beobachterperspektive und Erfahrung im Umgang mit den Begriffen die Definition der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin von 1999 vorgestellt. Anhand zweier Fallbeispiele werden sie erläutert. Ein kurzer Blick in europäische Nachbarländer wird zeigen, dass eine allgemeingültige Definition nicht existiert und obwohl vieles ähnlich erscheint, jedoch jedes Land seine Besonderheiten kultiviert. Dies gilt es bei internationalen Vergleichen und Diskussionen zu beachten. In der philosophischen Diskussion hat vor einigen Jahren noch die allgemeinere Unterscheidung Tun und Unterlassen eine große Rolle gespielt. Sie wird kurz erläutert und um einen praktischen Blickwinkel ergänzt. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass im praktischen Umgang mit Problemen der Sterbehilfe die klassischen Begriffe teilweise hilfreich sind, teilweise aber auch zu Verwirrung führen und zumindest durch Begriffe wie Sterbebegleitung, Therapieverzicht, Therapieabbruch und Tötung auf Verlangen ergänzt werden 2 müssen. In der Diskussion mit Angehörigen eignen sich zur Einordnung die klassischen Begriffe aktive, passive und indirekte Sterbehilfe, in der Diskussion mit Kollegen und Pflegenden eher die Begriffe Therapieverzicht, Therapieabbruch, Sterbebegleitung und Tötung auf Verlangen. In diesem Sinne und in diesem Zusammenhang enthalten nicht die Begriffe selber Wahrheit, sondern sie können Ärzten, Pflegenden, Patienten, Juristen, Theologen und Angehörigen dazu dienen, eine Situation zu strukturieren, sich darüber auseinanderzusetzen und zu einer Entscheidung zu kommen. Der Streit um Sterbehilfe und ihre Begriffe ist m. E. Ausdruck eines tiefsitzenden Unbehagens angesichts der Grenzen eines überzogenen Autonomieideals des neuzeitlichen Menschen in Krankheits- und Sterbesituationen, und er bildet die unterschiedlichen Auffassungen zu Grenzen menschlichen Handelns ab. 2. Beobachterperspektive und praktische Erfahrungen Der Titel dieses Vortrages enthält implizit die Hoffnung, dass es feststehende Definitionen für die Sterbehilfeformen gibt und es nur eine Frage der Systematisierung und guten Erklärung ist, diese auch zu verstehen. Es gibt diese Definitionen auch, nur sind in verschiedenen Texten zur Sterbehilfe dennoch unterschiedliche Auffassungen vorhanden, die es außerordentlich schwer machen, den Argumentationen und Zielsetzungen einzelner Autoren zu folgen. Blickt man dann über Deutschland hinaus ins europäische Ausland wird die ganze Sache noch verwirrender. Mein Blickwinkel auf Sterbehilfe ist durch die Tätigkeit als philosophisch denkende Chirurgin und Anästhesistin geprägt worden. Abgesehen davon, dass alle ärztlichen Kollegen natürlich um das Leben und die Gesundheit ihrer Patienten bemüht sind, ist es speziell Aufgabe der Anästhesie die lebenserhaltenden Funktionen eines Menschen sicherzustellen oder wiederherzustellen. Grundfunktionen, ohne die Leben sofort erlischt, sind Atmung und Kreislauf. Aber auch die Bewahrung oder Sicherstellung von Nieren-, Leber und Verdauungsfunktion, um noch einige wichtige zu nennen, zählt zu unseren Aufgaben. 3 Dies geschieht perioperativ, auf Intensivstationen oder im Rahmen des Rettungsdienstes. Sehr viele Operationen bei vielen sehr alten oder eben schwer kranken Menschen könnten heute nicht durchgeführt werden ohne eine sorgfältige anästhesiologische Betreuung vor, während und nach der Operation. Ein großer Teil von Patienten würde intraoperativ oder unmittelbar postoperativ an den Komplikationen sterben. Inzwischen zählt auch Schmerztherapie und in dem Zusammenhang Palliativmedizin zum anästhesiologischen Aufgabenfeld. Es ist wohl nach dieser kurzen Darstellung deutlich geworden, dass sich dieses für die meisten Laien und leider auch Kollegen so unscheinbare Fach Anästhesie tagtäglich mit Situationen beschäftigt, in denen ein Mensch in Lebensgefahr schwebt und dementsprechend wie man ihn vor dem Tode bewahren kann. Jede Narkose, so routiniert alles sein mag, bringt Menschen durch die Ausschaltung des Bewusstseins und der Atmung in eine lebensgefährliche Situation, die nur deswegen keine negativen Folgen hat, weil alles kontrolliert abläuft. Aus eigener Erfahrung auf insgesamt vier Intensivstationen weiß ich, dass der Begriff Sterbehilfe oder Euthanasie grundsätzlich bekannt ist, aber etwas Schlechtes damit verbunden wird. Die weiteren Differenzierungen in aktiv, passiv und indirekt werden, wenn sie denn als Begriffe in den Köpfen vorhanden sind, für eine Auseinandersetzung im Team und die Erarbeitung eines eigenen begründeten Standpunktes selten genutzt. Wenn die vorgesetzten Oberärzte offen über die Möglichkeit von Therapieabbruch auf einer Intensivstation sprechen und auch die Begründung ihrer Haltung darslegen, tun es die Assistenzärzte auch. Wenn nicht, dann nicht. Wenn bei den Visiten am Intensivbett über die Fortführung der Therapie diskutiert wird, sind natürlich medizinische Fakten, der Beobachtungszeitraum und die ärztliche Erfahrung mit solchen Krankheitsbildern Hauptthema. Dabei kann eine Entscheidung für oder gegen Therapieabbruch erarbeitet werden. Dies scheint das Wichtigste, die Durchführung des Abbruches ist solange Nebensache, bis sich der Assistenzarzt erschreckt die Frage stellt: wer macht denn das eigentlich und wie geht das? Dann stehen aber schon wieder technische Fragen im Vordergrund: Abstellen des Respirators, Abstellen von Perfusoren, keine Steigerung der Katecholamintherapie mehr, aussetzen der Dialyse. 4 Die Legitimation des Therapieabbruches hat sich durch die Entscheidung des Teams bzw. durch die Haltung des Vorgesetzten ergeben, die Differenzierung in aktiv, passiv oder indirekt wird selten bis gar nicht ausdiskutiert. Es bleibt auf diese Weise oft ein Unbehagen bei den Beteiligten, selbst wenn im Team relativ offen gesprochen wird, weil die moralischen Grundlagen und Konflikte nicht thematisiert worden sind. Moralische Topoi sind: Du sollst nicht töten, Du sollst Deinem Patienten nicht schaden, Du bist für das Wohlergehen des Patienten umfassend verantwortlich. Schlimm wird es, wenn nicht mehr klar ist, was dem Patienten eigentlich schadet: Therapie oder nicht Therapie, wie weit Verantwortung wirklich reichen kann, was dem Patienten in dieser Situation wohl tut und was es mit dem Töten so auf sich hat. Es kommt sehr auf den Vorgesetzten, den Chef und gewisse Traditionen in der Abteilung an, ob eine Diskussion während des Entscheidungsprozesses stattfindet oder ob therapiert wird, bis der Patient trotzdem stirbt. In den zuletzt genannten Fällen lastet eine schwere und undifferenzierte Entscheidung auf dem Gewissen des Vorgesetzten. Die Begriffe aktive, passive und indirekte Sterbehilfe spielen in solchen Diskussionen kaum je eine Rolle. Das Unwissen über die Definitionen und den rechtlichen Spielraum der Ärzte scheint groß. Eher wird noch davon gesprochen, auf eine weitere Therapie zu verzichten, überhaupt auf eine intensivmedizinische Therapie zu verzichten. Aber auch der Begriff Sterbebegleitung wird nicht benutzt. Wenn es zu einem Abbruch der Intensivtherapie kommt und eine Sterbebegleitung im Sinne einer ruhigen Umgebung, vermehrten Angehörigengesprächen und schmerz- und luftnotlindernder Medikation durchgeführt wird, geistert schnell scheinbar professionell der „Mo-Perfusor“ durch die Gespräche. Alle nicken wissend und der Themenkomplex scheint erschöpfend besprochen. Ein „Morphin-Perfusor“ ist eine Spritzenpumpe, die kontinuierlich eine bestimmte Menge Medikament in einen Patienten befördern kann. Wenn man die 50 ml Spritze mit Morphin und Kochsalzlösung füllt, ist es medizinisch-umgangssprachlich ein Morphin-Perfusor, wenn man sie zum Ausgleich von Elektrolyten mit Kalium und Kochsalzlösung befüllt, ist es ein „Kaliumperfusor“. Die in der Spritze befindliche Menge Medikament und die Förderrate pro Minute bzw. Stunde müssen der Indikation angemessen sein. Indikation und Anordnung sind ärztliche Aufgaben. 5 Die Indikation für einen Morphinperfusor wäre bei einem Therapieabbruch, dass der Patient Schmerzen hat oder, in der Intensivmedizin sehr häufig, Luftnot oder auch Angstzustände, die man durch Gespräche bei nur bedingter Ansprechbarkeit nicht mehr auflösen kann. Ganz im Gegenteil zu der meist stillschweigenden Annahme der jüngeren Kollegen und v. a. der Pflegenden, dass hiermit alles gesagt sei, ist nichts außer einer technischen Anordnung damit gesagt. Die wichtigen Fragen, ob ein Therapieabbruch gerechtfertigt ist und wenn ja, wie er für alle tragbar begründet wird, sind bestenfalls vorher besprochen worden. Ich möchte anhand von zwei Fallbeispielen Arten der Entscheidungsfindung und zugleich die Komplexität intensivmedizinischer Krankheitsbilder vorstellen, die eine Fülle von Abwägungen notwendig machen. Gleichzeitig sind sie aber mit den klassischen Begriffen aktive, passive und indirekte Sterbehilfe fassbar bzw. gegeneinander abgrenzbar. Fall 1 Eine 89jährige Patientin stellte sich wegen starker Rückenschmerzen in der orthopädischen Ambulanz vor. Es konnte zunächst ein Kniegelenkserguß rechts, sowie eine Druckschmerzhaftigkeit über der Lendenwirbelsäule festgestellt werden. Wegen des Alters der Patientin und des Schweregrades der Beschwerden wurde sie stationär aufgenommen. Im Verlaufe des nächsten Vormittages zeigte sich eine deutliche Vigilanzverschlechterung, nachfolgend auch Kreislaufprobleme, so dass die Patientin auf die Intensivstation verlegt wurde. Bis auf den Kniegelenkserguß konnte bis dahin noch keine weitere Diagnose ermittelt werden. Die über den bisherigen Verlauf gut informierte Tochter war erschrocken über die rasche Verschlechterung des Befindens ihrer Mutter, sagte jedoch, dass ihre Mutter nicht gewünscht habe, in so hohem Alter bei einer schweren Erkrankung und womöglich schlechten Prognose sich noch einer Intensivtherapie zu unterziehen. Bei dekompensierter Niereninsuffizienz, bekannter Herzinsuffizienz mit Klappenvitium, und deutlich erhöhten Entzündungsparametern, einem unauffälligen CCT, aber zunehmendem Meningismus, wurde zunächst eine niedrigdosierte Katecholamintherapie durchgeführt und eine empirische Antibiotikatherapie angesetzt . Von einer Respiratortherapie wurde abgesehen und weiter zugewartet. 6 Es trat eine deutliche Verschlechterung von Vigilanz, Kreislauf und Atmung im Verlaufe des Nachmittags ein. Die Tochter bekräftigte noch einmal den Wunsch der Mutter, keine invasive Intensivtherapie haben zu wollen. Die Antibiotikatherapie wurde nicht durchgeführt, wohl aber eine Lumbalpunktion zur Diagnosesicherung. Der Kollege von der Neurologie brachte in der Nacht den positiven Nachweis einer bakteriellen Meningitis und empfahl eine differenzierte Antibiotikatherapie unter Hinzuziehung der Abteilung für Hygiene. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Oberarzt der Intensivstation wurde von einer weiteren Therapie abgesehen. Die Dyspnoe und Stressreaktion der Patientin ließen sich zunächst mit Morphin-Boli lindern, später wurde ein Morphin-Perfusor mit 4mg/h angesetzt. Die Tochter erkundigte sich in der Nacht nach dem Befinden der Mutter . Sie wurde über die gesicherte Diagnose und die schlechte Prognose informiert. Noch einmal wurde von ihr die Entscheidung zur Therapiebegrenzung bekräftigt. Am nächsten Morgen kam die Tochter und blieb bis zum Tod der Mutter am späten Vormittag am Bett. Begrifflich gesehen handelt es sich um eine Kombination aus passiver und indirekter Sterbehilfe. Man kann es synonym auch als Therapieverzicht mit Sterbebegleitung bezeichnen. Der Morphinperfusor ist dabei nur eine technische Erleichterung für die Ärzte und Pflegenden gewesen. 7 3. Definitionen aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe Die DGAI hat diese Definitionen für die Intensivmedizin 1999 formuliert, um präziser als die Grundsätze zur Sterbebegleitung der Bundesärztekammer von 1998 die intensivmedizinischen Probleme und Schwerpunkte herauszuarbeiten. Aktive Sterbehilfe: Tötung eines unheilbar Kranken aufgrund seines ernstlichen Willens durch eine aktive Handlung. Passive Sterbehilfe: Verzicht auf lebensverlängernde Behandlungsmaßnahmen, insbesondere auf die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung vitaler Funktionen durch intensivmedizinische Verfahren, bei progredienten Erkrankungen mit infauster Prognose. Indirekte Sterbehilfe: Palliative Behandlung eines Schwerkranken, insbesondere potente Schmerztherapie, unter inkaufnahme einer möglichen Lebensverkürzung als unbeabsichtigte Nebenwirkung. Hier noch ein weiteres Fallbeispiel von der Intensivstation: Fall 2: Herr F. wurde primär wegen Ruhe und Bewegungsschmerz im linken Bein bei bekannter peripherer arterieller Verschlusskrankheit in einem peripheren Krankenhaus behandelt. Unter dem Verdacht auf eine Embolisation der A. iliaca externa links wurde zunächst eine Lyse geplant, von der aber abgesehen wurde, nachdem ein infrarenales Bauchaortenaneurysma (BAA) mit mehr als 5 cm Durchmesser sonographisch festgestellt wurde. Es erfolgte nach entsprechender Vorbereitung die operative Versorgung des BAA. Der postoperative Verlauf war zunächst unauffällig, jedoch kam es dann zu einer Zunahme des Bauchumfangs. Nach Punktion des Ascites wurde ein Chylaskos diagnostiziert. Es erfolgte zunächst eine Punktion zur Verringerung der Flüssigkeitsmenge und eine konservative Therapie mit Nahrungskarenz und parenteraler Ernährung. Über eine Bauchdrainage wurden täglich zwei Liter Chylaskos entleert. Bei gleichbleibender Klinik wurde ca. 8 8 Wochen nach der ersten Operation eine Revision durchgeführt. Postoperativ kam es zu einer respiratorischen Insuffizienz und einem akuten Nierenversagen. Drei Tage nach der Revision wurde Herr F. auf unsere Intensivstation verlegt. Bei Aufnahme des Patienten zeigte sich eine septisch hypodyname Kreislaufsituation mit low-cardiac-output-syndrome. Selbst unter kontinuierlicher Katecholamintherapie gelang es zunächst nicht, einen suffizienten Kreislauf herzustellen, so dass Suprareningaben als Bolus im Sinne einer protrahierten Reanimation notwendig wurden. Nach Negativbilanziereung durch CVVHD gelang es, die septische Kardiomyopathie positiv zu beeinflussen, so dass unter hohen Katecholamindosen zumindest eine Stabilisierung zu erreichen war. Insgesamt bot sich das Bild eines Multiorganversagens bei Sepsis. Bereits im auswärtigen Krankenhaus hatte der Patient Thrombosen der Vv. Subclavia, axillaris und anonyma rechts entwickelt, die eine Katheterisierung der Gefäße für die Intensivtherapie erschwerten. Im Verlauf thrombosierten auch noch die V. jug. interna rechts und links zu. Eine breite Antibiotikatherapie führte nicht zu der angestrebten Besserung der Sepsis. Bei Nachweis von Candida in der Blutkultur wurden zusätzlich Antimykotika verabreicht, die aber ebenso am Verlauf nichts änderten. Der Patient blieb weiter hoch katecholaminpflichtig und entwickelte schließlich ein Leberversagen mit metabolisch-toxischer Encephalopathie. Nach ausführlichen Gesprächen mit der Familie wurde die Therapie bei erneuter Verschlechterung der Kreislaufsituation nicht mehr erweitert, so dass der Patient wenige Tage später im Herzkreislaufversagen starb. In diesem Fall wurde bei einem schwerkranken, schon reanimationsbedürftigen Patienten eine Therapie auf einem hohen technischen Niveau weitergeführt. Es wurde die Lungenfunktion unterstützt, ebenso die Herzfunktion, die Nierenfunktion und die Verdauungsfunktion ersetzt. Mit all diesen Maßnahmen war eine „Stabilisierung“ zu erreichen: unter hohen Katecholamindosen, einer differenzierten Respiratoreinstellung, einer Antibiotikatherapie zeigte sich auf den Monitoren meistens eine konstante mittelmäßige Blutdruckkurve, die im Verlaufe auch nur zu halten war, indem die Katecholamindosen weiter erhöht wurden. De facto ist es kein stabiler Zustand, sondern es ist ein sterbender Patient, an dem eine Dauerreanimation vollzogen wird. Intensivmedizin ist dann sinnvoll, wenn ein Mensch vorübergehend in solch einen lebensbedrohlichen, sterbenden Zustand 9 gerät und durch die Therapie der temporäre Ausfall von Organfunktionen ersetzt wird und der Körper des Patienten danach wieder selbst die lebenswichtigen Funktionen übernehmen kann. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Definition passiver Sterbehilfe der DGAI: Verzicht auf lebensverlängernde Behandlungsmaßnahmen, insbesondere auf die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung vitaler Funktionen durch intensivmedizinische Verfahren, bei progredienten Erkrankungen mit infauster Prognose, so haben wir in dem geschilderten Fall durch die Entscheidung, bei weiterer Verschlechterung der Kreislaufsituation die Katecholamine nicht mehr zu erhöhen, sicher eine Entscheidung zu „passiver Sterbehilfe“ getroffen. Als Leitlinie zur Anwendung intensivmedizinischer Therapie schreibt die DGAI: Die Anwendung lebensverlängernder intensivmedizinischer Verfahren setzt voraus:...Ihre medizinische Indikation in Abhängigkeit von der konkreten Situation des Einzelfalles. Lebensverlängernde Maßnahmen sind nicht mehr indiziert und sollten unterbleiben, wenn sie bei aussichtsloser Grunderkrankung für den Patienten keine Hilfe mehr bedeuten, sondern nur noch ... den unvermeidlichen Sterbevorgang verlängern.“ Im Kommentar zu dieser Leitlinie heißt es: „Aufgrund seiner Garantenstellung ist der behandelnde Arzt verpflichtet, seinem Patienten die bestmögliche , die wirksamste Hilfe zu leisten. „Bestmögliche Hilfe“ bedeutet in der Regel die Anwendung aller zur Verfügung stehender Mittel zur Heilung oder Besserung der Erkrankung und auch zur Verlängerung des Lebens. Beim Sterbenden und beim Schwerstkranken mit infauster Prognose kann „bestmögliche Hilfe“ hingegen die Beschränkung auf Schmerzlinderung und Anxiolyse bedeuten, wenn durch die künstliche Aufrechterhaltung der vitalen Funktionen nur noch eine Verlängerung eines schweren Leidens und des Sterbens zu erreichen wäre ... Die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung ihrer vitalen Funktionen bedeutet für sie keine Hilfe mehr. Die Lebensverlängerung ist dann medizinisch nicht oder nicht mehr indiziert.“ Auf die genannten Fallbeispiele lassen sich die Überlegungen der DGAI gut anwenden. Wirft man noch einen Blick auf die Definition der indirekten Sterbehilfe als palliative Behandlung eines Schwerkranken, insbesondere potente Schmerztherapie, unter Inkaufnahme einer möglichen Lebensverkürzung als unbeabsichtigte Nebenwirkung, so trifft dies für das Fallbeispiel 1 ebenfalls zu. Die Gabe von Morphin an die alte 10 Dame, damit sie Luftnot und Rückenschmerzen nicht spürt ist eine palliative Behandlung einer Schwerkranken. Wenn sie denn durch die Medikamentengaben Minuten oder sogar Stunden vor dem Zeitpunkt starb, an dem sie ohne Medikamente gestorben wäre, so haben wir dies in Kauf genommen. Insgesamt stellen sich Fälle von passiver Sterbehilfe fast immer als eine Kombination aus beiden Sterbehilfeformen dar. Denn wenn man die Entscheidung zu einem Therapieverzicht oder einem Therapieabbruch trifft, heißt das nicht, gar nicht mehr für den Patienten zu sorgen, sondern die Heilungsoption aufzugeben, dem Sterben Raum zu geben und stattdessen „Symptomkontrolle“ durchzuführen. In Sterbesituationen ist übrigens die Linderung von Luftnot mindestens ebenso wichtig und tritt sehr häufig auf wie die in der ethischen und palliativmedizinischen Literatur gebetsmühlenartig zitierte Schmerztherapie. Praktischerweise ist für beide Symptome Morphin ein sehr geeignetes Mittel der Therapie. Aus meinem Blickwinkel heraus sind Situationen passiver und indirekter Sterbehilfe im Klinikalltag mit Kollegen und Pflegenden besser durch Therapieverzicht bzw. – abbruch und Sterbebegleitung zu bezeichnen. In den täglich wiederkehrenden Situationen der undifferenzierten Gemengelage aus dem Machtgefühl über Leben und Tod, dem schlechten Gewissen, der Frage, ob man genug getan hat, dem latenten Gefühl etwas gesetzlich und moralisch verbotenes zu tun, lässt sich mit den Kollegen und Mitarbeitern freier reden, wenn man nicht über Sterbehilfe spricht. In den wenigen stillen Stunden vielleicht einmal am Wochenende oder nachts ist der Zugang zum Gewissensdurcheinander einfacher ohne diese Etiketten. Dennoch sind die Begriffe passive und indirekte Sterbehilfe hinreichend genau definiert, um Sterbesituationen im Krankenhaus zu beschreiben und sie einzuordnen. Sterbesituationen von Menschen sind schier unendlich komplex. Alle Beteiligten sind bis ins Innerste aufgewühlt, versuchen dies vielleicht noch mühsam zu verbergen. Ein Leben geht zuende, das verflochten ist mit dem Leben anderer, gelöste und ungelöste Konflikte, Zuneigungen, Abneigungen, Unausgesprochenes, Liebe und Verlust stehen im Raum. Auch die für Menschen kaum beantwortbaren Fragen. Warum? Warum er oder sie? Warum jetzt? Welchen Sinn hat das Ganze? Warum kann die Medizin nicht helfen, dass der Abschied nicht stattfinden muß? Ärzte und Krankenschwestern, mehr noch die Ärzte haben in solchen Situationen die Aufgabe, Antworten zu geben, ein Halt zu sein und den Überblick zu behalten und zu 11 verstehen. Die Begriffe aktive, passive und indirekte Sterbehilfe können wichtige Stützen sein Kollegen, Angehörigen und im Vorfeld auch den Patienten zu erklären, was man macht: z. B. bei einem erstickenden Patienten, der eine schwere Pneumonie zusätzlich zum Bronchialkarzinom bekommen hat und dessen Frau die Geschwindigkeit des Krankheitsprozesses und die Tatsache des Sterbens schier noch nicht fassen kann. Wenn man zur Linderung der Erstickungsangst Morphin und Dormicum vorsichtig titriert, kann man gut erklären, dass es sich hierbei um eine allgemein akzeptierte Form der Sterbehilfe nämlich die indirekte handelt. Man kann erklären, dass es um die Linderung von Leid geht und dass dabei durch Reduktion der Atemfrequenz und des Tidalvolumens und durch die Sedierung der Tod möglicherweise etwas früher eintritt. Auch die Unterscheidung zur Tötung auf Verlangen, zur aktiven Sterbehilfe kann sehr deutlich herausgestrichen werden. Damit wird oft die Akzeptanz der Angehörigen im Sterbeprozeß in dieser emotional hoch aufgeladenen Situation ermöglicht, ohne dass es zu Schuldgefühlen oder Schuldzuweisungen kommen muß. Auch die Begriffe Therapieverzicht, Therapieabbruch und Sterbebegleitung sind hilfreich in den Gesprächen mit Patienten und Angehörigen. Gerade auf einer Palliativstation kann man vielen Ängsten der Patienten im Gespräch begegnen, die fragen, wie denn der Tod bei ihnen eintreten werde, ob sie ersticken würden, ob es wehtun würde. Mithilfe dieser Begriffe kann man dann gemeinsam eine Einordnung der möglichen Geschehnisse vornehmen und sehr viel Angst abbauen, ob Sterben sehr leidvoll sein müsse und ob man vielleicht selbst dabei etwas Verbotenes tut oder anderes etwas Verbotenes zumutet. Das Wissen um die medizinische, juristische und moralische Einordnung dieser Handlungsweisen kann Druck und schlechtes Gewissen mindern und damit auch Leid vermindern. Ich möchte sie noch einen Blick weiter über Deutschland hinaus ins europäische Ausland machen lassen, denn auch dort sind die Begriffe wichtig, zumindest in der Literatur. Aufgeführt sind die Länder Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien und Großbritannien. Einige Beobachtungen sind herauszuheben: Die Österreicher empfinden, dass nur Sterbebegleitung auch eine „Sterbehilfe“ ist. Dementsprechend wird die in unserem Sinne aktive Sterbehilfe als „unechte direkte Sterbehilfe“ bezeichnet. Die bei uns als indirekte (aktive) 12 Sterbehilfe bezeichnete Handlung heißt in Österreich „unechte indirekte Sterbehilfe“. In den Niederlanden wird die bei uns gebräuchliche genaue Differenzierung der Sterbehilfe in aktiv, passiv und indirekt nicht nachvollzogen. Es gibt nur eine Form der Sterbehilfe, die aktive. Sie wird als Euthanasie bezeichnet. Nach einer Empfehlung der KNMG von 1984 wird die Differenzierung in aktiv und passiv für unerwünscht gehalten. Bei internationalen Vergleichen ist somit Vorsicht im Umgang mit den Begriffen geboten. 4. Die allgemeinere Unterscheidung: Tun und Unterlassen Seit Mitte der 70er Jahre ist in philosophischen Kreisen viel um die Unterscheidung zwischen Tun und Unterlassen diskutiert worden. Ausgangspunkt war ein Aufsatz des Philosophen James Rachels im New England Journal of Medicine 1975, in dem er sich auf eine Erklärung der American Medical Association von 1973 bezog. In dieser Erklärung formulierten die amerikanischen Ärzte eine klare Absage an die aktive Sterbehilfe, die Tötung auf Verlangen und wagten gleichzeitig eine sehr vorsichtige Formulierung, dass es bei einem im Sterbeprozeß befindlichen Patienten geboten sein könne, sofern er selbst und die Angehörigen es wollten, nicht jede lebensverlängernde Maßnahme zu ergreifen. Man kann auch formulieren, dass bei Zustimmung des Kranken dem Sterben Raum gegeben werden darf. Rachels versucht nun meist auf der Grundlage von Analogieschlüssen zu beweisen, dass aktive Sterbehilfe (=Tun) im Grunde nicht von der passiven Sterbehilfe (=Unterlassen) zu unterscheiden ist, da die Konsequenz die gleiche ist. Am Ende ist ein Mensch tot. Ob durch Tun oder Unterlassen, spiele keine Rolle. Am Schluß seines Aufsatzes gesteht er den Ärzten noch zu, dass sie, um den Schein vor dem Gesetz zu wahren, vielleicht diese Unterscheidung machen müssten, sich aber nicht erdreisten sollten, dieser Unterscheidung durch offizielle Erklärungen auch noch größeres Gewicht zu verleihen. Inhalt und Art der Argumentation Rachels sind nicht unwidersprochen geblieben. Tom L. Beauchamp, Philippa Foot, Bruce Reichenbach und in jüngerer Zeit in Deutschland Birnbacher haben diese These diskutiert und teilweise entschärft. Die 13 Einzelheiten dieser Diskussion widerzugeben wäre Thema eines Universätsseminars für ein Semester und übersteigt die Möglichkeiten dieses Vortrages. Sie sind aus heutiger Sicht m. E. nicht in jedem Detail interessant. Man hat aus medizinischer Perspektive auch eher den Eindruck, dass die Diskussion weit hinter der Entwicklung der Medizin und damit auch der moralischen Problemstellungen bleibt. Es ist durchaus so, dass auch von etlichen Kollegen intuitiv gesagt wird, dass man aktiv und passiv, tun und unterlassen nicht unterscheiden könne. Dementsprechend schwer tun sich viele Kollegen mit Entscheidungen am Lebensende. Ich wage eine Interpretation, was als Grundmotiv hinter dieser Vorstellung steht. Unter der Vorstellung, dass uns Ärzten in unserem Handeln Grenzen gesetzt sind, von Gott, der Natur oder dem Schicksal, Grenzen jenseits derer unser Handeln gleichgültig ist, hat die Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe, zwischen Tun und Unterlassen sehr wohl einen Sinn. Bei der Tötung auf Verlangen, der aktiven Sterbehilfe, habe ich als Handelnder die Tatherrschaft. Durch mein Handeln stirbt ein Mensch. Weil ich ihm eine bestimmte Kombination aus Medikamenten gegeben habe, stirbt er. Hat hingegen ein von mir unabhängiger Sterbeprozeß eingesetzt wie im Fallbeispiel 2, den ich durch maximale intensivmedizinische Therapie bremsen, aber nicht umkehren kann, lasse ich durch meine Entscheidung zum Therapieabbruch dem von mir unabhängigen Geschehen Raum. So gesehen verbirgt sich hinter „passiver Sterbehilfe“ die Erkenntnis über die Grenze der Tatherrschaft hinausgekommen zu sein. Es ist gleichzeitig eine Anerkennung, dass es biologisches Geschehen auf dieser Welt gibt, das sich unserem Wollen entzieht. Und es ist eine moralische Grenze. Unter der Vorstellung, dass es eine ärztliche Macht über Leben und Tod gibt, wird die Unterscheidung zwischen Tun und Unterlassen tatsächlich schwierig. Dies verbirgt sich m. E. hinter der konsequentialistischen Auffassung zu dieser Frage. Ob ich etwas tue oder etwas unterlasse, am Ende ist ein Mensch tot. Ich kann das Unterlassen in diesem Fall aber nur als aktiv auffassen und , sei es das Abstellen eines Beatmungsgerätes, das Abstellen eines Katecholaminperfusors oder gar nur die Entscheidung dazu, wenn ich glaube, das biologische Geschehen mit medizinischen Mitteln im Grund noch beeinflussen zu können. Dann würde ich 14 tatsächlich einen Menschen töten, wenn ich ein Gerät abstelle, es gäbe keinen moralischen Unterschied. Zugegeben werden muß, dass das Wissen um die Unumkehrbarkeit des Krankheitsgeschehens nie vollkommen sicher sein kann. So gesehen ruht die aktiv/passiv Unterscheidung auf einer prinzipiellen Unsicherheit. Die inzwischen in gesellschaftlichen, juristischen und ärztlichen Kreisen anerkannte Unterscheidung und die breite Diskussion um Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten mahnt allerdings an, dass wir Ärzte uns nicht auf die prinzipielle Unvorhersagbarkeit zurückziehen können und lieber alles an Krankheiten so lange und intensiv therapieren bis die Menschen es trotzdem schaffen zu sterben. Ein Arzt, der nach Abwägung mit seinen Kollegen und den Mitarbeitern, nach Gesprächen mit Angehörigen und bestenfalls auch mit dem Patienten, dem Sterben Raum lässt und eine Sterbebegleitung in den Vordergrund stellt, zieht sich nicht unärztlich aus der Verantwortung zurück und tut gar „nichts“. Ärztliche Verantwortung und ärztliches Handeln ist nicht gleichzusetzen mit Aktionismus. Abgesehen davon, dass die Grundvoraussetzung der aktiv/passiv-Unterscheidung die Anerkennung einer Grenze menschlichen Einflusses ist, hat sie eine weitere Schwäche, die ihren Stand in der akademischen Diskussion erschweren: sie ist aus der Praxis gewonnen. Pragmatisches Wissen um Grenzen hat es im traditionellen akademischen Lehrbetrieb schwer, Annerkennung zu finden. Wo selbst praktische Medizinethik noch von Menschen gedacht wird, die nie mit Kollegen am Krankenbett gestanden haben oder allein als Notarzt vor der Frage standen, den kachektischen metastastierten Tumorpatienten zu reanimieren oder es zu lassen, hat es Erfahrung mit Kranken, Sterbenden und den Angehörigen schwer. 5. Schlussfolgerung Sind die Begriffe aktive, passive und indirekte Sterbehilfe eine Hilfe im Umgang mit Sterben und Tod? Gibt es bessere Begriffe, präzisere? Ist die Unterscheidung Tun und Unterlassen hilfreich? Einerseits sind sie eine Hilfe, andererseits können sie auch erschwerend wirken. Vor meinem Erfahrungshintergrund als philosophisch denkende Chirurgin und Anästhesistin sind zumindest die Begriffe aktive, passive und indirekte Sterbehilfe hilfreich, um Situationen am Lebensende im Wortsinn zu begreifen. 15 Die Beschäftigung mit der Unterscheidung „Tun und Unterlassen“ ist, wie oben ausgeführt insofern wichtig, dass sich der Handelnde darüber klar wird, ob er biologische Geschehnisse wie das Sterben als nicht mehr vom Menschen änderbar ansieht und damit ein passives Verhalten möglich wird oder ob die prinzipielle Unvorhersagbarkeit, ob ein Sterbeprozeß eingesetzt hat, einerseits ein argumentativ bequemer Rückzug ist, der gleichzeitig die neuzeitliche Vorstellung von der technischen Naturbeherrschung unangefochten lässt. Beides ist eine Haltung, die ein Mensch einnehmen kann. Davon hängt es ab, ob die Unterscheidung Tun/Unterlassen und damit aktive und passive Sterbehilfe sinnvoll ist. Probleme mit dem Sterbenlassen bei Nicht-Sterbenden wie missgebildeten Neugeborenen oder im Schlucken und Abhusten behinderter alter Menschen können allerdings mit der Begriffstrias aktiv, passiv und indirekt nur unzureichend erfasst werden, denn hier kann man den zumindest sehr stark vermuteten begonnenen Sterbeprozeß wie in den oben geschilderten Fällen nicht als „moralische Grenze“ heranziehen. Hier eher von „Entscheidungen am Lebensende“ zu sprechen erscheint sinnvoller. 16