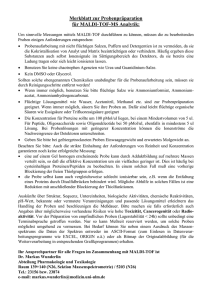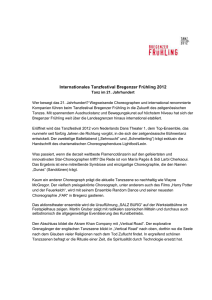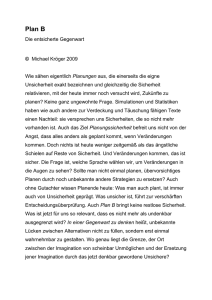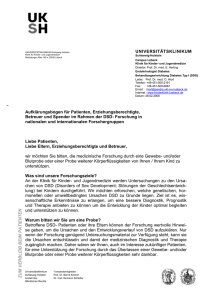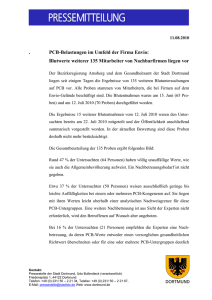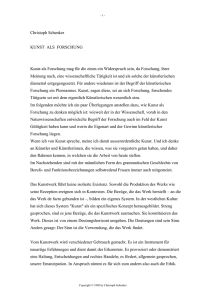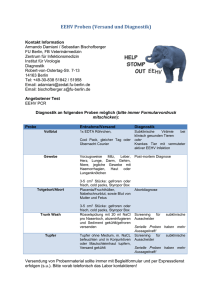Süddeutsche Zeitung FEUILLETON Donnerstag, 17. August 2006
Werbung

Süddeutsche Zeitung FEUILLETON Donnerstag, 17. August 2006 München Seite 13 · Bayern Seite 13 · Deutschland Seite 13 Bei der Arbeit Zeremonienmeister für Zeitgenössisches Tino Sehgal produziert Kunstobjekte, von denen nichts übrig bleibt. Die Museen lieben ihn dafür. Im Kunsthaus Bregenz wird heute eine Einzelausstellung mit Arbeiten von ihm eröffnet Bregenz im August, elf Uhr morgens, im Sichtbetonkeller des mattgläsern schimmernden Kunsthauses. Ein paar Leute stehen im Kreis. Erst herrscht totale Stille, dann atmen sie laut, vollständig synchron, und formen die Lippen zu Silben, die erst kaum verständlich sind, dann deutlicher vernehmbar, jetzt sprechen sie laut immer wieder gemeinsam den Satz: „ The objective of this work is to become the object of discussion.“ Dann plötzlich beginnen die acht Leute beim Sprechen des immergleichen Satzes zu röcheln, sie krümmen sich, sinken zu Boden, alle zugleich, die letzten Silben nur mehr gurgelnd, bis schließlich alle stumm daliegen. „ Okay. Und jetzt noch mal das Sterben“, sagt der Künstler Tino Sehgal, der als erster wieder aufspringt. Wenn man die Kamera zückt, um dieses seltsame Treiben aufzunehmen, gibt Sehgal mit einem freundlichen Kopfschütteln zu erkennen, dass man das lieber bleiben lassen soll. Er verbietet grundsätzlich Aufnahmen seiner Arbeit innerhalb des Museums. Und nur manchmal erlaubt er, dass man ihn selbst fotografiert. Wer das Bilderverbot zu durchbrechen versucht, bekommt es mit ihm zu tun. Seine Kunst soll so flüchtig bleiben wie ein Gerücht. Diese Türsteherstrategie – weise jemanden ab, und er denkt, er verpasst die wichtigste Party der Welt – funktioniert bislang wunderbar: Denn Gerüchte sind hartnäckig, und Sehgal wird inzwischen von Museen in ganz Europa eingeladen, seine choreographierten Aufführungen zu inszenieren. Tino Sehgal ist eigentlich ein Prince Charming – wobei seine Höflichkeit von einem verblüffenden Selbstbewusstsein grundiert wird. So sagt er zum Beispiel, ein paar Tage vor den Proben zu seiner Bregenzer Ausstellung, in einem Berliner Café Sätze wie diesen: „ Natürlich sind Künstler Egomanen, aber ich habe auch meine bescheidene Seite.“ Er ist sendungsbewusst, von seiner Arbeit überzeugt, von gewinnendem Wesen. Was dann aber wieder gar nicht so erstaunlich ist, wenn man weiß, dass Sehgal Objekte erzeugt, die im herkömmlichen Sinn keine sind: Sie entstehen aus dem Nichts, existieren immer nur für einen Moment lang und vergehen, als wäre nichts geschehen. Von ihnen existieren keine Fotos, keine Videos und keine Schriftsätze, ja nicht mal Hinweisschilder an der Museumswand, sie sind, als flüchtige Situationen, im Grunde nicht mal Teil der Wirklichkeit, denn sie finden innerhalb des geschlossenen Museumssystems statt und werden als ein immaterielles Gut wahrgenommen. Da sind nur ein paar Leute, die im Kreis stehen und sagen: Das Ziel dieser Arbeit ist es, zum Gegenstand einer Diskussion zu werden. Und dann sagen sie vielleicht noch so etwas wie: „ Das ist eine Arbeit von Tino Sehgal, 2006“. Sie sprechen die Unterschrift des Werks. Eigentlich ist sie der einzige Hinweis darauf, dass es sich um ein Kunstwerk handelt. Wenn ein Sammler Sehgals Arbeiten erwirbt – sowas ist durchaus möglich – , gibt es eine mündliche Abmachung beim Notar, mehr nicht: keine Rechnung, keine Quittung, nichts. Es ist eine Kunst auf Treu und Glauben. Der Sammler muss – nach genauer Instruktion des Künstlers – selbst sehen, wie er das Kunstwerk aufführt. Und weil das so ist, weil Sehgals Kunst nicht fassbar ist, ist er selbst deren wichtigste Gelenkstelle: als Verkäufer und Interpret, der Bedeutungszusammenhänge herstellt – und so garantiert, dass Museumsleute, Kritiker, Sammler sein Werk ernst nehmen. Im vergangenen Sommer, als er im Deutschen Pavillon der Kunstbiennale in Venedig italienische Wärter tanzen und singen ließ, wobei sie immer wieder ausriefen „ This is so contemporary!“ – das ist so zeitgenössisch! – , da empörten sich nicht wenige. Es kamen überrumpelte Kritiker aus dem Pavillon, die diese Inszenierung als „ Schande für Deutschland“ schmähten. Andererseits war dies das eine Kunstwerk der Biennale, über das jeder sprach – indem er wiederholte: Ja, stimmt, ist ja alles so zeitgenössisch hier. Wobei das Schöne war, dass dieser bald wie ein Mantra wiederholte Ausspruch je nach Laune lobend oder abschätzig gemeint sein konnte. Er traf ja immer zu. Sehgal hatte gewonnen. Seine Kunst war zum Gegenstand der Diskussion geworden. Wie eine Diskurswolke schwebte der nichts und alles sagende Satz über dem BiennaleKunstauftrieb. Wenn einer also für seine Kunst keine Staffelei braucht und kein Atelier, wenn er keine Skulpturen und weder Kameras benutzt noch zulässt, wie arbeitet er dann? Wie kommt eine Sehgal-Ausstellung zustande? Und: Warum macht er das alles eigentlich? Ist er eine Art Clown des Kunstbetriebs? Am heutigen Donnerstag wird im Kunsthaus Bregenz eine Einzelausstellung von Sehgal eröffnet. Die Proben mit Dutzenden von Darstellern dauern knapp eine Woche. Sehgal hat, das wird immer wieder zitiert, Ökonomie und Tanz studiert. Die Ideenfindung ist das eine – „ Ideen habe ich beim Zugfahren. Diese Langeweile ist sehr produktiv“ – , das Verwalten von Bedeutungen das andere. Eine Arbeit wie „ This is so contemporary“ ist nicht auf ein Verstehen angewiesen, sondern mehr auf Wirkung hin angelegt, sie funktioniert oder sie scheitert: „ In dem Moment, wo sie als zeitgenössisch anerkannt wird, ist die Gleichsetzung von ,zeitgenössisch‘ und ,technischer Fortschritt‘ aufgehoben.“ „ Ich mache keine Institutionskritik. Bildende Kunst ist ein Ritual, das die ökonomische Produktion feiert und reflektiert. Die Konzeptkunst der sechziger Jahre war der letzte Versuch, gegen die Warenförmigkeit der Kunst anzugehen, das war naiv, denn alles – auch eine Idee – kann ein Produkt sein. Bei mir geht es nicht um eine Kritik an der Ware und nicht darum, ein Außerhalb der Gesellschaft zu konstruieren. Im Gegenteil, ich affirmiere die Produkthaftigkeit des Kunstwerks und sehe es als einen immanenten Bestandteil von Gesellschaft und Markt an.“ Der Konzeptkünstler Robert Barry hatte in den Sechzigern eine Galerie, in der er ausstellen sollte, für die Dauer dieser Ausstellung einfach geschlossen. An der Eingangstür prangte ein entsprechendes Hinweisschild, das war alles. Das war eine deutliche Botschaft: nicht mit mir, Jungs. Sehgal dagegen verkauft seine Situationen in einer Auflage von drei bis sechs Stück. Sehgal ist kein Epigone von Andy Warhol. Auch der machte ja Kunst zur Ware und die Ware zur Kunst. Aber bei ihm gab es noch noch ein materiell greifbares Werk: den Siebdruck, den Film. Hier spricht jemand, der wie Yves Klein immaterielle Güter verkauft – nur ohne blaues Pigment, ohne goldene Schecks. Einer, der die Museen „ umcodieren“ will, ihre „ Gleichungen knacken“: „ Ein Museum ist ein Ort, wo die Werte der heutigen und der nächsten Generation zur Schau gestellt werden. Es geht um Kanon, Macht, Verantwortung.“ Was bleibt aber, wenn Sehgal seine Situationen konstruiert hat? Nur die Erinnerung daran. Ist er am Ende also doch: ein Kritiker des Museums? Eher ist er einer, der die Verteilung der Ressourcen zum Thema macht. „ Ich stelle nicht die marxistische Frage: Wie werden die Güter verteilt? Aber ich möchte schon wissen: Was kann, soll, muss man überhaupt noch produzieren?“ Was Sehgal also tatsächlich produziert, ist im Grunde nichts anderes als ein durchsichtig verpackter, gläserner Warenkreislauf. Auch und gerade im Museum. Die Bezahlung des Arbeitsaufwandes, der Proben etwa, muss dabei aber nicht eingerechnet werden. „ Kunst generiert Einkommen“, sagt Sehgal, ziemlich entwaffnend. Das Kölner Museum Ludwig hat eine von seinen Situationen erworben, so, wie man ein Gemälde erwirbt. Und natürlich wurde dieses immaterielle Gut dann, als ein anderes Museum anfragte, ganz regulär ausgeliehen. Was ist denn hier los? Apropos Arbeitsaufwand: in Bregenz ziehen sich die Proben nun schon den halben Vormittag hin. Es ist gar nicht so einfach, eine Schar auserwählter Laien dazu zu bringen, vollkommen synchron zu agieren oder zu sprechen. Wenn man während der Ausstellung in einen der lichtgrauen Kapellenräume in Peter Zumthors Kunstwürfel kommt, muss alles genau so ablaufen wie geprobt. Zum Beispiel müssen sich dann die Darsteller wegdrehen, wenn man ihnen näher kommt. Und wenn man etwas sagt wie „ das ist aber unhöflich“, dann kann es sein, dass sie ausrufen: „ Wir haben einen Kommentar! Wer will antworten?“ Und dann beginnen sie über den Ausspruch zu plaudern – so, als ob man selbst gar nicht da wäre. Das muss eine ziemlich merkwürdige Erfahrung sein: Die Idee der Performances der sechziger Jahre war ja, mit dem Objekt der Kunst gleichzeitig seinen Autor verschwinden zu lassen, um das Publikum aktiv einzubinden. In Sehgals Kunst dagegen bekommt man das befremdende Gefühl, dass die Leute über einen reden und gar nicht bemerken, dass man ihnen zuhört. Man ist Teil der Kunst, und doch ist sie unerreichbar, geht spürbar auf Distanz. Es ist, wenn man so will, Meta-Kunst: Kunst, die ohne den schützenden Hort der nobilitierenden Geste „ Dies ist ein Kunstwerk“ keine wäre. Die die Institution Museum, welche sie doch eigentlich aushebeln will, auf der anderen Seite dringend braucht. Sehgal kann guter Hoffung sein: Wie es scheint, wird es die Musentempel klassischer Prägung noch eine Weile geben. HOLGER LIEBS