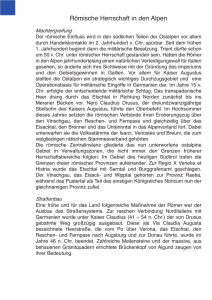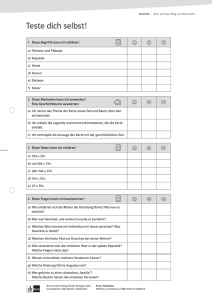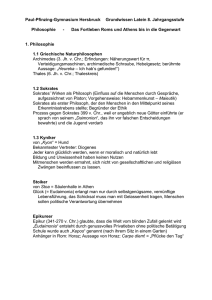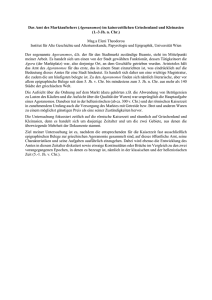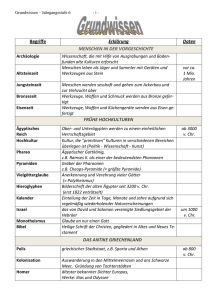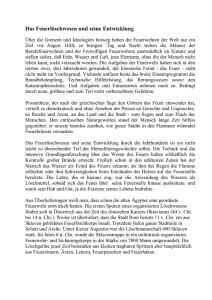Ausgabe 2007 - Sprachenzentrum
Werbung

SKRIPT zur Vorbereitung auf die MÜNDLICHE LATINUMSPRÜFUNG Sprachenzentrum der TU Chemnitz Ausgabe 2007 INHALT Seite 1. Der römische Staat 3 2. Die Gesellschaft 4 3. Familie und Haus 6 4. Die Stadt 7 5. Das Militär 9 6. Der Alltag 10 7. Zeit, Geld, Maße 11 8. Die Religion 12 9. Die Römer und ihre Nachbarn 14 10. Geschichte 15 Griechische Geschichte 15 Frühzeit Roms 16 Der Kampf gegen Karthago 16 Späte Republik 17 Das Kaiserreich 18 11. Cicero 19 12. Die Philosophie 20 13. Die Redekunst 23 14. Schreiben und Literatur 25 15. Die lateinische Sprache 28 Anhang 30 2 1. DER RÖMISCHE STAAT In früher Zeit war Rom Königreich (bis etwa 500 v. Chr.). Nachdem man den König, der als unerträglicher Tyrann empfunden wurde, gestürzt hatte, bildete sich in langen inneren Kämpfen die Struktur der Republik heraus, die fast ein halbes Jahrtausend dauern sollte; eine geschriebene Verfassung hatte der römische Staat nie. Die Römer waren stolz auf ihre „Mischverfassung“, in der sich monarchische, aristokratische und demokratische Elemente auf so stabile Weise verbanden; es überwiegt das aristokratische Element, weshalb man Rom am ehesten als eine Adelsrepublik bezeichnen kann. An der Spitze des Staats standen die Konsuln. Man wählte je zwei von ihnen (Prinzip der Kollegialität), und ihre Amtszeit war auf ein Jahr beschränkt (Prinzip der Annuität): Damit sollte verhindert werden, dass ein Einzelner allzu große Machtfülle erwarb. Jeder dieser zwei Konsuln besaß das Imperium, die uneingeschränkte Befehlsgewalt. Konnten sie sich nicht einigen, musste zwischen ihnen schließlich das Los entscheiden. Konsul wurde man, indem man die klassische Ämterlaufbahn einschlug, den Cursus honorum. Als Amt (Magistratus) galten Stellungen, in die man vom Volk gewählt wurde, die unselbständigen Hilfskräfte waren Ministri. Man begann, indem man sich zunächst zum Quästor wählen ließ, zuständig für Verwaltungs- und Finanzangelegenheiten. Hierauf folgte der Ädil, der für die Beaufsichtigung des Marktes, Bauten, Veranstaltung von Spielen usw. verantwortlich war. Den Prätoren unterstand das Rechtswesen, doch konnten sie auch Heere leiten. Ebenso wie den Konsuln fiel ihnen nach Ablauf der Amtszeit die Verwaltung einer Provinz zu - eine einträgliche Sache, die allein schon ausreichte, diese Ämter interessant zu machen. Vor den Beamten gingen, in unterschiedlicher Zahl je nach Ranghöhe, die Liktoren einher, Amtsdiener, die als Zeichen der Amtsgewalt und des Rechts, Strafen zu vollstrecken, die Fasces trugen: Rutenbündel, in denen ein Beil steckte; auf diese geht der Name des Faschismus zurück. In Krisenzeiten wurde ein Diktator ernannt; er erhielt außerordentliche Vollmachten, die jedoch auf sechs Monate beschränkt waren. In der späten Republik nahmen die faktischen Machthaber gern den scheinbar legitimen Titel eines „Diktators auf Lebenszeit“ an (Sulla, Cäsar). Von Zeit zu Zeit setzte man einen Zensor ein, der die Bürger-, Senatoren- und Steuerlisten zu überprüfen hatte. Ihm fiel damit auch die Möglichkeit zu, die sittliche Lebensführung seiner Mitbürger zu zensieren, was ihn zu einem geachteten, aber auch gefürchteten Mann machte; besonders der ältere Cato nutzte das Amt, um die Römer notfalls mit Zwang auf die altüberkommene Moral zu verpflichten. Wichtigste und kontinuierlichste Institution der römischen Republik war der Senat, zunächst mit 300, später 600 oder gar 900 Sitzen. Er tagte in der Kurie, einem häufig wechselnden Gebäude; gern benutzte man auch Tempel oder Theater. In den Senat wurde man nicht gewählt; es saßen darin vorwiegend die Oberhäupter der bedeutendsten adligen Familien, und zwar auf Lebenszeit. Er glich also mehr dem britischen Oberhaus als einem neueren Parlament. Mitglied wurde man, wenn man ein Amt bekleidet hatte. Die feierliche Anrede an die Senatoren lautet Patres conscripti, „versammelte Väter“. Der Senat setzt die Richtlinien der Politik, doch wirkt er hierbei durch seine Auctoritas, also durch das Ansehen, das er genießt, nicht durch festgesetzte Befugnisse. Ein Senatusconsultum war streng genommen nur eine Empfehlung, besaß jedoch praktisch immer bindende Kraft. Bei Abstimmungen 3 fragte man zunächst die Principes Senatûs, die führenden Männer, um ihre Meinung; häufig waren dies Konsulare, erfahrene Senatoren, die schon einmal das Konsulat bekleidet hatten. Neben Beamten und Senat waren die Einrichtungen des Volks die dritte Säule des römischen Staats. Es übte seine Macht durch verschiedene Arten von Volksversammlungen (Komitien) aus. In den Zenturiatskomitien, den wichtigsten von ihnen, stimmte man nach Zenturien ab. Das waren Stimmklassen, die sich nach dem Einkommen richteten (ursprünglich nach der Art der Leistung, die die Bürger im Heer erbrachten). Jede Zenturie hatte eine Stimme. Waren sich die oberen Vermögensklassen einig, so fiel die große Masse des Volks kaum noch ins Gewicht. Die Volksversammlung wählte die Beamten, beschloss Gesetze, entschied über Krieg und Frieden. Die Stimmbürger werden als Quirites angeredet. Zusammen mit dem Senat ist das Volk Inhaber der Souveränität; deshalb gilt als römisches Hoheitszeichen die Buchstabengruppe SPQR (Senatus Populusque Romanus). Die Plebs wählte ihre eigenen Beamten, die Volkstribunen (Tribuni Plebis), um sie gegen die Übermacht des Senats und der meist adligen Konsuln zu schützen. Sie besaßen das Recht des Veto („ich verbiete es“): Jede beliebige staatliche Maßnahme konnten sie durch ihren Einspruch blockieren. Außerdem kann die Plebs auf ihren eigenen Versammlungen Beschlüsse mit Gesetzeskraft fassen (Plebiszite). Seit dem letzten Drittel des 2. Jahrhunderts v. Chr. gerät die römische Republik mit ihren Institutionen in eine schwere Krise, die nach hundert Jahren schließlich in eine neue Monarchie mündet. Octavianus Augustus, der sie begründet, vermeidet es, den Titel eines Rex (König) anzunehmen, der den Römern verhasst ist: Sein Adoptivvater Cäsar war ermordet worden, als man ihn verdächtigte, „Rex“ werden zu wollen. Stattdessen wahrt Augustus, obwohl er gestützt auf die Armee die unumschränkte Macht besitzt, die Fiktion, es würde der Staat in seiner bisherigen Form fortbestehen. Das ist für die traditionsbewussten Römer, die „neue Dinge“ grundsätzlich ablehnen, sehr wichtig. Er selbst, Augustus, sei nur ein Princeps inter Pares, der Erste unter Gleichen. Er lässt sich zeitweilig oder dauernd verschiedene Funktionen übertragen, u.a. das Konsulat, die Gewalt der Volkstribunen (mit dem wichtigen Veto-Recht!) und den Titel eines Imperator, eines Feldherrn im Besitz des militärisch-zivilen Oberbefehls. Unter den Nachfolgern des Augustus stabilisiert sich die Monarchie und wird zur erblichen Einrichtung; so kann neben „Princeps“ und „Imperator“ auch der Familienname Caesar zum dritten Begriff für den Kaiser werden. Erst knapp hundert Jahre nach Augustus fühlt sich der Monarch stark genug, den bisher verpönten Titel Dominus (Herr) anzunehmen, der den Absolutheitsanspruch anzeigt. Die Institutionen der Republik, insbesondere der Senat, verlieren immer mehr an Einfluss, werden aber - bezeichnend für die konservativen Römer niemals abgeschafft. 2. DIE GESELLSCHAFT Römischer Bürger (Civis) ist, wer zum römischen Volk, dem Populus Romanus, gehört, das sich im Wesentlichen nicht als Sprach- oder Abstammungs-, sondern als Rechtsgemeinschaft versteht. Man wird Bürger durch Geburt oder Verleihung. Längst nicht alle Bewohner des Reichs genießen dieses Privileg. Die Bewohner Italiens sind teils römische Bürger (oft in Kolonien, Bürgersiedlungen, die von Rom aus angelegt werden), überwiegend aber 4 Bundesgenossen (Socii), die in ihren Landstädten (Municipia) Selbstverwaltung besitzen und im Gegenzug zum Kriegsdienst für das Reich verpflichtet sind. Die Bewohner der Provinzen haben demgegenüber erheblich geringere Rechte, z.B. sind sie fast ohnmächtig gegen habgierige römische Beamte; denn eine Provinz ist ein erobertes Außengebiet. Das römische Recht folgt nicht dem Grundsatz „Jedem das Gleiche“, sondern „Jedem das Seine“ (suum cuique). Erst im 3. Jh. n. Chr. werden diese Unterschiede ausgeglichen und das Bürgerrecht an alle (freien) Bewohner des Reichs vergeben. Das römische Volk selbst ist stark geschichtet. Am mächtigsten sind die Patrizier, eine eng umgrenzte Zahl von Familien; aus ihnen stammen zur Zeit der Republik fast alle wichtigen Politiker. Wer nicht zu diesem Kreis gehört (z.B. Cicero), hat es schwer: Er muss sich als homo novus den Weg gegen erheblichen Widerstand bahnen. Das Vermögen der Nobilität besteht zumeist in Grundbesitz, nicht selten riesigen Latifundien. Darunter kommt, als niederer Adel, der Stand der Ritter (Equites), die darum so heißen, weil sie in alter Zeit im Krieg ein Pferd stellen mussten. Sie erwerben oft großen Reichtum durch Handelsgeschäfte (die für den patrizischen Stand als nicht standesgemäß gelten). Cicero ist Eques. Die große Masse des Volks bilden die Plebejer. (Die!) Plebs ist kein abschätziger Ausdruck; er meint einfach eine Schicht. Viele Plebejer in der Stadt Rom waren jedoch völlig mittellose Proletarier („proles“ ist die Nachkommenschaft, der sie ihren einzigen Besitz, das Bürgerrecht, vererbten). Sie hatten keinen selbständigen Lebensunterhalt und ernährten sich durch Lebensmittelspenden und Stimmenkauf bei den Wahlen; ihnen mussten „Brot und Spiele“ (panem et circenses) geliefert werden. Eine große Rolle spielt das Verhältnis von Patron und Klient. Der Klient verrichtet für den Patron alle möglichen kleineren und größeren Dienste, er stellt Briefe zu, macht für ihn Reklame im Wahlkampf, erhöht dessen Ansehen, indem er ihn zusammen mit möglichst vielen anderen Klienten am Morgen begrüßt und aufs Forum begleitet. Der Patron seinerseits ist verpflichtet, den Klienten vor Gericht zu vertreten, ihm substantielle Geschenke zu machen (z.B. eine Toga, damit er sich als Stimmbürger bei der Volksversammlung blicken lassen kann) und ihn bei der morgendlichen Begrüßung mit einem Frühstück oder einem kleinen Geldbetrag zu empfangen. Die späte Republik wird beherrscht von den Kämpfen zwischen den Optimaten, der Senats- oder Adelspartei, und den Popularen, der Volkspartei. Es kämpften hier nicht, wie die Namen vermuten lassen, zwei Klassen gegeneinander - auch die Führer der Volkspartei (z.B. Cäsar) entstammten meist der Nobilität. Doch bediente sich die Volkspartei besonders der Volksversammlungen und des Tribunats und versuchte bestimmte volkstümliche Anliegen durchzusetzen, etwa eine Landreform, die nur auf Kosten des adligen Großgrundbesitzes zu verwirklichen war. Völlig außerhalb der Rechtsordnung stehen die Sklaven. Sie gelten juristisch als Sachen. Der ältere Cato unterscheidet in seiner Schrift über die Landwirtschaft „stumme Geräte“ (Sichel, Pflug usw.), „halbstumme Geräte“ (Nutztiere) und „stimmbegabte Geräte“ (Sklaven). Gegen Misshandlung und selbst Tötung genossen sie bis weit in die Kaiserzeit keinerlei Schutz. Große Angst hatte die römische Gesellschaft vor Sklavenaufständen, gegen die man daher mit exemplarischer Härte vorging: 5000 Teilnehmer des Spartakus-Aufstands (73-71 v.Chr.) wurden nach dessen Unterdrückung längs der Via Appia ans Kreuz geschlagen. Das Schicksal der Sklaven ist sehr verschieden; Sklaven auf den Galeeren und in den Steinbrüchen wurden oft regelrecht „verbraucht“, auf den großen Landgütern unter harten Bedingungen gehalten. Den Sklaven der Familia, d.h. der Hausgemeinschaft, bei den Reichen manchmal mehreren 5 Hundert, erging es besser; manche waren als Hauslehrer und selbst als Minister der Kaiser angesehen, sogar mächtig. Auf den Sklaven beruhte in der klassischen Zeit (100 v. Chr. bis 100 n. Chr.) der größte Teil der Wirtschaft. Sie wurden billig und in großer Zahl von Piraten, die die Küsten heimsuchten, und durch Roms zahlreiche Kriegszüge auf den Markt gebracht; mit den römischen Heeren der späten Republik reisten Sklaven-Großhändler, die das unterworfene Menschenmaterial aufkauften. Als diese zwei Quellen in der Kaiserzeit versiegten, wurde die Sklaverei (die stets eine sehr uneffiziente Art des Wirtschaftens bedeutet) allmählich zu teuer. Man begann die Sklaven für entsprechende Gegenleistungen (Geldzahlungen, Gewinnbeteiligung bei Geschäften usw.) freizulassen. Diese Freigelassenen bildeten in der Kaiserzeit allmählich so etwas wie einen gewerbetreibenden Mittelstand, der die extremen Unterschiede zwischen einer sehr reichen, aber sehr dünnen Oberschicht und den riesigen Massen, die gar nichts besaßen, teilweise ausglich. Die Sklaverei wird nie im eigentlichen Sinn aufgehoben; sie verschwindet ab dem 3. Jahrhundert langsam in der Bedeutungslosigkeit. 3. FAMILIE UND HAUS Baustein der Res publica ist das einzelne Haus, die Domus. Ihr gehören nicht nur Vater, Mutter und Kinder an, sondern oft auch andere Verwandte und die Sklaven. An ihrer Spitze steht der Paterfamilias, der Haushaltsvorstand, mit sehr weit gehenden Rechten, die in alter Zeit bis zur Tötung der Familienmitglieder reichen. So lange sein Vater noch lebt, wird ein römischer Bürger nie völlig mündig. Urbild des Hauses ist der autark wirtschaftende Bauernhof. So viel wie möglich von dem, was man braucht, wird im Haus hergestellt, vor allem Textilien; das Spinnen und Weben nimmt einen großen Teil der Hausarbeit in Anspruch. Dem Paterfamilias steht die Materfamilias, seine Gattin, zur Seite; die verheiratete Frau, die Matrona, ist sehr angesehen (weit mehr als bei den Griechen!), obwohl formal rechtlich dem Mann nicht gleichgestellt. Im Lauf der späten Republik verbessert sich allmählich ihre Stellung: Sie darf Vermögen erwerben und darüber verfügen, sie kann sich scheiden lassen. Dass sie kein aktives und passives Wahlrecht besitzt, hört spätestens in der Kaiserzeit auf, eine echte Benachteiligung zu sein. Frauen (der Oberschicht) haben oft Zugang zu Bildungsmöglichkeiten; die Zahl der überlieferten Philosophinnen, Dichterinnen usw. bleibt jedoch gering. Dafür spielen manchmal Kaiserinnen eine wichtige Rolle. Es wird früh geheiratet (die Frauen sind oft erst zwölf oder vierzehn) und auf bemerkenswert unsentimentale Weise. Scheidungen lassen sich leicht realisieren, doch muss dann der Mann die Mitgift wieder herausgeben (was ihn manchmal ruiniert). Den römischen Bürger erkennt man am dreiteiligen Namen. Für den Vornamen (praenomen) gibt es nur geringe Asuwahl; Vornamen werden darum nach einem einheitlichen Schlüssel abgekürzt: C. = Gaius, M. = Marcus, T. = Titus, L. = Lucius, A. = Aulus, P. = Publius, Cn. = Gnaeus und noch etwa ein halbes Dutzend weitere. Dass zu den Vornamen auch Quintus, Sextus und Decimus gehören, also ursprünglich der Fünfte, der Sechste und der Zehnte, zeigt, dass die Römer bei der Namensgebung Phantasie für überflüssig hielten. In der Mitte steht der Sippenname (Nomen gentile), der die Zugehörigkeit zu den großen Clans der Julier, Claudier, Cäcilier, Tullier usw. ausweist. Es folgt der Beiname (cognomen), der die Familie 6 im engeren Sinn angibt, also z.B. Caesar oder Cicero. Der Name kann durch ehrende Zusätze erweitert werden; so heißt P. Cornelius Scipio dazu auch noch „Africanus“, zur Erinnerung an seinen Sieg in Afrika. Frauen haben keine Vornamen! Für sie genügt der Sippenname; so heißt Ciceros Tochter einfach „Tullia“. Bei zwei Töchtern unterscheidet man zwischen „maior“ und „minor“, Älterer und Jüngerer; kommt noch eine dazu, heißt sie „Tertia“, mit Kosenamen für das Nesthäkchen gern auch „Tertiola“ („Drittchen“). Das römische Haus ist um ein Atrium herum organisiert, einen Innenhof, um den ein überdachter Gang läuft; auf ihn öffnen sich alle Zimmer, nach außen gibt es nur eine Tür und so gut wie keine Fenster. Im Atrium befindet sich oft ein Sammelbecken für Regenwasser, das von dem nach innen geneigten Dach hereinläuft, das Impluvium. So bleibt es auch bei südlicher Hitze schattig und kühl. Dieses Grundmodell kann erweitert werden durch ein Peristyl, ein von Säulen umgebenes zweites Rechteck. Durch Anbau erreichen besonders die vornehmen Landhäuser, die Villae, oft gewaltige Grundflächen. In die Höhe wird kaum gebaut; zwei Stockwerke genügen. Anders bei den billigen Mietswohnungen in Rom, den Insulae (insula = Straßenblock). Da nur ihre Höhe vorgeschrieben ist (maximal ca. 20 m), nicht aber die Stockwerkszahl, erreichen sie manchmal zehn Geschosse, wo die Mieter dann allerdings den Kopf einziehen müssen. Sie sind oft schlampig gebaut und von Feuer und Einsturz bedroht. 4. DIE STADT Die Antike ist weitgehend als eine Kultur der Stadt zu verstehen - dem griechischen Wort Polis entspricht die lateinische Civitas als Gemeinschaft der Bürger. Das gesamte römische Reich geht zuletzt aus einer Vergrößerung der Stadt Rom hervor, in die immer entferntere Gebiete „eingemeindet“ werden. Das Bild der antiken Städte wird weitgehend von den großen öffentlichen Bauten geprägt; Wohnhäuser und Produktionsstätten spielen eine weit geringere Rolle. In ihrem Zentrum befindet sich stets ein Forum: der Marktplatz, an dem jede Art von öffentlichem Leben stattfindet; es ist der allgemeine Treffpunkt. Nicht nur der Warenverkauf findet hier statt, sondern auch Gerichtsprozesse und Versammlungen. Oft ist es ganz oder teilweise zugebaut mit Tempeln, Säulengängen usw. Auf dem Forum oder nahe dabei findet sich, besonders in der Spätantike, die Basilika, ein großer Hallenbau, zunächst als Markthalle, später als Audienzsaal der Kaiser oder hoher Beamter; sie wird von den Christen weiterentwickelt zum wichtigsten Kirchentyp. Der römische Tempel sieht in seiner Standardversion ein wenig anders aus als der griechische: Während der griechische frei steht und allseitig von Säulen und ansteigenden Stufen umgeben wird, ist der römische auf den Anblick von vorn berechnet und weist oft nur von dieser Seite Treppen und Säulenstellungen auf. In seinem Innern befindet sich die Cella; sie gilt als Wohnraum der Gottheit, hier steht ihr Kultbild. Die Cella dient nicht dem Gottesdienst; die Gemeinde versammelt sich vor dem Tempel, dort finden auch die Opfer statt. Es gibt auch andere Typen von Tempelgebäuden: Der Tempel der Vesta z.B. ist kreisrund, das Pantheon in Rom ebenfalls und von einem riesigen Gewölbe überkuppelt. Überhaupt verwenden die Römer bevorzugt die Bauformen des gemauerten Bogens und des aus Zement gegossenen Gewölbes (die bei den Griechen fast gar nicht vorkommen). Die größten Bauwerke, die die römische Antike errichtet, sind die Thermen: Bäderkomplexe mit ungeheuren gewölbten Hallen, mit Serien von heißen, lauwarmen und 7 kalten Becken, Schwitzkammern Sportanlagen, Liegewiesen, kleinen Läden, selbst Bibliotheken. Da die Wohnungen oft eng und ungesund sind, findet hier findet das römische Freizeitleben statt, vornehmlich am Nachmittag. Die ungeheuren Mengen Wasser, die benötigt werden, schafft man oft über weite Strecken durch Leitungen herbei, die, wo sie Täler überqueren, über hoch gemauerte Aquädukte laufen. Geheizt wird durch ein System von Rohren, die durch Fußboden und Wände laufen, die Hypokausten. Die Theater verfügen über Kapazitäten von vielen tausend Sitzen. Sie sind als offener Halbkreis angelegt, in dem die Sitzreihen ansteigen. Die Griechen schauen gern in die offene Landschaft hinaus, die Römer schließen den Halbkreis mit einer hohen steinernen Bühnenkonstruktion. Im Amphitheater (z.B. dem Kolosseum in Rom) werden Gladiatorenspiele gezeigt; der Name (amphi = rund herum) rührt daher, dass sie im Gegensatz zu den Bühnentheatern einen vollen Kreis (meist ein Oval) beschreiben. Langgestreckt dagegen bieten sich die Anlagen dar, in denen Wagenrennen stattfinden, etwa der Circus Maximus in Rom. Hier können bis zu einer Viertelmillionen Zuschauer sitzen. Die antiken Städte erreichen oft erstaunlich hohe Einwohnerzahlen. Drei von ihnen überschreiten vermutlich die Millionengrenze: Rom; Alexandria, Hauptstadt Ägyptens und Zentrum der hellenistischen Kultur, berühmt für seinen Leuchtturm und seine Bibliothek; und Antiochia, die Hauptstadt Syriens. Die großen Städte liegen fast alle im griechisch beeinflussten Osten des Reichs: Ephesos, Milet und Pergamon in Kleinasien, Syrakus auf Sizilien, Tarent in Unteritalien. Athen und Korinth, die beiden wichtigsten Städte Griechenlands, haben ihre beste Zeit damals schon hinter sich. Die bedeutendsten Städte in Gallien sind Lugdunum (Lyon) und Augusta Treverorum (Trier), in Germanien Colonia Agrippina (Köln) und Moguntiacum (Mainz). Das vom Vesuvausbruch des Jahres 79 n. Chr. verschüttete und darum bewundernswert gut erhaltene Pompeji gibt einen Eindruck, wie man sich einen vornehmen Badeort vorzustellen hat. Wenn die Römer eine Stadt neu gründen, folgen sie dem Muster eines Heereslagers: Der Grundriss bildet annähernd ein Quadrat, mit gerundeten Ecken, in dem sich rechtwinklig die beiden Hauptstraßen kreuzen, der Cardo und der Decumanus; parallel verlaufen die kleineren Straßen, so dass sich ein Schachbrettmuster ergibt. An der Kreuzungsstelle wird das Forum angelegt .Wo die Straßen das ummauerte Geviert verlassen, stehen die vier Haupttore. Alte, gewachsene Städte hingegen, auch Rom selbst, bestehen aus einem Gewirr kleiner Gassen. Rom liegt am Unterlauf des Tibers, geschützt und doch in verkehrsgünstiger Nähe zu seinem Hafen Ostia, überwiegend östlich des Flusses, verteilt über sieben Hügel. Die wichtigsten davon sind das Kapitol, auf dem sich die Tempel der drei Hauptgottheiten Jupiter, Minerva und Juno sowie lange Zeit die Kurie (s.o.) befanden sowie in alter Zeit die Arx, die Burg; und der Palatin, die bevorzugte Wohngegend, später völlig von den Kaiserpalästen in Anspruch genommen. Das Forum Romanum der Republik wurde später durch mehrere Kaiserforen erweitert. Rom besaß eine Stadtmauer noch aus der Zeit der Könige, doch fühlte es sich jahrhundertelang so sicher, dass erst im 3. Jahrhundert n. Chr. ein neuer Ring gezogen wurde. Das Marsfeld im Nordwesten war zunächst eine große freie Ebene, auf der Volksversammlungen, Heeresschauen und sportliche Veranstaltungen stattfanden. Hier errichtete Augustus die Ara Pacis, einen Altar des Friedens, um seine Verdienste als Beendiger des Bürgerkriegs zu betonen. Das Mausoleum des Kaisers Hadrian ist heute als Engelsburg bekannt. Von Rom strahlen die wichtigsten Straßen Italiens aus („Alle Wege führen nach Rom“), am bekanntesten davon die Via Appia in Richtung Südosten. Sie ist mit zahlreichen Grabdenkmälern bestanden, denn Bestattungen waren innerhalb des Pomeriums, 8 der Stadtgrenze, verboten. Foren, öffentliche Bauten und private Parks verbrauchten den meisten Platz; der Großteil der Bevölkerung lebte sehr beengt z.B. in dem Stadtviertel Subura. Rom war noch in der späten Republik eine wenig ansehnliche Stadt aus Ziegeln und Holz, die mit ihrer engen Bebauung regelmäßig Brandkatastrophen zum Opfer fiel, am verheerendsten das Feuer von 64 n.Chr., zur Zeit des Kaisers Nero, als fast die ganze Stadt verbrannte. Danach wurde es weit großzügiger neu aufgebaut - wie die Kaiser sich generell bemühten, ihre Hauptstadt durch repräsentative Bauten aus Marmor zu schmücken. Seit dem 4. Jahrhundert, als andere Orte Residenzen wurden, und besonders nach den Plünderungen durch Westgoten und Vandalen im 5. Jahrhundert ging Roms Bedeutung zurück. Doch blieb die symbolische Bedeutung der Stadt als Zentrum der Reichsidee und Sitz des Papstes das ganze Mittelalter hindurch unangefochten. 5. DAS MILITÄR Der außerordentliche Erfolg Roms beruht vor allem auf der Schlagkraft seines Heers. Tapfer und stark waren auch seine vielen Feinde, manchmal sogar im strategischen Denken überlegen (wie z.B. Hannibal); das römische Heer jedoch, der „Exercitus“, war in einzigartiger Weise durchtrainiert und durchorganisiert. Hinzu kamen die Leistungen seiner Ingenieure im Bau von Brücken, Belagerungstürmen, Festungen usw. Die Soldaten Cäsars konnten mit schwerem Gepäck rund sechzig Kilometer am Tag marschieren und am Abend noch aus mitgenommenen Schanzpfählen ein Lager errichten (das am nächsten Morgen wieder abgebaut wurde). Zentrale Einheit des Heers ist die aus Bürgern bestehende Legion, in klassischer Zeit rund 6000 Mann stark. Sie gliedert sich in 10 Kohorten, diese wieder in je 6 Zenturien (Hundertschaften). An der Spitze des Heers steht der Imperator (Feldherr) mit umfassendem Oberkommando. Ihm unterstehen die Legaten (Generäle), die meist die einzelnen Legionen befehligen, und die Militärtribunen (Stabsoffiziere). Zenturionen und Dekurionen (Unteroffiziere) kommandieren je 100 bzw. je 10 Mann. Die Verbündeten stellten weitere Truppenteile, vor allem die Reiter (Equites, Singular Eques). Die römischen Fußsoldaten (Pedites, Singular Pedes) waren bewaffnet mit Schwert (Gladius) und einem kurzen Wurfspeer (Pilum). Derjenige Teil der Bewaffnung, den man in der Hand oder am Körper behielt - Schwert, Schild, Helm, Rüstung - waren die Arma, alle Waffen, die man schoss oder schleuderte - Speere, Pfeile, Katapultgeschosse -, hießen Tela. Kam es zur Schlacht, trat die römische Armee in einer genau geregelten Schlachtordnung (Acies) an; in der Mitte befand sich die Media Acies (das Zentrum), zu beiden Seiten die Flügel (Cornua, Singular Cornu), wo auch die Reiterei stand. Vom Feldherrn wurde erwartet, dass er vorher eine zündende Ansprache hielt und sich auch persönlicher Gefahr aussetzte. Der Orientierung auf dem Schlachtfeld dienten Feldzeichen und akustische Signale (beides als Signa bezeichnet), die durch große Blasinstrumente gegeben wurden. Im Winter stellte man den Krieg in der Regel ein, die Soldaten bezogen dann das feste Winterlager. Dem siegreichen Feldherrn konnte vom Senat der Triumph zuerkannt werden - die höchste Ehre für einen Bürger im republikanischen Rom. Er zog dann auf einem zweirädrigen goldenen Wagen im purpurnen Mantel unter einem Lorbeerkranz in die Stadt ein, begleitet von seiner Armee (Soldaten auf dem Boden Italiens waren sonst streng verboten!), und es wurde die Kriegsbeute zur Schau gestellt. Auch die gefangenen Feinde führte man an den 9 Triumphwagen gekettet mit. Da der Triumph unter anderem an die Zahl der erschlagenen Feinde gebunden war, kam es immer wieder zu Massakern an den besiegten Bevölkerungen. In der römischen Armee waren ursprünglich alle erwachsenen männlichen Bürger wehrpflichtig; Wehrpflicht und Bürgerrechte hingen eng zusammen. Da die Kriege aber an immer ferneren Orten stattfanden und die Soldaten kaum noch nach Hausen kamen, wurde Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. eine Berufsarmee geschaffen. Diese bewährte sich gut, aber ihre Soldaten begannen sich mehr und mehr, statt der Res Publica, dem jeweiligen Feldherrn verpflichtet zu fühlen, der für sie sorgte und durchsetzen musste, dass sie nach Ablauf ihrer Dienstzeit als Veteranen ein Stück Ackerland zugewiesen bekamen. So traten gegen Ende der Republik eine Reihe von Imperatores auf, die die Armee als Werkzeug ihrer persönlichen Macht einsetzten: Marius, Sulla, Pompejus, am erfolgreichsten Cäsar. 6. DER ALLTAG Die Römer stehen früh auf, gewöhnlich mit dem Hahnenschrei, „sub cantum galli“. In einer Gesellschaft, in der Sklaven fast alle (schwere) Arbeit verrichten, wird der Tag der Freien nicht von beruflicher Tätigkeit gegliedert. Morgens begrüßen die Klienten den Patron, dann gehen Alle gemeinsam aufs Forum. Anstrengende Verpflichtungen erledigt man möglichst bis zur Mittagsstunde, dann wird es (im Sommer wenigstens) zu heiß. Den Nachmittag verbringt man gern in den Bädern. Nachdem man morgens und mittags nur einen kleinen Imbiss zu sich genommen hat, findet abends, etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang, die Hauptmahlzeit statt, die Cena. Essen heißt bei den Römern gesellig sein; nur Menschenfeinde essen allein. Man trifft sich im Speisezimmer, dem Triclinium, dem wichtigsten Raum des Hauses. Es heißt so, weil hier die Speise-Sofas stehen, die Klinen, und zwar immer drei um einen Tisch gruppiert. Es wird nämlich im Liegen gegessen, auf einen Ellenbogen gestützt. Bei größeren Gastmählern bekränzt der Gastgeber die Gäste und salbt sie mit Wohlgerüchen, auch lässt man sich gern vorlesen, vorspielen, vortanzen. Die Nahrung der alten Römer ist einfach: Getreide (Weizen und Dinkel vor allem) nimmt man nicht nur als Brot, sondern auch gern als Mus zu sich. Große Bedeutung haben Hülsenfrüchte: Erbsen, Bohnen, Kichererbsen, Linsen. Fleisch liefert bevorzugt das Schwein. Als Soße für die oft trockenen Gerichte verwendet man das „Garum“, eine Tunke aus fermentiertem Fisch; allgegenwärtig ist das Olivenöl. Später entfalten die Oberschichten einen ungeheuren Speiseluxus. Die raffinierten und teuren Gerichte verleihen dem Gastgeber Prestige, richten ihn aber auch nicht selten zugrunde. Man isst Dinge nicht nur weil sie gut schmecken, sondern auch weil sie exotisch und schwer zu beschaffen sind. Der berühmte Feinschmecker Lucullus lässt Nachtigallenzungen servieren; andere Rezepte beschreiben, wie man Siebenschläfer in Honig und Mohnkörnern zubereitet. Es werden ganze Eber serviert, und wenn man sie aufschneidet, fliegen lebende Drosseln heraus, die dann eingefangen und als nächster Gang aufgetischt werden. Allgemeines Getränk ist der Wein. Üblicherweise trinkt man ihn mit Wasser vermischt, doch gibt es für die Trunkenheit sogar einen eigenen Gott (Bacchus). Die klassische Kleidung des Römers besteht, neben einem einfachen Schurz als Unterkleidung, aus der Tunica, einem T-Shirt-artigen Hemd, das bis zu den Knien reicht und 10 unterschiedlich hoch geschürzt werden kann, und darüber der Toga. Dabei handelt es sich um eine einzige lange Stoffbahn, die nach bestimmtem Muster um den Körper gelegt wird und dabei Bäusche und Faltenwürfe bildet. Als Kleidungsstück ist sie eher unpraktisch, da sie sich nur schwer anziehen lässt und die Bewegungsfreiheit erheblich einengt; doch gilt sie als offizielles Kleid des römischen Staatsbürgers in Friedenszeiten im Gegensatz zu a) dem Soldaten, b) dem Barbaren. Nur der Barbar hat Hosen an! Die römische Matrona trägt die fußlange, faltenreiche Stola. In alter Zeit trägt man Bart, die klassische Zeit geht glatt rasiert. Die Kaiser des 2. Jahrhunderts n. Chr. verstehen sich als Philosophen, und da man den Philosophen am Bart erkennt, bringen sie diesen neu zur Geltung. Die christliche Spätantike schafft den Bart wieder ab. Die reichliche Freizeit nutzen die Römer gern zu Ball- und Würfelspielen. Große Bedeutung haben die öffentlichen Schauspiele: Theateraufführungen, Wagenrennen und besonders die Gladiatorenkämpfe. Bei ihnen wird auf Leben und Tod gefochten, und das Volk ist unzufrieden, wenn nicht genügend Blut vergossen wird. Außerordentlich tapfere Kämpfer können durch Kundgabe des Volks begnadigt werden. Ansonsten prüft man mit einem glühenden Eisenhaken, ob der unterlegene Gladiator schon tot ist; ist er es nicht, schleift man ihn in einen Nebenraum, wo er ohne Aufsehen gänzlich umgebracht wird. Neben den Schwertkämpfen gibt man in der Arena (eigentlich: „Sand“, mit dem sie bestreut war) auch Seeschlachten, Tierhatzen und besonders einfallsreiche und grausame Hinrichtungen. Unter den Festen des Jahres, die zahlreich sind und durch Spiele aller Art gefeiert werden, heben sich die Saturnalien in den letzten Dezembertagen heraus. Sie vereinigen Züge von Weihnachten und Karneval, denn einerseits macht man Geschenke, andererseits trägt man farbenfrohe Kleidung und spielt „verkehrte Welt“: Die Herren müssen den Sklaven gehorchen! Zur Beleuchtung verwendet man bevorzugt Öllampen; auch große Kronleuchter bestehen aus Dutzenden dieser einfachen Lichtquellen. Daneben gibt es Fackeln, aber nur wenige Kerzen. 7. ZEIT, GELD, MAßE Der römische Tag reicht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und ist unterteilt in 12 Stunden - woraus sich ergibt, dass die Stunden im Sommer bedeutend länger sind als im Winter. Da man vor allem Sonnenuhren verwendete, ergab sich daraus kein Problem. Die Nacht zerfiel in 4 Nachtwachen. Minuten- und Sekundeneinteilung war unbekannt. Das Jahr bestand aus 12 Monaten, denen die Römer ihre bis heute geltenden Namen gegeben haben. Jahresbeginn war ursprünglich der 1. März; so erklärt sich, dass der September als der siebte, der Oktober als der achte Monat usw. benannt sind und alle Unregelmäßigkeiten des Kalenders vom Februar, dem früher letzten Monat, ausgebadet werden müssen. Innerhalb eines Monats kannten die Römer drei feste Bezugspunkte: die Kalenden am 1. eines Monats, die Nonen am 5. bzw. 7. und die Iden am 13. bzw. 15. Man zählte die Tage, indem man angab, wie lange hin es noch bis zum nächsten dieser Termine war; den ersten und letzten Tag zählte man mit, so dass die Römer immer auf eine um 1 höhere Zahl kommen als wir. Der 13. März lag also 3 Tage vor den Iden des März (am 15.) Der 16. März galt bereits 11 als der 17. Tag vor den Kalenden des April. Erst in der Spätantike begann man, unter dem Einfluss des Hellenismus und später auch des Christentums, je sieben Tage als Woche zusammenzufassen; jeder von ihnen erhielt seinen Namen nach einem der sieben Planeten (Sonne und Mond zählen mit!). Für die Jahreszählung gab es zwei Systeme: Das Jahr wurde nach den jeweils amtierenden Konsuln benannt, z.B. „Tullio Antonio consulibus“, „(Das Jahr, als) Tullius (und) Antonius Konsuln (waren)“, d.h. 63 v. Chr. Da dies bei weit zurückreichenden Daten unpraktisch war, verwendete man später eine Zählung von „Gründung der Stadt an“, „ab urbe condita“, ein Ereignis, das man in das Jahr 753 v. Chr. verlegte. Die Zählungsweise „vor / nach Christi Geburt“ („ante / post Christum natum“) wurde erst im Frühmittelalter eingeführt. Der alte römische Kalender war ein Chaos, das sich nur einigermaßen beherrschen ließ, indem man freizügig Schalttage einschob (bis zu zwanzig auf einmal). Erst C. Iulius Caesar brachte aus Ägypten ein verbessertes System mit, das nach ihm der Julianische Kalender heißt: alle vier Jahre ein zusätzlicher Schalttag. Er ist im Wesentlichen bis heute in Kraft geblieben und wurde nur noch einmal im 16. Jahrhundert durch den Gregorianischen Kalender nachgebessert (benannt nach dem Papst, der die Reform durchführen ließ). Grundeinheit des römischen Geldes war der As, so benannt, weil er aus Bronze (aes) bestand. Zweieinhalb As ergaben einen Sesterz, die wichtigste Recheneinheit. Vier Sesterz ergaben einen Denar, eine Silbermünze. Die Kaiserzeit prägte auch Goldmünzen. Münzen waren nicht nur Zahlungsmittel, sondern hatten auch wichtige symbolische Funktion: auf der Vorderseite sah man ein Porträt des Kaisers, die Rückseite deutete oft politische Programme an. Als Längeneinheit galt, neben dem Fuß, vor allem der Passus, ca. 1,50 Meter. 1000 Passus waren eine Meile (aus lateinisch „mille“). „Tria milia passuum“ sind also 3 Meilen, ungefähr 4 ½ km. 8. DIE RELIGION Die Römer hängen, wie die anderen indoeuropäischen Völker auch, einer polytheistischen Religion an, das heißt, sie setzen eine Vielzahl von Göttern voraus, welche miteinander in verwandtschaftlicher Beziehung stehen. Die römischen Götter wurden später den entsprechenden griechischen gleichgesetzt, so dass alle wichtigen Gottheiten unter zwei verschiedenen Namen bekannt sind. Auch die Götter anderer Völker identifizierte man mit denjenigen römischen, denen sie am meisten zu gleichen schienen (Interpretatio Romana); z.B. sagt Cäsar über die Gallier, ihr höchster Gott sei Merkur. Jupiter (griechisch Zeus) ist Himmelsgott und Oberhaupt der Götterfamilie; er wacht über Verträge und schleudert den Blitz. Verheiratet ist er mit Juno (griechisch Hera), seiner Schwester, der Schützerin des Hauses und der Frauen. Sie haben miteinander zwei Kinder: Mars (griechisch Ares), der Kriegsgott, genießt als Stammvater der Stadt Rom besondere Verehrung; Vulcanus (griechisch Hephaistos) ist zuständig für Feuer und Schmiedekunst. Brüder des Jupiter sind der Meeresgott Neptun (griechisch Poseidon) und Pluto (griechisch Hades), der Herr des Totenreichs. Seinen Vater Saturn (griechisch Kronos) hat Jupiter einst entmachtet. Aus dessen abgeschnittenen Genitalien, die ins Meer geworfen wurden, entstand die Liebesgöttin Venus (griechisch Aphrodite). Ebenfalls irregulär erzeugt ist Minerva (griechisch Athene), Göttin der Handwerkskünste und der Weisheit sowie Schutzpatronin 12 Athens, die fertig gerüstet mit Helm und Schild aus dem Haupt Jupiters hervorsprang. Mit anderen Frauen bzw. Göttinnen hat Jupiter als Kinder das Zwillingspaar Apollo (griechisch Apollon), Gott der Weissagung und der Künste (gelegentlich auch der Sonne) und Diana (griechisch Artemis), Göttin der Jagd und des Mondes; ferner Merkur (griechisch Hermes), Götterbote und Beschützer der Kaufleute, Reisenden (und Diebe!); sowie Bacchus (griechisch Dionysos), den Gott des Weins und der Ekstase, dessen Gottesdienste man als „Orgien“ bezeichnet. Göttin des Getreides ist Ceres (griechisch Demeter). Unter den kleineren Göttern spielen eine Rolle: Vesta, die Göttin des Herdes, in deren Tempel das heilige Feuer, gehütet von den Vestalinnen, niemals erlöschen durfte; Janus, Gott des Anfangs und des Endes und infolgedessen mit einem zweiten Gesicht auf dem Hinterkopf dargestellt; Herkules, eigentlich nur ein Halbgott, der aber wegen seiner großen Körperkräfte sehr geschätzt wird. Die Römer kennen dazu eine erhebliche Anzahl eher allegorischer Gottheiten, z.B. Roma, die Göttin der Stadt, Virtus, die Göttin der Tugend, Victoria, die Göttin des Sieges usw. Außerdem hat jedes Hauswesen seine eigenen Gottheiten, die Laren und Penaten, die in einer kleinen Nische ihren Hausaltar besitzen. Der Genius ist der persönliche Schutzgeist des einzelnen Mannes (Frauen haben keinen!). Larven und Lemuren sind umgehende Tote, böse Schreckgespenster. Während die griechische Religion die Götter vor allem als übermenschliche, aber doch sehr individuelle Personen fasst, über die der Mythos unermüdlich seine Geschichten erzählt, haben die Römer zu ihren Göttern ein eher formales, ja juristisches Verhältnis. Im Mittelpunkt steht bei ihnen weder die Buntheit des Mythos noch die Tiefe persönlichen Glaubens, sondern der Kult (Religio), auf den jede Gottheit ihren jeweils genau umschriebenen Anspruch hat. Er besteht aus bestimmten Gebeten, Opfern, Feiern und Spielen. Der geringste Formfehler, der dabei vorfällt, macht die ganze Zeremonie unwirksam, so dass sie wiederholt werden muss. Religion ist keine Privatangelegenheit, sondern Sache des Staats; das römische Wort Pietas bezeichnet nicht persönliche Frömmigkeit, sondern das Pflichtgefühl gegenüber Staat und Eltern ebenso wie gegenüber den Göttern. Auch die Götter haben Verpflichtungen gegenüber den Menschen; im Verhältnis zu ihnen gilt der Grundsatz „Do, ut des“ - ich gebe, damit du gibst. Ausgeübt wird der Kult von den Priesterkollegien, die jeder Tempel besitzt; über sie wacht der Pontifex Maximus, der Oberpriester, ein sehr angesehenes Amt (Cäsar hatte es bis zu seinem Tod inne). Den Willen der Götter und die Zukunft erforschen die Haruspices (Singular: Haruspex), die aus Eingeweiden, dem Fressen der heiligen Hühner usw. lesen, und besonders die Auguren, die den Vogelflug deuten; lauten die von ihnen abgehaltenen Auspizien ungünstig, können sie jeden politischen Akt unterbinden und haben dadurch beträchtlichen Einfluss. „Glauben“ die Römer an diese Weissagungen? Selbst der aufgeklärte Cicero amtiert als Augur. Wenn zwei Auguren sich begegnen, heißt es, lächeln sie einander vielsagend an. Aber da diese Einrichtung durch den Mos Maiorum überkommen ist, die Sitte der Vorfahren, wird daran festgehalten; sie gilt als unverbrüchliche Norm. Neben die Staatsreligion treten in späterer Zeit eine Reihe weiterer, besonders Mysterienkulte, die aus dem Osten des Reichs stammen, z.B. die Kulte der Isis und des Mithras. Zu ihnen gehört auch das Christentum. Die Christen sind in den ersten drei Jahrhunderten eine kleine, aber stetig wachsende Gruppe, die sich wiederholt Verfolgungen ausgesetzt sieht. Im 4. Jahrhundert steigt es in den Rang einer Staatsreligion auf und bekämpft nunmehr seinerseits alle anderen Religionen sehr aggressiv und erfolgreich; bis zum Ende 5. Jahrhunderts ist das alte polytheistische Heidentum praktisch vernichtet. 13 9. DIE RÖMER UND IHRE NACHBARN Kulturell am folgenreichsten ist die Begegnung der Römer mit den Griechen. Sie bewohnen nicht nur ihr Stammland (das sie bis heute innehaben), sondern sitzen rings ums Mittelmeer „wie Frösche um einen Teich“ (Platon), vor allem an der kleinasiatischen Westküste, in Unteritalien und auf Sizilien. Außerdem hat sich im gesamten Nahen Osten, in Ägypten, Syrien, Palästina und dem Gebiet der heutigen Türkei (zeitweise bis Afghanistan und Indien) seit den Eroberungszügen Alexanders des Großen eine orientalisch-griechische Mischkultur herausgebildet, der Hellenismus. Seit dem 2. / 1. Jahrhundert v. Chr. sind die meisten dieser Gebiete römische Provinzen; doch wird Rom dadurch auch für die überlegene griechische Kultur geöffnet: „Der Besiegte hat den Sieger als Gefangenen davongeführt“ (Vergil). Rom steht den Griechen ambivalent gegenüber. Die alten Römer sind stolz darauf, sich nur für handfeste und praktische, „reale“ Dinge (von lateinisch „res“) zu interessieren: Landwirtschaft, Militär, Politik, Architektur und Ingenieurswesen, Recht, die praktische Beredsamkeit. Das gilt ihnen als Negotium, nützliche Tätigkeit. Die Griechen hingegen befassen sich gern auch mit schönen Künsten, Philosophie, Literatur - alles das sehen die Römer als Otium an, eine Beschäftigung in der Freizeit. Doch in die Geringschätzung für die spitzfindigen, unterwürfigen, unzuverlässigen „Graeculi“ mischt sich auch Hochachtung für deren kulturelle Leistungen. Selbst der ältere Cato, der Rom von griechischen Einflüssen freihalten und sogar Ärzten den Zutritt verbieten will - denn was können sie anderes wollen als die echten Römer unter die Erde zu bringen! -, lernt im hohen Alter noch Griechisch. Griechisch bleibt die Sprache der Gebildeten und der ganzen östlichen Reichshälfte. Die gesamte lateinische Literatur und Kunst entwickelt sich in Auseinandersetzung mit der griechischen: erst in der Nachahmung, dann in der Konkurrenz. So bildet sich im Lauf der Jahrhunderte eine griechisch-römische Zwillingskultur heraus. Sie versteht sich selbst als wahre Humanitas, als den gesamten Menschen umfassende Bildung; wer nicht dazugehört, ist ein Barbar, was ursprünglich lautmalend bedeutet: ein Mensch, der rauh und unverständlich, fast wie ein Tier spricht. In ältester Zeit steht Rom unter dem Einfluss der Etrusker, einem Volk in Mittelitalien (besonders in der nach ihnen benannten Toscana), das mit keinem anderen verwandt scheint. Die römischen Könige waren etrurischer Abstammung. Von den Etruskern übernehmen die Römer die Schrift und viele ihrer ältesten Sitten und Zeremonien. Die eigenständige etruskische Sprache und Kultur verschwindet langsam unter dem Einfluss Roms. Die Gallier (= Kelten) bilden zeitweise die bedeutendste Volksgruppe Europas. Von Ihrem Kerngebiet im heutigen Frankreich dringen sie vor nach Spanien, Süddeutschland, Oberitalien (das deswegen in der Antike „Gallien diesseits der Alpen“ heißt), in den Donauraum, auf die britischen Inseln und bis in die heutige Türkei. Im 4. Jahrhundert v.Chr. gelingt es ihnen sogar, Rom zu erobern. Doch geraten sie zunehmend unter den Druck einerseits der Germanen, andererseits des römischen Reichs. Das freie Gallien wird bis Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. von Cäsar unterworfen und nimmt allmählich die römische Sprache und Kultur an. In einem Prozess, der sich über zwei Jahrtausende erstreckt und bis heute nicht abgeschlossen ist, werden die Kelten an den äußersten Nordwestrand Europas gedrängt. Mit den Germanen treffen die Römer erstmals Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. zusammen, als die Kimbern und Teutonen bis nach Italien vorstoßen. Mit ihrer hohen 14 Gestalt, den blonden Haaren und blauen Augen und vor allem mit ihrem rasenden Geschrei, mit dem sie in die Schlacht stürmen, dem „Furor Teutonicus“, flößen sie den Römern Panik ein. Cäsar gelingt es im Krieg gegen den Sueben-König Ariovist, die Germanen aus Gallien zurückzudrängen und den Rhein als dauerhafte Reichsgrenze festzulegen. Die römischen Provinzen Ober- und Niedergermanien befinden sich beide links des Rheins; sie sind, da die Römer die fortdauernde Gefährlichkeit ihrer Nachbarn erkennen, die am stärksten militärisch gesicherten Regionen des Reichs. Der römische Versuch, das Problem ein für allemal zu lösen und die Grenze bis an die Elbe vorzuschieben, endet 9 n.Chr. mit der Katastrophe der Schlacht im Teutoburger Wald. In der römischen Haltung zu den Germanen mischt sich Verachtung für die stets sauf- und rauflustigen Barbaren und Furcht vor ihrer Schlagkraft mit Bewunderung für ihren Kampfesmut und die unverdorbene Einfachheit der Sitten; so hat der römische Historiker Tacitus sie in seiner „Germania“ dargestellt, die er zur Mahnung seiner ihm dekadent erscheinenden Zeitgenossen schrieb. Seit dem 2. Jahrhundert 400 durchbrechen die Germanen den Limes, die stark gesicherte Grenzbefestigung im Gebiet des heutigen Südwestdeutschland, und überfluten ab 400 in der Völkerwanderung das ganze Reichsgebiet. Vandalen, Ostgoten, Westgoten, Burgunder, am nachhaltigsten die Franken errichten auf (west-)römischem Boden ihre eigenen Reiche und leiten so den Übergang zum Mittelalter ein. 10. GESCHICHTE Der Raum, in dem die antike Geschichte sich bewegt, ist das Gebiet rings um das Mittelmeer; von dort strahlt die griechisch-römische Doppelkultur bis nach Nordeuropa (entferntester Punkt: England) und Zentralasien aus. Die geografischen Kenntnisse der Antike sind beträchtlich - man kennt Indien und hat von China wenigstens gehört -, aber die Informationen werden desto unzuverlässiger, je weiter man sich von den Mittelmeerküsten entfernt. Man gerät dann zusehends ins Reich der Fabel, wo die Menschen das Gesicht auf dem Bauch tragen und es gefährliche Tiere gibt, die ihren Schwanz wie einen Speer verschießen können (gemeint ist der Tiger!). Zwei große Staatengebilde kennt die Antike: Das Reich Alexanders des Großen dehnt sich von Makedonien und Griechenland weit in den asiatischen Osten und zerfällt fast sofort nach dem Tod seines Gründers. Das römische Reich dagegen zeichnet sich durch einen hohen Grad von Stabilität aus. Von der zentral gelegenen Hauptstadt Rom aus expandiert es wie die Wellen eines Steins, den man ins Wasser wirft, bis es alle Küsten des Mittelmeers erreicht hat. Nach Süden zu stößt es an Wüsten, nach Westen an das Weltmeer, im Norden bilden Rhein und Donau lange und gut zu sichernde Grenzen gegen die barbarischen Urwälder und Steppen; der einzige andere Staat im eigentlichen Sinn, mit dem es in Kontakt steht, ist das Reich der Parther im Osten. In einmaliger Weise umfasst es so gut wie die ganze bekannte zivilisierte Welt: ein wahrhaftes „Reich der Mitte“. Griechische Geschichte Nach seiner heroischen Frühzeit (Krieg um Troja, erzählt in der Ilias) und langen dunklen Zeitaltern beginnt die griechische Blütezeit im 6. Jahrhundert v. Chr., besonders nachdem der Versuch der Perser, Griechenland zu erobern, in den Schlachten von Marathon und Salamis (490/80 v. Chr.) zurückgeschlagen worden ist. Zentrum der klassischen griechischen Kultur 15 ist Athen, in dem Künste, Philosophie, Literatur und Theater im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. ihren Höhepunkt erleben. Athen ist eine Polis, ein Stadtstaat von begrenzter Ausdehnung, ständig in Konflikte mit seinen Nachbarn verwickelt. Sein wichtigster Gegner dabei ist Sparta, ein den Künsten abholder, aristokratischer Soldatenstaat. In einem dreißigjährigen Krieg (Peloponnesischer Krieg) wird Athen von Sparta schließlich geschlagen. Trotz aller politischen Zerstrittenheit haben die Griechen jedoch ein starkes Gefühl kultureller Gemeinschaft. Deren Zentren bilden Delphi, wo sich das dem Apoll heilige wichtigste Orakel befindet, und Olympia, wo alle vier Jahre zu Ehren des Zeus die Olympischen Spiele veranstaltet werden. Im 4. Jahrhundert v.Chr. geht von Makedonien, einem Staat am nördlichen Rand Griechenlands, die gewaltsame politische Einigung aus. Der makedonische König Alexander erobert in wenigen Jahren das bei weitem wichtigste und größte Reich, das es bis dahin gegeben hat, das persische (333 Schlacht von Issos). Das Zeitalter des Hellenismus beginnt. Alexanders Nachfolger gründen eine Reihe kleinerer griechisch geprägter Staaten in Ägypten, Syrien und Kleinasien. Hier herrschen, anders als in den Demokratien der klassischen Stadtstaaten, absolute Monarchen. Sie alle geraten im 2./1. Jahrhundert v. Chr. unter die Herrschaft der Römer. Frühzeit Roms Die Anfänge Roms, der Überlieferung nach 753 v. Chr. von Romulus gegründet, verlieren sich in der Legende. Romulus war der Sohn des Gottes Mars und wurde zusammen mit seinem Zwillingsbruder Remus von einer Wölfin gesäugt. Er war der erste einer Reihe von sieben Königen, die man schließlich um 500 v.Chr. vertrieb. Es folgte eine Adelsrepublik, die in langen inneren Ständekämpfen auch demokratische Elemente in sich aufnahm. Bis ins 4. Jahrhundert v.Chr. war Rom ein wenig bedeutender Ort, der nur die unmittelbare Umgebung beherrschte, und die Römer selbst nur ein kleines italisches Volk neben zahlreichen anderen. Doch gilt gerade diese Zeit den späteren Römern als die eigentlich beste: Da herrschten noch Schlichtheit, Selbstlosigkeit, Tapferkeit! Dann beginnt in langen Kriegen gegen die Nachbarvölker der allmähliche machtpolitische Aufstieg - mit ihm setzt jedoch auch, nach Verständnis vieler Römer, der moralische Niedergang ein. Zu Anfang des 3. Jahrhunderts v.Chr. war der größte Teil der italienischen Halbinsel römisch. Der Kampf gegen Karthago Den entscheidenden Sprung zur Großmacht vollzieht Rom in der Auseinandersetzung mit Karthago. Karthago lag in Nordafrika und war, ähnlich wie Rom selbst, eine aristokratische Stadtrepublik; als Seemacht beherrschte sie das westliche Mittelmeer. In drei Punischen Kriegen (Punier = Karthager, die von den Phöniziern herstammten) unterlag es schließlich gegen Rom. Der erste Krieg drehte sich um den Besitz der großen Mittelmeerinsel Sizilien; sie wurde Roms erste Provinz. Im Zweiten Punischen Krieg trat Rom in Gestalt des karthagischen Heerführers Hannibal ein überaus gefährlicher Feind entgegen. Er trug den Krieg auf dem Landweg nach Italien, bis vor die Tore Roms (Schreckensruf „Hannibal ante portas!“) und fügte den Römern mehrere Niederlagen zu, am schwersten in der Schlacht von Cannae (216 v. Chr.). Dennoch verloren die Karthager den Krieg doch noch, als der ältere Scipio ein Heer nach Afrika führte, Hannibal zur Heimkehr zwang und ihn in der Schlacht von Zama (202 v.Chr.) schlug. 16 Rom erzwang einen äußerst harten Friedensvertrag, Hannibal musste fliehen; dennoch blieb Karthago weiterhin die bedeutendste Handelsmacht der Region. Dies erregte die Missgunst der Römer, besonders des älteren Cato, der jede Senatsrede mit dem Satz geschlossen haben soll: „Im übrigen beantrage ich, Karthago zu zerstören!“ („Ceterum censeo Carthaginem esse delendam“). Schließlich wurde die Stadt im Dritten Punischen Krieg, der eigentlich nur eine lange Belagerung war, völlig zerstört und die Trümmer auf Geheiß des Senats mit Salz bestreut, damit dort nie wieder etwas wachsen sollte. Im selben Jahr 146 v. Chr. wurde auch Korinth, wichtige Handelsstadt im östlichen Mittelmeer, dem Erdboden gleichgemacht. Von nun war Rom unangefochtene Vormacht des ganzen Mittelmeerraums. Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. waren Afrika (= das Hinterland Karthagos), Griechenland, Makedonien sowie Teile Spaniens und Galliens römische Provinzen geworden; das Königreich Pergamon (in der heutigen West-Türkei) fiel Rom durch Erbschaft zu und bildete die Provinz Asia. Die späte Republik Die großen äußeren Erfolge führten jedoch zu einer schweren inneren Krise. Die Oberschichten bereicherten sich über alle Maßen auf Kosten der ausgebeuteten Provinzen; die alte bäuerliche Mittelschicht hingegen, zu fortwährendem Kriegsdienst gezwungen und durch die neuen, mit Sklaven bewirtschafteten Riesenlatifundien von ihren Höfen verdrängt, sank zum land- und besitzlosen Proletariat herab. Die Brüder Gaius und Tiberius Gracchus, die sich zu Volkstribunen wählen ließen, versuchten durch ein Ackergesetz eine Landreform herbeizuführen, durch die verarmte Bürger auf dem Boden der Großgrundbesitzer angesiedelt werden sollten. An deren massivem Widerstand scheiterte das Vorhaben unter bürgerkriegsähnlichen Umständen (133 / 121 v. Chr.) Seit ca. 100 v. Chr. war die Republik erschüttert. Das staatliche Leben wurde ganz beherrscht vom Gegensatz zwischen der Senatspartei, den Optimaten, und der Volkspartei, den Popularen. Beide Seiten brachten Anführer hervor, die sich zumeist auf das inzwischen eingeführte Berufsheer stützten und sich bedenkenlos über die alten Verfassungseinrichtungen hinwegsetzten. In einer ersten Serie von Bürgerkriegen in den 80er-Jahren v.Chr. traten der Popular Marius und der Optimat Sulla einander gegenüber; die jeweils siegreiche Seite richtete furchtbare Massaker an. Eine verhängnisvolle Dynamik entwickelte das System der Proskriptionen, der Ächtung politischer Gegner: Wer sie tötete, durfte sich die Hälfte ihres Vermögens aneignen. Sulla siegte und ließ sich zum Diktator auf Lebenszeit erheben, starb jedoch bald darauf (78 v. Chr.). Es folgten der Bundesgenossenkrieg, durch den die „Socii“ der Römer sich Gleichberechtigung erkämpften, und der Sklavenaufstand des Spartakus. Die Verschwörung des Popularen Catilina (63 v. Chr.; s. Kapitel „Cicero“) blieb eine Episode; kurz darauf fanden die drei maßgeblichen Männer Cäsar, Pompejus und Crassus sich zum Ersten Triumvirat zusammen, einem Geheimabkommen, durch das sie ihren Einfluss im Staat sicherten. Crassus war der Geldgeber; Pompejus der erfolgreichste Feldherr, der riesige Gebiete im Osten erobert und die Seeräuber ausgemerzt hatte. Der auf lange Sicht bedeutendste von ihnen war C. Iulius Caesar (geb. 100 v. Chr.). Wie sein Onkel Marius Mitglied der Volkspartei, ließ er sich für das Jahr 59. v. Chr. zum Konsul wählen und im Jahr darauf das Imperium über Oberitalien und Südfrankreich geben. Die dort stationierten Legionen benutzte er, um in nur sieben Jahren das ganze restliche Gallien bis zum Rhein zu erobern. Als er im Jahr 49 v. Chr. das Kommando abgeben soll und ihm der Senat nicht erlauben will, sich ein zweites Mal um das Konsulat zu bewerben, überschreitet er mit den Soldaten, die blind ihrem Feldherrn gehorchen, am Rubikon die Grenze zum demilitarisierten Italien und begeht damit den Staatsstreich. („Alea iacta est“ 17 „Die Würfel sind gefallen!“) Die Armee des Senats, die von seinem früheren Verbündeten Pompejus geführt wird, schlägt er bei Pharsalos (Griechenland), Pompejus selbst flieht nach Ägypten und wird dort ermordet. Cäsar, der ihm nachsetzt, lässt sich auf eine berühmte Liebesgeschichte mit der ägyptischen Königin Cleopatra ein. Der jüngere Cato, Kommandeur der letzten republikanischen Armee, begeht Selbstmord. Cäsar nimmt, wie Sulla, den Titel eines Diktators auf Lebenszeit an, wird aber schon nach zwei Jahren, an den Iden (15.) des März 44 v. Chr. von republikanischen Senatoren getötet; an ihrer Spitze stehen Brutus und Cassius. Nach Cäsars Tod tritt allgemeines Chaos ein; es stehen gegeneinander die Anhänger der Republik, angeführt von Cicero; Cäsars wichtigster Gefolgsmann Marcus Antonius; und Cäsars erst 18jähriger Großneffe Octavianus, den Cäsar testamentarisch adoptiert hatte. Als Marc Anton und Octavian (unter Einschluss des unbedeutenden Lepidus) 43 v. Chr. das Zweite Triumvirat bilden, ist die Republik am Ende; zu den Opfern dieses Jahres zählt auch Cicero. Octavian und Marc Anton entzweien sich jedoch schon bald, und wieder gibt es Bürgerkrieg. Als Sieger geht daraus, nach der Schlacht von Actium (31 v. Chr.), Octavian hervor. Das Kaiserreich Octavian geht bei der Konsolidierung seiner Macht behutsam vor; nur langsam gewinnt die neue Monarchie, die er begründet, Gestalt. Als Herrscher nimmt er den Ehrennamen Augustus an (= der Erhabene). Dem von einem Jahrhundert der Bürgerkriege erschöpften Rom bringt er Frieden; die Römer akzeptieren seine Herrschaft, obwohl sie den Verlust der alten „Libertas“, der republikanischen Freiheit, bedeutet. Augustus regiert 45 Jahre lang und begründet die julisch-claudische Dynastie. Zu ihr gehören als Kaiser sein Adoptivsohn Tiberius, der wegen seines brutalen Zynismus berüchtigte Caligula und Claudius, den seine Frau vergiftet, um ihrem Sohn Nero den Weg auf den Thron zu ebnen. Nach Neros Ermordung (68 n. Chr.) folgt wiederum ein Bürgerkrieg, der mit dem Sieg der flavischen Dynastie unter Kaiser Vespasian endet. Seit dem Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. regieren etwa hundert Jahre lang die Adoptivkaiser, die deswegen so heißen, weil der jeweilige Herrscher, statt seines leiblichen Sohns, den seiner Meinung nach fähigsten Mann als Nachfolger adoptiert. Unter den Adoptivkaisern, zu denen Trajan, Hadrian, Antoninus Pius und Marc Aurel gehören, erreicht das römische Reich seine maximale Ausdehnung und höchste Blüte. Im äußerst unruhigen 3. Jahrhundert wird das Reich von rasch wechselnden Soldatenkaisern regiert; sie werden von den Truppen ausgerufen und meist bald ermordet. Erst am Ende des Jahrhunderts kommt es unter Diokletian noch einmal zu einer Stabilisierung; Diokletian teilt das Reich in vier Teilstaaten, jeder mit eigener Hauptstadt (z.B. Trier) und eigenem Herrscher: Anders sind die gefährdeten Grenzen nicht mehr zu halten. Die künftige Spaltung in West- und Ostrom kündigt sich an. Kaiser Konstantin der Große macht 313 n. Chr. das Christentum (das unter Diokletian noch einmal schwer verfolgt worden war) faktisch zur Staatsreligion. 395 n. Chr. wird die Trennung des Reiches permanent: ein Kaiser residiert im lateinischen Westen, der andere im griechischen Osten, mit der neuen Hauptstadt Konstantinopel, die Konstantin der Große gegründet hatte und die später Byzanz heißt. Das Kaiserreich des Westens geht 476 n. Chr. in den Wirren der Völkerwanderungszeit zugrunde; germanische Nachfolgestaaten treten an seine Stelle. Das Datum dient üblicherweise dazu, das Ende der Antike und den Beginn des Mittelalters zu markieren. Das oströmisch-byzantinische Reich dagegen hat eine noch fast tausendjährige 18 Geschichte vor sich; erst 1453 wird Byzanz von den Türken erobert, die es in Istanbul umbenennen. Doch auch im Westen dauert die Reichsidee weiter. Karl der Große lässt sich zum Kaiser krönen, nach ihm im 10. Jahrhundert Otto der Große. Mehr als achthundert Jahre existiert das Heilige Römische Reich deutscher Nation, bis es sich in der napoleonischen Zeit auflöst. Der russische Zar seinerseits fühlt sich als der Fortsetzer von Byzanz, Moskau wird das „Dritte Rom“. 11. CICERO Marcus Tullius Cicero wird 106 v. Chr. in der Landstadt (Municipium) Arpinum geboren; er gehört zu einer Familie des Ritterstandes. Zusammen mit seinem Bruder Quintus erhält er eine Ausbildung in Jura, Rhetorik und Philosophie, zunächst in Rom, später auf Reisen in Griechenland und Kleinasien. Seinen ersten großen Erfolg als Anwalt erzielt er im Jahr 70 v. Chr., als er Verres anklagt. Verres war Verwalter (Prätor) der Provinz Sizilien gewesen und hatte sie rücksichtslos ausgeplündert. Da die Sizilier, die ja bloße Provinzbewohner waren, nicht selbst Klage erheben konnten, wandten sie sich an Cicero, den sie kannten, weil er einige Jahre zuvor dort als Quästor amtiert und sich durch seine selbstlose Verwaltung Sympathien erworben hatte. Die Beweisführung Ciceros ist so schlagend, dass Verres noch vor Prozessende flieht und Cicero die bereits verfassten Reden gar nicht mehr halten kann. Cicero gilt von nun an als bedeutendster Redner Roms. Wenige Jahre später empfiehlt er in der Rede Über den Oberbefehl des Gnäus Pompejus (De Cn. Pompei Imperio) diesen bewährten Feldherrn erfolgreich als Kommandanten im Krieg gegen König Mithridates von Pontos, der die römische Herrschaft in Kleinasien seit Jahrzehnten bedroht. Im Jahr 63 v. Chr. ist Cicero, der als Außenseiter (homo novus) erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden hatte, am Ziel seiner Wünsche: Er hat die höchste Würde im römischen Staat erlangt, das Konsulat, und zwar als Kandidat der Optimaten. Gerade in dieses Jahr fällt die Verschwörung des Catilina: Catilina, der dem radikalen Flügel der Popularen angehörte, hatte versucht, die Macht an sich zu reißen und den Konsul Cicero nachts daheim ermorden zu lassen. Cicero, der gewarnt worden war, entgeht dem Anschlag und hält am nächsten Morgen im Senat eine flammende Rede gegen Catilina, der daraufhin aus Rom flieht. Die wichtigsten Anhänger Catilinas werden nunmehr verhaftet und im Senat zum Tode verurteilt; man vollstreckt das Urteil sofort. Catilina, der sich zu seinen Truppen in Etrurien geflüchtet hatte, fällt kurz darauf im Kampf. Cicero, der für seine Verdienste den Titel eines „Vaters des Vaterlandes“ verliehen bekommt („Pater Patriae“), hält den Konflikt mit Catilina für den Höhepunkt seines Lebens: Ohne Waffen, als Zivilist (togatus) hat er Rom vor dem Bürgerkrieg gerettet! Als jedoch die Volkspartei und besonders Ciceros alter Feind Clodius wieder die Oberhand gewinnen, werden ihm Formfehler beim Todesurteil gegen die Catilinarier nachgewiesen, und er muss ins Exil gehen (58/57 v. Chr.), ein Urteil, das ihn sehr trifft, obwohl sein Auslandsaufenthalt nur ein Jahr währt und er es in Thessaloniki, der Hauptstadt Makedoniens, recht bequem hat. Seine Rückkehr, unter wiederum veränderten Machtverhältnissen, wird zum Triumphzug. Die Ereignisse der folgenden Jahre, in denen er keinen Einfluss auf die Politik nehmen kann, zwingen ihn wiederholt zur Muße. Verfasst er in seiner aktiven Zeit vor allem Reden, 19 die er vor Gericht, vor dem Senat und vor der Volksversammlung hält, so schreibt er in den Zeiten des erzwungenen Privatisierens seine großen theoretischen Werke. (S. hierzu die Kapitel „Philosophie“ und „Redekunst“.) Im Bürgerkrieg nach Cäsars Staatsstreich nimmt er Partei für die Republik; als diese unterliegt, muss er (zähneknirschend) um die Gunst des Siegers Cäsar buhlen. Man hat ihm deswegen den Vorwurf der Heuchelei gemacht; mit welchem Recht, bleibt umstritten Als Cäsar ermordet wird, sieht Cicero die große Chance zur Wiederherstellung der Republik gekommen, an die er, trotz aller gegenteiligen Indizien, sein Leben lang glaubt. Den Hauptfeind erblickt er in Cäsars Stellvertreter Marc Anton, der seinen früheren Chef ganz offensichtlich beerben will. Gegen ihn hält er die glühend unversöhnlichen Philippika, Zornesreden, wie sie dreihundert Jahre zuvor der griechische Redner Demosthenes gegen den makedonischen König Philipp (Vater Alexanders des Großen) gehalten hatte. Cicero übersieht, dass Cäsars Adoptivsohn Octavian sich insgeheim mit Marc Anton verständigt hat. Die beiden einigen sich darauf, Cicero auszuschalten. Cicero, der zu spät aus Italien fliehen will, wird unterwegs von den Häschern Marc Antons aufgegriffen und umgebracht. Sein Kopf und seine Hände, abgehackt, werden auf der Rednertribüne Roms zur Schau gestellt: zur Warnung für alle hartgesottenen Republikaner, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen wollen (43 v. Chr.). Neben seinen Reden und seinen Büchern sind von Cicero sehr viele Briefe erhalten. Auf diese Weise ist von Ciceros Privatleben von Tag zu Tag mehr bekannt als von jedem anderen Menschen bis ins 18. Jahrhundert. Wichtigster Empfänger ist sein Freund Atticus, der Ciceros Werke nach dessen Tod herausbringt. Ein besonders zärtliches Verhältnis besteht zu seiner (früh verstorbenen) Tochter Tullia. Cicero gilt als der bedeutendste Redner, den Rom je hervorgebracht hat. Seine rhetorische Prosa wird schulbildend für die ganze Antike und solang das Lateinische als lebendige Sprache fortdauert. Er versucht Latein zu einer Sprache zu machen, in der sich auch philosophische und andere eher abstrakte Themen darstellen lassen, und hebt es damit auf eine (annähernd) gleiche Stufe mit dem Griechischen. Wie kein anderer Autor wirkt er auf die Humanisten des 15. und 16. Jahrhunderts ein, die an der Beschäftigung mit seinen Werken einen neuen klassischen Stil ausbilden. Die Bewertung in jüngerer Zeit schwankt zwischen der Geringschätzung des wortreichen und häufig sentimentalen Opportunisten - und der Bewunderung für den ungemein vielfältig gebildeten und aktiven Staatsmann, Redner, Philosophen an einem der interessantesten Wendepunkte der Geschichte, der zu guter Letzt doch bereit war, sich für seine Überzeugungen in Gefahr zu begeben und zu sterben. 12. DIE PHILOSOPHIE Die Philosophie (griechisch: Liebe zur Weisheit) entsteht im Griechenland des 6. Jahrhunderts v. Chr. Man gibt sich nicht mehr mit den Auskünften des Mythos zufrieden, sondern sucht neue Antworten nach dem Ursprung und Wesen der Welt. Geht die Welt aus dem Feuer hervor, oder aus dem Wasser? Was sind ihre kleinsten Teile? Pythagoras erkennt, welche große Rolle in der Natur wie in der Musik Zahlenverhältnisse spielen, und sucht daraus eine Lehre der Weltharmonie zu begründen. Zur bedeutungsvollsten Gestalt der antiken Philosophie wird Sokrates. Dieser Athener des 5. Jahrhunderts v. Chr. ist der Sohn eines Steinmetzen und einer Hebamme; er entspricht nicht 20 gerade dem griechischen Schönheitsideal und spottet selbst über seinen dicken Bauch, die dünnen Beine und das ungeschlachte Gesicht. Die Berufung zur Philosophie erfährt er spät: Als seine Mitbürger eine Anfrage an das Orakel von Delphi richten, wer der Weiseste unter ihnen sei, erhalten sie zur Antwort: Sokrates. Das verblüfft ihn - denn was wüsste er, das die anderen nicht wissen? Schließlich kommt er darauf: Während die anderen meinen, sie hätten das Richtige schon gefunden, weiß er immerhin, dass er nichts weiß! Es kommt also darauf an, hinter dieser (falschen) Meinung die Wahrheit zum Vorschein zu bringen. Das wäre ein hoffnungsloses Unterfangen, wenn wir nicht aus unserer Vor-Existenz in einer höheren Welt eine Erinnerung bewahrt hätten. Wie sich diese höhere Welt zu unserer irdischen verhält, das erläutert er in dem berühmten Höhlengleichnis: Wir befinden uns in der Lage von Bewohnern einer Höhle, vor deren Eingang ein großes Feuer brennt. Gegenstände werden draußen emporgehalten - Krüge, Waffen, Geräte -, von denen wir aber nur den Schatten auf der Wand zu sehen bekommen. Dennoch wissen wir, um welche Dinge es sich handelt, weil wir sie an ihrem bloßen Umriss wiedererkennen. So haben wir also auch die Möglichkeit, in dieser Welt des Scheins zur Wahrheit vorzudringen. Es muss die Fähigkeit zum Wiedererkennen mobilisiert werden. Aber wie? Da grundsätzlich Alle sich in derselben Lage befinden, am besten durch das Gespräch. Sokrates entwickelt seine Lehre methodisch in der Dialektik, ein Wort, das vom Dialog abgeleitet ist. Jeder trägt die Wahrheit in sich wie eine Schwangere ihr Kind, und die Hebamme produziert dieses Kind nicht, sie hilft ihm nur ans Licht; diese Maieutik, die Hebammenkunst, sagt Sokrates, habe er von seiner Mutter gelernt. Sokrates lehrt daher nicht, sondern er befragt seine Mitbürger, in denen erst einmal ein Gefühl für das Problem geweckt werden muss. Was z.B. ist Tapferkeit? Der alte Offizier, den er fragt, antwortet ohne Zögern: Tapfer ist, wer immer fest draufhaut und vor dem Feind nicht zurückweicht! Aber, wendet Sokrates ein, gibt es nicht auch so etwas wie den taktischen Rückzug? Gewiss kann sich auch für einen echten Helden diese Notwendigkeit ergeben, und standhalten wäre dann nicht Tapferkeit, sondern Selbstmord. Das muss der Offizier einräumen; und so kommt man, ganz langsam, der Sache näher. Von den – nach Kant – drei Fragen der Philosophie: Was kann ich erkennen? (Erkenntnislehre), Was soll ich tun? (Ethik), Was darf ich hoffen (Metaphysik) interessiert Sokrates vor allem die zweite, die ethische. Damit gibt er der ganzen weiteren antiken Philosophie die Hauptrichtung vor, die danach in ihre vorsokratische und ihre nachsokratische Phase unterteilt wird. Von sich selbst sagt er, er trage in sich eine innere Stimme (das Daimonion), das ihm nie mitteile, was er tun solle, aber unfehlbar, was er nicht tun solle. Dabei bleibt er auch, als ihm im Jahr 399 v. Chr. der Prozess gemacht wird. Seine Art, fragend alle Gewissheiten zu erschüttern, gefällt Vielen nicht; er wird angeklagt, die Jugend zu verderben und neue Götter einführen zu wollen. Leicht hätte er durch Nachgiebigkeit einen Freispruch erreichen können, hält aber stattdessen eine selbstbewusste Verteidigungsrede (Apologie) und wird zum Tod verurteilt. Als er schon den Schierlingsbecher, der das langsam wirkende Gift enthält, getrunken hat, tröstet er noch, selbst heiter, seine weinenden Jünger. Der ganzen Antike gilt dies als vorbildhafter Abschluss eines bedeutenden Lebens: Denn der Philosoph soll sich nicht nur als theoretischer Lehrer bewähren, sondern vor allem als Weiser (Sapiens), d.h. seine Lehren glaubhaft selbst im Leben und besonders angesichts des Todes praktizieren. Unter den Jüngern der weit wichtigste ist Platon. Da Sokrates keine einzige Zeile hinterlassen hat und umgekehrt das gesamte Werk Platons aus Dialogen besteht, in denen er als Hauptsprecher Sokrates auftreten lässt, ist die Grenze zwischen den beiden Philosophen schwer zu ziehen; insgesamt zeigt sich Platon mehr am systematischen Theoriegebäude interessiert als sein Lehrer. Platon begründet, als die wichtigste philosophische Schule, die 21 Akademie. Platons Schüler wiederum ist Aristoteles, der seine eigene Schule begründet, die der Peripatetiker, nach der Wandelhalle (Peripatos), wo sie untergebracht ist. Die Schule der Kyniker (griechisch kyon = der Hund) predigt auf volkstümliche Art die Bedürfnislosigkeit, die ihre Vertreter auf eine malerisch verwahrloste Weise praktisch leben, allen voran Diogenes, der statt in einem Haus in einer leeren Tonne wohnt. Für die Philosophie der Römer jedoch werden vor allem zwei spätere Philosophenschulen der hellenistischen Zeit bedeutsam. Die Epikureer und die Stoiker geben entgegengesetzte Antwort auf die zentrale Frage: Was ist das höchste Gut (summum bonum)? Epikur sagt, dies sei die Lust (Voluptas). Man hat ihn darum oft für einen gewissenlosen Genussmenschen gehalten. Dabei geht Epikur weit vorsichtiger zu Werke. Um das höchste Maß an Lust zu erzielen, sei es vor allem nötig, den Schmerz zu vermeiden. Man müsse sich mit dem zufriedengeben, was der Körper unbedingt braucht. Wichtig ist es, sich Klarheit über die eigenen Bedürfnisse zu verschaffen: welche sowohl natürlich als auch notwendig sind (z.B. Essen und Trinken), welche zwar natürlich, aber nicht notwendig (z.B. die Sexualität) und welche weder natürlich noch notwendig (z.B. die unersättliche Habgier, die nie gestillt wird und wahre Lust darum ausschließt). Dies versteht der Epikureismus unter „secundum naturam vivere“ („gemäß der Natur leben“). Götter, meint Epikur, gibt es vielleicht; aber da sie sich nicht um uns sorgen, sollten wir uns auch nicht um sie bekümmern. Die Lehre Epikurs führt zu einer eher zurückgezogenen, privaten Lebensweise, die die Freundschaft in den Mittelpunkt rückt, und musste den Römern, die die öffentliche Verpflichtung eines Jeden betonten, daher Unbehagen bereiten. Doch gibt es zwei bedeutende Autoren, die sich offen zu ihr bekennen: den Lyriker Horaz (s. „Literatur“) und Lukrez. Lukrez, ein Zeitgenosse Ciceros, verfasste ein langes Lehrgedicht, „Über das Wesen der Dinge“ („De Rerum Natura“), die ausführlichste Darstellung des Epikureimus. Für die Stoa (auch sie nach dem hallenartigen Gebäude benannt, wo sie ursprünglich ihren Sitz hatte), ist das höchste Gut hingegen die Tugend (Virtus). Nur sie, und nicht die Lust, könne den Menschen glücklich machen; wenn er sich nur bewusst sei, seiner Pflicht zu genügen, dann sei es für ihn völlig ausgeschlossen, unglücklich zu werden. Allein auf diesen inneren Wert komme es an, alles Äußere sei bedeutungslos. Dies verleiht dem Weisen, wie die Stoiker ihn verstehen, eine unerschütterliche, eben die stoische Ruhe in allen Wechselfällen des Lebens. „Wenn die Welt zusammenstürzt“, so charakterisiert ihn Horaz, „werden ihre Trümmer einen Unerschrockenen treffen.“ Die stoische Pflichtethik lässt sich leichter mit dem römischen „Mos Maiorum“ vereinigen und zieht darum z.B. auch den letzten Verfechter der Republik an, den jüngeren Cato. Ihr wichtigster Vertreter ist Seneca, in der Zeit Neros. Er versteht die stoische Philosophie vor allem als Mittel zum Trost in einer Welt, in der es niemals Gewissheit gibt und jederzeit das Unglück hereinbrechen kann. Dazu passt es, dass er sein Hauptwerk in der Form von Briefen anlegt, den Epistulae Morales ad Lucilium (Moralische Briefe an Lucilius). Lucilius ist ein junger Mann, der bei seinem älteren Freund Rat zur Gestaltung seines Lebens sucht, und Seneca belehrt ihn über das Alter, das Vergnügen, den Tod usw. Auch Seneca hat, wie Sokrates, Gelegenheit, die Tragfähigkeit seiner Lehre durch sein Sterben zu beweisen: Er wird der Verschwörung gegen den Kaiser Nero bezichtigt, dessen Premierminister er lange gewesen war; und er besteht die entscheidende Probe durch die Gelassenheit des befohlenen Selbstmords. Auch der Kaiser Marc Aurel im späteren 2. Jahrhundert n. Chr. bedient sich des stoischen Trosts. Cicero ist nicht der erste Römer, der Philosophie treibt; doch als erster bemüht er sich, dies auf angemessene Weise in lateinischer (statt in griechischer) Sprache zu tun. Er versteht seine Aufgabe nicht in der Parteinahme für eine bestimmte Schule, noch auch will er eine neue 22 begründen; er liest Alles und greift sich heraus, was ihm verwendbar scheint, d.h. er verfährt eklektisch. Dabei kommt der Stoa allerdings der größte Einfluss zu. In Laelius De Amicitia spricht er von den Aspekten der Freundschaft (für ihn, wie für alle antiken Philosophen, die wichtigste aller freiwillig eingegangenen Bindungen, weit wichtiger als die Liebe), in Cato De Senectute über das Alter, das er nicht nur aus seiner Gebrechlichkeit und Todesnähe verstehen will, sondern als erfüllte Lebensphase eigenen Rechts. In De Finibus Bonorum et Malorum (Von den Grenzen des Guten und des Bösen) nimmt er die alte Frage vom höchsten Gut (und Übel) auf, in De Officiis (Von den Pflichten) behandelt er die Lehre von den Pflichten und was als sittlich gut (honestum) und was als sittlich schlecht (turpe) zu gelten hat. Von vielen ethischen Fragen sprechen die Tusculanae Disputationes (Tuskulanische Diskussionen; in Tusculum bei Rom hat Cicero ein Landhaus). Dazu gehören auch die Widersprüche, die sich aus der sokratischen Annahme ergeben, wer weise sei, müsse immer auch gut sein und darum mit Notwendigkeit auch glücklich. Gibt es denn nicht viele Beispiele böser Menschen, die glücklich gewesen sind, z.B. die zahlreichen Tyrannen in der Geschichte? Nein, sagt Cicero, wenn man sich diese Tyrannen, z.B. den berühmten Dionysios von Syrakus, einmal genauer anschaue, werde man immer finden, dass sie zwar vielleicht reich und mächtig waren, aber zugleich doch auch einsam, misstrauisch und voller Angst vor Anschlägen. Hier wie überall in seinen theoretischen Werken verwendet Cicero die Form des Dialogs; als Sprecher lässt er berühmte Römer der Vergangenheit auftreten, aber auch sich selbst und seine Vertrauten. De Re Publica ist Ciceros großes Werk über den Staat. Anders als die Politeia des Platon, zu der es den Gegenentwurf bedeutet, malt Cicero keinen utopischen Idealstaat aus, sondern betrachtet konkret den römischen als Beispiel einer gelungenen Synthese aus demokratischen, monarchischen und aristokratischen Elementen. Damit wiederum wird sich später, als Rom in der Völkerwanderung des 5. Jahrhunderts ins Wanken gerät, Augustinus auseinandersetzen; sein De Civitate Dei (Über den Gottesstaat) will den heidnischen Staat der Antike durch ein christliches Konzept ablösen. Etwas unschlüssig steht Cicero vor dem Todesproblem. Die älteste Aufassung, dass der Mensch nach seinem Tod in den Hades eingeht, ein freudloses unterirdisches Schattendasein (wobei zwischen guten und bösen Menschen kein Unterschied gemacht wird), kann er nicht mehr teilen. Er will aber auch nicht, wie Epikur, den Tod schlechthin als NichtExistenz verstehen, die kein Übel sei, weil es ja niemanden mehr gibt, dem es widerfahren könnte. Im Somnium Scipionis, dem „Traum Scipios“ (der zu „De Re Publica“ gehört), entwirft Cicero nach stoischem Vorbild eine Art Paradies am Sternenhimmel, in das Menschen eingehen, die sich auf Erden besonders ausgezeichnet haben. Sehr fest scheint er nicht daran zu glauben: Denn parallel dazu weist er auf das ehrende Angedenken der Posteritas hin, der Nachwelt, in dem unsere Taten auch dann fortleben, wenn wir längst gestorben sind. Auch aus dieser Art von Unentschiedenheit erklärt es sich, dass die Mysterienreligionen, allen voran das Christentum, mit ihrer Verheißung unbedingter Unsterblichkeit wenig später so großen Erfolg haben. 13. DIE REDEKUNST Im antiken Stadtstaat hat die Redekunst zentrale Bedeutung. Andere Medien irgendwelcher Art gibt es nicht oder kaum (die Schrift steht nur Wenigen zu Gebote, und auch sie haben 23 meist nur eine bescheidene Anzahl von Büchern); die Stimmbürger passen mehr oder weniger Alle auf einen großen Platz und können einem einzelne Sprecher zuhören; ein Fraktionszwang im modernen Sinn, der die Teilnehmer einer Versammlung von vornherein zur Meinung einer Partei zwingt, fehlt: Die Kunst also, die die Zuhörer zu überreden vermag, hat großen Einfluss und genießt hohes Ansehen. „Rhetorik“ ist ein Wort, das in der Neuzeit z.T. abschätzige Bedeutung trägt: als wollte jemand andere auf windige Weise manipulieren. Die Antike denkt hier völlig anders. Wer es vermag, seine Mitbürger durch begeisternden Vortrag auf seine Seite zu ziehen, den achtet man. Zwei Hauptbetätigungsfelder gibt es für den Redner: die Rede vor Gericht und die politische Rede. Während heute die Juristerei ein Gebiet für Fachleute darstellt, wird von einem ehrgeizigen jungen Römer ganz allgemein erwartet, dass er jederzeit in einem Prozess auftreten und seine Klienten verteidigen kann. Wichtige Prozesse werden aufmerksam verfolgt, und ein guter Jurist hat Chancen, sich auch in der Politik durchzusetzen - Cicero z.B., dessen Sieg über Verres das Eingangstor für seine weitere Laufbahn darstellt. Der Redner darf sein Thema nicht herunterhaspeln; er muss den ständigen Kontakt mit den Zuhörern suchen, die schließlich über sein Anliegen befinden werden. Zu Beginn seiner Rede muss er ihr Wohlwollen zu gewinnen suchen (die „Captatio benevolentiae“), und auch im weiteren Verlauf sollte er sie immer wieder anreden: als Patres conscripti, wenn er vor dem Senat, als Quirites, wenn er vor der Volksversammlung, als Iudices, wenn er vor Gericht spricht. Cicero, der bedeutendste Redner der römischen Antike, hat sich auch theoretisch Gedanken über die Redekunst gemacht. Sie sind u. a. in seiner Schrift De Oratore enthalten, in der er einige der berühmtesten Redner der älteren Generation auftreten lässt. Für Cicero ist der vollendete Redner das Ziel aller Bildung: Wer wirklich gut reden will, muss alles andere Wissen in sich aufgenommen und verarbeitet haben, so dass es ihm in ungeheurer Breite zur Verfügung steht und er jederzeit in lässiger Souveränität über die entlegensten Wissensgebiete verfügen kann. So wird er zum perfekten Redner, der kein Gelehrter ist, sondern ein Mann des praktischen Lebens, und der doch immer das Passende auf angemessene Weise zu sagen weiß, zur Idealgestalt des allseits ausgebildeten, des wahrhaft humanen Menschen. Die Schule des Redners gestaltet sich also sehr vielseitig. Man lehrt ihn natürlich zuerst alles Wissen, das er sich auch sitzend in der Schulbank einverleiben kann: Wie man eine Rede konzipiert, den Stoff sammelt, ausarbeitet usw. Vieles davon hat sich bis heute in den Empfehlungen für den deutschen Aufsatz erhalten. Aber irgendwann muss er aufstehen und unmittelbar auf sein Publikum einwirken. Dazu sind zwei Dinge erforderlich, die heute kaum noch eine Rolle spielen: das Gedächtnis und der Vortrag. Der Redner darf selbstverständlich nichts ablesen. Selbst wenn seine Rede zwei Stunden dauert, würde ihm der Notizzettel als Schwäche ausgelegt. Es gibt ein Schulfach, das sich eigens damit beschäftigt, wie man sich Dinge, die man später wieder vergisst, doch kurzfristig merken kann: die Mnemotechnik. Man stellt sich ein großes Haus vor, worin man die Beschaffenheit jedes einzelnen Raums genau kennt; dies bleibt konstant. Darin verteilt man jeweils neu die zu behandelnden Gegenstände. Dabei bedeutet z.B. ein Schwert ein militärisches, ein Anker ein nautisches Thema usw. So wird auch die längste Rede als Rundgang durch den visuellen Speicher gemeistert. Und man muss natürlich ohne Mikrophon eine Ansammlung von mehreren tausend Menschen beschallen. Wer eine schwache physische Konstitution hat, sollte es gar nicht erst versuchen. Der junge Cicero ist ganz verzweifelt, weil seine Lungen der Belastung nicht standzuhalten scheinen; er entschließt sich, lieber jung an Schwindsucht zu sterben, als auf das Reden zu verzichten. (Der Fall tritt dann zum Glück doch nicht ein.) Cicero lebt noch in der Republik, in der die Beredsamkeit im Handgemenge der Meinungen und Interessen durchaus ihre Bedeutung hat. Im Kaiserreich sind alle wichtigen 24 Entscheidungen immer schon vorab von der Herrschermacht gefällt. Dennoch dauert die hochentwickelte rhetorische Kultur weiter, als ob es auf sie ankäme. Das wirkt sich langfristig demoralisierend auf die Redekunst aus und verschafft ihr den schlechten Ruf als hohler Schein, den sie seither nie mehr ganz losgeworden ist. Es gibt eine Reihe von rhetorischen Figuren, d.h. eine besondere Art, Worte und Gedanken anzuordnen, damit sie den maximalen Eindruck machen. Dazu gehören beispielsweise: Alliteration - mehrere Wörter beginnen mit demselben Anlaut, z.B.: Götter, Gräber und Gelehrte Anapher - mehrere einander entsprechende Satzglieder beginnen mit demselben Wort, z.B.: Wer will, wer kann, wer muss Parallelismus - mehrere Sinnabschnitte sind auf einander entsprechende Weise gebaut, z.B.: Heute / back´ ich, // morgen / brau´ ich, // übermorgen / hole ich der Königin ihr Kind! Chiasmus - einander entsprechende Glieder sind über Kreuz gestellt (X, wie der griechische Buchstabe Chi), z.B.: heute (a) Regen (b) - Sonne (b) morgen (a) Hyperbaton - Trennung zusammengehöriger Satzglieder, vor allem in der Lyrik, im Deutschen fast nicht nachzuahmen. Z.B.: eum diligo regem, wörtlich: diesen ich schätze König = diesen König schätze ich. Klimax - Steigerung: jedes Glied überbietet das vorherige, z.B.: er ist abgereist, er hat das Weite gesucht, er hat die Mauer durchbrochen (von Catilina). Hendiadyoin - (griechisch „Eins durch Zwei“), zwei Wörter bilden zusammen einen Begriff, z.B. „mit Sack und Pack“ = mit allem Zubehör; eiecit atque expulit, er hat ihn hinausgeworfen und vertrieben = er hat ihn mit aller Gewalt vertrieben. Litotes - eine doppelte Verneinung ergibt eine modifizierte Bejahung, z.B.: Ich habe nicht wirklich keinen Hunger Rhetorische Frage - eine Frage, deren Antwort von vornherein feststeht, z.B.: Glaubst du, du kannst mich anlügen? = Du kannst mich nicht anlügen. Ironie - Man sagt das Gegenteil von dem, was man meint, z.B.: Siehst du aber elegant aus!, wenn jemand etwas ganz Abscheuliches trägt (und es nicht merkt). Diese rhetorischen Figuren stehen niemals als Selbstzweck (oder nur dann, wenn der Redner, erfüllt vom Gefühl seiner Redegewalt, den eigenen Worten lauscht - also wenn er ein schlechter Redner ist!), sondern dienen immer dazu, die Expressivität der Rede zu erhöhen: Dem Zuhörer soll das Gemeinte lebendig vor Augen treten, er soll die Gegensätze deutlicher erfassen, sich in die Emotionen des Redners einfühlen usw. Eine rhetorische Figur ist erst dann vollständig analysiert, wenn man ihre Absicht verstanden hat. 14. SCHREIBEN UND LITERATUR Die Römer übernehmen, durch Vermittlung der Etrusker, das Alphabet von den Griechen. Die Zahl der Buchstaben ist kleiner als heute: I und J werden nicht unterschieden, ebensowenig U, V, und W; Y und Z kommen nur in griechischen Fremdwörtern vor. Ursprünglich trennt man beim Schreiben nicht einmal die Wörter voneinander (Scriptura continua); auch später gibt es nur ein einziges Satzzeichen, den Punkt. Notizen, (kürzere) Briefe u.ä. schreibt man auf Holztäfelchen (Tabulae), die mit einer Wachsschicht überzogen sind; in diese tieft man die Buchstaben mit dem Stilus ein, einem 25 Griffel. Er hat ein breites hinteres Ende, mit dem man das erwärmte Wachs wieder glattstreichen kann, so dass die Tafel neu verwendet werden kann: man macht „tabula rasa“. Zwei oder mehr solcher Tafeln sind mit Scharnier oder Lederbändern verbunden; man klappt und schnürt sie zusammen und sichert sie gegen unbefugte Lektüre, indem man sie mit dem persönlichen Siegelring versiegelt. Dann schickt mant die Post los - auf kürzere Entfernung durch einen Sklaven oder Klienten, auf längere, indem man sie einem reisenden Bekannten mitgibt, oder durch die Staatspost, die, wenigstens in der frühen Kaiserzeit, rasch und zuverlässig funktioniert. Wichtigstes Beschreibmaterial der Antike für längere Texte ist der Papyrus: Die markreichen Stengel dieser ägyptischen Sumpfpflanze werden geklopft und gewalzt, bis sie einen festen Verband bilden, dann zwei solcher Lagen im rechten Winkel zueinander verklebt, wie Sperrholz. Es ergibt sich auf diese Weise ein Buch, das wie eine Tapetenrolle aussieht: das Volumen. Der Text wird, nur auf der Innenseite, in Spalten quer zur Rollrichtung geschrieben. Um ein größeres Werk zu verfassen, braucht man meist mehrere Volumina; z.B. besteht Cäsars „Gallischer Krieg“ (der heute in eine einzige dicke Reclam-Ausgabe passt) aus zehn Büchern. Bücher werden immer mit der Hand geschrieben (auch wenn man sie vervielfältigen kann, indem man sie gleichzeitig einem ganzen Schwarm von Schreibern diktiert) und sind entsprechend teuer und selten. Man bewahrt sie in röhrenförmigen Schatullen auf, von denen vorn der „Titulus“ herabhängt, ein Zettel mit Angabe des Titels. Sie sind auch nicht ganz einfach zu lesen: man muss zur Lektüre beide Arme einsetzen, den einen, um die Rolle auf-, den anderen, um sie wieder zusammenzuwickeln. Die Bibliotheken für diese Gebilde gleichen einem Keller voller Flaschenregale. Die größte von ihnen, diejenige von Alexandria, soll ungefähr eine Millionen Bücher umfasst haben. Daneben gibt es den praktischeren Codex, das Buch aus Einzelbögen, die am Rücken geheftet werden, wie wir es auch heute noch kennen. Er hat in der klassischen Zeit eher geringe Bedeutung, setzt sich aber am Ende der Antike allgemein durch. Hierzu nimmt man Pergament, ein besonders feines Leder, das eher noch teurer ist als Papyrus, aber leichter verfügbar; denn die Verkehrswege nach Ägypten werden immer unzuverlässiger. Papier kommt als weit billigeres Schreibmaterial erst am Übergang zur Neuzeit auf. Fast ein Wunder muss man es nennen, dass überhaupt so viel Literatur überliefert worden ist, wenn man bedenkt, wie anfällig die Schreibmaterialien für Nässe und Feuer sind und wie wenig Interesse die „dunklen Zeitalter“ vom 5. bis zum 11. Jahrhundert zumeist an diesen vergangenen Subtilitäten nahmen. Original antike Manuskripte gibt es allerdings nur aus dem griechischen Osten, wo das extrem trockene Klima besonders Ägyptens selbst den empfindlichen Papyrus konserviert hat. Die ältesten lateinischen Handschriften stammen (bereits in der Form des Codex) aus der Zeit des 5. Jahrhunderts n. Chr. Die Werke der meisten antiken Autoren sind in Handschriften tradiert, die ein Alter zwischen fünfhundert und tausend Jahren haben. Sie verdanken ihre Fortdauer fast ausschließlich den Klöstern, den einzigen Kulturträgern des frühen Mittelalters. In ihren Schreibstuben wurden nicht nur christliche Texte immer wieder abgeschrieben, sondern auch die Werke solcher Heiden, in denen man eine gewisse Seelenverwandtschaft mit dem Christentum zu erkennen glaubte, z.B. Seneca und Vergil, oder die als vorbildliche Stilisten galten, wie Cicero. Aber auch Autoren, die den Mönchen als frivol erscheinen mussten, wie Catull und Ovid haben sich erhalten - wenn auch nahezu der ganze Catull am seidenen Faden eines einzigen, später wieder verschollenen Manuskripts hängt! Das große Problem bei allen antiken Werken besteht darin, die ursprüngliche Textgestalt zu rekonstruieren. Bei allen Handschriften hat man es mit Unikaten zu tun, und jede davon ist eine Abschrift von einer Abschrift von einer Abschrift... und bei jeder 26 schleichen sich natürlich neue Fehler ein: Sei es, dass der kopierende Mönch sich einfach irrt, sei es, dass er ein schwieriges, ihm unbekanntes Wort durch ein ihm bekanntes ersetzt (denn nicht alle Schreiber waren mehr sattelfest in der klassischen Sprache), sei es, dass eine bloße Anmerkung am Rand vom nächsten Kopisten für einen Teil des Texts gehalten wird und mit hineinrutscht. Es ist die detektivische Kunst der Philologie, aus diesen tausend Varianten einen Stammbaum zu erstellen, wer von wem abgeschrieben hat, und sich einigermaßen an einen erschlossenen Ur-Wortlaut heranzutasten. Aus diesem Grund erscheinen wissenschaftliche Ausgaben der antiken Autoren stets mit einem kritischen Apparat, der die wichtigsten Varianten mit angibt, so dass klar wird, was am vorliegenden Text gesichert ist und was bloß erschlossen und vermutet wird. Erst mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhunderts gibt es die Möglichkeit, eine große Zahl völlig gleicher Exemplare eines Texts herzustellen: die Literatur hat das Nadelöhr vereinzelter und zweifelhafter Überlieferung hinter sich. Fast in allen Literaturgattungen, die das Lateinische kennt, ahmt es ein älteres griechisches Vorbild nach. Eine neue Gattung nach Rom zu bringen, es so gut wie die Griechen zu machen oder womöglich noch besser - das bleibt lange der Hauptehrgeiz der Schriftsteller. Als Literatursprache beginnt sich das Lateinische langsam seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. zu entwickeln. Seine Blütezeit erreicht es im 1. Jahrhundert v. Chr. mit Cicero, Cäsar, Sallust, Livius, Lukrez, Vergil, Horaz, Catull, Ovid, Phaedrus: das Zeitalter der goldenen Latinität; ihm folgt im 1. Jahrhundert n. Chr. noch die silberne Latinität mit Seneca, den beiden Plinius, Tacitus, Martial. Danach setzt eine lange Phase abnehmender Produktivität ein, aus der im 4./5. Jahrhundert n. Chr. noch Augustinus herausragt. Viele antike Literaturgattungen, weit mehr als in den modernen Literaturen, werden grundsätzlich in Versen verfasst, darunter das Epos, die Satire, die Fabel, das Lehrgedicht. Während wir heute ein (traditionelles) Gedicht am Reim und einer bestimmten Verwendung des Druckakzents erkennen, kosntituiert sich der antike Vers ausschließlich durch die regelhafte Wiederkehr langer und kurzer Silben. Das Epos ist eine lange Erzählung von Heldentaten der Frühzeit, verfasst in der Versform des Hexameters. Seine klassische griechische Form hat es in den zwei Werken Homers gefunden: der Ilias, die vom Krieg der Griechen mit Troja berichtet, und der Odyssee, die die Irrfahrten des Odysseus auf seinem Heimweg von Troja zum Gegenstand hat. Beiden Epen auf einmal eifert die Äneis des Vergil nach. Sie erzählt von Äneas, einem der trojanischen Helden, der die Zerstörung seiner Vaterstadt überlebt und sich auf Geheiß der Götter aufmacht, eine neue Heimat in Italien zu suchen; er findet sie in Latium und wird zum Ahnherren der Römer, zugleich zu einem wichtigen Bindeglied der griechischen und lateinischen Kultur. Daneben hat Vergil noch die „Georgica“ verfasst, ein Lehrgedicht über die Landwirtschaft, und die „Bucolica“, Hirtengedichte. Horaz ist der wichtigste Lyriker; seine Oden galten bis weit in die Neuzeit als Inbegriff lyrischer Dichtung überhaupt. Doch hat er daneben auch Satiren verfasst, die sich mit zeittypischen Lastern wie übermäßigem Speiseluxus, Erbschleicherei usw. beschäftigen. Während Horaz einen eher milde allgemeinen Ton anschlägt, schreckt Martial auch vor persönlichen Angriffen nicht zurück und lässt in seinen Satiren ein lebhaftes Bild des römischen Alltagslebens entstehen. Ein sehr vielseitiger Dichter ist Ovid. Seine Metamorphosen verarbeiten viele der kleineren Mythen zu einer durchlaufenden Erzählung in Hexametern; immer steht dabei eine Verwandlung im Mittelpunkt oder doch am Ende: die der Zeus-Geliebten Io in eine Kuh, um sie vor den eifersüchtigen Augen der Hera zu verbergen; die der Daphne, die sich vor der Verfolgung des Apoll flüchtet, in einen Lorbeerbaum. Er hat außerdem die Ars Amatoria geschrieben, ein Lehrgedicht über die Liebe, in der er Männern und Frauen Ratschläge für 27 eine verfeinerte erotische Kultur gibt, von geeigneten Orten zur Kontaktsuche bis zur richtigen Art, mit Frisuren und Haarteilen umzugehen. Ovid wird als Mitwisser einer (bis heute nicht aufgeklärten) Palastaffäre am Hof des Augustus ins Exil ans Schwarze Meer verbannt, ein Schicksal, das er in seinen „Tristia“ beklagt, und stirbt dort auch. Catull ist neben Horaz der bedeutendste lyrische Dichter. Kernstück seines verhältnismäßig schmalen Werks bildet die heftige und zuletzt unglückliche Liebe zu einer Frau, die er in den Gedichten Lesbia nennt; daneben enthält es zahlreiche scherzhafte oder spöttische, nicht selten auch obszöne Kurzgedichte. Die Geschichtsschreibung liegt den traditionsbewussten Römern besonders am Herzen. Von Sallust sind nur zwei kurze Bücher erhalten, die sich mit Einzelepisoden der späten Republik beschäftigen, dem Krieg gegen den Numiderkönig Jugurtha und der Verschwörung des Catilina; ihm kommt es darauf an, exemplarisch die Sittenverderbnis seiner Zeit vorzuführen. Cäsar hingegen gibt mit seinen Commentarii de Bello Gallico (Kommentare über den Gallischen Krieg) vor allem Rechenschaft über seine Tätigkeit als Feldherr, ebenso wie mit dem späteren Werk De Bello Civili (Über den Bürgerkrieg). Livius verfasst ein riesenhaftes, aus mehreren hundert Einzelbüchern bestehendes Werk Ab Urbe Condita, worin er die Geschichte Roms von den Anfängen bis zur Zeit des Augustus nachzeichnet. Als bedeutendster Geschichtsschreiber gilt Tacitus, der die römische Geschichte der frühen Kaiserzeit darstellt; als Republikaner auf verlorenem Posten gibt er in den Annales und den Historien ein düsteres Gemälde seiner Zeit, von Kaisern beherrscht, die fast alle früher oder später dem Cäsarenwahn verfallen. Dem dekadenten Römer stellt er in seiner Germania das Bild des unverdorbenen Barbaren gegenüber. Der ältere Plinius hat mit seiner Naturgeschichte eines der umfangreichsten Werke der Antike hinterlassen, ein buntes, aber kulturgeschichtlich informationsreiches Sammelsurium. Sein Neffe und Adoptivsohn, der jüngere Plinius, ist bekannt besonders durch seine Briefe, in denen er z.B. als Augenzeuge den Vesuv-Ausbruch des Jahres 79 n.Chr. schildert. Ein kleineres Genus ist die Fabel, eine kurze Geschichte, in der zumeist Tiere agieren und die auf eine einfache Moral hinausläuft. Als ihr Begründer gilt Äsop, von Phaedrus frei ins Lateinische übertragen. Augustinus steht am Ende der Antike, im Übergang zum Mittelalter: Er wächst noch als Heide auf, erlebt eine Erschütterungskonversion zum Christentum und stirbt als Bischof seiner Heimatstadt, während sie von den Vandalen belagert wird. Er hat sein Leben in den Confessiones geschildert, der ersten Autobiographie der Weltliteratur. (Zum „Gottesstaat“ s. Kapitel Philosophie.) 15. DIE LATEINISCHE SPRACHE Das Lateinische war zunächst nur die Sprache der Latiner, eines kleinen Stammes in der unmittelbaren Umgebung Roms. Seine Bedeutung nimmt zu in dem Maß, wie das römische Weltreich aufsteigt. Es gehört zur Gruppe der italischen, und diese wiederum zur großen Familie der indoeuropäischen Sprachen, denen z.B. auch das Deutsche zurechnet. So kommt es, dass man bei Formen wie „est“ - „(er) ist“ oder „sal“ - „Salz“ unmittelbar noch die Verwandtschaft merkt. Das Lateinische wächst allmählich an seiner Aufgabe, Verkehrssprache eines Weltreichs zu sein. Was diese praktisch gesonnene Bauernsprache zunächst noch nicht von 28 sich aus mitbringt, das fügen ihr nach und nach die Redner, Philosophen und Literaten hinzu. Das klassische Latein steht tief in der Schuld des Griechischen. Es setzt sich als Amts- und Verkehrssprache überall dort durch, wo es als Träger einer überlegenen Kultur auf „Barbaren“ trifft. Das ist im gesamten Westen der Fall. Dieser Einfluss bleibt erhalten bis in die Gegenwart: Alle romanischen Sprachen leiten sich auf direktem Weg aus dem Lateinischen ab: die großen wie Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, aber auch die kleinen wie Sardisch, Katalanisch, Rätoromanisch. Wirksam ist dabei allerdings nicht die Schriftsprache, sondern das gesprochene Vulgärlatein. Eine Sonderrolle nimmt das isolierte Rumänisch ein: Auf dem Gebiet des heutigen Rumänien lebten die einzigen nicht griechisch vorgeprägten Barbaren des Ostens, die römisch wurden! Nicht alle Gebiete im Westen verbleiben im Bereich der Latinität. Nordafrika wird im 7. Jahrhundert arabisch, in England setzen sich ab dem 5. Jahrhundert die germanischen Angeln und Sachsen fest. (Erst die Normannen werden 1066 dem Englischen seinen lateinischen Anteil auf dem Umweg über das Französische einverleiben.) Noch viele Jahrhunderte nach dem Untergang des Römischen Reichs bleibt Latein die einzige Kultur- und Schriftsprache Europas. Vor allem ist es die Sprache der Kirche mit ihrem Monopol auf alle Bildung und Kultur, die ihre heiligen Texte und ihre Gottesdienste nur in dieser einen Sprache zulässt. So erreicht Latein auch diejenigen Teile Europas, die nie römisch gewesen waren. Zentren der Gelehrsamkeit sind die Klöster, im deutschen Sprachraum vor allem Fulda, St. Gallen und die Reichenau. Im Hochmittelalter kamen als ein zweiter Pol die Universitäten hinzu - in Italien seit dem 11., in Deutschland seit dem 14. Jahrhundert. Auch sie lehrten grundsätzlich nur in Latein. Latein blieb dabei immer eine gesprochene Sprache, die sich langsam weiter zum Mittellatein entwickelte; gegenüber dem klassischen Latein zeichnet es sich durch eine gewisse syntaktische Vereinfachung und die starke Anpassung an die christliche und feudale Vorstellungswelt aus. Der Wortschatz hat den Bedürfnissen der Religion zu genügen: „gratia“, allgemein die Gunst, wird zur göttlichen Gnade, „fides“, die Treue, zum Glauben, „peccatum“ verwandelt sich vom bloßen Fehler, den man gemacht hat, in die christliche Sünde. Es wurde in dieser Sprache auch viel gedichtet. Das berühmteste Beispiel stellen die Carmina Burana dar, Lieder (Gedichte) aus dem süddeutschen Kloster Beuron. Sie weisen die Besonderheit auf, dass sie sich reimen, Am Ende des Mittelalters versucht man, das klassische Latein Ciceros neu zu beleben und das allgemein übliche „Küchenlatein“ zurückzudrängen: die Bewegung des Humanismus entsteht. Ihre wichtigsten Vertreter sind Francesco Petrarca und Erasmus von Rotterdam. Sie erreicht ihre Ziele, aber langfristig führt diese Hebung des stilistischen Niveaus dazu, dass Latein als gesprochene Sprache abstirbt. Schon im Hochmittelalter hatten die Nationalsprachen wie Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch sich selbstbewusst neben dem Lateinischen behauptet; seit dem 16. Jahrhundert beginnen sie es langsam zurückzudrängen. Im 17. Jahrhundert werden in Deutschland noch mehr lateinische als deutsche Bücher gedruckt; im 18. Jahrhundert kehrt sich das Verhältnis um. Latein verliert allmählich die Aufgabe, die es zwei Jahrtausende lang erfüllt hatte: über die Grenzen der Einzelvölker hinweg eine einheitliche literarische, religiöse und wissenschaftliche Kultur Europas zu begründen. Weit ins 20. Jahrhundert jedoch ist eine höhere Schulbildung ohne gründliche Kenntnis des Lateinischen nicht vorstellbar. Bis zur Mitte des Jahrhunderts tritt kaum ein deutscher Schriftsteller auf, dessen Stil nicht am Lateinischen geschult worden ist. Auch heute noch ist es offizielle Amtssprache der katholischen Kirche. Das Deutsche empfängt die Anregungen des Lateinischen in mehreren Wellen. Wörter, die frühzeitig - in germanischer oder frühmittelalterlicher Zeit - übernommen werden, folgen den 29 einheimischen Lautgesetzen und sind von rein deutschen auf Anhieb nicht zu unterscheiden: es sind Lehnwörter geworden. Dazu gehören viele Vokabeln für Dinge, die die Germanen von den Römern übernommen haben: „Wein“ aus „vinum“, „Mauer“ aus „murus“ (aus Stein! die Germanen bauen mit Holz), „Sack“ aus „saccus“, aber auch Verben wie „dauern“ aus „durare“ oder „kosten“ aus „constare“. Manche Wörter werden mehrfach entlehnt: Der „Keller“ (aus „cella“) entstammt noch der Zeit, als das römische c wie k gesprochen wurde, und ist damit älter als die „Zelle“, die als Behausung eines Mönchs erst in christlicher Zeit einen Namen braucht. Als älteste Entlehnung gilt „Kaiser“, aus „Caesar“, mit dem es die Germanen schon früh zu tun bekamen. Lehnübersetzungen benutzen deutsche Bestandteile, setzen sie aber nach lateinischem Muster zusammen; so entsteht „Ab-wesenheit“ aus „absentia“, „Mit-leid“ aus „com-passio“ und ebenso „(b)arm-herzig“ aus „miseri-cors“ (beides von den Germanen offenbar zuvor nicht benannt), „Mon-tag“ aus „dies Lunae“. Auch Vorbilder des komplexen Satzbaus werden vom Lateinischen bezogen. Das Deutsche bildet sich am Lateinischen zu einer differenzierten und abstraktionsfähigen Schriftsprache heran wie zuvor das Lateinische am Griechischen. Lateinische Wörter, die in Spätmittelalter oder Neuzeit ins Deutsche gelangen, behalten dagegen eine Gestalt, die sie als Fremdwörter erkennen lässt. Verben bekommen zumeist die Endung „-ieren“ angehängt, wie „spazieren“, „regieren“, „inspizieren“. Unter den Substantiven sind typische Formen z.B. „Nation“, „Fakultät“, „Traktat“, „Zeremonie“, „Villa“, „Studium“. ANHANG Hier finden Sie weitere Informationen über Autoren, deren Texte vom Frühjahrstermin 2007 an bei der mündlichen Prüfung berücksichtigt werden. Lesen Sie dazu auch in „Studium Latinum“, Band 1, die Seiten 37f, 43, 47 und 79 nach! Seneca Lucius Annaeus Seneca wurde kurz vor der Zeitenwende in Spanien geboren und kam schon als junger Mann nach Rom, wo er bald als Philosoph und Rhetor großen Einfluss gewann. Eine (angebliche oder tatsächliche) Affäre mit einer kaiserlichen Prinzessin führte dazu, dass Kaiser Claudius ihn für neun Jahre auf die Insel Korsika verbannte, damals kein Urlaubsziel, sondern das Ende der Welt. Seneca rächte sich später dafür, indem er über den Tod dieses Kaisers eine bitterböse Satire schrieb: Die „Apocolocyntosis“, wörtlich „Verkürbissung“; der Kaiser wurde darin nicht zu den Göttern erhoben, sondern zu den Gemüsen, denen er, laut Seneca, schon zu Lebzeiten auffallend ähnlich sah. Zu seinen Werken gehören außerdem neun Tragödien und mehrere philosophische Monografien („De Brevitate Vitae – Über die Kürze des Lebens“; „De Providentia – Über die Vorsehung“ u.a.) Die Kaiserin Agrippina holte Seneca nach Rom zurück, als sie Claudius ehelichte, um ihn bald darauf durch ein selbstgekochtes Pilzgericht aus dem Weg zu räumen; sie sorgte dafür, dass ihr siebzehnjähriger Sohn Nero, den sie mit in die Ehe gebracht hatte, den Thron bestieg. Seneca, dem bisherigen Erzieher, fiel damit gewissermaßen die Rolle des Premierministers zu. Schon Platon hatte verlangt: Wenn die Welt ideal geleitet werden soll, müssen entweder die Könige Philosophen oder die Philosophen Könige werden. Diese 30 einmalige Chance schien jetzt gekommen; Seneca betrieb, und offenbar mit einigem Erfolg, als praktischer Philosoph Politik. Doch begann ihm sein Zögling, der sich immer weniger von seinem alten Lehrer sagen ließ, immer mehr zu entwachsen. Schließlich zog Nero Seneca in ein Mordkomplott hinein, das er gegen seine allzu herrschsüchtige Mutter Agrippina angezettelt hatte und das misslungen war. Nero gab dem Sohn, der vor Angst außer sich war, den Rat: Jetzt musst du es durchziehen! Was Nero auch sogleich tat. Alles andere hätte den Staat in eine Krise gestürzt. Der Philosoph an den Hebeln an der Macht war zum Komplizen eines Mordes geworden. Seneca verlor seinen Einfluss auf den Kaiser und ging mit einem beschädigten Ruf aus der Sache hervor. Er zog sich ins Privatleben zurück und verfasste dort als alter Mann sein Hauptwerk: Die “Epistulae Morales ad Lucilium“, deutsch „Briefe an Lucilius zur Ethik“. Die in 20 Büchern zusammengefassten 124 Briefe richten sich an einen jungen Freund namens Lucilius, von dem man nichts weiter weiß und der vielleicht eine bloße Fiktion ist. So etwas wäre in der Antike nicht ungewöhnlich; die Briefform gab jedenfalls Gelegenheit, über Probleme der praktischen Lebensführung in locker reihender, humorvoller, unaufdringlich belehrender Weise zu sprechen – ein bisschen wie die heutigen Ratgeberkolumnen in den Zeitschriften. Auf diese Weise verbreitet Seneca eine heitere, leichte Version des strengen Stoizismus. Gern geht er dabei von einem konkreten Erlebnis aus, an das er Betrachtungen knüpft. Zum Beispiel kehrt er nach Jahren zu seinem Landhaus zurück und bemerkt, dass es ganz heruntergekommen ist. Als er den Verwalter zur Rede stellt, entschuldigt der sich: es sei eben alles alt! Und plötzlich erkennt Seneca, wie alt er selbst geworden ist und wie wenig ihn noch vom Tod trennt. Vom Tod und dem rechten Umgang mit ihm handeln viele Briefe. Das Schlimmste im Leben, meint Seneca, sei, sich vor dem Tod zu fürchten, denn was hätte man dann vom Leben? Am besten also lebt man, als ob man schon schon so gut wie tot wäre; als wäre dieser Tag unser letzter und der nächste ein unerwartetes Geschenk. Selbst in den Augen dieses reichen, überlegenen Mannes in einer der sichersten Friedenzeiten der Geschichte stellt sich die Welt immer wie eine feindliche Übermacht dar, aus der jederzeit ein Angriff hervorbrechen kann. Sein Rat: Tu, als hättest du alles schon verloren, dann kannst du nichts mehr verlieren! Man erfährt nebenbei vieles über Senecas Privatleben: dass er an einer Art Asthma leidet, welches ihn oft in Todesangst versetzt; dass er sich im Urlaub über einer Badeanstalt einquartiert und unter dem Krach leidet; dass er ein guter Schwimmer ist und sich in Seenot lieber in die eiskalten Wellen stürzt, als weiterhin die Seekrankheit zu erdulden. Seneca geht, ganz ähnlich wie Sokrates, gelassen und heiter in den Tod, als Nero, der seinen alten Lehrer der Teilnahme an einer Verschwörung verdächtigt, ihm den Selbstmord befiehlt (65 n.Chr.). Damit hat er in den Augen der Antike seine Lehre existenziell bekräftigt. Dennoch waren ihm nicht alle wohlgesonnen: Der Kaiser Caligula hasste seinen abgehackten Stil, der dazu neigt, auch triviale Sachverhalte geistreich zuzuspitzen, und nannte ihn „harena sine calce – Sand ohne Kalk“. Und Schopenhauer meinte: Wenn man wissen wollte, was die Pädagogik taugt, so schaue man sich den berühmtesten Lehrer aller Zeiten an – Seneca – und seinen einzigen Schüler – Nero -, und man wisse genug. Livius Titus Livius ist der produktivste aller römischen Historiker: Seine Geschichte Roms „Ab Urbe Condita – Von der Gründung der Stadt an“ behandelt die Geschichte Roms von den Anfängen (753 v.Chr.) bis in seine eigene Zeit, die Zeit des Augustus (also fast acht Jahrhunderte), in 142 Büchern. Er folgt dabei dem Prinzip der Annalen, den von den Priestern offiziell geführten Jahrbüchern; Geschichte wird Jahr für Jahr chronologisch fortgeschrieben. Von seinem Leben weiß man wenig; er wurde in Patavium, dem heutigen 31 Padua in Oberitalien, geboren und strab dort auch im Jahr 17 n.Chr.. Er scheint ein ruhiges, rein schriftstellerisches Dasein geführt zu haben. Mehr als drei Viertel seiner Bücher sind verloren. Erhalten ist zum einen die erste Gruppe, die von den Anfängen Roms bis um die Zeit ca. 300 v.Chr handelt, d.h. jener Epoche, die Rom selbst als sein goldenes Zeitalter zu betrachten pflegte. Zum anderen existieren noch die Bücher über die Zeit vom späten dritten bis zur Mitte des zweiten Jahrhunderts v.Chr. Besonders viel Widerhall hat dabei seine Schilderung des Zweiten Punischen Kriegs (218-201 v.Chr.) gefunden. Ins Zentrum rückt Livius die Figur des Hannibal, des gefährlichsten Feinds, mit dem Rom es je zu tun hatte. Livius stellt ihn dar als einen glänzenden, den Römern weit überlegenen Strategen – aber getrieben von einer in der Familie fortgeerbten Rachsucht, die um jeden Preis die Scharte des verlorenen Ersten Punischen Krieges auswetzen will. Hannibal dringt von Spanien auf dem Landweg über die Alpen nach Italien vor, schlägt die Römer wiederholt, darunter einmal vernichtend bei Cannae (216 v.Chr.), versetzt die Stadt Rom in Schrecken, als er vor ihren Toren auftaucht – und verliert den Krieg zuletzt doch. Die Römer liefern ihm keinen Kampf mehr, er erhält keinen Nachschub aus der Heimat und steht jahrelang in Süditalien, ohne etwas bewirken zu können. Schließlich, als den Römern die Landung in Nordafrika gelingt, muss er heimkehren. In der Schlacht von Zama unterliegt er dem römischen Feldherrn Scipio dem Älteren. Karthago muss bittere Friedensbedingungen akzeptieren, Hannibal flieht. Als seine Feinde ihn an entlegener Stelle weit im Osten aufgespürt haben, begeht er Selbstmord. „Befreien wir die Römer von einer schweren Sorge, da sie den Tod eines alten Mannes nicht abwarten können“, sollen seine letzten Worte gewesen sein. Sallust Gaius Sallustius Crispus ist Zeitgenosse Ciceros und Parteigänger Cäsars. Als Politiker scheint er kein strahlendes Vorbild der Moral gewesen zu sein: Er wird wegen Ehebruchs aus dem Senat ausgestoßen, später läuft ein Prozess gegen ihn wegen unerlaubter Bereicherung. Cäsar verhütet das Schlimmste und hält die Hand über seinen Schützling. Nach Cäsars Ermordung wendet er sich der Geschichtsschreibung zu. Komplett erhalten sind nur zwei vergleichsweise kurze Bücher: „De Coniuratione Catilinae – Die Verschwörung des Catilina“ und „De Bello Iugurthino – Der Krieg gegen Jugurtha“. Jugurtha ist Ende des 2. Jhs. v.Chr. König des relativ unbedeutenden nordafrikanischen Reichs Numidien, das unter der Weisungsgewalt Roms steht. Über diese setzt sich Jugurtha hinweg und beginnt einen jahrelangen Kleinkrieg gegen die Schutzmacht. Dass er so lange damit Erfolg hat, verdankt er nicht nur seiner Guerilla-Taktik im unübersichtlichen Wüstengelände, sondern vor allem der Bestechlichkeit der maßgeblichen politischen Kreise in Rom. Von Jugurtha stammt der Satz, ganz Rom sei käuflich. Erst dem neuen Feldherr Marius gelingt es, Jugurtha endgültig niederzuwerfen. (Über die Verschwörung des Catilina vgl. den entsprechenden Abschnitt zu Cicero, S. 19.) Sallust stellt diese Vorgänge in Form einer Monografie dar, einer historischen Einzelschrift, die, anders als die Annalen, nicht alles festhält, was in jedem Jahr passiert, sondern sich auf ihr jeweiliges Thema konzentriert. Sallust interessieren nicht die Geschehnisse als solche – es handelt sich um eher beiläufige Episoden in der Geschichte der späten Republik –, sondern ihr symptomatischer Charakter: Er liest daran den Grad der Dekadenz seiner Landsleute und Zeitgenossen ab, die in Zynismus, Habgier, Korruption und persönlicher Rivalität versacken, seit der äußere Aufstieg Roms die altererbten Werte zugrunde gerichtet hat. 32 Velleius Paterculus gehört zu den kleineren Historikern. Er lebt als Senator zur Zeit des Kaisers Tiberius (ca 30 n.Chr.) Auch er legt, wie Livius, eine Geschichte Roms von den Anfängen bis in seine Gegenwart vor („Historia Romana“), doch fällt sie wesentlich schlanker aus. Besonders eindringlich schildert er die Krisen und Bürgerkriege der späten Republik in all ihrer Grausamkeit. Als Anhänger der Monarchie und der Dynastie des Augustus kommt es ihm auf den Kontrast an: Erst Augustus hat diese Zustände durch seine umfassende Friedensherrschaft beendet. 33