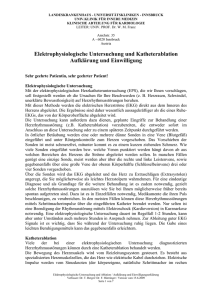BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks
Werbung

Sendung vom 18.1.2012, 20.15 Uhr Dr. Florian Hintringer Kardiologe im Gespräch mit Iska Schreglmann Schreglmann: Ganz herzlich willkommen zum alpha-Forum. Bei mir zu Gast ist heute der Kardiologie Dr. Florian Hintringer. Schön, dass Sie aus Innsbruck zu uns nach München gekommen sind. Hintringer: Danke schön für die Einladung. Schreglmann: Man kann sich ja als Mediziner ganz verschiedene Fachrichtungen aussuchen, Sie sind ziemlich schnell in Richtung Herz losmarschiert. Warum? Hintringer: Das hat mich schon während des Studiums fasziniert. Dadurch, dass man dabei die einzelnen Fächer im Schnelldurchlauf lernen muss, bekommt man doch einen gewissen Eindruck, welches Fach einen am meisten interessiert. Als ich mit der Kardiologie in Berührung gekommen bin, war sehr schnell klar, dass ich das werden möchte. Schreglmann: Warum? Hintringer: Die Kardiologie ist eine sehr schöne Kombination aus verschiedenen Bereichen. Man befasst sich erstens mit dem Menschen als Ganzes. Das heißt, man arbeitet wie ein klassischer Internist, der Visiten macht, der eine Ambulanz führt, dort mit dem Patienten sprechen kann. In einem Krankenhaus habe ich auch nicht den Zeitdruck wie in einer Praxis, ich kann mich also wirklich auseinandersetzen mit dem Patienten. Zweitens kann ich als Kardiologie ähnlich wie ein Chirurg auch handwerklich tätig sein. Das heißt, ich kann z. B. Herzkatheteruntersuchungen durchführen. Und ich habe auch die Bestätigung, dass ich wirklich etwas reparieren oder sogar heilen kann an einem Patienten und nicht nur auf die Wirkung von Tabletten vertrauen muss. Schreglmann: Es ist also die Kombination, die Sie fasziniert. Über das Handwerkliche, das Technische sprechen wir gleich noch, aber davor würde mich das Verhältnis zum Patienten näher interessieren. Sie haben gesagt, für Sie sei es wichtig, mit dem Patienten ins Gespräch zu kommen und dass Sie dabei in der Klinik keinen Zeitdruck hätten. Das wundert mich jetzt doch, denn es heißt doch immer, dass im Krankenhaus alles so schnell gehen müsse und dass man als Arzt mit dem Patienten gar nicht so lange sprechen kann, wie man möchte. Hintringer: Wir haben das Glück, dass wir eine Universitätsklinik sind und unsere Ambulanz eine ist, der Patienten im Sinne einer speziellen Betreuung bzw. Untersuchung zugewiesen werden. Ich teile die Patienten ein: Wir haben einen EDV-basierten Terminplaner und da sehe ich dann eben jeweils entsprechende Slots vor. Wenn ich sage, ich werde bei einem Patienten ungefähr eine Stunde für das Gespräch brauchen, dann teile ich da auch eine Stunde ein. Diese wirtschaftlichen Aspekte, wie sie ein niedergelassener Arzt hat, spielen bei mir keine Rolle. Ein Patient von mir hat ja bereits mehrere Ärzte gesehen und wird deshalb zu uns geschickt, damit wir sein Problem lösen. Und das braucht Zeit. Und diese Zeit gebe ich mir. Ich weiß, dass das ein Privileg ist. Schreglmann: Herzprobleme sind ja eine ganz komplexe Angelegenheit. Braucht man denn gerade für Herzpatienten deswegen mehr Zeit, um mit ihnen auch über ihre persönliche, ihre private Situation zu sprechen? Hintringer: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten, bei denen geht es darum, einfache nur den Blutdruck einzustellen, gemeinsam eine Blutdrucktabelle anzuschauen und zu sagen: "Hier und hier müssen wir noch nachbessern!" So etwas ist natürlich schnell erledigt und solche Patienten haben ich selbstverständlich auch. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Patienten, bei denen beides eine Rolle spielt. Herzrhythmusstörungen z. B. kann man sehr mechanistisch, sehr schulmedizinisch erklären. Aber wenn ein Patient über lange Zeit einen erheblichen Leidensdruck durch so etwas gehabt hat, dann ist es auch wichtig, dass man Anteilnahme zeigt. Da spielen beim Umgang mit diesem Problem dann eben auch noch andere Faktoren eine Rolle. Darum habe ich doch den Eindruck, dass es den Patienten wichtig ist, dass man das nicht nur im Vorbeihuschen macht, sondern dass man sich auf sie auch wirklich einlässt. Ich bin aber kein Psychotherapeut und ich habe auch keine derartige Ausbildung, sondern ich versuche einfach nur, mir Zeit zu nehmen für die Patienten. Schreglmann: Gerade bei Herzpatienten bzw. bei Herzrhythmuspatienten heißt es, dass da nicht nur das Herz aus dem Rhythmus geraten sei, sondern vielleicht auch das ganze Leben. Haben Sie den Eindruck, das Leben gerät als Folge dieser Erkrankung aus dem Rhythmus? Oder ist es so, wie es ja auch manchmal heißt, dass häufiger Stress oder psychische Probleme zuerst einmal zu Herzrhythmusstörungen führen? Hintringer: Es gilt beides. Es ist sicherlich so, dass es bestimmte Rhythmusstörungen gibt, die teilweise sogar angeboren sind wie z. B. das Wolff-ParkinsonWhite-Syndrom, das WPW-Syndrom. Da gibt es gar nichts zu diskutieren, so etwas gehört ordentlich behandelt. Und dann werden sich für den betroffenen Patienten auch die damit verbundenen Ängste lösen – nicht direkt nach der Behandlung, aber doch im Laufe der nächsten Wochen oder Monate. Aber es gibt eben auch Menschen, die sehr besorgt sind wegen Phänomenen, die physiologisch, die also natürlich sind wie z. B. einzelne Extraschläge, die jedes Herz hat. Wir beide werden jetzt auch ein paar Extraschläge haben während dieses Gesprächs, weil das einfach ein häufiges Phänomen ist und sicher längst nicht immer eine Herzerkrankung bedeutet. Aber da das Herz so ein zentrales Organ ist, entstehen da schneller mal Ängste. Ich habe auch Patienten, bei denen ich zwar nichts tun kann gegen diese Extraschläge – sie sind ja auch natürlich, warum sollte ich also etwas dagegen tun –, aber bei denen ich doch versuchen muss, ihnen ihre Ängste auszureden. Das ist manchmal schwieriger, als eine komplexe Katheterablation durchzuführen. Schreglmann: Was sind das für Ängste? Hintringer: Nun ja, das sind Ängste wie: "Bleibt mein Herz stehen? Erleide ich den Sekundenherztod?" Denn möglicherweise ist das in der Familie oder bei einem guten Freund des Patienten in jüngster Zeit so passiert. So tritt dann ein Phänomen, das jemand bis dahin nur unterschwellig bemerkt hat, auf einmal stärker in den Vordergrund und verursacht wirklich Ängste. Es ist wirklich häufig so, dass jemand wegen seiner an sich harmlosen Rhythmusstörungen verängstigt zu uns kommt. Im Gespräch stellt sich dann heraus, dass ein sehr guter Freund oder eine sehr gute Freundin vor einem halben Jahr plötzlich tot umgefallen ist. Schreglmann: Das subjektive Empfinden und die Erinnerung an bestimmte Dinge spielen also offensichtlich eine sehr große Rolle dabei. Hintringer: Ja. Das ist entweder wirklich die Ursache für die Probleme und den Leidensdruck des Patienten oder es spielt zumindest eine Rolle, wie die betreffenden Menschen damit umgehen. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass Rhythmusstörungen ähnlich wie bei der Funktion eines Computers durch elektrische Leitungsvorgänge sehr wohl erklärbar sind und wir hier rein organische Behandlungsansätze anbieten können. Schreglmann: Das heißt, die Ursachen können vielgestaltig sein. Manchmal leiden Herzpatienten ja auch ein bisschen darunter, dass sie von anderen Menschen gesagt bekommen: "Na ja, das ist bei dir sicherlich psychisch bedingt." Hintringer: Man sollte extrem aufpassen, hier jemanden gleich in die "psychische Ecke" abzudrängen. Wenn sich bei mir jemand wegen Herzrhythmusstörungen meldet, dann begegne ich dieser Person zuerst einmal als jemand, der Herzrhythmusstörungen hat, und nicht als jemand, der einen Vogel hat. Schreglmann: Wobei aber nicht jeder, der psychisch belastet ist, einen Vogel hat. Hintringer: Ja, selbstverständlich. Aber wenn es in der Medizin schnell gehen muss, dann ist man leider auch sehr schnell bereit zu sagen: "Das bildet sich dieser Patient alles nur ein!" Schreglmann: Gut, das "Einbilden" ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Hintringer: Sie haben recht, der "Vogel" war vielleicht ein bisschen heftig formuliert. Schreglmann: Nun, Sie haben das halt so ausgedrückt, wie es die Leute auf der Straße auch sagen würden. Und mit diesem O-Ton von der Straße werden diese Leute ja auch konfrontiert. Hintringer: Es wäre jedenfalls sicherlich ein Fehler, nach einer ersten Blickdiagnose sofort zu sagen: "Ach, das ist eh nichts! Das bilden Sie sich nur ein! Regen Sie sich nicht so auf und geben Sie Ruhe!" Denn es ist einfach so, dass auch eine harmlos imponierende Rhythmusstörung nur die Spitze eines Eisberges sein kann. Das heißt, sie kann eine darunter liegende schwerwiegende Herzerkrankung anzeigen. Eine Rhythmusstörung ist also ein Symptom und als solches zu werten, als ein Alarmzeichen, das die Natur vorsieht. Und deshalb muss man eben bei jedem dieser Patienten zuerst einmal abklären, ob er strukturell herzkrank ist. Erst dann kann ich eine Einschätzung vornehmen und sagen: "Gut, hier versuche ich, den Patienten zu beruhigen und ihn von der Rhythmusstörung abzulenken." Wenn jedoch eine strukturelle Herzkrankheit vorliegt, ist es notwendig, eine Behandlung einzuleiten: sei es medikamentös oder mittels Herzkatheter. Schreglmann: Ab wann ist denn die Rhythmusstörung wirklich krankhaft? Sie haben vorhin gesagt, dass diese Extraschläge des Herzens in bestimmten Situationen ganz normal sind. Hintringer: Hier gibt es, wenn Sie so wollen, unterschiedliche Schwellen. Es gibt natürlich Herzrhythmusstörungen, die auf jeden Fall lebensbedrohlich sind. Das sind vor allem Herzrhythmusstörungen, die von der Herzkammer ausgehen und das sind vor allem Herzrhythmusstörungen bei Menschen, die strukturell herzkrank sind, die z. B. bereits einen Herzinfarkt hatten. Hier muss ich natürlich sehr konsequent behandeln. Eine der möglichen Behandlungsmodalitäten ist die Implantation eines sogenannten Defibrillators, der das Kammerflimmern und damit den drohenden Sekundenherztod erkennt und auch automatisch behandelt. Schreglmann: Können Sie ein bisschen genauer erklären, was ein Defibrillator ist? Hintringer: Ein Defibrillator schaut äußerlich so aus wie ein etwas größerer Herzschrittmacher: Der Defibrillator ist ein Implantat, d. h. man kann ihn unter die Haut und meistens sogar unter den Muskel einsetzen. Er ist mit dem Herzen durch eine sogenannte Elektrode verbunden, also sozusagen durch ein Kabel. Er macht zunächst einmal gar nichts, außer dass er den Puls des Patienten mitzählt. Wenn er feststellt, dass der Puls viel zu schnell ist, wie das beim Kammerflimmern der Fall ist, bei dem der Puls auf weit über 200 Schläge pro Minute ansteigt und womit die Gefahr eines Herzkreislaufstillstands droht, dann ist dieser "Defi" in der Lage, einen Gleichstromschock abzugeben. Das ist so, wie man das auch von den externen Defibrillatoren kennt, wenn jemand wiederbelebt wird. Beim implantierten Defibrillator ist es jedoch so, dass die Diagnose, die Entscheidung zur Therapie und die Therapie selbst automatisch erfolgen. Schreglmann: Dieser Elektroschock, der da abgegeben wird, ist aber so klein, dass das für den Patienten nicht spürbar ist. Hintringer: Nein, das ist sehr wohl schmerzhaft. Aber wenn man einen Kreislaufstillstand erleidet, dann wird man bewusstlos. Das heißt, es vergehen etwa zehn Sekunden, bis dieser Gleichstromschock erfolgt. Dafür gibt es gewisse technische Gründe, aber das kommt uns aufseiten der Medizin auch entgegen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Patienten jedenfalls schon dabei, das Bewusstsein zu verlieren. Damit wird dieser Gleichstromschock als nicht so schmerzhaft empfunden. Allerdings ist es so, dass diese Geräte natürlich aufgrund von bestimmten Algorithmen entscheiden müssen. Und so ein Algorithmus ist so "gestrickt", dass er sich im Zweifelsfall immer für den Schock entscheiden wird. Das heißt, es besteht für den Patienten ein gewisses Risiko, dass eine andere Herzrhythmusstörung, die nicht lebensbedrohlich ist, trotzdem behandelt wird: Und dann bekommt er diesen Schock natürlich bei vollem Bewusstsein. Auch das ist etwas, was man mit dem Patienten gut besprechen muss. Man muss ihm sagen: "Ich kann Ihnen hier etwas anbieten, das Sie vor dem Sekundenherztod sehr, sehr verlässlich schützt. Der Preis dabei ist jedoch, dass Sie u. U. einmal einen Schock zu viel bekommen." Wenn man die Patienten darauf nämlich nicht gut vorbereitet, dann ist das ein fürchterlicher Schreck für den Patienten und verunsichert ihn maßlos und er fragt sich: "Warum bekomme ich da einen Schock? Es hat mir doch gar nichts gefehlt!" Schreglmann: Bevor ich mit Ihnen über alternative Behandlungsmöglichkeiten spreche, würde mich noch interessieren: Was sind denn eigentlich, sofern man das weiß, die Ursachen für diese Herzrhythmusstörungen? Hintringer: Die Ursachen sind sehr vielfältig. Wenn wir mal beim Kammerflimmern bleiben: Da steckt praktisch immer eine strukturelle Erkrankung dahinter. In erster Linie ist das eine Verschlechterung der Pumpfunktion des Herzens infolge eines Herzinfarktes oder infolge anderer sogenannter Kardiomyopathien, also Herzmuskelerkrankungen. Dann gibt es aber auch noch andere Ursachen, von denen vor allem die jungen Patienten betroffen sind. Das sind angeborene Herzrhythmusstörungen wie das sogenannte WPW-Syndrom, das ich vorhin bereits erwähnt hatte: Da ist von der Embryonalentwicklung her eine zusätzliche elektrische Leitungsbahn vorhanden und diese Bahn kann, wenn Sie so wollen, anfallsartig einen Kurzschluss verursachen. Schreglmann: Sie gibt, wenn man das so sagen kann, Fehlimpulse? Hintringer: Das sind keine Fehlimpulse, sondern der richtige Begriff ist der "elektrische Wiedereintrittskreis". Das heißt, durch die vorhin genannten Extrasystolen, die an und für sich harmlos sind … Schreglmann: Extrasystolen sind Extraschläge des Herzens. Hintringer: Diese Extraschläge können dazu führen, dass sich die elektrische Leitung anders durch das Herz bewegt und eine Kreisbahn bildet. Diese Kreisbahn führt zu einem plötzlich einsetzenden Herzrasen, das aber irgendwann auch wieder plötzlich endet. Diese zusätzliche Leitungsbahn ist selbstverständlich zu viel. Hier nun kommt die Katheterablation als Paradedisziplin ins Spiel. Denn so eine zusätzliche Leitungsbahn kann man mit dem Katheter lokalisieren: Mit einem schwachen Stromimpuls in diesem Fall oder durch einen Wechselstromimpuls kann man dann für den Patienten schmerzlos diese Bahn durchtrennen und normale Verhältnisse herstellen. Das ist etwas, bei dem man wirklich eine Heilung erzielen kann. Schreglmann: Wie läuft denn diese Herzkatheterablation, die Sie soeben beschrieben haben, aus der Sicht des Patienten genau ab? Hintringer: Der Untersuchungsraum ist zuerst einmal sehr eindrucksvoll, weil er voll mit medizinisch-technischen Geräten ist. Das Herzstück dabei ist immer eine hochwerte Anlage zur Durchleuchtung. Man kann den Brustkorb und damit das Herz durchleuchten und kann auf diese Weise Katheter, die man zum Herzen vorführt, sichtbar machen. Der Zugangsweg für den Katheter befindet sich üblicherweise im Bereich der Leiste: Dort laufen Vene und Arterie, also die Schlagader, knapp unter der Haut, weswegen man dort nur eine örtliche Betäubung braucht. Die Katheter werden dann – das läuft ungefähr so wie bei einer Punktion, bei einer Blutabnahme – dort in der Leistengegend eingeführt. Schreglmann: Diese Katheter sind winzig klein: Wie klein sind sie genau? Hintringer: Es gibt sie von ungefähr 1,5 bis ungefähr 4 Millimeter. Das heißt, das, was da eingeführt wird, ist schon ein bisschen dicker als die Nadel bei einer Blutabnahme: Das ist auch der Grund dafür, warum man vorher eine Lokalanästhesie, also eine örtliche Betäubung braucht. Diese Prozeduren können, z. B. bei Vorhofflimmern, auch relativ lange dauern, sodass es für die Patienten doch angenehmer ist – und so machen wir das auch bei uns in Innsbruck –, wenn sie zumindest eine oberflächliche Narkose bekommen und diese Untersuchung quasi verschlafen können. Schreglmann: Sie sagen, dass die Patienten diese Untersuchung verschlafen können. Heißt das, sie können auch wach bleiben und das mitverfolgen? Hintringer: Nein, das steuere ich schon, ich sorge schon dafür, dass sie es verschlafen. Das ist einfach eine Frage der Dosierung dieser Medikamente. Bei Kindern ist es grundsätzlich so, dass wir hier immer eine oberflächliche Narkose geben. Bei Erwachsenen hängt es einfach davon ab, was ich mit ihnen vorher besprochen habe. Sehr ängstlichen Menschen werde ich das anbieten, aber an und für sich und objektiv gesehen reicht die örtliche Betäubung der Leiste aus. Schreglmann: Ich frage das nämlich deswegen, weil ich kürzlich mit jemandem gesprochen habe, der so eine Herzkatheterablation hatte und der das Ganze auf einem Monitor mitverfolgt hat. Er konnte genau sehen, was da gemacht wird. Hintringer: Ja, das ist der übliche Vorgang. Wenn aber so eine Prozedur vier Stunden dauert, bei der man flach und absolut regungslos auf dem Rücken liegen muss, ist das halt nicht sehr angenehm. Deshalb neige ich dazu, je komplexer die Prozedur ist, je länger sie dauert, dem Patienten zu raten, sich diese Mittel geben zu lassen, damit er oder sie diese Prozedur verschlafen kann. Schreglmann: Das ist ja eine Sache, bei der man unglaublich viel Fingerspitzengefühl braucht als Arzt. Wie steuern Sie diesen Katheter eigentlich? Hintringer: Ich denke, dass das mit dem Fingerspitzengefühl doch ein bisschen überschätzt wird. Das ist einfach eine handwerkliche Tätigkeit, die erlernbar ist. Und grundsätzlich ist es ja so: Wenn in der Medizin irgendwo von ein paar Genies eine Methode eingeführt wird, die auch nur von denen durchgeführt werden kann, dann wird sich diese Methode allgemein nie durchsetzen. Das ist aber das Tolle an allen Kathetertechniken in der Kardiologie – wir sprechen hier ja jetzt nur über Rhythmusstörungen, aber man kann eben auch die Herzkranzgefäße mit Katheter behandeln –, dass das alles sehr gut reproduzierbare Techniken sind, in denen eigentlich jeder Mensch, der bereit ist, sich zu engagieren, auch ausgebildet werden kann. Aber selbstverständlich ist es auch so, dass man sehr sorgfältig mit dieser Methode umgehen muss, weil man eben auch Komplikationen verursachen kann. Schreglmann: Es gibt hier also auch ein gewisses Risiko, dass das Ganze nicht gut geht. Um dieses Risiko besser verstehen zu können, würde ich gerne von Ihnen erklärt bekommen, was Sie mit diesem Herzkatheter eigentlich genau machen an der entsprechenden Stelle im Herzen. Hintringer: Grundsätzlich ist es so, dass wir in der Katheterablation immer mehrere Katheter brauchen. Das heißt, wir brauchen diagnostische Katheter, die uns eine wertvolle Orientierungshilfe geben und die auch wichtig sind in der Abklärung: Was ist das genau für eine Rhythmusstörung? Und selbst wenn wir wissen, was es für eine Rhythmusstörung ist, müssen wir noch klären, wo genau das Problem sitzt. Dazu brauchen wir also zuerst einmal die diagnostischen Katheter. Der Katheter, den wir dann für die Ablation selbst einsetzen, ist ein Katheter, der entweder über hochfrequenten Wechselstrom durch eine Erhitzung eine Verödung, also eine Gewebeabtötung – wir sagen dazu "Nekrose" – verursacht oder durch Einleitung eines Kältemittels, das aber nicht in den Körper gelangt, sondern sich im geschlossenen System dieses Katheters befindet, eine Erfrierung verursacht. Das heißt, der gemeinsame Endpunkt ist auf jeden Fall, dass wir ganz gezielt kleine Gewebebezirke im Herzen abtöten, nämlich diejenigen, die für die Rhythmusstörung verantwortlich sind, um dann deren Auftreten zu unterbinden. Schreglmann: Es gibt also quasi Gewebe, das abgetötet wird, weil es einen falschen Reiz aussendet. Hintringer: Ja, genau. Schreglmann: Und wenn dieses Gewebe abgetötet ist, dann kommt es in wie viel Prozent der Fälle nicht mehr zu den Herzrhythmusstörungen? Gibt es da genaue Zahlen? Hintringer: Nun, das ist sehr variabel. Bei Herzrhythmusstörungen, die man wirklich heilend angehen kann, wie das beim vorhin genannten WPW-Syndrom der Fall ist, gibt es eine primäre Erfolgsrate von über 95 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass es trotz erfolgreicher Behandlung erneut zu Herzrhythmusstörungen kommt, liegt bei unter drei Prozent. Das ist wirklich ein exzellentes Ergebnis. Die häufigste Herzrhythmusstörung ist aber das Vorhofflimmern: Bei ihr liegt die Erfolgsrate in der Region von 60 bis 70 Prozent. Wenn man diese Prozedur im Abstand von einigen Wochen noch einmal wiederholt, dann kommt man vielleicht auf 70 bis 80 Prozent Erfolgsquote. Dies ist aber auch nur dann der Fall, wenn man die Patienten sehr genau auswählt hinsichtlich der Erfolgsaussichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Wiederauftritt von Herzrhythmusstörungen kommt, liegt hier ebenfalls wesentlich höher: nämlich bei ungefähr 30 bis 40 Prozent. Schreglmann: Vorhofflimmern ist ja ein Problem, das sehr viele Menschen betrifft. Mehr als eine Million Menschen alleine in Deutschland haben damit zu kämpfen. Hintringer: Ja, und das ist wahrscheinlich noch weit unterschätzt. Man kann sich das auch folgendermaßen merken: 5,5 Prozent der 55-Jährigen leiden an Vorhofflimmern. Nicht jeder ist allerdings symptomatisch, das Spektrum der möglichen Beschwerden durch Vorhofflimmern ist sehr, sehr unterschiedlich: Das reicht von einem Zufallsbefund bei einem gesunden Menschen bis zu wirklich hochsymptomatischen Befunden, bei denen die Leute ihrem Beruf nicht mehr nachgehen können. Schreglmann: Danach wollte ich gerade fragen: Wie erleben denn die Patienten das Vorhofflimmern? Wie beeinträchtigt das den Alltag eines Patienten? Hintringer: Das Vorhofflimmern ist dann, wenn es beeinträchtigend ist, immer eine Herzrhythmusstörung, die sehr schnell ist, d. h. der Patient hat ein Herzjagen und das Herz schlägt noch dazu unrhythmisch. Das ist also das ganz Typische für das Vorhofflimmern. Wenn man in Ruhe dasitzt und sich konzentrieren soll, also eine körperlich nicht anstrengende Tätigkeit hat oder wenn man einfach nur Alltag hat und hat dabei aber einen Puls von 130 oder 140, dann fühlt man sich ständig getrieben: Man fühlt sich, als hätte man viel zu viel Kaffee getrunken, d. h. man fühlt sich ständig aufgeputscht. Das ist schon sehr, sehr unangenehm. Und wenn man sich in so einem Moment auch noch belastet, weil man eine körperlich anstrengende Tätigkeit hat oder weil man seinen Sport machen möchte, dann wird es kritisch. Wenn man da nämlich anfängt, aus der Ruhe heraus Sport zu betreiben, wenn man bereits einen Ruhepuls von 130 hat, der noch dazu unrhythmisch geht, dann ist man irrsinnig schnell auf knapp 200 Pulsfrequenz. Damit ist man in einem Bereich, in dem das Herz unökonomisch arbeitet, in dem man sich sehr, sehr rasch erschöpft. Da kommt also wirklich eine starke Reduktion der Belastbarkeit hinzu. Schreglmann: Der Leidensdruck scheint also relativ hoch zu sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Patienten, wenn Sie zu Ihnen in die Beratung kommen, nicht alle sofort sagen: "Klar, Sie haben jetzt die Herzkatheterablation so schön erklärt. Da begebe ich mich doch gerne in den Operationssaal und Sie machen mal." Stattdessen ist da vermutlich doch eine ganz schöne Hürde vorhanden. Hintringer: Es ist mir auch wirklich ein Anliegen, vorher mit dem Patienten darüber zu sprechen. Uns werden ja häufig Patienten mit Vorhofflimmern von anderen Ärzten überwiesen. Und weil es da viel zu besprechen gibt mit den Patienten, ist es bei uns in der Klinik die Regel – und von dieser Regel abzuweichen, sind wir bisher nicht bereit –, dass die Patienten vorher, und das selbst dann, wenn sie von weit her anreisen, zu uns in die Ambulanz kommen müssen. Dort in der Ambulanz führen wir dann ein ausführliches Gespräch mit ihnen. Denn das Ausmaß der Beeinträchtigung durch das Vorhofflimmern ist sehr unterschiedlich, d. h. es gilt zunächst einmal mit dem Patienten zu klären, wie schwerwiegend seine Symptome sind. Es gilt auch zu klären, was die mögliche Ursache ist: Es könnte z. B. ein ernsthaftes Herzleiden dahinterstecken und dann wäre die Behandlung eine ganz andere. Die Patienten, die hoch symptomatisch sind und deren Herzstruktur gleichzeitig gesund ist, sind diejenigen, bei denen die Katheterablation prinzipiell infrage kommt. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, und manchmal ist das die einzige Option, das Vorhofflimmern als chronischen Rhythmus nur mit Medikamenten zu kontrollieren: Das kann man damit kontrollieren, aber man bekommt es damit nicht weg. Oder man verabreicht Rhythmusmedikamente, um den regulären Rhythmus, also den Sinusrhythmus, wieder herzustellen. Das ist eine weitere Alternative zur Katheterablation. Schreglmann: Sie haben soeben die Medikamente als alternative Behandlungsweise genannt. Aber offenbar ist man damit als Patient oft nicht so zufrieden, denn sonst gäbe es ja die Katheterablation nicht. Hintringer: Ja, das ist genau der wesentliche Antrieb dafür, dass sich die Katheterablation so stark entwickelt hat und dass so viele Anstrengungen in die Weiterentwicklung gesteckt werden. Es ist leider so, dass wir vor wenigen Jahren ein neues Rhythmusmedikament zur Verfügung bekommen haben: Das war seit vielen, vielen Jahren die erste Neuentwicklung, die es wirklich bis auf den Markt geschafft hat. Dieses Medikament ist zwar im Hinblick auf die potentiellen Nebenwirkungen akzeptabel, aber leider ist es ein Medikament, das bei Weitem nicht allen Menschen hilft. Das heißt, wir brauchen die Katheterablation als eine Alternative. Die Erfolge der Katheterablation haben sich schrittweise verbessert über die letzten Jahre, sodass der Schritt zur Katheterablation heute wesentlich früher unternommen wird, als das noch vor zehn Jahren der Fall gewesen ist. Schreglmann: Die Nebenwirkungen von Herzmedikamenten sind, nach dem, was ich weiß, ja auch nicht zu unterschätzen. Hintringer: Genau. Schreglmann: Die Betablocker z. B. können wiederum der Lunge schaden. Hintringer: Ja, bei Menschen, die bereits von vornherein verengte Bronchien haben, kann das zu einer weiteren Verengung führen, das ist richtig. Aber die Betablocker sind beinahe noch das Harmloseste, was es diesbezüglich gibt. Denn die Verengung der Bronchien geht wieder weg, wenn man den Betablocker absetzt. Aber es gibt hier noch viel, viel toxischere Medikamente, es gibt z. B. das sogenannte Amiodaron: Das ist ein Medikament, das Schilddrüsenüberfunktion erzeugen kann oder Lungenfibrose, also Veränderungen an der Lunge, die nicht mehr rückbildungsfähig sind. Das ist kein Medikament, das man einem Patienten gerne langfristig gibt, sondern das ist ein Medikament, das man bestenfalls als eine Überbrückung verwendet. Schreglmann: Wenn sich ein Patient aufgrund der von Ihnen gerade genannten Gründe entscheidet, von Ihnen eine Katheterablation machen zu lassen, dann wird er ja auch darüber informiert, dass es wie bei jedem Eingriff auch hier ein gewisses Risiko gibt. Wie hoch ist denn dieses Risiko? Haben Sie es denn selbst schon mal erlebt, dass dabei etwas schiefgegangen ist? Hintringer: Eine schwerwiegende Komplikation – so formuliere ich das im Gespräch mit dem Patienten immer – ist eine Komplikation, bei der sich der Patient wie auch ich als Arzt sagen: "Hätten wir doch lieber die Ablation gar nicht gemacht." Solche schwerwiegenden Komplikationen treten mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Prozent auf: 2 von 100 Patienten erleiden eine solche Komplikation. Das ist im Vergleich zu chirurgischen Eingriffen nicht so dramatisch, aber nachdem man ja beim Vorhofflimmern in den allermeisten Fällen auch die Möglichkeit hätte, eine Katheterablation nicht durchzuführen, muss man den Patienten natürlich besonders sorgfältig über diese Komplikationen aufklären. Das kann z. B. ein Schlaganfall sein, das kann eine schwerwiegende Verletzung der Herzwand sein, sodass es nach außen blutet und ein Kreislaufschock entsteht. Schreglmann: Haben Sie es denn schon mal erlebt, dass etwas schiefgelaufen ist? Hintringer: Selbstverständlich, und man sollte sich hüten zu behaupten, für einen selbst würde diese Statistik nicht gelten. Natürlich habe auch ich schon Fehler gemacht oder es sind Komplikationen, wenn Sie so wollen, schicksalshaft eingetreten. An solche Patienten erinnert man sich selbstverständlich besonders gut: Das geht einem auch nicht aus dem Kopf. Schreglmann: Wie wird man damit fertig? Hintringer: Man versucht, sich vor sich selbst zu rechtfertigen, indem man sich vor allem sagt: "Ich habe mit dem Patienten vorher wirklich alles genau besprochen. Wir haben beide, nämlich der Patient und ich, gewusst, auf was wir uns einlassen." Das Zweite ist, dass man sich halt sehr kritisch fragt: "Habe ich einen Fehler gemacht? War ich irgendwo schlampig? Oder habe ich u. U. auch wissentlich gegen die Regeln der ärztlichen Kunst verstoßen?" Wenn ich diese Dinge für mich alle abhaken kann, wenn ich mir also sagen kann: "Das habe ich alles ordentlich gemacht!", dann ist das schon mal eine große Erleichterung. Es ist aber auch ganz wichtig, dass man in solchen Fällen einen Ansprechpartner hat. Das Allerschlimmste ist, wenn am nächsten Morgen in der täglichen Morgenbesprechung irgendjemand aufsteht, Vorwürfe erhebt und sagt: "Du, bei mir wäre das nie passiert!" Natürlich weiß man, dass das nicht stimmt. Stattdessen ist es eben viel besser, wenn man da jemanden hat, der einem auf die Schulter klopft und sagt: "Ich weiß, du hast das gut gemacht oder du hast das zumindest gut gemeint! Und ansonsten ist das halt einfach tragisch." Schreglmann: Gibt es so jemanden bei Ihnen? Hintringer: Das betrifft etwas, was unser Chef immer sehr kultiviert hat. Er ist streng und verlangt auf jeden Fall, dass man die eigene Arbeit ordentlich erledigt. Aber er ist keiner, der dann Vorwürfe erhebt. Er will lediglich genau wissen, was passiert ist. Ich habe es mir auch angewöhnt, dass ich ihn, wenn es eine Komplikation gibt bzw. gegeben hat, als Allerersten darüber informiere. Es kommen da aber auch noch andere Dinge hinzu. Das schlechte Gewissen, das man hat, die Betroffenheit und eben auch die Angst, ob das strafrechtliche Konsequenzen hat für mich. Da greift dann also auch irgendwann der Selbstschutzreflex. Schreglmann: Der Beruf, den Sie haben, ist wirklich sehr, sehr verantwortungsvoll. Ich kann mir vorstellen, dass man für diesen Beruf sehr starke Nerven braucht. Hintringer: Das ist ein bisschen überschätzt. Ein Pilot braucht auch starke Nerven oder ein Lokomotivführer. Schreglmann: Gut, aber die operieren beide nicht am lebenden Herzen – ohne deren Arbeit kleinreden zu wollen. Hintringer: Ja, schon. Aber ein Flugzeug kann eben auch abstürzen oder eine Lok kann entgleisen. Aber das ist ja auch das Schöne an so einem Beruf, dass er einen emotional auf keinen Fall gleichgültig lässt: So einen Beruf lebt man. Schreglmann: Nun sind Sie ja nicht nur Arzt an der Uniklinik, sondern Sie versuchen auch noch in einer anderen Hinsicht die Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern, und zwar durch eine Innovation, die Sie gerade einführen und bei der Sie auch unternehmerisch tätig sind. Hintringer: Ich bin Mitgründer eines Start-up-Unternehmens und ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Es ist so, dass aus der Beschäftigung mit der Katheterablation und auch aufgrund der Situation speziell bei Vorhofflimmern, mit dem wir so häufig konfrontiert sind, die Behandlungsergebnisse nicht so gut sind, wie wir das von anderen Anwendungen in der Katheterablation kennen. Daraus ergeben sich eben verschiedene Ideen, wie man es besser machen könnte. Einen Großteil dieser Ideen muss man aber sofort wieder verwerfen, weil sie sich doch nicht als so gut herausstellen. Letztlich hat das aber dann mal dazu geführt, dass ich mir ein Design, eine Form eines Katheters ausgedacht habe. Anschließend habe ich dann in der Medizintechnikindustrie eine deutsche Firma angesprochen deswegen. Letztlich ist das Ganze dann in einem Patent gemündet. Dieses Patent ist mittlerweile auch erteilt: Wir sind sehr stolz darauf, dass es in Europa und in den USA erteilt worden ist. Ich habe damals aber nicht daran gedacht, das mit einem eigenen Unternehmen zu verfolgen, sondern ich habe mir gedacht: "Gut, ich mache da halt eine Erfindungsmeldung bei einem Unternehmen und dieses Unternehmen greift dann meine Idee auf." Das hat diese Firma auch durchaus gemacht, denn sie hat die ersten Schritte für die Patentierung in die Hand genommen. Aber aus diversen Gründen hat diese Firma dieses Projekt dann nicht weiter verfolgt. Ich habe daraufhin von meinem Recht, das in einem Erfindervertrag niedergeschrieben war, Gebrauch gemacht und gesagt: "Ich möchte die Rechte dieses Patents auf mich übertragen haben." Diese Rechte habe ich dann eingebracht in ein Start-upUnternehmen, das ich mit einem Elektrotechniker gegründet habe, mit dem ich in der Wissenschaft bereits vorher sehr viel zusammengearbeitet habe, den ich also bereits sehr gut gekannt habe. Und so haben wir 2005 ein Unternehmen gegründet, das mittlerweile recht gut gewachsen ist: Inzwischen beschäftigen wir nämlich bereits 13 Mitarbeiter. Wir arbeiten in diesem Unternehmen an der Entwicklung eines Kathetersystems zur Behandlung von Vorhofflimmern, das die Prozedur sehr stark vereinfachen soll – und wir sind auch überzeugt davon, dass das der Fall sein wird, denn unsere ersten Tests haben das gezeigt. Wir arbeiten mit Kälte, und das ist das Besondere daran. Nur noch eine andere Firma außer uns setzt in diesem Bereich Kälte ein, verwendet also auch nicht, wie sonst üblicher, Strom. Schreglmann: Das bedeutet, dass bei der Katheterablation im Herzen die entsprechenden Stellen nicht mit Hilfe von Hitze verödet werden, sondern mit minus 80 Grad, wie ich gelesen habe. Hintringer: Ja, das ist richtig. Das funktioniert nach dem sogenannten JulesThompson-Effekt. Auch das ist etwas, was ich erst im Laufe meines "zweiten Lebens" als Gründer eines Start-up-Unternehmens gelernt habe. Das heißt, man leitet ein Kältemittel – in diesem Fall ist das verflüssigtes Lachgas – in einen Hohlraum in einem Katheter. Dort kann die Flüssigkeit expandieren und in den gasförmigen Zustand übergehen. Das braucht sehr viel Energie und diese Energie wird in Form von Wärme der Umgebung entzogen. Das heißt, dort, wo der Katheter Kontakt hat mit dem Gewebe, entsteht eine Erfrierung durch diese Abkühlung auf etwa minus 80 Grad. Schreglmann: Und warum ist hier Kälte besser als Hitze? Hintringer: Dieses Katheterdesign, wie ich mir das ausgedacht habe und wie wir das dann gemeinsam weiterentwickelt haben, lässt sich mit Hitze, mit Strom nicht realisieren. Warum? Wir können mit diesem Katheter auf einer Länge von zehn Zentimetern auf einmal eine Verödung machen und müssen mit dem Katheter nicht Punkt für Punkt arbeiten. Und wenn man einen Katheter von dieser Länge – das ist ja eine Schlaufe von zehn Zentimetern Länge – mit lauter kleinen Elektroden versehen will, dann braucht man dafür irrsinnig viele Kabel, die man dort zu den Elektroden hinleiten muss. Das heißt, dieser Katheter würde sehr, sehr steif werden. Das war der Hauptgrund, warum wir uns auf Kälte festgelegt haben. Der zweite Grund ist: Es gibt – allerdings nicht durch in großen Studien verifizierte Daten – Hinweise darauf, dass die Kälte schonender ist. Wenn man unter dem Mikroskop Gewebe betrachtet, das mit Hitze verödet wurde, und das dann vergleicht mit Gewebe, das mit Kälte verödet wurde, dann stellt man fest: Bei der Hitze schaut das Gewebe quasi wie nach einem Bombeneinschlag aus. Das Ergebnis soll ja auch das zerstörte Gewebe sein, also wäre das ja eigentlich in Ordnung. Bei der Kälte ist es so, dass man auch da lauter tote Zellen findet, dass aber darüber hinaus die Struktur des Gewebes erhalten geblieben ist. Das heißt, die mechanische Widerstandsfähigkeit bleibt dadurch besser erhalten und damit ist das Risiko einer Perforation als Komplikation bei der Behandlung möglicherweise geringer. Bei der Kälte wird auch die Herzinnenhaut weniger beschädigt, wodurch sich wiederum weniger Blutgerinnsel bilden. Das heißt, möglicherweise gibt es bei der Verödung mit Kälte auch ein geringeres Schlaganfallrisiko. Das sind allerdings alles Dinge, die auf experimentellen Daten beruhen und die nicht in großen Studien in irgendeiner Weise validiert sind. Schreglmann: Bei dem Wort "Bombeneinschlag im Herzen" zuckt vermutlich jeder Patient bzw. Herzleidende zu Hause vor dem Bildschirm zusammen. Wie geht denn das Herz mit diesem abgestorbenen Gewebe eigentlich um? Wird das abgebaut? Verheilt das alles irgendwie? Hintringer: Das wird zu einer Narbe umgebaut, so wie man das z. B. auch kennt, wenn man sich an der Hand verletzt. Das heißt, es wächst keine Muskulatur mehr nach – das sollte auch nicht sein, denn sonst hätten wir ja wieder das gleiche Problem. In manchen Fällen wächst aber die Muskulatur doch und zu gut nach und deswegen gibt es dann das Wiederauftreten der Herzrhythmusstörungen. Aber normalerweise wird das in Form von Bindegewebe ersetzt und bildet dann eine hoffentlich bleibende elektrische Barriere gegen die Ausbreitung der Herzrhythmusstörungen. Schreglmann: Sie haben ja nun etwas Neues erfunden. Wie und wann kam Ihnen denn diese Idee? Hintringer: Das Ganze ist nun fast schon wieder zehn Jahre her, 2003 hatte ich den ersten Kontakt mit diesem Unternehmen aus der Medizintechnik. Die Überlegungen dazu hatte ich im Jahr 2002 und 2003. Das war aber damals nur eine Idee. Bis man aus einer Idee dann aber ein funktionstüchtiges System entwickelt, das dauert ewig. Dafür bin ich als Arzt auch nicht die geeignete Person, sondern da braucht man eben einen Partner, der etwas von der Technik versteht. Dieser Partner hat natürlich in diesem Entwicklungsprozess auch sehr viel für sich selbst gelernt. Das geht auch nur mit einem Team von sehr, sehr tüchtigen Ingenieuren, die alle aus der Forschungsgruppe meines Co-Gründers stammen, weil es nämlich extrem schwierig ist, einfach so Entwicklungsingenieure zu finden. Man braucht darüber hinaus auch noch einen Kaufmann, der dafür sorgt, dass das Organisatorische und Finanzielle funktioniert. So etwas ist also viel, viel komplexer, als ich mir das 2003 vorgestellt habe. Schreglmann: Sie üben also nicht nur Ihre medizinische Tätigkeit in der Uniklinik Innsbruck aus, sondern haben auch noch diese unternehmerische Tätigkeit. Wie kombinieren Sie beides? Wie bekommen Sie das vor allem zeitlich auf die Reihe? Hintringer: Zeitlich ist es schwierig, das ist richtig. Denn ich habe eine normale Dienstverpflichtung an der Universitätsklinik. Schreglmann: Und eine Familie mit Kindern. Hintringer: Ja, eine Familie habe ich auch. Stressen tut mich das deshalb nicht, weil das so ein wunderbarer Kontrast ist. Es geht jedem in seinem Beruf so, dass er manchmal frustriert ist: Das geht mir in der Medizin auch so und das geht mir auch in unserem Start-up-Unternehmen so. Aber wenn ich dann immer wieder die Fronten wechseln kann, dann ist das jedes Mal eine wunderbare Ablenkung. Und ich muss sagen, das lässt sich in der Tat unter einen Hut bringen. Aber das geht natürlich nur, wenn man Gleichgesinnte um sich hat, wie das bei mir mit meinem Gründerpartner und diesem ganzen Team in dieser Firma der Fall ist. Sie alle müssen mitziehen. Ich als Arzt bin ja denkbar ungeeignet, um Entwicklungstätigkeit zu leisten, denn ich habe das ja alles nicht gelernt und verstehe das nur ganz am Rande. Schreglmann: Wie weit sind Sie denn inzwischen mit Ihrer Entwicklung? Denn einige brennen bestimmt schon darauf, sich damit behandeln zu lassen, um Probleme, die es mit der herkömmlichen Behandlung gibt, nicht mehr zu haben. Hintringer: Es ist so, dass wir nun die gesamten In-vitro-Tests abgeschlossen haben, also die ganzen Labortests: Wie hoch ist die Kühlleistung? Bringe ich die Kühlleistung wirklich effektiv an die Katheterspitze? Das Gerät, das diesen Katheter mit dem Kühlmittel versorgt, die sogenannte Konsole, ist ja auch etwas, das wir selbst entwickeln mussten. Hier muss man sehr viele Sicherheitsfeatures vorsehen, damit dieses Gerät im Falle eines Fehlers am Katheter sofort die Kühlmittelzufuhr stoppt. Die Konsole ist überprüft vom TÜV, sodass wir eine provisorische Genehmigung haben, es auch klinisch, also am Menschen, anzuwenden. Beim Katheter ist die Prüfung beim TÜV derzeit im Gange: Die Serienfertigung ist nun gerade angelaufen und wir sind mittendrin, diese Katheter aus der Serienfertigung zu testen, um zu zeigen, dass die genauso gut funktionieren wie die Katheter, die wir bisher mit der Hand gefertigt haben, damit wir dann hoffentlich im zweiten Quartal 2012 die erste klinische Anwendung im Rahmen einer wirklich streng kontrollierten Studie durchführen können. Schreglmann: Irgendeiner muss dann ja zwangsläufig der erste Patient sein. Hintringer: Ja. Schreglmann: Erklärt sich so jemand selbst dazu bereit? Oder wie funktioniert so etwas? Hintringer: Patienten sind heutzutage erstaunlich gut informiert. Ich trenne meine klinische Tätigkeit streng von meiner Tätigkeit als Gründer eines Start-upUnternehmens, d. h. ich spreche keinen Patienten in der Ambulanz oder während eines stationären Aufenthalts an, sage ihm also nicht: "Äh, ich hätte da auch noch etwas …" Ich müsste dann ja auch noch dazusagen, dass ich mit dem, was ich da hätte, später auch noch gerne Geld verdienen möchte. Nein, so geht das nicht und so mache ich das nicht. Stattdessen ist es so, dass Patienten zu mir kommen, mit mir das Gespräch führen und mich dann fragen: "Und was ist mit Ihrem Katheter? Ich habe das im Internet gefunden." Und so haben wir tatsächlich bereits Patienten, die gesagt haben: "Wenn es diesen Katheter eines Tages gibt, möchte ich mich hiermit schon mal anmelden!" Schreglmann: Sie haben also inzwischen bereits eine Warteliste? Hintringer: "Warteliste", das wäre übertrieben. Und das mache ich ja auch nicht. Ich darf auch aus ethischen Gründen erst damit arbeiten, wenn die Ethikkommission der Universität gesagt hat: "Diese Studie ist unbedenklich!" Erst wenn ich das schriftlich vorliegen habe, darf ich von mir aus einen Patienten ansprechen. Das ist also bisher eine völlig informelle Sache. Sie können sich sicherlich vorstellen, wie sorgfältig ich dann jemanden aufklären werde, der in diese Studie kommt. Ich werde ihm ganz genau sagen: "Sie sind einer der Ersten bzw. sogar der überhaupt Erste!" Sie können sich sicherlich vorstellen, wie nervös ich dann sein werde, wenn es so weit ist. Schreglmann: Dafür drücken wir Ihnen jetzt schon die Daumen. Jetzt kenne ich ja bereits mindestens zwei Gründe, warum es für Sie Sinn hat, in Innsbruck zu bleiben: erstens Ihre Tätigkeit an der Uni-Klinik und zweitens Ihr Start-upUnternehmen. Aber ich weiß auch, dass Sie recht gerne im Ausland unterwegs sind. Sie haben in Ihrer Jugend längere Zeit in München gelebt, Sie waren dann nach dem Studium in London und haben dort an der Klinik gearbeitet. Und Sie haben ein Herz für Afrika. Erklären Sie uns das doch bitte. Hintringer: Ja, ich habe ein Herz für Afrika, das stimmt. Dem sind aber bisher leider keine konkreten Taten gefolgt. Ich habe mir, während ich studiert habe, immer gewünscht, dass ich, bevor ich mich auf eine Fachdisziplin fokussiere, ein paar Jahre in Afrika verbringe und dort irgendwo auf dem Land Entwicklungshilfe mache. Schreglmann: Um etwas Gutes für die Welt zu tun oder weil Afrika so ein faszinierendes Land ist? Hintringer: Weil Afrika so faszinierend ist. Ich glaube, das hatte doch mehr mit meinem Egoismus zu tun und weniger mit Samaritertum. Das Ganze kommt natürlich aus meiner Kindheit und z. B. so berühmten Filmen wie "Serengeti darf nicht sterben" von Bernhard Grzimek. Letztlich ist das also schon eine sehr romantische Verklärung. Nach dem Abitur bin ich dann mit zwei Freunden tatsächlich mit dem Rucksack in Ostafrika unterwegs gewesen. Eine meiner großartigsten Erinnerungen daran ist der Sonnenaufgang knapp unterhalb des Kraterrands des Kilimandscharo: Das war einfach großartig. Aber ich habe mich dann nicht getraut, diesen Schritt zu machen und wirklich nach Afrika zu gehen und dort zu arbeiten. Ich bin dann auch sehr jung Vater geworden und hatte daher damals schon eine Tochter. Ich hätte überhaupt keine Bedenken gehabt, sie nach Afrika mitzunehmen, aber ich hatte Angst davor, das damals bereits vorhandene Angebot, Kardiologe zu werden, auszuschlagen und zu sagen: "Ich gehe jetzt erst einmal drei Jahre lang nach Afrika und komme dann wieder und mache hier weiter." Ich hatte einfach Angst davor, danach nicht mehr Fuß fassen zu können, weswegen ich mich sozusagen für die leichtere Variante entschieden habe und die Gelegenheit, Kardiologe zu werden, genützt habe. Ich bereue das auch bis heute nicht, aber es gibt halt in mir bis heute diese unterschwellige Sehnsucht, Afrika mal richtig kennenzulernen. Schreglmann: Wie ist das mit Urlauben? Könnten Sie sich nicht mal ein paar Wochen freimachen und nach Afrika reisen? Hintringer: Ein paar Wochen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein richtiger Urlaub im Sommer geht auf jeden Fall. Das ist mir auch extrem wichtig, denn das ist jedes Mal so eine Art "Mini-Aussteigen" für mich. Die erste Woche im Urlaub ist zwar noch nicht wirklich Urlaub, aber so aber der zweiten Woche kann ich dann doch loslassen. Andererseits ist man aber heutzutage über Internet und Mobiltelefon auch immer gut erreichbar. Für die Firma bin ich immer erreichbar, auch wenn ich im Urlaub bin, und das stresst mich auch nicht. Aber ich bin schon sehr, sehr froh darüber, dass es in der Klinik sehr kompetente Kollegen gibt, die ich gerne mag und denen ich voll vertraue, sodass ich weiß, dass ich auch mal für drei Wochen in der Klinik nicht gebraucht werde und daher was ganz anderes machen darf. Schreglmann: Nun leben Sie ja im schönen Tirol, wo man outdoor sehr viel machen kann. Machen Sie das zum Ausgleich? Hintringer: Ja, das genieße ich auch sehr und das würde mir sehr, sehr fehlen, wenn ich woanders hingehen würde. Wenn es im Sommer länger hell ist, kann man in Innsbruck um sechs Uhr abends aus der Universitätsklinik gehen, aufs Mountainbike steigen, um dann über irgendeine Alm zwei Stunden lang einen Ausflug zu machen, sodass man wunderbar erholt zu Hause ankommt: Man ist friedlich und hat den Kopf komplett frei. Das ist wunderbar. Schreglmann: Das machen Sie? Hintringer: Ja. Schreglmann: Sie steigen also nach Ihrem Klinikalltag aufs Mountainbike und fahren los? Hintringer: Ja, das gönne ich mir mindestens einmal die Woche. Schreglmann: Respekt! Das ist vermutlich auch ein gutes Training fürs Herz, oder? Das ist doch das, was man den Leuten immer empfiehlt: sich zu bewegen. Hintringer: Absolut. Bewegung ist eine der wichtigsten therapeutischen Maßnahmen. Wir haben in Tirol, das ist mir aber erst aufgefallen, als ich dort hingekommen bin, extrem viele Leute, die wirklich sehr, sehr fit sind. Wenn ich da noch einmal kurz aufs Vorhofflimmern zurückkommen darf: Auch fitte, völlig gesunde Leute können vom Vorhofflimmern betroffen sein. Da gibt es Menschen, die bereits 70, 75 Jahre alt sind und durch dieses Vorhofflimmern massiv beeinträchtigt. Es gibt viele, die über so jemanden sagen: "Na, der muss in dem Alter aber nicht mehr mit dem Mountainbike durch die Gegend fahren!" Aber das macht einfach einen Teil der Lebensqualität für diesen Menschen aus. Zumindest für einen Teil der Bevölkerung ist es eben auch der Lebensstil, der die Lebensqualität ausmacht. Dementsprechend muss man eben auch die Entscheidung hinsichtlich einer Katheterablation oder sonstiger Therapien nach der biologischen und nicht nach der kalendarischen Uhr eines Menschen treffen. Schreglmann: Kann man denn nach so einem Eingriff wieder eine doch recht anstrengende Tour mit dem Mountainbike unternehmen? Hintringer: Ja, absolut und das ist auch das Ziel. Man kann bei Vorhofflimmern – sofern man durch Blutverdünnung dafür sorgt, dass jemand keinen Schlaganfall bekommt und das Herz im Vorhofflimmern nicht zu schnell geht – durchaus für ein langes Leben sorgen. Aber man kann eben kein so aktives Leben führen. Und genau das ist ja oft das Ziel bei einer Behandlung des Vorhofflimmerns: Es geht nicht so sehr darum, das Leben des Patienten zu retten … Schreglmann: … weil das Vorhofflimmern gar nicht so lebensbedrohend ist. Hintringer: Genau, weil es nicht so lebensbedrohend ist. Wobei ich hier aber die Einschränkung machen muss, dass es eben schon auch um den Schutz vor einem Schlaganfall geht. Stattdessen geht es bei einer Behandlung des Vorhofflimmerns darum, dem betreffenden Menschen die Lebensqualität wieder zurückzugeben. Und nachdem wir ja nicht den Brustkorb eröffnen müssen, denn wir schneiden ja nirgendwo hinein, ist die Rekonvaleszenz nach so einem Eingriff natürlich sehr kurz. In Bezug auf das Herz braucht man da eigentlich überhaupt keine Erholungszeit, aber aufgrund der Punktion der Leiste, bei der eben doch auch mal ein kleiner blauer Fleck entstehen kann, rate ich den Patienten doch immer, sieben Tage lang mit dem Sport Pause zu machen. Aber danach können sie wieder machen, was sie wollen. Wir hatten schon Patienten mit Katheterablation aufgrund von Vorhofflimmern, die dann nachher sogar Achttausender bezwungen haben. Schreglmann: Tatsächlich? Mit diesen Menschen stehen Sie also noch weiterhin in Kontakt? Hintringer: Ja, auf die bin ich natürlich besonders stolz. Einen davon habe ich sogar mal im Fernsehen gesehen. Schreglmann: Gut, dann kann man Ihnen dazu nur gratulieren! Ich wünsche Ihnen sowohl indoor wie auch outdoor viele schöne Erlebnisse und Erfolge. Ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. © Bayerischer Rundfunk