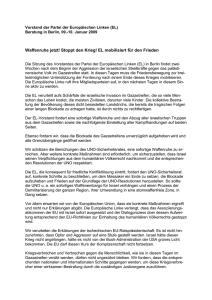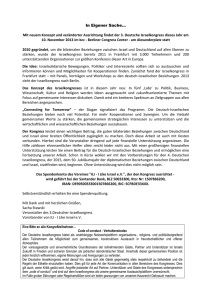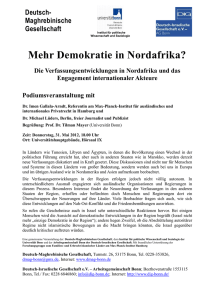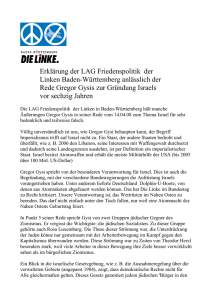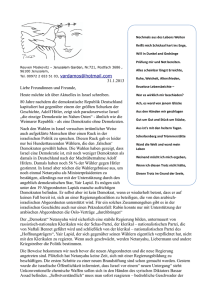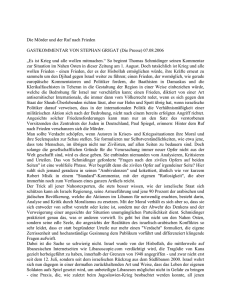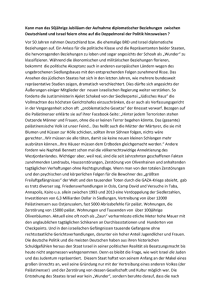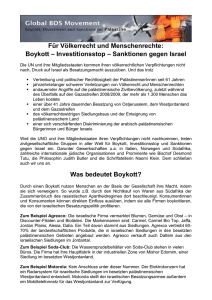Word-File
Werbung

Den Frieden mit der Seele suchen Links, religiös und feministisch: Der rote Faden in Alice Shalvis Leben heisst Gerechtigkeit. Eine aussergewöhnliche Israelin war in Zürich zu Gast. Von Daniela Kuhn Tages Anzeiger, 28.05.03 In England habe sie sich immer als sehr klein erlebt, erst in Israel sei ihr ihre Körpergrösse normal vorgekommen. Alice Shalvis Augen lachen, als sie nach einer kurzen Siesta in der Hotellobby erscheint. Am Morgen ist sie aus Berlin angekommen, wo sie am europäischen jüdisch-feministischen Kongress Beth Deborah teilgenommen hat. Das Tagungsthema «Macht und Verantwortung» war von ihr angeregt worden - es ist ihre Passion. So dominierte es auch den Montagabend im Restaurant «Falcone», als sich TA-Redaktorin Claudia Kühner mit Alice Shalvi unterhielt. Eingeladen hatte die Gruppe «Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina». Shalvi wurde gebeten, Deutsch zu sprechen, doch erklärtermassen hätte sie den Abend lieber auf Englisch bestritten, in der Sprache, in der sie zu Hause ist. Geistig freiere Frauen 1926 in Essen geboren, emigrierte sie 1934 mit ihrer Familie nach London. Nach dem Soziologiestudium in Cambridge wanderte sie 1949 nach Israel aus. Am neu eingerichteten englischen Seminar der Hebräischen Universität in Jerusalem unterrichtete sie Englisch, aus den improvisierten Stunden wurde eine Professur. Daneben amtierte sie von 1975 bis 1990 als Rektorin der experimentellen Mittelschule Pelech für religiöse Mädchen, 1984 war sie Mitinitiantin bei der Gründung der Frauenrechtsbewegung «Israel Women?s Network», und 1997 wurde sie erste Rektorin eines modern orthodoxen Rabbinerseminars, in dem Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Ihr Motto: «Wissen ist Macht.» Doch sie betont auch ihr «Glück»: All dies habe sie nur tun können, weil ihr Mann sie im Haushalt und in der Betreuung der sechs Kinder stets unterstützt habe: «Für seine Generation ist er aussergewöhnlich.» Dabei war ihr das gar nicht immer bewusst. «Bis 1973 habe ich gedacht, in Israel sei eine Gleichstellung zwischen den Geschlechtern bereits erreicht, doch immer mehr sah ich, dass wir davon sehr weit weg waren - und sind: Frauen erhalten heute gerade 68 Prozent des Lohns, den ein Mann für dieselbe Arbeit erhält.» Ebenso problematisch ist die Schlüsselrolle der Armee in der israelischen Gesellschaft. Nicht zufällig haben die meisten Politiker eine Berufsmilitärkarriere hinter sich. Hohe militärische Ränge sind sozusagen das Eintrittsticket in die Politik, aber auch für andere wichtige Funktionen der Zivilgesellschaft. Aus diesem Grund setzte sich Shalvi dafür ein, dass Frauen im Militär in Bereiche vordringen können, die bisher Männern vorbehalten waren. Halb ernst, halb scherzend zitiert sie das englische Sprichwort «If you can?t beat them, join them». Ein Militärfan ist sie deshalb keineswegs, vielmehr befürwortet sie einen freiwilligen Militärdienst. Gerade weil Frauen weniger im militärischen System eingebunden seien, könnten sie unabhängiger denken. Dies sei auch der Grund, weshalb in der Friedensbewegung mehr Frauen aktiv seien - von ihnen ist allerdings nur eine Minderheit religiös. «So deprimierend war es noch nie» «Die religiöse Linke macht eben weniger Lärm», meint Shalvi. Kürzlich freute sie sich aber über ein in israelischen Zeitungen publiziertes Manifest, das 170 junge religiöse Menschen unterschrieben haben. Obwohl aus der Siedlerbewegung stammend, wollen sie damit die religiöse Öffentlichkeit auf den unwürdigen Umgang mit den Palästinensern aufmerksam machen. Vor 15 Jahren war Shalvi verändert von einem Treffen zwischen israelischen und palästinensischen Frauen in Brüssel nach Hause zurückgekehrt, zum ersten Mal hatte sie die andere Seite verstanden. Die Kontakte sind heute spärlicher geworden, man lebt im Abstand von wenigen Kilometern, sich zu treffen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. «Die anderen verstehen», so einfach dies klingt - wer von Angst geleitet wird, scheitert. Shalvi spricht vom «nachvollziehbaren Verfolgungswahn, an dem beide Seiten leiden». Obwohl ihr klar ist, dass es eine Zweistaatenlösung geben muss, mag sie Ariel Sharon nicht trauen: «There is quite a way to go», meint sie, ein langer Weg stehe noch bevor. Schlimmer noch als der Zusammenbruch der Wirtschaft scheint ihr der moralische Zerfall, der mit jüdischer Ethik nicht zu vereinbaren sei: «Die Okkupation führt zu einer Entmenschlichung, zur Brutalisierung der Besatzer. Bei den Palästinensern stehen Demütigungen auf der Tagesordnung, bei uns ist es die permanente Angst vor Selbstmordattentaten. Seit ich in Israel lebe, war die Stimmung noch nie so deprimierend. Die letzten zweieinhalb Jahre waren der Tiefpunkt.» Dennoch hofft sie auf bessere Zeiten. Hätte sie Verständnis, wenn eines ihrer 21 Enkelkinder aus Israel wegziehen würde? Sie lächelt: «Ich wäre enttäuscht.»