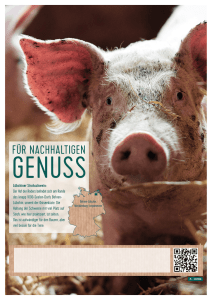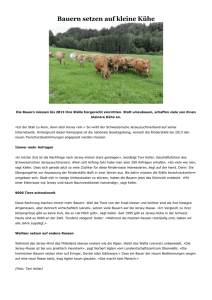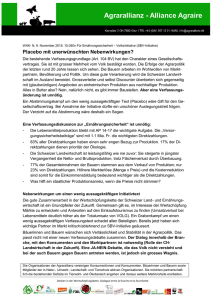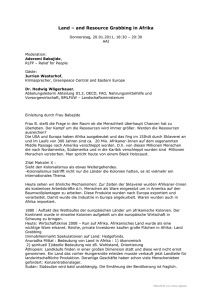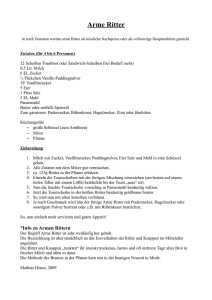Roland Müller Franziska von Westerholt Historischer Roman Drittes
Werbung
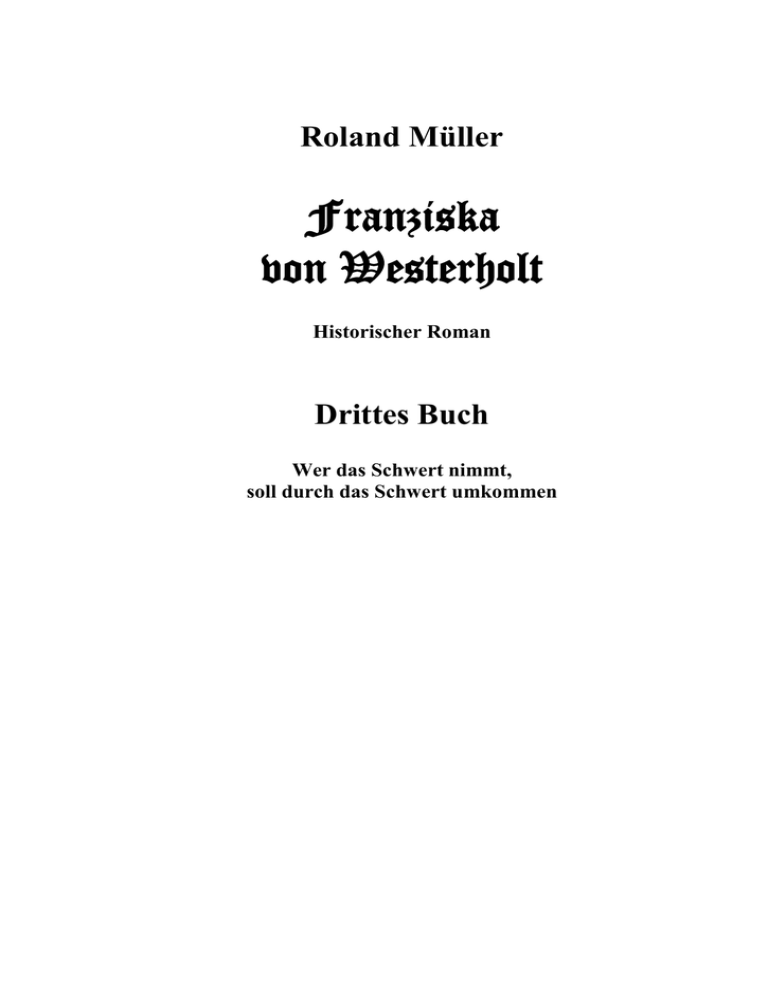
Roland Müller Franziska von Westerholt Historischer Roman Drittes Buch Wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen 2 Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? (Matthäus 26.51-54) 3 4 1.Kapitel I W ährend Christian die morschen Stufen der Kellertreppe hinunter stieg, schlug ihm Lärm entgegen wie aus einer Trinkstube. Ist das denn vernünftig, solch ein Spektakel zu vollführen? Es musste immerhin nicht jeder in der Stadt wissen, dass sie sich jeden Dienstag kurz nach Einbruch der Dunkelheit dort unten trafen! Der junge Mann stieß eine nur angelehnte Tür auf und betrat einen engen, muffigen Lagerraum. Kisten und Ballen ließen nur wenig Platz in der Mitte. Dort stand eine Öllampe auf dem Fußboden. Ihr schwacher, flackernder Schein beleuchtete die vor Erregung geröteten Gesichter einer Gruppe von Bürgern. Sie benutzten die Kisten und Ballen als Sitzgelegenheiten. "Man kann euch bis zum Dom hin hören!" rief Christian beim Eintreten. "Ich dachte, wir wollen dem ehrwürdigen Herrn Erzbischof eine Überraschung bereiten." "He, ho! Da bist du ja endlich! Hat deine Liebste dich nicht fortgelassen?" "Meine Liebste?" schrie er außer sich. "Das muss ich mich fragen lassen?" Tosendes Gelächter war die Antwort. "Hereingefallen!" sagte Norbert, sein etwa gleichaltriger Freund, und zog ihn auf einen Platz neben sich. "Strafe muss sein!" "Erzählt mir lieber, warum ihr so herumschreit!" Ein Mann, welcher der Vater fast aller anderen hätte sein können, ein Kaufmann seiner Kleidung nach, wandte sich ihm zu. Er saß erhöht auf einer etwas größeren Kiste. Schon dieser kleine Unterschied wies ihn als den Führer der Gruppe aus. Es gab aber noch mehr, was ihn auszeichnete. Mit seinem Bart, auf dessen Pflege er große Sorgfalt verwandte, folgte er einer Mode, wie sie durch die Stauferkaiser unter den Fürsten aufkam. Seine dunklen Augen drückten Entschlossenheit aus. Allerdings war er ein eher ruhiger und bedächtiger Mensch, einer, der mit Geduld auf seine Gelegenheiten zu warten versteht. "Wenn Erzbischof Gerhard morgen im Dom die diesjährige Fastensynode feierlich beendet, wird er die Stedinger zu Ketzern erklären. Wir reden uns nun die Köpfe heiß, was das für uns und unsere Sache bedeutet." Christian stieß einen Pfiff aus. "Seid ihr euch sicher?" "Du kennst doch meine Verbindungen zum Palast", sagte Andreas, ein jüngerer Kaufmann, der dem Älteren wie ein Sohn zu Füßen saß, jedoch in Wahrheit mit ihm weder verwandt noch verschwägert war. "Nun, so eine Ketzerpredigt ist kein Kinderspiel. Die hält ein Mann wie Gerhard nicht zum Spaß. Will er ... Krieg?" "Vielleicht!" "Und wie gedenkt er das zu begründen?" "Die Bauern haben einen seiner Dominikaner erschlagen, einen, der ihnen wegen der verweigerten Zinsen ins Gewissen reden wollte. Weißt du noch nichts von dieser Sache?" "Ich hielt es für ein Gerücht." "Es ist aber wohl wahr." Nun fielen sich die Männer, die schon eingeweiht waren, gegenseitig ins Wort, um Einzelheiten zu ergänzen. "Angeblich haben sie jede zweite Kirche verwüstet." 5 "Gottesdienste, so wie sie sein sollten, gibt es schon lange nicht mehr." "Sie dulden sogar Wahrsagerinnen." "Und an die Eide, welche sie dem Erzbischof geleistet haben, halten sie sich nicht." Da verschaffte sich plötzlich Norbert Gehör. "Was soll denn das? Kein Gottesdienst, Wahrsagerinnen, Eidbruch! Seit wann glaubt ihr das, was dieser Halunke verbreitet? Habt ihr vergessen, weshalb wir hier zusammenkommen?! Gerhard ist ein Kirchenfürst, wie ihn der Teufel sich nicht besser wünschen könnte. Er bricht seine Eide, noch ehe er sie schwört, wenn es ihm einen Vorteil bringt. Für den zählen nur Macht und Gold. Wieso redet ihr mit seiner Zunge? Die Stedinger sind unsere natürlichen Freunde, weil sie seine Feinde sind." Einige Zeit herrschte Stille im Keller. Einige der Männer nickten und schämten sich insgeheim, dem Erzbischof auf den Leim gekrochen zu sein. Andere blickten skeptisch drein und rangen noch um eine Meinung. Schließlich ergriff der Ältere wieder das Wort. "Die Stedinger können nicht unsere Freunde sein. Wir sind Bürger und sie sind Bauern. Das ist ein Unterschied. Es mag sein, dass sie uns zeitweilig nützlich sind. Vielleicht lohnt sich sogar (in einer bestimmten Lage) ein Bündnis mit ihnen. Doch das sollten wir uns gut überlegen." Seine ruhige, überlegene Art verfehlte nicht die beabsichtigte Wirkung. "Das war sehr vernünftig, was der Gottfried da gesagt hat", bestätigte Andreas mit dem Eifer eines strebsamen Schülers - und übersah das Lächeln, das über die Gesichter der anderen huschte. Während die Versammelten nun wieder zu disputieren begannen, folgte Christian seinen eigenen Gedanken. Es war eine Eigenheit von ihm, dass er bei politischen Fragen jede Aussage lange im Kopf hin und her wälzte. 'Die Politik ist eine Hure. Ein jeder treibt's mit ihr, wie's ihm g'rad paßt.' Das war einer seiner Lieblingssprüche. Das Misstrauen, das ohnehin zu seinen charakteristischen Eigenschaften zählte, trieb er auf diesem Gebiet besonders weit. Er glaubte niemandem, seinen Freunden ebenso wenig wie seinen Gegnern. Die Stedinger waren die Nachkommen holländischer Siedler. Bremer Erzbischöfe hatten sie in der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts mit günstigen Pachtbedingungen herbeigelockt. Damals war der Landstreifen beiderseits der Weser noch unfruchtbar und menschenleer. Schilfartiger Rusch wuchs dort. Mittendrin standen ein paar Eichen, Erlen und Eschen. Schon bald zeigte sich aber, dass der Boden, sobald man ihn entwässert hatte, gute Feldfrüchte hervorbrachte. Die Bauern kamen innerhalb weniger Generationen zu beträchtlichem Wohlstand. Dabei hielten sie an den Traditionen aus der Anfangszeit fest. Wie in ihrer Heimat üblich, begrenzten sie die Parzellen gerade und rechtwinklig. Die Dörfer lagen in der Nähe der Deiche und waren geschlossen wie Städte. Das Leben in diesen neuen Dörfern verlief lange Zeit friedlich. Die Familien zahlten regelmäßig den (nach wie vor niedrigen) Zins an den Bremer Erzbischof und entrichteten bereitwillig auch den Kirchenzehnt. Um die Wende zum dreizehnten Jahrhundert bahnten sich allerdings Auseinandersetzungen an. Den Adligen in der Umgebung war es ein Ärgernis, dass diese Bauern in einem Großteil des Marschlandes eine eigene Gerichtsbarkeit pflegten. Musste ein solches Vorbild auf die Dauer nicht 6 verderbliche Folgen nachziehen? Vor allem Moritz, der machthungrige Graf von Oldenburg, tat sich hervor. Ihm war die Vogteigewalt über die dem Erzbischof unterstellten Gebiete übertragen. Doch das reichte ihm nicht. Er mochte seine Macht nicht teilen, schon gar nicht mit Bauern. Die volle Feudalordnung forderte er - mit Gewinn- und Willkommengeldern, Meierrecht und Leibeigenschaft. Im Jahre 1204 brach der Konflikt offen aus. Moritz unterhielt damals zwei Burgen in unmittelbarer Nähe des Stedingerlandes - die Burg Lichtenberg am linken Hunteufer und die Burg Linnen bei Elsfleth. Die Bauern verbitterte, dass von dort zahlreiche Überfälle auf junge Bauernmädchen ausgingen. Die Waffenknechte des Grafen hatten leichtes Spiel, denn die Dörfer lagen weit auseinander und die Wege waren lang, zum Beispiel am Sonntag beim Kirchgang. Immer wieder forderten die Eltern der Opfer harte Bestrafung der Schuldigen. Die Hauptleute aber machten mit ihren Knappen gemeinsame Sache und beteiligten sich selbst mit an den Vergewaltigungen. Eines Nachts trafen sich etliche entschlossene Männer am Brokdeich bei Iprump und rüsteten sich zum Sturm. Unter dem Vorwand, wieder einmal Beschwerden vortragen zu wollen, verschaffte sich eine Vorhut Einlass. Die Besatzung am Tor wurde überwältigt. Dann brachen die anderen aus dem Wald hervor. Nach kurzer Zeit standen beide Burgen in Flammen. Die Waffenknechte suchten das Weite sofern sie nicht erschlagen worden waren. Unter dem Eindruck des Handstreichs kam es zum allgemeinen Aufstand. Moritz von Oldenburg, der nicht hatte teilen wollen, verlor seine Vogtei nun ganz. Es sollte aber noch ärger werden. Ein dem Erzbischof unmittelbar unterstellter Geistlicher leistete sich einen üblen Streich. Eine Bäuerin hatte ihm nach der Beichte nur einen Pfennig gegeben. Als Rache steckte er ihr beim nächsten Abendmahl diesen Pfennig an Stelle der Hostie in den Mund. Während des Aufruhrs, den das auslöste, kam er zu Tode. Der Bremer Erzbischof forderte energisch die Auslieferung der Schuldigen. Die Stedinger indes wollten sie selbst aburteilen. Am Ende waren die Fronten derart verhärtet, dass die Marschlandbauern aus Trotz alle Zahlungen einstellten. Der Bruch war vollzogen. Aus Angst vor Vergeltung begannen die Stedinger mit dem Bau umfangreicher Verteidigungsanlagen. An der Ochtum entstanden ein gemauerter Graben sowie ein Wall von der Höhe eines Hauses mit einem Ausfalltor bei Hasbergen. An der Weser und an der Hunte wurden die Deiche mit Verschanzungen bestückt. Im Norden schränkten die widerspenstigen Friesen die Bewegungsfreiheit feindlicher Truppen ein. Lediglich Oststedingen blieb weitestgehend schutzlos. Schon bald mussten sich die neuen Anlagen bewähren. Im Jahre 1207 griff Erzbischof Hartwig II mit einem gut gerüsteten Heer an. Die Oldenburger unterstützen ihn. Der Kirchenfürst erkannte aber nach ersten Scharmützeln, dass er nur mit hohen Verlusten zum Erfolg kommen konnte. Als die Bauern ihm Geld anboten, brach er das Unternehmen etwas überraschend ab. Seitdem hatten die Bauern so etwas wie einen eigenen Staat. Sie nannten ihn Universitas Stedingorum Gemeinschaft der Uferanwohner. Dort führten sie sogar ein eigenes Siegel. Christian hatte bisher noch niemals mit einem Stedinger gesprochen, jedenfalls nicht wissentlich. Er kannte nur die Sicht des Erzbischofs und der Dominikanermönche. Letztere hatten 7 vor einigen Jahren ihren ersten Konvent in Bremen gegründet. Seitdem hetzten sie mehr und mehr gegen die freien Bauern von der Weser. Bei ihren Predigten gingen sie sehr geschickt vor. Den ungebildeten Leuten boten sie haarsträubende Geschichten an, behaupteten zum Beispiel, die Menschen dort behielten nach dem Abendmahl die Hostie im Mund, um sie dann auf den Misthaufen zu speien. Den Kaufleuten, die lesen konnten und in der Welt herumkamen, wiesen sie nach, dass Ungehorsam gegenüber einem Kirchenfürsten gleichzusetzen sei mit Götzendienst, und der wiederum Ketzerei bedeute. Die Mönche mit den weißen Kutten und schwarzen Mänteln kannten die Bibel besser als die meisten Priester und wussten auf jede Frage eine Antwort. Vielleicht hätte auch Christian schließlich auf sie gehört, trotz seines Misstrauens. Die Führer des Konvents aber galten als Busenfreunde des Erzbischofs und der stand bei ihm auf der Liste der fragwürdigen Leute ganz weit oben. Wer es mit diesem Halunken hielt, konnte nichts Gutes im Schilde führen! So fühlte er sich auf die Seite der Bauern gezogen, ohne dafür auch nur eine einzige stichhaltige Begründungen nennen zu können. Um sich nicht der Lächerlichkeit preiszugeben, hütete er sich davor, seine Meinung in dieser Frage laut zu sagen. Ansonsten war er freilich nicht so zurückhaltend. "Ich wette, er wird angekrochen kommen, um sich Geld zu borgen", mischte er sich in das Gespräch ein. "So ein Feldzug, der kostet einiges." "Und wir sollten das ausnutzen", nahm Norbert den Faden auf. Diesmal waren sich alle einig. Mit seinen hochfliegenden Plänen geriet der Erzbischof in eine gewisse Abhängigkeit von seinen Bürgern. "Er muss entscheiden, ob er uns niederhalten will oder die Stedinger", sagte Gottfried. "Wenn er die Bauern morgen zu Ketzern erklären will, so hat er sich bereits entscheiden." Schon ergab sich aber ein neuer Streitpunkt. Die Bürger konnten ihre Hilfe nur dann teuer verkaufen, wenn sie zusammenhielten. Wem aber konnte man vertrauen? Die, welche hier im Keller zusammenkamen, vertraten keineswegs die Mehrheit. Sie hatten nicht einmal Angehörige einflussreicher Familien hinter sich. Doch sie waren voller Ehrgeiz und ohne Furcht. In ihren Träumen sahen sie Gottfried bereits als Bürgermeister ins Rathaus einziehen. Der Lagerraum weitete sich zu einem Saal. Die Kisten und Ballen verwandelten sich in Stühle aus schwarzem, kunstvoll beschnitztem Holz. Es war stockdunkel, als Norbert und Christian nach Hause gingen. Ohne ihr Öllicht hätten sie den Weg nicht gefunden. Norbert ging Christian zuliebe einen Umweg. Nach den Versammlungen hielten sie das immer so. Unterwegs redeten sie noch einmal unter sich über die wichtigsten Themen. Dabei stellten sie oft verblüfft fest, dass sie ähnlich urteilten. Aber auch für die persönlichen Gespräche war nun die richtige Zeit. "Nun verrate mir endlich, warum du zu spät gekommen bist?" "Ihr denkt euch da immer gleich was rein! Der Alte hat mich nicht früher fortgelassen." "Du magst ihn nicht, deinen Stiefvater!" "Reden wir über etwas anderes!" "Über Mädchen?" Christian lachte gutmütig. Wenn Norbert damit anfing, wurde er niemals wütend. Er war sein Freund. Von ihm fühlte er sich ernst genommen, immer. 8 Vielleicht band das die beiden nun schon seit Jahren aneinander. "Ich werde meine Meinung nicht ändern. Was sollte mich umstimmen? Was kann einen Mann an einem Weib reizen? Doch nur das Dingelchen zwischen ihren Beinen. Nun, vielleicht lässt sie dich mal ran. Schön! Aber nach einem kleinen Moment ist alles vorbei. Natürlich möchtest du's noch mal erleben. Klar! Du bist auf den Geschmack gekommen. Nur leider hängen die Trauben nun schon viel höher. Und so geht das weiter. Für den kleinen Moment am Abend musst du einen ganzen Tag lang auf den Knien liegen. Und dann kommen Kinder, die dir nachts die Ohren voll plärren. Das nennt man die Frucht der Liebe. Nicht wahr?" "Oh nein! Hör auf! Du bist ein hoffnungsloser Fall. Gott hat was falsch gemacht, als er dich schuf." "Nein, lach nicht! Es ist besser, allein zu leben." "Eines Tages hast du vielleicht alle Männer überzeugt und es werden keine Kinder mehr geboren. Wer aber soll sich um dich kümmern, wenn du alt und krumm bist?" "Ein paar müssten sich opfern. Vielleicht sollte man losen, so wie beim Kriegsdienst. Aber nein! Es gibt ja noch immer genug Dumme, die sich freiwillig melden. Niemals werde ich sie alle überzeugt haben." "Du glaubst nicht an die Liebe ..." "... die gibt's nur in den dummen Gedichten der fahrenden Ritter." "Aber überkommt es dich nicht manchmal. Ich meine ..." "Deshalb würdest du dich einem Weib an den Hals hängen? Hast du nicht zwei gesunde Hände?" "Das wird ja immer schlimmer! He, das ist Sünde!" "Ist es nicht! Das Verbot steht im Alten Testament und gilt nicht mehr." "Wir sind angekommen. Hau bloß ab! Du machst mich ganz wirr im Kopf." "Den, der auf dem Pfade der Tugend wandelt, vermag nichts zu verwirren." Sie umarmten sich brüderlich und gingen auseinander. II C hristian hatte gehofft, sich ungestört in seine Kammer schleichen zu können. Für den Verschlag, den er bewohnte, war das Wort Kammer eigentlich schon eine Übertreibung. Oberhalb einer Tischlerwerkstadt im Winkel zwischen einem Regal für Bretter und dem Dach befand sich ein Zwischenraum, der gerade ausreichte, dass ein erwachsener Mensch hineinkriechen konnte. Christian hatte sich dieses Heim selbst ausgesucht. Immerhin war er dort oben allein. Ein Vorhang aus alten, grob zusammengenähten Säcken schirmte ihn zur Werkstadt hin ab. Zog er ihn zu, erfasste ihn ein trügerisches Gefühl, dass es in dieser Welt etwas gab, was ihm ganz allein gehörte, ein winziges Reich, über das er regieren durfte. Selbstverständlich besaß er auch Schätze, die er in Verstecken deponierte, Schriftstücke zumeist. Schon war er an der Leiter. Noch ehe er sie aber erklommen hatte, ließ ein Licht ihn herumfahren. Hinter sich gewahrte er Berthold, seinen Pflegevater. Der Tischlermeister war ein kräftiger Mann Mitte Fünfzig. Sein von dichten, graumelierten Haaren umrahmtes Gesicht zerfurchten zahlreiche Falten. Er wirkte sehr ehrbar und erweckte dadurch rasch anderer Leute Vertrauen. Zuweilen allerdings 9 gab ihm eine geringe Änderung des Mienenspiels plötzlich einen Zug von Unnahbarkeit und Strenge, so auch diesmal. "Wo kommst du um diese Zeit her?" fragte er. "Ich war bei Freunden", entgegnete der junge Mann kurz. Er kannte seinen Stiefvater gut genug, um zu ahnen, was er dachte und was folgen würde. Meister Berthold hatte Lebensgrundsätze, denen er unerbittlich folgte. Genau genommen waren das nicht seine Grundsätze sondern die der Zunft, welcher er angehörte. Oft nannte er sie seine Heimat. Er sagte auch: "Von ihr verstoßen zu werden, würde für mich nicht weniger bedeuten, als euch alle mit einem Schlag zu verlieren.". In gewisser Hinsicht bewertete er die Zunft sogar höher als die Familie. Kein schlimmeres Vergehen konnten sich seine Angehörigen zu schulden kommen lassen, als ein solches, das bei der Morgensprache im Zunfthaus Aufsehen erregte (oder auch nur geeignet schien, Aufsehen zu erregen). "Was sind das für Freunde?“ wollte er von Christian wissen. „Kenne ich sie?" "Nein!" versetzte dieser feindselig. Hinter der Schulter des Meisters tauchte das Gesicht seiner Frau auf. Sie hieß Mathilde, wurde aber von allen nur Mutter Hilde genannt. "Wir haben uns Sorgen um dich gemacht", sagte sie in der Hoffnung, dadurch die Wogen zu glätten. Christian wurde jedoch eher noch gereizter. Er wünschte sich, dass sie ihn hin und wieder in Schutz nähme. Hatte sie denn nicht für ihn die Stelle der Mutter eingenommen? Gewiss, gegen Meister Berthold war nicht leicht anzukommen, wenn es um seine Lebensgrundsätze ging. War es aber wirklich unmöglich? "Ich arbeite für euch und ich arbeite nicht schlecht!“ rief er, nun schon ernsthaft wütend. "Vorhin bin ich geblieben, bis diese Truhe fertig war. Nun also! Ihr könnt mir nicht vorwerfen, dass ich euch zur Last falle." "Das behaupten wir doch gar nicht", hielt ihm Berthold entgegen mit der unerschütterlichen Ruhe eines Menschen, der immer Recht hat. "Wir haben aber Verantwortung für dich." Der junge Mann schlug mit der flachen Hand gegen die Leiter. "Ich kann mein Leben selbst verantworten. Vielleicht wäre es das Beste, wenn ich auf Wanderschaft ginge." Entschlossen kletterte er zu seinem Verschlag hinauf, kroch auf sein Lager und zog den Vorhang zu. Nun fühlte er sich besser. Allerdings hielt dieser Zustand nur kurz an. Dann überkam ihn das schlechte Gewissen. Warum verhielt er sich seinen Pflegeeltern gegenüber so? Er hatte doch allen Grund, ihnen dankbar zu sein! Ohne sie wäre er wahrscheinlich in einem dieser schrecklichen Waisenhäuser gelandet. Wer dort aufwuchs, konnte vom Leben nicht mehr viel erwarten. Bei Meister Berthold und Mutter Hilde entbehrte er dagegen nichts. Sie zogen nicht einmal ihren leiblichen Sohn Fritz vor. Norbert hatte einmal gesagt: Du wetterst gegen jedermann, weil du dich selbst nicht magst. Dieser Satz beschäftigte ihn seither. Manchmal wollte er ihn nicht wahr haben und versuchte, ihn (zumindest für sich) zu widerlegen - vergebens. Doch warum mochte er sich selbst nicht leiden? Als Kind hätte er geantwortet: Weil ich nicht weiß, wer meine richtigen Eltern sind. Zu keiner Familie zu gehören, war für ihn damals ein böser Makel gewesen. Er fühlte sich anderen Kindern gegenüber zurückgesetzt. Selbst diejenigen, deren Eltern eine Krankheit hinweggerafft hatte, beneidete er noch. Die konnten ihren 10 Vater und ihre Mutter mit Namen benennen und auf dem Friedhof besuchen. Bei ihm lagen die Dinge anders. Da gab es ein Geheimnis. Seine Pflegeeltern wollten mit ihm darüber nicht reden. Mit dreizehn Jahren stellte er Nachforschungen auf eigene Faust an und versprach sich davon eine Aufwertung. In seinen Vorstellungen tauchten Grafenfamilien auf, denen er aus einem dunklen Grund abhanden gekommen war. Entführungen bei Nacht, Giftmorde, pikante Fehltritte. Dann die große Enttäuschung am Ende, über die ihn nicht einmal hinwegtröstete, dass er tatsächlich auf ein Verbrechen gestoßen war. In der Obhut eines Nonnenklosters der Zisterzienser lebte eine offenbar geisteskranke Frau. Sie erledigte dort die niederen Arbeiten. Mal sah man sie beim Säubern der kleinen Kirche, mal beim Ausmisten der Geflügelställe. Sie war fleißig und deshalb durchaus beliebt. Allerdings gelang es niemandem, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Sie weigerte sich sogar, den Beichtstuhl zu betreten. Ihre Ängstlichkeit erinnerte an das Verhalten eines kleinen Tieres. Sie spürte mit all ihren Sinnen, wenn sich ihr jemand näherte und war jederzeit zur Flucht entschlossen. Man nannte sie die scheue Anna. Über diese Frau gab es eine Geschichte. Um das Jahr 1212, zu jener Zeit, als der jugendliche Stauferspross Friedrich siegreich am Rhein entlang zog und seinem welfischen Rivalen Otto IV eine Stadt nach der anderen entriss, als allenthalben Ritter und Landsknechte zum Verdruss der arbeitenden Menschen umherstreunten, als der Frieden zwar beschlossen aber noch nicht durchgesetzt war, damals also tobte eines bösen Tages nahe beim Bremer Markt ein Trinkgelage. Ein Dutzend Anhänger des neuen Herrschers wollten (inzwischen brotlos geworden) ihrer Wege gehen. Zum Abschied berauschten sie sich noch einmal am Wein (gekauft von den letzten Geldstücken in ihren Beuteln) und an den alten Heldentaten (den tatsächlichen und den erfundenen). Als sie am späten Nachmittag schon schwer betrunken waren, kam unglücklicher Weise ein Bürgermädchen in ihre Nähe. Das zerrten sie in die Runde hinein - um ein wenig Schabernack mit ihm zu treiben. Einer der Männer aber wollte mehr. Er schlug dem Mädchen die Röcke hoch und vergewaltigte es vor allen Leuten. Es wäre ein Leichtes gewesen, den Schuldigen zu ermitteln. An Zeugen zumindest bestand kein Mangel. Niemand aber mochte sich mit den rauen Gesellen anlegen. Zudem hatte Friedrich der Stadt ihre Privilegien noch nicht bestätigt. Die Verurteilung eines seiner Männer richtete da vielleicht Schaden an. So hieß es plötzlich, man wisse nicht genau, wer der eine gewesen war, der dem Mädchen Gewalt angetan hatte. Und weil man nicht blindlings die Unschuldigen mit dem Schuldigen in einen Topf werfen dürfe, könne man (leider!) kein Verfahren eröffnen. Die Waffenknechte verschwanden für immer aus der Stadt. Es hieß, sie hätten dem Rat ein Geschenk hinterlassen. Das Mädchen bekam einen Sohn, den sie nicht annahm. Nicht einmal die Brust gab sie ihm. Anfangs versuchten die Leute, sie mit Ermahnungen zu ihren mütterlichen Pflichten zu drängen. Doch die Vergewaltigung hatte ihr den Verstand geraubt. Sie war ein bedauernswertes Geschöpf, auf das man nicht noch mehr einprügeln durfte. Eines Tages nahmen die Zisterzienserinnen sie aus Barmherzigkeit bei sich auf. Um den Sohn kümmerten sich Verwandte. So 11 wuchs Christian bei dem Tischler Berthold und dessen Frau (der Mutter Hilde) zu einem jungen Mann heran. Durch seine Nachforschungen wusste er freilich nur, dass die scheue Anna seine Mutter war. Den Namen seines leiblichen Vater erfuhr er nicht. Vielleicht hieß er Egbert. Manche Leute behaupteten das. Der Name seiner Familie habe mit der Silbe West begonnen. Das war aber leider kein sehr nützlicher Hinweis. Jeder dritte Ort in der Umgebung Bremens hieß "Süder...", "Norder...", "Oster..." oder eben "Wester...". Und warum sollte dieser Egbert überhaupt aus der Umgebung Bremens stammen? Im Grunde war das eher unwahrscheinlich. Wie viele nach Himmelsrichtungen benannte Orte mochte es in der ganzen Welt geben?! Christian versuchte erst gar nicht, sich Klarheit zu verschaffen. Angesichts der Umstände war keineswegs selbstverständlich, dass Christian im Leben einiges erreichte. Er erlernte nicht nur das Tischlerhandwerk, sondern erwarb zudem eine gewisse Bildung. Meister Berthold war nicht reich genug für den Luxus, den eine Schule darstellte. (Auch sein leiblicher Sohn Fritz kam nicht in ihren Genuss.) Das verstoßene Kind der scheuen Anna brachte sich größtenteils selbst bei, was die Jungen aus den Kaufherrenfamilien lernten. Gelegentlich bekam er auch Unterricht von einem Mönch, mit dem er durch die Vermittlung seines Freundes Norbert Bekanntschaft schloss und der sich seiner ohne jeden Lohn annahm, weil ihn sein ungewöhnlicher Eifer und seine überdurchschnittliche Klugheit tief beeindruckten. Allerdings stieß er auch auf Schwierigkeiten, denn es wurde nicht gern gesehen, wenn jemand etwas wollte, was ihm seinem Herkommen nach nicht zustand. Von einigen bösartigen Schülern bezog er Prügel, sobald sie ihn in der Nähe ihres Klosters zu fassen bekamen. Inzwischen konnte er recht gut Lesen, Schreiben und Rechnen. Auch hatte er gelernt, über die Wälle und Mauern seiner Heimatstadt Bremen hinweg in die Welt zu schauen. Er konnte mitreden bei Gesprächen über die großen Fürstenfamilien und wusste Bescheid über deren Bedeutung für das Reich. Schon verhältnismäßig zeitig hatte er sich dabei eine eigene Meinung gebildet - und zwar eine ziemlich radikale, die ihn fast zwangsläufig an eine politische Gruppe geraten ließ. Es handelte sich nicht um Gewalttäter, nicht um Verschwörer im engeren Sinne, wohl aber um Leute, die mit den bestehenden Verhältnissen unzufrieden waren und die ihre Sache ernst nahmen, die mehr wollten, als sich in muffigen Kellern die Köpfe heiß zu reden. Dass sie Waffen besaßen, sagte allerdings noch nichts aus. Kaufleute mussten sich gegen Räuber verteidigen können, sobald sie die Stadt verließen. Kaiserliche Erlasse erlaubten ihnen darum das Tragen von Schwertern, was selbstverständlich die Genehmigung einschloss, das Fechten zu üben (in der Regel bei zu bezahlenden Meistern). Für die Handwerker galten zwar (ebenso wie für die Bauern) wesentlich strengere Bestimmungen, doch hielten viele sich nicht daran. Selten wurde jemand deswegen bestraft, und wenn dann nur mit einem kleinen Bußgeld. Christian bewahrte in seinem Verschlag über der Tischlerwerkstadt ebenfalls ein Schwert auf - und er konnte auch damit umgehen. Er liebte die Fechtübungen, denn sie gaben ihm die Möglichkeit, ungestraft seine angestaute Wut abzureagieren. Berserker nannten man ihn im Scherz - nach den legendären, in Bärenfelle gehüllten Kriegern des hohen Nordens. 12 III A m Sonntag, dem 17. März 1230 hatte Erzbischof Gerhard II von Bremen aus Anlass der Fastensynode die Bauern des Marschlandes an der Weser zu Ketzern erklärt. Am darauf folgenden Dienstag fand nur wenige hundert Meter vom Dom entfernt eine denkwürdige Versammlung statt. Zunächst hatte nichts darauf hingedeutet, dass die Ereignisse sich an diesem Abend derart überstürzen sollten. Mit der Ketzerpredigt hatte in dieser Runde jeder gerechnet. Auch bei der Begründung war nichts Aufsehen erregendes gesagt worden. Zwei der jungen Leute hatten sich entschuldigen lassen, weil sie sich von den Gesprächen wenig versprachen. "Wir müssen abwarten", war die Meinung der meisten. "In zwei oder drei Wochen sehen wir klarer." Gottfried nutzte die Gelegenheit, um seine Stellung als Oberhaupt zu festigen, und hielt eine lange Rede. Andreas unterstrich seine Worte durch eifriges Nicken und gelegentliche Zwischenrufe. Die anderen hörten mehr oder weniger interessiert zu oder träumten vor sich hin. Allein die Trägheit verhinderte, dass die Zusammenkunft schon zeitig endete und die meisten schon zu Hause gewesen wären, ehe jene Kette von Zufällen ihren Anfang nahm, welche dem Abend eine Wendung zum Schlimmen gab. Mitten hinein in das Schweigen, welches Gottfrieds Rede gefolgt war, platzte Norberts jüngerer Bruder mit der Nachricht. "Vater ist gefangen genommen worden. Du musst sofort nach Hause kommen." Der zehnjährige Knirps war gänzlich aufgelöst vor Aufregung. Je mehr Fragen er beantworten sollte, desto mehr kam er durcheinander. "Waren es die Knechte des Erzbischofs?" "Ich glaube." "Glaubst du es oder weißt du es?" "Es ging alles so schnell. Du sollst nach Hause kommen. Mutter hat mich geschickt." Norbert konnte sich das nicht erklären. Sein Vater war ein vorsichtiger und rechtschaffener Mann. Niemals hatte er sich in die Politik eingemischt. Von dem, was sein Sohn an den Dienstagabenden trieb, wusste er nichts. Welchen Grund sollte es geben, ihn gefangen zu setzen? Wollte der Erzbischof den Vater für den Sohn büßen lassen? Eine Blutwoge schoss Norbert in den Kopf, als ihm diese Deutung in den Sinn kam. Das wäre eine Ungeheuerlichkeit! "Gerhard will uns herausfordern!" rief er. Andere pflichteten ihm bei. Ein Wort ergab das andere und schon bald hieß es: "Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Lasst uns zu seinem Palast ziehen!" Doch das war nicht die Meinung aller. "Besonnenheit ist die Mutter des Erfolges", sagte Gottfried philosophisch. "Gerade wenn er uns herausfordern will, dürfen wir nicht die Ruhe verlieren. Denkt an unser eigentliches Ziel!" "Und was wird solange aus meinem Vater?" hielt Norbert ihm aufgebracht entgegen. "Behältst du auch dann noch deine Ruhe, wenn ihn der Erzbischof zur Hinrichtung führen lässt?" "Recht hat er!" schrie Christian durch das aufbrandende Stimmengewirr. "Je mehr wir uns gefallen lassen, desto härter springt er mit uns um." "Was wollt ihr denn erreichen vor dem Palast?" warf Andreas ein. Er wurde sofort niedergeschrieen. "Aus deinen Worten spricht Geheimbündlern die größte überhaupt denkbare Beleidigung darstellt. "Verräter!" Keiner wusste hinterher, wer es ausgesprochen hatte. Niemand bekannte sich dazu. Es war sogar unklar, welche der beiden Parteien die Schuld traf. Eine Rolle spielte das ohnehin nicht mehr. Das Wort stand fortan zwischen ihnen. Wie ein Axthieb hatte es die Gruppe auseinander gehauen. "Wer zu mir hält, der folge mir nach!" rief Norbert und führte seine Anhänger die Kellertreppe hinauf auf die Straße. An diesem Tage war nichts mehr zu bewerkstelligen. Schon brach die Dunkelheit herein. Am folgenden Morgen aber trafen sich die jungen Leute wieder. Sie zogen zum Dom und riefen dabei Losungen, die sich teilweise auf die Verhaftung bezogen, teilweise auf allgemeine, seit langem populäre Forderungen. Zu ihrer Überraschung blieben sie nicht lange allein. Aus den Gassen strömten ihnen Dutzende Menschen zu, Lehrburschen und Gesellen, Kinder und gestandene Männer, arme Hunde in zerrissenen Kitteln und Meister, denen lange Mäntel ein würdiges Aussehen verliehen. Der Zug war so bunt, dass er lustig gewirkt hätte ohne die gewalttätigen Sprüche. Erzbischof Gerhard regierte die Stadt mit harter Hand und hatte im Laufe der Jahre fast alle Bevölkerungsgruppen gegen sich aufgebracht. Die Kaufleute empörten sich über neue Burgen an der Weser, die sie als Bedrohung empfanden, und über Zölle, die in alten Verträgen nicht vorkamen. Die Handwerker stöhnten über neue Steuern. Die Ratsmitglieder sahen sich gedemütigt durch die Selbstherrlichkeit des Kirchenfürsten. Die Bettler waren vom Domplatz vertrieben worden. Ein Tropfen hatte gereicht, das Fass zum Überlaufen zu bringen. Feigheit." Durch den Raum verlief plötzlich eine scharfe Trennlinie. Auf der einen Seite fanden sich Gottfrieds Anhänger zu einer Phalanx zusammen. Ihnen gegenüber standen die Hitzköpfe, die kämpfen wollten. Dass es Meinungsunterschiede in der Gruppe gab, das war nichts Unbekanntes. Niemand aber hatte bisher für möglich gehalten, dass der Graben schon so tief war. Unüberwindlich wurde er, als ein böses Wort fiel, ein Wort, das unter 14 Kurz vor dem Markt kam dem Zug ein Bote entgegen gerannt. Der schrie mit greller Stimme: "Geht nach Hause! Er ist längst wieder frei. Hört ihr denn nicht? Er ist frei! Es war ein Missverständnis. Er bekommt sogar eine Entschädigung." Den Zug, der sich da seinen Weg zum Dom bahnte, konnte er damit nicht aufzuhalten. Die meisten Leute rätselten, worauf sich seine Worte eigentlich bezogen, und Norbert dachte gar nicht daran, sie aufzuklären und womöglich zu beschwichtigen. "Er hat ihn frei gelassen, um dem Aufruhr den Wind aus den Segeln zu nehmen", knurrte er. "Wenn die Lage sich beruhigt hat, sperrt er ihn wieder ein." Wie eine Brandungswelle schlug der Zug über dem Boten zusammen, riss ihn ein Stück mit und schleuderte ihn dann gegen eine Hauswand. Erst auf dem Platz vor dem gewaltigen Westwerk des Doms kehrte ein wenig Ruhe ein. Ohne dass es jemand geplant hatte, fanden sich mehrere Redner, die nacheinander unter großem Beifall verschiedene Forderungen der Bremer Bürger vortrugen. Christian hörte einige Zeit aufmerksam zu, dann aber langweilte er sich zunehmend, weil die Redner sich zu wiederholen begannen und weil ihm das Gesagte größtenteils sowieso nicht neu war. Eine Reihe Wappen lenkte ihn ab. Sie zierten über ihm die Wand eines dem Erzbischof gehörenden Hauses. Erst vor wenigen Tagen hatte der Kirchenfürst sie anlässlich der Fastensynode erneuern lassen, so dass sie nun mit kräftigen Farben in der Sonne leuchteten. Neben Gerhards prächtigem Wappen war jenes des Grafen von Oldenburg angebracht, zweifellos nicht zufällig. Den goldenen Untergrund durchschnitten waagerecht zwei rote Zickzacklinien. Diese Ammerländer Linien gingen auf eine Sage zurück. Während des Fürstenaufstandes gegen König Heinrich IV im Jahre 1073 gerieten Graf Huno von Ammerland und sein Sohn Friedrich in Gefangenschaft. Beide sollten einem Löwen vorgeworfen werden. Friedrich aber sprach: "Lasst uns nicht so unritterlich sterben, edler König! Ich will mit dem Untier kämpfen, damit sich zeigt, ob Gott unseren Tod will oder nicht." Diesem Ansinnen konnte sich Heinrich nicht widersetzen. Friedrich stieg also in den Käfig und schaffte, was niemand für möglich gehalten hatte - er besiegte den Löwen. Tief gerührt sagte daraufhin der König: "Gottes Wille geschehe! Ich schenke dir und deinem Vater die Freiheit. Zugleich entbinde ich euch und eure Nachkommen von allen Lehnspflichten, ausgenommen denen, die ihr dem Reich schuldet." Diese Kaiserfreiheit ging von den Ammerländer Grafen auf die Oldenburger Herrscher über. Mit dem Wappen der Wildeshausener war keine Geschichte dieser Art verbunden. Drei rote Rosen leuchteten auf silbernem Grund. Die Hallermunder Rosen waren erst durch die Mutter des regierenden Grafen in das Hoheitszeichen hinein gelangt. Das Wappen wirkte weniger edel als das der Oldenburger, obgleich sich die Künstler viel Mühe gegeben hatten, eben diesen Eindruck nicht entstehen zu lassen. Die Tafel der Bruchhausenern verwirrte ein wenig. Sie war in vier Felder aufgeteilt und im Wechsel silbern und rot gefärbt. Die roten Abschnitte bestanden aus jeweils drei Streifen, die sich durch verschiedenartige senkrechte Striche voneinander abhoben. Das Rot wies auf die Oldenburger hin, das Silber auf die Wildeshausener. Christian wusste, dass zwischen den drei Grafenhäusern verwandtschaftliche Beziehungen 15 bestanden. Daraus ergaben sich verschiedene Ansprüche, die schon etlichen mehr oder minder ernsthaften Auseinandersetzungen als Vorwand gedient hatten. Die Bruchhausener waren die jüngste Linie. Ihr Wappen brachte vermutlich zum Ausdruck, worauf ihre Politik hinauslief: Sie wollten sich so lange wie möglich alle denkbaren Wege offen halten. Obwohl sie sich innerhalb der Reihe ganz am Ende wieder fanden, träumten sie zweifellos davon, eines Tages die letzte, die einzige Linie zu sein. Und so schloss sich der Reigen zum Kreis, denn Huno von Ammerland, jener Graf aus dem elften Jahrhundert, den die Sage bis zur Unkenntlichkeit verklärte, er hatte seine Macht (angeblich!) noch mit niemandem teilen müssen. Geschrei riss Christian jäh aus seinen Gedanken. Er reckte sich hoch und sah, dass vorn am Domportal Waffenknechte aufmarschiert waren. Wenn es einen besonderen Anlass dafür gab, hatte er ihn verpasst. Die Männer des Erzbischofs hielten Speere quer vor den Körper und rückten langsam vor. Noch blieben die Auseinandersetzungen frei von Gewalt. Die Bürger stießen Beschimpfungen aus und stemmten sich gegen die Speere. Die Knechte folgten mit versteinerten Gesichtern ihren Befehlen. Da der Platz vor dem Dom nicht regelmäßig geformt war, wurden die zurückweichenden Menschen an zwei Stellen gegen die Mauern vorspringender Häuser gedrückt. Männer versuchten, ihre Frauen und Kinder zu schützen. Es entstand eine Gegenbewegung. Die Gesichter der Knechte verzerrten sich nun vor Anstrengung. Die Speere bogen sich wie Gerten - bis drei von ihnen nacheinander krachend zerbrachen. Einem Gesellen bohrte sich ein umher fliegender Splitter in den Arm. Wenige Augenblicke später war vor dem Portal des Doms die Hölle los. Die Knechte, die sich von der aufgebrachten Menge nun ernsthaft bedroht fühlten, prügelten mit dicken Knüppeln blindlings auf die Leute ein. Dabei trafen sie junge Raufbolde ebenso wie wehrlose Frauen, die nicht rechtzeitig ausweichen konnten. Das wiederum heizte die Stimmung unter den Bürgern an. Während die einen entsetzt durch die Gassen zu entkommen versuchten, legten es die anderen darauf an, die Kette der Knechte zu durchbrechen. Christian und Norbert gerieten dabei immer weiter nach vorn. Als die ersten Steine flogen, standen sie mitten unter denen, die am meisten zum Kampf entschlossen waren. Die Männer des Erzbischofs dachten nur noch an ihre eigene Sicherheit. Sie standen im Halbkreis Schulter an Schulter direkt an der Portaltreppe und bemühten sich, mit ihren Schilden Kopf und Brust zu schützen. Das Holz zerfaserte unter den Steinen, die wie ein Hagelschauer niederprasselten. Es war völlig ungewiss, wie lange sie noch standhalten würden. Für einen Moment öffnete sich einer der großen Türflügel und es tauchte das kreideweiße Gesicht eines Priesters auf. Man musste mit dem Schlimmsten rechnen. Der Platz hatte sich inzwischen weitgehend geleert. Nur die Knechte waren noch da und die jungen Männer, die in irrsinniger Wut nur noch daran dachten, ihnen den Garaus zu machen. Da plötzlich sprengten von rechts her Reiter heran. Die veränderten das Kräfteverhältnis schlagartig und aus den Angreifern wurden Gejagte. "In die Gassen hinein können sie uns nicht folgen!" schrie Norbert und packte Christian am Arm. Sie hörten Hufschläge unmittelbar hinter sich und rannten um ihr Leben. Ein dicker Pflock vor einem Gasthof 16 rettete sie. Der Reiter flog über sie hinweg und ehe er wenden konnte, entkamen sie über die Umfassungsmauer eines städtischen Gutshofes. "Das war verflucht knapp", keuchte Norbert und ließ sich entkräftet auf den Boden fallen. "Ob sie uns erkannt haben?" fragte Christian. Sein Freund zuckte mit den Schultern. "Das werden wir bald merken." 17 IV C hristian erwachte durch ein Geräusch, das er sich nicht erklären konnte. Er lauschte in die Dunkelheit hinein. Vielleicht hatte er geträumt. Da aber war es wieder! Jemand warf kleine Steine gegen die Hauswand und zwar genau an jene Stelle, wo sich sein Verschlag befand. Das konnten nur Zeichen sein, die ihm galten. Flink zog er sich an und glitt lautlos die Leiter nach unten. Meister Berthold und Mutter Hilde schliefen fest und hörte ihn nicht, als er hinaus auf die Straße trat. Dort erwartete ihn Norbert. "Was ist? Warum kommst du um diese Zeit hierher?" "Der Erzbischof will ein abschreckendes Beispiel. Es gibt eine Liste mit Namen." "Und da stehen wir drauf?" "Verschwinden wir nicht noch in dieser Nacht aus der Stadt, werden wir festgenommen." Christian blickte sich unwillkürlich nach dem Haus um. Hätte ihn am Tag zuvor jemand gefragt, was ihn daran binde, wäre ihm nicht viel eingefallen. Doch nun, da er so plötzlich aufgefordert wurde, auf und davon zu gehen, ohne sich von seinen Pflegeeltern verabschieden zu können, da zögerte er. Norbert erriet seine Gedanken. "Du kannst nur wählen zwischen Wald und Kerker." "Es ist also sicher, dass ..." "Mir fällt das Fortgehen noch schwerer als dir, denn ich habe meine leiblichen Eltern noch und verstehe mich gut mit ihnen." "Wie viele sind wir?" "Zwölf. Wir treffen uns außerhalb der Stadt auf freiem Feld. Kleine Gruppen kommen unauffälliger nach draußen." Christian hatte nicht viel einzupacken. Die Kleidung, die er nicht auf dem Leib trug, verschnürte er zu einem Bündel. Ein paar kleine Gegenstände, mit denen angenehme Erinnerungen verknüpft waren, verstaute er in einem Beutel. Dort kamen auch die Münzen hinein, die seine Ersparnisse darstellten. Am Schluss holte er sein Schwert aus dem Versteck. Die Wälder jener Zeit waren keine behaglichen Orte. Die Ortschaften mit ihren Feldern, Weiden und Gärten bildeten Inseln innerhalb eines Meeres gewaltiger Bäume und undurchdringlichem Gestrüpp. Unbefestigte Wege, kaum breit genug für einen beladenen Wagen, verbanden die Flecken miteinander. Ohne zwingenden Grund drang niemand in die Wildnis ein. Dort teilten sich die Tiere und die Kobolde die Herrschaft. Waren die Wälder schon tagsüber unheimlich, so erst recht in der Nacht. Die vor den Häschern des Erzbischofs geflohenen jungen Männer schwiegen vor Unbehagen. Wenigstens gab es unter ihnen jemanden, der sich ein wenig auskannte. Sein Großvater hatte einst bei einem Grafen als Jäger seinen Lebensunterhalt verdient. Jeder klammerte sich nun fest an der schwachen Überzeugung, dass der Führer den Weg tatsächlich wisse. Selbst nahe liegende Fragen legte sich niemand vor. Was waren die Geschichten wert, die ein alter Mann an den langen Winterabenden seinem Enkel erzählte? Was hatte sich verändert in den zurückliegenden dreißig Jahren? Die erste Nacht war schrecklich. Als aber die Sonne aufging und den schwarzen Schleier von den Dingen nahm, da sah die Welt schon wieder 18 freundlicher aus. Die Bürgerssöhne richteten sich gegenseitig mit respektlosen Scherzen auf. Sie trugen Waffen bei sich. Sie waren jung und kräftig. Um sie herum wimmelte es von Tieren, die sich zum Essen eigneten. Warum also sollte ihnen vor der Zukunft bange sein? Bis zum Nachmittag schlugen sie sich durch das Dickicht, bis sie eine Stelle erreichten, die ihnen zum Errichten eines Lagers geeignet schien. Das Unterholz war weniger dicht als anderswo. Die nächsten Siedlungen lagen hinreichend weit entfernt. Bei einer Versammlung wurden die dringendsten Arbeiten verteilt. Norbert und drei andere gingen auf Jagt und kochten. Christian leitete eine Gruppe, die einen freien Platz schuf und mit dem Bau eines Holzhauses begann. Mehrere Wochen lang arbeiteten alle buchstäblich bis zum Umfallen. Selbst kleine Fortschritte waren nur unter unsäglichen Mühen zu erreichen. Sie hatten zu wenig geeignetes Werkzeug, um die riesigen Bäume zu fällen und zu zerlegen. Außerdem gab es niemanden, der sich auf den Hausbau verstand. Christian, der als Tischler dieser Arbeit noch am nächsten stand und ein gewisses Vertrauen genoss, bewunderte die Geduld seiner Gefährten angesichts seiner zahlreichen Irrtümer. Das Dach war erst beim dritten Versuch dicht und stabil. Nach und nach richteten sie sich leidlich ein. Besondere Ansprüche stellten sie nicht. Sie hatte reichlich zu Essen. Allein das war ein guter Grund, Gott zu danken. Ein klarer Bach ganz in der Nähe versorgte sie mit Wasser. Sogar einen Bienenstaat hatten sie sich inzwischen eingefangen. Selbstverständlich mussten sich alle an Regeln halten, um so mehr, da sie sich nicht zur Wahl eines Anführers entschließen mochten. Noch immer stimmten sie ab, sobald es etwas zu entscheiden galt. Diese Art des Zusammenlebens gefiel ihnen. Je länger sie sich bewährte, desto mehr sahen sie darin ein Beispiel für die Zukunft aller Menschen. Allerdings durften sie in ihrer Idylle niemals aus den Augen verlieren, dass sie außerhalb der Gemeinschaft der rechtschaffenen Leute standen, dass vieles, was sie taten, jeglichem Gesetz nach als Verbrechen galt. Der Wald mitsamt den Tieren darin gehörte jemandem (auch wenn sie nicht wussten wem). Wilderer und Diebe wurden aufgeknüpft. Wären sie in Bremen geblieben, hätten sie für den Aufruhr vor dem Dom vielleicht eine viel mildere Strafe erhalten. Sie konnten sich noch so tief in der Ödnis verstecken, irgendwann musste ihnen jemand auf die Spur kommen. Tausend Zufälle waren als Verräter denkbar. Zudem würden sie eines Tages gezwungen sein, jemanden nach Bremen zu schicken, um Dinge zu besorgen, die sich beim besten Willen mitten im Wald nicht herstellen ließen. Bei einer der Versammlungen hatte Norbert vorgeschlagen, eine Wache aufzustellen. Doch er war nicht durchgedrungen damit, wohl weil die meisten alle Gedanken an mögliche Gefahren gern verdrängen wollten. So traf es sie völlig unvorbereitet, als sie einige Tage später ungebetenen Besuch erhielten. Im Morgengrauen wurde Norbert vor der Hütte plötzlich durch einen schweren Fausthieb niedergestreckt. Christian, der zwei Schritt hinter ihm ging, konnte gerade noch zurückspringen. Nur dadurch gelang es ihm, nach seinem Schwert zu greifen und die anderen zu alarmieren. Die Hütte bestand nur aus einem einzigen großen Raum. Auf der rechten Seite waren Ställe abgeteilt (in denen sich allerdings noch keine Tiere 19 befanden). Links hatten die Bewohner ihre Schlafwinkel (die den Ställen auffällig ähnelten). Der Tür gegenüber war der Herd eingerichtet (über dem der Kochkessel fehlte). Licht konnte nur durch die Tür und durch insgesamt vier schmale, mit hölzernen Läden versehene Fenster eindringen. Am Morgen des Überfalls war es so dunkel, dass die Kämpfenden kaum zwischen Freund und Feind zu unterscheiden vermochten. Lange blieb völlig unklar, mit wem die Bremer Flüchtlinge es überhaupt zu tun bekommen hatten. Das änderte sich erst, als sich das Handgemenge ins Freie verlagerte. Die verwegene Kleidung der Angreifer verriet, dass es sich bei ihnen nicht um Waffenknechte eines adeligen Herrn handelte. Außerdem waren sie nur zu fünft. Je mehr die Verteidiger sich zu einheitlichem Handeln zusammenfanden, desto deutlicher wurde ihr Übergewicht. Das hieß nicht, dass sie nun leichtes Spiel hatten. Sie standen Männern gegenüber, die das Fechten gewöhnt waren und sich vor niemandem fürchteten, Raufbolden, die sich selbst in scheinbar auswegloser Lage nicht geschlagen gaben. Niemand hatte jedoch ein Interesse daran, Blut zu vergießen. Irgendwann sahen die Angreifer ein, dass die Überrumpelung nicht gelungen war, und boten Verhandlungen an. "Man nennt mich Rupert, den Räuber", erklärte der größte und kräftigste der Fünf. "Rupert, der Räuber - ein lustiger Name", rutschte Christian über die Lippen. Rupert wandte sich ihm zu und erwiderte mit leichtem Grinsen: "Es gibt Leute, die finden meinen Namen lustig, und es gibt Leute, die finden ihn nicht lustig. Zu letzteren gehören jene, denen ich die Kehle durchschnitt." Christian fürchtete, dass er nicht übertrieb. "Was wollt ihr von uns?" fragte Norbert, der sich von dem Fausthieb inzwischen erholt hatte. "Das sagt dir mein Stellvertreter Ernst Eisenarm." In Christians Richtung fügte er hinzu: "Ernst Eisenarm - auch ein lustiger Name, nicht wahr?" "Für diejenigen, die er am Leben zu lassen geruht ..." "Du bist ein Bursche mit Witz. Du gefällst mir." "Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich darauf Wert lege." Unterdessen trat Ernst Eisenarm vor Norbert hin und erklärte: "Das hier ist unser Gebiet. Wir wollen, dass ihr verschwindet." "Ein großartiger Vorschlag! Wir haben in wochenlanger Arbeit diese Hütte gebaut, um jetzt einfach weiterzuwandern!" "Die Hütte können wir gut gebrauchen." "Vielleicht haben wir gar nicht so viel Witz, wie ihr glaubt!" rief Christian dazwischen. "Was haltet ihr davon, den Kampf fortzusetzen?" "Wenn du dich mir Mann gegen Mann stellst, können wir's gern ausfechten", entgegnete Rupert gelassen. Norbert versuchte, seinen Freund durch ein Zeichen zu warnen. Christian jedoch hatte gerade einen seiner von tief innen kommenden, keines Anlasses bedürfenden Wutanfälle und stürzte sich mit seinem Schwert auf den Anführer der Räuberbande. Der war völlig überrascht. Er hatte den eher schmächtig wirkenden jungen Mann für einen Schwächling gehalten. "Was ist denn mit dem los?!" schrie er. "Hat ihn eine Schlange gebissen? Befreit mich doch von diesem Verrückten!" 20 Man trennte die beiden und begann endlich, ernsthaft zu verhandeln. "Machen wir gemeinsame Sache!" schlug Ernst Eisenarm vor. "Rupert sollte der Anführer sein. Er kennt sich am besten aus. Ihr könnt aus euren Reihen einen Stellvertreter wählen." "Wir haben keinen Anführer und wir wollen auch keinen", wies Norbert das Ansinnen zurück, ohne lange zu überlegen. "Ohne Anführer, wie soll das gehen? Wer bestimmt, was getan wird?" Die Räuber sahen sich gegenseitig verständnislos an, argwöhnten eine Finte. Rupert indes, der klügste von ihnen, ließ sich darauf ein, denn er hatte längst erkannt, wie hilflos diese Bürschchen aus der Stadt letztlich waren, auch wenn sie mit ihren Schwertern recht ordentlich zuschlagen konnten. Mochten sie ihre Hirngespinste von christlicher Gleichheit ausbrüten! Mochten sie sich fühlen wie die heiligen zwölf Apostel! Am Ende würden sie sich doch ducken müssen. Tatsächlich nutzten die unklaren Machtverhältnisse den Räubern mehr als den Bürgerssöhnen. Rupert konnte in den Versammlungen mit seiner Ausstrahlung jede beliebige Stimmung erzeugen. Mal versetzte er die Neulinge in helle Panik, mal köderte er sie mit verlockenden Versprechen. Seine Begründungen verstand niemand. Es wollte sich aber auch keiner die Blöße geben, beharrlich nachzufragen. Viel genutzt hätte das Misstrauen ohnehin nicht. Dass die Bekanntschaft mit den Räubern eine Bereicherung war, vielleicht sogar die Rettung, ließ sich nicht bestreiten. Natürlich blieb das Leben unter dem Einfluss eines Mannes wie Rupert nicht friedlich. Die Bande lebte nicht mehr nur von Wilderei allein (was schon schlimm genug gewesen wäre) sondern unternahm auch Raubzüge gegen einzeln stehende, schlecht zu verteidigende Gutshöfe und gegen die Handelsstraße zwischen Oldenburg und Wildeshausen. Eine Gruppe von siebzehn Männern war eine Streitmacht. Damit ließ sich mehr bewerkstelligen als mit fünf Leuten. Zugleich wurde die Hütte im Wald beinahe behaglich. Die Bereicherung bestand nicht nur in dringend notwendigen Gegenständen (wie einem eisernen Kessel zum Kochen über dem Herd) sondern auch in allerlei Luxus (wie einem Dutzend silbernen Kerzenhaltern). Man ließ es sich gut gehen. Unmerklich glichen sich die Bürgerssöhne in ihrem Verhalten und in ihrem Denken den Räubern an. 21 2.Kapitel I D er Palast des Erzbischofs von Bremen umfasste so viele Räume, dass der Kirchenfürst die meisten von ihnen kaum kannte. Dennoch hatten die Leute, die hier ihren (wie auch immer gearteten) Dienst verrichteten, in jedem Augenblick den Eindruck, ihr Herr stünde gerade hinter ihnen. Gerhard II war ein Mann, der auch kleine Nachlässigkeiten zu ahnden pflegte und der nichts dem Zufall überließ. Andererseits bot die gewaltige Macht, über die er verfügte, beträchtliche Aufstiegsmöglichkeiten, weshalb er trotz allem unter den Angehörigen seines Hofstaats weitaus beliebter war als in der Stadt unter den Handwerkern und Kaufleuten. Neben dem prächtig gestalteten Audienzzimmer und dem großen Saal für die bedeutenden Empfänge, neben seiner (damit verglichen) fast spartanischen Schlafkammer und dem mit Büchern und Pergamentrollen bis zur Decke hinauf voll gestopften Leseraum, nutzte der Erzbischof vor allem einen kleinen, in einer Ecke gelegenen Salon. Er liebte ihn vor allem, weil er auf zwei Seiten Fenster hatte. Durch das eine konnte er die Zufahrt zum Haupttor, durch das andere einen der Innenhöfe sehen. Das gab ihm das Gefühl, einen guten Überblick zu haben, also ganz Herr der Lage zu sein. Besonders bei vertraulichen und heiklen Gesprächen über politische Themen, zog er sich gern hierher zurück. An jenem Tage Anfang Mai 1230 war sein Bruder Hermann sein Gast. "Wir dürfen uns das dreiste Auftreten des Lüneburgers nicht länger bieten lassen", sagte er gerade und durchmaß den Raum in der Art eines Hauptmanns, der die Front seiner Ritter abschreitet. Gerhard war den Jahren nach längst kein junger Mann mehr, doch er wirkte wie jemand, der sich noch an den Ringkämpfen beteiligen könnte, die regelmäßig am Rande des Marktes ausgetragen wurden. Tatsächlich ging (unter den Bürgern) das Gerücht um, dass der Geistliche sich mehr der Stärkung seines Leibes als der seiner Seele widme. Mochte dies auch böswillige Erfindung sein, so waren es immerhin Tatsachen, dass er viel und gern ritt und dass er regelmäßig mit einem Waffenmeister das Fechten übte. "Otto wurde immer kühner, je länger wir ihn gewähren ließen." Die kurzen, energischen Handbewegungen, mit denen er seine Worte unterstrich, erweckten den Eindruck, als dringe er auch in diesem Moment mit dem Schwert auf einen Gegner ein. Seine Entschlossenheit konnte rasch in Unbeherrschtheit umschlagen. Diese Schwäche hatte ihn in der Vergangenheit um manchen Sieg gebracht. Allerdings war er sich dieses Umstandes mit zunehmendem Alter mehr und mehr bewusst. Seither bewies er auch die Fähigkeit, beharrlich auf günstige Gelegenheiten zu warten, und zwar in einem Maße, wie es ihm kaum jemand zugetraut hätte. Hermann ähnelte seinem Bruder dem Äußeren nach sehr. Er hatte dieselben dunklen Augen, denselben stechenden Blick, dasselbe kantige Kinn, dieselbe Größe. Allerdings war er nicht ganz so athletisch. Auch an Klugheit und Tatkraft stand er Gerhard nach. Dadurch hatte sich schon frühzeitig eine Rangfolge zwischen beiden eingestellt. Hermann erkannte die Überlegenheit des Bruders an und unterwarf sich ihm. In dessen Glanz fielen seine eigenen Unzulänglichkeiten weniger auf. Ernsthafte Zerwürfnisse waren zwischen ihnen selten. "Wir verfügen über ein starkes Heer", sagte er, als Gerhard seinen Gang durch den Raum beendete und sich ihm gegenüber setzte. "Was hältst du davon, wenn wir eine versprengte Gruppe seiner Ritter überrennen? Das würde ihn zwar nicht ernsthaft schwächen, ihn aber vielleicht nachdenklich stimmen." "Wie wollen wir in Erfahrung bringen, was wir für solch ein Unternehmen wissen müssten?" "Wir könnten einen Mann aus seinem Hofstaat entführen und dann in irgendeiner Burg ..." "Nein, nein!" rief der Erzbischof. "Das kommt überhaupt nicht in Frage!" "Niemand wird davon erfahren." "Nein und nochmals nein!" Gerhard war zwar (seinem Wesen nach) ein machthungriger Tyrann doch zugleich (im politischen Alltag) ein nüchtern kalkulierender Fürst, der ein Gespür dafür hatte, welche Mittel er anwenden durfte und welche nicht. Die verborgene, in bestimmten Situationen urplötzlich hervorbrechende Grausamkeit seines Bruders beunruhigte ihn. Hermann brachte es fertig, jemanden aus Vergnügen und ohne Rechtsgrundlage foltern zu lassen ungeachtet der Folgen. "Ich schicke ihm eine Botschaft mit der Andeutung, dass ich Verbindungen zum Papst angeknüpft hätte. Der Text muss unklar sein und sich in verschiedener Weise auslegen lassen." Otto von Lüneburg entstammte einer großen Familie, den Welfen. Der Sachsenherzog Heinrich der Löwe war sein Onkel, der ehemalige Kaiser Otto IV ein anderer Blutsverwandter. Dennoch hatte er vor drei Jahren am Rande eines Abgrundes gestanden. Vier Generationen lang kämpften die Welfen schon mit den Staufern erbittert um die Macht in Deutschland. Seit aber Friedrich II fest auf dem Thron saß, waren sie im Nachteil. Als König Waldemar II von Dänemark in Schleswig einfiel, erschien das dem Lüneburger wie ein Zeichen Gottes und er schloss ein Bündnis. Vermutlich indes hatte ihm in Wahrheit der Teufel den Rat erteilt, denn in der Schlacht bei Bornhöved erlitten er an der Seite des Eroberers aus dem Norden eine vernichtende Niederlage und fiel seinen Feinden in die Hände. Zu seinem Glück wollte das Schicksal (in Gestalt des Papstes), dass er nicht in einem finsteren Kerker verrottete oder gar auf dem Schafott endete. Friedrich II, einst als Pfaffenkaiser mit Hilfe der Kirche an die Macht gelangt, hatte seine Sympathien in Rom verspielt, seit er eigene Ziele verfolgte. Gregor IX beabsichtigte, in Deutschland das alte Gleichgewicht der Kräfte wieder herzustellen, und half den am Boden liegenden Welfen auf die Beine. Otto von Lüneburg kam durch seine Vermittlung nicht nur aus der Gefangenschaft frei sondern sogar zu Herzogswürden. Der Erzbischof von Bremen wäre verpflichtet gewesen, dem Papst bei diesem Vorhaben zu helfen, hätte dazu jedoch glatt über seinen Schatten springen müssen. Im Jahre der Schlacht bei Bornhöved starb der Pfalzgraf Heinrich von Stade ohne männlichen Nachfolger. Die Stadt selbst und die Dithmarschen fielen als erledigte Lehen zurück an das Bremer Erzbistum. Gerhard II hatte das Recht, sie nach Gutdünken neu zu verteilen. Otto von Lüneburg kam ihm jedoch zuvor. Er berief sich auf alte Rechte (was jeder Fürst in so ziemlich jeder Streitfrage mehr oder minder glaubwürdig zu tun 23 pflegte) und schickte seine Ritter ins Feld (was zweifellos das stärkste seiner Argumente war). Seither wogte der Kampf hin und her, ohne dass eine für beide Seiten befriedigende Lösung in Sicht kam. Gerhard hatte seinen Gang durch den Raum wieder aufgenommen und suchte nach Formulierungen für die Botschaft, die er Otto zu senden gedachte. Da klopfte jemand an die Tür. "Wir wollen nicht gestört werden, ehe ich eine andere Weisung gebe!" herrschte er den zaghaft eintretenden Diener an. Dieser ließ sich aber nicht abweisen: "Bischof Johannes und der Dompriester warten mit einer außerordentlich wichtigen Neuigkeit." Gerhard ballte die Hände zu Fäusten, behielt aber die Beherrschung und sagte, plötzlich sichtlich entspannt: "So führe denn die beiden herein!" Johannes war Bischof von Lübeck, hielt sich aber häufig in Bremen auf, weil er in Personalunion als Prior dem vor einigen Jahren in der Stadt gegründeten Dominikanerkonvent vorstand. Gegenüber dem großen und kräftigen Erzbischof wirkte er beinahe zerbrechlich. Dabei ließ ihn seine Mönchskutte eher noch beleibter erscheinen, als es der Wahrheit entsprach. Aus den weiten Ärmeln ragten zwei schmale Hände hervor, die eher einem Musiker oder Maler zu gehören schienen. Alles an ihm war geprägt von einer ausgewogenen Mischung aus Vornehmheit und Bildung. Seine gemessenen Bewegungen und seine ruhige Art zu reden brachten das vielleicht noch am augenfälligsten zum Ausdruck. Die Nachricht, die er zu überbringen hatte, verlor durch seinen Mund viel von ihrer Rohheit. "Es wäre mir gewiss nicht eingefallen, Euch zu unterbrechen, hätte nicht der Lauf der Ereignisse mich dazu gezwungen. Verzeiht mir! Gott, der Herr, ließ in seinem unerforschlichen Willen zu, dass die Stedinger in Eure Schlutterburg eindrangen." Wer nicht um die Bedeutung der Mitteilung wusste, hätte sich nicht beunruhigt, nicht einmal ein Kind, so sanft war die Stimme des Dominikaners gewesen. Sogar Gerhard benötigte einen Augenblick der Besinnung, ehe er das Ausmaß der Katastrophe begriff und fassungslos entgegnete: "Auf der Burg war eine starke Besatzung. Warum haben die Waffenknechte den unverschämten Bauern nicht auf Haupt geschlagen?" "Vermutlich bedienten sich die Angreifer einer List. Wenn sich Eure Waffenknechte Nachlässigkeit haben zu Schulden kommen lassen, so solltet Ihr ihnen diese nicht länger nachtragen, denn Gott, der Herr, geruhte die meiste von ihnen zu sich zu nehmen." "Die Bauern haben meine Waffenknechte erschlagen? Sie haben gewagt ..." Gerhard rang nach Luft, drohte an seinem ohnmächtigen Zorn zu ersticken. Johannes indes sprach ruhig weiter, als preise er die Lieblichkeit des Gartens Eden. "Ich hörte, dass die aufständischen Stedinger inzwischen weiter gezogen sind, auf das Kloster von Hude zu. Leider wird niemand sie daran hindern, auch dort ihre Lust am Zerstören zu befriedigen. Unsere Brüder vom Orden der Zisterzienser haben gerade erst zu bauen begonnen und der Wehrfähigkeit noch nicht in ausreichendem Maße ihre Aufmerksamkeit widmen können." "Noch weiß niemand genau zu sagen, welches die letzten Ziele des Aufruhrs sind, so dass wir mit dem Schlimmsten rechnen müssen", mischte sich der Dompriester ein, der sich bisher im Hintergrund gehalten hatte. 24 Er war ein fülliger Mann, dem man nicht zutraute, dass er sehr beweglich sein konnte. Auch, was seinen Verstand anging, unterschätzten ihn die meisten Leute. Er selbst hatte übrigens gar kein Interesse daran, dass seine Fähigkeiten öffentlich gepriesen würden. Seine Taktik beruhte darauf, sich still, beinahe heimlich nach oben zu arbeiten. An Ehrgeiz nämlich mangelte es ihm nicht. Vielleicht war er derjenige unter all den Leuten, die in der erzbischöflichen Residenz ihren Lebensunterhalt verdienten, der am geschicktesten die Macht des Kirchenfürsten auszunutzen verstand. Allein Gerhard musste ihn zu schätzen wissen, und das traf zu. Der Dompriester wurde mit den schwierigsten Missionen betraut. Angesichts der zerstörten Schlutterburg mochte sich der Erzbischof allerdings selbst auf den treuesten seiner Untertanen nicht verlassen. Von dem, was sich dort an Ungeheuerlichem zugetragen hatte, wollte er sich mit eigenen Augen überzeugen. "Diener!" rief er. "Lass vier Pferde satteln!" Niemand widersprach, obgleich das Vorhaben, trotz des Gerüchts, die aufständischen Bauern hätten sich inzwischen dem Kloster Hude zugewandt, noch immer gefährlich genug war. II V on Ferne sah man der Burg kaum an, dass sie gerade überrannt worden war. Der Bergfried blickte noch immer hochmütig auf das flache Land und seine Dörfer herab. Die Mauern der Steinbauten ragten noch immer scheinbar unversehrt auf. Verdacht erregten allein die Rauchfäden, die sich von verschiedenen Stellen aus zum Himmel ringelten. Erst, als die vier Männer näher kamen, änderte sich ihr Eindruck. Die Fenster waren nur noch dunkle Löcher mit schwarzen Kronen aus Ruß. Jeder Windstoß wehte eine Wolke beißenden Qualms herüber. Unheimlich wurde der Ort auch durch die Stille ringsum, eine ungewöhnlich tiefe Stille, wie sie sonst nur kalten Wintertagen eigen ist. Die aufständischen Bauern waren wohl weiter gezogen, aber warum fehlte jedes Zeichen von Überlebenden der Burgbesatzung? Hatte Gott, der Herr, sie allesamt "zu sich genommen". Selbst der sonst so forsche Erzbischof war blass geworden und sprach kein Wort. Der Dompriester hätte am liebsten auf der Stelle sein Ross gewendet. Er fragte sich schon seit dem Aufbruch, weshalb vernünftige Menschen unter Gefahr einen Schauplatz aufsuchten, an welchem sich allem Anschein nach ohnehin nichts mehr retten ließ. Leider musste er schweigen, um nicht in den Augen seines Gönners als Feigling dazustehen. Hermann lenkte sich ab, indem er seine Gedanken drei Jahre zurückschweifen ließ. Im Jahre 1227 hatte Gerhard schon einmal ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, die Stedinger mit Heeresmacht zurück in die Gewalt des Erzbistums zu zwingen. Die Schlutterburg lag mitten im Gebiet der Bauern und war somit ein Faustpfand von unermesslichem strategischem Wert. Hermann erhielt den Auftrag, von hier aus den Feldzug vorzubereiten. Die Burg wurde mit Waffen voll gestopft. Auf dem Hof standen Zelte, in denen jene Ritter und 25 Knappen wohnten, die in den Gebäuden keine Unterkunft gefunden hatten. Aus verschiedenen Gründen (nicht zuletzt wegen der Machenschaften Ottos von Lüneburg) war Gerhard von seinem Plan noch vor dem ersten Schwertstreich wieder abgerückt. In der Umgebung der Burg aber hatten die Bauern freiwillig wieder Abgaben entrichtet. Inwieweit Hermann ihrer Gutwilligkeit nachhalf, blieb eine offene Frage. Die Bauern redeten von beispiellosen Grausamkeiten. Doch das hatte in einer Zeit, da beide Seiten sich durch haarsträubende Beschuldigungen aller Art wechselseitig zu überbieten trachteten, nicht viel zu sagen. Johannes war der einzigen, der unberührt blieb vom Anblick der ausgebrannten Burg, äußerlich zumindest. Er war dann auch derjenige, der das Schweigen brach. "Viele Herren dieser Welt sind geneigt, dem aufrührerischen Geist des Volkes zu wenig Bedeutung beizumessen. Der Teufel erreicht das Ohr des Ungebildeten eher als das des Gebildeten. Die Bauern sind wie Schafe. Ist der Hütehund nicht am rechten Fleck, so brechen sie aus zu ihrem eigenen Schaden. Wir sind ihnen gefällig, wenn wir sie züchtigen." Gerhard nahm die Rüge mürrisch aber wortlos hin. Er warf sich bereits selbst vor, sich zuviel mit Otto von Lüneburg und zuwenig mit den Stedingern auseinandergesetzt zu haben. "Es ist an der Zeit, den Ketzereien in den Dörfern des Marschlandes auf den Grund zu gehen", fuhr Johannes fort. "Man muss das Unkraut kennen, um es mitsamt all seinen Wurzeln ausraufen zu können. Fast immer ist das verderbliche Verlangen nach Unzucht der Stachel für Aufsässigkeit wider die heilige römische Kirche. Nicht ohne Grund lehrte der Apostel Paulus, dass dem Himmel näher steht, wem es ge- lingt, jenen niederen Trieb ganz und gar in sich zu bezwingen. Wer zu schwach ist dafür, der möge heiraten. Ohne Aufsicht freilich werden diese schwachen Naturen ein sittsames Eheleben nicht zu führen imstande sein. Die Männer werden zum puren Vergnügen (statt zum alleinigen Zwecke der Zeugung) zwischen den Schenkeln ihrer Weiber liegen. Manchem wird gar das nicht genügen, so dass er den Huren auf den Leim kriecht. Das höchste Maß jedoch erreicht der Frevel dort, wo man jene Priester, die sich mit ihren Ermahnungen dem Laster in den Weg stellen, misshandelt und davonjagt." Gerhard hörte dem Dominikaner nur mit halbem Ohr zu. Theologische Ausführungen langweilten ihn. Sein reger Geist war mehr den praktischen Dingen zugetan als den wissenschaftlichen. Allerdings spielte Johannes in fast all seinen Plänen eine wichtige Rolle. Die Beziehungen des unscheinbaren Mönchs mit der sanften Stimme einer Amme reichten bis zum Papst. Zudem war er nicht nur ein guter Theologe sondern zudem ein guter Jurist. Sein Wissen würden vielleicht entscheidend sein, wenn es galt den großen Feldzug zu begründen. Der Verlust der Schlutterburg bewies, dass den Stedingern nur mit Hilfe der weltlichen Herren beizukommen war. Die wiederum ließen sich so leicht nicht zu einheitlichem Handeln bewegen. "Ich werde veranlassen, dass die Burg schon im nächsten Jahr wieder ihrem Zweck dient", verkündete der Erzbischof entschlossen, während er durch das Haupttor auf den Hof ritt. Unmittelbar hinter dem hochgezogenen Fallgitter lagen etliche Männer, Bauern und erzbischöfliche Waffenknechte in annähernd gleicher Zahl. Man konnte glauben, sie seien plötzlich erstarrte, gerade als sie heftig miteinander rangen. Der Boden war 26 dunkel von versickertem Blut. Sogar die Pferde scheuten, als sie über die leblosen Leiber hinwegsteigen sollten. Auf dem Hof hatte der Kampf offenbar weniger heftig getobt. Dort lagen die Leichen verstreut. Die meisten waren Angehörige der Burgbesatzung. Vielleicht hatten die Stedinger bereits die Oberhand gewonnen und ihre Feinde wie Hasen gejagt. Ob die Gebäude im Getümmel durch Zufall in Brand geraten waren, oder ob die Sieger sie mit Vorbedacht angezündet hatten, ließ sich nicht mehr feststellen. Von den Holzhäusern standen nur noch verkohlte Balken. In den Steinbauten konnte man vom Erdgeschoß aus den Himmel sehen. In den Flammen hatten weitere Männer den Tod gefunden. Angesichts dieses Grauens musste sich selbst Johannes abwenden. Der Dompriester übergab sich und flüchtete, ohne auf seinen Dienstherrn zu achten. "Diesen Tag werden die Stedinger verfluchen!" rief Gerhard II. Er war ein Feind der Marschlandbauern gewesen, seit er im Palast von Bremen residierte. Er hatte niemals hinnehmen wollen, in einem Teil seines Besitzes nicht mit aller Machtvollkommenheit schalten und walten zu können. Bisher aber war dies für ihn ein Ärgernis unter anderen gewesen, gleichrangig etwa mit den Anmaßungen eines Ottos von Lüneburg oder mit den Unverschämtheiten der Bürger seiner Stadt. "Ich habe die Universitas Stedingorum unterschätzt", sprach er, mehr zu sich selbst als zu den anderen. "Sie führen ein eigenes Siegel. Sie regeln ihre Angelegenheiten selbst, die höhere Gerichtsbarkeit eingeschlossen. Die lockeren Zügel haben sie kühn gemacht. Nun sind sie so schwer zu bändigen wie ein durchgegangenes Pferd." Um dies klar zu erkennen, benötigte er nicht die Bildung des Dominikaner Johannes. Von nun an waren die Stedinger sein Hauptfeind. Noch am selben Abend wollte er vor dem Hochaltar des Doms mit Christus, Maria und allen Heiligen als Zeugen den Schwur ablegen, nicht eher zu ruhen, ehe diese zum Himmel schreiende Ketzerei beseitigt ist. Schon auf dem Rückweg sprach er mit seinem Bruder über einen ersten Plan auf dem Weg zu seinem Ziel: "Es wäre gut, wenn wir noch eine zweite gut befestigte Burg westlich von Bremen hätten." "Mit zwei Burgen könnten wir sie in die Zange nehmen", pflichtete Hermann ihm bei. "Am Delmenhorst werde ich sie bauen lassen." "Ich denke, das ist ein guter Ort." Auf dem Marktplatz von Bremen trennten sich die vier Männer. Johannes begab sich zum Konvent der Dominikaner. Hermann erklärte, dass er bereits seit Mittag erwartet werde. Der Dompriester wurde von einem Vikar in Anspruch genommen, weil sich bei Ausbesserungen an einem der Nebenaltäre unvorhergesehene Komplikationen ergeben hatten. Gerhard blieb allein zurück und fand sich zufällig direkt vor jenem Haus wieder, wo anlässlich der Fastensynode die Wappenreihe frisch auf die Wand gemalt worden war. Die zwei blutroten Ammerlandlinien der Oldenburg, die an den sagenhaften Löwenkampf zu Zeiten Kaiser Heinrichs IV erinnerten; die drei Hallermundrosen der Wildeshausener; das verwirrend zerteilte Hoheitszeichen der Bruchhausener. In seiner Phantasie sah der Erzbischof die drei Grafen im Kreise ihrer Ritter und Knappen auf einer weiten Wiese vor ihm stehen, bereit zur großen Schlacht für die 27 Wiederherstellung der von Gott gestifteten Ordnung auf Erden. Sie hatten ihre Fehden beendet für dieses eine Ziel. Sie waren endlich zu der Einsicht gelangt, dass es Wichtigeres gab als einen strittigen Flecken dürftigen Ackerlandes. Der wohlmeinende Hinweis eines Ritters seiner Leibgarde riss ihn jedoch aus seinen Träumen. "Eure Eminenz sollten sich nicht ohne Schutz hier aufhalten. Die Stimmung ist nicht gut in der Stadt." Bremen stand tatsächlich am Rande eines allgemeinen Aufstandes. Der Erzbischof hatte sich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass nicht einige wenige Unruhestifter dafür verantwortlich waren. Die Bürger hielten ohne zu wanken den Rädelsführern aus dem Rathaus die Stange. Festnahmen hätten die Lage nur noch verschlimmert. Welch ein Berg von Schwierigkeiten auf dem Wege zur Züchtigung der Stedinger! Die Kaufleute forderten täglich größere Freiheiten. Die Handwerker wollten keine Steuern mehr bezahlen. Und selbstverständlich zerfleischten die Grafen einander weiterhin wegen eines Fleckens dürftigen Ackerlandes und dachten gar nicht daran, ihre Ritter und Knappen ins Feld zu führen für die Sache der Kirche. 28 3.Kapitel I A ls ihn ein Diener ins Empfangszimmer des Grafen von Wildeshausen geleitete, hatte Wilhelm von Westerholt bereits geraume Zeit vor dem Palas auf dem Haupthof der Burg gewartet. Doch der erfahrene, knapp fünfzigjährige Lehensritter ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Er kannte seinen Dienstherrn, kannte dessen Launen, kannte aber auch die Zeichen, an denen sich wirkliche Gefahren ablesen ließen. An diesem Tage war Burchard guter Stimmung. Er hatte sich zum Frühstück ein kleines Weißbrot bringen lassen. Solcherlei Luxus leistete er sich immer dann, wenn er mit einem bedeutenden Erfolg rechnete. "Ich erweise dem Herrn Grafen meine Ehrerbietung", sagte Wilhelm beim Eintreten, wobei er nach Sitte und Anstand die rechte Hand auf die Brust legte und sich tief verneigte. Burchard gab sich streng, wie er es häufig tat, um seine Untergebenen einzuschüchtern. Obgleich er bereits mehr als dreißig Jahre über seine Grafschaft herrschte, was ihm ein gewisses Maß an Abgeklärtheit hätte geben müssen, fühlte er sich überall und von jedem bedroht. Er ließ die Köche vor seinen Augen die Speisen kosten, um vor Gift sicher zu sein. Er unterhielt ein ganzes Heer geheimer Spitzeln, die er sogar gegeneinander einsetzte. Und um ganz sicher zu gehen, umgab er sich mit magischen Zeichen, einem Netz aus Hokuspokus, das der Burggeistliche argwöhnisch beobachtete und zuweilen sogar (mit aller gebotenen Vorsicht) missbilligte. Lange hielt der Graf seine strenge Miene jedoch nicht durch. Die guten Aussichten waren diesmal stärker als das Misstrauen. Außerdem rechnete er Wilhelm zu den ehrlichsten unter seinen Dienstmannen. Das lag weniger daran, dass er seine Moral hoch einschätzte. (Das tat er bei niemandem.) Er glaubte vielmehr, dass dieser Hüne mit dem allmählich ergrauenden Haar und dem von Falten zerfurchten Gesicht für einen Schurkenstreich zu einfältig sei. Sein Lehen lag eingezwängt zwischen Sümpfen, gewissermaßen am Ende der Welt. Wer von dort kam, galt in den größeren Schlössern der Gegend von vornherein als dumm. Übrigens tat Wilhelm wenig gegen dieses Vorurteil. "Du weißt, dass ich den Besuch des Erzbischofs erwarte", sagte der Graf und versuchte, seine Worte bedeutungsschwer klingen zu lassen. Der Ritter nickte, ohne eine Miene zu verziehen. Bei Burchards Unberechenbarkeit war es das Beste, überhaupt keine Gefühle zu zeigen. "Ich habe dich ausgewählt für eine besondere Aufgabe", fuhr der Graf feierlich fort. "Du sollst die Vasallen samt ihrem Gefolge einweisen, dass jeder auf seinem Platz steht, wenn Gerhard eintrifft." "Ich denke, ich weiß, was ich zu tun habe", entgegnete der Ritter. Tatsächlich war Wilhelm mit den Ehrenämtern am Hof zu Wildeshausen bestens vertraut. Mochte sein Land auch klein sein und zwischen Sümpfen liegen, so war es doch politisch bedeutungsvoll - wegen des (inzwischen drei Jahre alten) Vertrags, der (mit Vorbedacht unklar gestaltet) die Westerholts zwar formal als Vasallen des Grafen von Oldenburg auswies, sie aber bis auf weiteres den Wildeshausener Verwandten unterstellte, ausgeliehen gewissermaßen. Da die beiden Grafenfamilien verfeindet waren und das Land der Ritterfamilie genau zwischen deren Burgen lag, brachte das zahlreiche Verwicklungen mit sich. Die missliche Lage der Dinge schrie geradezu nach einem besseren Vertrag, doch solche Bestrebungen hintertrieb wiederum (wohl berechnend) der Erzbischof von Bremen. Burchard litt noch immer unter der Schmach des Prozesses, den man ihm zugemutet hatte, damals in Oldenburg nach dem verlorenen Krieg gegen seinen Bruder Heinrich von Bruchhausen. Er musste seither vorsichtig sein, denn eine weitere Feindseligkeit konnte ihn in Acht und Bann werfen. Doch der stolze Wüterich war gewissermaßen über seinen Schatten gesprungen. Er hatte sich (da er nun einmal die völlige Freiheit vorerst nicht wiedererlangen konnte) dem mächtigsten seiner ehemaligen Gegner unterworfen, dem Erzbischof. Gerhard II von Bremen war immerhin ein Fürst, der einem anderen Stand angehörte und somit über der Familienfehde stand. Einen erkennbaren Vorteil hatte Burchard die neue Verbindung bereits gebracht. Die Grafen von Wildeshausen übten traditionell die Vogtei über das vor fast dreihundert Jahren gegründete Alexanderstift aus. Da dieses zu den berühmtesten Pilgerstätten weit und breit gehörte, war es ziemlich reich, weshalb sich wiederum die Kanoniker kam retten konnten vor weltlichen Herren, die vorgaben, ihnen Schutz gewähren zu wollen - allen voran Herzog Albert von Sachsen, der eine ganze Reihe weltlicher und geistlicher Parteigänger hinter sich wusste. Vor Gerhard II jedoch musste er schließlich zurückweichen. Im Jahre 1228 verzichtete er plötzlich (wodurch auch immer zum Sinneswandel veranlasst) für alle Zeit auf die Vogtei. Zu Burchards Leidwesen gewährte der Erzbischof solche Vergünstigungen nicht ohne Gegenleistung. Er bestand nun auf dem formalen Lehenseid. Die Unterzeichnung der Urkunde erfolgte seinerzeit mit großem Gepränge. Achtundvierzig hochgestellte Persönlichkeiten waren zugegen. Boten verbreiteten die Nachricht in alle Welt. Das Ereignis fand (zumindest in Niedersachsen) viel Beachtung. In Oldenburg löste es geradezu Unruhe aus. Wilhelm von Westerholt wusste über all diese Dinge gut Bescheid. Er und seine Familie hatten bisher eher Nutzen gehabt von den Ränken um sie herum. Doch das konnte sich über Nacht ändern. Der Ritter fühlte sich nicht selten wie der Kapitän eines kleinen, vom Sturm umher gewirbelten Schiffes. Wie alle rechtschaffenen, friedfertigen Menschen wünschte er sich ruhigeres Fahrwasser, auch um den Preis gewisser Nachteile. Leider hatte er darauf wenig Einfluss. Er konnte nur die Neuigkeiten verfolgen und sich darauf einzustellen versuchen. Sich diese zu verschaffen, fiel ihm freilich nicht allzu schwer. Oft drängte Burchard sie ihm regelrecht auf, so auch diesmal. "Der Erzbischof plant einen Feldzug gegen die Stedinger", begann er zu plaudern, "und sucht einen weltlichen Herrn, der im Feld die Führung übernimmt. Nun verhält es sich so, dass die Oldenburger dem Unternehmen fern bleiben wollen. Wenn aber Graf Christian II nicht in Frage kommt, wird Gerhard sich wohl auf mich besinnen müssen." Vorfreude und Begeisterung trieben Burchard hoch von seinem Stuhl. Sein Blick schweifte über die Wand mit den von Wappen flankierten Gemälden seiner Vorfahren. Zweifellos hatte er in diesem Moment vergessen, unter 30 welchen Umständen er an die Seite des Erzbischofs geraten war. Erst einige Zeit später kamen ihm Bedenken, vielleicht zuviel von sich preisgegeben zu haben. "Genug geredet!" rief er nun aus. "Wir müssen unsere Vorbereitungen treffen." "Gewiss!" sagte Wilhelm, verneigte sich und ging hinunter auf den Hof, wo mehrere Höflinge und Ritter ihn bereits erwarteten. II W ährend Agnes über den Hof schlenderte, gab sie sich die größte Mühe, ihre innere Erregung zu verbergen. Seit ihr Vater im Palas verschwunden war, fand sie keine Ruhe mehr. Sie versuchte, sich das Gespräch mit dem Grafen vorzustellen, verlor sich dabei aber immer wieder in vagen Vermutungen. Leider ließen sich Burchards Reaktionen niemals voraussehen, nicht einmal für diejenigen, die ihn seit Jahren kannten. Nüchtern betrachtet, durfte sie sich nicht viel ausrechnen. In der Burg waren alle ganz auf den Besuch des Erzbischofs eingestellt. Der Vater hatte ihr schon im Voraus gesagt, dass er ihr Anliegen wohl kaum würde anschneiden können. Aber gerade weil Burchard so unberechenbar war, im Guten wie im Bösen, mussten die Voraussagen ja nicht unbedingt stimmen. Eigentlich hätte Agnes mit einer Handarbeit beschäftigt sein sollen. Mit der Behauptung, sie könnte sich wegen heftiger Kopfschmerzen nicht konzentrieren, war sie jedoch dem engen, stickigen Raum zwischen Palas und Burgkapelle entronnen. Dass sie nun für jedermann sichtbar über den Hof stolzierte, konnte sie sich leisten, denn ihr Ansehen in Wildeshausen hatte sich während der vergangenen sechs Jahre langsam aber nahezu stetig entwickelt. Seit sie sogar der Graf vorzog, wagte kaum noch jemand, ihr einen Wunsch abzuschlagen. Die Sechzehnjährige war im strengen Sinne keine Schönheit. Sie sah stets ein wenig kränklich aus und auch die weiblichen Rundungen prägten sich bei ihr langsamer aus als bei anderen Mädchen. Weil schon ein Wetterumschwung reichte, sie für zwei, drei Tage aufs Bett zu werfen, blieb sie (obgleich sie selten wirklich in Gefahr schwebte) blass und mager. Noch immer wirkte sie kindlich. Dabei hatte sie schon mit acht Jahren nach Kleidern im Schnitt erwachsener Frauen verlangt. Sie war ehrgeizig und konnte bei ihren hochfliegenden Plänen nicht viel mehr in die Waagschale werfen als ihren Charme. Der allerdings half ihr beträchtlich. Sie besaß ein angeborenes Talent, sich anzupassen und fand unbewusst fast immer die richtigen Bewegungen und die richtigen Worte. Mittlerweile hatte sie eine Eleganz erlernt, die sie wie die Tochter des Burgherrn erscheinen ließ. Sie lief in prächtigen Kleidern einher. Ihre dichten, tiefschwarzen Haare ließ sie lang bis weit in den Rücken hinein fallen und zierte sie mit goldenen und silbernen Spangen. Manchmal zischelte eine neidische Rivalin, dass ihr sowohl die meisten Kleider als auch der gesamte Schmuck nur geliehen waren. Doch das durfte sie getrost überhören, solange sie eine unangefochtene Stellung genoss. Die Frau des 31 Burgvogts, der die Beaufsichtigung der heranwachsenden Mädchen bei der Arbeit oblag, hatte nicht lange nachgefragt, als ihr Zögling sich davonstahl. Trotz all dem gab es freilich etwas, das an Agnes nagte und sie befürchten ließ, ihr könnten eines Tages die Felle davonschwimmen. Allmählich kam sie nämlich in jenes Alter, wo sie verheiratet werden musste. Viele Mädchen waren schon mit zwölf oder dreizehn Jahren Ehefrauen. Eine Achtzehnjährige galt bei manchen Männern bereits als Sitzengebliebene. Der Graf hatte versprochen, mit dem Vater über einen angemessenen Bräutigam zu reden und einen Bewerber aus dem Hochadel in Aussicht gestellt. Doch seit drei Monaten geschah nichts. Weil sich das junge Mädchen in den Kopf gesetzt hatte, den Vater am Portal des Palas abzupassen, drehte sie eine Runde nach der anderen um den in der Mitte frei stehenden Bergfried und kam sich dabei allmählich dumm vor. Ihr kaum zu verbergender Müßiggang stand in zunehmend peinlichem Gegensatz zur Geschäftigkeit der Knechte, die unter Geschrei die Fassaden verzierten, und der Mägde, die für das Essen im Rittersaal Speisen und Getränke heranschafften. Sie war schon nahe daran, das Warten aufzugeben und zurück ins Handarbeitszimmer zu gehen, da entdeckte sie etwas, das sie noch einmal auf dem Hofe festnagelte. Durch das breite Tor, das sich zwischen Palas und Burgkapelle unterhalb einer Brücke aus mehreren kleineren Räumen zur Stadt hin auftat, ritt gerade ein junger Mann mit hellblondem, welligem Haar. Er trug ein enges, grünes Gewand. Drei Hunde umringten ihn mit lautem Kläffen. Er hatte also die Stirn besessen, vor dem Empfang des Erzbischofs noch auf die Jagd zu gehen! Seine Beute bestand lediglich aus zwei Hasen, die von seinem linken Arm herab baumelten. Wahrscheinlich war er nur kurz im Wald gewesen, vielleicht allein deshalb, um aller Welt zu zeigen, dass er sich dergleichen erlauben durfte. Im Grunde war Agnes ein vernünftiges Mädchen. Missgünstige Leute warfen ihr vor, kalt und berechnend zu sein. Sobald aber der Sohn des Grafen sich zeigte, vermochte sie nicht mehr klar zu denken. Sie liebte ihn mit der Tiefe und Bedingungslosigkeit der ersten echten Leidenschaft. Dabei scherte sie sich weder um die hämischen Bemerkungen, denen sie sich seinetwegen mehr und mehr aussetzte, noch darum, dass er ihr niemals ein Lächeln, geschweige denn ein Wort gönnte. Sie verehrte ihn wie ein übernatürliches Wesen, fand sogar einen besonderen Reiz dabei, für ihre Liebe zu leiden. Der fünfundzwanzigjährige Heinrich war ein hübscher Bursche, für den nicht nur heranwachsende Ritterstöchter schwärmten. Allerdings erzählte man sich (hinter vorgehaltener Hand) auch ein paar merkwürdige Geschichten über ihn. Dass er sich mit seinem Vater nicht verstand und sich häufig fern von Wildeshausen aufhielt, kreidete ihm kaum jemand an. Schwerer wogen da schon die Gerüchte, er leide unter Anfällen von Schwermut. Nicht immer, wenn er aus der Burg verschwand, ritte er zur Jagd, zum Turnier oder zu einem Feldzug. Manchmal ziehe er sich vielmehr zurück in eine Einsiedelei, wo er bei einem steinalten Mönch den Frieden in Christus suche. Obgleich die Welt ihm zu Füßen zu liegen schien, quälten ihn Zweifel. Innerhalb von nur drei Jahren hatte er zweimal seine Frau durch Krankheit verloren. Beide male waren politische Gründe ausschlaggebend für die Hochzeit gewesen. Beide male kannte 32 er die Braut kaum, als er sie zum Traualtar führte, und die wenigen Ehemonate trugen nicht dazu bei, dass er ihr wirklich nahe kam. Beide male also war der menschliche Verlust eher gering. Doch Heinrich zitterte seither vor einem Fluch, den er auf sich lasten fühlte, obwohl er keineswegs so abergläubisch war wie sein Vater. Mit den Zweifeln schlichen sich Missgeschicke in sein Leben ein. Man nannte ihn den Bogener, weil er mit dem Pfeil wie kein anderer getroffen hatte. Doch das war nicht mehr immer so. Auch zwischen den Schranken gewann er nicht mehr wie einst. Großartigen Triumphen folgten unvermittelt grässliche Tage, an denen er das Gefühl hatte, wie sein Schatten neben sich selbst zu stehen, und an denen er sich bös blamierte. Agnes wusste von dem allem nichts weil sie es nicht wissen wollte. Das Verlangen, sich an seine breite Brust zu werfen und sein blondes Haar durch die Finger gleiten zu lassen, brachte sie fast um den Verstand. So kam es, dass sie vor Schreck aufschrie, als sie plötzlich von der Seite angesprochen wurde. "Ich bin es nur!" beruhigte sie ein junger Mann mit gutmütigem Lächeln. Wilbrand war ebenso groß wie Heinrich der Bogener, jedoch nicht kräftig und frisch wie dieser sondern aufgequollen dick und träge. Er wirkte derart ungelenk, dass man ihm nicht einmal zutrauen mochte, auf einem Pferd reiten zu können. Sein breites Gesicht war blass und glatt wie bei einem ungesunden Kind. Allerdings strahlte er gerade dadurch die Friedfertigkeit eines Heiligen aus. Seiner Einfältigkeit wegen wurde er immer wieder gehänselt, selbst von den Gören der Dienstleute, wehrte sich aber fast nie, sondern entwaffnete durch seine Ruhe. Agnes freilich wusste das nicht zu schätzen. Sie konnte ihn nicht ausstehen. Unglücklicher Weise bemerkte er das nicht, denn sie erinnerte ihn an seine kleine Freundin, die er vor drei Jahren verloren hatte, und zwar so plötzlich und auf so merkwürdige Art, dass er in seinem massigen Schädel noch immer darüber nachgrübelte. Zwischen ihm und Franziska war so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft entstanden. Sie wurde grün und blau geschlagen, weil sie sich mit dem Stolz und dem Eigensinn einer jungen Katze der Burgvogtsfrau widersetzte. So weit er sich zurückbesinnen konnte, hatte nur sie ihn wie einen Menschen behandelt. Seine unschuldige Zuneigung übertrug sich nun (unverdientermaßen) auf Agnes, die ungleiche Schwester. "Wie geht es dir?" wollte er wissen. "Ich muss ins Handarbeitszimmer", entgegnete sie und versuchte, ihm zu entfliehen. Gerade war aber ihr Vater am Portal erscheinen. Die Leute, die ihn umringten, um Anweisungen zu erhalten, versperrten die Tür. Agnes musste warten und Wilbrand nutzte die Gelegenheit, ihr ein Gespräch aufzudrängen. "Mutter geht es nicht gut", sagte er und drehte verlegen an seinen Knöpfen. Er meinte die Gräfin. "Ich habe Angst, dass ihr etwas passiert." Eigentlich hatte er Kunigunde de Schodis nicht viel zu verdanken. Es wäre ihre Pflicht gewesen, ihm zu helfen gegen all diese bösartigen Hofschranzen, die sich auf seine Kosten belustigten. Doch trotz seiner Einfalt spürte er, dass sie ihn nicht aus bösem Willen vernachlässigte. Sie litt wohl unter dem selben dunklen Schicksal wie er selbst. Wie oft schon hatte er erlebt, wie der Graf sie anschrie und verprügelte! Als Kind hatte ihn das gegrämt. Später war er abgestumpft, denn es gab so vieles um ihn herum, 33 was er nicht verstand und was er nicht ändern konnte. Seit zwei Jahren hatte die Gräfin eine sonderbare Krankheit. Wochenlang konnte sie das Bett nicht verlassen. Manchmal schien es, als werde sie nicht wieder aufstehen. Dann aber erholte sie sich plötzlich. Für einen Monat oder auch für zwei bekam sie eine frische Gesichtsfarbe. Sie wurde unternehmungslustig, kehrte den Übermut eines jungen Mädchens heraus. Doch von einem Tag auf den anderen kehrte das Übel zurück. Wie immer, wenn sich Unerklärliches zuträgt, war das Aufsehen groß. Jedermann versicherte, von einem derartigen Fall noch nie gehört zu haben. Der Burggeistliche bemerkte einmal zu Burchards Verdruss viel sagend: "Lasst uns überlegen was Gott uns lehren will, indem er uns mit dieser Plage schlägt!" Wilbrand hatte sich in den Kopf gesetzt, am Bett seiner Mutter Krankenwache zu halten. Er tat nichts, redete nicht einmal, saß nur da mit stumpfsinnigem Gesichtsausdruck. Niemand wusste, was genau ihn dort festhielt, aber er ließ sich nicht vertreiben. "Sie hatte heute so rote Flecken im Gesicht", berichtete er Agnes. Er wollte noch mehr erzählen, doch dem jungen Mädchen wurde es nun endgültig zuviel. In beinahe unschicklicher Weise drängelte sie sich zwischen den Männern hindurch. Da ihr Vater offenbar den Empfang des Erzbischofs vorbereiten musste, konnte sie vorläufig nicht mit ihm reden. Vielleicht würde sich am Abend noch eine Gelegenheit ergeben. Allerdings ahnte sie, dass er nichts für sie erreicht, ja dass er nicht einmal etwas für sie unternommen hatte. Es war töricht von ihr, auf ihn zu rechnen. Sie musste für sich selbst sorgen. III A ls der Erzbischof Einzug hielt in der Burg, stand Agnes dem Brauch gemäß neben ihrem Vater im Kreise der höhergestellten Dienstleute des Grafen, der Vasallen. Nahezu hundert Menschen hatten sich zu Ehren des Kirchenfürsten auf dem Herrenhof versammelt. Das war entschieden zuviel, fand das Mädchen. Die Leute drängten sich schier zu Tode, vor allem, weil ein Dutzend Waffenknechte (zur Feier des Tages prächtig ausstaffiert) in rüder Weise einen Raum vor dem Torbogen frei hielten. Der Bergfried, der sich in der Mitte des Hofes breit machte, erhitzte ganz besonders die Gemüter. Die Mägde und Knechte, die direkt hinter ihm standen, brauchten nicht zu hoffen, auch nur einen Zipfel von Gerhards Rock zu sehen. Agnes hingegen, die vorn stand, nahm kaum wahr, was um sie herum geschah, denn sie träumte noch immer von Heinrich - und von tragischen Liebesgeschichten. Eine handelte von dem Geheimgang, der vom Bergfried aus bis zur Unterburg führte. Einstmals habe ein Grafensohn die Tochter eines Ritters geliebt. Er wollte sie auch heiraten, doch sein Vater ließ das nicht zu. Daraufhin begann er, sich heimlich mit ihr zu treffen. Bei Einbruch der Dunkelheit kletterte sie in den damals noch bis jenseits der letzten Mauer reichenden Gang hinab und gelangte ungesehen bis zum Bergfried, in dessen Fuß er sie erwartete und in sein Gemach 34 geleitete. Unglücklicher Weise erfuhr davon der Ratgeber des Grafen, ein grausamer Mann. Als der Prinz sich mit ihm entzweite, überfiel er das Mädchen unten im Gang und sperrte es in ein Verließ, wo es qualvoll zu Tode kam. Seit sie von der Sage wusste, wurde Agnes von ihr bis in die Träume hinein verfolgt, und selbstverständlich hatte der Prinz die Züge Heinrichs des Bogeners. Eines Abends schlich sie sich in den Keller des Bergfrieds hinab. Nun war sie selbst jenes Rittermädchen. Leicht fand sie den Anfang des Fluchtwegs und tastete sich wie im Rausch immer tiefer in die Dunkelheit vor. Sie steigerte sich dermaßen hinein in ihre Rolle, dass sie schließlich bewusstlos zusammenbrach. Anschließend musste sie zwei Wochen lang mit Fieber das Bett hüten. Bei all dem ahnte sie nicht, dass sich in diesem geheimnisvollen Gang eine tatsächliche Tragödie abgespielt hatte - die Ermordung ihres eigenen Halbbruders, nur wenige Meter entfernt von jener Stelle, wo sie ohnmächtig geworden war. Zu ihrem Leidwesen hatte Agnes zwar freie Sicht auf das Tor nicht jedoch auf die Grafenfamilie. So wusste sie nicht, welche Kleidung Heinrich zu Ehren des Erzbischofs trug. Seinen Jagdrock gewiss nicht mehr. Wenn er es darauf anlegte, konnte er sehr elegant aussehen. Das junge Mädchen schloss die Augen und versuchte, ihn sich wenigstens vorzustellen. Dabei wurde sie aber bald gestört durch eine neue Welle des Gedränges. Gerade war Gerhard II mit seinem Gefolge auf den Hof geritten. Diensteifrig nahmen Stallknechte die Pferde in Empfang. Dann verschwand der Kirchenfürst für Agnes hinter den breiten Rücken mehrerer Männer. So sehr sie sich auch reckte, sie konnte nichts sehen vom Begrüßungszeremoniell. Jetzt wurde er zweifellos durch den Grafen willkommen geheißen. Sicherlich überreichte die Gräfin ein Geschenk. Und dicht dabei stand Heinrich. Vielleicht ruhten des Erzbischofs Augen gerade auf ihm. Natürlich hätte er einen so jungen und kräftigen Burschen gern in den Reihen seines ritterlichen Anhanges. Immerhin war er schon einmal für ihn in den Kampf gezogen, vor ein paar Jahre gegen die Dänen. Seufzend gab das Mädchen auf. Sie konnte nicht länger auf den Zehen stehen. Nach der Begrüßung zerstreuten sich die Leute noch einmal. Der Erzbischof wurde in den Palas geleitet, wo er sich nach dem langen Ritt erfrischen konnte. Lange aber dauerte die Pause nicht, denn Gerhard verabscheute den Müßiggang. Schon bald musste Wilhelm von Westerholt den Zug formieren, der sich feierlich hinüber zur Kirche des Alexanderstifts bewegen sollte. Einen Moment lang hatte Burchard mit dem Gedanken gespielt, quer durch die Stadt zu ziehen, um auf diese Weise sein Ansehen gegenüber den Bürgern zu erhöhen. Zwar besaßen die Leute in Wildehausen noch kein steinernes Rathaus und beugten sich in allen wichtigen Fragen ziemlich bereitwillig ihrem Herrn, doch allmählich drang auch in diesen Winkel der Ruf nach mehr Unabhängigkeit. Der Graf spürte das in den Blicken der Bürgervertreter, in der Art, wie sie sich vor ihm verneigten. In den engen Straßen, die zum Markt hin führten, wäre der Zug aber unweigerlich ins Stocken geraten, hätte sich in die Länge gezogen und am Ende kein besonders eindrucksvolles Bild mehr abgegeben. So entschied sich Burchard für einen anderen Weg. Vom Tor aus ging es an der Burgmauer entlang hinab zur Hunte. Dem Lauf des Flusses folgend, gelangte man dann zu 35 den Wiesen unterhalb der Stiftsgebäude und erreichte im Bogen schließlich das Ziel, den Platz vor dem Portal der Alexanderkirche. Unterwegs fand Agnes zu ihrer guten Stimmung zurück. Was für den Grafen nur eine Notlösung gewesen war, erwies sich als Glücksgriff. In Scharen strömten die Leute ans Ufer der Hunte oder richteten sich auf den Mauern ein, wo an diesem Tage niemand Wache stehen brauchte. Wen nicht allein das besondere Ereignis aus dem Haus lockte, den verführte das sonnige Wetter zu einem Spaziergang. Das Arbeiten hatte Burchard für diesen Tag ausdrücklich untersagt. Natürlich wusste die Ritterstochter aus dem Land zwischen den Sümpfen, dass der Jubel nicht ihr galt. Dennoch genoss sie ihn in vollen Zügen. So war es immer gewesen in den vergangenen Jahren. In Burchards Gefolge hatte sie versucht, ein paar Lichtstrahlen zu erhaschen vom Glanz des Hofes. Sie war realistisch genug, sich damit zufrieden zu geben. Sofern es nicht um Heinrich den Bogener ging. Der Sohn des Grafen ritt kurz hinter dem Erzbischof und seinem Vater, welche nebeneinander die Spitze des Zuges bildeten. Er trug einen prächtig gemusterten Umhang, in welchem das Rot überwog - ein kräftiges, königliches Rot. Der Wind blähte ihn auf. Agnes beobachtete aber auch die Leute, und ihr entging nicht, dass manches junge Bürgermädchen viel eifriger zu Heinrich hin winkte als zum Erzbischof. Auf dem Platz vor der Stiftskirche schuf Wilhelm von Westerholt noch einmal Ordnung - für den Einzug. Die Arbeiter hatten schon zuvor die noch nicht vollendeten Teile des Gebäudes geschickt verdeckt. Der bald nach dem Einsturz der alten Türme (anno domini 1214 und 1219) begonnene Neubau gedieh allerdings hervorragend, weil die Stiftsherren mit einem gleichmäßigen Strom von Zuwendungen aus ganz Norddeutschland rechnen konnten. In ein paar Jahren würde nichts mehr verdeckt werden müssen. Der Querriegel bildete einen beeindruckenden Abschluss nach Westen hin. Nur sparsam mit Fenstern versehen, erinnerte er an eine Burg, wobei die gewaltige kreisrunde Rosette über dem Portal die Strenge teilweise wieder zurück nahm. Dort, wo sich der wuchtige Turm einmal erheben sollte, ragte ein Kran auf. Agnes hatte viel Zeit, sich das alles anzusehen, denn durch das Portal konnten immer nur zwei Leute gleichzeitig schreiten. Seit sie den Sohn des Grafen nicht mehr im Blick hatte, begann sie sich zu langweilen. Endlos schien es ihr zu dauern, ehe ein jeder auf seinem Platz war gemäß seinem Stand und der Gottesdienst beginnen konnte. Nun gab es immerhin wieder Interessantes zu beobachten. Der Erzbischof thronte auf einem üppig mit Gold verzierten Stuhl rechts vom Altar. Neben ihm saßen zwei Priester in festlichem Ornat. Auch ein Chor von Benediktinermönchen fehlte nicht. Der Grafenfamilie war eine besondere Loge schräg gegenüber dem Stuhl des Erzbischofs vorbehalten. Das Stufengebet sprach einer der Priester des Alexanderstifts. Er leitete auch das allgemeine Sündenbekenntnis. Agnes sagte die bekannten Worte anfangs ohne nachzudenken daher. "Ich bekenne, gegen Gottes Gebote verstoßen zu haben, in Gedanken, in Worten und in Werken, zu jeder Zeit und an jedem Ort, durch Unterlassung und durch Begehung, bewusst oder unbewusst." Plötzlich aber durchzuckte sie wie ein Fieberschauer ernsthafte Reue. Was wird wohl Gott davon halten, dass sie in eitler Selbstüberschätzung einen Mann 36 begehrte, der ihr niemals würde gehören können? Hochmut kommt vor dem Fall! Das Kyrie eleison und vor allem das anschließende Gloria in excelsis Deo erlöste sie aus ihrem kurzen Alptraum. Der Raum schien größer zu werden. Die Pfeiler reckten sich und drohten das behelfsmäßige Dach zu sprengen. Gerade gab draußen eine Wolke die Sonne frei und heiteres Licht flutete herein. Nachdem der Priester der Burg von Wildeshausen die Epistel des Tages und das Evangelium verlesen hatte, stand der Erzbischof selber auf. Er predigte nur kurz und sagte nichts Unerwartetes. Dennoch hinterließ er einen tiefen Eindruck. Das lag am Klang seiner Stimme, an der Entschlossenheit, die sich darin widerspiegelte, an der Angriffslust, die sich zwischen den sanften Worten ahnen ließ. Flüstern ging durch die Reihen. Die Leute fragten sich, was er im Schilde führte. Gerüchte kamen auf, die in den kommenden Tagen (aufgebauscht zu haarsträubenden Geschichten) Burg und Stadt in Atem halten sollten. Bei der heiligen Kommunion, dem Höhepunkt des Gottesdienstes, ließ sich der Erzbischof von den beiden Priestern assistieren. Jener vom Alexanderstift sprach der Gemeinde das Glaubensbekenntnis vor. (Credo in unum Deum ...) Der von der Burg nahm das weiße Tuch von dem silbernen, mit Edelsteinen verzierten Kelch und dem ebenfalls silbernen Teller. Tiefer, langgezogener Gesang setzte ein und legte sich schwer auf den Raum. Die bisher kaum beachteten Chorgeistlichen im Hintergrund ehrten den Wein im Kelch und die Hostien auf dem Teller, die sich in den Vorstellungen der Versammelten in wenigen Augenblicken in Blut und Leib Jesu Christi verwandeln würden. Agnes senkte mit den anderen den Blick und vertiefte sich in ein Gebet. Die Angst vor Gottes Rache kroch wieder in sie hinein und machte sie beklommen. Als das Glöckchen erklang, zuckte sie zusammen wie unter einem Peitschenhieb. Sie fürchtete, wieder in Ohnmacht zu fallen wie seinerzeit im Geheimgang. Doch so weit kam es mit ihr diesmal nicht. Schon begannen die Schlussgesänge und bald wurden die großen Flügel des Portals geöffnet. Der Erzbischof schritt, gefolgt von der Familie des Grafen, nach draußen in den Frühlingstag. Nach und nach folgten die anderen. Das Wichtigste, Folgenreichste, was sich an diesem Tage in Wildeshausen ereignete, war allerdings keineswegs jener Gottesdienst. Es geschah nicht im Glanz duzender Kerzen, nicht begleitet von altehrwürdigen Zeremonien, nicht unter dem andächtigen Erschauern einer Menschenmenge. Es geschah im Audienzzimmer des Grafen am späten Abend im Geheimen. Gerhard II und Burchard führten ein Gespräch unter vier Augen. "Ich weiß, dass du nach Höherem strebst", sagte ersterer sofort rundheraus (offen lassend, ob er das als Lob oder Tadel verstanden wissen wollte). Die Grafenfamilie war nicht nur von einem verliebten Ritterstöchterchen beobachtet worden sondern auch von den Gefolgsleuten des Erzbischofs, so dass dieser einen guten Eindruck von den Zuständen in der Burg besaß. Nachdem er Burchard eine Zeit lang verunsichert nach einer Erwiderung hatte suchen lassen, erlöste er ihn mit einer beschwichtigenden Handbewegung. "Eifer 37 ist nichts Verwerfliches, sofern er sich auf gottgefällige Ziele bezieht." Der Graf atmete auf, hütete sich aber, das offen zu zeigen. Vielmehr gab er sich unterwürfig wie ein Kammerdiener. "Ihr seid mein Dienstherr. Euch steht es zu, mich zu unterweisen. Sagt mir, was Ihr von mir erwartet und ich werde es tun!" Gerhard sah ihn scharf an. Er fühlte, wie nah dieser Mann dem Wahnsinn war. Tatsächlich hatte er noch während des Gottesdienstes in seiner Meinung geschwankt. Doch er wünschte sich als militärischen Führer des Stedingerfeldzugs jemanden, der sich der Sache blindlings annahm, einen Eiferer also. Eiferer sind letztlich immer Wahnsinnige. IV A ls Wilhelm am Ende eines Hohlwegs die Wardenburg auftauchen sah, fühlte er sich erleichtert. Warum? Er hatte in Wildeshausen nichts erlebt, was zur Besorgnis Anlass gab. Oder etwa doch? Gefühl und Verstand lagen miteinander im Widerstreit. Ihm war, als versuche eine leise Stimme in seinem Innern beharrlich, ihn zu warnen, doch er vermochte kein Wort zu verstehen. Es blieb bei einer unbestimmten, dumpfen Ahnung, gepaart mit der Gewissheit, für einige Zeit in Sicherheit zu sein, geborgen hinter einer unsichtbaren Bannlinie. An der Zugbrücke erwarteten ihn seine Frau Martha und sein Sohn Rotbert. Den Ritter berührte es tief, die beiden dort stehen zu sehen. Zweifellos hatten sie ihn von einem Fenster des dicken Wohnturms aus kommen sehen und waren dann hinunter geeilt, ihm entgegen. Dennoch fiel die Begrüßung kurz und nüchtern aus. Ein Uneingeweihter hätte nicht einmal geahnt, wie innig die beiden einander im Herzen liebten. Martha war eine ruhige, ernste Frau, die (obgleich sie aus einer anderen Gegend stammte) wie kaum jemand sonst den Charakter des Landstriches verkörperte, über den die Westerholts herrschten. Generationen von Menschen hatten mit gebeugten Rücken den Sümpfen ein paar Flecken Ackerlandes abgerungen, beharrlich bis an die Grenze der Besessenheit. Wer sich nach üppigen Festen sehnte, war hier am falschen Ort, der hielt es hier nicht bis zum Ende seines Lebens aus. Die Westerholts waren unter den Bauern nur die Vornehmsten. Es gab kein anderes Gesetz als das der täglichen Mühsal. Es gab kein Stück Brot, das nicht Schweiß gekostet hatte. Wenn Wilhelm in Wildeshausen, Oldenburg oder Bremen Kaufleuten traf und sie von ihren Geschäften reden hörte, von Geschäften, bei denen man über Nacht bettelarm oder steinreich werden konnte, dann schüttelte er ungläubig den Kopf. Rotbert war ein aufgewecktes Bürschchen von elf Jahren. Er entwickelte sich prächtig, wenngleich sein Ungestüm den Eltern manchmal Angst einjagte. Ihn zog es eher zum Schwert als zum Pflug. Wilhelm hoffte, ihm die Liebe zur Erde noch anerziehen zu können. Immerhin war nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Ritter sich gut zu schlagen verstand. Errang er Ruhm im Dienste des Lehnsherrn, brachte das auch seinem Land manchen Vorteil. Zum Glück hegte er nicht jene Verachtung für das Moor, die Agnes wohl für immer fortgetrieben hatte. Die Eltern wagten aus ganz anderen 38 Gründen nicht, ihn nach Wildeshausen zur Erziehung zu schicken. Der Knirps mit den kräftigen Armen eines Vierzehnjährigen und dem feurigen Blick eines kleinen Wilden ordnete sich anderen Kindern nicht unter. Er wollte stets der Führer sein und war imstande, für dieses Ziel fürchterliche Prügeleien anzuzetteln. Wenn man ihn dann blutend aus einem Knäuel Widersacher herauszog, dann lachte er noch. "Das nächste Mal gebe ich es ihnen!" schrie er trotzig und ohne jede Reue. In dieser Hinsicht war jede Belehrung verlorene Liebesmüh. Trotz mancher bedenklichen Veranlagung blieb Rotbert freilich für Wilhelm die größte Hoffnung für den Fortbestand der Familie. Einst hatte eine ganze Schar von Westerholtkindern mit ihrem Lachen und Geschrei den Hof erfüllt, fünf an der Zahl. Wo waren sie geblieben? Agnes träumte in Wildeshausen von der völlig unmöglichen Heirat mit dem Sohn des Grafen und überschüttete ihre Angehörigen mit Vorwürfen. Arnold, sein Großer, der ihn schon hatte vertreten können, dem die Bauern zugetan gewesen waren wegen seiner Klugheit und seiner Geduld, er lag irgendwo in einem unbekannten Grab, verscharrt von seinem Mörder. Franziska und Pentia lebten vielleicht noch. Ihnen hatte er unzählige Gebete gewidmet. Aber keine Antwort war gekommen, nicht von Gott und nicht von den Menschen. Hielten sie sich noch in der Gegend um Bremen auf, hätte sie irgendwann einmal jemand sehen müssen. Während Wilhelm hinter Martha die Treppe hinaufstieg zur kleinen Wohnung der Burgherrenfamilie im zweiten Obergeschoß des Hauptturms, wurde er sich plötzlich bewusst, was die leise Stimme in ihm sprach. "Der Erzbischof will Krieg führen gegen die Stedinger und Burchard soll der Feldherr sein", sagte er. "Dann wirst auch du mit in diesen Krieg ziehen müssen", entgegnete seine Frau. Diese schlichte Antwort beruhigte ihn für einen Moment, obwohl sie im Grunde etwas Schlechtes ausdrückte. Immerhin erinnerte sie ihn an eine Regel. Er war Burchards Vasall und ein Vasall folgt seinem Dienstherrn in den Krieg. Regeln haben die Eigenschaft, eine im Lot befindliche Welt vorzutäuschen. Doch diesmal ließ sich Wilhelm nur kurz auf den Selbstbetrug ein. Die Stimme in ihm redete der Regel zum Trotz weiter. "Ich kenne die Stedinger. Vor zwanzig Jahren, wenige Monate nach dem Tod meines Vaters, kämpfte ich schon einmal in Burchards Heer gegen sie. Sie ähneln unseren Bauern, sind dickköpfig und zäh. Selbst ein großes Heer wird sie nicht so leicht von ihren Äckern vertreiben. Und wer sich in ihrem Land nicht auskennt, kämpft nicht nur gegen Menschen sondern auch gegen tiefe Sumpflöcher und tückisch feuchte Wiesen. Sogar von Dämonen ist die Rede." Die beiden waren in ihrer Wohnung angelangt. Im Grunde ihres Herzens glaubte selbst Martha nicht mehr an die Regel. "Mit den Dämonen sollte man sich nicht anlegen", murmelte sie. Dann verstummten beide. Die Frau griff mechanisch nach einer Handarbeit, unfähig einen Moment lang untätig zu sein. Der Mann wechselte seine durchschwitzten und verstaubten Kleider. Ihre Gedanken aber trafen sich im Marschland der Stedinger. Und sie beschworen dieselben Visionen herauf. Sie sahen Bauern mit entschlossenen Gesichtern. Dicht an dicht standen sie hinter ihren Deichen und warteten auf 39 den Feind. In den Fäusten hielten sie gute Waffen, mit Sorgfalt geschmiedet in den eigenen Dörfern. Männer, die nicht für Sold dort standen und auch nicht eines Eides wegen, sondern weil sie ihre Frauen und Kinder schützten, ihre Häuser, ihr Land, in das sich seit Monaten kein fremder Steuereintreiber mehr hineinwagte. 40 4.Kapitel I R upert strahlte übers ganze Gesicht. "Sie sind allein", verkündete er. "Wir haben leichtes Spiel." "Aber es wird nicht viel zu holen sein", gab Ernst Eisenarm zu bedenken. "Ach, geh mir! Weiber haben immer Klunkern bei sich." Norbert trat vor den Räuber hin und zwang sich, ihm voll ins Gesicht zu blicken. Noch immer galt formal die Gleichberechtigung aller Mitglieder der Bande. Jeder aber wusste, dass längst der Kampf um die tatsächliche Macht entbrannt war. "Es ist unehrenhaft, sich an wehrlosen Mädchen zu vergreifen!" Ein Dutzend Augenpaare hefteten sich auf die beiden Männer. Niemand hätte sich gewundert, wären sie plötzlich mit blanken Schwertern aufeinander losgegangen. Und niemand hätte eingegriffen. Doch einmal mehr ließen sie es nicht bis zum Äußersten kommen. Rupert sagte: "Wir vergreifen uns nicht an ihnen, wir nehmen ihnen lediglich den Schmuck weg." Norbert spürte, dass er in Gefahr geriet, sich lächerlich zu machen. Rupert schlug unterdessen versöhnliche Töne an. "Jeder von uns beiden bestimmt zwei Mann, die mitmachen. Du kannst mir also zwei Aufpasser auf den Hals laden." Zähneknirschend ging Norbert auf das Angebot ein. Gelassenheit vorspielend, blieb er mit der größeren Gruppe auf einer Lichtung zurück. An der Straße zwischen Oldenburg und Wildeshausen gab es eine Stelle, die so eng und unübersichtlich war, dass sie sich Wegelagerern als Schauplatz für einen Überfall geradezu aufdrängte. Umgestürzte Bäume engten den ohnehin schmalen Weg ein. Auf einem steilen, mit Sträuchern dicht bestandenen Hang hätte ein Dutzend Leute sich bequem verstecken können. "Ich sehe sie", flüsterte Rupert schon bald. "Aber wieso sind sie nur noch zu zweit? Wo ist die eine Schwarzhaarige geblieben?" "Musste vielleicht mal pinkeln", flüsterte Ernst Eisenarm zurück und grinste anzüglich. Unterdessen erreichten zwei Mädchen die gefährliche Stelle. Die eine war rothaarig und wirkte wie eine Bettlerin. Angesichts ihres zerlumpten Kleides verzog Ernst Eisenarm das Gesicht und sah kopfschüttelnd zu seinem Anführer hinüber. "Das ist die Dienerin," beharrte Rupert mit dem Eigensinn des Anführers. "Wer sich Diener leisten kann, hat auch Klunkern." Das zweite Mädchen hätte tatsächlich ausgesehen wie die Herrin des ersten, wäre es nicht so offensichtlich schüchtern und brav gewesen. Ihr schwarzes Haar und ihr Kleid wirkten angesichts der Umstände fast unglaublich ordentlich. "Los! Schnappt sie euch!" Ernst Eisenarm und zwei seiner Kumpane sprangen auf den Weg hinunter und umringten die Mädchen, die wie erstarrt stehen blieben und keinen Widerstand zu leisten wagten. "Wir sind Heimatlose!" versicherten sie. "Wir haben nicht einmal genügend zum Essen." "Davon würden wir uns gern überzeugen", entgegnete Ernst Eisenarm kalt. In eben diesem Augenblick begann Rupert, der allein auf dem Hang zurückgeblieben war, wild zu fluchen. Zunächst hatte er geglaubt, ihm sei ein wildes Tier in den Nacken gesprungen. Dann aber spürte er den Stahl an seinem Hals. Der Angreifer wusste genau, was er tat. Er gab dem erfahrenen Räuber keine Gelegenheit, sich zu entwinden. Die Klinge eines kurzen Schwertes drückte flach genau auf seine Kehle. Eine kleine Drehung und sie würde bis zur Wirbelsäule durch den Hals rutschen. "Befiel den drei Halunken, sich mit dem Gesicht nach unten auf den Weg zu legen!" Die dunkle Stimme des jungen Mädchens hätte er in anderer Lage vielleicht als angenehm empfunden. Auch jetzt war er im Widerstreit mit sich. Einerseits spürte er, dass er sie ernst nehmen musste. Andererseits passte sie (nach seinem Gefühl) nicht hierher, nicht an diesen Ort und erst recht nicht in diese Lage. "Legt euch hin, damit ich diese Wildkatze loswerde! Das hätte sich sowieso nicht gelohnt." Wenig später waren die drei Mädchen verschwunden und Ernst Eisenarm brüllte, dass sich die Bäume schüttelten. "Wer hat von Anfang an gesagt, dass das schwachsinnig ist? Ich habe es gesagt!" "Halt die Schnauze!" brachte Rupert ihn zum Schweigen. "Du wirst hier noch so lange herumzetern, bis uns die Waffenknechte finden." Er hatte sich wieder ganz in der Gewalt. Niemand würde es wagen, ihn dieser Blamage wegen weniger zu achten. "Es ist besser so. Wer weiß, was es mit dieser Hexe auf sich hat", sagte er geheimnisvoll. "Mir kommt da eine Ahnung." Seine Leute sahen ihn voller Bewunderung an, ohne ihn zu fragen, worin diese Ahnung bestand. Eine Woche später - die Männer in der Waldhütte sprachen schon nicht mehr über den missglückten Überfall, weil anderes sie beschäftigte - stand Norbert plötzlich dem wehrhaften Mädchen mitten im Wald gegenüber. Sie hatte ihn offenbar bereits eine Zeitlang beobachtet und sich dann eine besonders einsame Stelle für die Begegnung ausgesucht. Der junge Bürgerssohn, der sie persönlich noch nicht kannte, war sprachlos vor Überraschung. Sie kam geradewegs zur Sache: "Wir sind Fremde. Können wir für ein paar Wochen bei euch wohnen?" "Wir betreiben keine Herberge. Wir sind ..." "Ich weiß. Ich hatte bereits Gelegenheit mit eurem Anführer zu reden." "Du bist also dieses Mädchen, das ..." "Ja, genau dieses Mädchen bin ich. Die anderen beiden sind meine jüngere Schwester und eine Freundin. Ich möchte, dass du deinem Anführer mein Anliegen vorträgst." Ohne eine Antwort abzuwarten, verschwand sie wieder und Norbert blieb völlig verwirrt zurück. Sie hatte ihn nicht schüchtern um einen Gefallen gebeten, sondern ihm regelrecht einen Befehl erteilt. Überhaupt lag in ihrem Wesen etwas Herrisches, was im krassen Gegensatz zu ihrer Notlage stand. Dennoch war sie ihm irgendwie sympathisch. Er hatte den Eindruck, dass sie sich angesichts der Umstände so verhielt, dass sie sich auch ganz anders geben konnte. Sie verstand sich auszudrücken. Zweifellos war sie klug. Vielleicht hatte sie sogar eine gute Erziehung genossen. Obwohl er sich sonst nicht gern vorschreiben ließ, was 42 er tun oder lassen solle, schon gar nicht von einem wildfremden Mädchen, war er in diesem Fall nachgiebig. Schon auf dem Wege zurück ins Lager überlegte er sich Rechtfertigungsgründe, um Rupert zu überzeugen. Wenn ihn etwas ärgerte, dann allenfalls, dass sie diesen Halunken Anführer genannt hatte. Andererseits war sie an ihn, den Bürgerssohn, herangetreten mit ihrem Anliegen. Norbert fühlte sich aufgefordert, diesem Räuber-Rupert seine Grenzen aufzuzeigen. Auf der Versammlung am Abend setzte er sich so entschlossen für das schwarzhaarige Mädchen und ihre beiden Gefährtinnen ein, dass die Männer tuschelten und schließlich unverhohlenen zu spotten begannen. Einer schrie in die Runde: "Also, was meint ihr? Hat er sich ein Betthäschen verdient oder nicht?" Dröhnende Buhrufe antworteten ihm. "Wenn sie hübsch ist, haben wir anderen auch noch ein Wörtchen mitzureden." "Vielleicht teilt er sie ja mit uns!" "Der? Niemals! Seht ihn euch doch an, den elenden Geizkragen! Der platzt gleich vor Eifersucht." Norbert musste all seine Willenskraft aufbringen, um sich zu beherrschen. Er zitterte vor Zorn und fragte sich dabei, was ihm eigentlich an diesem Mädchen lag. Er kannte nicht einmal ihren Namen. Ein kurzer Blick auf Rupert brachte ihn endgültig aus der Fassung. Der Räuberhauptmann beteiligte sich nicht an der Auseinandersetzung und amüsierte sich wie bei einer Schaustellervorführung. Er dachte gar nicht daran, sich gegen die Aufnahme der Mädchen auszusprechen. Er plante nicht einmal, sich für die Niederlage an der Straßenenge zu rächen. Dass die Hexe bei ihm über einen Boten um ein Nachtlager bettelte, war ihm ausreichend Genugtuung. II I n den nächsten Tagen waren die drei künftigen Bewohner der Waldhütte das wichtigste Gesprächsthema. Rupert, Ernst Eisenarm und die beiden anderen, die bei dem missglückten Überfall dabei gewesen waren, mussten unzählige Fragen beantworten. Weil sie so genau auch nicht Bescheid wussten, ihre besondere Rolle aber nicht einbüßen wollten, ließen sie ihrer Phantasie freien Lauf. Ihre haarsträubenden Berichte heizten die Stimmung weiter an. Im Grunde waren die Männer trotz ihres Lebenswandels nicht bösartig, selbst Ruperts Leute nicht. Das Schicksal hatte sie mehr oder minder gegen ihren Willen in diese Lage gebracht. Inzwischen sahen sie die Räuberei beinahe wie einen ehrbaren Beruf an. Dazu gehörte, dass sie sich nach bestimmten Regeln richteten. Sie misshandelten keinen Wehrlosen. Raubten sie einen Kaufmann aus, ließen sie ihm ein Pferd, um damit bis zur nächsten Ortschaft zu reiten. Bei keinem Überfall hatten sie eine Frau vergewaltigt. Ruperts Leute waren darauf übrigens auch nicht angewiesen, denn sie unterhielten (im Unterschied zu den Bürgerssöhnen) heimliche Beziehungen zu einem Bordell in Bremen. Die drei neuen Bewohner würden selbstverständlich keine Prostituierten sein. Trotzdem freuten sich fast alle auf ihre Ankunft. Das Leben in der Waldhütte hatte nach und nach den Charakter eines Klosteralltags 43 angenommen. Die wilden Auseinandersetzungen der ersten Tage waren dem Einerlei ständig wiederkehrender Verrichtungen gewichen. Abwechslung brachten nur die Raubzüge und die gelegentlich aufflackernde Rivalität zwischen Rupert und Norbert. Drei Mädchen würden die Waldhütte auf jeden Fall freundlicher machen. Und natürlich träumte ein jeder davon, mehr zu bekommen als ein Lächeln. Nur einer schimpfte wie ein Rohrspatz - Christian. "Es wird Scherereien geben", versicherte er eines Abends, als alle schon in ihren Betten lagen. "Wenn Weiber ins Spiel kommen, gibt es immer Scherereien." Zunächst glaubten die anderen, er würde sich mit ihnen einen Spaß erlauben. Als sie merkten, dass er seine sonderbaren Ansichten ernst meinte, erlaubten umgekehrt sie sich mit ihm Späße, ziemlich derbe noch dazu. "Kriegst wohl deinen Schwanz nicht hoch, dass du mit Weibern nichts anzufangen weißt." "Und ob ich ihn hochkriege!" verteidigte er sich wütend Doch er kam nicht an gegen das Gejohle seiner aus Vorfreude närrischen Kameraden. Schließlich drehte er sich beleidigt zur Wand hin und tat, als ob er schliefe (obwohl ihm genau das bis zum frühen Morgen nicht gelang). Die Nachricht, dass die Mädchen eingetroffen seien, verbreitete sich in Windeseile. Zweifellos hätte nicht einmal ein Feuer bewirkt, dass jeder so rasch zur Waldhütte zurück eilte. Die Männer drängten sich, als ob sie noch nie im Leben einem weiblichen Wesen begegnet wären. Allerdings mussten sie bald einräumen, dass sie sich mehr ausgerechnet hatten. Die Mädchen waren nicht direkt hässlich, strahlten aber alle drei (aus unterschiedlichen Gründen) fast keinen Liebreiz aus. Die große Schwarzhaarige wirkte wie ein junger Mann, nicht nur wegen dem groben Lederwams, der die Formen ihres Oberkörpers verdarb, nicht nur wegen dem Schwert, das sie ziemlich auffällig an einem breiten Gürtel trug, sondern vor allem, weil sie keinerlei Furcht zeigte angesichts der vielen Männer, von denen sie schamlos angestarrt wurde. Entschlossen ging sie auf Rupert zu und sagte: "Gott sei mit Euch! Mein Name ist Franziska. Ich danke Euch für die Güte, uns aufzunehmen." Trotz der überaus höflichen Anrede fühlte sich der Räuberhauptmann unbehaglich. Er spürte deutlich, dass sie sich ihm mindestens ebenbürtig fühlte. Die anderen, selbst Norbert, mussten mit sich kämpfen, ihm in die Augen zu sehen, dieses Mädchen dagegen tat es, ohne zu blinzeln. 'Hexe!' dachte er mit einer Mischung aus Bewunderung und Ärger. 'Womöglich hat dieser verdrehte Tischler mit seinem Weiberhass doch Recht.' Pentia erschien gegen sie wie ein Kind. Sie war so schüchtern, dass sie kaum den Blick zu heben wagte. Dass sie auch Stärken besaß, stellte sich erst ein paar Tage später heraus. Bei allem, was mit Hauswirtschaft zu tun hatte (und sei es nur entfernt) entwickelte sie ein verblüffendes Maß an Bienenfleiß und Geschicklichkeit. Ohne dass sie jemand dazu aufforderte (und ohne zu erwarten, dafür den gebührenden Dank zu bekommen) brachte sie die in Verwahrlosung geratene Waldhütte in Ordnung. Anschließend besserte sie die Kleidung der Räuber aus. Als Rupert sie zum Kochen beorderte, vollbrachte sie auch dabei Wunderdinge. Zum Verdruss der Männer blieb sie aber scheu wie eine Elfe. Sobald sich ihr jemand bis auf weniger als drei Schritte näherte, legte sie ihre Arbeit beiseite und flüchtete. Und ihre Sinne 44 waren immer hellwach. Niemals gelang es jemandem, sie zu überlisten. Um sich nicht die leckeren Mahlzeiten und die mit nahezu unsichtbaren Nähten geflickten Kittel zu verscherzen, ließen die Räuber sie fortan in Frieden. Auch mit dem dritten Mädchen war, was zärtliche Stunden anging, nicht viel anzufangen. Zwar hatte sie nicht die martialische Ausstrahlung ihrer Freundin Franziska und auch nicht Pentias Ängstlichkeit, dafür aber die mürrische Art einer alten Jungfer. Dass Ramira Artistin war, glaubte ihr niemand. Wie sie sich gab, hätte sie selbst das gutwilligste Publikum vergrault. Unzugänglich war nicht nur ihre Verhalten. Auch ihre zerschlissene Kleidung und ihre mutwillige Nachlässigkeit bei fast allem, was ein junges Mädchen anziehend erscheinen lässt, drückten das aus. Und als einer der Bürgerssöhne (der keine Huren bekam wie Ruperts Leute) sich trotz allem an sie heranzumachen versuchte, bekam er eine solch rabiate Abfuhr erteilt, dass es nie wieder jemand probierte. Am Ehesten kam vielleicht Norbert auf seine Kosten. Weil er beharrlich festhielt an der Überzeugung, dass hinter Franziskas ledernem Panzer ein zu zarteren Gefühlen fähiges Herz schlug, störte er sich weniger als die anderen an ihrem Auftreten. Er unterhielt sich oft und gern mit ihr. Manchmal vergaßen beide am Rande der Lichtung die Zeit und kehrten erst im Dunkeln in die Waldhütte zurück. Geduld musste er freilich aufbringen. Sie offenbarte sich nicht ohne weiteres. Von sich selbst erzählte sie so wenig, dass sie für ihn geheimnisvoll blieb, wie eingehüllt in eine Nebelwolke. Gelegentlich sprach sich Norbert mit Christian über sie aus. Der war zwar ein verdammter Frauenfeind, doch zugleich sein bester Freund. Bei ihm brauchte er zumindest nicht zu befürchten, dass seine Herzensangelegenheiten am nächsten Tag der Spottlust der anderen Nahrung gaben. Einmal verkündete er stolz: "Ich kenne jetzt ihren vollständigen Namen. Sie hat ihn auf die Klinge ihres Schwertes gravieren lassen." "Was meinst du mit vollständig?" "Sie ist eine Adlige. Sie hat einen Familiennamen." "Eine Adlige? Bist du sicher?" "Ich war mir schon vorher sicher." "Also, wie heißt sie denn nun?" "Franziska von Westerholt." Christian zuckte so heftig zusammen, dass sich Norbert wunderte. "Sagtest du Westerholt?" "Ja, sagte ich. Kennst du die Familie?" "Ach, nein. Vergiss es! Es ist nichts, jedenfalls nichts, was mit deiner Franziska zu tun hat." III D as Gespräch mit Norbert ließ Christian keine Ruhe mehr. Konnte es sein, dass Franziskas Vater jener Ritter war, der seine Mutter vergewaltigt hatte? Viel sprach nicht dafür. Das junge Mädchen sah ihm kaum ähnlich. Aber es kam durchaus vor, dass sich Halbgeschwister stark voneinander unterschieden. Im Übrigen entdeckte er, je öfter er sie verstohlen beobachtete, immer mehr Kleinigkeiten, die seine Vermutung zu stützen schienen. Eines Tages hielt er die Spannung nicht mehr aus und sprach sie an. Da er 45 sich von Frauen sonst fern hielt, war er dabei ziemlich linkisch. "Darf ich Euch eine persönliche Frage stellen?" Sie wusste nicht, was er von ihr wollte. Da sie aber (im Gegensatz zu dem, was die meisten von ihr dachten) recht gutmütig war, ließ sie ihn ausreden. Dadurch beruhigt, kam er rasch zur Sache. "Heißt Euer Vater Egbert?" Sie verstand zwar noch immer nicht, worin sein eigentliches Anliegen bestand, antwortete aber freimütig. "Nein. Er heißt Wilhelm und ist Vasall der Oldenburger Grafen." "Dann entschuldigt mich! Ich wollte Euch nicht belästigen." "Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Übrigens kannst du mit mir so reden wie mit den anderen." In Wahrheit hatte er gar nicht darüber nachgedacht, ob er Franziska wegen ihres Adels ehrenvoller behandeln musste als seine bürgerlichen Kameraden. Für ihn waren die Höflichkeitsformen ein Mittel, um Abstand zu wahren, ohne den Gesprächspartner zu beleidigen. Nun wusste er nicht, was er tun sollte und zog sich mit einer ungeschickten halben Verbeugung zurück. In eben diesem Moment aber fiel Franziska etwas ein. "Vielleicht meinst du meinen Onkel. Ist der, an den du denkst, so ein komischer Kauz, der immerzu über die Vergänglichkeit alles Irdischen predigt?" Christian setzte sich wieder neben sie. "Ich kenne ihn nicht. Er muss aber ein bösartiger Mensch gewesen sein, ganz gewiss kein Heiliger. Er hat meiner Mutter Gewalt angetan." "Das wusste ich nicht", sagte Franziska teilnahmsvoll und dachte angestrengt nach. "Ich war klein, als er mit mir sprach, und er erzählte mir sonderbare Sachen, die ich nicht verstand." Sie versuchte, sich seine Worte wieder ins Gedächtnis zu rufen. "Ja, er schämte sich wegen irgendetwas. Ich glaube, er war in Bremen in ein Verbrechen verwickelt." Christian schlug das Herz bis zum Hals. "Hat er das wirklich gesagt?" fragte er aufgeregt. "Hat er genau das gesagt?" "Ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Die Vergewaltigung und seine Erlebnisse auf dem Kreuzzug haben ihn dazu gebracht, das Ritterleben aufzugeben. Er wollte Geistlicher werden." "Ich bin die Frucht dieses Verbrechens", flüsterte Christian. Das junge Mädchen drehte sich abrupt zu ihm hin. "Was? Du bist der Sohn dieses Egbert?" "Ja. Wir beide sind blutsverwandt." "Welch sonderbarer Zufall, dass wir uns hier mitten im Wald kennen lernen!" "Gott muss wohl Pläne mit uns haben." Norbert wunderte sich, dass sein Freund, dieser elende Frauenhasser, sich plötzlich ausgerechnet gegenüber Franziska, dieser sogar von Rupert insgeheim gefürchteten Amazone, so unbefangen verhielt. Für kurze Zeit (bis er den Hintergrund des Sinneswandels erfuhr) hegte er sogar heimlich Eifersucht. Aber Christian fürchtete sich nun einmal vor einer streitbaren Frau weitaus weniger als vor einer liebestollen. Die Tatsache, dass er mit Franziska verwandt war (und sie ihn folglich niemals heiraten konnte), beruhigte ihn und nahm dem Verhältnis die Spannung. Überhaupt fühlte er sich besser, seit er über seinen Vater Bescheid wusste. Dass dieser Mann seiner Mutter das Leben gestohlen hatte, berührte ihn nur oberflächlich. Die Scheue Anne war für ihn ein bemitleidenswertes Geschöpf, 46 aber ansonsten eine fremde Frau. Seit er seine Wurzeln kannte (wie geartet sie auch waren) fühlte er sich vollständig. Als Norbert ihn einmal fragte, ob er nicht manchmal Groll gegen Franziska empfinde, ob er sich vielleicht rächen wollte an ihr für ihren Onkel, sah er ihn entgeistert an, als zweifle er an seinem Verstand. Die anderen begannen, die drei Mädchen, die nichts mit sich anstellen ließen, mit Nichtachtung zu strafen. Allerdings zog der träge Alltag nicht wieder ein, denn die Rivalitäten zwischen den alteingesessenen Räubern und den Bürgerssöhnen brachen wieder aus. Die Unklarheit bei der Anführerfrage wurde allmählich für alle unerträglich. Rupert schürte die Anarchie, indem er sich neuerdings betont zurückhielt, sobald eine Entscheidung erforderlich wurde. Ein Streit um Beutestücke, der in eine Massenschlägerei ausartete, brachte das Fass zum Überlaufen. "So kann es nicht weitergehen!" war die einhellige Meinung. Längst glaubte niemand mehr an die hehren Ideale der Gleichberechtigung. Im Grunde wollte inzwischen jeder einen Anführer. Die Frage war nur, wer es sein sollte. Rupert hatte kein Vertrauen bei den Bürgerssöhnen. Die Räuber wiederum wollten sich keinem anderen unterordnen. Eine einfache Mehrheitswahl (bei der die Bürgerssöhne im Vorteil gewesen wären) hätte unweigerlich die Gruppe auseinandergetrieben. Also schlug Ernst Eisenarm vor: "Heute gehen wir nicht eher auseinander, bis wir einen einstimmig gewählten Anführer haben." Mit dem ihm eigenen Zynismus fügte er hinzu: "Selbstverständlich gibt es nichts zu essen. Werden wir uns nicht einig, dann verhungern wir eben alle zusammen." Obwohl niemand voraussehen konnte, wem die erbarmungslose Regel am Ende Nutzen bringen würde, waren schließlich alle einverstanden. Am Nachmittag trafen sie sich auf der durch Rodung erweiterten Lichtung vor der Waldhütte. Da der Sommer gerade begann, würde die Sonne so bald nicht untergehen. Für den Fall, dass man sich selbst in dieser Zeit nicht einigen könnte, lag Holz für ein Feuer bereit. Auf den ersten Blick boten die zwanzig Heimatlosen, wie sie so im Kreis saßen, ein Bild friedlicher Eintracht. Tatsächlich aber war die Stimmung äußerst gespannt. Norbert und Rupert, die einander genau gegenüber auf je einem Baumstumpf thronten, getrennt durch den Holzstoß für das Feuer, fochten bereits mit Blicken gegeneinander. Sie ähnelten Katern beim Kampf um ein Weibchen. Wer zuerst zurückwiche, und sei es nur um eine Winzigkeit, der hätte verloren. Und jeder nahm Anteil an diesem stummen Ringen. Norbert fühlte sich freilich in seiner Rolle nicht recht wohl. Er hatte gegen Rupert Stellung genommen, weil dieser das Gesetz der Gleichberechtigung untergrub. Ihn zu verdrängen und selbst an seine Stelle zu treten, war ihm nie in den Sinn gekommen. Nun plötzlich erwarteten seine Freunde genau das von ihm. Die möglichen Folgen eines Sieges beschäftigten ihn mehr als die einer Niederlage. Nach dieser Versammlung würde vieles anders sein als zuvor. Wer an diesem Abend die Macht errang, der musste sie fest in den Händen behalten. Ein Dutzend heiliger Grundüberzeugungen rebellierte in ihm gegen das, was man ihm da zugemutete. Je länger das gewittergeladene Schweigen andauerte, desto deutlicher sah er voraus, dass seine Zweifel Rupert den Sieg bringen würden. Das aber könnte ihn und die anderen Bür- 47 gerssöhne zu Dienern erniedrigen. Und er fürchtete, dass seine Kameraden ihm die Niederlage ankreideten. Warum nur hatte er sich so weit vorgewagt? Warum war er auf die Herausforderungen eingegangen? Vermutlich hatte sein Rivale längst gemerkt, dass er wankte und nicht mehr bis zum Einbruch der Dunkelheit durchhalten würde. Gerade wechselten Rupert und Ernst Eisenarm einen viel sagenden Blick. Norbert stand mit dem Rücken zur Wand. In dieser Lage nun kam ihm eine Idee, deren er sich bald schämte, obgleich sie sich später (ohne sein Hinzutun) als recht brauchbar erwies. "Ist es neuerdings Brauch, dass Bürger und Bauern über Adelige regieren?" rief er unvermittelt. Mit Befriedigung stellte er fest, dass Rupert verwirrt war und (zumindest für einen Moment) seine Siegessicherheit verlor. "Du willst doch jetzt nicht einen adeligen Urgroßvater aus dem Grab holen?" höhnte er, als er sich gefasst hatte. Ernst Eisenarm unterstützte ihn. "Wusstest du nicht, dass sich seine Großmama hat von einem Grafen umlegen lassen?" Wollte Norbert unterbinden, dass seine Familie weiterhin dem wüsten Gespött dieser Galgenvögel preisgeben war, musste er den Weg weitergehen. "Ich spreche nicht von mir", sagte er, so würdig er konnte. "Unter uns weilt die Tochter eines Vasallen." Das Gelächter riss schlagartig ab. Alle Blicke wandten sich Franziska zu. Das junge Mädchen ließ eigenartiger Weise keinerlei Unruhe erkennen. Sie malte seelenruhig mit einem Stöckchen Figuren in den Sand, als sei gar nicht von ihr die Rede, ja, als interessiere sie das Thema nicht einmal. "Sie soll die Tochter eines Vasallen sein?" brüllte Rupert, der nun plötzlich doch fürchtete, dass ihm die Felle davonschwömmen. "Wir haben sie von der Landstraße aufgelesen. Warum lebt sie nicht auf der Burg ihres Vaters?" In diesem Moment bereute Norbert seinen Vorstoß. Er sprang auf, wild entschlossen, sich notfalls zu schlagen. Franziska aber, die ebenfalls aufgestanden war, hieß ihn zu schweigen und drückte ihn mit einer kurzen, energischen Bewegung auf seinen Platz zurück. Während sie das Wort ergriff, merkte er, dass er die Kontrolle über die von ihm ausgelösten Ereignisse verloren hatte. "Er hat Recht. Ich bin die zweite Tochter des Lehensritters Wilhelm von Westerholt. Auf dessen Burg lebe ich deshalb nicht, weil mir Graf Burchard von Wildeshausen nach dem Leben trachtet. Ich sah, wie er meinen Bruder ermordete." Rupert blickte in die Runde. Wäre Franziska schüchtern gewesen wie ihre Schwester, hätte er nichts zu befürchten gehabt. Doch der Stolz, der aus ihrer Körperhaltung sprach, das Sendungsbewusstsein, das ihre dunklen Augen widerspiegelten, das beeindruckte ihn. Sie hatte von ihrem Vater eben nicht nur den Namen bekommen sondern auch den Willen und die Entschlossenheit zum Herrschen. Und noch etwas fiel den Männern auf. Franziska war noch jung. Ihr Wesen strahlte Leidenschaft und Hoffnung aus, Schätze, welche zumindest die Räuber längst nicht mehr besaßen. Lediglich Ernst Eisenarm hielt noch eine Weile seinem Hauptmann die Stange. "Sollen wir uns von einem Weib herumkommandieren lassen? Wo gibt es denn so etwas?" Aber Franziska war um keine Antwort verlegen. "Auf fast jeder Burg kannst du das erleben - wenn der Ritter fern seiner 48 Heimat kämpfen muss. Ist er kein Tor, so vertraut er Haus und Hof seiner Gemahlin an, die ihn liebt, und nicht dem Meier, der nur an seinen eigenen Gewinn denkt." Rupert war klüger als Ernst Eisenarm und mehr als dieser herumgekommen in der Welt. Es hat keinen Zweck sich mit den Weibern anzulegen. Mögen die Pfaffen predigen, dass sie dem Manne nach Gottes Willen untertan sein sollten! Mögen in den Chroniken die Könige und Herzöge in männlicher Linie aufgezeichnet sein! Ist nicht viel wichtiger, wer die täglichen Entscheidungen trifft? Rupert hatte seine Rolle als Anführer verloren, nicht sein Gesicht. Er dachte bereits an die Zukunft. Wollte er einen Teil seiner Macht behalten, durfte er seine Kräfte nicht bei sinnlosen Gefechten vergeuden. So kam es, dass die einstimmige Wahl überraschend zeitig, lange vor Sonnenuntergang stattfand und die Bewohner der Waldhütte zur gewohnten Zeit zu Abend essen konnten. 49 5.Kapitel I R upert hatte die Wahl Franziskas zum Anführer nicht zuletzt deshalb nahezu widerspruchslos hingenommen, weil er davon ausgegangen war, sie habe sich mit der Aufgabe übernommen und werde sich als junges Mädchen inmitten erwachsener Männer nicht behaupten können, mochte sie auch gebildet und von adliger Herkunft sein. Als sie ein Fechtturnier ankündigte, glaubte er, sie sei verrückt geworden. 'Sie wird sich blamieren', dachte er, 'und ihren ohnehin geringen Respekt völlig einbüßen.' Warum kehrte sie nicht ihr Wissen heraus, die Tatsache, dass sie mühelos Lesen und Schreiben konnte? Warum tat sie das glatte Gegenteil? Nach einem komplizierten System sollten alle (ausgenommen Ramira und Pentia) denjenigen ermitteln, der mit dem Schwert am besten umzugehen verstand. Um Verletzungen zu vermeiden, wurden Brustpanzer aus Holz angefertigt. Im Kampf bestand das Ziel darin, die Klinge dort hinein zu bohren. Wem das gelang, der hatte gewonnen. Anfangs konkurrierten vor allem die Bürgerssöhne mit den Räubern. Die einen rechneten sich ebenso Chancen aus wie die anderen. Ausbildung bei bezahlten Schwertmeistern in Bremen stand gegen jahrelange Erfahrung bei Scharmützeln an den Handelsstraßen. Franziska hatte niemand auf seiner Rechnung. Die ersten, die gegen sie verloren, wurden erbarmungslos ausgelacht. Dann aber ergaben die Regeln, dass Rupert gegen das Mädchen antreten musste. Zweimal verlor er, weil er sie nicht ernst nahm. Beide Male erklärte sie den Kampf für ungültig. Auch der dritte Versuch brachte jedoch kein anderes Ergebnis, obwohl der Räuberhauptmann diesmal wirklich alles zeigte, was er konnte. Franziskas Überlegenheit beruhte auf ihrer Taktik. Während Rupert seine Kraft vergeudete, indem er die Entscheidung mit roher Gewalt suchte, tat sie nichts Überflüssiges. Wurde sie attackiert, wich sie aus, so dass sie zeitweise beinahe feige wirkte. Sobald sie aber selbst angriff, entfaltete sie für einen Moment all ihre Kräfte und schlug mit äußerster Genauigkeit zu. Sie war unberechenbar, zu jedem Zeitpunkt. Hinzu kam, dass sie ihren Gegner, wenn sie vor ihn hintrat, starr in die Augen blickte, was die meisten Männer verwirrte. Auch Norbert verunsicherte ihr Auftritt. Am Abend ging er ihr aus dem Wege, um nicht in Versuchung zu kommen, etwas Verletzendes zu sagen. Schon in der Nacht aber verzeih er ihr. Sie musste sich ja etwas einfallen lassen, um sich durchzusetzen! Und er hatte sie immerhin in diese Lage gebracht. Am nächsten Abend war er nur noch erstaunt darüber, dass sie in ihrem Alter so gut fechten konnte. "Wo hast du das alles gelernt?" Sie antwortete mit derselben Frage. "Wo hast du gelernt, was du kannst?" "In Bremen, bei einem Schwertmeister." "Und was hat der getan, wenn du bei einer Übung ungeschickt warst?" "Er hat mir gezeigt, wie ich es besser machen kann. Er war ziemlich geduldig." "Genau das ist der Unterschied. Mein Schwertmeister war beim Unterricht niemals geduldig. Wenn ich mich dumm anstellte, prügelte er mich grün und blau. Dabei sagte er: 'Du kannst von Glück reden, dass du nur verprügelt wirst. Eigentlich bist du jetzt tot.' Manchmal drohte er mir: 'Wenn du heute nicht besser bist als gestern, bringe ich dich um.' Ich glaubte ihm und wurde tatsächlich immer besser." "Dieser Mann muss vom Teufel besessen sein." "Ich verdanke ihm in gewisser gab und sich ihm verweigerte. Eigentlich sah er sich in der Rolle ihres heimlichen Beschützers. Bis zum Fechtturnier war er der Ansicht gewesen, dass sie ihn dringend brauche. Dabei fühlte er sich durchaus reinen Herzens. Dass er auch mit der Vorstellung liebäugelte, sie in seine Abhängigkeit zu bringen, war ihm nicht bewusst - im Gegensatz zu ihr. So war es nur eine Frage der Zeit, bis sie sich erstmalig stritten. Bei einer der abendlichen Versammlungen lehnte sich Ernst Eisenarm auf, ohne Anlass, nur um zu erproben, was er sich herausnehmen durfte. Noch ehe Franziska antworten konnte, stopfte Norbert ihm mit klaren Worten den Mund. Hinterher kam er sich großartig vor, und selbstverständlich erwartete er Dankbarkeit. Als das junge Mädchen ihn stattdessen anfauchte, verstand er die Welt nicht mehr. "Spiel dich nicht als mein Ritter auf! Spar dir deine Worte auf für den Fall, dass du selbst angegriffen wirst!" "Was ist Schlechtes daran, wenn ein Mann das Mädchen, das er mag, beschützen will?! Ist er nicht gar dazu verpflichtet?" "Ich brauchen niemandes Schutz", versetzte sie trotzig. "Im Übrigen bin ich keineswegs deine Frau." Sie sagte nicht, dass sie dem Stande nach über ihm stand. Sie dachte nicht einmal daran. Er aber unterstellte ihr, genau auf diesen Unterschied anzuspielen. Vermutlich würde ihre Familie den Segen verweigern für die Ehe mit einem Bürgerlichen. Tief beleidigt ging er davon. Lange dauerte dieses erste Zerwürfnis aber nicht an. Schon bald bereuten beide ihre Heftigkeit und vertrugen sich wieder - was wiederum nicht verhinderte, dass sie noch öfter aneinander gerieten. Manchmal ging es um Hinsicht, dass ich noch lebe - auf der langen Wanderung von Köln hierher in meine Heimat. Mehr als einmal wäre ich tatsächlich tot gewesen, wenn ich mich dumm angestellt hätte." "Und wie lange warst du diesem furchtbaren Mensch ausgeliefert?" "Nicht lange. Ein Jahr vielleicht. Diese Monate aber werde ich nie vergessen. ... Übrigens möchte ich, dass du nicht so schlecht von ihm redest. Ich bin ihm wirklich dankbar. Vielleicht ist er ja ein Engel, den Gott mir geschickt hat." "Gehörte dieser eigenartige Blick auch zur Ausbildung?" "Selbstverständlich! Man muss den Gegner verwirren. Es gibt da noch viele andere Mittel." "Erzähl!" Sie lächelte verschmitzt. "Die verrate ich natürlich nicht." "Auch mir nicht?" "Nicht einmal dir." Norbert lächelte gutmütig zurück. Tief in seinem Innern freilich kränkte es ihn, wenn sich Franziska so überlegen 51 Prinzipien, manchmal um Kleinigkeiten. Manchmal vermochten sie sich gerade noch rechtzeitig zu bremsen, manchmal schrieen sie sich an und schmollten zwei volle Tage lang miteinander. Dass sie sich dabei immer näher kamen, merkten sie fast gar nicht. Sie waren nun einmal beide eigenwillig und selbstbewusst. Die Vertrautheit wuchs langsam wie ein Baum. II F ür Christian gab es nur eine Schlussfolgerung aus dem, was er beobachtete - er tat recht daran, wenn er sich von den Weibern fern hielt. Leider blieb er von Norberts täglichen Tragödien nicht gänzlich verschont. Sein Freund war für die Menschheit verloren. An den guten Tagen (den seltenen) verkroch er sich mit seiner Franziska im Wald und turtelte mit ihr herum. An den schlechten Tagen (den häufigen) jammerte er entweder wie ein Klageweib oder aber er fluchte wie ein Landsknecht. Was war nur aus ihm geworden?! Christian vermisste die Streitgespräche über den Erzbischof, über Bremens Zukunft und über die wahre Religion. Er führte seither ein recht einsames Leben. Zwar stand er gelegentlich im Mittelpunkt, weil er bei den Abendversammlungen wegen seiner radikalen Meinungen zum Wortführer der Bürgerssöhne wurde (an Norberts Stelle), doch nahm er sich tagsüber mehr und mehr jener Arbeiten an, die er allein erledigen konnte. Zu diesen Pflichten gehörte die Versorgung der Jungtiere. Die Bewohner der Waldhütte hatten sich inzwischen so viele Tiere zusammengeraubt, dass besondere Ställe notwendig geworden waren. Es gab (neben Hühnern und Enten) zwei Schweine, eine Ziege und ein halbes Dutzend Schafe. Bei den Schafen hatte sich Nachwuchs eingestellt. Leider waren die Lämmchen zu früh auf die Welt gekommen. Das Muttertier hatte sich wohl bei seiner Entführung zu sehr aufgeregt. Christian bemühte sich nun mit an Besessenheit grenzendem Ehrgeiz um die Frühchen. Er stand deshalb sogar mehrmals in der Nacht auf. In dem besonders geschützten Winkel des Stalls, den er für die Lämmchen ausgesucht und in welchem er ihnen ein Lager eingerichtet hatte, war er stets allein. Er vernahm deutlich, was draußen vor sich ging, konnte sogar Gespräche verstehen, gehörte aber nicht dazu. Schon bald war er an diesen Umstand so sehr gewöhnt, dass er sich, wenn er den Stall betrat, nicht mehr nach unerwarteten Gästen umblickte. So kam es, dass er nicht merkte, als er einmal beobachtet wurde. Auch Ramira zog sich gern in geschützte Winkel zurück. Sie hatte sich in den zurückliegenden Wochen kaum verändert, insbesondere ihre Unnahbarkeit nicht abgelegt. Allerdings war sie (ohne einen eigenen Beitrag dazu geleistet zu haben) in eine besondere Rolle hineingeraten. Es liegt in der menschlichen Natur, für ungewöhnliche Dinge eine Erklärung zu suchen, welche sich in das althergebrachte Weltbild einfügt. Deshalb wurde in der Waldhütte unermüdlich gerätselt, was es wohl mit diesem sonderbaren Mädchen im Bettlerinnengewand auf sich haben mochte. Irgendjemand (im Nachhinein bekannte sich niemand mehr dazu) stellte die Vermutung auf, sie sei vielleicht eine Fee. Wenn sie zu den 52 Geistern gehörte, wäre es verständlich, dass sie den Menschen aus dem Wege ging. Das Gerücht wurde zum Anlass unzähliger Spekulationen über das Wesen der Feen im Allgemeinen und über Ramira im Besonderen. "Feen zeigen sich ganz selten am Tage. Und wenn sie ans Licht kommen, dann nur aus besonderen Anlässen und nur ganz kurz." "Weißt du denn nicht, dass es Tagfeen und Nachtfeen gibt? Zwar sind die Tagfeen in der Minderheit, aber tief in den Wäldern sieht man sie öfter, als die meisten Leute glauben." "Aber sie sind durchsichtig. Man kann sowohl durch ihre Kleider als auch durch ihren Körper hindurch blicken." "Nein, auch das ist ein Vorurteil. Haben denn die Menschen alle dieselbe Farbe? Bei den Feen verhält es sich nicht anders. Manche von ihnen sind durch nichts von menschlichen Mädchen zu unterscheiden." "Aber Feen sind hübsch und unermesslich reich." "Auch Ramira ist eigentlich hübsch. Sieh dir ihre rotgoldenen Haare an und ihre strahlend blauen Augen! Sie verkleidet sich, damit wir sie nicht belästigen. Und ihre Schätze sind natürlich in einer Höhle verborgen, deren Eingang sich nur mit einem Zauberspruch öffnen lässt." Einigkeit herrscht darin, dass sie zu den gutmütigen Feen gehörte (sofern sie denn eine war). Nun sind gutmütige Feen bekanntlich Glücksbringer. Wenn sie wollen, können sie alles herbeizaubern, was das Herz begehrt. Leider lassen sie sich nur selten zum Glückszauber überreden. Man muss sehr viel Geduld mit ihnen haben. Vor allem darf man ihnen nicht durch Rohheiten Angst einjagen, weil sie sich dann in Luft auflösen und an diesen Ort niemals zurückkehren. Kaum hatte Ramira also jene Männer abgeschüttelt, die sie gern als Frau haben wollten, da scharwenzelten schon andere um sie herum, die aus irgendeinem Grund Glück benötigten. Und Letztere waren beharrlicher, denn sie fühlten sich in ihren Überzeugungen noch bestätigt, wenn sie vor ihnen flüchtete. Eigentlich wollte sich das junge Mädchen heimlich aus dem Stall schleichen, doch der Anblick, der sich ihr bot, fesselte und überraschte sie so, dass sie an ihrem Platze blieb. Christian hielt eines der beiden Lämmchen im Arm wie einen Säugling und flößte ihm mit einem geschickt gefalteten Stofffetzen Milch ein. Das Mutterschaf hatte das schwächliche Jungtier längst aufgegeben. Das Kleine merkte, dass mit der ihm dargebotenen Zitze etwas nicht stimmte. Christian aber ließ sich von seiner Ungeschicklichkeit nicht aus der Ruhe bringen und bemühte sich mit schier unendlicher Geduld wieder und wieder. Ganz selten hatte Ramira einen Mann gesehen, der so behutsam war. Plötzlich merkte er, dass ihm jemand zusah. Das war im Grunde kein Anlass, sich aufzuregen. Er tat nichts Verbotenes, mehr noch - jeder in der Waldhütte wusste, dass er in diesem Stall die Jungtiere versorgte. Vielleicht wäre er an einem anderen Tage tatsächlich gelassen geblieben. An diesem Abend aber war er schlecht gestimmt. Nachdem er das inzwischen gesättigte Lämmchen auf sein Lager gelegt hatte, fiel er über Ramira her. "Ich habe es satt, dass mir ständig Frauen nachschleichen!" stieß er hervor - mit gedämpfter Stimme (um die Tiere nicht zu erschrecken) aber wild gestikulierend und mit vor Wut dunklen Augen. "Du willst sehen, wie ich reagiere! Ist es so? Da hast du dann was zu kichern, wenn du wieder mit deinen Freundinnen zusammen bist. Warum könnt ihr nicht begreifen, dass ich allein 53 wunderbar zu Recht komme?! Ich brauche niemanden!" Ramira sah ihn entgeistert an. Sie hatte in ihrem Leben schon viele ungerechtfertigte Vorwürfe über sich ergehen lassen müssen, selten aber war ihr einer derart absurd vorgekommen. Sie fragte sich ernsthaft, ob Christian verrückt war, nicht schlimm, nicht so, dass er nicht mehr wusste, was er tat, aber eben doch ein bisschen. Andererseits rette sein Anfall sie aus einer Versuchung. Sie ging den Männern ja nicht aus dem Wege, weil sie zu den Feen gehörte, sondern weil sie Arnold und Raimund nicht vergessen konnte und sich solchen Kummer nicht noch einmal zumuten wollte. Sie bekam schon Alpträume, wenn sie am Abend in Gedanken mit der Möglichkeit spielte, sich ein drittes Mal zu verlieben. III W ieder vergingen einige Wochen, in denen sich nichts Besonderes ereignete. Franziska hatte sich als Anführer weitgehend durchgesetzt, sowohl bei den Räubern als auch bei den Bürgerssöhnen, aber das änderte fast nichts am Alltag. Dass man neuerdings mehr von der eigenen kleinen Landwirtschaft lebte als von den Raubüberfällen an der Handelsstraße, lag weniger an ihrem persönlichen Einsatz als am allgemeinen Hang zur Bequemlichkeit. Selbst Raubeine wie Rupert und Ernst Eisenarm mochten keine unnötigen Gefahren heraufbeschwören. Franziskas Erfolg inmitten der Männerwelt beruhte vor allem darauf, dass sie zwischen den beiden Gruppen ausgleichend wirkte. Die Vernunft verlangte ganz einfach nach einem Richter, welcher die ständig aufs Neue aufflackernden Streitereien schlichtete. Allenfalls Dummköpfe wie Ernst Eisenarm rüttelten zuweilen an ihrer Autorität - und wurden prompt von den anderen in die Schranken gewiesen. Langsam und beinahe unmerklich aber war in dieser Zeit etwas Neues in der Waldhütte aufgekeimt. Zunächst hatte es nur die Bürgerlichen erfasst. Seit sie nicht mehr in ständiger Furcht vor dem nächsten Tag lebten, redeten sie wieder häufiger über die Zukunft. Sie weilten mit ihren Gedanken wieder in Bremen, stellten Mutmaßungen an über die Machenschaften des Erzbischofs, versuchten die spärlich zu ihnen dringenden Nachrichten zu deuten. Mit einem Wort - sie wurden wieder zu Geheimbündlern im Kampf für eine bessere Welt. Diese politischen Gespräche am Abend gewannen stark an Bedeutung, als sich Rupert aus einer Laune heraus an ihnen zu beteiligen begann. Am Anfang waren die Bürgerssöhne davon alles andere als begeistert, mussten aber bald eingestehen, dass sie den Räuberhauptmann unterschätzt hatten. Er war durchaus klug genug, um folgen zu können und verblüffte zuweilen mit Einzelheiten, von denen nur er wusste, woher auch immer. Und dann fing er Feuer. Einen Erzbischof in die Enge treiben, das war etwas anderes als Kaufleute überfallen! Letztlich dachte er nur an seinen persönlichen Ruhm. Aber er lernte die klangvollen Phrasen rasch und begann Reden zu halten, mit denen er selbst Norbert und Christian in den Schatten stellte. Einmal nutzte er das gemeinsame Abendessen dafür. Er pflanzte sich in der Mitte neben dem Bratenspieß auf und tat, als wolle er lediglich eine Neuigkeit verkünden. 54 "Gerhard von Bremen, dieser Hurensohn, will einen Krieg gegen die Stedinger vom Zaun brechen, und Burchard von Wildeshausen (auch so ein sauberer Geselle!) der soll das Heer anführen." "Wer hat dir denn das erzählt? Nein, das glauben wir dir nicht." "Ich weiß, was ich weiß!" entgegnete er nur und ging sofort über zu der Vorführung, die er sich zuvor überlegt hatte. "Ihr denkt: Was gehen uns die Stedinger an? Sollen sie doch zusehen, wie sie mit dem Heer aus Wildeshausen fertig werden! Ich dagegen sage euch: Sie sind unsere Brüder." Er blickte in die Runde und wiederholen mit der Stimme eines Löwen: "Jawohl! Unsere Brüder! Wenn wir sie im Stich lassen, so treffen wir uns selbst. Dies nämlich ist der ewige Streit zwischen den Armen und den Reichen." Unvermittelt trat er vor Ernst Eisenarm: "Gehörst du zu den Reichen?" "Aber nein!" antwortete der Angesprochene verwirrt. "Und wie ist es mit dir?" drang Rupert auf Christian ein. "Natürlich nicht!" sagte dieser, ein wenig verärgert darüber, in das Schaustellerstück einbezogen zu werden. "Wir alle gehören nicht zu den Reichen", fasste der Räuberhauptmann zusammen. "Und weil das so ist, sind die Reichen unsere Feinde", schlussfolgerte er triumphierend. Franziska verfolgte die Entwicklung mit Unbehagen. Ruperts plötzliche Begeisterung für Politik brachte die beiden Gruppen einander näher verbunden mit der Gefahr, dass die (trotz ihrer Bildung) ziemlich leichtgläubigen Bürgerssöhne von ihren gewieften Bündnispartnern einmal mehr über den Tisch gezogen wurden. Unter diesen Umständen wollte sie sich die Herrschaft nicht aus der Hand nehmen lassen. Sie war mehr als alle anderen in der Welt herumgekommen und fiel nicht mehr so leicht auf großartig klingende Reden herein. Mochte Rupert auch kein tumbrer Schlagetot sein, ein gefährlicher Abenteurer war er allemal. In mehreren schlaflosen Nächten grübelte sie, wie sie sich verhalten sollte. Von den Stedingern wusste sie nur wenig. Wer hatte bei ihnen gerade das Sagen? Dass sie keine Grafen über sich duldeten, war nur die eine Seite der Wahrheit. Eine größere Menschengemeinschaft ohne jede Führung gibt es nicht. Franziska mochte sich nicht gern auf Bündnispartner einlassen, die sie kaum kannte. Andererseits blieb ihr wohl nichts anderes übrig, wollte sie Rupert den Wind aus den Segeln nehmen. Es wäre töricht von ihr gewesen, sich gegen die Mehrheit zu stellen. Nachdem sie sich so zu einer Entscheidung durchgerungen hatte, ergriff sie gleich bei der nächsten Gelegenheit die Initiative. "Ich halte es für gut, wenn wir Verbindung zu den Stedingern aufnehmen ", sagte sie und tat (zu Ruperts Ärger) gerade so, als habe noch niemand in diesem Kreis je etwas Ähnliches vorgeschlagen. "Allerdings wissen wir nicht, was umgekehrt sie von uns denken. Wir sollten zwei unserer Leute zu ihnen schicken, dass sie ihren Führern unser Angebot unterbreiten. Wer traut sich eine solche Aufgabe zu?" Nach kurzem Zögern meldete sich Christian. Er fühlte sich ohnehin nicht mehr so recht wohl in der Waldhütte. Die mit dem Weg verbundene Gefahr schreckte ihn nicht, denn er war kein Feigling. Doch er sollte nicht allein gehen und ein zweiter Freiwilliger fand sich nicht. Rupert und Norbert wollten (aus verschiedenen Gründen) nicht aus Franziskas Nähe weichen. Ernst 55 Eisenarm drückte sich und schützte eine Magenverstimmung vor. Nach langem, betretenem Schweigen wandte sich die Ritterstochter an ihre Freundin Ramira. "Würdest du es tun? Du weißt dir in jeder Lage zu helfen, weil du das Umherziehen gewohnt bist." "An mir soll es nicht scheitern! Ich weiß aber nicht, ob Christian ..." Verständnislos blickte Franziska den jungen Mann an. "Was ist daran so schwierig? Ihr geht zusammen! Christian versteht sich gut auszudrücken, Ramira wird unauffällig beobachten." Damit war es beschlossene Sache. Christian war klar, dass er seine Bereitschaft nicht ohne Gesichtsverlust wieder zurücknehmen konnte, und fügte sich missmutig. IV A m Morgen des nächsten Tages brachen die beiden auf. Quer durch den Wald zu gehen, wäre zu gefährlich gewesen. Aber auch die Straßen waren voller Tücken. Die Kaufleute fuhren in dieser unsicheren Gegend fast nur noch in Kolonne mit bewaffneten Begleitern. Die Reiter schwärmten mitunter aus, um den Weg nach vorn zu sichern. Urplötzlich konnten sie hinter einer Biegung auftauchen. Selbstverständlich hatten die beiden keine Lust, als Landstreicher aufgegriffen und auf irgendeiner Burg einem strengen Verhör unterzogen zu werden. Wenn sie sich einmal halbwegs sicher fühlen durften, litten sie unter der Verkrampftheit ihres Verhältnisses zueinander. Am Anfang redeten sie kein Wort. Das aber wurde Ramira schließlich gar zu dumm. So knüpfte sie einfach an das Gespräch im Stall an. "Du magst also keine Frauen?" "So ist es!" bestätigte Christian und wurde plötzlich regelrecht geschwätzig. "Sobald sich ein Mann auf ein Weib einlässt, verliert er seine Kraft und seinen Verstand. Sieh dir Norbert an! Seit er seine Franziska hat, ist er zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich sage nicht, dass das an Franziskas bösem Willen liegt. Ob sie ihn erhört oder ob sie ihn zum Teufel schickt - er redet hinterher fast genau dasselbe dumme Zeug. Das kommt wie eine Krankheit. Mich warnt ein guter Geist, der stets wachsam in meinem Nacken sitzt und mich kneift, sobald ich einen Fehler begehen will. Sobald ich mir (warum auch immer) vornehme, mich um eine Frau zu bemühen, bekomme ich höllische Schmerzen im Rücken. Gebe ich meinen törichten Plan auf, sind die Schmerzen weg." Ramira hörte ihm schweigend zu und musste sich das Lachen verbeißen. 'Er ist ganz sicher verrückt!' dachte sie bei sich. 'Aber irgendwie verrückt auf nette Weise.' Überhaupt kam sie zu der Überzeugung, dass er kein so schlechter Begleiter war, denn während er an den Frauen und Mädchen kein gutes Haar ließ, verhielt er sich andererseits durchaus ritterlich. Er half ihr über die Wasserläufe hinweg, schleppte ohne zu murren fast das gesamte Gepäck und bestand beim Essen darauf, dass sie die besten Stücken nahm. Selbstverständlich stellte er bei jeder Gefälligkeit klar, dass sie sich bloß nichts darauf einbilden solle. Einmal sagte sie: "Du bist der sonderbarste Vogel, der mir je über den Weg gelaufen ist - und 56 ich habe eine Menge Leute kennen gelernt." "Was willst du damit sagen?" fragte er argwöhnisch. "Dass ich dich nicht leiden kann! Dass ich dich ganz unausstehlich finde." "Dann ist es gut!" Nach drei Tagen erreichten die beiden Abgesandten den Wall an der Ochtum. Sie hatten die Straße verlassen und eine Wiese überquert, in der Hoffnung, damit abzukürzen. Anstatt aber an ein Dorf zu kommen und Menschen zu treffen, standen sie nun ziemlich ratlos vor den Befestigungsanlagen der Stedinger. Erst nach einigem Zögern entschlossen sie sich, auf die andere Seite hinüber zu klettern. "Wenn sie uns jetzt gesehen haben, müssen wir uns eine gute Erklärung einfallen lassen", flüsterte Ramira. "Wenn Bewaffnete kommen, lenke ich sie ab und du versuchst zu fliehen." "Ich soll dich hier allein lassen?! Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich das mache?!" "Jemand muss in der Waldhütte Bescheid sagen. Hab dich nicht so!" Die Wirklichkeit indes warf alle ihre Überlegungen über den Haufen. Nachdem sie eine Weile gelaufen waren, wurden sie plötzlich in einem Hohlweg von fünf Männern eingekreist, ohne viel Federlesens gefangen genommen und sofort verhört. "Hat euch der Erzbischof geschickt? Was sollt ihr bei uns ausspionieren? Unsere Wälle?" Ramira war elend zumute. Böse Erinnerungen stiegen in ihr auf. So sehr sie auch mutig zu bleiben versuchte, begann sie zu zittern und brachte kein sinnvolles Wort über die Lippen. Christian indes war ruhig, als feilsche er mit einer Marktfrau. "Als Spione hätten wir uns geschickter angestellt." "Wir haben euch entdeckt, weil wir auf der Hut sind." "Ihr habt uns entdeckt, weil wir ganz offen den Weg entlang spaziert sind. Was soll dieses Misstrauen? Wir sind Freunde und wollen mit euren Anführern reden." Die bewaffneten Bauern berieten sich leise. Dann sagten sie: "Gut, ihr werdet mit unseren Anführern reden können. Aber wenn ihr uns hintergeht, bekommt euch das schlecht." Zwei der Bauern führten die Abgesandten nun in Richtung Nordwesten. Vor ihnen musste irgendwo die Weser liegen. Christian und Ramira kannten sich aber nicht aus und versuchten erst gar nicht, sich genauer zu orientieren. Rechts und links sahen sie vorbildlich bewirtschaftete Felder und Weiden. Durch die rechtwinkligen Abgrenzungen der einzelnen Parzellen, genau gekennzeichnet mittels Markierungssteinen und niedrigen Zäunen, wirkten sie ganz besonders ordentlich. Zweifellos war der Alltag hier im Land der Stedinger ungewöhnlich gut organisiert. Ramira wurde dabei ein wenig unheimlich zumute. Sie hatte sich als Gauklerin mit einem Leben zwischen Gefahr und Freiheit angefreundet, ähnelte einem Vogel - im Walde ständig auf der Flucht und dennoch im prächtigsten Käfig todunglücklich. Nach etwa zwei Stunden erreichten die vier ein ausgedehntes Anwesen, in dessen Mitte ein erst kürzlich fertig gestelltes Steinhaus thronte, die Residenz der Anführer. Ob sie dort mit ihren Familien wohnten, oder ob das Gebäude der Gemeinschaft gehörte, blieb zunächst offen. Jedenfalls gab es einen Raum, der sowohl in der Größe als auch in der Ausgestaltung viele Rittersäle ausstach. Zwei andere Räume 57 waren Salons nachempfunden. In einem davon hieß man Christian und Ramira zu warten. Nach der rauen Begrüßung rechneten sie kaum noch mit glücklichen Verhandlungen. Ihre Hoffnungen liefen vor allem darauf hinaus, möglichst bald und möglichst ungeschoren zur Waldhütte zurück zu gelangen. Doch sie erlebten eine angenehme Überraschung. Offenbar waren die Anführer weniger misstrauisch als ihre Gefolgsleute an den Grenzen. Sie kamen zu dritt und betonten von Anfang an, dass ihnen an Bündnispartnern sehr gelegen sei. Aus ihren Fragen ging hervor, dass sie das ernst meinten. Während Christian redete, hatte Ramira Gelegenheit, die drei Männer zu beobachten. Tammo von Huntorf war der Wortführer. Stolz stellte er sich als ehemaliger Schmied vor. Von seinem Handwerk hatte er die gewaltigen Oberarme und die schwieligen Hände übrig behalten. Überhaupt war er ein Riese. Mit seinem Kahlkopf, in welchem eine dicke Nase und zwei hervortretende runde Augen auffielen, wirkte er beinahe Furcht erregend. Aber dieser erste Eindruck täuschte, denn beim Verhandeln neigte er von allen am ehesten dazu, Kompromisse einzugehen. Dietmar tom Diek war dagegen ein kleiner, dunkelhäutiger Mann mit dichtem Bart und flinken Augen, in denen stets ein schalkhaftes Blitzen zu sein schien. Zweifellos stammten seine Vorfahren weder aus Holland noch aus Norddeutschland. Er blieb stets ein wenig undurchsichtig. Manchmal hatte es den Anschein, als belauere er seinen Gesprächspartner, als ziele er darauf ab, ihn in eine Falle zu locken. Andererseits - Warum sollte er zwei Fremden auf Anhieb uneingeschränkt Vertrauen schenken? Vermutlich war er der Kopf der Stedinger, der Taktiker, der Denker. Bei Wige, dem dritten im Bunde, änderte Ramira ihre Ansicht ein halbes Dutzend Mal. Am Ende hatte sie sich noch immer nicht entschieden. Er wirkte sehr elegant und trug sein Haar ungewöhnlich gepflegt, passte nicht recht zu den Bauern, zu deren Anführer er gehörte. War er ein Verbündeter, ein übergelaufener Adliger? Er selbst betonte, in Braake an der Ochtum aufgewachsen zu sein. Immer mehr Widersprüchliches fiel dem jungen Mädchen an ihm auf. Einerseits war er äußerst liebenswürdig, andererseits gab es da um seine Mundwinkel einen beunruhigenden Zug. Ramira hatte sich so in ihre Beobachtungen vertieft, dass sie von den Gesprächen nur wenig mitbekam. Auf dem Rückweg, als die beiden jenseits der Schutzwälle wieder unter sich waren, musste sie Christian fragen, was bei der Verhandlung eigentlich herausgekommen sei. "Haben wir nicht mit deutscher Zunge gesprochen?" spottete er, gab dann aber doch bereitwillig Auskunft. "Sie sind ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits brauchen sie so viele Bündnispartner wie möglich, weil sich ja auch ihr Feind, der Erzbischof von Bremen, unermüdlich nach neuen Parteigängern umsieht. Andererseits fürchten sie sich vor Spionen und Verrätern. Nun ja! Ich denke, der Boden ist bereitet. Für die Ernte sind unsere großen Schlauköpfe zuständig Franziska, Norbert, Rupert." "Was hältst du von dem Wige?" Christian zuckte mit den Schultern. "Ein wenig fanatisch ist er. Will immer noch einen draufgeben, wenn einer was sagt. Sieht sich als den Größten an von allen. Aber solche Leute sind meistens harmlos. Für mich ist er ein Aufschneider. Das Sagen haben die anderen beiden. Tammo von Huntorf ist der oberste Befehlshaber des 58 Heeres, Dietmar tom Diek macht das Politische." Während er so mit Ramira sprach, war sich Christian gar nicht mehr bewusst, dass er ein Mädchen vor sich hatte. Beide vergaßen den Hinweg mit seinen Verkrampftheiten. Das gemeinsame Erlebnis hatte sie gleichsam unmerklich aneinandergekettet. Am zweiten Abend saßen sie einander an einem kleinen Feuer gegenüber. Der Widerschein der Flammen flocht Lichtreflexe in ihr Haar, was Christian derart beeindruckte, dass er lange wie im Traum dorthin starrte. Dann flüsterte er, noch immer nicht ganz wach: "Du hast wunderschöne Locken!" Ramira stutzte und musste dann unwillkürlich lachen: "He! Was war denn das? Du hast mir ja etwas richtig Nettes gesagt! Was meint dein Schutzgeist dazu?" Christian begriff und kratzte sich verlegen hinter dem Kopf. Dann aber musste auch er lachen. "Ach, die Geister!" 59 6.Kapitel I N och war die Sonne nicht zu sehen. Man konnte nur ahnen, dass sie hinter dem Dom, dessen tiefschwarze Masse wie ein Felsen die Bürgerhäuser überragte, gerade aufging. Ihr Licht aber hatte die Mauer bereits erreicht. Auf der Wiese, die sich von ihrem Fuß bis zu einem Waldsaum erstreckte, ließen sich einzelne Sträucher unterscheiden. Es war jene Stunde, zu der die gewöhnlichsten Gegenstände ein bizarres Erscheinungsbild annehmen und zaghafte Gemüter sich auch ohne besondere Ursache gruseln. Die drei Männer, die zwischen den Zinnen nach unten spähten, gehörten nicht zu den zimperlichen Leuten. Als Waffenknechte des Erzbischofs stand ihnen das auch nicht zu. Dennoch war ihnen unwohl zumute an diesem Julimorgen. "Wenn sie heute einen Angriff versuchen, dann jetzt und zwar genau hier", flüsterte der eine. "Sieh mal! Dort hat sich etwas bewegt. Sie schleichen sich heran und nutzen die Sträucher als Deckung. Warum hat man die nicht abgehackt?" Mit angehaltenem Atem starrten die drei in die Dämmerung, die rechte Hand am Griff des Schwertes, gewärtig, im nächsten Augenblick die Angreifer mit Leitern heran stürmen zu sehen. Da plötzlich wurde die Stille durchschnitten von einer gewaltigen Stimme. Einen Moment lang meinten die Waffenknechte allen Ernstes, Gott der Allmächtige selber spreche da zu ihnen. "Was seid ihr für Jammerlappen, dass ihr vor ketzerischem Bauerngesindel erzittert?! Geht hinaus und schlagt ihnen die sündigen Schädel ein, anstatt euch hinter den Wehren zu verkriechen!" Sie fuhren herum und sahen einen Mönch, der sich anschickte, auf eine der Zinnen zu klettern. Von unten gesehen musste er sich gegen den blassen Morgenhimmel abheben und so für Bogenschützen ein vortreffliches Ziel bieten. "Er ist verrückt", raunte einer der Waffenknechte. Der Mönch hatte ihn verstanden, kam von der Mauer herunter und packte ihn an seinem Lederwams. "Verrückt nennst du Lump es also, wenn jemand auf Gottes Schutz vertraut! Versuche nicht, dich herauszureden! Ich sehe dir an, dass du allein des schnöden Mammons wegen hier stehst, schlotternd um deinen schäbigen, vergänglichen Leib und dafür sorglos um deine Seele. Es sind betrübliche Zustände, die ich hier vorfinde. Ich werde dem Erzbischof die Augen öffnen müssen." Dann drehte er sich um und verschwand so geheimnisvoll, wie er gekommen war. Ganz Unrecht hatten die drei Waffenknechte nicht, als sie in dem fremden Mönch den Herrgott zu erblicken glaubten. Er war kein Geringerer als Konrad von Marburg, der Großinquisitor für die deutschen Lande. Papst Gregor IX hatte ihn vor drei Jahren bevollmächtigt, ohne Nachsicht gegen jeden vorzugehen, der sich der Römischen Kirche zu widersetzen wagte. Von keinem weltlichen Manne, nicht einmal vom Kaiser sollte er sich dabei beeinflussen oder gar behindern lassen. Freilich lag zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine beträchtliche Kluft. Ein Ketzer bürgerlichen oder bäuerlichen Standes ließ sich noch ohne viel Federlesens in Ketten abführen. Bei einem widerspenstigen Grafen war das schon eine ganz andere Geschichte. Indes hätte der Heilige Vater kaum einen besseren Diener finden können als Konrad. Dessen Eifer folgte nicht allein aus seinem Gehorsam oder seinem Pflichtbewusstsein, nein, der Marburger litt geradezu körperlich unter den vielfältigen Häresien, die sich allerorten breitmachten, ähnlich dem Unkraut, das der Gärtner auszuraufen versäumte. Allem Anschein nach fehlte ihm jede Leidenschaft, von jener einen einmal abgesehen. Er verabscheute den Reichtum. Auch sah man ihn niemals freundlich mit einer Frau reden. Allenfalls wenn er einen jener verfluchten Feinde der einzig rechtmäßigen Kirche zur Strecke gebracht hatte, konnte es geschehen, dass der Anflug eines Lächelns seine dünnen Lippen verbog. In Rom baute man auf Leute seines Schlages. Dort erinnerte man sich noch allzu gut an die Albigenser, die in der Umgebung von Toulouse die Menschen zu Tausenden im Glauben irre gemacht und sogar mächtige Fürsten auf ihre Seite gezogen hatten. Ströme von Blut waren geflossen, ehe auch dort wieder die gottgewollte Ordnung Einzug halten konnte. Nein, so weit durfte man es nicht wieder kommen lassen. Man musste den eiternden Fuß abhacken ehe er den ganzen Leib vergiftete. So nahm Papst Gregor jenes Schreiben des Bremer Erzbischofs, worin dieser von ungeheuerlichen Freveln der Stedinger Bauern berichtete, nicht auf die leichte Schulter. Um selbst ein Bild zu gewinnen von den angedeuteten Zuständen, entsandte er einen Mann seines Vertrauens, den besten, den er für diese Dinge wusste, eben Konrad von Marburg. Der Großinquisitor weilte seit vier Tagen in der Stadt. Unmittelbar nach seinem Eintreffen hatten die Stedinger die Stadt eingeschlossen. Zweifellos war der Belagerungsring nicht undurchlässig. Die rebellischen Bauern machten jedoch die ganze Gegend unsicher und kannten sich hervorragend aus. Es war nahezu unmöglich, sie zu packen. Sie wichen den gerüsteten Reiterverbänden aus, um im nächsten Moment einen Trupp Leichtbewaffneter niederzuwerfen. Dennoch war Konrad, während er mit dem festen Schritt eines Hauptmanns zum Palast des Erzbischofs schritt, in bester Stimmung. Er hatte den drei Männern auf der Mauer keineswegs etwas vorgegaukelt, er fürchtete die Bauern in der Tat nicht. Im Geiste sah er ihre Rädelsführer bereits auf dem Scheiterhaufen. Für ihn war das alles in erster Linie ein juristisches und politisches Problem. Die Diplomatie gehörte nicht zu seinen Stärken. Deshalb fürchtete er, dass ihm (wie schon manches Mal zuvor) irgendein regierender Herr aus selbstsüchtigen Gründen einen Strich durch die Rechnung machte. Das Beste, was ihm unter diesen Umständen widerfahren konnte, waren himmelschreiende Untaten der Ketzer. Mochten sie Frauen schänden und Männern die Kehle durchschneiden! Jede Gräueltat war ein guter Rechtfertigungsgrund gegen die Zauderer und Zweifler. Zu seiner Freude hatte Konrad in dem Erzbischof schon nach wenigen Gesprächen einen Mann mit Rückrat erkannt, zumindest in der Frage der Ketzerei im Wesermarschland. Auf dem Hof seines Palastes indes erwartete ihn eine herbe Enttäuschung. Er bemerkte eine Kutsche und wusste, dass Gerhard nicht allein war. Am Wappen erkannte er den Besitzer. Es war Johannes der Deutsche. Wie hatte der es geschafft, 61 jetzt noch in die Stadt hinein zu gelangen? Warum war er überhaupt (ungeachtet der Gefahr) hergekommen? Etwa ebenfalls in Häresieangelegenheiten? Eine Blutwoge schoss Konrad in den Kopf. Er war rasend eifersüchtig auf jeden, der ihm den Rang des eifrigsten Ketzerjägers streitig zu machen drohte. Der Deutsche besaß als Beichtvater des Papstes durchaus die Möglichkeit dazu. Freilich war er von anderer Wesensart. In Rom galt er als einer der geschmeidigsten und scharfsinnigsten Diplomaten. Zudem kannte er sich in den rauen Sitten der Leute nördlich der Alpen aus. Dies vor allem ließ ihn zu einem der engsten Vertrauten Gregors aufsteigen. Wollte sich der Papst den deutschen Kaiser vom Halse halten, musste er sich mit den deutschen Fürsten arrangieren. Einen Augenblick lang erwog Konrad, einfach umzukehren, sich noch ein wenig in der Stadt umzusehen und später wiederzukommen. Das aber empfand er dann als Feigheit und ließ sich anmelden. Auf der Treppe überlegte er sich, dass Johannes vielleicht einfach seiner Heimatstadt einen Besuch abgestattet hatte. Er stammte aus Wildeshausen. Gegen eine so einfache Erklärung sprach aber, dass auch der andere Johannes, der Bischof von Lübeck, anwesend war und dass man hinter verschlossenen Türen ohne Diener miteinander redete. Beim Eintreten wusste er endgültig, dass die drei über gewichtige Fragen verhandelte, mehr noch, er spürte eine äußerst gespannte Atmosphäre. Für einen Moment verstummte das Gespräch. Gerhard nutzte die Pause, um unter einem Vorwand aufzustehen und ein paar schnelle Schritte auf und ab zu gehen. Sein in Erregung geratener, athletischer Körper verlangte danach. Der Bischof von Lübeck betrachtete sich seine zarten Hände und überspielte damit eine gewisse Verlegenheit. Allein Johannes der Deutsche blieb undurchdringlich hinter seiner weltmännischen, im Grunde nichts sagenden Freundlichkeit. Er war dann auch derjenige, der den Eingetretenen in die Runde zog. Und obwohl dieser sich durchaus sträubte, machte er ihn zu seinem Verbündeten. "Ihr, lieber Konrad von Marburg, kennt ebenso wie ich die Bedrängnis, in welcher sich unser Heiliger Vater in Rom befindet, seit Kaiser Friedrich ihn von Norden und Süden umklammert hält. Deshalb werdet Ihr mir beipflichten, dass es eines Gegengewichts bedarf." "Gewiss!" brummte der Angesprochene, verärgert, in diesem Fall schwerlich widersprechen zu können. Der Deutsche wandte sich, die versteckte Feindschaft nicht beachtend, wieder dem Erzbischof zu: "Es ist einem jeden, der die Verhältnisse kennt, offenkundig. Um aber einen Mann wie Friedrich zu bändigen, bedarf es eines starken Widerparts. Nicht viele kommen in Frage. Nennt mir einen besser Geeigneten, wenn Euch Otto von Lüneburg unwürdig erscheint!" Als der Name des verhassten Widersachers fiel, zuckte Gerhard zusammen und kehrte mit einer heftigen Handbewegung an seinen Platz zurück. Johannes erkannte sofort, dass er die Kröte schlucken würde - unter bestimmten Umständen. Deshalb schlug er versöhnliche Töne an. "Ihr braucht nicht zu befürchten, dass Otto zum Gegenkönig erhoben wird. Niemand will Zustände wie vor dem Jahre zwölf. Der Heilige Vater ist zuversichtlich, bei seinen Verhandlungen mit dem Kaiser zu einer 62 Lösung zu gelangen. Es geht hier um einen politischen Schachzug." "Eine Erpressung?" warf Gerhard trocken ein. "Auch das. Jedenfalls steht dem Heiligen Vater nichts ferner, als Euch zu verärgern. Und sollte Euch tatsächlich durch Ottos Aufwertung ein Schaden entstehen, wird er Mittel und Wege finden, Euch angemessen zu entschädigen." Er ließ eine gewichtige Pause und beobachtete den Erzbischof genau. Dessen Gesichtszüge entspannten sich. Unter die Verärgerung mischte sich Neugier auf das Angebot. "Ihr habt Schwierigkeiten mit ketzerischen Bauern. Nun, ich würde mich in Rom dafür einsetzen, dass Ihr die entsprechenden Vollmachten erhaltet, um ..." "Ich will einen vom Papst gesegneten Kreuzzug!" sagte Gerhard gerade heraus. "Wie Ihr wisst, bin ich Gregors Beichtvater. Einen besseren Anwalt als mich könnt Ihr nicht finden." Der Erzbischof kämpfte mit sich. Er wollte beides, Stade und das Land der Stedinger. Und er war der Auffassung, dass ihm beides von Rechts wegen zustand. Doch er wusste auch, dass er vielleicht beides verlöre, schlüge er des Deutschen Angebot aus. "Was also kann ich im Sinne des Heiligen Vaters tun?" Johannes lächelte liebenswürdig. "Ich will nichts anderes, als mich der Loyalität eines mächtigen Mannes versichern." "Selbstverständlich liegen mir die Belange des Pontifex maximus nicht weniger am Herzen als meine eigenen", ahmte der Erzbischof dessen Redeweise nach, was bei ihm freilich ein wenig zynisch klang. Mit den üblichen Höflichkeitsfloskeln klangen die Verhandlungen aus. Wirklich zufrieden war letztlich nur der Bischof von Lübeck, der sich praktisch gar nicht beteiligt hatte. Johannes der Deutsche stand erst am Anfang einer Mission, für die er noch etliche Schwierigkeiten voraussah. Gerhard fragte sich, ob er nicht einen schlechten Handel eingegangen war. Konrad schließlich kochte innerlich. Leider durfte er sich weniger noch als der Erzbischof seinen Ärger anmerken lassen. Dabei stand dem Großinquisitor die eigentliche Demütigung erst noch bevor. Am Sonntag nach der Zusammenkunft im Palast des Erzbischofs las Johannes der Deutsche eine Messe im Dom. Diese Gelegenheit nutzte er zu einer Predigt wider die Ketzerei der Stedinger. Konrad war nahe daran, den Gottesdienst vorzeitig zu verlassen. Doch gerade noch rechtzeitig erinnerte er sich, dass der lästige Konkurrent seiner eigentlichen Aufträge wegen nicht lange würde bleiben können. Genau genommen, verweilte er sich schon viel länger, als ihm lieb war. Die Stedinger aber hatten den Belagerungsring inzwischen verstärkt und Johannes verspürte wenig Lust, sich von ihnen gefangen nehmen zu lassen. So kam es, dass Konrad von Marburg, dem der Angriff der Bauern anfangs so gelegen gekommen war, nun nichts so sehnlich wünschte, als dass sie sich endlich davon scherten. II 63 D iese verfluchte Dunkelheit!" murmelte der Dompriester. "Man sieht ja die eigene Hand nicht vor Augen." Andererseits wünschte er sich auch nicht gerade einen Vollmond, der ihn aus klarem Himmel anleuchtete. Er hatte sich das alles viel einfacher vorgestellt. In dieser Gegend war er geboren. Hier kannte er jeden Stein. Zumindest hatte er das bisher geglaubt. Wie anders aber sieht die Welt aus, wenn die Nacht sich herabgesenkt hat! Und der rundlich gewordene Mann musste sich auch eingestehen, nicht mehr so behände voranzukommen wie einst als Jüngling. "Welch ein Narr geistert hier zu dieser Stunde umher!" verspottete er sich selbst. In Wahrheit hatte er sich wohl berechnend auf das gefährliche Unterfangen eingelassen. Durch die Belagerung war ihm eine Aufgabe zugefallen, die seinem Rang keineswegs entsprach. Unwillkürlich tastete seine Hand nach dem Schriftstück, das ihn berechtigte, mit dem Grafen von Oldenburg und jenem von Bruchhausen im Namen des Erzbischofs zu verhandeln. Dabei durchrieselte ihn ein Schauer, als habe er eine Reliquie berührt. Schon stellte er sich den Triumph bei seiner Rückkehr vor. Zunächst allerdings musste er ein bestimmtes Pfarrhaus finden, wo ein Pferd für ihn bereitgehalten wurde. Tagsüber war der Turm der daneben stehenden Kirche schon von weither zu erkennen. In dieser Nacht bemerkte er ihn erst, als er schon fast dagegen rannte. "Wir waren in Sorge ..." begrüßte ihn ein kleiner Stallbursche mit pockennarbigem Gesicht. "Mit Recht! Ein halbes Dutzend Mal hatte ich die Orientierung verloren." Dass er immer wieder auf den rechten Weg zurück gelangt war, erschien ihm im Nachhinein wie ein Wunder - oder ein Fingerzeig Gottes. In dem Dorf hielt er sich nur kurz auf. Der Stallbursche sagte ihm, dass bis nach Oldenburg hin keine Gefahr mehr drohe. Also schwang er sich in den Sattel und ritt in scharfem Trab los. Die unerlässlichen Pausen eingeschlossen, benötigte er dennoch einen vollen Tag, ehe er sein Ziel erreichte. Es war bereits dunkel. Er konnte die Hunte auf einer festen Brücke zu etwa zwei Dritteln überqueren, dann stand er vor einem Abgrund. Sein Rufen bewirkte nichts. Entweder lagen die Wächter in tiefem Schlaf oder sie stellten sich taub. Erst im Morgengrauen ließen sie ihn auf den Hof. Unhöflich behandelte man ihn aber keinesfalls. Er befand sich auf Schloss Oldenburg und die Oldenburger Lebensart war weithin berühmt. Ein Diener erkundigte sich, ob er müde sei und ein wenig zu ruhen wünsche oder ob vielmehr sein Anliegen keinen Aufschub erlaube. Untröstlich zeigte sich der tadellos, beinahe vornehm gekleidete Mann ob des Umstandes, dass der Herr Graf mit seiner Gattin ausgeritten war. "Wenn die Zeiten friedlich sind und das Wetter angenehm, pflegen Durchlaucht zuweilen mit kleinem Gefolge ein paar Tage auf einem Gutshof zu verbringen. Wir erwarten ihn allerdings gegen Mittag zurück. Falls der Gesandte aus Bremen sich bis dahin gedulden könnte ..." Der Priester fand, dass die Oldenburger Höflichkeit auch einen Nachteil besaß - man wusste nie, woran man war. Zum Beispiel wurde er das Gefühl nicht los, als eine Art Bote zu gelten. Immerhin ließ sich Salome von Wickenrode, die Mutter Christians II, zu einem Gespräch mit ihm herab. Sie trat zwar öffentlich nur noch selten in Erscheinung, genoss aber ein hohes Maß ehrfürchtiger Verehrung und überwachte zudem die Erziehung des sechsjährigen Grafensohns Johann. Während der Priester mit ihr sprach, spürte er ihren wachen Verstand. Oberflächliche Zuhörer mochten meinen, die Unterhaltung drehe sich nur um Nebensächlichkeiten. In Wahrheit forschte sie den Gast aus. Diesem wurde dabei zunehmend unwohl, denn er wusste nicht, ob sie das aus eigenem Antrieb tat oder im Auftrage des Grafen. So war es für ihn eine Befreiung, als fröhliches Lärmen von der Ankunft der Herrschaftsfamilie kündete. Da die alte Gräfin ihn allein ließ, fand der Dompriester Gelegenheit, vom Fenster aus das Treiben auf dem Hof zu beobachten. Christian II hatte er schon öfter gesehen. Auch diesmal aber war er wieder erstaunt über dessen jugendliche Frische. Er trug nicht wie manch andere Herrscher den Reichtum durch Fettleibigkeit zur Schau, sondern legte Wert auf ein ritterliches Erscheinungsbild. Dazu gehörten bei ihm die guten Manieren ebenso wie die Gewandtheit. Oldenburg war auch bekannt für ein in jedem Jahr stattfindendes Turnier. Der kleine Johann liebte seinen Vater abgöttisch und ahmte ihm nach, so weit er das in seinem Alter vermochte. Auch von Natur her ähnelte er ihm auffällig. Er hatte dieselben glatten, blonden Haare, dieselben klaren, blauen Augen, dieselbe eigentümliche Form des Kopfes. Am häufigsten aber blickte der Priester zu Gräfin Agnes hin. Er war so verblüfft über sie, dass er sie zuerst nicht erkannte. Zuletzt hatte er sie vor drei Jahren gesehen. Damals stand sie ganz im Schatten ihres Mannes und ihr Spitzname war Häschen. Inzwischen hatte sie sich zu einer stolzen jungen Frau entwickelt, die sich zu behaupten wusste. Ihre Zierlichkeit fiel kaum noch ins Gewicht. Selbst ihr Mann behandelte sie anders als früher. Vielleicht hatte das Kind sie erwachsen werden lassen. Wahrscheinlicher als Ursache war freilich, dass sie nicht mehr im Bannkreis ihrer Schwägerin Kunigunde stand. Was mochte aus der wohl geworden sein? Kuni hatte als der heiß geliebte Schrecken aller jungen Ritter schon im zarten Alter von fünfzehn Jahren Berühmtheit erlangt. Nun war sie mit zwanzig die Frau eines Edelherrn namens Giselbert von Brunkhorst. Lebte sie glücklich mit ihm oder grämte sie sich? Oder trieb sie ihn mit ihren Launen in den Wahnsinn? Der Priester verscheuchte die Gedanken, denn er war unsicher, ob sie sich mit seinem Keuschheitsgelübde in Einklang bringen ließen. Zunächst zog sich die Grafenfamilie in ihre Privatgemächer zurück, um sich umzuziehen und vom Ritt zu erholen. Diener brachten Getränke und ein wenig Essen. Dann tauchte Christian II wieder auf, musste sich aber zunächst mit einer Angelegenheit befassen, die ihm ein Sekretär als äußerst dringend darstellte. Als der Dompriester dem Grafen schließlich gegenüber saß, musste er sich beherrschen, um sich keine Verärgerung anmerken zu lassen. "Ich habe den Auftrag, Euch im Namen seiner Eminenz, des Erzbischofs von Bremen, zu grüßen. Er ist voll des Lobes über Euer politisches Geschick und über Eure unnachgiebige Haltung gegenüber den Feinden der einzig selig machenden Kirche." Bei den letzten Worten huschte Christian ein Lächeln über das Gesicht, das dem Priester nicht entging. Gewiss, dieser Teil des Lobes war Ausdruck einer Erwartung, eine etwas vage Vorwegnahme also. Der Graf von Oldenburg hatte natürlich das Gedeihen 65 seines Herrschaftsbereiches weitaus mehr im Sinn als die Sorgen der Geistlichkeit. Die Ketzereien der Stedinger wären ihm vermutlich in geradezu sündigem Maße gleichgültig, würden die bewaffneten, täglich dreister auftretenden Bauern nicht seine eigenen Burgen und Höfe bedrohen. "Seine Eminenz beauftragte mich ferner, Euch in seinem Namen Hilfe anzubieten, denn Eure Feinde sind auch die seinen." Diesmal spiegelte sich ein Anflug von Unmut auf des Grafen Antlitz. "Bisher konnte ich mich und die Meinen mit eigenen Mitteln recht gut schützen." Diese Erwiderung hatte der Dompriester befürchtet. Dem Grafen war die Führungsrolle Gerhards ein Dorn im Auge. "Ein Ketzerkreuzzug bedarf eines weltlichen und eines geistlichen Führers." Das war ein Angebot, was Christian jedoch wenig beeindruckte, weil er durch Spione von Gerhards Zusicherungen an Burchard von Wildeshausen wusste. "Jener Kreuzzug, auf den du anspielst, entbehrt weder des einen noch des anderen. Bist du gekommen, mich als Fähnleinführer anzuwerben?" Der Dompriester geriet ins Schwitzen. Der Graf war nahe daran, ihm die Tür zu weisen, und er brauchte einen Erfolg, einen kleinen wenigstens. Sonst wäre alles umsonst gewesen, die Angst vor den Belagerern, der lange Ritt. Um sich aus der Ecke zu befreien, wagte er die Flucht nach vorn. "Meine Vollmachten sind beschränkt, doch bin ich hier in Vertretung des Erzbischofs, den der Aufstand der Stedinger in Bremen festhält." Zu seiner Überraschung lenkte Christian tatsächlich ein. "Es liegt mir fern, Euch zu beleidigen. Ich wollte mit meinem (zugegebenermaßen etwas gewagten) Scherz zu verstehen geben, dass ich meinen Platz bei dem bevorstehenden, höchst löblichen Unternehmen noch nicht zu erkennen vermag. Sicherlich wird es seiner Eminenz nicht schwer fallen, meine gegenwärtigen Zweifel zu zerstreuen." "Ihm wäre sehr daran gelegen, könntet Ihr Euch zumindest der Form nach bereit erklären ..." Der Graf nickte und ließ seinen Sekretär eine Urkunde aufsetzen. Darin verpflichtete er sich zu nicht mehr als zu dem, was er ohnehin zu tun plante, ja, was er wohl oder übel tun musste. Der Dompriester aber atmete dennoch auf, denn er stand nun nicht mehr mit leeren Händen da und brauchte den Hohn seiner Gegner nicht mehr zu fürchten. III W ährend Graf Christian im Palas mit dem Dompriester aus Bremen verhandelte, saß im unteren Geschoß des Turms ein auf den ersten Blick etwas wunderlich anmutender Mann vor einem Schreibpult. Um sich herum hatte er Bücher zu Stapeln geordnet. Die umgaben ihn nun wie ein Ringwall, schirmten ihn gewissermaßen ab gegen die Welt. Doch Otto von Oldenburg war dennoch kein Träumer. Er ging mit offenen Augen umher und sah dabei mehr als die meisten anderen. Dass er die Einsamkeit der Bibliothek suchte, war eine Folge vieler vergeblicher Versuche, etwas zu verändern. Er hatte einsehen müssen, dass es am Hofe 66 Kräfte gab, die stärker waren als er, und denen er mit Vernunft nicht beikam. Nunmehr beschränkte er sich darauf, das Beobachtete aufzuzeichnen, beherrscht von der Vorstellung, dass eines Tages jemand Lehren daraus zöge. Im Laufe von zwei Jahren hatte seine Chronik einen keineswegs eingeplanten Umfang angenommen. Er musste die Verflechtung der Oldenburger Ereignisse mit den Geschehnissen in der Welt beachten. Die Politik seines Bruders Christian, des Grafen, hing zusammen mit jener Gerhards, des Erzbischofs. Dieser wiederum bekam es mit dem Lüneburger wegen der Stadt Stade zu tun. Und über dem allen standen der Kaiser und der Papst sowie deren Konflikt miteinander. Und selbstverständlich durften die vielen anderen mächtigen Fürstengeschlechter nicht vergessen werden. Im durchaus löblichen Bemühen, so genau wie möglich zu sein, verzettelte sich Otto, bis er in den Einzelheiten fast erstickte. Seit einigen Wochen versuchte er, eine bessere Ordnung in seine Schrift zu bringen, indem er sich von den höchsten Instanzen nach unten durcharbeitete. Zurzeit galt seine besondere Aufmerksamkeit dem gescheiterten Kreuzzug des Kaisers vor drei Jahren. "... So sammelte Kaiser Friedrich II also bei Brindisi ein starkes Heer, um übers Meer nach Palästina aufzubrechen, zum Kreuzzug, wie er ihn feierlich geschworen hatte zu Aachen anlässlich seiner Krönung. Die meisten Ritter, mehrere hundert an der Zahl, stellte ihm Ludwig, der Landgraf von Thüringen. Doch allem Anschein nach ermangelte dem Unternehmen der Segen Gottes, des Allmächtigen, denn gerade, als die ersten Schiffe den Hafen verließen, begann eine Seuche im Lager zu wüten. Auch Friedrich und Ludwig wurden von ihr geschlagen. Während der Kaiser sich wieder erholte, starb der Landgraf bald darauf." Nachdem er dies niedergeschrieben hatte, legte Otto den Griffel beiseite, um sich bezüglich des weiteren Hergangs Gewissheit zu verschaffen. Er besann sich einiger aufschlussreicher Briefe, die er aber im Wall aus Folianten und Rollen erst nach längerem Suchen fand. Dann schrieb er weiter: "Als Papst Gregor IX erfuhr, dass der Kaiser sein Versprechen nicht eingelöst hatte, schleuderte er in der Kathedrale von Anagni den Bannstrahl wider ihn. Vermutlich wusste er nicht, welch schwerwiegende Gründe Friedrich gezwungen hatten, von seinem ehrlichen Vorhaben Abstand zu nehmen. Vielleicht war er gar wissentlich falsch unterrichtet worden. Unterdessen rückten die Vorausabteilungen des Kaisers in Palästina auf Sidon vor und eroberten es. In den Hafenstädten Jaffa und Caesarea entstanden starke Festungen." Abermals setzte er ab, denn ihm fiel auf, wie verschwommen sein Bericht an dieser Stelle war. Konnte es nicht sein, dass der Papst sehr wohl wusste, welche Umstände den Kaiser am Kreuzzug gehindert hatten, dass ihm aber der Anlass gerade recht kam, etwas zu tun, was ohnehin in seinen Plänen stand. Gregor IX kämpfte seit seiner Wahl erbittert um die weltlichen Ansprüche des Heiligen Stuhls. Er galt als redegewandt, freilich auch als unduldsam und jähzornig, kraftvoll in Wort und Tat. Leider widersprachen sich die Aussagen über seinen Charakter (je nachdem, welchem Lager der Verfasser angehörte) so dass sich kein sinnvolles Bild ableiten ließ. Fest stand immerhin, dass er den Bettelorden zugetan war. Den Dominikanern rechnet er wohl ihre Verdienste bei der Niederschlagung der Albigenser an. Seine Unerbittlichkeit gegenüber den 67 Feinden der Römischen Glaubenslehre belegten auch die Vollmachten mit denen er den eifernden Konrad von Marburg ausstatte. Einen Großinquisitor hatte es in den deutschen Landen zuvor überhaupt noch nicht gegeben. Otto spürte, wie er auf dünnes Eis geriet. Gäbe er dem Drang nach, Zweifel an der Rechtmäßigkeit des päpstlichen Bannfluchs niederzuschreiben, befände er sich bereits im Dunstkreis der Ketzer. Gewiss, eben weil die Päpste sich in die Politik einmischten und sich mit Königen und Fürsten anlegten oder verbündeten, verging kein Jahr, ohne dass neue Hetzschriften für Aufsehen sorgten. Anonym entstanden Schmähreden in geradezu vulgärem Tonfall. Dennoch blieb es gefährlich, sich zu offen und zu gründlich mit den Rechten der Kirche auf Erden auseinanderzusetzen. Er erschrak, weil er Schritte hinter sich hörte. Sofort aber hellte sich sein Gesicht wieder auf, denn er erkannte seine Frau. Als er ihr entgegen eilen wollte, stolperte er über seinen Bücherwall. Bei einem anderen Menschen hätte er sich darüber geärgert, wäre sich lächerlich vorgekommen, bei ihr nicht. Sie kannte ihn mit all seinen Schwächen und Eigenheiten, freilich auch mit all seinen Stärken. Vor ihr brauchte er sich nicht zu verstellen. "Habe ich wieder das Essen verpasst?" erkundigte er sich. "Aber nein!" beruhigte sie ihn lachend. "Ich wollte nur mal sehen, was du in deiner Höhle so treibst." "Oh, ich grüble über den Palästinakreuzzug unseres Kaisers und über den Bann, den der Papst über ihn verhängte." Er sprach mit seiner Frau ganz unbefangen über politische und religiöse Fragen. Die 32-jährige Mechthild von Woldenberge war klug und gebildet. Zwar ging sie den Dingen nicht so auf den Grund wie er, doch besaß sie dafür einen praktischen Verstand, der ihr sogar einen gewissen Einfluss auf den Grafen verschaffte. Sie hatte die nützliche Fähigkeit erworben, mit kleinen Erfolgen zufrieden zu sein. Otto, der aufgegeben hatte, bewunderte sie dafür. An der Tür tauchte für einen kurzen Moment ein Kinderkopf auf. Er gehörte einem kleinen Mädchen, das gern hereinkommen wollte, sich aber nicht traute. Otto winkte ihm zu, lockte es umsonst. Salome, benannt nach der Großmutter, war zwei Jahre alt und bereitete den Eltern wegen ihres fröhlichen Wesens viel Freude. Die Bibliothek allerdings flößte ihr Angst ein. Sie wurde schließlich ungeduldig und nötigte die Mutter, mit ihr wieder nach draußen in den Hof zu gehen. So war Otto also abermals allein. Mechthilds Bild jedoch stand ihm noch eine Zeitlang vor Augen. Anfangs, kurz nach der von seiner Mutter in die Wege geleiteten Hochzeit, hatte sie ihn ein wenig erschreckt. Doch inzwischen wurde ihm himmelangst, wenn er sich ein Leben ohne sie vorzustellen versuchte. Was sollte er anfangen, ohne ihre liebevollen Zurechtweisungen? Er würde ein zerstreuter Bücherwurm werden und aus Vergesslichkeit verhungern! Während sein Blick wieder über das Manuskript schweifte, dachte er an Yolande, die zweite Gemahlin des Kaisers, die vor zwei Jahren blutjung bei der Geburt des Prinzen Konrad starb. Durch sie besaß Friedrich Ansprüche auf die begehrte Krone des Königreichs Jerusalem. Ihr Vater, der Ritter Johann von Brienne, ein Parteigänger des Papstes, behauptete indes, er habe sie wie eine Dienstmagd behandelt und unwürdige Frauenzimmer ihr vorgezogen. Was sollte 68 man glauben? Über Friedrich waren die sonderbarsten Gerüchte im Umlauf. Er habe ein Frauenhaus nach orientalischer Art und kleide sich zuweilen wie die Muselmanen. Auch auf die Falkenjagd verstünde er sich. Ein Buch habe er darüber verfasst. Ein Fernhändler berichtete einmal von sonderbaren mechanischen Apparaten, welche ihm am Hof in Sizilien zu Gesicht gekommen seien. Das Staunen der Welt. Gern hätte Otto den Kaiser einmal persönlich kennen gelernt. Aber das wäre nur bei einem Feldzug in der fernen Lombardei denkbar gewesen und nach dem Schlachtfeld stand ihm nun einmal überhaupt nicht der Sinn. 69 IV V on Oldenburg aus ritt der Dompriester nach Bruchhausen. Die Burg war nicht groß, aber stark befestigt wegen der seit dreißig Jahren andauernden Fehde des regierenden Grafen Heinrich III mit seinem Bruder Burchard von Wildeshausen. Anders als in Oldenburg, wo die Herrscherfamilie einen großzügig angelegten Palas besaß, bildete hier nach altem Muster ein Turm mit dicken Wänden und schmalen Fenstern den Mittelpunkt des Hoflebens. Weil sich eine kurze Ringmauer mit weniger Leuten verteidigen ließ, hatte man den Hof klein gehalten. Um der Enge zu entfliehen, verbrachten die Bewohner, die Adligen ebenso wie die Dienstleute, in Friedenszeiten einen großen Teil des Tages auf dem Gelände vor dem Graben. Für den Ankömmling war dieser Brauch zunächst bequem. Der Graf saß gerade mit einem Dutzend seiner Waffenknechte mitten auf der Wiese um eine Tafel herum. Da die fröhliche Runde schon dazu übergegangen war, das Mal mit einem Humpen Wein zu krönen, spielten Höflichkeitsregeln keine große Rolle mehr. Der Dompriester trat einfach an Heinrich heran und sagte ihm, dass er im Namen des Erzbischofs mit ihm zu reden wünsche. Der urwüchsige Bruchhausener jedoch hatte dazu keine rechte Lust. An Trunkenheit lag das nicht, denn der Wein schien sich in seinem gewaltigen Körper zu verlieren, ohne Spuren zu hinterlassen. Er wirkte an der Stirnseite der Tafel majestätisch und furchtbar wie ein germanischer Stammesfürst. Aus einer Laune heraus packte er den Priester beim Arm und zog ihn neben sich auf die Bank. Dann überbrüllte er den Lärm seiner Leute mit den Worten: "He, ihr Halunken! Benehmt euch ab jetzt ein bisschen gesitteter! Wir haben einen Geistlichen unter uns." Und vertraulich an den Gast gewandt: "Aber einen Becher Wein wirst du doch nicht ausschlagen. Das ist kein echter Mönch, der einem guten Tropfen entsagt." Unglücklicher Weise hatte der Dompriester lange nichts mehr gegessen, so dass der Wein, den er aus Höflichkeit in sich hinein goss, eine verheerende Wirkung entfaltete. Schon bald nahm er die Gesellschaft nur noch verschwommen wahr. Dicht neben ihm stritten sich zwei junge Männer, die dem Grafen ähnelten. Etwas weiter weg kippte jemand nach hinten um und blieb dort, wo er zufällig hin rollte, liegen wie ein Toter. Noch später schienen die Männer um den Gast aus Bremen herum zu tanzen - ehe sie hinter einem grauen Schleier langsam verschwanden. Mitten in der Nacht erwachte er mit rasenden Kopfschmerzen und wusste nicht, wo er sich befand. Erschöpft fiel er kurz darauf wieder in tiefen Schlaf, aus dem ihn am Morgen das Lärmen der Mägde in der Küche nebenan weckte. Er lag in einem winzigen Raum im unteren Geschoß des Bergfrieds. Noch immer ging es ihm ziemlich übel, doch der Gedanke an seinen Auftrag trieb ihn auf die Beine. Er musste den Grafen zur Rede stellen, egal wie. So forderte er denn, energisch, wie er das von sich bisher nicht kannte, dass man ihn vorließe. Heinrich hatte das Gelage vom Vortag offenbar wenig zugesetzt. Prächtig gelaunt, bat er seinen Gast in das nicht üppig, aber durchaus behaglich eingerichtete Wohnzimmer in einem der Obergeschosse des Bergfrieds. Dort saß seine Frau Ermentrud mit einer Handarbeit im 70 Hintergrund, unauffällig wie ein Stück Einrichtung. Der Graf schien sie nicht zu bemerken, was freilich nicht stimmte, denn er schickte sie absichtlich nicht hinaus. Der Dompriester, den man vorgewarnt hatte, versäumte nicht, ihr einen höflichen Gruß zu entbieten. "Seine Eminenz, der Erzbischof von Bremen, vernahm von den Schwierigkeiten, die Euch die aufrührerischen Bauern aus Stedingen bereiten", begann er schließlich, "und er bietet Euch durch mich seine Hilfe an." Heinrich verzog keine Miene, wartete auf handfeste Aussagen. "Seine Eminenz planen einen Feldzug, um dem Übel ein für allemal beizukommen, einen Feldzug aller Betroffenen." Der Graf blieb noch immer regungslos, was den Gesandten verunsicherte. Der kam sich albern vor. Höchstwahrscheinlich wusste Heinrich (ebenso wie Christian) längst von Gerhards Angebot an Burchard von Wildeshausen und war entsprechend voreingenommen. Die Eifersüchteleien und Ränke zwischen den drei verwandten Grafenhäusern lasteten schwer auf dem Unternehmen. Genau genommen, hatten sich die Stedinger ihre Freiheit eben wegen dieser Uneinigkeit nun schon seit mehreren Jahrzehnten bewahrt. Nicht auszudenken, wenn sie noch selbst eingriffen in das politische Spiel und die Missgunst noch weiter schürten. "Seine Eminenz wird als geistlicher Führer Sorge tragen, dass keinem der Beteiligten ein Nachteil entsteht", warb der Priester. "Ein jeder wird reichlichen Lohn erhalten, nicht nur an vergänglichen Dingen sondern mehr noch ..." "Dem Erzbischof unterwerfe ich mich in Demut", unterbrach ihn der Graf. "Hinsichtlich der Einzelheiten jenes Unternehmens plagen mich indes einige Zweifel." Der Priester versuchte, zu retten, was sich noch retten ließ. "Es steht keinesfalls fest, dass Euer Bruder Burchard eine so hervorragende Stellung zugebilligt bekommt, wie Ihr anscheinend glaubt. Seiner Eminenz geht das Gelingen des Vorhabens über alles." Heinrich III saß vor ihm wie ein Fels, unverrückbar selbst in der stärksten Brandung. Nur der Form halber bat er ihn um eine Bereitschaftserklärung. Es war längst klar, dass er sie nicht erhalten würde. Er hatte auch nicht mehr die Kraft, um weiter zu kämpfen. Sein Kopf schmerzte, als würde jemand dicke Nägel hinein schlagen. Die rüden Rufe der Waffenknechte, die vom Hof her herauf schallten, bereiteten ihm zusätzliches Unbehagen. Er wollte fort von diesem Ort, so schnell wie möglich. Sein Aufbruch glich einer Flucht. Unterwegs merkte er freilich, dass er nur von einer Hölle in eine andere geraten war. Der Ritt schüttelte seinen Körper durch und steigerte die Beschwerden ins Unerträgliche. Schließlich musste er anhalten. Er übergab sich und schlief mehrere Stunden lang am Wegesrand. Erst danach hatte er den Rausch und die Enttäuschung einigermaßen überwunden. Seine Stimmung verbesserte sich wieder. Ihm blieb ja noch Zeit, sich eine Geschichte auszudenken, die ihn ins rechte Licht rücken würde. Etwa zur selben Zeiten tauschten der Graf und die Gräfin von Bruchhausen in ihrem Wohnturm ihre Eindrücke und Meinungen aus. "Vielleicht hast du ihn zu grob abgefertigt, Mann." Ermentrud de Schodis, die Schwester der Gattin Burchards von Wildeshausen, hatte kaum adlige Züge 71 in ihrem Wesen. Sie glich einer von harter Arbeit auf dem Feld herb und wortkarg gewordenen Bäuerin. Allerdings besaß sie eine praktische Schläue, derentwegen sie der etwas schwerfällige Heinrich schätzte. "Du meinst? ... Aber das war doch bloß so ein Pfaffe." "Der Dompriester von Bremen immerhin und vor allem ein Vertrauter des Erzbischofs." In des Grafen Stirn gruben sich zwei Falten ein. "Noch so ein sauberer Geselle! Gott, der Allmächtige, möge mir verzeihen, dass ich einem seiner Knechte übel nachrede! Er paktiert mit meinem Bruder." "Er ist auf seine Schmeicheleien hereingefallen. Wir sollten nach Mitteln suchen, ihm die Augen zu öffnen." "... und uns beteiligen an diesem Feldzug gegen die Stedinger?" "Haben sie uns nicht genug Schaden zugefügt? Außerdem winkt gute Beute. Wer zu spät kommt, muss zusehen, wie andere sich die Keller füllen." "Ich kann den Pfaffen doch nicht zurückholen und um Verzeihung bitten?!" "Er wird nicht der letzte Bote sein, den der Erzbischof zu uns schickt." Oft beriet sich der Graf auch mit seinen Söhnen. Sein gleichnamiger Ältester zählte 24 Jahre und übte schon manch wichtiges Amt aus. Der Bruder Ludolf stand ihm nur wenig nach. Als der Dompriester zum Tor hinaus ritt, erwarteten die beiden, gerufen zu werden. Dass die Eltern stattdessen geheimnistuerisch unter sich blieben, verärgerte sie. Vor allem der Jüngere ereiferte sich. "Sie reden gewiss über den Stedingerfeldzug. Von dem reden ja jetzt alle. Der Alte, dieser Zauderer, will sich wahrscheinlich drücken. Und weil er weiß, dass wir ..." "Sprich nicht von Dingen, die du noch nicht verstehst!" schnitt Heinrich ihm das Wort ab. Er legte es bei der Zurechtweisung darauf an, den anderen zur Weißglut zu bringen. In Wahrheit dachte er ähnlich. (Er fürchtete, der Vater könnte seine geistige und körperliche Kraft verlieren und sich dennoch nicht zum Zurücktreten entschließen.) Die Rivalität mit Ludolf indes überdeckte im Augenblick alles andere. Lange war Heinrich wegen seines Altersvorsprunges von drei Jahren der eindeutig Überlegene gewesen. Doch die meisten seiner Vorteile hatten sich inzwischen verloren. Bei den in Bruchhausen üblichen Kampfspielen zum Beispiel siegte auch Ludolf mitunter. Geblieben war dem Älteren indes seine kühle Ausgeglichenheit. Wenn sein Bruder, wie so oft, in Jähzorn geriet, beging er Fehler. Manchmal verunsicherte Heinrich ihn auch hinterlistig durch Überraschungen - so wie diesmal, indem er dem Vater die Stange hielt. "Er soll Angst haben vor den Stedingern? Das ist doch lächerlich. Er muss freilich vieles bedenken. Ich weiß da so einiges ..." Ludolf ballte die Fäuste. Im letzten Moment aber fiel ihm ein, wie oft es ihm in solchem Zustand übel ergangen war. Nein, diesmal wollte er ihm diesen Gefallen nicht tun. Weil er aber andererseits gar zu sehr litt, rannte er mit einem wüsten Fluch über die Zugbrücke nach draußen in die Wiesen. V 72 U m nach Bremen zurück zu gelangen, musste der Dompriester wieder die Nacht abwarten. Insgeheim hatte er gehofft, die Stedinger würden ihre Belagerung inzwischen beendet haben. Was versprachen sie sich eigentlich von diesem Vorstoß? Sie planten doch nicht ernsthaft, die große Stadt zu erobern! Allmählich wurden ihm diese Bauern unheimlich. Die Feindseligkeiten unter den Adligen stärkten ihnen den Rücken. Nach seinen Eindrücken in Oldenburg und Bruchhausen fürchtete er sogar, diese Grafen könnten sich in ihrer Selbstsucht mit ihnen verbünden, um einen Rivalen zu schädigen. Das erinnerte ihn an den falschen Waldemar, den Erzbischof von des Dänenkönigs Gnaden, den der Papst für abgesetzt erklärte und der sich dennoch jahrelang an der Macht hielt. Auch der hatte mit den Bauern paktiert. Eine Schande! Trotz der Absichtserklärung Christians von Oldenburg wusste der Dompriester nicht, ob er mit dem Ergebnis seiner Mission zufrieden sein durfte. Ein Wächter ließ ihn (auf eine Parole hin) durch eine ins Tor eingelassene Pforte schlüpfen. Erschöpft zog er sich dann zum Schlafen ins Pfarrhaus am Dom zurück. Lange blieb er dort allerdings nicht ungestört, denn schon bei den ersten Sonnenstrahlen weckte ihn das Lärmen einer Menschenmenge draußen auf dem Platz. Verwundert trat er ans Fenster, denn es war ein gewöhnlicher Arbeitstag. Nachdem er sich angekleidet und vor die Tür getreten war, erfuhr er, welches Ereignis die Leute so sehr in Aufregung versetzte. Konrad von Marburg, der Großinquisitor des Papstes für die deutschen Lande, wollte eine Predigt halten. Welchem Gegenstand er sich dabei zuzuwenden gedachte, wusste freilich noch niemand. Gewiss war ihm nicht entgangen, dass es in der Stadt noch immer gärte, dass ein bewaffneter Aufstand noch immer drohte. Zwei Rädelsführer aus der Bürgerschaft standen zufällig in der Nähe des Dompriesters. Der eine, Gottfried, wollte Bürgermeister werden, der andere, Andreas, versprach sich Vorteile, falls sein Freund und Gönner siegte. "Gerhard wird uns angeschwärzt haben." "Darauf kannst du dich verlassen! Jetzt stehen wir wie Kirchenfeinde da. Dabei fordern wir nicht mehr als die Erfüllung besiegelter Verträge." Sie mussten ihr Gespräch unterbrechen, weil vorn ein Chor von Mönchen zu singen begann. Dem Erzbischof war offenkundig nichts zu aufwändig, um seinen Gast zu ehren. Auch das Volk liebte normalerweise solche Prachtentfaltung. Zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten kamen die Leute von weither, um eine Messe im Dom zu erleben. An diesem Tag jedoch war die Stimmung viel zu angespannt, als dass der erbauliche Gesang die Herzen hätte erreichen können. Konrad von Marburg, der Großinquisitor, genoss diese nervöse Unruhe, die seinen Auftritten vorausging. Er wertete sie als Angst. Die wiederum war in seinen Augen Voraussetzung für einen erfolgreichen Kampf gegen das Böse. "Der Teufel kommt in vielerlei Gestalt", begann er mit Donnerstimme. "Den Habsüchtigen verspricht er Reichtum. Den Lüsternen und Genießern verhilft er zur Befriedigung ihrer niederen Begierden. Den Machtgierigen schenkt er Einfluss, den Lügnern Glaubwürdigkeit. Doch all dies ist ein kurzer Gewinn. Reichtum zerrinnt wie Sand zwischen den Fingern, Macht zerbricht und Lüge wird durchschaut." "Was meint er?" raunte Andreas. "Wen meint er?" "Pst! Er wird schon noch deutlicher werden", entgegnete Gottfried. Doch Konrads Rede blieb unklar. Solange er niemanden beim Namen nannte, musste jeder zittern. Andreas erinnerte sich an die Flucht der Zwölf. Wo mochte sie geblieben sein? Vielleicht war in ihrem Versteck noch Platz für ein paar weitere Vertriebene. Vielleicht würde gemeinsames Unglück die alten Streitigkeiten in Vergessenheit geraten lassen. Auch Gottfried wälzte düstere Gedanken. Zwar konnte er sich notfalls zu Verwandten nach Hamburg absetzen, doch blutete sein Herz bei der Vorstellung, sein Besitz werde konfisziert. Dann plötzlich wendete sich alles. Drei Sätze genügten, um allem zuvor Gesprochenen einen anderen Sinn zu geben. Das Aufatmen der Bürger war unüberhörbar. "Eure Habsucht, eure Lüsternheit und eure Machtgier haben euch den Blick verschleiert. Draußen vor den Mauern steht des Satans Streitmacht bereit. Ihr seid nicht anders als die Israeliten, welche nicht dem Allmächtigen vertrauten, als die Babylonier wider sie zogen. In euerer Verstocktheit werdet ihr es dahin bringen, dass euch dasselbe Schicksal wie jene ereilt." Noch immer prügelte der Inquisitor mit Worten auf die Bürger ein. Noch immer bedachte er die Gegner des Erzbischofs mit Bemerkungen, die Axthieben glichen. Aber es gab nicht mehr die scharfe Trennung zwischen dem Ketzerjäger auf der einen Seite und den Zuhörern auf der anderen. Indem er vor den Stedingern warnte, sprach Konrad etlichen Leuten aus dem Herzen. "Es ist in der Tat eine Schande, dass wir uns nicht einmal in der Gefahr einig sind!" hörte man manchen murmeln. Die Gefahr erschien plötzlich unermesslich. "Das sind Gottlose. Als sich noch Priester zu ihnen wagten, spieen sie die geweihten Hostien zu Hause auf den Misthaufen. Heute betreten sie die Kirchen gar nicht mehr. Dafür halten sie an verrufenen Orten Teufelsmessen ab." Selbstverständlich sagte der Inquisitor genau, wie es dort zuging. Besonders die unappetitlichen Einzelheiten hatten es ihm angetan. Die Bürger hörten ihm mit offenen Mündern zu, entsetzt angesichts des Dämonenheeres, das da ihre Mauern berannte. Gottfried und Andreas waren zu gebildet, um sich so leicht einwickeln zu lassen, und bemerkten, dass der Marburger über etwas redete, was er gar nicht wissen konnte, da er erst wenige Tage in der Gegend weilte. Aber auch an ihnen ging die Rede nicht spurlos vorüber. "Ich hatte schon einmal darüber nachgedacht, sie als Druckmittel gegen Gerhard zu benutzen. Aber wahrscheinlich würden wir uns damit ein Übel ins Haus holen." "Ja, das fürchte ich auch." Konrad steigerte sich nun in den Höhepunkt seiner Predigt hinein. Vor Tagen war er drei Waffenknechten wie der leibhaftige Gott erschienen, nun empfanden mehrere hundert Menschen so. Hysterie griff um sich. Einige Frauen fielen in Ohnmacht. Der Großinquisitor indes konnte Bremen versöhnt verlassen - er hatte seinen großen Auftritt doch noch bekommen. 74 7.Kapitel I D ie Stimmung war gereizt. Norbert stapfte voraus auf dem schmalen, morastigen Pfad. Franziska folgte ihm und fragte mehrmals ungeduldig, ob er mit seiner Vorsicht nicht übertreibe. Christian, der die Nachhut bildete, schimpfte, dass er sich viel besser auskennte, was übrigens nicht stimmte. Nur Ramira wirkte wie fast immer ruhig und ein wenig abwesend. Bei einer Rast brachte Norbert schließlich direkt zur Sprache, was (fast) allen die Laune verdarb. "Habt ihr Ruperts Grinsen bei unserem Aufbruch gesehen?! Er und dieser Ernst Eisenarm sind jetzt die Herren in der Waldhütte." Und an Franziska gewandt: "Wahrscheinlich bist du schon nicht mehr der Hauptmann." "Du übertreibst." "Ich übertreibe? Ha! Seine Räuber überzeugt Rupert im Handumdrehen. Den Bürgerlichen macht er weiß, wir hätten sie im Stich gelassen." "Hör auf!" schnitt Franziska ihm das Wort ab. "Die Gefahren kenne ich auch ohne deine Vorträge. Doch Rupert ist nicht der liebe Gott. So dumm sind deine Freunde aus Bremen nun auch wieder nicht, dass sie sich ihm einfach unterwerfen. Im Übrigen kommt es nicht darauf an, was dort in der Waldhütte geschieht, weil sich die wichtigen Ereignisse woanders abspielen - zum Beispiel dort, wohin wir gehen. Uns steht ein Krieg bevor, ein großer Krieg, nicht zu vergleichen mit den Fehden zwischen dem Grafen Burchard und seinen Nachbarn. Wer sich nicht beizeiten auf eine der beiden Seiten schlägt, wird zwischen den Fronten zerrieben." Das wollte nun aber auch Christian nicht hinnehmen. "Du redest, als ob du der liebe Gott wärest. Wie kommst du darauf, dass es zum Krieg kommt? Zwischen den Stedingern und den Grafen gibt es seit zwanzig Jahren Streitereien." "Diesmal hält Erzbischof Gerhard die Fäden in der Hand. Das ist ein Kirchenfürst, dessen Arm bis nach Rom reicht." "Gut, er könnte einen Krieg beginnen. Woher aber weißt du, dass er es auch wirklich will?" "An manchen Tagen, wenn ich nicht in der Waldhütte war, habe ich (in Verkleidung) auf der Straße zwischen Wildeshausen und Oldenburg mit Leuten geredet. Ich gab mich als fremd aus und lenkte sie auf politische Themen." "Warum wussten wir nichts davon? Das war gefährlich." "Wir dürfen nicht blind und taub dort im Wald leben. Irgendwann kommt uns jemand auf die Spur. Bis dahin müssen wir einen Weg heraus aus dieser Mausefalle kennen." Die vier rechneten damit, frühestens am Wall mit Stedingern zusammenzutreffen. Doch schon zwei Meilen zuvor sahen sie sich plötzlich von Männern mit blanken Schwertern in den Fäusten umringt. Da einige von ihnen unter ihren Kettenhemden und ledernen Wämsern einen Kittel aus grobem Leinen trugen, handelte es sich zweifellos nicht um die Waffenknechte eines Grafen. Auch ihrem Gebaren war anzusehen, dass sie lieber und öfter den Boden beackerten als die Waffen zu führen. Franziska gab ihren Begleitern ein Zeichen, keinen Widerstand zu leisten, und wandte sich an einen stämmigen Mann mit braun gebranntem Gesicht, dichtem Bart und einer Narbe auf der rechten Hand, den sie für den Anführer des Trupps hielt. "Wir tragen Schwerter bei uns, kommen aber in friedlicher Absicht. Unser Ziel ist das Stedingerland. Wir wollen ein Angebot unterbreiten." Der Angesprochene, bedächtig wie fast alle Bauern von der Küste, ließ sich Zeit mit der Antwort und beriet sich zuvor leise mit seinen Leuten. Einer von diesen zeigte plötzlich auf Christian und Ramira. Er hatte die beiden erkannt. "Ihr seid uns willkommen", entschied der Mann mit der Narbe. "Ihr müsst euch aber ein paar Tage gedulden." Zusammen mit dem Trupp, liefen die vier nun mehrere Stunden lang über düstere Waldwege und geheimnisvolle Sumpfpfade. Ab und zu tauchten Felder auf, in deren Mitte ein Dorf lag. Auch Christian und Ramira verloren die Orientierung. Ein wenig unheimlich war die Wanderung auch dadurch, dass die bewaffneten Bauern nicht verrieten, wo genau man die Gäste unterzubringen gedachte. Es hieß nur, sie würden im Hause des Truppführers wohnen, der den Namen Jörg trug. Schließlich kamen sie nach Neudeich, einem noch jungen Dorf. Keines seiner Häuser stand länger als fünfzig Jahre. Es lag unweit der Weser in einer Senke, die sich noch vor weniger als einem Menschenleben im Bereich der Flut befunden hatte. Inzwischen schützte ein mächtiger, mit Feldsteinen verstärkter Erdwall die Gegend. Der fruchtbare Boden zog die Bauernfamilien an, trotz der Gefahr eines verheerenden Dammbruchs. Im Norden und Osten reichten die mit weißen Steinen gekennzeichneten Felder bis zum Bogen des Deiches. Im Westen zeigten Weiden das frühere Ufer an. Das Dorf selbst war noch einmal von einem niedrigen Wall umgeben. Ergänzt durch einen Graben, eine Schlehdornhecke (dem Etter) sowie einem nur von innen zu öffnendem Falltor aus starken Holzlatten und Flechtwerk, gab er dem Flecken den Eindruck einer winzigen Stadt. Bauer Jörg war stolz auf sein Dorf. Als Kind hatte er die Gründung noch miterlebt. Je näher er kam, desto gesprächiger wurde er. Sein Hof lag in der Nähe des Angers und wirkte schon auf den ersten Blick sehr gepflegt. Franziska, die sich auskannte, sah schon am Dunghaufen, dass es der Familie gut ging. Wenigstens zehn Schweine mussten in den Ställen stehen, dazu einige Rinder. Am Haus gab es kein einziges zerbrochenes Brett. Das seitlich bis fast zum Boden reichende Strohdach wies keine Unebenheiten auf. Der Westerholthof war nur um ein weniges größer und schmucker, und der hatte immerhin Franziskas adligen Vorfahren bis zum Bau der Wardenburg als Stammsitz gedient. Vor der Missendör, dem Einfahrtstor, das groß und wuchtig die Giebelfront des Hauses beherrschte, flatterten ein paar Hühner vor einer jungen Frau davon, die sich mühte, sie in den Stall zu treiben. "Das ist meine Tochter Gudrun", stellte Jörg sie vor. "Das sind Freunde, die für ein paar Tage bei uns wohnen werden." Die junge Frau überließ die Hühner sofort sich selbst und kam den Fremden mit strahlendem Gesicht entgegen. Vermutlich waren die Tiere für sie nur ein Vorwand gewesen, in den Vorgarten zu kommen und die Ankömmlinge zu sehen. Besonders Norbert hatte es ihr angetan. Sie war durchaus hübsch kräftig von der Arbeit, aber zugleich gut gebaut. Ihre hübschen Brüste betonte sie, indem sie ein zu enges Kleid trug. 76 "Ihr müsst mit uns einen Schluck Met aus dem großen Krug trinken, bevor ihr zum ersten Mal die Missendör durchschreitet", sagte sie. "Das ist so Brauch bei uns." "Sie bleiben doch nur ein paar Tage", wehrte der Bauer ab, doch da war sie schon verschwunden. Mehr zu sich selbst fügte Jörg hinzu: "Es wird Zeit, dass sie heiratet. Sie bereitet mir sonst noch Schande." Gudrun kam zurück mit einem verzierten Steingutkrug. Der wanderte nun wie ein Abendmalskelch von einem zum anderen. "So, nun gehört ihr zu uns und dürft hereinkommen." In der Diele bestätigten sich Franziskas erste Eindrücke. Sie bildete einen lang gestreckten, durch dicke Stempel der Länge nach in drei Teile gegliederten Raum. Der Fußboden des mittleren Teils war zu ungefähr zwei Dritteln mit gestampftem Lehm bedeckt. Vorn, wo der Lehm fehlte, lagerten Heuund Strohhalme, Futterreste und anders mehr, was als Abfall anfiel und jetzt im Sommer zum Düngen der Felder diente. Rechts befanden sich die Schweineställe, dahinter der Verschlag für drei Pferde. Ja, Bauer Jörg besaß tatsächlich Pferde, und zwar gleich drei an der Zahl! Norbert und Christian, den beiden Städtern, fiel das kaum auf. Auch Ramira, die Gauklerin, vermochte die Bedeutung nicht zu ermessen. Franziska indes, die Ritterstochter, trat voller Erstaunen ein paar Schritte näher. Jörg bemerkte das alles genau und versuchte, sich einen Reim darauf zu machen. Am Ende der Diele trennte das niedrige Flattgatter den Wohnbereich ab. Dass Tiere und Menschen unter einem Dach eng beieinander lebten, war kein Zeichen von Armut. So konnte der Bauer jederzeit nach seinem wertvollsten und zugleich empfindlichsten Besitz sehen. Im Winter sparte man Feuerung. Am Herd bereitete die Bäuerin gerade das Essen zu. Zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, halfen ihr dabei. Bei dieser Arbeit ließ sie sich auch durch die Ankunft der Gäste nicht stören. Sie reichte nur jedem kurz die Hand, nachdem Jörg sie vorgestellt hatte. "Meine Frau Luise." Ihre Zurückhaltung hatte nichts zu bedeuten. Ein Fremder musste in diesen Dörfern immer damit rechnen, dass ihm zunächst Misstrauen entgegen schlug. Mancher brauchte mehrere Jahre, um diese Barrieren zu überwinden. Auch Liemar, dem Knecht, war es so ergangen. Die Gäste erfuhren seine Geschichte am späten Abend, als das Bier die Zungen lockerte. Er kam als Sohn zweier Leibeigener zur Welt. Unglücklicher Weise starben seine Eltern schon bald an einer Krankheit. Der Junge war nun ohne Schutz und wurde auf einem Fronhof des Wildeshausener Grafen herumgestoßen. Die harte Arbeit, die man ihm aufbürdete, hatte jedoch auch ihr Gutes. Sie stählte Liemars Muskeln. Während er zum Manne heranwuchs, spürte er immer deutlicher seine Kraft. Er lehnte sich auf, wurde dafür manches Mal unbarmherzig geschlagen, gab aber nicht auf. Eines Tages lief er davon. Die Flucht brachte ihm zunächst wenig Glück. Er musste sich vor den Waffenknechten des Grafen in Acht nehmen, irrte umher und kam vor Hunger fast um. Völlig erschöpft hatte er die Hoffnung, ein Zuhause zu finden, schon fast aufgegeben, als ihn der Zufall nach Neudeich führte. Dort endlich wendete sich sein Leben zum Guten, denn der Bauer Jörg brauchte gerade einen neuen Knecht. Dessen ehemaliger baute sich nach einer günstigen Heirat ein eigenes Haus. 77 "Ein Jahr und drei Monate war ich nur zur Probe hier, ehe ich meinen Mietpfennig bekam." "Was ist das, der Mietpfennig?" erkundigte sich Christian. "Ein uralter Brauch! Die ganze Familie versammelt sich am Herd. Wie beim ersten Schritt durch die Missendör wird ein großer Krug mit Met gefüllt. Dann legt der Bauer einen Pfennig in den Kesselhaken, den der Neuling wieder herausnimmt. Das gilt dann als Eid. Wie einen Vertrag müsst ihr euch das vorstellen. Mit einem Händedruck über eine Herdecke und einem kräftigen Schluck aus dem Krug wird er besiegelt." Worüber er nicht sprach, was sich aber nicht übersehen ließ, das war seine Liebe zu Gudrun, des Bauern Tochter. Normaler Weise sahen Bauern es gar nicht gern, wenn einer ihrer Knechte sich solcherlei Hoffnungen hingab. Jörg aber zitterte angesichts der Leichtfertigkeit seines hübschen Kindes. Zudem wollte er keine Arbeitskraft verlieren. Liemar würde auch nach einer Heirat auf dem Hof bleiben müssen. Nach altem Recht galt er noch immer als Gast. Nachbar werden konnte er erst nach einigen Jahren. Ihm blieben also in Neudeich vorläufig noch eine Reihe von Rechten vorenthalten. Dazu gehörte der Bau eines eigenen Hauses. II bernachten durften die Gäste auf dem Boden zwischen Herd und Flattgatter. Das war zwar nicht bequem aber ausreichend. Tagsüber halfen sie bei der Arbeit. Niemand forderte das von ihnen, aber dass sie es freiwillig taten, half ihnen, das heimliche Misstrauen ein wenig zu zerstreuen. Zudem verging dadurch die Zeit schneller. Natürlich fragten sie sich, warum die Anführer nicht zu sprechen waren. Ramira argwöhnte sogar, man treibe ein Spiel mit ihnen. Ein besonderes Ereignis im Dorf jedoch lenkte sie am dritten Tag ab. Gudrun kam auf den Hof gerannt und rief: "Seht, der Burknüppel ist da!" Dabei schwenkte sie einen etwa einen halben Meter langen, glatt geschliffenen Stock, an dessen Ende mehrere kurze, bunte Bänder festgeknotet waren. "Weißt du, was es damit auf sich hat?" flüsterte Norbert, an Franziska gewandt. "Das ist die Einladung zur Gemeindeversammlung." Bauer Jörg trat vor die Missendör und sagte: "Reiche ihn gleich weiter! Du weißt ja, es bringt Unglück, wenn man ihn zu lange im Haus hat." "Doch nur, wenn man ihn über Nacht behält." "Tu, wie ich dir sage! Es ist besser, sich vor den bösen Geistern zu viel als zu wenig zu schützen." Am nächsten Morgen kündigte der durchdringende Klang des Burhorns den baldigen Beginn der Versammlung an. Jeder erwachsene Mann, der als vollwertiges Gemeindemitglied galt, musste nun zur Linde kommen, es sei denn, er war durch den Dorfschulzen ausdrücklich befreit, zum Beispiel einer schweren Krankheit wegen. Allerdings ging fast jeder gern. Der Gemeindeversammlung, die in der Regel nur einmal im Jahr stattfand, haftete etwas Feierliches an. Man trug die besten Ü 78 Kleider und wetteiferte miteinander, zuerst an der Linde zu sein. Franziska und ihre drei Begleiter mussten in respektvoller Entfernung bleiben. Immerhin konnten sie von einem Baum aus das Geschehen gut beobachten. Von den Reden wehte der Wind zumindest einige Satzfetzen zu ihnen herüber. Daraus konnten sie schlussfolgern, worum es ging. Allem Anschein nach war die Versammlung außer der Reihe einberufen worden. Der Dorfschulze, ein alter Mann mit schneeweißem Haar, den beim Laufen sein Enkel stütze, der aber ansonsten noch frisch wirkte wie ein junger Bursche, stellte drei Männer vor, die nicht in Neudeich wohnten und die hier wohl auch kaum jemand kannte. "Sie haben uns im Namen des Rates der Universitas Stedingorum etwas mitzuteilen." Einer der drei stieg auf einen Tisch und hielt eine lange, verwirrende Ansprache. Erst, als die Bauern unruhig wurden, kam er zu seinem eigentlichen Anliegen. "... wir dürfen also niemals vergessen, dass wir von Feinden eingeschlossen sind, von Feinden, die Tag und Nacht auf eine Schwäche von uns lauern. Wir müssen ständig und überall auf ihren Angriff vorbereitet sein, selbst an den hohen Feiertagen. Deshalb möge sich ab sofort ein jeder zum Kampf bereit halten." Während er erläuterte, was das im Einzelnen bedeutete, hörten die Leute unter der Linde wieder aufmerksam zu. Eine ziemlich große Anzahl eiserner Waffen sollte im Dorf hergestellt werden. Alle Männer, die älter als 16 und jünger als 50 Jahre waren, mussten sich zu zwölft in Gruppen zusammenfinden und dazu je einen Fähnleinführer benennen. Diese unterstanden dann einem der (vor ein paar Monaten in einem anderen Zusammenhang gewählten) Hauptleute. Das alles klang in den Ohren der an viel Freiheit gewöhnten Bauern recht ungewohnt. Besonders die vier Heimbürgen, die auf der anderen Seite des Schulzen saßen, verkniffen den Mund. Sie waren stolz auf ihr Wahlamt und besaßen, da ihnen die Betreuung des Gemeinguts oblag, beträchtlichen Einfluss innerhalb des Etters. Nun mischten sich plötzlich Leute von außen ein, zwar keine Adligen, wohl aber Fremde, die offenbar eine Sonderstellung beanspruchten innerhalb der auf Gleichberechtigung eingeschworenen Gemeinschaft der Marschlandbewohner. Doch es kam sogar noch ärger. "Unsere Feinde lassen nichts unversucht, um einen Judas unter uns zu finden", sagte der Abgesandte der Universitas. "Weil die Befestigungswerke an unseren Grenzen inzwischen so sicher sind, dass selbst ein Ritterheer sie nicht überwinden würde, suchen sie nun jemanden, der ihnen heimlich die Tore von innen her öffnet." Mit eindringlichen Worten malte er das Blutbad, das in einem solchen Fall die Folge wäre. "Nur mit eurer Hilfe gelingt es uns, die Verräter rechtzeitig zu entdecken", schloss er. "Wir wissen, dass es schwer fällt, den Nachbarn oder den Verwandten zu entlarven, dass es unter Umständen sogar gegen alten Brauch verstößt. Wir verlangen deshalb auch nicht, dass ihr hier vor allen redet. Kommt zu uns ohne Aufsehen! Niemand wird davon erfahren." Da schnitt ihm ein Sturm der Entrüstung das Wort ab. "Du redest wie einer dieser Ketzerjäger! Immer haben wir es so gehalten, dass jede Anschuldigung hier unter der Linde vor jedermanns Ohren vorgetragen wird. Schande über den, 79 der in aller Heimlichkeit seinen Nachbarn anschwärzt!" Besonders die Männer, die zum streute er Beispiele über gemeine Schurkenstreiche ein. Niemand mochte so recht glauben, dass sie sich tatsächlich zugetragen hatten, doch verfehlten sie ihre Wirkung nicht gänzlich. Am Ende sorgte ein Kompromiss für ein versöhnliches Ende. Wer einen Verdacht hat, solle sich vertrauensvoll an den Bürgermeister wenden. Der könne dann entscheiden, ob die Meldung weitergegeben wird oder nicht. Auch die vier Gäste aus der Waldhütte waren sich nicht einig. Sogar Franziska und Ramira gerieten in Streit miteinander, was bei den beiden äußerst selten vorkam. "Es gibt Zeiten, in denen jemand die Zügel fest in der Hand halten muss und in denen nicht alle Freiheiten zugelassen werden dürfen", meinte die Ritterstochter. "Und wer bestimmt, wann solche Zeiten sind?" hielt die Gauklerin dagegen. "Und vor allem: Wer ist derjenige, der die Zügel hält? Nein, nein! Das gefällt mir gar nicht, was dieser Kerl da verlangt. Die Bauern hatten vorhin ganz recht, als sie ihn mit einem Ketzerjäger verglichen." "Nun ist es aber genug! Die Universitas Stedingorum ..." "Der Name ist mir gleich! Wenn sie anfangen, alle Leute, die nicht ihrer Meinung sind, in Ketten zu legen oder gar hinzurichten, dann ..." "Davon war nicht die Rede!" "Aber so wird es kommen!" Norbert und Christian griffen beschwichtigend ein. "Das sind doch Vorurteile. Wir wissen von den Stedingern noch so gut Vierer gehörten, ereiferten sich. Sie sammelten von Amt wegen Abgaben ein, jene an die Dorfgemeinschaft und jene an die Universitas. Zudem schlichteten sie die Händel innerhalb des Etters. Es bedurfte nicht viel Weitsicht, um die Auswirkungen heimlicher Anzeigen auf den Dorffrieden zu ahnen. Der Vierer hatte ohnehin schon so viel Ärger, dass eine Wahl immer nur über den Amtzwang zustande kam. "Niemals werden wir in Neudeich dulden, was du da verlangst!" schrieen die Männer wie aus einem Munde. Der Sprecher der Universitas ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Er wartete, bis sich die Aufregung gelegt hatte, und milderte dann in beinahe salbungsvollem Tonfall das Gesagte ab. Nur an schweren Verrat habe er gedacht. Selbstverständlich werde niemand etwas ohne die Zustimmung des Bürgermeisters, der Heimbürgen und des Vierer unternehmen. Dabei 80 wie nichts. In ein paar Tagen sehen wir das alles vielleicht schon mit ganz anderen Augen." 81 III N ach der Versammlung unter der Linde bestellten die Abgesandten der Universitas die Gäste aus der Waldhütte zu sich. Nach den harten Forderungen an die Dorfbewohner erwarteten sie nichts Gutes, erlebten aber eine angenehme Überraschung. Die fremden Männer waren über die Mission Christians und Ramiras gut unterrichtet und verhielten sich freundlich. Selbst die misstrauische Gauklerin fand nichts Verdächtiges. So waren alle in guter Stimmung, als sie am nächsten Morgen im Gefolge der Abgesandten aufbrachen. Unterwegs entspann sich eine lebhafte Unterhaltung, bei der es auch manchen Grund zur Heiterkeit gab. Vor allem Norbert knüpfte den Faden immer wieder neu. Christian dagegen hielt sich im Hintergrund. Das war so abgesprochen mit Franziska, die trotz ihrer Zuversicht nicht unvorsichtig sein wollte. Er eignete sich als Beobachter gut, weil er vergleichen konnte. So fiel ihm zum Beispiel auf, dass das große Haus der Anführer viel mehr als seinerzeit geschützt wurde. Ein mit Wasser gefüllter Graben bildete das erste Hindernis. Ihn in wenigen Wochen auszuheben, hatte wohl hundert Männer beschäftigt. Dahinter ragte ein Palisadenzaun aus angespitzten Stämmen auf. Auch der war nicht im Handumdrehen aufzustellen. Ein Adliger konnte bei derlei Arbeiten auf seine Leibeigenen zurückgreifen. Die Stedinger jedoch duldeten keine solchen Abhängigkeiten. Hatten sich die Bauern aus den Dörfern in großer Zahl freiwillig für den Bau bereit erklärt oder gab es ein stehendes Heer? Christian vermutete Letzteres, obgleich er nirgends Spuren eines Lagers fand. Allerdings glich die Umgebung des Hauptquartiers durchaus einer Festung. Jeder Ankömmling wurde am Zugbrückentor untersucht und entwaffnet. Nur die Leibwächter der Anführer durften auf dem Hof mit Schwertern umherlaufen. Von diesen gab es freilich so viele, dass man kaum glauben mochte, im Frieden zu leben. Christian fragte sich unwillkürlich, wer dieses Sicherheitsbedürfnis verursachte. Nur der Erzbischof? Die Gäste fanden wenig Zeit, sich auf dem Hof umzusehen. Sie wurden ins Haus geführt und dort durch Tammo von Huntorf begrüßt. Der ehemalige Schmied mit der hünenhaften Statur und dem gewaltigen Kahlkopf wirkte auf Christian fast unverändert. Um seinen Mund gab es aber neuerdings einen harten Zug, vielleicht ausgelöst durch einen Schicksalsschlag, vielleicht auch bedingt durch ein andauerndes Ärgernis. Er begrüßte die Abordnung aus der Waldhütte und wandte sich an die beiden jungen Männer mit den Worten: "Folgt mir bitte in mein Zimmer. Wir werden dort ungestört sein. Eure Begleiterinnen können im Saal warten. Falls sie einen Wunsch haben, ..." "Das ist unmöglich!" unterbrach ihn Norbert. Allerdings fiel ihm dann nichts Wirkungsvolles mehr ein. Franziska hingegen, die mit einem solchen Ansinnen gerechnet hatte, sagte an seiner Stelle völlig gefasst: "Ich bin der gewählte Anführer der Leute aus dem Wald." Tammo sah sie verblüfft an. Einen Moment lang glaubte er, sie habe sich einen Scherz erlaubt. Als sie dann aber seinem Blick nicht auswich, entstand eine lange, unangenehme Pause. Jeder fühlte die Gefahr, dass die Verhandlungen an dieser scheinbar nebensächlichen Frage scheiterten, ehe sie überhaupt begonnen hatten. 82 "Nach unseren Bräuchen ...", begann der Bauernführer vorsichtig. Franziska ließ ihn nicht ausreden. "Ich muss noch etwas sagen: Ich bin die Tochter eines Vasallen des Grafen von Wildeshausen." Norbert zuckte unmerklich zusammen. War es denn wirklich nötig, das in diesem Moment zu erwähnen? Ein Wink dieses Mannes konnte sie alle in ein Verließ bringen, vor allem in einer Zeit, da sich die Anführer offenbar in besonderem Maße vor Verrätern fürchteten. Tammo war unschlüssig und versuchte, durch belanglose Sätze Zeit zu gewinnen. "Du bist also zum Hauptmann gewählt worden, weil du eines Vasallen Tochter bist ..." Etwas ungeschickt, blickte er sich suchend um. Christian vermutete, dass er auf die beiden anderen Stedingerführer rechnete. Da diese aber nicht kamen, musste er sich zu einem Entschluss durchringen. Er gab sich einen Ruck und sagte: "Ich wusste nicht, dass die junge Dame euer Hauptmann ist. So begleitet mich denn also alle vier in mein Zimmer!" Tatsächlich respektierte Tammo von nun an Franziskas Stellung. Er wandte sich immer zuerst an sie. Was er dabei dachte, blieb ungewiss. "Weshalb wollt ihr euch uns anzuschließen?" erkundigte er sich. "Wir rechnen mit einem großen Krieg." Tammo blickte sie scharf an. "Warum stellst du dich angesichts dieses Krieges nicht auf die Seite deines Vaters und dessen Lehnsherrn?" "Zum einen, weil der Graf von Wildeshausen mir nach dem Leben trachtet, zum anderen, weil wir hoffen, uns auf die Seite der Sieger zu stellen." Das Misstrauen des Stedingerführers blieb. "Wenn ihr euch uns anschließt, müsst ihr unsere Gesetze und Bräuche achten." "Das ist recht und billig. Zähl uns die wichtigsten davon auf! Dann werde ich dir sagen, ob wir sie achten können." Mit süffisantem Lächeln fügte sie hinzu: "Wenn ihr bei euch nur Männer als Hauptleute duldet, wäre das allerdings für uns schwierig." Für einen Moment gruben sich zwei Falten in seine Stirn. Er spürte den Widerstand dieser jungen Frau, die eigentlich noch ein Mädchen war. Sie taktierte, um ihren Wert zu erfahren, und der ehemalige Schmied fühlte sich ihr auf diesem Gebiet nicht gewachsen. Wo nur blieben Dietmar und Wige?! Um ihr nicht das Gefühl zu lassen, er sei verletzt durch ihre spitze Bemerkung, sagte er rasch: "Wir müssen uns vor Verrätern schützen." "Obgleich wir als Gäste in Neudeich an der Versammlung unter der Linde nicht teilnehmen durften, erfuhren wir doch von den neuen Bestimmungen." "Und was haltet ihr davon?" "Sie sind wahrscheinlich notwendig ..." Ramira vermochte einen Unmutslaut nicht zu unterdrücken und blickte dann (nachdem Christian sie angestoßen hatte) starr zu Boden. Ehe aber Tammo darauf aufmerksam wurde, betraten die beiden anderen Stedingerführer den Raum. Der kleine, dunkelhäutige Dietmar tom Diek mit den flinken Augen erfasste die Situation rasch und übernahm die Gesprächsleitung. Der elegante Wige hielt sich zunächst noch zurück. "Ihr seid überrascht, dass wir Stedinger, die sich ihrer Freiheit rühmen, so harte Gesetze erlassen", bemerkte Dietmar und ließ seinen Blick über die vier Abgesandten aus dem Wald schweifen. Niemand wusste, worauf er hinaus wollte. 83 "Ich sagte gerade ..." "... dass sie vermutlich notwendig sind. Ich hörte es, als ich hereinkam. Ein Ritter ist daran gewöhnt, Befehle zu befolgen. Du bist eines Ritters Tochter. Deine Meinung allein kann uns aber nicht genügen. Kannst du dich auch für deine Leute verbürgen?" Franziska merkte, dass sie ihm gegenüber keinen Bildungsvorteil besaß. Von nun an musste sie auf der Hut sein. Natürlich konnte sie die gewünschte Zusicherung nicht geben! Es war möglich, dass sie gerade auf Ruperts Betreiben hin als Hauptmann abgewählt wurde. Vielleicht hätte Dietmar sie noch böse in die Enge getrieben, wäre das Gespräch nicht durch Tammo und Wige plötzlich in eine andere Richtung geraten. "Wir stehen am Rande eines Krieges und im Krieg gelten von Alters her besondere Gesetze", rief Tammo aus, in der irrigen Annahme, seinen Gefährten damit zu unterstützen. "Im Krieg haben die Hauptleute das Sagen. Wer sich ihnen widersetzt, ist ein Verräter, weil er die Kampfkraft des Heeres schwächt. Das klingt hart nur in den Ohren von Träumern." Wige trieb es dann bis zum Äußersten: "Mit Verrätern darf man kein Mitglied haben. Selbst vor Folter sollten wir nicht zurückschrecken." Ramira drückte die Hände so fest aneinander, dass die Knöchel weiß wurden. Christian beruhigte sie mit Mühe, indem er seine Hand auf ihren Arm legte. Aber auch Dietmar war sichtlich schockiert. Freilich ließ sich nicht feststellen, ob ihn der Inhalt der Bemerkung entsetzte oder nur die Bemerkung selbst. Andererseits fand Franziska ihre Selbstvertrauen wieder. "Wir gelten für viele Menschen als Räuber, doch derlei Gräuel verabscheuen sogar wir", bemerkte sie trocken. Nun war plötzlich Dietmar derjenige, der sich verteidigen musste. "Wige ist zuweilen unbesonnen. Zum Glück kann er allein keine Gesetze erlassen. Dafür genügt nicht einmal, dass wir drei Führer uns einig sind. Wir benötigen die Mehrheit der zwölf von allen Marschlandbauern gewählten Hauptleute. Ihr werdet sie nachher kennen lernen. Um euch zu beweisen, dass wir euch vertrauen, laden wir euch zu einer unserer Versammlungen ein." Der vor den Gästen gescholtene Wige versank wieder in Schweigen und warf Dietmar hin und wieder einen wütenden Blick zu. Auch Tammo war unzufrieden. Die Einladung überraschte ihn. Er setzte schon an, dagegen zu protestieren, aber um nicht neue Missstimmung heraufzubeschwören, brach er den begonnen Satz ab. Der Pakt stand auf des Messers Schneide, denn beide Parteien waren verunsichert. Ramira missbilligte ihn unverhohlen. Aus anderen Gründen wollte ihn auch Wige nicht. Christian, Norbert und Tammo schwankten. Dietmar hoffte, die Gäste bei der Versammlung als neue Verbündete präsentieren zu können, hatte aber keine Argumente mehr. Nach einer längeren Pause begann Franziska vorsichtig: "Du spieltest vorhin mit recht darauf an, dass ich nicht für alle meine Leute die Hand ins Feuer legen kann." Davon wollte Dietmar nun nichts mehr wissen. "Sie haben dich zum Hauptmann gewählt und sind dir bisher gefolgt." 'Jedenfalls bis vor einer Woche', dachte Franziska bei sich. Nachdem sie aber noch ein letztes Mal alles Für und Wider gegeneinander abgewogen hatte, stand sie mit einem Ruck auf und streckte dem Stedingerführer die Hand hin. Dieser 84 erhob sich ebenfalls und besiegelte das Bündnis auf Bauernart. Um keine Zweifel aufkommen zu lassen, tauschten anschließend auch Norbert und Tammo sowie Christian und Wige einen Händedruck. Dass sich Ramira aus dem Zeremoniell heraus hielt, fiel niemandem auf. Übrigens sagte sie auch hinterher nichts gegen das Bündnis. Franziska kannte ihre Meinung ohnehin. Bei der Versammlung waren neben den drei Führern, den zwölf Hauptleuten sowie den vier Gästen noch zwei Männer anwesend, die sich um eine Audienz beim Papst bemüht hatten. Über das Ergebnis ihrer Mission erfuhren Franziska und ihre Begleiter nichts. Durch ihre Reise wussten die Unterhändler aber auch über die politische Lage im fernen Rom Bescheid. Einer von ihnen stand auf und berichtete: "Was wir schon vermutet hatten, erwies sich als wahr - zwischen dem Papst und dem Kaiser herrscht wieder Frieden." "Warum ist das für die Stedinger so wichtig?" flüsterte Franziska, an Norbert gewandt. "Sie hielten ganz offen zu Friedrich", flüsterte dieser zurück. "Unter anderem gaben sie ihm Geld für seinen Palästinakreuzzug." Der Redner ging unterdessen auf Einzelheiten ein. "Zunächst hatte alles danach ausgesehen, als würde eine Versöhnung niemals mehr möglich sein. Ihr erinnert euch, dass Gregor gegen den Kaiser den Bannstrahl schleuderte, weil der mit dem bei der Krönung gelobten Kreuzzug zu lange zögerte. Als Friedrich dann aber tatsächlich aufbrach, packte jener unwürdige Schurke von einem Papst die Gelegenheit beim Schopfe und fiel mit Heeresmacht in Apulien ein. Gerade noch rechtzeitig kehrte der Kaiser zurück und verhinderte den üblen Streich. Welch eines Beweises bedarf es noch, um Gregor als einen Knecht des Teufels zu entlarven. Keine Schandtat gibt es, die er nicht schon begangen oder veranlasst hat. Um die Menschen zu täuschen, hatte er sogar verbreiten lassen, Friedrich sei tot." Der zweite Mann setzte den Bericht fort: "In Rom fanden wir Gelegenheit, mit unserem Freund Hermann zu reden." "Wen meint er?" fragte Franziska. "Hermann von Salza, den Großmeister des Deutschritterordens?" "Der Großmeister ist ein Verbündeter der Stedinger", antwortete Norbert. "Wie es dazu kam, weiß ich nicht." Unterdessen rühmte der Redner: "Ohne Hermanns Bemühungen wären nicht einmal mehr Verhandlungen möglich gewesen, geschweige denn ein Friedensschluss. Unermüdlich reiste er zwischen den Lagern hin und her. Dabei erreichte er, dass das Eis allmählich schmolz." Die zwölf Hauptleute hörten mit wachsender Aufmerksamkeit zu. Sie fanden den Bericht jedoch zu salbungsvoll und riefen dazwischen: "Wir hörten, dass sich der Kaiser den Frieden mit großen Zugeständnissen erkaufen musste. Ist das wahr?" "Friedrich gab nur Kleinigkeiten preis. Er verzichtete auf die Rechte eines päpstlichen Legaten in Sizilien, er gab den Templern und den Johannitern den eingezogenen Besitz zurück und er ließ die von seinen Leuten gefangen genommenen Anhänger des Papstes frei." "Kleinigkeiten nennst du das? Warum musste er auf einen so schlechten Vertrag eingehen? Hatte er nicht gesiegt? Hatte nicht der Papst ihn auf niederträchtige Art und Weise betrogen und sich damit selbst ins Unrecht gesetzt?" 85 Ein anderer wusste davon, dass einige deutsche Fürsten an der Aussöhnung beteiligt gewesen waren, darunter auch Erzbischof Gerhard II von Bremen. Hatten auch sie den Kaiser verraten? Die solchermaßen bestürmten Unterhändler mussten eingestehen, dass sie die Hintergründe so genau nun auch wieder nicht kannten. So blieb am Ende die für die Stedinger wichtigste Frage unbeantwortet. Der Einfluss des Hermann von Salza sowohl am Hofe des Kaisers als auch in der Umgebung des Papstes hatte ihnen in den zurückliegenden Jahren viele Vorteile gebracht. Seit der Versöhnung wurde der Großmeister in Rom und Apulien aber als Diplomat nicht mehr benötigt. Sank damit sein Ansehen? Würde er in Zukunft für seine Freunde nichts mehr bewirken können? Die Zuversichtlichen unter den Hauptleuten versicherten, dass ein Mann mit Hermanns Fähigkeiten auch in Friedenszeiten unverzichtbar sei. Die Vorsichtigen dagegen empfahlen, sich beizeiten nach neuen Verbündeten umzusehen. IV B ei ihrer Rückkehr nach Neudeich platzten die vier Abgesandten der Waldhütte mitten in ein Familiendrama hinein. Vom Hof her hörten sie die von Zorn erfüllte Stimme des Bauern Jörg. Genaues konnten sie nicht verstehen, aber ziemlich deutlich vernahmen sie das Wort Schande. Wenig später kam Gudrun, in Tränen aufgelöst, zur Missendör heraus gerannt und flüchtete, ohne die Gäste zu beachten, hinters Haus in den Gemüsegarten. Taktvoll bot Franziska an, sofort weiter zu ziehen. Davon jedoch wollte Luise nichts wissen. Sosehr sie den Fremden misstraute, mochte sie dennoch nicht als schlechte Gastgeberin dastehen. Mindestens die eine Nacht sollten die vier noch unter ihrem Dach verbringen. Bis zum nächsten Morgen aber änderte sich die Lage noch einmal gründlich. Obgleich man alles tat, um die Familienangelegenheit vor den Gästen geheim zu halten, spürten diese doch die fieberhaften Bemühungen um eine Lösung. Ständig standen zwei oder drei Leute in einem Winkel zusammen und redeten aufeinander ein - mit gedämpfter Stimme, jedoch wild gestikulierend. Tief in der Nacht war dann wohl eine Entscheidung gefallen. Beim Frühstück wirkten vor allem Jörg und Liemar sehr ausgelassen. Gudrun sah noch immer ein wenig bedrückt aus, erleichtert war aber auch sie. Die Gäste durften nun erst recht nicht weiterziehen. Am übernächsten Tag nämlich sollte Hochzeit gefeiert werden. Kurz vor Mittag desselben Tages schallte plötzlich eine helle Kinderstimme über den Hof: "Der Schlachter ist da, der Schlachter ist da!" Für Hänschen und seine Schwester Jule, die Kinder einer mit auf dem Hof lebenden Cousine des Bauern, war Schlachttag noch ein ganz besonderes Ereignis. Vor allem gefiel ihnen, dass sie gebraucht wurden und ebenso wie die Erwachsenen einen Platz zugewiesen bekamen. Selbstverständlich fühlten sie sich noch dreimal wichtiger, als sie es in Wirklichkeit waren, und liefen mit roten Wangen eifrig umher. Hinter Hänschen trat der Schlächter des Dorfes, ein kräftiger Mann mittleren Alters mit beachtlichem Bauch 86 bedächtigen Schritts durch die Missendör. Er begrüßte Luise und Gudrun mit Handschlag und erkundigte sich nach Jörg und Liemar. "Sie halten hinterm Haus das Abbrühwasser am Kochen." "Ja, das ist gut so." Dann wandte er sich an den Kleinen, den er zum Spaß so anredete, als hielte er ihn für einen Mann: "He, künftiger Bauer, hole den Jörg und sag ihm, er soll die Schweinezange mitbringen!" Nachdem das ausgewählte Schwein aus dem Stall gezogen worden war, kam es auf den Stechstuhl, wo ihm der Schlächter mit geübtem Schnitt die Halsschlagader durchtrennte. Gudrun fing das Blut in einem Bottich auf und begann sofort, es kräftig zu rühren, damit es nicht klumpte. Das Abbrühen und Abschrapen des ausgebluteten Tiers im Brenntrog übernahmen Jörg und Liemar, während Luise schon den großen Kessel vorbereitete. Dort kamen die großen Fleischstücken, die nun nach und nach abgeteilt wurden, zum Kochen hinein. Er war aus gutem Eisen und galt in der Familie als Wertstück. Ein Großvater, den niemand mehr so recht kannte, hatte ihn einst von einem Bremer Schmied fertigen lassen. Als er voll war, hingen die Männer das restliche Fleisch zum Räuchern an die Haken über dem Herd. Die Stücke mussten nun gar kochen, dann begann das Wurstmachen. Der Schlächter schnitt das Fleisch auf einem Tisch in kleinere Teile. Diese verarbeiteten Jörg und Liemar mit je zwei scharfen Hackmessern auf Blöcken zu einer feinen Masse. Das war auf die Dauer eine anstrengende Arbeit, weshalb die beiden das Angebot der Gäste, ihnen zu helfen, dankbar annahmen. Franziska, die dergleichen zu Hause schon als Zehnjährige getan hatte, erwies sich als am geschicktesten. Norbert fühlte sich dadurch in seiner Ehre als Mann verletzt, mühte sich wie besessen und hackte sich beinahe den Daumen ab. Ramira dagegen, die Künstlerin, die man eigentlich nirgends so recht gebrauchen konnte, nahm ihre Ungeschicklichkeit gelassen hin. "Ich spiele euch zum Ausgleich morgen bei der Hochzeit was vor", versprach sie. Für die Zutaten sorgten Luise und Gudrun. Die Bäuerin schnitt die Zwiebeln klein und drückte sie durch die Zwiebelpresse. Ihre Tochter bereitete die Gewürze für die Pottwurst zu. Die Magd schließlich drückte die fertigen Würste in die Därme. Niemand konnte so gut wie sie mit den Kuhhornringen umgehen. Die Fäden zum Zubinden auf die rechte Länge zu schneiden und bereitzulegen, blieb für die Kinder übrig, die sich dabei wichtigtuerisch gegenseitig maßregelten. Anschließend mussten die Würste noch einmal gekocht werden. Das erledigte Luise, die sehr stolz darauf war, dass bei ihr fast nie eine davon platzte. Die Männer fertigten unterdessen die Mettwürste, die sofort zum Räuchern über den Herd kamen. Beim Arbeiten merkte kaum jemand, wie die Zeit verging. Der Tag neigte sich schon dem Ende entgegen, als Luise die gekochten Würste aus dem Kessel nahm und an Gudrun übergab, die sie gemeinsam mit Ramira zum Abkühlen auf eine Schicht Stroh breitete. Der Schlächter, die Angehörigen des Hofes sowie ihre Gäste setzten sich nun erschöpft nieder und ließen ihre Blicke über das Ergebnis ihrer Mühe schweifen. Fleisch und Wurst verbreiteten einen würzigen Duft. In Steintöpfen erstarrte das vom Kessel abgeschöpfte Fett zu Schmalz. Dabei meldete sich mit Macht der Hunger. Immerhin hatten sie alle seit Stunden nichts mehr gegessen. Sie 87 holten das Versäumte nun um so üppiger nach. Der darauffolgende Vormittag brachte Aufregung anderer Art. Gudrun wurde als Braut herausgeputzt und durfte selbstverständlich den Bräuten vergangener Jahre in nichts nachstehen. Luise war umso mehr auf genaue Einhaltung aller Regeln bedacht, da auf der Hochzeit ein Makel lag (von dem die Gäste freilich bis zuletzt kaum etwas erfuhren). Jörg und Liemar, die jetzt im Haus eher störten als nutzten, begaben sich auf einen Spaziergang durchs Dorf. Unterwegs verbreiteten sie die Neuigkeit unter den Nachbarn und luden sie alle ein. Natürlich sprach innerhalb des Etters an diesem Tage niemand mehr von etwas anderem. Das Fest fand am Nachmittag statt, und zwar unter der Linde, weil nur dort genügend Platz zur Verfügung stand. Ein jeder kam, um des junge Paar und die Eltern der Braut zu beglückwünschen, es sei denn ein sehr gewichtiger Grund hinderte ihn daran. Der Schulze gratulierte, der Hirt, der Dorfknecht. Die Heimbürgen bekamen einen besonderen Tisch reserviert. Den Angehörigen des Vierer, denen in den vergangenen Tagen zeitweilig das Lachen vergangen war, amüsierten sich unbeschwert. Ramira schließlich löste ihr Versprechen ein und bot eine Vorführung, bei der vor allem Christian aus dem Staunen nicht herauskam. Sie konnte nicht nur alle Musikinstrumente spielen, die man ihr zureichte, sondern vollführte zudem schier unglaubliche Kunststücke auf einem zwischen zwei Häuser gespannten Seil. Wer sie nach dem Schlachten für ein wenig dumm gehalten hatte, der änderte spätestens jetzt seine Meinung. Selbst Franziska ließ sich gehen. Seit die Hauptmannsbürde auf ihren Schultern lastete, war sie sehr ernst geworden. In der Waldhütte stand sie fast immer unter innerer Anspannung. An den Gelagen, die dort häufig stattfanden, meist von Rupert angeregt, nahm sie nur widerwillig teil und ohne jedes Vergnügen. An diesem Abend aber erwartete niemand von ihr eine Entscheidung und niemand bedrohte ihre Stellung. Anfangs nippte sie nur zaghaft am Wein und beim Tanzen bemühte sie sich, Würde zu bewahren. Dann merkte sie, dass sie sich mit solchem Gehabe nur zur Zielscheibe des Spotts machte, und ließ mehr und mehr ihr eigentliches Wesen an die Oberfläche. Bald verblüffte sie die Dorfjungen mit ihrem derben Humor. Noch mehr wunderte sich freilich Norbert, der ihr eine solch wilde Leidenschaftlichkeit am allerwenigsten zugetraut hätte. Sie riss ihn mit in einen Taumel, bei dem er allmählich den Boden unter den Füßen verlor. Ein Sprichwort sagte: Hochzeiten bringen wieder Hochzeiten. Wer nicht wusste, was damit gemeint war, hatte wahrscheinlich noch keine solche Dorfhochzeit miterlebt. Dass sich das Blut der jungen Leute erhitzte, lag nicht allein am Wein. Die Anspielungen auf den künftigen Kindersegen des Paares, die gewagten Neckereien, die schon fast zum Brauch gehörten, die ganze Atmosphäre eines solchen Abends wurden zu Mitschuldigen. Übrigens galt es bei den meisten Bauernfamilien nicht als Schande, schon vor der Eheschließung im Heu gelegen zu haben. Nur wenn die Tochter eines wohlhabenden Bauern so dumm war, sich von einem armen Hund einen Balg andrehen zu lassen, war es ein Skandal. Auch in der größten Leidenschaft sieht ein anständiges Mädchen sich an, bei wem es die Beherrschung verliert! Als die Geisterstunde nahte, war Franziska schon ziemlich betrunken. Ihrer Liebessehnsucht tat das allerdings keinen Abbruch, im Gegenteil. Der 88 Rausch verscheuchte den Stolz, der sie sonst gehindert hätte, so geradlinig und zugleich geschickt auf ihr Ziel zuzusteuern. Da Norbert ein Mann war, wollte er erobern. Also tat sie, nachdem sie ihn durch Neckereien gründlich gereizt hatte, gerade so, als habe sie sich plötzlich alles anders überlegt. "Ach, lass mich in Ruh!" sagte sie, riss sich los und rannte davon. "Ich habe keine Lust mehr zum Feiern", rief sie ihm zu. "Ich leg mich schlafen." Nun war Norbert aber ebenfalls nicht mehr nüchtern und demzufolge nicht weniger ungehemmt. Er verfolgte sie und (nicht ganz zufällig) ergab es sich, dass beide in einen finsteren Winkel gerieten. Sie konnte nicht mehr weiter zurückweichen und spielte ihm vor, sich vor ihm zu fürchten. Genau genommen, steigerte sie sich in ihr Spiel so weit hinein, dass List und Wirklichkeit ineinander übergingen. Als er sie packte, wehrte sie sich mit ganzer Kraft. Andererseits verlieh ihm das sexuelle Verlangen die nötige Stärke, sie trotzdem festzuhalten. Er wurde regelrecht brutal, zerriss ihr das Kleid, zerrte sie zu Boden. Noch immer stieß sie ihn zurück. Während er ihr aber heftig atmend die entblößten Brüste massierte, konnte sie kaum noch erwarten, dass er Besitz von ihr ergriff. Erst am nächsten Morgen merkten beide, wie sie einander in der Nacht zugerichtet hatten. Das war ihnen nun ein wenig peinlich, zumal es sich kaum verbergen ließ. Norbert hatte unter anderem eine blutige Schramme quer über das Gesicht, Franziska ein blaues Auge. Um den neugierigen Blicken und dem Gelächter der Dorfjugend zu entgehen, flüchteten sie in die Wiesen hinaus. Dort behandelten sie sich erst einmal gegenseitig ihre Blessuren. "So sanft kenne ich dich ja gar nicht", meinte Norbert dabei. "Du hast mir mit meiner Jungfräulichkeit meine Kraft geraubt. Das ist wie in dieser Geschichte mit der isländischen Königin." "Was für eine Königin?" "Sie war so stark, dass der König, der sie haben wollte, sich einen Vasallen mitnahm, um mit ihr fertig zu werden." "Und das hat sie nicht gemerkt?" "Der andere war durch Zauber unsichtbar. Sie ist aber später doch noch dahinter gekommen." "Und dann?" "Weiß ich nicht mehr. Mein Bruder hat mir das erzählt, als ich noch gar nicht recht wusste, worum es geht. Es gab jedenfalls eine Menge Scherereien und am Schluss waren alle tot." "Das ist ja gruselig." "So etwas muss man sich eben vorher überlegen." "Ich schwöre, dass ich diese Nacht allein war!" "Das kannst du so genau gar nicht wissen. Du warst viel zu betrunken. Glaub nicht, dass das so weitergeht. Ich bin jetzt in gewisser Hinsicht deine Frau und werde dafür sorgen, dass du ein anständiges Leben führst." "Das ist ja großartig! Nur wenige Stunden nach der Hochzeitsnacht! Vielleicht hat Christian doch Recht." "Womit hat Christian vielleicht Recht?" "Ach, nichts." In den folgenden Tagen ließ sich Franziska von einer gewissen Trägheit treiben. Insgeheim fürchtete sie sich vor den Zuständen in der Waldhütte. Den Vorwand, noch für eine knappe Woche in Neudeich zu bleiben, lieferte ihr die kirchliche Trauung für Liemar und Gudrun am darauf folgenden Sonntag. Die Leute in den Dörfern maßen dem christlichen Zeremoniell eigentlich nur formale Bedeutung bei, wollten aber andererseits unter keinen Umständen darauf verzichten. Auch dass alle sich 89 besser noch als bei gewöhnlichen Kirchgängen kleideten, dass das gesamte Dorf sich zu einer Prozession zusammenfand, schließlich dass die Neuvermählten und deren Verwandte sich nicht kleinlich gaben bei der Spende für den Priester, das alles war eine Selbstverständlichkeit. Neudeich besaß noch keine eigene Kirche, so dass die Leute zum Gottesdienst in einen Nachbarort gehen mussten. Der Priester dort hatte sich dem Erzbischof widersetzt und war trotz anderer Anweisungen an seinem Posten geblieben. Sein Verständnis für die Denkweise der Bauernfamilie sorgte dafür, dass fast jeder ihn mochte. Wenn von Misshandlungen der Geistlichen im Stedingerland die Rede war, zuckte er nur verständnislos mit den Schultern. 90 8.Kapitel I E rzbischof Gerhard stand am Fenster und blickte starr hinunter in den Hof seines Palastes, wo ein Kutscher mit einem Pferd kämpfte, das sich nicht einspannen lassen wollte. Man konnte glauben, er langweile sich und beobachte die eher belanglose Szene zur Zerstreuung, wären da nicht seine Finger gewesen, die unablässig einen Takt auf die Wand klopften. Tatsächlich ballte er nach einiger Zeit plötzlich die Hand zur Faust und drehte sich abrupt um. "Ich verstehe es nicht. Nein, ich weiß wirklich nicht, was ihn an einer klaren Botschaft hindert." Wieder wandte er sich dem Hof zu, aber nur kurz. "Bei Konrads Abreise war ich mir sicher, dass die Kreuzzugsbulle nur noch vier, höchstens sechs Wochen würde auf sich warten lassen. Warum schickt der Heilige Vater seinen Großinquisitor hierher, wenn er sich hinterher von dessen Eindrücken gar nicht beeinflussen lässt?" Sein Bruder Hermann saß mit versteinertem Gesicht am Tisch. Er wirkte in dieser Haltung ein wenig schläfrig. Der äußere Eindruck täuschte jedoch. Genau dieses Gesicht hatte er immer dann, wenn ein wilder Entschluss in ihm reifte, einer jener Entschlüsse, die den Erzbischof zuweilen in Angst und Schrecken versetzten. Gerhard war aber zu sehr mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, um darauf zu achten. "Vermutlich hat dieser Hermann von Salza wieder seine Hände im Spiel. Ich hasse ihn, obgleich er der Großmeister eines geistlichen Ritterordens ist. Das sind ja sonderbare Zustände, wenn Ketzerfreunde zu solchen Würden gelangen! Und ich hatte gehofft, dieser Mensch werde nicht mehr in Gregors Umgebung geduldet, nun da es mit dem Kaiser keine Friedensverträge mehr auszuhandeln gibt." Wieder wandte er sich kurz dem Hof zu. Der Kutscher war des Pferdes endlich Herr geworden. Gerade rollte der Wagen durch das Tor. Gerhard erschien das wie ein Fingerzeig Gottes. Sein Gesicht hellte sich ein wenig auf. "Der Tag der Gerechtigkeit wird kommen. Leider verlieren wir wertvolle Zeit. Energisches Handeln täte not." Der letzte Satz wirkte auf Hermann wie ein Stichwort. Trocken sagte er: "Wenn es niemand sonst tun will, so werde ich sie züchtigen." Gerhard blickte ihn überrascht an und verstand nicht recht. Hermann musste deutlicher werden. "Ich würde wagen, die Stedinger auch ohne die Hilfe des Papstes und der Grafen anzugreifen." "Das sagst du, ohne überlegt zu haben. Sahst du nicht mit eigenen Augen die Spuren ihres Wütens in der Schlutterburg?!" "Ich habe alles bedacht. Meinen Plan hege ich schon seit langem. Mehr als zweihundert Panzerreiter könnte ich in nur zwei Wochen zusammenbringen, dazu mindestens noch zehnmal soviel Fußvolk." Der Erzbischof setzte sich seinem Bruder gegenüber. Der Vorschlag erschien ihm verlockend. Dennoch schob er ihn mit einer Handbewegung beiseite. "Nein, nein! Das ist ein Abenteuer und wir können uns eine Niederlage nicht leisten. Die Stedinger werden frecher mit jedem ihrer Siege." "Sie werden auch frecher durch unser Zögern, das sie als Schwäche werten", hielt Hermann dagegen. "Zweihundert Panzerreiter!" sprach Gerhard vor sich hin. Er sah die Streitmacht im Geiste vor sich, mit ihren Bannern, umringt vom Fußvolk. Die Versuchung war gar zu groß für ihn. "Hast du eine Vorstellung davon, wo du angreifst und wie du dann vorgehst?" Über Hermanns versteinertes Gesicht huschte ein Lächeln. Er ließ sich Zeit mit der Antwort und kostete die Spannung des mächtigen Bruders aus. Selbstverständlich hatte er Vorstellungen von dem Angriff. Seit drei Monaten dachte er an nichts anderes mehr. "Wir müssen sie überraschen, indem wir zu einer Zeit angreifen, in der sie nicht damit rechnen, und dies an einer Stelle tun, wo sie uns erst im letzten Moment sehen." "Kannst du es nicht genauer sagen?" drängte der Erzbischof. "Ich habe mir die Deiche angesehen. Einer ist so gelegen, dass man ihn bei Ebbe trockenen Fußes erreicht. Zugleich ist er so hoch, dass er einen Reiter sicher verbirgt." "Aber er wird doch bewacht sein!" "Die Bauern dieser Gegend sind sorglos. Wegen der Wesersümpfe gab es bisher noch nie einen Angriff aus dieser Richtung, auch nicht durch die Oldenburger." "Und wann willst du angreifen? Zu Beginn des neuen Jahres?" Wieder ließ Hermann eine längere Pause entstehen. "Nein, noch in diesem Jahr - genau am Heiligen Abend." Gerhard zuckte zusammen, obgleich er gewöhnlich selbst nicht zimperlich war bei der Wahl seiner Mittel. In einem Anflug von Verlegenheit trat er wieder ans Fenster. Der Hof gönnte ihm diesmal keinen Fingerzeig Gottes. Er war leer. "Wir dürfen uns nicht versündigen, indem wir einen Feiertag des Herrn entweihen", gab er zu bedenken. "Könnten wir ihn besser ehren als durch die Bekämpfung der vermaledeiten Ketzer?" beharrte Hermann. "Und wenn es so wäre! Ich kann dem niemals zustimmen. Ich muss politisch denken. Schon heute höre ich, wie sie über mich herfallen. Leider habe ich Gegner unter den Fürsten, die allezeit auf einen Fehler von mir lauern." "Wer wagt einen Erzbischof zur Verantwortung zu ziehen wegen dem gläubigen Eifer seines Bruders?" Abermals unterlag Gerhard seinem glühenden Verlangen nach Rache an den Bauern, die ihm in der Schlutterburg seine Waffenknechte erschlagen hatten. Seine Gedanken schweiften schon zu den praktischen Fragen des Unternehmens. Er wollte auf jeden Fall im Hintergrund bleiben und keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass Hermann auf eigene Faust handelte. Andererseits fürchtete er, die Grafen zu verärgern, würde er sie nicht über den Plan unterrichten. Leider konnte er sich über solche Feinheiten mit seinem Bruder nicht beraten. "Ich danke dir für deinen Plan und billige ihn. Er spricht für deine edle Gesinnung", sagte er. "Zugleich muss ich dich bitten, meinen Namen im Zusammenhang mit dem Unternehmen niemals zu erwähnen, auch nicht vor den Rittern." Hermann verstand, dass er damit verabschiedet war, und entfernte sich. Der Erzbischof blieb allein zurück und begann sein Einverständnis bereits zu bereuen. Wer ist so dumm, tatsächlich zu glauben, er habe mit all dem nichts zu tun? Zumindest den Oldenburgern 92 musste er den Plan mitteilen und zwar mit allen Einzelheiten. Und auch die Zweifel an dem Unternehmen selbst kehrten zurück. Er sah böse Verwicklungen auf sich zukommen. Dass mit diesen Stedingern nicht zu spaßen war, wusste er spätestens seit der Belagerung Bremens. Die Bauern hatten ihm einen Fingerzeig gegeben. Sie hatten ihm bewiesen, dass er selbst in seinem Palast nicht wirklich sicher vor ihnen war. In der folgenden Nacht wurde er von Alpträumen geschüttelt. Finstere Gestalten drangen mit blanken Schwertern in sein Schlafgemach ein. Er indes lag wie gefesselt in seinem Bett und vermochte nicht einmal davonzulaufen. II S elten hatte Otto seine Frau in solcher Erregung gesehen. Mechthild war rot angelaufen im Gesicht und musste nach Worten suchen. "Ein Überfall am Heiligen Abend! Das ist ein Verbrechen, gleich was der Anlass auch sein mag." "Es ist eines der vielen Verbrechen, die geschehen, weil wir sie nicht verhindern können, du nicht und ich auch nicht." "Wir könnten die Bauern warnen." "Sagt das meine kluge Frau, die bei den Dingen des Alltags immer einen Schritt weiter denkt als ich alter Träumer? Soll ich mich jetzt auf ein Pferd schwingen und nach Stedingen reiten? Soll ich mich zu deren Anführer bringen lassen? Natürlich werden sie mir glauben. Selbstverständlich wird Christian Verständnis haben dafür. Er wird es sogar gut heißen, da wir doch damit einen argen Frevel verhindern." "Ja, ja! Du hast Recht. Aber wie kannst du so ruhig bleiben?!" Otto stutzte. Er wunderte sich plötzlich über sich selbst. War er schon so abgebrüht gegen die Ungerechtigkeiten der Welt, dass er sie gleichgültig zur Kenntnis nahm? Nein, das wohl nicht. Es musste an etwas anderem liegen. "Auch du wünschst mich manchmal heldenhafter. Nicht wahr?" sagte er bedächtig. "Ich fürchte, dass ich dich in dieser Beziehung auch künftig enttäuschen werde. Die Sache des Schwertes ist nicht die meine. Vielleicht aber ist das ja von Gott so gewollt. Sprach nicht unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als man ihn verriet, zu seinem Lieblingsjünger Petrus: 'Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen'? Weißt du, meine liebe Mechthild: Ich bin lediglich der Chronist all dieser Dinge. Ich schreibe sie auf, damit spätere Generationen ihre Lehren daraus ziehen." "Bist du dir sicher, dass man deinen Berichten dereinst mehr Glauben schenkt als heute deinen Worten?" "Ich hoffe es. Was bleibt uns denn außer der Hoffnung?" Mechthild hob resignierend die Arme. Ja, diesmal hatte sie tatsächlich mit ihrem Mann die Rollen getauscht. Diesmal war sie der Träumer gewesen. Niemand aus der Familie des Grafen von Oldenburg konnte verhindern, was dieser Hermann plante. Weil sie nicht mehr darüber reden wollte, fragte sie unvermittelt: "Womit beschäftigst du dich eigentlich gerade bei deiner Chronik?" "Ach, der fünfte Kreuzzug ist es immer noch." Er lachte in sich hinein, glücklich wieder bei einem Thema zu sein, das ihn nicht als Schwächling 93 erscheinen ließ. "In gewisser Hinsicht trifft auf seinen Verlauf der Ausspruch unseres Herrn ebenfalls zu. Als Friedrich wieder gesund war, brach er mit einem verhältnismäßig kleinen Heer nach Palästina auf. Seine Streitmacht hätte niemals ausgereicht, um Jerusalem im Sturm zu nehmen. Aber das plante er auch gar nicht." Er hielt inne. "Oh, ich langweile dich schon wieder mit meinem Geschwätz." "Ich langweile mich nie, wenn du etwas erzählst." "Der Kaiser brach also mit seiner Flotte auf. Genau am siebenten Juli vor zwei Jahren erreichte er Akkon. Dort merkte er, dass er Geduld brauchte, und kümmerte sich erst einmal um die Zustände auf der Insel Zypern. Die ist zwar in christlicher Hand, doch wird das nicht mehr lange so bleiben, wenn die Barone weiterhin ein so zügelloses Leben führen. Sie haben wohl vergessen, welche Verantwortung sie tragen auf jenem Vorposten. Ein ordnungsliebender Herrscher wie Friedrich konnte das natürlich nicht mit ansehen. In Sizilien ist das Leben auf so wunderbare Art und Weise geregelt, wie wir es uns hier in den deutschen Landen gar nicht vorstellen können. Kaufleute haben mir viel davon erzählt. Aber das gehört nicht hierher. Friedrich versuchte also, seine vorbildliche Ordnung auch in Zypern einzuführen." Hier unterbrach ihn Mechthild. "Warum denkst du, dass es ihm nur um das Wohl der Christenheit ging? Vielleicht wollte er die Insel einfach nur für sich erobern." Otto kratzte sich hinterm Ohr. "Gewiss. Das ist möglich. Übrigens hatte er nicht viel Erfolg dabei. Die Barone waren sich, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben, völlig einig und stellten sich entschlossen gegen ihn. Auch später machten sie ihm noch viel zu schaffen." "Er kehrte also nach Palästina zurück?" "Ja. Dort unternahm er gegen Ende des Jahres etwas, was nun wirklich noch niemand vor ihm getan hatte und weshalb ich ihn bewundere. Er nahm Verhandlungen mit Sultan al-Kamil auf." "Tatsächlich? Sagt man nicht, die Araber seien hinterhältig? Fürchtete der Kaiser nicht, in eine Falle gelockt zu werden?" "Ich glaube, davor brauchte er sich nicht zu fürchten. al-Kamil war für ihn fast so etwas wie ein Freund. Er kannte seine Sprache und hatte zuvor schon häufig seine Gesandten am Hof empfangen. Geschenke waren ausgetauscht worden, zum Teil kostbare und wirklich erstaunliche Dinge. Friedrich ist ein Freund mechanischer Geräte und die Araber sind Meister auf diesem Gebiet." "Dass er diesen Sultan gut kannte, war bei den Verhandlungen sicherlich ein Vorteil", sagte Mechthild. "Ja, ganz bestimmt. Er wusste, was er fordern konnte und welche Kompromisse er eingehen musste. Am 28-ten Februar im vorigen Jahr war es dann soweit - die christlichen Pilger durften nach langer Zeit die Stadt Jerusalem wieder ungehindert betreten. Nur einige wenige Stätten, welche den Muselmanen als heilig galten, blieben davon ausgenommen. Auch über den Weg in die Stadt hatten die beiden sich geeinigt. Ein schmaler Streifen sollte als Verbindung zum christlichen Küstenstreifen dienen." "Eine schöne Geschichte!" rief Mechthild begeistert. "Ich hörte zwar von der Befreiung der Heiligen Stadt, nichts aber von der Art, wie sie zustande gekommen war." "Auch mir gefällt die Geschichte. Leider ist es den meisten Menschen lieber, wenn Blut fließt." 94 "Das glaube ich nicht." "Oh doch! Sie heucheln Friedfertigkeit, aber sie wollen Gewalt. Der Vertrag zwischen Friedrich und elKamil wurde in beiden Lagern als schändlich gebrandmarkt. Die Araber sagten: 'Warum hast du ihn nicht zusammengehauen, da er doch nur über ein kleines Heer verfügte?!' Die Christen fanden es verdächtig, dass ihr Kaiser sich als Muselmanenfreund entpuppte. Und selbstverständlich mäkelten alle am Vertrag selbst herum. Friedrichs Hoffnung, dass der Papst den Bann von ihm nimmt, nun, da er sein Versprechen voll und ganz erfüllt hatte, wurde bitter enttäuscht. Du weißt, dass der Heilige Vater längst schon daran dachte, die Abwesenheit seines Widersachers zum Eroberungszug auszunutzen." "So hat Friedrich der Kreuzzug also keinerlei Gewinn gebracht?" "Er scherte sich zunächst nicht um den Papst und dessen widersinnigen Anordnungen. Im Frühjahr scharte er zahlreiche Pilger um sich und zog mit ihnen im vollen Schmuck seiner Insignien symbolisch in die Heilige Stadt ein. Auch in der Grabeskirche zeigte er sich. Leider musste er auf die Hilfe der meisten Priester verzichten. Der Patriarch von Jerusalem hielt zum Papst." In Gedanken versunken, überflog Otto noch einmal seine Aufzeichnungen. "Ich glaube, Friedrich war am Ende tatsächlich enttäuscht über den Ausgang des Unternehmens. Zwar nutzen immer mehr Pilger seinen Erfolg aus, doch denkt dabei kaum jemand an ihn. Der Papst erlöste ihn nur unter großem Druck vom Bann. Die Verhältnisse auf Zypern sind wieder wie zuvor, seit Johann von Brienne die Stadthalter vertrieben hat. Ja, die Geschichte ist, als Ganzes betrachtet, eben doch nicht so schön." Beklommen spürten beide, dass ihre Gedanken an den Ausgangspunkt zurückgekehrt waren. Hatte Gott die Welt wirklich so schändlich eingerichtet, so sehr bestimmt von Gewalt und Verrat, dass hochherziges und vernünftiges Verhalten darin absonderlich wirkt? Ohne ein weiteres Wort zog Mechthild sich zurück. Otto hörte ihre Schritte auf der Wendeltreppe leiser werden und stürzte sich wieder in die Arbeit seiner Chronik. III ber Nacht hatte es geschneit. Die Äcker und Wiesen schlummerten unter einer weißen Decke, die zwar noch nicht dick war, aber immerhin schon vollständig geschlossen. Die sanften Wellen wurden erst am Deich und am Waldrand unterbrochen und erinnerten an das Meer an einem klaren, windstillen Abend. Die Bauern von Neudeich, die sich absichtlich keine besondere Arbeit vorgenommen hatten, ließen versonnen den Blick schweifen. Die Zeit stand still. Die Kinder genossen den Tag in anderer Weise. Jule und Hänschen lieferten sich auf dem Anger eine Schneeballschlacht, an der sich bald auch noch andere Kinder beteiligten. Das gab einen Mordsspektakel, der schließlich einem alten Mann gar zu sehr auf die Nerven ging. Drohend schwang er den Knüppel, auf den er sich sonst stützte. Eine Frau aber sprang den Kindern bei: Ü 95 "Was schimpfst du so?! Warst du nicht selbst einmal jung? Und fühlst du nicht, dass heute ein besonderer Tag ist?" Mit einer weiten Bewegung wies sie auf das Dorf, das wie verzaubert war. Die Linde hatte hundert weiße Pfötchen. Die Häuser trugen Mützen von sonderbarer Form. An einigen Stellen wuchsen kristallklare Eiszapfen. Der Alte war zwar keineswegs überzeugt, doch wusste er keine gute Widerrede. Wütend stapfte er in sein Haus zurück, während die Kinder jubelten und lauter kreischten als zuvor. Übrigens hätte sie wohl niemand auf Dauern bändigen können. Sie waren viel zu aufgeregt wegen der schönen Dinge, die am Abend auf sie warteten. Die Erwachsenen trieben schon seit einiger Zeit geheimnisvolle Vorbereitungen. Hänschen brüstete sich, Genaueres zu wissen. Seine kleine Schwester Jule trieb ihn aber mit ihren neugierigen Fragen ziemlich schnell in die Enge und schloss triumphierend: "Du weißt genau so wenig wie ich. Gib nicht so an!" Bauer Jörg schlenderte mit Liemar, seinem ehemaligen Knecht, der nun sein Schwiegersohn war, müßig die Dorfstraße entlang in Richtung Ettertor. Ihnen knurrte ein wenig der Magen. Um beim Festmahl am Abend ordentlich zulangen zu können, aß man an diesem Tag nichts zu Mittag. Aber das nahmen die beiden gern in Kauf. Sie waren einfach glücklich, obwohl man ihnen das kaum ansah. Die Dorfbewohner pflegten von einem gewissen Alter an ihren Gefühlen nicht mehr vorbehaltlos zu vertrauen. Im Erfolg ahnten sie das Unheil, in der Niederlage künftigen Sieg. Das Auf und Ab des Schicksals war Teil ihres Wesens geworden. Daran lag es, dass sie gelassen blieben, als von der Kirche des Nachbardorfes plötzlich Gefahrläuten zu ihnen herüber wehte. Sie sahen sich an und rannten zum nur noch wenige Meter entfernten Tor, um den Grund zu erkunden. Dabei vermuteten sie, dass ein Haus in Brand geraten sei. Die vielen Kerzen, welche die Leute am Heiligen Abend zu Ehren des Christkindleins entzündeten, führten leider immer wieder zu großem Unglück in dieser sonst so herrlichen Zeit. Sie sahen jedoch keinen Rauch aufsteigen, so sehr sie ihre Augen auch anstrengte. Die tatsächliche Gefahr bemerkten sie erst, als jemand sie anstieß und aufgeregt zum Deich hin zeigte. Dort flutete soeben auf breiter Front ein Heer aus etlichen gepanzerten Reitern und zahlreichem Fußvolk heran. Die schwer bepackten Pferde wurden durch den Schnee zwar behindert, blieben jedoch nicht stecken. Die Schar, die sich vor dem weißen Hintergrund schwarz abhob und dadurch besonders bedrohlich wirkte, näherte sich langsam aber unerbittlich. Der erste Schrecken dauerte nur kurz. Den Bauern war der Befehl der Universitas, in jedem Dorf ein Waffenlager anzulegen, nun sehr nützlich. Alle Männer strömten zum Anger, wo ein Schuppen als Magazin diente. Selbst Halbwüchsige wollten kämpfen. In kurzer Zeit verlor Neudeich seine weihnachtliche Lieblichkeit und verwandelte sich in eine grimmige Festung. Nachdem das Heer die freie Fläche überwunden hatte, teilte es sich, um die Dörfer anzugreifen. Das war ungewöhnlich. Die Ritter hätten leicht an ihnen vorbei tiefer ins Stedingerland vorstoßen können, anstatt sich schon an dessen Rand so zu verzetteln. Vielleicht unterschätzte ihr Hauptmann den Widerstand, auf den seine Leute nun stießen. Vielleicht glaubte er, die Familien mitten beim Feiern niedermetzeln zu können. 96 Die Bauern waren in ihrer Erbitterung über die Hinterhältigkeit der Feinde, den Frieden des Heiligen Abend gestört zu haben, zu jeder Heldentat entschlossen. Das schlecht gerüstete und anfangs recht unbesorgte Fußvolk wurde von einem Hagel aus Steinen und Pfeilen dezimiert. Auch einer der Ritter fiel tot zu Boden. Ein Armbrustbolzen war zwischen den Stäben des Visiers hindurch in seinen Kopf eingedrungen. Der Etter, hinter dem die Verteidiger auf einfachen Gerüsten und Dächern kämpften, wirkte wie eine Mauer. Mehrere Versuche, ihn in Brand zu stecken, schlugen fehl. Er war durch den Schnee viel zu nass, um Feuer zu fangen. Liemar erwies sich als hervorragender Armbrustschütze. Das lag an seiner Geduld. Kaltblütig wartete er vor jedem Schuss auf den richtigen Zeitpunkt. Erst, wenn sich jemand innerhalb seines Bereiches unvorsichtig verhielt, drückte er ab. Manchmal kündigte er seine Taten sogar an. "Seht ihr den mit dem grünen Wams?" rief er. Und während sich alle Köpfe dorthin wandten, durchbohrte ein Bolzen die Brust des Mannes. Doch die Angreifer ließen trotz ihrer Verluste von dem Dorf nicht ab. Sie wollten es nun erst recht einnehmen. Verstärkung traf ein und offenbar wechselte auch der Befehlshaber. Ein Ritter, der sich durch seine fein gearbeitete Rüstung und einen darüber geworfenen, kurzen Umhang von den anderen unterschied, hatte neuerdings das Sagen. Bald munkelte man im Dorf, dass dies der Hauptmann des ganzen Heeres sei. Sogar ein Name ging um Hermann, der leibliche Bruder des Erzbischofs. Die Kinder waren von dem Angriff mitten im Spiel überrascht worden und verstanden nicht, was da plötzlich um sie herum vor sich ging. Jule und Hänschen gerieten auf dem Anger zwischen die Männer, die sich aus dem Magazin Schwerter und Spieße holten. Niemand achtete auf sie, niemand nahm auf sie Rücksicht, niemand beantwortete ihnen ihre Fragen. Wenn sie jemandem im Weg standen, wurden sie barsch angefahren. Sie fühlten, dass sie überall störten. Um herauszubekommen, was diese merkwürdige Wandlung hervorgerufen hatte, liefen sie auf das Ettertor zu. Dort war der Lärm am stärksten. Je näher sie kamen, desto größer wurde ihre Angst. Sie fassten sich bei den Händen. Das half ein bisschen. Sie wollten auch nicht umkehren, weil die Ungewissheit ihnen zusetzte. Plötzlich aber sahen sie etwas, das sie erstarren ließ. Das riesige Tor begann zu schwanken. Dann fiel es um, wie von der Pranke eines Riesen aus der Verankerung gerissen. Zugleich drangen gerüstete Reiter ein. Sie sprengten die Dorfstraße entlang und erschlugen mit ihren Waffen jeden, der sich nicht mehr in Sicherheit bringen konnte. Als Hänschen sich gefasst hatte, rannte er davon und zog Jule hinter sich her. Er kam jedoch nicht weit. Die Zäune der einzelnen Gehöfte waren zu hoch für ein Kind. Ein Tor stand nirgends offen. So holten die Reiter die beiden blitzschnell ein. Todesmutig drückte Hänschen nun seine kleine Schwester in eine Nische und stellte sich schützend vor sie. Kaum einen Schritt entfernt sah er einen Mann in einer besonders hellen Rüstung. Ein Schwert blitzte, doch es traf ihn nicht. Jedenfalls glaubte er das, weil er nichts spürte. Er blickte dem Reiter nach und wunderte sich über dessen Mantel, der völlig überflüssig zu sein schien, weil er von den Schultern hinterher flatterte. Dann erst fiel ihm auf, dass sein Rock vorn ganz feucht geworden war, und 97 bemerkte die Wunde an seinem Hals. In heller Panik rannte er auf sein Haus zu, brach aber schon nach wenigen Schritten zusammen. Jule lief ihm schreiend nach und warf sich über ihn. Dabei besudelte sie sich von Kopf bis Fuß mit Blut. Als zwei Frauen sie in ein Gehöft hinein zogen, glaubten sie zunächst, sie sei ebenfalls tödlich verletzt worden. Tatsächlich fehlte ihr körperlich nichts. Sie wurde jedoch ganz steif und konnte nicht mehr sprechen. Das schreckliche Geschehen auf der Dorfstraße blieb nicht verborgen. Auf geheimnisvolle Weise gelangte die Kunde davon bis zu den Männern, die an verschiedenen Stellen noch immer kämpften. Aus jedem zweiten Haus flogen den Angreifern Pfeile und Armbrustbolzen entgegen. Hinter jeder Biegung lauerte ein Hinterhalt auf sie. Diese ständige Bedrohung hinderte sie sogar daran, Feuer zu legen. Sie fanden einfach keine Zeit dazu. Natürlich hätten die Bauern sich gegen die Übermacht nicht ewig behaupten können. Irgendwann wäre der letzte der mutigen Verteidiger gefallen. Die Ritter hätten schließlich doch noch ein Blutbad angerichtet. Die Schlacht nahm jedoch einen unvorhersehbaren Verlauf. Jörg und Liemar verteidigten verbissen ihren Hof. Sie fochten Seite an Seite und gaben sich dabei gegenseitig Deckung. Verzweifelt spürten sie, wie ihre Kräfte nachließen. Beide waren auch schon verwundet. Als sie sich aber innerlich schon mit dem nahen Tod abzufinden begannen, ließ der Druck plötzlich nach. Aus unbekannter Ursache gerieten die Angreifer in Unruhe. Immer mehr von ihnen zogen sich, anscheinend ohne Not, aus dem Dorf wieder zurück. Wenig später verbreitete sich die glückliche Neuigkeit. Ein Teil des stehenden Heeres der Universitas hatte zufällig in der Nähe gelagert und war herbeigeeilt. Hermanns Streitmacht fand keine Gelegenheit, sich auf die völlig neue Lage einzustellen. Fünf Abteilungen kämpften ohne Verbindung zueinander in verschiedenen Dörfern. Die Stedinger konnten sie nacheinander mit Übermacht angreifen. Ehe den Hauptmann eine erste Meldung erreichte, war eine davon schon niedergehauen. Eine zweite hatte die Flucht ergriffen, ohne einen Befehl abzuwarten. In Neudeich versteifte sich unterdessen der Widerstand der Einwohner. Mit wilder Entschlossenheit traten die Männer aus ihren Verstecken hervor und warfen sich den Feinden erneut entgegen. Schon bald war das Dorf von ihnen gesäubert. Die Schlacht tobte nun auf der Wiese. Dort hatten sich die Reste der verbliebenen drei Abteilungen um Hermann geschart. Die Ritter und ihr Fußvolk kämpften nur noch ums bloße Überleben. Der Rückweg zum Deich hin war ihnen inzwischen abgeschnitten und auf Gnade konnten sie kaum rechnen. Schon nach kurzer Zeit gerieten die mit Mühe aufgebauten Reihen wieder in Unordnung. Diese Leute waren nicht hierher gekommen, um zu sterben. Nur wenige von ihnen glaubten ernsthaft daran, dass Gottes Segen über dem Unternehmen läge. Hermann hatte nicht allzu wählerisch sein können bei der Zusammenstellung des Heeres. So galt schließlich die berüchtigte Parole "Rette sich, wer kann". Sie wirkte umso mehr, als sich der Hauptmann in dieser Hinsicht keineswegs besonders vorbildlich verhielt. Er war es, der einen der ersten schnöden Fluchtversuche einleitete. Eine Verwundung vortäuschend, mogelte er sich durch die Reihen der Stedinger und gab dann seinem Pferd die Sporen. 98 Seine auffällige Rüstung, die er aus Eitelkeit angelegt hatte, ließ ihn aber nicht lange unbemerkt sein. Jörg stieß Liemar an und beide nahmen, ohne ein Wort zu wechseln, die Verfolgung auf. Ihre Ackerpferde waren für einen solchen Galopp nicht gut geeignet. Andererseits hatte das edle Streitross Hermanns viel mehr zu tragen. Auch die Ortskenntnis spielte eine Rolle. Während die beiden Bauern den Wegen folgten, die sie selbst unter der Schneedecke noch ahnten, geriet der flüchtende Hauptmann des Ritterheeres immer wieder in Löcher und Verwehungen hinein. Am Fuße des Deiches kam es zur Begegnung. Hermann sprang vom Pferd, um sich zu Fuß zu retten. Die Böschung erwies sich jedoch als zu steil. Er rutschte ab, verlor das Gleichgewicht und rollte seinen ebenfalls abgestiegenen Verfolgern genau vor die Füße. Weil er, fernab von seinem Heer, keinen anderen Ausweg mehr sah, verlegte er sich aufs Verhandeln. "Ich bin der Bruder des Erzbischofs von Bremen", sagte er. "Um so schlimmer!" entgegnete der Bauer Jörg kalt. "Ich will damit sagen, dass meine Verwandten mich freikaufen werden. Nehmt mich gefangen und fordert ein Lösegeld! Auf diese Weise nutze ich euch am meisten." "Wir wollen dein Geld nicht", wies Liemar das Ansinnen zurück. "Das Blut eines kleinen Jungen schreit nach Rache." Und ohne ihn noch einmal zu Wort kommen zu lassen, stieß er ihm sein Schwert genau in die Lücke zwischen Helm und Brustpanzer. Die kleine Jule war noch immer völlig verstört. Sie redete nicht und niemand wusste, ob sie verstand, was man zu ihr sagte. Zwar hatte sich ihre Verkrampfung inzwischen gelegt, doch dafür wirkte sie nun schlaff und willenlos wie eine Puppe. Ihre Augen waren immerfort starr geradeaus gerichtet. "Sie hat den Verstand verloren", sagte Luise, die sich gemeinsam mit Gudrun um sie kümmerte. "Wir müssen ihr Zeit lassen. Vielleicht erholt sie sich wieder." "Vielleicht! Ich werde sie ins Bett bringen." Beide glaubten nicht so recht daran. Sie wurden aber von ihren traurigen Gedanken abgelenkt, weil Jörg und Liemar eintraten. Die Männer bluteten zwar, doch erwiesen sich die Verletzungen als ungefährlich. Außerdem spürten sie die Schmerzen kaum. Noch immer beherrschte sie die Verbitterung über den feigen Überfall am Heiligen Abend. Selbst das Blut der Feinde hatte sie nicht wirklich beruhigen können. Nur die Hälfte der 220 Panzerreiter war nach der Schlacht noch am Leben. Vom Fußvolk hatte sich nicht einmal jeder Vierte retten können. "Das war trotz allem ein bitterer Sieg", sprach Jörg aus, was alle dachten. Die Bauern waren keine Waffenknechte. Sie kämpften nicht für Sold und Beute. Am nächsten Tag wurden die Toten begraben. Die Bauern taten es ohne Schuldgefühl. Sie warfen die erschlagenen Feinde einfach in eine große Grube, ohne geistlichen Beistand. So war das üblich bei Mördern und anderen Schwerverbrechern. Auch Hermann, dem Bruder des Erzbischofs erging es so. Er hatte geglaubt, der Feldzug werde ihm den Ruhm bringen, ihn womöglich für kurze Zeit aus dem Schatten des übermächtigen Gerhard heraustreten lassen. In Wahrheit endete er ruhmlos, wie es schlimmer hätte nicht kommen können, auf einer Wiese erschlagen wie ein tollwütiger Hund. 99 IV N orbert saß zusammen mit zwei Kameraden aus Bremen an einem kleinen Feuer. Der Abend neigte sich zur Nacht. Die meisten Bewohner der Waldhütte hatten sich schon zum Schlafen niedergelegt. In diesen Tagen herrschte eine niedergedrückte Stimmung. Weihnachten ist ein Familienfest. Besonders die jungen Männer, die vor den Häschern des Erzbischofs geflüchtet waren, erinnerten sich jäh an das, was sie hatten zurücklassen müssen. Sie sahen ihre Eltern und Geschwister vor sich und zergrübelten sich die Köpfe, was wohl aus ihnen allen geworden sein mochte. Die wenigsten hatten in den zurückliegenden Monaten eine halbwegs verlässliche Nachricht aus der Stadt erhalten. Seit fast zwei Wochen nun schon hing jeder so seinen eigenen Gedanken nach. Ruperts Räuber, die schon einige Weihnachtsfeste im Wald erlebt hatten, wollten sich nicht anstecken lassen und stellten zunächst lärmende Fröhlichkeit zur Schau. Doch dann verging auch ihnen nach und nach die gute Laune. Mancher dachte in dieser Zeit wohl insgeheim daran, die Schar zu verlassen und heimzukehren, ganz gleich, welches Schicksal auf ihn wartete. Auch die drei am Feuer waren nicht eben guter Dinge. Schweigend stocherten sie in der Glut und verfolgten wie im Bann das Spiel der Flammen. Als plötzlich jemand an sie herantrat, schreckten sie hoch wie aus tiefem Schlaf. "Was gibt es?" "Da ist ein Mann ... ein Mönch ... er will unseren Hauptmann sprechen." "Ein Mönch?" fragte Norbert verwundert. Einer seiner Kameraden raffte sich zu einem Scherz auf: "Nun ja, wenn er bei uns mitmachen will, soll er uns willkommen sein. Immerhin hätten wir dann jemanden, der uns die Beichte abnehmen kann." Alle lachten, wenn auch nicht wirklich fröhlich. Norbert fragte sich, was dieser Mönch im Schilde führte und wie er zu ihnen gefunden hatte. War das Versteck inzwischen bekannt? Sollte der Fremde es auskundschaften? Der Ankömmling erwies sich als ungewöhnlich großer, breitschultriger Mann. Auch sein schwerer Schritt entsprach nicht den Erwartungen von einem hauptsächlich mit Andachten beschäftigten Menschen. Norberts Misstrauen wuchs, wurde aber dann schlagartig zerstreut. Der angebliche Mönch schlug seine Kapuze zurück - er war in Wirklichkeit Tammo von Huntorf, der Stedingerführer. "Mit jedem hätte ich gerechnet, nur nicht mit dir." "Dabei gehöre ich zu den wenigen Menschen, denen ihr den Weg zu euch beschrieben habt." Beide umarmten sich. "Es gibt sicher einen wichtigen Grund für deinen Besuch. Der Weg hierher ist beschwerlich und nicht ohne Gefahr." Tammo setzte sich ans Feuer und berichtete zunächst mit wenigen Sätzen von Hermanns Überfall. "Wir befürchten, dass der Erzbischof den Tod seines Bruders nicht tatenlos hinnehmen wird", schloss er. "Ich werde in diesen Tagen mit allen unseren Verbündeten reden." "Was genau erwartet ihr von uns?" erkundigte sich Norbert. "Ihr könnt uns nicht helfen, wenn ihr so weit entfernt von unseren Dörfern wohnt. Von jenem Überfall am Heiligen Abend erfahrt ihr erst heute, fünf Tage nachdem wir ihn abgewehrt haben." "Wir sollen zu euch ins Stedingerland ziehen? Wovon leben wir dort? Jetzt ernähren wir uns durch ..." "Wenn ihr zu unserem Heer gehört, geben wir euch alles, was ihr braucht. Auch etliche unserer Bauern können nicht mehr auf dem Feld oder in der Werkstatt arbeiten. So ist das nun einmal in Kriegszeiten." Norbert überlegte laut: "Wir sollen ein Teil eures Heeres werden. Das heißt, wir unterstehen dann dem Befehl eines eurer Hauptleute. Wir müssten uns nach den in eurem Heer geltenden Gesetzen richten." "Ja, das ist alles richtig." Eine längere Pause entstand. Tammo hatte mit Vorbedacht nichts beschönigt. Er wusste, dass nur treue Verbündete etwas taugen. Angesichts der Bedrohung durch die immer stärker werdende Allianz des Erzbischofs war Klarheit vonnöten. "Ich kann leider nicht sagen, ob die Mehrheit von uns das hinnehmen würde. Gegen den Willen der ..." "Ich erwarte weder heute noch morgen eine Antwort. Jeder von euch soll genau wissen, worauf er sich einlässt. Ich bitte dich, mit deinen Leuten ebenso offen zu sein, wie ich es mit dir war." Norbert war erleichtert, nicht nach seiner persönlichen Meinung gefragt worden zu sein. Er hätte dann eingestehen müssen, sich eine Mehrheit für Tammos Forderung kaum vorstellen zu können. Ruperts Räuber würden sich auf jeden Fall dagegen stemmen und von den Bürgerlichen liebten auch die meisten das freie Leben. So weit ging die Sympathie für die Stedinger wohl nicht. Eine Frage Tammos indes riss ihn aus seinen Gedanken. "Bist du jetzt der Hauptmann?" Er verstand nicht, worauf das abzielte und antwortete vorsichtig: "Eine so schwerwiegende Sache wie deine Bitte muss nach unseren Gesetzen erst beraten werden. Ich kann dir also jetzt nur versprechen, dass ich in der Versammlung für deine Vorschläge eintrete." "Daran zweifle ich nicht. Ich will nur wissen, ob ..." Norbert begriff endlich und musste unwillkürlich lachen. "Ach so! Selbstverständlich ist noch immer Franziska der Hauptmann. Allerdings ..." Er nestelte verlegen an seinem Wams und suchte nach den richtigen Worten. "Allerdings ging es ihr vorhin nicht gut." "Sie ist krank?" "Nein, das auch wieder nicht. ... Nun, du hast ein Recht darauf, mit ihr zu reden. Ich schicke jemanden zu ihr. Vielleicht geht es ihr schon wieder besser." Etwas verwundert blickte Tammo dem Boten nach. Norberts Gebaren ergaben für ihn keinen Sinn. "Sie wartet in der Hütte auf euch. Es ist alles in bester Ordnung." Tatsächlich traf Tammo die selbstbewusste Ritterstochter genau so an, wie er sie in Erinnerung behalten hatte, außer dass sie statt des ledernen Wamses ein Kleid trug, das sie weiblicher erscheinen ließ. Dennoch stimmte etwas nicht. Er merkte es am eigenartigen Verhalten der anderen. Jeder im Raum sah ihn an, wartete auf eine Reaktion von ihm. Er kam aber nicht auf die Lösung, so dass ihm Norbert schließlich eine Erklärung geben musste. "Wir denken, das sie ein Kind erwartet. Trotzdem bleibt sie unser Hauptmann. Wir haben sie noch einmal gewählt - einstimmig." 101 "Nun, dann bleibt mir wohl nur, zu gratulieren", sagte Tammo etwas linkisch. Hatte ihm schon die Tatsache, dass überhaupt ein junges Mädchen Hauptmann war, einiges Unbehagen bereitet, war er nun vollkommen verwirrt. Er ahnte, dass Norbert und Franziska nicht einmal in geregelten Verhältnissen lebten. Wer hätte sie hier im Wald trauen und unter Gottes Segen stellen sollen? Immerhin war es nicht seine Aufgabe, über Moral und Sitte zu richten. Die Stedinger brauchten Verbündete und dafür mussten zweifellos noch ganz andere Kompromisse eingegangen werden. Am nächsten Morgen verabschiedete sich Tammo schon zeitig. Danach konnte sich Norbert mit Franziska beraten. "Sollten wir es tun? Ich bin mir da nicht so sicher." "Es hat sich nichts geändert. Uns bleibt keine Wahl." "Und die anderen?" "Wir werden sie überzeugen müssen. Warum begreift ihr das nicht? Die Mühlsteine, die da aneinander reiben, werden von Woche zu Woche größer. Entweder wir schlucken die Kröte oder wir enden so." Sie zerbröselte ein morsches Stück Holz zwischen den Händen zu Staub. "Und unser Kind?" "Was soll sein damit? Es kommt auf die Welt und wir werden es lieben. Hier oder im Land der Stedinger. Ein Dach über dem Kopf finden wir auch dort." 102 9.Kapitel I E rzbischof Gerhard hielt sich (nicht ohne einen Anflug von Eitelkeit) seine gute gesundheitliche Verfassung zugute. Er konnte einen vollen Tag lang im Sattel sitzen und dennoch am Abend einen Gast zum Gespräch empfangen. Bei heiklen Verhandlungen nutzte er das gelegentlich aus. Seine Gegner gaben manchmal ihren Widerstand allein deshalb auf, weil sie sich nach etlichen Stunden einfach nicht mehr auf ihren Stühlen zu halten vermochten. Doch an den vergangenen Tagen hatte Gott ihn belehrt, dass auch seine Kräfte begrenzt waren. Bis Köln war die Reise noch ohne besondere Schwierigkeiten verlaufen. Dort hatte sich Erzbischof Heinrich I von Müllenark dem Zug angeschlossen. Der bestand von nun an aus sieben großen Wagen. Die beiden Fürsten fuhren in einer geräumigen Kutsche, umschwärmt von prächtig gekleideten Reitern, denen man kaum noch ansah, dass sie eigentlich als Waffenknechte vor Überfällen schützen sollten. Aber zwischen Boppart und Bingen, gerade in einem Abschnitt also, wo steile Felsen das Rheintal einengen, verschlechterte sich das Wetter. Ein steifer Wind peitschte Eiskristalle vor sich her. Schneewehen bildeten innerhalb weniger Stunden unüberwindliche Barrieren. Da die Kälte in der Kutsche trotz dicker Decken unerträglich war, entschlossen sich die beiden Erzbischöfe, auf Pferde umzusteigen. Zwischen Worms und Freiburg kam der Zug wieder besser voran. Nun jedoch galt es, die verloren gegangene Zeit aufzuholen, denn niemand wusste, was in den Alpen noch geschehen würde. Tatsächlich schlug das Wetter hinter Innsbruck abermals um, so dass an eine Passage des Brennerpasses nicht zu denken war. In einem wahrhaft infernalischen Schneesturm flüchteten die Reisenden in ein kleines Benediktinerkloster, wo sie völlig erschöpft zwölf Stunden hintereinander ruhten. Auch am nächsten Tag mussten die Fürsten mit ihrem Gefolge noch in der notdürftigen, für die vielen Menschen ziemlich unbequemen Unterkunft ausharren. Gerhard versuchte, die Zeit zu nutzen, sich mit dem Erzbischof von Köln zu verständigen. Heinrich von Müllenark war nach der Ermordung des legendären Engelbert überraschend an die Spitze eines der bedeutendsten Machtzentren des Reiches gelangt und hatte seither manche Schwierigkeit zu bewältigen gehabt. Im Jahre 1226 fing er den Mörder seines Vorgängers, einen Ritter namens Friedrich von Isenberg, und stellte ihn vor Gericht. Bei den Verhandlungen führte aus formalen Gründen der jugendliche König Heinrich, des Kaisers Sohn, den Vorsitz. Da jener Ritter nicht aus eigenem Antrieb gehandelt hatte, kam es zu schweren Tumulten. Beinahe hastig wurde das Todesurteil ausgesprochen und vor den Toren der Stadt vollstreckt. In der durchaus vernünftigen Absicht, die Politik Engelberts fortzusetzen, betrieb der neue Erzbischof dessen Heiligsprechung und schuf sich Feinde. Zeitweilig drohte ihm die Lage völlig zu entgleiten. Der Herzog Walram von Limburg belagerte seine Burg Valdenz bei Herzogenrath. Die Bürger Kölns verbrannten (gewissermaßen vor seinen Augen) alle neuen Urkunden, die ihre Rechte beschnitten. Er musste, um an der Macht zu bleiben, weit zurückweichen. Inzwischen waren die meisten Gesetze aus dem Jahre 1216 wieder gültig. Ob Engelbert noch ein Heiliger werden würde, hatte keine Bedeutung mehr. Die Zeit verwischte die Spuren des großen Mannes. Gerhard hatte freilich wenig Grund zur Schadenfreude und sah in ihm eher einen Schicksalsgefährten. Der Zeitpunkt für eine Verständigung war geeignet. Der Papst hatte die Fürsten des Reiches nach Rom geladen, damit sie dort für den Kaiser bürgten. Nur unter diesen Bedingungen sollte der Friedensvertrag dauerhaft gültig sein. Auseinandersetzungen waren nicht auszuschließen, obgleich kaum jemand das Scheitern der Verhandlungen wünschte. Manch einer gedachte zweifellos, die Reise für ein den Kaiser überhaupt nicht betreffendes Anliegen zu nutzen - wie der Erzbischof von Bremen, der in der Stedingerfrage etwas zu erreichen hoffte. Unübersichtlich war die Lage durch Neuigkeiten über den jungen König Heinrich. Den Erzbischof von Köln beschäftigte das in besonderem Maße, was er beim Abendessen unter vier Augen freimütig eingestand. "Die Bürger haben sich beruhigt. Auch auf die meisten meiner Lehensleute kann ich mich wieder verlassen. Aber wie verhalten sie sich, wenn man sie aufgehetzt? Jeder, der sich mir heute aus Vernunft beugt, kann schon morgen sein Wort wieder brechen. Ich habe in den vergangenen Jahren viel von meinem Glauben an Vasallentreue verloren." "Wie Ihr wisst, bin auch ich auf die Unterstützung meiner Bürger angewiesen. Auch ich wünsche nichts so sehr wie die Unterbindung gewisser Worte und Taten jenes Unwürdigen auf dem deutschen Thron." Sie wussten beide, worüber sie sprachen. Kaiser Friedrich II hatte seinen Sohn schon im Kindesalter zum König von Deutschland wählen und krönen lassen, um sich mehr seinem geliebten Südreich, Sizilien und Apulien, widmen zu können. Der eigentliche Herrscher war damals Herzog Ludwig von Bayern, der Vormund des Knaben. Die Auseinandersetzungen mit dem Papst hatten Friedrich zeitweilig die nördlichen Teile seines Reiches fast völlig aus den Augen verlieren lassen. Ludwig betrieb unterdessen ungestört eigene Politik. So fiel er 1227 unter einem Vorwand in das Herzogtum Braunschweig ein. Doch es kam noch ärger. Im Jahr darauf löste sich der ungestüme, inzwischen 16-jährige König, auf seine Mündigkeit pochend, von Ludwig und setzte sich in den Kopf, die Fürsten des Landes zu unterwerfen. Streng gesehen, begehrte er, was ihm von Rechts wegen auch zustand, verstieß jedoch gegen ungeschriebene Gesetze, die sich aus Machtverhältnissen ergeben hatten. Dass er nicht schon bald scheiterte, lag an der tatkräftigen Unterstützung durch dunkle Kräfte, die sich von Reformen Vorteile versprachen. Im September 1229 war er bereits stark genug, um seinen ehemaligen Vormund in dessen eigenem Herzogtum mit Heeresmacht anzugreifen. Spätestens seit dieser Zeit herrschte helle Aufregung unter den Fürsten. Schwäbische Ministeriale drängten den König zur Entschlossenheit. Bedrohlich war die Entwicklung vor allem wegen der Gefahr eines durch den Herrscher befürworteten Zusammenschlusses der niederen Stände. Einen allgemeinen Aufstand mussten selbst mächtige 104 Fürsten wie Gerhard und Heinrich von Müllenark ernsthaft fürchten. "Ich denke, dass nur ein Machtwort des Kaisers diesen wilden Burschen zügeln kann", meinte Letzterer. "Ein kaiserlicher Schiedsspruch würde Heinrich die Berechtigung für sein Handeln entziehen", bestätigte der Erzbischof von Bremen mit Nachdruck. "Einige seiner Verbündeten bekämen Skrupel und wir hätte die Möglichkeit, notfalls mit Gewalt vorzugehen." Am dritten Tag ließ der Schneesturm endlich nach. Die beiden Fürsten waren aber auch deshalb guter Stimmung, weil sie sich auf einen gemeinsamen Standpunkt hatten verständigen können. Nicht oft rückten zwei deutsche Adlige ihres Ranges die eigenen Interessen so sehr in den Hintergrund, um ein gemeinsames, größeres Ziel zu erreichen. In ihrem Gepäck lag nunmehr ein Text über den gewünschten Wortlaut der kaiserlichen Erklärung gegen den widerspenstigen Sohn. Die beiden Erzbischöfe hatten sich schließlich eine Strategie überlegt, um sich geschickt den Ball gegenseitig zuzuspielen. II D ie Verhandlungen in Rom verliefen günstig für die deutschen Fürsten - zum Teil weil sie so einheitlich auftraten wie lange nicht mehr, zum Teil wegen des geringen Interesses Friedrichs an seinem Nordreich. Von Sizilien oder Apulien hätte er nichts ohne zähen Kampf preisgegeben, in Deutschland sollte einfach nur Ruhe herrschen. Über seinen Sohn war er auch vor den Beschwerden schon verärgert gewesen. Dessen Politik hatte er niemals gutgeheißen, obgleich sie (einen Erfolg vorausgesetzt) der stauferschen Hausmacht nutzte. Gerhard gab die schnelle Einigung zu den Grundsatzfragen die Möglichkeit, sich mit ganzer Kraft seinen persönlichen Angelegenheiten zu widmen. Zunächst bemühte er sich um ein Treffen mit dem Kaiser. Der freilich wollte aus Sorge um das Zustandekommen des Friedensvertrages nicht durch Separatverhandlungen mit einzelnen Fürsten das Misstrauen der anderen erregen. Einen Grund, sich mit dem Bremer Erzbischof in besonderem Maße zu arrangieren, sah er nicht gegeben. Erst, als die Bürgschaft als sicher galt, wurde er zugänglicher und seine (reichlich bestochenen) Ratgeber konnten seine Aufmerksamkeit auf den Kirchenmann von der fernen Nordseeküste lenken. Gerhar d hatte den Kaiser seit einigen Jahren nicht mehr gesehen und war schwanke nd in seinen Erwartungen. Was ihm an vertraulichen Hinweisen mit auf den Weg gegeben worden war, erschien ihm zu widersprüchlich, als dass er es glauben mochte. Nun, da ein Diener ihn in einen mit farbenfrohen Teppichen ausstaffierten Raum führte und er vor den behelfsmäßig aufgebauten Thron des römisch-deutschen Herrschers trat, begann er die Ursache der sonderbaren Reden zu ahnen. Friedrich passte in 105 keine der gängigen Vorstellungen hinein. Die Stirn wurde eingerahmt von kurzem, welligem Haar. Die Frisur erinnerte an die heidnischen Figuren, welche man in Rom noch an etlichen Stellen fand, Figuren, die von längst vergangenen, geheimnisvollen Zeiten kündeten, die den Leuten unheimlich waren. In den Augen des Kaiser spiegelte sich jene Entschlossenheit, die ihn als Knabe sein Geschick in die eigenen Hände hatte nehmen lassen. Daran erkannte man den jungen Mann wieder, der 1212 zur Überraschung aller plötzlich nördlich der Alpen erschien, seinen welfischen Rivalen Otto vertrieb und den Thronstreit beendete. Das fein geformte Bärtchen über den Lippen jedoch widersprach jenem Eindruck. Auch der vom gleichnamigen Großvater geerbte rote Bart wirkte auffällig gepflegt. Gerhard begriff, was diesen Mann von seinen Vorgängern unterschied. Vier Jahrhunderte enger Beziehungen hatten die Kluft zwischen Orient und Okzident nicht verringert. Noch immer stach die raue Lebensart des Nordens ab gegen die verfeinerten Sitten des Südens. Die Griechin Theophanu hatte sich in jener Zeit, als sie auf dem deutschen Thron saß, an die Gepflogenheiten des Norden angepasst und damit durchgesetzt. Friedrich hingegen, der Spross der schwäbischen Hohenstaufen, aufgewachsen in Sizilien inmitten eines moslemisch geprägten Hofes, entschied sich zunehmend für den Süden als Wahlheimat. Er, der ein wirklich erstaunliches Talent beim Erlernen fremder Sprachen besaß, tat sich noch immer schwer mit den Worten seiner barbarischen Untertanen von jenseits der Alpen. Unter solchen Umständen fiel es dem Bremer Erzbischof schwer, den für sein Anliegen günstigsten Anfang zu finden. Wie sollte er diesen sonderbaren Menschen beeindrucken, wie ihn für sich gewinnen? Unabhängig davon empörte ihn die geheime Verachtung, die er spürte. Entsprechend hölzern fiel seine Rede aus. "Ich wage in aller Bescheidenheit zu unterstellen, dass Eurer Majestät an Frieden in den deutschen Landen gelegen ist. Ihr wisst zweifellos, wie die Unruhestifter beständig auf Gelegenheiten lauern, ihre Schlupflöcher verlassen zu können." Gerhard bemerkte, wie der Kaiser unruhig am Saum seines Umhangs zupfte. Er mochte wohl keine langen Vorreden. "Kurz gesagt, in der Umgebung von Bremen hat sich eine üble Ketzerbewegung eingenistet. Bewaffnete Bauern machen die Gegend unsicher. Sie sind inzwischen so stark, dass ich allein ihnen mit meinen bescheidenen Mittel nicht mehr beikommen kann. Deshalb ersuche ich Euch, kaiserliche Majestät, die Reichsacht zu verhängen, auf das alle Herren des Landes ermutigt werden, mir in meinem Kampf beizustehen." Des Kaisers Gesicht belebte sich. Zweifellos wusste er Bescheid, erinnerte sich wohl auch noch, dass die Stedinger ihm für den Kreuzzug Waffen geschenkt hatten. Nach einem Moment angestrengten Nachdenkens stand er plötzlich mit erstaunlicher Behändigkeit von seinem Thron auf und sagte: "Nach meinem Dafürhalten sind diese Bauern fleißige Leute, die vor allem wünschen, in Frieden gelassen zu werden." Er sprach die einzelnen Worte mit starkem Akzent aus, verstand sich aber auszudrücken. "Sie kämpfen für ihre Sache mit dem Schwert, weil sie sich auf kein brauchbares Gesetz berufen können. Einheitliches Recht ist vonnöten." Er blickte kein einziges Mal zu seinem Gast hinüber, denn er hatte 106 wenig Hoffnung, verstanden zu werden. "Die Bauern sollten ebenso wie die Bürger genau festgelegte Abgaben entrichten. Die Grafen und Herzöge sollten Amtleute ohne Vorrechte sein. Während die einen den Acker bestellen, obliegt den anderen die Verwaltung. Auch die Geistlichen müssen in einer solchen Gesellschaft ohne Eigennutz den ihnen entsprechenden Platz einnehmen." In der Tat hätte ihm Gerhards Mienenspiel wenig Freude bereitet. Der Erzbischof schwankte, ob er den Kaiser für krank halten oder seine widersinnige Rede als eine Art Verhöhnung auffassen sollte. Wahrscheinlich spielte der verderbliche Einfluss des Hermann von Salza noch immer eine große Rolle am Hof des Herrschers. Mit Sicherheit ließ sich keine Reichsacht gegen die Stedinger erwirken, nicht solange dieser verkappte Muselman darüber zu befinden hatte. Als sich die beiden Männer voneinander verabschiedeten, war die gegenseitige Abneigung so ausgeprägt, dass die unvermeidlichen Höflichkeitsgesten kaum über eine bloße Andeutung hinaus kamen. Der völlige Misserfolg beim Kaiser zwang Gerhard, während der Audienz beim Papst drängender vorzugehen, als er es geplant hatte. Gregor IX unterschied sich von Friedrich II so augenfällig, dass die Feindschaft der beiden verständlich war. Der 60-jährige verabscheute alles, was dem entgegenstand, was er für den rechtmäßigen Glauben ansah. Nicht zuletzt durch diesen Starrsinn wirkte er mitunter wie ein Greis. Der erste Eindruck freilich entsprach nicht ganz der Wahrheit. Gregor war geistig beweglich und stand bestimmten Neuerungen durchaus aufgeschlossen gegenüber. Als Kardinal hatte er sich mit Nachdruck für die Bettelorden eingesetzt. Die Dominikaner kämpften seinerzeit ganz vorn in der geistigen Auseinandersetzung mit den Ketzern im südlichen Frankreich. Die Franziskaner boten den nach urchristlicher Armut verlangenden Menschen eine Heimat im Schoße der katholischen Kirche. Was schließlich die weltliche Seite seines Pontifikats angeht, so hatte sich der ehemalige Graf Ugolino von Segni mehr als einmal als ein mit allen Wassern gewaschener Stratege erwiesen. Gerhard glaubte, der Papst spiele eine gewisse Hinfälligkeit vor, um seine Gesprächspartner in Sicherheit zu wiegen. Er stand, wenn auch unter anderen Voraussetzungen, abermals vor der Schwierigkeit, auf bloße Vermutungen hin die richtigen Worte finden zu müssen. Gregor saß nahezu unbeweglich auf einem betont schlichten Stuhl und hielt den Kopf gesenkt wie bei einem Gebet. Sein Gesicht drückte Müdigkeit aus. Die Hände lagen schlaff auf den Knien. "Dass ich Eure Heiligkeit zu behelligen wage, ist begründet in meiner Ratlosigkeit. Da ich bei einigen Eurer Botschaften die Absicht nicht bis in die letzte Einzelheit verstanden habe, andererseits aber Bedarf zum unverzüglichen Handeln zu erkennen meine, bitte ich Euch hier und heute in aller Demut um Auskunft." Dann beschrieb er die Lage im Wesermarschland aus seiner Sicht. Zunächst begnügte er sich mit Andeutungen. Da der Papst jedoch nicht erkennen ließ, dass ihm der Sachverhalt in Erinnerung geriet, wurde er ausführlicher. Zugleich wuchs seine innere Unruhe. Konnte es denn sein, dass Gregor, auf dessen Entscheidung er so ungeduldig wartete, nicht einmal genau Bescheid wusste, dass er der Sache gar keine Bedeutung beimaß? Er erkühnte sich zu einer Anspielung. "Vermutlich ermüde ich Euch mit der Weitschweifigkeit meiner 107 Ausführungen, da Ihr zweifellos durch Euren Großinquisitor Konrad von Marburg bestens unterrichtet seid." Der Papst nahm das zum Anlass, um das Wort zu ergreifen. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass ein ausführliches Gutachten vorlag, sondern auch, dass sich Gregor längst eine eigene Meinung gebildet hatte. "Auch ich bin der Auffassung, dass Ketzerei bekämpft werden muss, wo auch immer sie auftritt. Deshalb befürworte ich ausdrücklich alle Maßnahmen, welche der Zügelung jener aufrührerischer Bauern dienen." "Ähnlich äußerte sich Eure Heiligkeit bereits in einem Schreiben, jedoch ..." Der Papst brachte Gerhard mit einer Handbewegung zum Schweigen. "Ich weiß, worauf du hinaus willst, mein Sohn. Du begehrst einen Ketzerkreuzzug. Bedenke aber, dass dies das äußerste Mittel ist! Jeder Handwerker weiß, dass nicht immer das grobe Gerät der Arbeit am besten dient. Im Gegenteil, fast immer führt Fingerspitzengefühl weit eher zum Ziel." "Diese Bauern sind reichlich bewaffnet, sie ..." "Ich weiß auch das. Immerhin wurde mein Großinquisitor durch eine Belagerung Bremens an der Weiterreise gehindert. Dennoch bleibe ich bei meinem Rat. Ich ersuche dich, alles dir Mögliche auszuschöpfen, ehe du mich noch einmal wegen jenes äußersten Mittels ansprichst. Es ist verständlich, dass dir deine Schwierigkeiten groß, vielleicht nahezu unüberwindlich erscheinen. Ein Papst jedoch muss das Wohl der ganzen Christenheit im Sinn haben. Wird das scharfe Schwert eines Kreuzzuges gar zu oft benutzt, so könnte es stumpf sein in einem entscheidenden Moment." Gerhard wollte noch etwas einwerfen, doch Gregor erklärte die Audienz für beendet. Der Erzbischof musste seine ganze Selbstbeherrschung aufbringen, um sich in seiner Enttäuschung nicht zu einer Unbesonnenheit hinreißen zu lassen. Schon am nächsten Tag reiste er aus Rom ab. III D ie Fahrt von Rom nach Bremen war für Gerhard ähnlich beschwerlich wie jene fünf Wochen zuvor in die entgegen gesetzte Richtung. Die Strapazen setzten ihm diesmal sogar noch mehr zu, weil seine Stimmung sich arg verschlechtert hatte. Vielleicht war er von allen Fürsten, die für Friedrich bürgten, der einzige, der gänzlich unzufrieden über die Alpen zurück nach Deutschland reiste. Andererseits gehörte er nicht zu jenen Leuten, die sich von solchen Niederlagen von ihrem Weg abbringen ließen. Selten hatte er so angestrengt nachgedacht wie während der vielen Stunden, die er eingezwängt in seiner ungefederten Kutsche zubringen musste. Er war derart mit seinen Plänen beschäftigt, dass er schließlich die Schmerzen, welche die unruhige Fahrt ihm bereitete, kaum noch spürte. Allerdings blieben seine Pläne nicht unbeeinflusst von der Verbitterung, die ihn beherrschte. Die Zurückhaltung der Oldenburger brachte ihn in Zorn. Bisher hatte er bei allem, was er im Zusammenhang mit den Stedingern unternahm, auf ihre Empfindlichkeiten Rücksicht genommen. Unter bestimmten Umständen wäre er sogar bereit 108 gewesen, ihnen die militärische Führung zu überlassen, ungeachtet des den Wildeshausenern gegebenen Versprechens. Christian jedoch hatte mit seinem Taktieren eine Grenze überschritten. Der Erzbischof war entschlossen, sich nun offen zu Burchard zu bekennen. Nicht allein, dass er keine Rücksicht mehr walten lassen wollte gegenüber den Oldenburgern, er plante sogar, sie bewusst zu demütigen. Allerdings musste er sich angesichts eines so schwerwiegenden Entschlusses rückversichern. Er hatte die Zustände am Wildeshausener Hof in den zurückliegenden Monaten etwas aus den Augen verloren. Zwar erhielt er regelmäßig Berichte, doch ersetzten diese nicht den eigenen Eindruck. Zunächst beabsichtigte er, sich in Bremen zwei bis drei Tage lang von der Reise auszuruhen und danach einen harmlos klingenden Vorwand zu erfinden, um Burchard einen Besuch abzustatten. Je näher er der Heimat jedoch kam, desto größer wurde seine Ungeduld. Ihm schien plötzlich, als könnten die zwei oder drei verlorenen Tage für den Ausgang des Unternehmens wichtig sein. Hatte er die weite Reise nach Rom und zurück überstanden, so konnte er sich getrost auch noch eine Unterredung zumuten! Zu bedenken blieb freilich noch, dass ein Besuch in Wildeshausen unmittelbar nach einer Romfahrt Burchard in solchem Maß aufwerten würde, wie es trotz allem nicht gut sein konnte. Gerhard verfiel schließlich auf den abenteuerlichen Ausweg, sich als Kaufmann zu verkleiden und seine Leute ohne ihn nach Bremen weiter fahren zu lassen. Im Palast sollte dann der Eindruck erweckt werden, er sei angekommen. Der Graf von Wildeshausen war an jenem Tage schlecht gestimmt und deshalb überhaupt nicht bereit, einen ihm unbekannten Händler persönlich zu empfangen. "Er möge sich bis morgen gedulden", sagte er schroff zu dem Diener, der ihn meldete. Das brachte den Erzbischof in Verlegenheit. Gäbe er sich zu erkennen, wäre er in kürzester Zeit Gesprächsthema in der ganzen Burg. In diesem Fall hätte er sich gar nicht erst zu verkleiden brauchen. Er musste sich den Zugang auf andere Weise erzwingen. "Ich bin nicht hier, um etwas zu verkaufen. Vielmehr habe ich den Auftrag, eine Botschaft zu überbringen, eine Botschaft von großer Wichtigkeit, die keinen Aufschub erlaubt. Richte das dem Grafen so aus!" Unwirsch ließ Burchard den Gast daraufhin vor. "Ich hoffe sehr, du hast nicht geflunkert!" rief er statt einer Begrüßung unhöflich. Kaum aber hatte sich der Diener entfernt, legte Gerhard die Verkleidung ab und gebärdete sich ganz als der mächtige Kirchenfürst, der er war. Burchard unterdessen bereute seine Grobheit und überschlug sich mit Demutsbekundungen. "Wenn Eure Eminenz sich setzen wollen. Ich werde umgehend Wein heraufbringen lassen. Untröstlich bin ich, dass kein Braten bereit steht." "Mich gelüstet keineswegs nach sinnlichen Annehmlichkeiten", unterbrach ihn der Erzbischof. "Selbstverständlich! Wie konnte ich Euch nur dergleichen unterstellen!" "Du erinnerst dich unseres Gespräches über die Stedinger?" kam Gerhard geradewegs zur Sache. "Als ob es gestern gewesen wäre." "Und?" Etwas verwirrt suchte der Graf nach der erwarteten Antwort: 109 "Ich stehe Euch, Eminenz, zur Verfügung, welchen Dienst auch immer Ihr von mir begehrt. Ich weiß sehr wohl, was Vasallenpflicht bedeutet." "Bist du bereit, einen Kreuzzug gegen die Stedinger anzuführen?" Burchard zuckte zusammen. Natürlich wusste er, dass er seit einiger Zeit als aussichtsreicher Anwärter für diese Würde gehandelt wurde. Sein krankhafter Ehrgeiz hatte ihn fast irrewerden lassen bei dem Gedanken an den Triumph über die Oldenburger. Nun aber sprach der Erzbischof das Unglaubliche unmissverständlich aus und das brachte ihn aus der Fassung. Unterdessen umspielte Gerhards Mund ein Lächeln. Er hatte es darauf angelegt, den Grafen so zu überrumpeln. "Überlege es dir gut! Du wirst nicht umkehren können, wenn du diesen Weg erst einmal eingeschlagen hast." Burchard fasste sich und verkündete feierlich: "Ich bin bereit." "Ich habe für diesen Fall eine Urkunde vorbereitet. Sie soll vorläufig geheim bleiben. Ich möchte aber, dass du dich darin schon heute verbindlich verpflichtest." Der Graf nahm das Schreiben in die Hand. Es berief sich auf den Willen des Papstes und es war die Rede von einem dem Palästinakreuzzug gleichgestellten Unternehmen. "So deutlich hat der Heilige Vater sich ausgesprochen?" Gerhard erwog, inwieweit er Burchard gegenüber ehrlich sein durfte. "Wie ich schon andeutete - ich werde die Urkunde bis auf weiteres unter Verschluss halten. Sie greift den Ereignissen gewissermaßen vor. Der Heilige Vater ist mit meinem Vorgehen vollkommen einverstanden." Schon wollte der Graf unterzeichnen und siegeln, da stieß er auf eine Klausel, die zu seinem Bedauern nicht allein von seinem Willen abhing. Sie betraf seinen Sohn Heinrich. Der Erzbischof bemerkte das Zögern und fragte nach. Die Kluft zwischen Vater und Sohn hatte sich weiter vertieft. Heinrich wollte die Burg wieder einmal verlassen, diesmal für unbestimmte Zeit und mit unbestimmtem Ziel. Sein Gepäck war schon gebündelt. Er hatte auch erklärt, sich an einem Feldzug gegen die Stedinger nicht zu beteiligen, wann und unter welchen Bedingungen auch immer er stattfände. Zu Burchards Überraschung nahm Gerhard das Geständnis aber gelassen hin. Der Erzbischof bot sich an, dem jungen Mann ins Gewissen zu reden, und hatte keine Zweifel, dabei das Gewünschte zu bewirken. "Unerfahrene, junge Leute wie er können noch nicht immer das Unwichtige vom Wichtigen unterscheiden. Daran ist nichts Besorgniserregendes. Das Beste wird sein, du lässt ihn gleich rufen." Boleke wusste nicht, wo er suchen sollte. Heinrich hielt sich wahrscheinlich noch in der Burg auf, hatte sich jedoch zurückgezogen, in einem seiner Anfälle von Schwermut sogar regelrecht versteckt. Der Diener war mit dem jungen Turnierhelden, der sich in der Öffentlichkeit hochfahren und unnahbar zu gebärden pflegte, niemals vertraut geworden. Dennoch bedauerte er ihn. Er überlegte einen Augenblick, ob er ihn überhaupt benachrichtigen sollte. Die Unterredung mit dem Erzbischof würde ihm in seinem Zustand wohl nicht gefallen. Doch das waren Rücksichtnahmen, die einem Knecht nicht zustanden. In der Vorburg traf er Agnes von Westerholt. Das brachte ihn auf einen Gedanken. Das junge Mädchen hatte gewiss schon vor ihm nach dem Verschwundenen gesucht und zwar mit der unbändigen Energie eines verliebten 110 Backfischs. Leider war Agnes nicht allein. Wilbrand, der geistig zurückgebliebene zweite Sohn des Grafen, lief ihr wie ein Hund nach, unbeeindruckt von ihrer schroffen Abwehr. Vor Aufregung hatte er einen ganz roten Kopf. "Mein Vater will mich verheiraten", verkündete er. "Er meint, ich bin nun in einem Alter, wo so etwas sein muss. Natürlich darf ich nicht so hohe Ansprüche stellen." Er kicherte verlegen. "Ich weiß schon, was er damit meint." Boleke entschloss sich, den gutmütigen Schwachkopf beiseite zu schieben, wie es alle taten, obgleich ihm das eigentlich nicht behagte. "Agnes, ich brauche deine Hilfe." "Aber gern! Hörst du Wilbrand? Verschwinde! Ich muss arbeiten und kann mich nicht mit dir unterhalten." Das sah er ein und trollte sich. "Er ist schrecklich!" ereiferte sich das Mädchen. "Ich glaube, ich bringe ihn eines Tages um, wenn er mich nicht in Ruhe lässt." "So etwas sagt man nicht." "Es ist aber ehrlich." Boleke war nicht zu Moralpredigten aufgelegt und wechselte das Thema. "Kannst du mir sagen, wo sich Heinrich versteckt?" Agnes blickte ihm misstrauisch ins Gesicht. "Welchen Heinrich meinst du?" "Wen werde ich wohl meinen?!" In die Stirn der jungen Ritterstochter gruben sich zwei Falten. "Er hat sich nicht versteckt!" sagte sie angriffslustig. "Er hat es nicht nötig, sich zu verstecken. Wenn er sich zurückzieht, gibt es dafür Gründe. Das ... das sind geheime Angelegenheiten." "Und wo betreibt er gerade diese geheimen Angelegenheiten?" Agnes fühlte sich nicht ernst genommen und entgegnete spitz: "Er wünscht nicht gestört zu werden." Sie konnte schnippisch sein wie eine Prinzessin. Boleke wusste nicht recht, ob sie etwas wusste oder sich nur aufspielte. Auf jeden Fall musste er sich etwas einfallen lassen, um sie zum Reden zu bringen. "Ich soll ihm eine Botschaft überbringen. Sie ist versiegelt." Agnes hob den Kopf mit einem Ruck. "Sie ist bestimmt wichtig! Ich führe dich zu ihm!" Im letzten Moment allerdings zögerte sie. "Geh bitte allein zu ihm rein! Vielleicht ist es ihm nicht recht, dass ich ..." Sie wurde feuerrot vor Verlegenheit und rannte davon. Während Heinrich von Wildeshausen dem Erzbischof gegenüber saß, war nichts von einem Schwermutsanfall zu sehen. Vor allem Burchard wunderte sich. Entweder er hatte sich tatsächlich erholt oder aber er verstellte sich auf gekonnte Weise. Im Übrigen stritt er schlankweg ab, sich jemals gegen einen Feldzug wider die Stedinger ausgesprochen zu haben. "Wie konntet Ihr daran zweifeln, dass ich Euch zu Diensten stehe, sobald Ihr meiner bedürft? Wenn Ihr, Eminenz, meinen Vater zum militärischen Führer zu berufen geruht, unterwerfe ich mich selbstverständlich seinem Befehl." "Nichts anderes habe ich erwartet!" rief Gerhard begeistert. Dabei warf er einen Seitenblick zum Grafen hinüber. Dieser hatte inzwischen den Verdacht, sein Sohn treibe ein böses Spiel. In gewisser Weise schwärzte er ihn an, denn der Erzbischof musste nun annehmen, dass entweder Burchard sich die Zerwürfnisse nur einbilde oder dass er der Schuldige dabei sei. Und Heinrich trieb es auf die Spitze, indem er sich mit 111 der Faust an die Brust schlug und ausrief: "Eure Sache, Eminenz, sei auch die meine und ich will mein Leben nicht schonen!" Gerhard sah nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen erstmals wieder einen Fortschritt bei seiner Sache. Vermutlich wäre seine Zuversicht aber ein wenig gedämpft worden, hätte er Heinrich so gesehen wie der Diener Boleke unmittelbar nach der Unterredung. Seine Augen blickten in eine unbestimmte Ferne und den Mund verzerrte ein zynisches Lächeln. Dies war gewiss nicht das Gesicht eines Mannes, der vom Glauben an eine heilige Bestimmung erfüllt ist. Freilich hatte auch Burchard unrecht mit seiner Unterstellung. Heinrich hegte keineswegs die Absicht, seinem Vater zu schaden. Er war tatsächlich über Nacht zu dem Entschluss gelangt, in den Krieg zu ziehen - aus Todessehnsucht. 112 10.Kapitel I W ilhelm von Westerholt schreckte hoch, als die Zugbrücke unter den Hufen eines Pferdes krachte. Wer galoppiert denn am frühen Morgen auf den Hof, als wäre ein Rudel Wölfe hinter ihm her? Besorgt trat er an das schmale Fenster des Wohnturms der Wardenburg und sah, wie sein Sohn Rotbert mit Schwung vom Pferd sprang. Gleich darauf hörte er ihn die Treppe hinauf eilen. "Was ist geschehen?" fragte er ihn, als er vor ihm stand. "Nichts." Der Junge zuckte verständnislos mit den Schultern. Er war zwölf Jahre alt, wirkte aber ungewöhnlich reif, fast schon ein wenig männlich, wenn auch auf etwas sonderbare Art. Seine drahtigen, tiefschwarzen Haare, die sich zu keiner Frisur ordnen ließen, das stark gebräunte Gesicht und vor allem die funkelnden Augen gaben ihm einen Ausdruck von Wildheit, der seinem Wesen auch tatsächlich entsprach. Er trug immer lederne Kleidung, als wolle er in den Krieg ziehen und verabscheute jede Art von Behaglichkeit. Wenn seine Eltern es ihm erlaubten, schlief er unter freiem Himmel, um sich abzuhärten. "Warum reistest du wie der Teufel, wenn nichts geschehen ist? Du machst die Tiere in den Ställen scheu!" "Ich bin vom alten Westerholthof bis hierher im Galopp geritten. Das ist großartig. Als ob man fliegt." "Ein Pferd ohne Sinn und Verstand so zu hetzen! Rotbert, Rotbert! Wie soll das enden, wenn du so wild bleibst?! Hast du wenigstens nicht vergessen, meinen Auftrag zu erfüllen?" "Was denkt Ihr von mir, Vater!" erwiderte der Junge gekränkt. "Ich bin ein Ritter. Selbst wenn sich mir der Teufel in den Weg stellte, würde ich meine Pflicht erfüllen." "Du bist noch kein Ritter", belehrte ihn der Vater. "Du musst noch sehr viel lernen, bis du so etwas von dir sagen darfst. Dein Meister ist nicht zufrieden mit dir. Du hältst deinen Schild nicht richtig, obgleich er dir schon oft gezeigt hat, wie man es macht." "Warum verrät er immer gleich alles?" "Weil du offenbar auf ihn nicht hören willst." "Er will mich zur Feigheit erziehen." "Schluss jetzt! Ich werde mich nach der nächsten Übungsstunde erkundigen. Wenn ich höre, dass du dich nicht gebessert hast, belehre ich dich eigenhändig mit dem Stock. Hast du mich verstanden?" "Jawohl!" rief der Junge zackig und stapfte die Treppe wieder hinunter. Wilhelm blickte ihm nach, wie er den Hof überquerte. Der Stock war keine ernsthafte Drohung. Wurde er verprügelt, konnte er beweisen, dass er Züchtigungen ohne einen Schmerzenslaut aushielt. Tief im Herzen war Wilhelm doch stolz auf sein jüngstes Kind, das einzige, das er noch bei sich hatte. Nachdem er sich seinen Gürtel umgebunden hatte, ging er ebenfalls nach unten. Der Vormittag verging wie hunderte zuvor. Das bäuerliche Leben auf der Burg des Ritters war geprägt von der gleichförmigen Wiederkehr derselben Arbeitsgänge. Da die Sonne brannte, mochte niemand viel reden. In der Luft lag ein fast monotones Hämmern und Schaben, vermischt mit den Lauten der verschiedenen Tiere. Dadurch wirkte es wie Lärm, als abermals jemand in Eile über die Zugbrücke ritt. Diesmal handelte es sich nicht um einen übermütigen Jungen. Ein Mann meldete aufgeregt: "Bewaffnete nähern sich!" Sofort herrschte helle Aufregung auf dem Hof. "Die Leute auf den Wiesen sollen hereinkommen!" rief Wilhelm. "Und dann schließt das Tor!" Anschließend eilte er zur Plattform des Turmes hinauf. Von dort aus fand er die Warnung bestätigt. Ein Trupp von etwa zehn Reitern war nur noch wenige Meilen entfernt. Einer der Männer trug eine vollständige Rüstung. Die Begleiter waren durch Lederwämser und einzelne Panzerteile geschützt. Alle hatten Spieße und Schwerter bei sich. Wilhelm hoffte zunächst, die Fremden würden weiterziehen. In Wahrheit aber blieben sie vor der geschlossenen Zugbrücke stehen, und der Hauptmann forderte mit herrischer Stimme Einlass. "Ihr gleicht nicht friedlichen Wanderern!" entgegnete Wilhelm vom Turm herab. "Warum sollten wir euch vertrauen?" "Ich bin ein Ministeriale des Grafen Burchard von Wildeshausen. Diese Burg ist ab sofort ein Stützpunkt für den Kreuzzug gegen die Stedinger." "Die höheren Dienstleute des Grafen kenne ich. Dich habe ich noch nie gesehen. Ich glaube dir kein Wort." "Ich stehe erst seit zwei Wochen in Burchards Diensten." Die Reiter wirkten in der Tat wie Männer, die gerade erst geworben worden waren. Der Hauptmann hatte wohl schon in anderen Heeren gedient, seine Leute hingegen konnten kaum die Waffen ordentlich halten. Vielleicht plante Burchard, sie in der Wardenburg ausbilden zu lassen. Doch er hätte ihn unterrichten müssen. Dass Wilhelm hart blieb, half ihm freilich kaum weiter. Die Fremden richteten sich auf der Wiese vor der Zugbrücke ein und belagerten die Burg regelrecht. Am späten Nachmittag spitzte sich die Lage weiter zu. Der Hauptmann brüllte, man solle ihm und seinen Leuten Bier, Brot und Braten bringen. Andernfalls würden sie sich selber besorgen, was sie brauchten. "Ich soll diese Räuber beköstigen?!", rief der Ritter, außer sich vor Zorn. "Damit sie sich wohl fühlen und uns womöglich wochenlang belästigen?!" Seine Frau indes warnte: "Wenn der Hunger sie zwickt, machen sie ihre Drohung wahr. Gib ihnen lieber freiwillig etwas zum essen!" Am nächsten Tag verkaufte den Halunken jemand leichtfertiger Weise ein Fass Wein - ein vermeintlich gutes Geschäft mit unschönen Folgen. Am Abend waren die angehenden Waffenknechte sternhagelvoll und pöbelten die Bauern an, die ahnungslos mit ihren Wagen an der verschlossenen Zugbrücke erschienen. Einige versuchten gar, sich mit Gewalt Einlass in die Burg zu verschaffen. Schließlich nahmen sie einen vierzehnjährigen Jungen als Geisel. "Wir wollen noch mehr Wein. Und wir wollen nicht wieder ein so ekelhaftes Gesöff. Erzählt uns nicht, dass ihr keinen besseren in eurem Keller habt!" Wilhelm stellte sich selbst auf die Mauer und forderte gebieterisch: "Lasst den Jungen frei!" Die Hoffnung, seine Persönlichkeit allein werde die rauen Gesellen zum Einlenken bringen, erfüllte sich nicht. Einer bedrohte das Kind mit einem Messer, während der Hauptmann tat, als ginge ihn das alles nichts an. 114 "Entweder ihr gebt den Jungen frei, oder ich lasse euch alle niederhauen!" rief der Ritter. "Versuche es doch! Ich wette, dass du zu feige bist." Wilhelm indes meinte seine Drohung ernst, denn er wusste keinen anderen Rat mehr. Auf dem Hof befahl er ein paar Männern, die Waffen zu ergreifen, und vielleicht wäre es tatsächlich zum Äußersten gekommen, hätte der Hauptmann nicht geahnt, was sich da zusammenbraute. Auf die Kampfkraft seiner Leute vertraute er nicht sonderlich. Der Junge kam frei und ein Zusammenstoß war fürs erste abgewendet. Einen weiteren Tag später tauchte der Bremer Dompriester auf, der einer geheimen Mission wegen in der Gegend weilte. Wie er vom Streit vor der Wardenburg erfahren hatte, blieb rätselhaft. Er wusste erstaunlich gut Bescheid und besaß eine allgemein formulierte Vollmacht des Erzbischofs, als Unterhändler zu wirken. Wilhelm fand, dass er sich sehr anmaßend benahm. "Warum heißt du diese Männer in deiner Burg nicht willkommen?" "Weil ich sie für Strauchdiebe halte." "Haben sie dir nicht gesagt, welchem Befehl sie folgen?" "Leuten, die ich für Strauchdiebe halte, glaube ich nicht, was sie sagen." "Dann sage ich dir jetzt, dass sie wahrhaftig Gefolgsleute des Grafen von Wildeshausen sind und dass sie auf deiner Burg auf den Kreuzzug wider die Stedinger vorbereitet werden sollen." Wilhelm ließ sich durch das hochmütige Auftreten des Priesters nicht beirren. "Das kann nicht sein. Zwar habe ich verschiedene Verpflichtungen gegenüber den Wildeshausenern, doch bin ich nach den Verträgen aus dem Jahre 27 ein Lehnsmann der Ol- denburger. Niemals dürfen innerhalb dieser Mauern fremde Waffenknechte Stellung beziehen. Das widerspräche den Bedingungen des Grafen Christian." "Willst du mich belehren?!" brauste der erzbischöfliche Unterhändler auf. "Ich will dich an Einzelheiten erinnern, die dir vielleicht entfallen sind." "Oh, so kannst du nicht mit mir reden. Auch dir sind, so scheint es mir, ein paar Einzelheiten entfallen. Zum Beispiel die himmelschreiende Ketzerei der Stedinger. Steckst du womöglich mit diesen Leuten unter einer Decke? Ich warne dich davor, die Kreuzzugsvorbereitungen zu stören. Es ist manch einer schon wegen geringerer Vergehen exkommuniziert worden." Der Ritter hätte noch manches entgegnen können. Er fühlte sich vollkommen im Recht. Andererseits wusste er, dass dieser Wichtigtuer dem Erzbischof Bericht erstatten würde und mit Gerhard von Bremen wollte er sich denn doch nicht anlegen. Wilhelm duldete die Ausbildung der Waffenknechte in der Nähe seiner Burg, nachdem der Priester und der Hauptmann ihm die Erfüllung einige Bedingungen zugesichert hatten. Die Fremden durften sich nur in einem begrenzten Gebiet aufhalten und die Dörfer nicht betreten. Der Hauptmann erhielt als einziger Einlass in die Burg. Er wohnte fortan im Obergeschoss des Herrenhauses, in einem der ohnehin den Wildeshausenern vorbehaltenen Räume. Seine Leute mussten sich mit Zelten begnügen. Der Alltag allerdings sah anders aus. Der Hauptmann, der während der Ausbildung wie ein hungriger Tiger zwischen den Männern umherlief und sie zusammenbrüllte, ließ abends die Zügel schleifen. Meistens schaute er einfach weg, an einigen Streichen beteiligte er sich sogar. Die Sitten 115 verkamen mit jedem Tag mehr. Die Waffenknechte stahlen wie die Raben. Wer sich ihnen in den Weg stellte, wurde verprügelt. Die Dorfbewohner halfen sich schließlich selbst, indem sie kräftige junge Burschen mit Knüppeln als Wächter aufstellten. Das hatte zur Folge, dass sich brutale Massenschlägereien häuften. Am meisten aber verbitterte die Bauern, dass die ungehobelten Fremden ihren Töchtern nachstellten. Dabei spielte es keine Rolle, ob ein leichtfertiges Ding sich freiwillig mit diesen Halunken einließ oder ob ein sittsames Mädchen gewaltsam bedrängt wurde. Vor allem, wenn die Männer wieder einmal zu viel getrunken hatten, waren sie unberechenbar. Wilhelm mochte das nicht länger hinnehmen und ritt nach Wildeshausen, um sich bei Burchard in aller Form zu beschweren. "Ich bin nicht mehr bereit, diesen marodierenden Landsknechtshaufen in meinem Land zu dulden", erklärte er, ohne die ihm sonst eigene respektvolle Haltung. "Wenn Ihr sie nicht von dort weg befehlt, lasse ich sie vertreiben, und zwar mit Gewalt, wenn nötig." Der Graf war verblüfft über das entschlossene Auftreten des Ritters. Seinem Wesen entsprechend, wollte er zunächst aufbrausen, überlegte sich dann aber, wie leicht er diesen Mann mitsamt seiner Burg vollständig und endgültig an die Oldenburger verlieren konnte, und lenkte ein. "Du schätzt meine Lage falsch ein. Mir sind die Hände gebunden. Auch ich werde überrumpelt von den Ereignissen." "Diese Leute haben sich als Eure Waffenknechte ausgegeben." "Das ist ja wahr. Aber ich habe sie nicht zu meinem eigenen Nutzen angeworben. Ich tat es auf Befehl des Erzbischofs, dessen Vasall ich bin." "Geschieht es auch mit dem Einverständnis des Erzbischofs, wenn diese Männer unbescholtenen Töchtern meiner Bauern mit List und Gewalt nachstellen?" Wieder musste der Graf eine Woge des Zorns in sich unterdrücken. "Ich werde den Hauptmann streng ermahnen, seine Leute mehr in Zucht zu halten." "Ich hoffe, Ihr erreicht mit Euren Ermahnungen mehr als ich in den zurückliegenden Wochen mit den meinen." So leicht ließ Wilhelm sich nicht beschwichtigen. Ändert sich nichts an den Zuständen, reitet er erneut nach Wildeshausen - sofern er sich nicht gleich an die Oldenburger wendet. Burchard suchte nach einem Köder. "Ich bin täglich aufs Neue erstaunt über die Anmut Eurer Tochter Agnes", wechselte er unvermittelt das Thema. "Hast du schon darüber nachgedacht, mit wem du sie verheiraten willst?" "Ich sprach einige Male mit meiner Frau darüber ..." "Du solltest sie nicht einem Unwürdigen hinwerfen. Sie ist wie ein Edelstein. Ich selbst will mich nach einem Bräutigam für sie umsehen." "Das ist ein Dienst, den ich von Euch, Herr Graf, nicht annehmen darf." "Nur durch meine Vermittlung wird sie das bekommen, was sie verdient. Ihr künftiger Gemahl muss dem Hochadel entstammen." "Herr Graf, ich bin aufgewachsen in einem kargen Land. Dort lernt ein Mensch beizeiten, sich zu bescheiden. Es ist töricht, nach dem Unerreichbaren zu streben, denn die Enttäuschung käme gewiss." Burchard aber war nun von seiner eigenen Idee begeistert. "Ich verspreche es dir. Und wenn ich dieses mein Versprechen nicht werde halten können, so soll Agnes allen 116 Schmuck behalten, den sie jetzt leihweise trägt." Schon rief er einen Schreiber, der eine Urkunde aufsetzen musste, die er dem Ritter zum Abschied buchstäblich aufdrängte. Auf dem Weg hinunter in die Unterburg überlegte Wilhelm, ob es gut wäre, Agnes von Burchards Plan zu erzählen. Er wusste, dass sie zur Hochnäsigkeit neigte und wollte dieser schlechten Eigenschaft nicht ohne Not Nahrung geben. Doch zufällig lief sie ihm direkt über den Weg und bestürmte ihn solange mit Fragen, bis er sich zu Andeutungen hinreißen ließ. Tatsächlich löste die Neuigkeit einen Sturm von Gefühlen in dem jungen Mädchen aus, wenn auch in etwas anderer Weise, als vom Vater befürchtet. Für Agnes stand sofort fest, dass der Graf an niemanden anders als an seinen Sohn Heinrich dachte. Wenn dieser immer wieder in Schwermut verfiel, dann doch nur deshalb, weil er keine Frau hatte. Leider war es nicht einfach, ihm eine dritte Gemahlin zu beschaffen. Die Familien aus dem Hochadel argwöhnten einen bösen Fluch und wollten ihre Töchter nicht hergeben. Deshalb sah sich Burchard nunmehr unter den Kindern der Ritter um. Für Agnes war das alles sehr einfach und vollkommen einleuchtend. Eigentlich hatte sie diesen Ausgang ja von Anfang an vorausgesehen. Im Himmel war die Ehe zwischen ihr und Heinrich längst geschlossen. Nun richtete Gott, der Herr, die Verhältnisse auf Erden so ein, dass sich sein Wille auch hier erfüllte. Ganz närrisch vor Glück lief sie über die Brücke zur anderen Seite der Hunte. Das Gelände des Schlosses erschien ihr plötzlich viel zu klein. Wer ihr begegnete, lächelte ihr mit Nachsicht zu, ohne sich die Ursache ihrer überschäumenden Freude erklären zu können. II D ie Waldhütte hatte in der ersten Hälfte des Jahres 1231 ein anderes Aussehen bekommen. Streng genommen, entsprach der Name nicht mehr der Wahrheit. Aus der dürftigen Hütte zwischen Bäumen war eine Anlage geworden, die vom Charakter her ein Mittelding zwischen Gutshof und Burg darstellte. Man hatte Bäume gefällt und dadurch die Lichtung um fast das Doppelte vergrößert. Die Grenze bildeten neuerdings ein Graben und ein Palisadenzaun. Das Eingangstor wurde von einem hölzernen Turm überragt. Neben solch martialischen Bauwerken waren aber auch neue Ställe und ein großer Speicher für Vorräte aller Art entstanden. An die ursprüngliche Hütte lehnten sich zwei weitere Wohnhäuser an, die wie Seitenflügel wirkten. In einem davon wohnten Franziska, Pentia und Ramira sowie Norbert und Christian. Rupert hatte den Namen Herrenhaus geprägt, zweifellos in der hinterhältigen Absicht, unter den Leuten Neid zu schüren. Seine Versuche, das Ansehen der Anführerin zu untergraben, scheiterten aber, und zwar vor allem daran, dass Franziska seit Mitte August Mutter eines Töchterchens war. Weil es sonst keine Kinder im Lager gab, war die kleine Beatrice der Liebling aller. Man gönnte ihr die Vorzüge des Herrenhauses. Trotz allem blieb die Pflege des Säuglings unter den nach wie vor 117 primitiven Bedingungen beschwerlich. Leider gehörte Beatrice zu den empfindlichen Kindern. Zeitweilig entwickelte sie sich prächtig, dann wieder wurde sie plötzlich wieder zurückgeworfen, oft wegen einer Kleinigkeit. Manchmal war es fast unheimlich, wie genau dieser Winzling die Vorgänge in der Umgebung in sich aufnahm. Auch wunderten sich alle, dass Franziska und Norbert, die doch beide sehr robust wirkten, ein derart sensibles Kind hatten. Wieder einmal war Beatrice unruhig und aß zu wenig, diesmal wenigstens aus erkennbarem Grund. Franziska hatte nicht mehr genügend Milch zum Stillen. Nun war es nicht so, dass sie als Mutter keine Geduld besaß. Sie tat wirklich alles Erdenkliche, um die Umstellung zu bewerkstelligen. Allmählich aber geriet sie ans Ende ihrer Kräfte. Der Schlafmangel tat ein Übriges. Sie zweifelte an sich und kam schließlich so weit, dass sie vor der Hütte in Tränen ausbrach. Da spürte sie plötzlich, wie sich sanft eine Hand auf ihre Schulter legte. Sie blickte auf und erkannte Pentia. "Soll ich dir helfen? Vielleicht schaffe ich es." Im ersten Moment steigerte sich Franziskas Verzweiflung noch. Als die beiden Mädchen noch klein waren, hatte die große Schwester einmal die kleine während einer heimtückischen Krankheit buchstäblich im letzten Moment dem Tode entrissen, allein durch die Kraft ihrer Liebe. Gab es diese Kraft nicht mehr in ihr? Konnte sie nun nur noch Räuberbanden anführen? Pentia erriet ihre Gedanken und sagte: "Warum willst du mir nicht eine Gelegenheit geben, meine Schuld abzutragen?" Franziska überlegte. "Ja, du hast wohl Recht. Entschuldige bitte, wenn ich dich manchmal ohne Absicht kränke!" Dass Pentia sich so unauffällig verhielt und oft zurückzog, bedeutete nicht, dass sie mit diesem Leben glücklich war. In Wahrheit wusste sie nicht, was sie anders tun sollte in diesem Lager voll grobschlächtiger Männer, vor denen sie sich fürchtete. Sie beneidete ihre Schwester wegen ihrer Durchsetzungskraft. Und sie fand es sehr ungerecht, dass Franziska, der es doch eigentlich an nichts mangelte, vom Schicksal nun auch noch mit einem niedlichen Säugling bedacht wurde. An Norbert dachte sie dabei kaum. Für sie war das Kind ein Geschenk des Himmels. Vielleicht hätte der geheime Neid allmählich die Liebe der unzertrennlichen Schwestern untergraben. Doch von jenem Tage an gab es für Pentia keinen Grund zur Verbitterung mehr, denn ihr gelang das scheinbar Unmögliche. Beatrice ließ sich von ihr füttern und erholte sich. Sie wurde zu einem guten Teil ihre Mutter. In der Zeit, als sich Franziska um ihre Tochter kümmerte und für nichts anderes mehr Sinn hatte, führte Norbert das Kommando in der Waldhütte-Burg. Der auf der Lauer liegende Rupert erkannte sofort die Gelegenheit, sammelte seine Anhänger und verlangte scheinheilig, die Anführerin zu sprechen. "Wir möchten Beschwerden vortragen." "Du weißt genau, dass Franziska jetzt nicht zu sprechen ist." "Leider erlaubt unser Anliegen keinen Aufschub." "Du weißt auch, dass Franziska mich zu ihrem Vertreter ernannt hat." "Nun denn! Wir sind nicht einverstanden mit den neuen Sitten, die sich seit einigen Monaten einschleichen." 118 "Was meinst du damit?" "Nun bist du derjenige, der sich dumm stellt." Tatsächlich war es für Norbert nicht schwer, sich den Hintergrund der Revolte auszurechnen. Seit dem Überfall am Heiligen Abend kümmerten sich die Stedinger verstärkt um die Bündnispartner, die nun (mit Franziskas Billigung) einem besonderen Hauptmann unterstanden. Offensichtlich hatte die Universitas Pläne mit ihnen - Pläne, deren Inhalt im Dunkeln blieb. Der Hauptmann stritt ihr Vorhandensein zunächst rundweg ab, wobei ihn die Anordnungen, die er gab, klar widerlegten. Die Gegend sollte gründlich erkundet werden. Auch die Befestigungsanlagen errichtete man auf seine Anweisung. Freilich waren Abhängigkeit und Bevormundung nur die eine Seite der neuen Lage. Die Vorteile überwogen. Wenn es an Nahrung mangelte, brauchte niemand mehr bei einem Überfall an der Fernstraße Leben und Freiheit aufs Spiel zu setzen. Es reichte, mit einem Wagen ins Marschland zu fahren. Der Hauptmann ließ auch durchaus mit sich verhandeln. Zum Beispiel bedrängte er sie nicht mehr mit dem Umzug ins Kerngebiet der Stedinger. Dessen ungeachtet kehrte einer der Bürgersöhne Ende März nach Bremen zurück. Als sich herumsprach, dass er begnadigt worden war und wieder friedlich bei seiner Familie lebte, folgten ihm drei andere nach. Ruperts Räuber blieben zwar, sonderten sich aber demonstrativ ab. Andererseits kamen Bauernsöhne aus Stedingen zu ihnen. Die hatten anfangs keinen leichten Stand, denn jeder misstraute ihnen. Im Oktober sickerte durch, dass die Universitas in der inzwischen ziemlich wehrhaften Waldhütte-Burg einen vorgeschobenen Stützpunkt für den Kriegsfall sah. Man konnte von dort aus das Schloss von Wildeshausen mit Pferden innerhalb eines halben Tages erreichen. Im Falle einer Niederlage konnte man sich dorthin zurückziehen und hinter den Palisaden verschanzen. Auch als Waffenlager eignete sich die Anlage. Das ging den Räubern zu weit. Rupert fürchtete (berechtigter Weise), dass seine Stellung desto schwächer würde, je mehr die Stedinger die Bündnispartner in ihre Kriegstrategie einbezogen. "Ich glaubte bisher, dass ihr mit jenen neuen Sitten einverstanden seid", entschloss sich Norbert zu antworten. "Wir haben sie unter Protest hingenommen." "Was soll dieses Katz-und-MausSpiel?! Sag frei heraus, was ihr wollt!" "Wir wollen, dass das Bündnis mit den Stedingern wieder gelöst wird. Wir wollen frei sein und nicht abhängig von den Launen eines fremden Hauptmanns und den Befehlen einer noch fremderen Universitas." "Die Mehrheit ist anderer Meinung." "Ihr könnt uns nicht zwingen, für eine Sache zu kämpfen, die uns nichts angeht." Allmählich stieg in Norbert der Zorn hoch. "Du redest noch immer nicht offen. Dass Franziska die Stedinger nicht verrät, konntest du dir denken, bevor du zu mir kamst." "Vielleicht wollte ich die letzte Brücke nicht voreilig abschlagen." "Heuchler!" "Warum so grob? Nun ja! Da wir hier nicht mehr gern gesehen sind, werden wir unsere eigenen Wege gehen." "Nur zu!" "Es gibt allerdings noch ein paar Kleinigkeiten zu verhandeln. Uns steht ein Drittel zu von aller beweglichen Habe, einschließlich der Waffen." 119 "Euch steht überhaupt nichts zu!" brauste Norbert auf. "Außerdem kann ich zählen. Nicht einmal ein Viertel käme heraus." "Ein Drittel!" beharrte Rupert. "Immerhin müssen wir uns ein neues Haus bauen. Über die Tiere wäre selbstverständlich noch gesondert zu reden." Als Norbert den Vorfall Franziska berichtete, reagierte diese zu seiner Verwunderung gelassen. Er argwöhnte, ihre Gedanken drehten sich nur noch um Beatrice. Ihre Begründung belehrte ihn dann aber eines Besseren. "Hast du erwartet, dass Rupert jemals die Zeit vergisst, da er noch der Herr über den Wald war? Wenn er zusammen mit seinen Kumpanen geht, ohne uns in Schwierigkeiten zu bringen, ist das für uns die beste Lösung." "Bringt er uns denn nicht in Schwierigkeiten mit seinen unverschämten Forderungen?" "Wir sollten ihm goldene Brücken bauen. Aber das will ich nicht allein entscheiden." Für den übernächsten Tag berief Franziska eine Versammlung ein. Überraschend für alle, sollte dabei nicht nur über Ruperts Antrag sondern auch über die Gesetze in der Waldhütte-Burg sowie über den Anführer beraten und abgestimmt werden. "Ist diese abermalige Wiederwahl denn nötig?" fragte Christian sie verunsichert in einem günstigen Augenblick. "Damals, als du deine Schwangerschaft bemerktest, war das wohl angebracht, aber jetzt, wegen der Revolte dieser Galgenvögel?" "Worum sorgst du dich? Ich bin mir sicher, dass sie mich zum dritten mal wählen, zumal Ruperts Leute nicht mehr mit abstimmen dürfen." "Das ist doch keine Antwort!" "Ich will wissen, was sie sich von mir versprechen. Sie hegen bestimmte Erwartungen. Hast du noch nicht beobachtet, wie die Bauernsöhne aus Stedingen mich verstohlen mustern? Sie sehen mich an, als ob ich ihnen das ewige Seelenheil bringen kann." "Warum fragst du sie nicht einfach danach?" "Sie weichen mir aus." Die Versammlung verlief stürmisch, doch nicht wegen Franziska sondern wegen Forderungen der Räuber. Rupert stellte verärgert fest, dass er zu lange gezögert hatte. Durch die jungen Stedinger war das Kräfteverhältnis zu seinen Ungunsten verschoben worden. Mit Gewalt erreichte er nun nichts mehr. Er beschwichtigte Ernst Eisenarm, der das nicht begriff, und verlegte sich aufs Feilschen. Franziska brachte sich in jene Rolle, in der sie sich am besten fühlte - sie vermittelte zwischen den Parteien. Die Wahl sollte den Abschluss der Versammlung bilden und wäre beinahe nicht zustande gekommen, weil die Sonne schon bedenklich tief stand. Die meisten fanden sie (ebenso wie Christian) völlig überflüssig. Franziska jedoch hatte sich eine Begründung überlegt. "Die vorige Wahl ist nicht der Ordnung gemäß verlaufen. Wenn ein Schulze bestimmt wird, sagen ihm die Dorfbewohner, welche Pflichten und Rechte er hat." "Ja, das stimmt", bestätigten einige Männer halblaut. "Und ist nicht die Waldhütte-Burg etwas Ähnliches wie ein Dorf? Nur der Form halber wiederholen wir die Wahl." Was so einfach klang, erwies sich dann aber als recht kompliziert, denn jene Pflichten und Rechte standen nirgendwo geschrieben, konnten also nicht (wie in einem alten Dorf) einfach verlesen werden. Da wiederum die Zeit drängte, war eine lange Beratung nicht möglich. Trotzdem erfuhr Franziska 120 noch, was sie wissen wollte. Einer der letzten Neuankömmlinge, ein Bursche von knapp zwanzig Jahren mit strohblondem Haar trug es vor, wenn auch verschämt und umständlich. "Niemand soll denken, dass ich nur aus Eigennutz hierher gekommen bin. Es ist nur so, dass ich als jüngster von fünf Söhnen in unserem Dorf niemals einen eigenen Hof erhalten kann. Auch die meisten anderen Dörfer nehmen keine fremden Bauern mehr auf. Das Land ist knapp geworden, weil wegen dem Erzbischof keine neuen Deiche mehr entstehen. So bin ich eben ausgewandert. Ihr seid eine Ritterstochter und könntet mir vielleicht behilflich sein." Einige andere junge Männer nickten. Franziska beobachtete unterdessen aus dem Augenwinkel den Hauptmann. Der rührte sich nicht, war offenbar einverstanden. Die Universitas hatte also nichts dagegen, wenn sich junge Leute, für die im Marschland kein Platz mehr blieb, bei den Adligen verdingten. Nun versprachen sie sich einiges von den Westerholts, die eine ihnen freundlich gesonnene Tochter hatte. Zweifellos wussten die Stedingerführer nicht, in welch schwierigen Treuebeziehungen diese Familie ohnehin schon steckte. III W ährend ich die erste Seite dieser Chronik schreibe, weiß ich noch nicht, ob sie für spätere Leser eine Mahnung sein wird oder ein Anlass zur Freude, ob sie vor allem von bösartigen, verwerflichen Taten berichten wird oder von guten, vorbildlichen. Vielleicht wird sie ein Beispiel geben dafür, wie sich schlechte Anzeichen durch Gottes wunderbare Fügungen nicht erfüllen. Ein steiniger Acker trägt Früchte und aus einem verdorrten Ast bricht frisches Blattwerk. Doch noch während ich bete, dass es also geschehen möge, beschleichen mich Zweifel. Es wäre wohl töricht, wenn nicht gar eine Versuchung des Allmächtige, auf etwas Unmögliches zu hoffen. Ich will meine Gefühle vergraben, will zu einem Werkzeug werden, einzig dazu geschaffen, die Tatsachen niederzuschreiben, ohne etwas wegzulassen oder zu beschönigen. Otto von Oldenburg Anno Domini MCCXXXI, sechsundzwanzigsten Juli am Seine Heiligkeit Papst Gregor IX wendet sich in einem Schreiben an den Bischof Johannes von Lübeck, welcher zugleich Prior der Dominikaner zu Bremen ist, sowie an Johannes den Deutschen, seinen Beichtvater, und ermächtigt die beiden geistlichen Würdenträger, den Erzbischof Gerhard II bei seinem Kampf wider die Stedinger zu unterstützen, insbesondere den weltlichen Herren ins Gewissen zu reden und an ihre Pflichten zur Unterdrückung der Ketzerei zu erinnern. Zur Begründung beruft er sich auf das Gutachten seines Großinquisitors für die deutschen Lande, des Herrn Konrad von Marburg. Anno Domini Spätsommer MCCXXXI, im Seine Heiligkeit Papst Gregor IX ist sich offenbar unsicher, was die angeblichen Ketzereien der Stedinger 121 angeht. Er weigert sich, den von Erzbischof Gerhard II geforderten Feldzug in den Rang eines Ketzerkreuzzuges zu erheben. Sogar dem Gutachten seines Großinquisitors Konrad von Marburg schenkt er neuerdings kein uneingeschränktes Vertrauen mehr. Er beauftragte den Bischof von Minden, den Bischof von Ratzeburg sowie den Bischof von Lübeck, weitere Gutachten anzufertigen. Burchard insgeheim entschädigt worden? Anno Domini MCCXXXII, neunundzwanzigsten Oktober am Seine Heiligkeit Papst Gregor IX erlässt eine Bulle mit dem Aufruf zum Kreuzzug wider die Stedinger und sendet sie an den Bischof von Lübeck, an den Bischof von Minden sowie an den Bischof von Ratzeburg. Somit hat sich der Papst also schließlich doch umstimmen und zu einer harten Haltung gegenüber den Bauern des Marschlandes an der Weser drängen lassen. Sicher ist die Bulle ein Ergebnis der unermüdlichen Bemühungen des Erzbischofs von Bremen, auch wenn seine Eminenz Gerhard II darin nicht erwähnt wird. Wer soll nun den Krieg noch verhindern? Anmerkung: Was mag den Papst in Zweifel gestürzt haben? Sind ihm Berichte zugegangen, welche den Darstellungen des Großinquisitors entgegenstehen? Wer verfasste diese Berichte, so es sie denn gäbe? Leider ist von den durch seine Heiligkeit ausgewählten Würdenträgern kaum zu erwarten, dass sie sich als unparteiische Gutachter erweisen. Bischof Johannes von Lübeck gehört zu den engsten Vertrauten des Erzbischofs von Bremen. Sind die neuen Untersuchungen also nichts als eine Posse? Anno Domini MCCXXXI, siebzehnten September ausreichend Anno Domini MCCXXXII, zwölften November am Seine Heiligkeit Papst Gregor IX erlaubt seiner Eminenz Erzbischof Gerhard II von Bremen, mit allen einem Kirchenfürsten zur Verfügung stehenden Mitteln gegen jene Geistlichen vorzugehen, die sich, aus welchen Beweggründen auch immer, den Vorbereitungen des Kreuzzuges wider die Stedinger in den Weg stellen. Zugleich sichert er all jenen, die sich am Kampf gegen die Ketzer beteiligen, umfangreichen Ablass zu. am Seine Eminenz Erzbischof Gerhard II von Bremen ordnet an, dass von nun an und für alle Zeiten der Probst des Alexanderstifts zu Wildeshausen ein Mitglied des Bremer Domkapitels sein muss. Wie mag der Graf von Wildeshausen diesen Beschluss aufnehmen? Und was mag den Erzbischof veranlasst haben, jenen Mann vor den Kopf zu stoßen, den er als weltlichen Führer des geplanten Feldzuges gegen die Stedinger auserkoren hat? Oder gab es eine Absprache zwischen beiden, von welcher niemand etwas erfuhr? Ist Anmerkung: Ich hörte, dass sich vor allem in der Stadt Bremen aber auch anderenorts die warnenden Stimmen häufen. Mancher verlangt ein weiteres Gutachten, verfasst von wahrhaftig unabhängigen Leuten. Mancher rät, mit den Stedingern zu verhandeln und bei allen strittigen Fragen eine gütliche Einigung 122 anzustreben. Mancher warnt gar, der Kreuzzug könnte mit einer Niederlage enden, weil er in Wahrheit weltlichen Zielen dient, weil also gewiss Gottes Segen nicht auf ihm liegt. Es sind keineswegs bekannte Ketzer, die solche und ähnliche Reden im Munde führen. Wirklich verlassen kann sich der Erzbischof allem Anschein nach nur auf die Brüder vom Dominikanerkonvent. Vielleicht vermag dieser Umstand doch noch das Äußerste zu verhindern, auf dass nicht friedliche Dörfer in Flammen aufgehen und Unschuldige durch das Schwert sterben müssen. sieben Bischöfe, die sich in ihrem Machtbereich für den Krieg gegen die Marschlandbauern von der Weser einsetzen. Das wird nicht ohne Folgen bleiben. Schon jetzt haben etliche größere und kleinere Herren Lust, sich mit dem Schwert in der Hand zu bereichern." Otto von Oldenburg zitterten die Hände vor Empörung, als er das niederschrieb. Während er die Chronik verfasst hatte, war er mehrmals von Zweifeln bis in die Träume hinein verfolgt worden. Konnte es nicht sein, dass die Stedinger wirklich mit dem Teufel im Bunde standen, wie es der Erzbischof behauptete? Die Schilderungen der Gräuel beeindruckten auch ihn. Und es war ja nicht zu leugnen, dass die Bauern Priester erschlagen hatten. Doch immer wieder stieß er auf Beweise für die schier unglaubliche Habsucht der selbsternannten Ketzerjäger. Bei so vielen von ihnen erinnerte nichts, aber auch gar nichts an Heilige. Otto war unter einem Vorwand bis nach Osnabrück geritten und hatte mit den Eiferern persönlich gesprochen. Da gab es wenig Frommes zu hören. Nein, es blieb dabei - Erzbischof Gerhard plante einen ungerechten Krieg. Leider hatte er den Heiligen Vater für sein schmutziges Vorhaben zu missbrauchen verstanden. Obgleich er sich seiner Ohnmacht bewusst war, wurde Otto fortgerissen von dem Bedürfnis, etwas zu unternehmen, irgendetwas, was zumindest den Anschein hatte, sinnvoll zu sein. Er wünschte, dass wenigstens die Oldenburger, seine Verwandten, sich nicht beteiligten an jenem Verbrechen. Darüber war immerhin noch keine Entscheidung gefallen. Seit zwei Jahren drängte der Erzbischof auf eine klare Aussage. Genau so lange verschanzte Christian sich hinter vagen Versprechungen. Das konnte allerdings Anno Domini MCCXXXII, im Herbst Seine Eminenz Erzbischof Gerhard II von Bremen ist mehr denn je und allen Schwierigkeiten zum Trotz entschlossen, den Kreuzzug schon bald zu beginnen. Unermüdlich treibt er die Vorbereitungen voran. Unter anderem richtete er die von den Stedingern zerstörte Schlutterburg wieder auf. Sie ist nun so stark befestigt wie nie zuvor. Für die Bauern bedurfte es dieses Zeichens nicht mehr, um sie die drohende Gefahr erkennen zu lassen. Längst stellen auch sie sich auf einen Waffengang ein. Sie schmieden Schwerter und sehen sich nach Verbündeten um. Dieser Krieg wird furchtbar sein. Wenn der Erzbischof von einer einfachen Züchtigung redet, so sagt er wider besseren Wissens die Unwahrheit. Anno Domini MCCXXXIII, im Januar Seine Heiligkeit Papst Gregor IX wendet sich in einer zweiten Kreuzzugsbulle wider die Stedinger an den Bischof von Paderborn, an den Bischof von Hildesheim, an den Bischof von Verden sowie an den Bischof von Osnabrück. So sind es nun also ihrer 123 alles Mögliche bedeuten. Otto entschloss sich, mit seinem Bruder zu reden, obgleich ihn das Überwindung kostete. Der Graf war an jenem Tage gut gelaunt. Er empfing Otto ohne viel Aufhebens und sprach ziemlich offen aus, was er dachte. "Du wunderst dich über meine schwankende Haltung zu diesem Kreuzzug? Merkst du denn nicht, wie gut das alles für uns läuft?" "Ich verstehe nicht recht ..." Christian lachte mit der Fröhlichkeit eines Lausbuben. "Unter den weltlichen Herren, welche für den Erzbischof in den Krieg ziehen wollen, gibt es nicht einen, der mir ebenbürtig ist. Wir Oldenburger können folglich zu jedem beliebigen Zeitpunkt in das Geschehen eingreifen. In jedem Fall beherrschen wir sofort das Feld. Da müsste ich gehörig dumm sein, würde ich mich gleich am Anfang ins Getümmel stürzen. Burchard, dieser Schwachkopf, hat sich ja schon weit aus dem Fenster gelehnt. Die Stedinger werden ihm mächtig das Fell versohlen. Das sind tapfere Kämpfer, gut bewaffnet zudem. Den ersten, der in ihr Land eindringt, machen sie nieder. Da bin ich mir ganz sicher. Denk an Gerhards wackeren Bruder Hermann! Erst die zweite oder dritte Welle bringt die Wende. Vielleicht!" "Und bei all dem willst du zusehen?" "Und zwar mit großem Vergnügen! Es wird sehr, sehr gut für uns ausgehen. Ich weiß, dass du eine Chronik schreibst. Wahrscheinlich entsteht da unter deinen Fingern die Geschichte vom Beginn des Aufstiegs unserer Familie." Er übertrieb das Pathos in komödiantischer Weise. Im Grunde aber meinte er ernst, was er andeutete. Auch er beteiligte sich am Kreuzzug, auch er rüstete auf - nur eben auf seine Art. Als Otto das begriff, lag ihm eine grobe Erwiderung auf den Lippen. Er beherrschte sich jedoch. Christian hätte auch daraufhin nur gelacht. 124 11.Kapitel I C hristian gehörte zu den letzten, welche die Neuigkeit erfuhren. Streng genommen, handelte es sich um ein Gerücht, zu dem sich niemand mehr bekannte und dessen Ursprung sich nicht mehr ermitteln ließ. Trotzdem gingen immer neue ausschmückende Einzelheiten um. Als das Geraune Christian nun also endlich erreichte, sträubte er sich entschieden dagegen. "Da ist nichts dran. Ihr glaubt dieses Märchen, weil ihr gern dran glauben wollt. Ihr seid wie Kinder." Tatsächlich freilich klammerte gerade er sich am meisten an dieser Hoffnung fest. Während er äußerlich auf Beweise pochte, dürstete er innerlich nach Begründungen, um den Behauptungen folgen zu können. Nur allmählich gestand er sich ein, dass er unter Heimweh litt. Wenn der Erzbischof mit den Bürgern Frieden geschlossen hatte, wenn alle im Zusammenhang mit den Unruhen der zurückliegenden Jahre Festgenommenen wieder auf freiem Fuß waren, wenn sogar ein Vertrag ausgearbeitet wurde, wenn sich also die Verhältnisse in Bremen derart zum Besseren wendeten, dann konnten auch die Flüchtlinge auf Milde rechnen. Christian wurde von dem Gedanken fortan Tag und Nacht verfolgt. Manchmal meinte er am Morgen, in seinem Verschlag über der Werkstatt des Meisters Berthold, seines Stiefvaters, aufzuwachen. Allerdings wollte er sich nicht einfach davonstehlen. Es gab Freunde, die auf ihn rechneten - Norbert, der auf jeden Fall in der Waldhütten-Burg bleiben wollte; Franziska, seine Dank eines unglaublichen Zufalls in sein Leben getretene Cousine; die jungen Stedinger, für die er zu den alten Helden zählte. Mehrere Tage vergingen, in denen er sich im Grunde schon entschieden hatte, aber noch nach einem würdigen Rückzug suchte. Sein Verhalten wurde dabei so auffällig, dass Norbert ihn ansprach. "Was ist mit dir? Du wirkst sonderbar. Jeder hier sagt das." "Es ist wegen der Gerüchte über Bremen." "Du willst ... zurückkehren?" Christian nickte. "Dein Entschluss ist ... unwiderruflich?" "Ja." Nach einer längeren Pause stand Norbert auf. "Das letzte Wort steht Franziska zu." Die junge Anführerin hatte gerade mit Beatrice gespielt und übergab die Kleine nun an Pentia. Dann wandte sie sich, noch immer erfüllt von ihrer Mutterliebe, den beiden Männern zu. "Er will nach Hause." Norberts Enttäuschung und Missbilligung waren unüberhörbar. Franziska indes schwieg und dachte über etwas nach, was sie nicht verriet. Ihre Gesichtszüge verdüsterten sich zunehmend und plötzlich, als litte sie unter Atemnot, stand sie auf und trat vor die Tür. Als sie nach einiger Zeit zurückkehrte, wirkte sie erschöpft. Norbert schien sie aus einem tiefen Traum zu holen mit seiner Frage: "Lassen wir ihn gehen?" "Was sagst du? ... Ach so! ... Ja, selbstverständlich! Das hier ist doch kein Gefängnis." Christian bedankte sich und kam sich schäbig vor. War er einer, der im entscheidenden Moment seinen Posten verlässt, ein pflichtvergessener Knappe, der sich mitten im feindlichen Angriff von der Seite seines Ritters schleicht? Doch diese Überlegungen hätte er früher anstellen müssen. Nun blieb ihm nur noch, seine persönlichen Sachen zu einem Bündel zu schnüren. Anders als Rupert der Räuber wollte er nur mitnehmen, was ohnehin niemand mehr würde gebrauchen können. Während er seinen Schlafplatz im neuen Seitenflügel der Hütte aufräumte, hatte er das Gefühl, nicht allein zu sein. Er drehte sich um, konnte aber niemanden im Raum sehen. Auch in der Eingangstür stand keiner. Eher zufällig blickte er auch einmal nach oben und entdeckte Ramira, die dort auf einem der Deckenbalken saß. Das war keineswegs ungewöhnlich. Die kleine Artistin lebte buchstäblich in drei Dimensionen. Sie bewegte sich mit der Sicherheit und Wendigkeit eines Eichhörnchens und hielt ihren Mittagsschlaf dort, wohin sich andere nicht für einen Augenblick wagten. Mittlerweile schüttelte höchstens noch ein Neuer darüber den Kopf. Christian hatte diesmal aber das Gefühl, als wäre sie absichtlich besonders still gewesen, als wäre sie darauf ausgegangen, ihn heimlich zu beobachten. Gegen diesen Eindruck sprach lediglich, dass sie nicht erschrak, als er sie entdeckte. Sie wirkte gelangweilt da oben auf ihrem Balken. Oberkörper und Kopf lehnten an einem Stempel. Ein Bein baumelte herunter. Die Hände spielten mit einem vom Dach gefallenen Strohhalm. Christian wandte sich wieder seinem Bündel zu - und kam nicht mehr zu Recht damit. Ein halbes Dutzend mal musste er es wieder aufknoten, weil er etwas hineinzulegen vergessen hatte. Seine Bewegungen wurden fahrig. Was war plötzlich los mit ihm? Dass er Ramira liebte, glaubte er nicht. Seit je- nem denkwürdigen Besuch bei den Stedingern verstanden er sich mit ihr recht gut, setzte sich wohl auch gelegentlich zum Plaudern zu ihr. Doch niemals hatten beide sich umarmt oder gar geküsst. Sie vermieden sogar harmlose Berührungen. Nein, nein, zwischen ihnen gab es nichts. Endlich war er fertig. Er warf sich das Bündel über die Schulter und sah noch einmal zu der Artistin hinauf. "Ich wünsche dir alles Gute." "Danke! Ich dir auch." Die Antwort klang kurz und beiläufig. Da war keine Bitterkeit in der Stimme. Im selben Ton sagt man "Gesegnete Mahlzeit!". Hatte er mehr erwartet? Ein wenig hastig überquerte er den freien Raum bis zum Tor im Palisadenzaun. Dann stand er draußen, außerhalb der Waldhütten-Burg, war also frei. Irgendwie anders hatte er sich das vorgestellt. Er ging doch nach Hause zurück und er ließ eine Räuberhöhle hinter sich. Er war im Begriff, wieder ein anständiger Mensch zu werden, und er hatte dem Verbrecherdasein abgeschworen. Die zurückliegenden Monate würden für ihn bald nur noch wie ein Alptraum sein. Warum freute er sich nicht? Auf der Wanderung wurde Christian abgelenkt. Er durfte die Orientierung nicht verlieren und musste auf der Hut sein vor Waffenknechte aller Art. Solange er nicht in Bremen in aller Form begnadigt und wieder in die Bürgergemeinschaft aufgenommen worden war, galt er als Räuber. Die Vorstellung, gewissermaßen im Angesicht des heimatlichen Herdrauches gefangen genommen und in einen Kerker geworfen zu werden, versetzte ihn in Schrecken. Sogar am Tor zitterte er noch. Sicher fühlte er sich erst, als er in die Gasse der Tischler einbog. Dort, hinter jener sanften Biegung stand das Haus 126 von Meister Berthold. Christian erinnerte sich durchaus der Auseinandersetzungen, die er mit seinem Stiefvater gehabt hatte. Doch die Zeit heilt bekanntlich Wunden. Im Rückblick erschien mancher Anlass lächerlich, manche Schlussfolgerung übertrieben. Als er das Haus betrat, war er geradezu feierlich gestimmt. Er dachte an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, auch wenn er nicht erwartete, dass die Pflegeeltern tatsächlich für ihn ein Fest ausrichten würden. Meister Berthold war gerade damit beschäftigt, bei einer Truhe die Seitenteile anzupassen. Sein Sohn Fritz half ihm. Sie redeten kein Wort, waren so gut aufeinander abgestimmt, dass kleine Gesten zur Verständigung genügten. Mutter Hilde putzte einen Zinnkrug, eine Neuanschaffung, die in Ehren gehalten wurde. Eine Weile sah Christian den dreien zu und fand es lustig, dass sie ihn nicht gleich bemerkten. Dann begann er, sich zu wundern. So sehr konnten sie doch nun wirklich nicht in ihre Arbeit vertieft sein! Er räusperte sich. Nichts! Ihn beschlich die böse Ahnung, dass sie ihn absichtlich übersahen. Die feierliche Stimmung verflog und der alte Groll kehrte zurück. Er erkannte seinen Verschlag unter dem Dach wieder, diesen einzigen Teil des Hauses, der ihm gehörte. Alles stand wieder vor ihm, die Streitereien um Kleinigkeiten, die Ungerechtigkeiten, all das, was ihn einst weggetrieben hatte, unabhängig von der Verfolgung durch die Schergen des Erzbischofs. "Ich bin zurückgekehrt", sagte er schließlich mit einer Stimme, die herausfordernd und hart klang. Meister Berthold konnte ihn nicht mehr ignorieren, ließ sich aber trotzdem Zeit, ehe er sich aufrichtete und mit kaum weniger Kälte antwortete: "Ja, unser undankbarer Pflegesohn ist zurückgekehrt. Ich sehe es. Gefällt es ihm nicht mehr unter den Räubern? Lohnt es sich heuer nicht mehr, auf den Landstraßen die Kaufleute zu überfallen? Dass sein Pflegevater sich bei der Morgensprache verantworten musste, berührt ihn selbstverständlich nicht." Sein Gesicht verdüsterte sich. Zweifellos dachte er daran, wie er seinerzeit im Zunfthaus nach vorn gerufen wurde, wie die Blicke der anderen Meister sich auf ihn hefteten, als er Rede und Antwort stand. Man wollte wissen, warum er auf die Entwicklung des seiner Erziehung anvertrauten jungen Mannes nicht mehr Einfluss genommen habe, ob er womöglich insgeheim damit einverstanden gewesen sei. Eine gute Gelegenheit für neidische Nachbarn, sich (scheinheilig die Interessen der Zunft vorschützend) am erfolgreicheren Konkurrenten zu rächen. Sie stellten hinterhältige Fragen, solche, die schwer widerlegbare Verdächtigungen enthielten. Oder sie verteidigten den Beschuldigten in einer Weise, dass sie ihn zugleich demütigten. Und sie nutzten die besonderen Empfindlichkeiten des Meisters Berthold aus. Der litt schon unter den kleinsten Makeln. Christian sah, dass er sich ehrlich grämte wegen der vermeintlichen Schande. Dennoch konnte er in sich kein Mitgefühl finden. Zählt Ehre mehr als Menschlichkeit? Hat der Heiland etwa eines Titels wegen gelitten? Sind die heiligen Märtyrer gestorben, um den Leuten gefällig zu sein? Im Gegenteil! Nur wer die Eitelkeit von sich wirft, ist des Himmelreichs würdig. Christian brachte nicht einmal eine Entschuldigung über sich. "Ich wurde einer guten Sache wegen verfolgt und musste fliehen, um nicht in 127 Gefangenschaft zu geraten", sagte er stolz. "Inzwischen ist der Erzbischof gezwungen, auf unsere gerechten Forderungen einzugehen." Mutter Hilde legte den Zinnkrug beiseite und trat mit beschwörend gehobenen Armen an den Pflegesohn heran. "Warum bist du so ein sturer Esel? Warum kannst du dich nach all dem, was du angerichtet hast, nicht einfach deinem Vater zu Füßen werfen?" Eine Blutwoge schoss Christian ins Gesicht. Sich ihm zu Füßen werfen? Das fehlte gerade noch! Sein Blick fiel auf Fritz, der nichts sagte, aber alles beobachtete, und entdeckte unverhohlene Feindschaft. Der wieder aufgetauchte Stiefbruder war für ihn ein Störenfried. Christian fühlte, dass er sich bald nicht mehr würde beherrschen können. Um es nicht bis zum Äußersten kommen zu lassen, wandte er sich abrupt ab und flüchtete zurück auf die Gasse. II W as hatte Christian sich nicht alles erhofft? Wenige Augenblicke hatten seine Träume vollständig zerstört. Wohin sollte er nun gehen? Von seinen alten Freunden hatten sich nur die Gemäßigten in der Stadt halten können. Mit denen aber war es ja am Ende zum Bruch gekommen. Es kostete Christian einiges an Überwindung, den Weg zu Gottfrieds Haus einzuschlagen. Er hielt für möglich, kurzerhand hinausgewiesen zu werden, erlebte aber zunächst eine angenehme Überraschung. Gottfried war gut gelaunt und freute sich ehrlich, einen Bekannten aus der Geheimbundära wieder zu sehen. Er nötigte ihn, sich im guten Zimmer niederzulassen und ließ einen Krug Wein aus dem Keller holen. "Du bist genau zur richtigen Zeit zurückgekommen", sagte er, während er für jeden einen Becher füllte. "Wir stehen kurz vor dem vollständigen Sieg." "Ich hörte schon davon." "Gerüchte verbreiten sich schnell. Aber nun erzähle doch erst einmal, wie es dir ergangen ist! Musstest du dich als Knecht durchschlagen?" Christian zögerte, wollte zunächst vorsichtshalber lügen, entschloss sich dann aber doch dazu, die Wahrheit zumindest anzudeuten. Er sprach davon, dass er nicht immer die Gesetze habe beachten können. Die Verbindung zu den Stedingern verschwieg er. Gottfried nahm keinen Anstoß. "Manchmal muss man sich halt auch mit schmutzigen Dingen befassen", meinte er. "Wichtig ist, sich hinterher gründlich zu waschen." Christian nickte, obwohl er nicht wusste, was genau damit gemeint war. Unterdessen lockerte der Wein die Zungen. Aufgeräumt tauschten die beiden Erinnerungen aus. Die frühen Jahre erschienen ihnen seltsam verklärt und selbst die unerfreulichsten Zwischenfälle bekamen einen romantischen Glanz. Zwangsläufig sprachen sie auch über ihre damaligen Ziele, wobei Christian die Frage auf der Zunge lag, ob sein Gastgeber dem großen Ziel, Bürgermeister zu werden, näher gerückt sei. Er wagte nicht, sie auszusprechen. Gottfried kam schließlich von selbst auf das Thema. "Wir hatten damals alle so unsere Flausen. Das Leben hat uns belehrt, dass klangvolle Titel nicht das 128 Wichtigste sind." Er setzte sich in Positur, etwas anmaßend, wie Christian fand. "Ich übernehme demnächst das Handelshaus eines Oheims. Neben dieser Verantwortung könnte ich die Pflichten eines Bürgermeisters kaum erfüllen. Es reicht, wenn ich in den Rat einziehe." "Und du denkst, dass dir dies gelingt?" "Bei den Neuwahlen im Sommer bin ich ein sicherer Kandidat." Das Schweigen, das nun folgte, war nicht frei von Spannung. Gottfried spürte, dass er überzogen hatte, und suchte nach einer versöhnlichen Geste. Ein weiterer Gast indes befreite ihn aus der Verlegenheit - Andreas. Auch der war gut gelaunt. Als er Christian gewahrte, stutzte er zunächst, schickte auch einen misstrauischen Blick zu seinem Förderer hinüber, wurde dann aber rasch unterhaltsam. Er brachte ein paar drollige Geschichte mit, die er nun gekonnt zum Besten gab. Nach dem Abendbrot erkundigte sich der Heimgekehrte, der bislang nur Gerüchte kannte, nach dem geheimnisvollen Vertrag, den der Erzbischof mit der Bürgerschaft abzuschließen beabsichtigte. Für Gottfried war das ein gutes Stichwort. Er kam sofort ins Schwärmen. "Wir haben ihn weich geklopft. Er hebt die ungerechten Zölle auf und zwar ersatzlos. Er verpflichtet sich, an der Weser von Hoya bis hoch ans Meer keine Burgen mehr zu bauen. Die vorhandenen Anlagen übergibt er an uns, die Bürger. Wer hätte vor drei Jahren für möglich gehalten, dass er eines Tages so klein und erbärmlich um Gutwetter bittet?" "Ihm muss das Wasser bis zum Halse stehen", ergänzte Andreas. "Es sind vor allem die Wünsche der Kaufleute berücksichtigt worden", überlegte Christian laut. "Gewiss! Wir haben ja auch am meisten dafür gekämpft." 'Ja, nachdem die Handwerker unter euch aus der Stadt gejagt worden sind', dachte Christian bei sich und sagte: "Hoffentlich sind alle Bürger glücklich damit." "Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann." "Gewiss!" sagte Christian. Gottfried schickte unterdessen einen Knecht in den Keller und ließ einen neuen Krug Wein holen. "Es ist wirklich ein großartiger Kompromiss. Einen besseren hätte niemand ausgehandelt." Christian stutzte. "Sagtest du Kompromiss? Vorhin zähltest du nur Vorteile auf. Es gibt auch Klauseln, die der Erzbischof verlangt hat?" "Jeder Vertrag ist letztlich ein Kompromiss. Der Gerhard will den Rücken frei haben für seinen Kreuzzug gegen die Stedinger. Hast du erwartet, dass sich ein Mann wie er ohne jeden Grund auf Verhandlungen mit uns einlässt, dass er uns aus reiner Freundlichkeit Geschenke überreicht?" "Ich bin kein Dummkopf. Ich meine nur, dass man bei jedem Ding über die Nachteile ebenso reden sollte wie über die Vorteile. Mir scheint, ihr wollt nur das Gute sehen." "Hör sich einer diesen Kleingläubigen an!" rief Gottfried aus, unerschütterlich in seiner guten Stimmung. "Manche Zugeständnisse sind buchstäblich umsonst. Was stört es uns, wenn sich der Erzbischof mit diesen Bauern herumschlägt? Mehr noch - selbst bei dieser Klausel winkt uns noch Gewinn. Von den frei werdenden Gütern der Stedinger erhalten wir jedes dritte. Auch von den Strafgeldern bekommen wir einen entsprechenden Anteil." "Wen meinst du, wenn du wir sagst?" 129 "Die Aufteilung wird in der Verantwortung des Rates liegen." '... womit klar ist, dass die Kaufleute den Löwenanteil erhalten', ergänzte Christian in Gedanken. Ihm erschien der Vertrag durch und durch faul. Da er aber mit seinen Einwänden gegen den lärmenden Optimismus seiner Gesprächspartner nicht ankam, erkundigte er sich lediglich noch, ob die Befürwortung des Vertragsentwurfs einhellig sei in der Stadt. "Die Stedingerklausel hat nicht allen gefallen. Einige sehen in den Bauern natürliche Verbündete. Aber das sind Wirrköpfe. Wir müssen für unsere Sache kämpfen, anstatt uns vor den Karren Fremder spannen zu lassen." Christian wollte dazu eigentlich schweigen, weil er spürte, dass sein Kredit allmählich schwand. Ihm fiel wieder ein, dass er von seinen Pflegeeltern im Unfrieden geschieden war. Er brauchte ein Quartier, um nicht winselnd zu ihnen zurückkehren zu müssen. In seiner zunehmenden Trunkenheit jedoch konnte er den Mund nicht halten. Lallend ergriff er immer offener Partei für die Stedinger. "Vielleicht besiegen die Bauern das Heer des Erzbischofs. Was macht ihr dann? Vielleicht zerstören sie die Burgen an der Weser, die Gerhard euch übergeben will. Ja, sie stürmen sie, um sich an euch zu rächen. Dann habt ihr gar nichts gewonnen. Dann steht ihr mächtig im Regen." "Hör bloß auf! Was haben die nur mit dir gemacht? Du bist kein Bauer sondern ein Bürger. Begreife das endlich!" Christian begriff es nicht, wollte es gar nicht begreifen. Mit der Sturheit des Betrunkenen stritt er sich herum. Im Eifer war er nahe daran, Geheimnisse auszuplaudern. Zu seinem Glück schrieben Gottfried und Andreas seine sonderbaren Reden dem Wein zu. Sie sahen ihm seine Ausfälle nach, so wie man einem trotzigen Kind nichts übel nimmt. Er bekam sein Quartier allein schon deshalb, weil man ihn in seinem ziemlich hilflosen Zustand nicht auf die Straße lassen wollte, erst recht nicht bei Dunkelheit. Wie tief er in den Becher geschaut hatte, wurde ihm am nächsten Morgen bewusst. Neben schrecklichen Kopfschmerzen gab ihm eine Bemerkung Gottfrieds zu denken. "Ein rothaariges Mädchen also ist schuld am gegenwärtigen Zustand deines Geistes! Wer hätte das gedacht von unserem Frauenhasser?" "Woher weißt du ...?" Gottfried konnte sich kaum halten vor Lachen. "Du hast fast die ganze Nacht über davon erzählt." III C hristian blieb bei Gottfried wohnen und das Zusammenleben im Alltag gestaltete sich besser als erwartet. Er übernahm kleine Arbeiten im Kontor, in die er recht schnell hineinfand. Dafür bekam er (neben Verpflegung und Unterkunft) sogar einen kleinen Lohn, der ihm das Gefühl gab, frei zu sein. Zu seinen Pflegeeltern hatte er praktisch keine Verbindung mehr. Als er Meister Berthold einmal zufällig auf dem Marktplatz sah, tat er so, als bemerke er ihn nicht. Am Abend empfing Gottfried häufig Gäste, vor allem Parteigänger und Geschäftspartner. Je näher der Tag der Vertragsunterzeichnung heranrückte, desto länger dauerten die Zusammenkünfte. Gegenstand der Gespräche 130 war nicht der Vertragstext. Der stand längst fest. Es ging schon um die Zeit danach. In ganz Bremen rüsteten sich die Leute für den Kampf um den erwarteten Gewinn. Jeder wollte sich ein Stück vom Kuchen sichern. Während die Bürger ihre Einigkeit als Grundpfeiler des erstaunlichen Sieges lobten, waren sie insgeheim schon wieder heillos zerstritten. Christian hatte mit all diesen Dingen nichts zu tun. Er war nur noch ein mittelloser Angestellter, ein besserer Knecht. Deshalb wunderte er sich, als Gottfried ihn eines Tages zu einer Versammlung ausdrücklich einlud. Er sollte sogar als Zeuge der Vertragsunterzeichnung beiwohnen. Welcher Umstand ihm diese Ehre verschafft hatte, erfuhr er nie. Am wahrscheinlichsten erschien ihm, dass er in der Delegation einen für die Zünfte des Handwerks vorgesehenen Platz blockierte. Der Gedanke an diese Möglichkeit amüsierte ihn köstlich. Da verzehrte sich Meister Berthold vor Kummer, weil seine Zunft ihn seines ungeratenen Pflegesohns wegen gerüffelt hatte, und nun vertrat eben dieser Pflegesohn alle Zünfte der Stadt vor dem Erzbischof! Die Vertragsunterzeichnung wurde mit großem Gepränge inszeniert. Die Bürger hatten daran nur einen bescheidenen Anteil. Sie schmückten ihre Häuser und trafen sich zu dem einen oder anderen Freudenfest. Der Erzbischof dagegen versetzte ganz Niedersachsen in Aufruhr. Offenbar legte er Wert darauf, dass jeder, wirklich jeder von dem Vertrag erfuhr. Ein Heer von Boten hetzte umher. Die mächtigsten Adligen der Gegend um das Stedingerland wurden als Zeugen herbeizitiert, und zwar mit solchem Nachdruck, dass ein Fernbleiben einem Affront gleichgekommen wäre. Unmengen feinster Speisen und ausge- suchtester Weine sollten den großartigen Rahmen schaffen. Die abermalige Verschönerung der Wappen auf dem Domplatz fiel da kaum noch ins Gewicht. Ein wenig aufgeregt war Christian schon, als er mit elf anderen Bürgern Bremens zum Palast des Erzbischofs zog, obgleich er keinerlei Aufgabe während des Zeremoniells zu erledigen hatte. Von den Kleidern, die er trug, gehörte kein einziges Stück ihm selbst. Von Gottfried von Kopf bis Fuß ausstaffiert, kam er sich vor wie ein Diener. Mit Sicherheit passte er nicht hinein in diese Gesellschaft angesehener Kaufleute. Die alten Familien waren allesamt vertreten. Drei steinreiche Emporkömmlinge ergänzten die Runde. Alle platzten fast vor Selbstgefälligkeit. Ihr Geltungsdrang ließ sich an diesem Tag vortrefflich befriedigen. Auf dem Weg vom Haus des Rates bis zum Palast des Stadtherrn bildeten die Leute Spalier. Die meisten von ihnen lebten noch in der Illusion, dass auch für sie persönlich etwas Nützliches herausspringen könnte. Frauen jubelten mit heller Stimme. Männer stemmten Kinder in die Höhe. Die Höfe des Palastes waren von Fahrzeugen aller Art und Größe fast gänzlich versperrt. Dazwischen hatte man Pferde angepflockt. Offenbar reichte der Platz in den Ställen nicht mehr aus. Etliche gut eingewiesene Dienstleute waren aber eifrig bemüht, die Ordnung trotz allem aufrecht zu erhalten. Sie eilten unermüdlich umher und wiesen die Ankömmlinge nach einem bestimmten Plan ein. Auch die zwölf Bürgerlichen wurden sofort in Empfang genommen und in eines der vielen Zimmer geleitet, wo sie warten sollten. Nach einiger Zeit holte ein Mönch sie dort wieder ab und führte sie mit feierlichem Ernst in den großen Saal. 131 Christian war ein wenig enttäuscht, als er eintrat. Er hatte hier die letzte Steigerung, die absolute Krönung der Pracht erwartet und fand sich einer Leere gegenüber, die ihn unwillkürlich an eine riesige Scheune denken ließ - im Frühjahr, wenn fast nichts darin lagert. Spärlich der Schmuck an den Wänden, spärlich auch das Mobiliar. Vermutlich wollte der Erzbischof dem Zeremoniell dadurch eine besondere Erhabenheit verleihen. Für die Prachtentfaltung blieb noch genügend Gelegenheit beim für den Abend vorgesehenen Festmahl. Gesteigert wurde der spartanische Eindruck des Saales noch dadurch, dass sich kaum Menschen darin aufhielten. Der Tür gegenüber, schier endlos weit entfernt, saß vorerst nur Gerhard II inmitten des Domkapitels. Der Einzug erfolgte streng gemäß der Ständeordnung und die Bürgerlichen waren zuerst dran. Damit sie sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlten, billigte ihnen der Erzbischof als Ausgleich einen Platz unmittelbar am Unterzeichnungstisch zu. Nun kamen nach und nach die hochrangigen Zeugen herein, jeweils angekündigt von einem neben der Tür stehenden Herold. Graf Heinrich III von Bruchhausen erschien mit seinen beiden Söhnen Heinrich dem Jüngeren und Ludolf. Ansonsten bestand sein Gefolge nur aus wenigen Rittern. Das beeinträchtigte aber keineswegs sein Selbstbewusstsein. Erst kurz vor dem Kirchenfürsten beugte er den Rücken, im letzten Moment bevor er einer Unhöflichkeit schuldig geworden wäre. Burchard von Wildeshausen zog eine Anhängerschaft wie ein Herzog hinter sich her. Er hatte wirklich jeden aufgeboten, der in Frage kam, unbekümmert darum, dass er sein Land ohne einen einzigen erfahrenen Hauptmann nahezu schutzlos zurückließ. Sein Gesicht drückte Missmut aus. Es hieß, er wäre gern mit den Zeichen eines Kreuzzugführers erschienen, was Gerhard II ihm aber verboten hätte. Vielleicht grämte er sich auch, weil nicht er sondern (wie seit eh und je) der Graf von Oldenburg den Höhepunkt des Einzugs bilden durfte. Daraus ging hervor, wie sehr der Erzbischof noch immer um dessen Mitwirkung beim Kreuzzug buhlte. Christian hatte seinen großen Namensvetter noch nie so nah gesehen und staunte über dessen frisches, jugendliches Auftreten. Rein äußerlich entsprach der beleibte, ein wenig träge Bruder des Grafen weit eher seinem Bild von einem hochrangigen Adligen. Wer allerdings die Gesichter der beiden genau studierte, erkannte durchaus, wer von ihnen der Machtmensch war und wer das glatte Gegenteil davon. Das Gefolge der Oldenburger stand dem der Wildeshausener zwar zahlenmäßig nach, hatte aber einen sichtbaren Vorteil, was die Vornehmheit betraf. Zwei Männer des niederen Adels fielen auf - der Edelherr von Stotel und der Ritter von Westerholt. Jeder von ihnen führte ein Aufgebot von fünf weiteren Vasallen an. Christian fühlte, wie sein Herz heftiger zu schlagen begann. Wilhelm von Westerholt, der Bruder seines leiblichen Vaters Egbert von Westerholt! War da irgendeine Ähnlichkeit in den Zügen? Das von der Sonne und vom salzhaltigen Wind gegerbte, vorzeitig faltig gewordene Gesicht gab keine Auskunft mehr darüber. Absurde Einfälle drängten sich ihm auf. Wenn er nun plötzlich aufstünde und sich dem Oheim zu erkennen gäbe, ihm vor all diesen Herren um den Hals fiele? Oder wenn er ihm nun Grüße ausrichtete von seiner Tochter, der Herrin über eine andere, tief im Wald verborgene Burg? Doch er 132 ermahnte sich zur Ordnung. Gerade entrollte ein Mönch den Vertag und las ihn mit klarer, kräftiger Stimme vor. Das eigentliche Zeremoniell begann. Erzbischof Gerhard II bestätigte, dass der Entwurf sein Wille sei und zugleich sein Angebot an die Bürger Bremens. Danach war der Rat an der Reihe, dessen Sprecher sich im Namen der Stadt mit dem Text einverstanden erklärte. Anschließend traten die Zeugen auf. Fünf von ihnen waren ausersehen, durch Siegel und Unterschrift ihre Anwesenheit zu bestätigen - die Grafen Christian II von Oldenburg, Burchard von Wildeshausen und Heinrich III von Bruchhausen sowie der Edelherr von Stotel und der Ritter Wilhelm von Westerholt. Sie traten nacheinander an den Unterzeichnungstisch und leisteten beides in genau vorgeschriebener Weise. In Christian weckte solcherlei Pathos Misstrauen. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass eine Sache umso fragwürdiger ist, je aufdringlicher sie als großartig angepriesen wird. Unter dem Vorwand, den Bürgerlichen Sicherheit zu geben, wertete der Erzbischof den Vertrag über Gebühr auf. So sollte ihn später König Heinrich bestätigen, ein Mann den Gerhard sonst zu bekämpfen pflegte. Christian hörte kaum zu. Ihn interessierten mehr die kleinen Gesten am Rande. Feindselige und einladende Blicke, ein kurzes Zögern, verständnisinniges Nicken. Dergleichen sagte mehr über die wahren Verhältnisse aus als jene Urkunde, gab auch Auskunft darüber, was sie einmal wert sein würde. Nach der Unterzeichnung trennten sich die Bürgerlichen. Die Kaufherren verließen den Palast, um am späten Nachmittag zum Festessen zurückzukehren. Sie wollten sich umziehen, die betont seriöse Kleidung ablegen und stattdessen ihren Reichtum zur Schau stellen. Christian, der anbehalten musste, was Gottfried ihm überlassen hatte, blieb als einziger zurück, was ihm zu erstaunlichen Beobachtungen verhalf. Selbst jemand, der sich nur auf den Höfen und in einigen wenigen Räumen aufhalten durfte, übersah nicht die hektische Betriebsamkeit, von welcher der Palast plötzlich erfüllt war. Während die Gefolgsleute ähnlich den Bürgerlichen den freien Nachmittag für einen Gang durch die Stadt nutzten, vielleicht auch für ein kleines Geschäft im Viertel der Handwerker, blieben die hochadligen Zeugen und ihre engsten Vertrauten verschwunden. In verschwiegenen Räumen saßen sie zu geheimen Verhandlungen zusammen. Näheres wussten Diener, die zuweilen in kleinen Gruppen beieinander standen. Obwohl sie leise sprachen, schnappte Christian zuweilen ein paar Sätze auf. Der Erzbischof schmiedete an einem Bündnis der verfeindeten Verwandten für seinen Kreuzzug. So rasch würde er sie nicht wieder alle beieinander haben. Plötzlich überkam Christian ein unbezwingliches Gefühl des Ekels, ein körperlicher Widerwille, als hätte er Verdorbenes gegessen. Die Neugier verflog. Er hielt es nicht mehr aus auf den Höfen des Palastes, trat auf den Domplatz hinaus und schlug den Weg zu Gottfrieds Haus ein. Unterwegs aber kehrte das Ekelgefühl zurück. Er erinnerte sich der selbstzufriedenen Gesichter der Delegierten. Was hatte er mit diesen Leuten gemein? Gewiss, er konnte bei Gottfried wohnen und arbeiten. Doch welch einen Preis müsste er dafür bezahlen! All diese Heuchelei, all diese Selbstverleugnung! Er würde das nicht mehr lange durchhalten. Er kannte sich. Als er das Haus betrat, stand sein Entschluss fest, was ihm die Fähigkeit 133 gab, glaubhaft zu lügen. Sein Pflegevater habe ihn zu sich bestellt und eine solche Aussprache könne er nicht einfach in den Wind schlagen. Er zog sich um und schnürte heimlich sein Bündel, was nicht lange dauerte, denn seine Habseligkeiten waren nicht der Rede wert. Am Stadttor wunderte sich die Wächter, dass er um diese Zeit, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, noch nach draußen wollte. Aber auch für sie hatte er sich etwas zurechtgelegt. Er gab sich als Boten des Rates aus und tat sehr geschäftig. IV D ie Nacht wurde empfindlich kalt. Christian konnte nicht schlafen. Um sich warm zu halten, hüpfte er umher wie ein Gnom. Dennoch war er guter Stimmung. Jenes Gefühl, was er auf dem Wege nach Bremen vermisst hatte, das Gefühl, nach Hause zu gehen, es stellte sich sonderbarer Weise jetzt ein. Er freute sich darauf, die Leute aus der Waldhütte-Burg wieder zu sehen, redete in Gedanken schon mit ihnen. Ihm war, als sei ein große Last von ihm genommen worden, ohne dass er sich erklären konnte, worin diese Last eigentlich bestand. Erst am Eingangstor fiel ihm ein, dass manche ihm die Wochen in Bremen vielleicht übel nahmen. Möglicherweise fragten sie sich, warum er plötzlich wieder da war, ob er gar als Spion zurückkehrte. Vor derlei Verdächtigungen aber bewahrte ihn sein Freund Norbert. Ihm brauchte er nichts zu erklären. "Ich habe fest damit gerechnet", sagte er. "Du wolltest mir nicht glauben, wolltest unbedingt nachsehen, ob nicht ein Wunder geschehen ist. Nun bist du um eine Erfahrung reicher." Während Christian durch die Anlage lief, kam es ihm so vor, als sei er gar nicht fort gewesen, zumindest nicht für länger als einen Tag. Viel hatte sich nicht geändert. Sogar sein Schlafplatz war noch frei. Er packte sein Bündel wieder aus und wollte sich von der Wanderung ausruhen. Die Erschöpfung hatte ihm am Schluss hart zugesetzt. Dennoch fand er jetzt, da sich in einem festen Haus auf einem weichen Lager die Gelegenheit für erholsamen Schlaf bot, lange keine Ruhe. Eine Stimme in ihm sagte beharrlich, dass er noch etwas erledigen müsse. Er schloss die Augen und öffnete sie im nächsten Moment wieder. Dabei fiel sein Blick jedes Mal auf ein Balkenkreuz schräg über ihm. Er fragte sich, was es damit auf sich hatte, doch seine Gedanken verwirrten sich wie im Fieber. Als er erwachte (nach wie langer Zeit wusste er nicht), stand Ramira neben seinem Lager. Sie beobachtete ihn aus ihren klarblauen Augen aufmerksam, so wie jemand, der eine Antwort auf eine ihn sehr beschäftigende Frage sucht, wie ein Arzt beinahe. Ihm war etwas unbehaglich dabei. Er richtete sich halb auf und fragte unsicher: "Willst du etwas von mir?" Sie schüttelte den Kopf und wandte sich ab. "Hast du schon lange dort gestanden?" "Nicht sehr lange." Plötzlich fiel Christian die erste Nacht bei Gottfried ein. Im Weinrausch hatte er damals träumend von ihr geredet. "Ich erzähle manchmal im Schlaf so Sachen ..." Er brach ab, lauerte auf ihre Reaktion. Doch er erfuhr nichts. Sie war leider ein 134 sonderbares Mädchen, in das man nicht leicht hineinzublicken vermochte. Ihr gleichgültiges Schweigen konnte alles Mögliche bedeuten. Immerhin lud sie ihn zum Essen ans Lagerfeuer ein. "Die anderen warten schon. Ich nehme an, dass du ziemlich hungrig bist." Nach dem Essen ging Christian zu Franziska, um ihr Bericht zu erstatten. Zuerst setzte er ihr die Lage in Bremen auseinander. Sie hörte ihm aufmerksam zu, wollte alles sehr genau wissen, erkundigte sich nach den Hintergründen. Im Grunde war sie im Nachhinein froh über seinen Ausbruchsversuch. Endlich erfuhr sie aus dem Mund eines vertrauenswürdigen Kameraden die Einzelheiten zu den seit langem kreisenden Gerüchten. "Wir mussten damit rechnen, dass Gerhard sich eines Tages auf diese Weise Handlungsfreiheit verschafft", bemerkte sie, als sie alles wusste. "Kaufleute sind als Freunde unzuverlässig. Sie verraten jeden, sobald ihnen ein besseres Geschäft winkt. Das sage ich, obgleich ich in einen Kaufherrensohn unsterblich verliebt war und ihn beinahe geheiratet hätte." Christian konnte dem nicht widersprechen und fügte lediglich hinzu: "In der Bürgerschaft haben sich die falschen Leute durchgesetzt. Ich fürchte, das wird ihnen allen noch teuer zu stehen kommen." "Das soll unsere Sorge nicht sein." "Die Vertragsunterzeichnung war ein großes Ereignis." "Das glaube ich dir." "Aber du weißt noch nicht, wen der Erzbischof alles als Zeugen bestellt hat." Er suchte nach einem Übergang, fiel dann aber doch mit der Tür ins Haus. "Auch dein Vater war dabei." Franziska zuckte zusammen. "Mein Vater? Wilhelm von Westerholt? Er war in Bremen?" "Ja, als Vasall des Grafen von Oldenburg." Nun zählte keine Politik mehr. Christian musste einen ganzen Sturm von Fragen beantworten. An vieles konnte er sich so genau gar nicht mehr erinnern. Jetzt bereute er, dass er am Nachmittag nach der Vertragsunterzeichnung nicht wenigstens versucht hatte, mit Wilhelm ein paar Worte zu wechseln und etwas über das Leben in der Wardenburg zu erfahren. Franziska wäre ihm gewiss sehr dankbar dafür gewesen. Als er ging, wunderte er sich, dass ihr trotz ihres Scharfsinns nicht aufgefallen war, dass sie und ihr Vater auf verschiedenen Seiten standen. Mit keinem Wort hatte sie es erwähnt. Vielmehr redete sie so, als könne ein glückliches Wiedersehen allenfalls noch zwei oder drei Wochen auf sich warten lassen. Sicherlich wollte sie die Wahrheit in diesem Fall nicht gelten lassen. 135 12.Kapitel I A n dieser Stelle sehe ich mich genötigt, die Chronik zum Zwecke einer Ergänzung zu unterbrechen, da ich auf Berichte gestoßen bin, die ich als bedeutsam ansehe. Die Geschehnisse, um welche es sich dabei handelt, betreffen Seine Majestät Friedrich II, Kaiser des Heiligen römischen Reiches deutscher Nation, und Seine Hoheit Heinrich VII, seinen Sohn, König über die deutschen Lande an seiner Statt, sowie das Verhältnis beider zueinander. In dem Maße, wie der Kaiser sich durchzusetzen vermochte, vollzogen sich Veränderungen, deren Auswirkungen bis hierher nach Oldenburg und Bremen reichen. Anno Domini MCCXXXI, dreiundzwanzigsten Januar am Auf dem Reichstage zu Worms sieht sich Seine Königliche Hoheit Heinrich VII, noch unter dem Eindruck der strengen Ermahnung durch den Kaiser, seinem Vater, gezwungen, den Forderungen der mächtigsten Fürsten der deutschen Lande nachzugeben, dergestalt, dass er etliche seiner, den Bürgerlichen nützlichen Gesetze zurücknimmt und darüber hinaus allen Städten auf Dauer verbietet, untereinander Bündnisse abzuschließen. Anno Domini MCCXXXI, am ersten Mai Seine Majestät Kaiser Friedrich II erlässt in Cividale eine Gesetzessammlung mit dem Namen Statutum in favorem principum. Er verzichtet darin ausdrücklich auf die Ausübung gewisser Hoheitsrechte auf den Gebieten der weltlichen und geistlichen Fürsten, so insbesondere auf das Münzrecht. Außerdem untersagt er den Städten, Pfahlbürger und Hörige in ihren Mauern aufzunehmen, wie es bisher durchaus Brauch war, sobald Seuchen oder andere Umstände einen Mangel an Arbeitskräften schufen. Anno Domini MCCXXXI, im Herbst Seine Hoheit Herzog Ludwig von Bayern fällt einem hinterhältigen Mordanschlag zum Opfer. Niemand weiß, wer die feigen Mörder sind und wer sie gedungen hat. Jedermann kennt jedoch das schlechte Verhältnis des ehemaligen Reichsverwesers für die deutschen Lande zu Seiner Königlichen Hoheit Heinrich VII, seinem früheren Mündel. Deshalb wirft die Bluttat einen Schatten auf letzteren und verschlechtert dessen ohnehin ungünstige Lage. Anno Domini Weihnachten MCCXXXI, an Seine Majestät Kaiser Friedrich II beruft in Ravenna einen Reichstag ein. Er hatte dergleichen bereits einen reichlichen Monat zuvor zu bewerkstelligen versucht. Die Heere der Lombardischen Städte jedoch hielten damals die Zufahrtswege besetzt und verhinderten so die Anreise der Fürsten. Seine Königliche Hoheit Heinrich VII erscheint trotz ausdrücklicher Einladung nicht und bleibt statt dessen im elsässischen Hagenau, wobei er behauptet, die Bedrohung sei nach den ihm zugegangenen Meldungen noch nicht vorbei. Vermutlich beabsichtigt er, auf diese Weise neuerliche Demütigungen zu vermeiden. Von den gefassten Beschlüssen halte ich drei für so bedeutsam, dass ich sie in meiner Chronik erwähnen möchte. Primo: Ketzer sollen von nun an und für immer grundsätzlich als Strafe den Feuertod erleiden. Secundo: Wenn sich eine Stadt einen Rat wählt, so soll die Wahl erst dann gültig genannt werden dürfen, wenn der jeweilige Stadtherr seine Zustimmung gegeben hat. Tertio: Die aufsässigen Lombardischen Städte werden mit ausdrücklicher Zustimmung der Fürsten mit dem Bann Seiner Majestät belegt. allein in der Bibliothek. Hätte nicht ab und an eine Maus geraschelt, wäre es totenstill um ihn herum gewesen. Der Lichtkegel der Öllampe begrenzte seine Welt auf einen engen Teil des Raumes. Da fragte er sich, ob er nicht tatsächlich allmählich ein Trottel wurde, ein Dummkopf mit dem Wissen eines Pariser Professors, ein Prophet, den niemand ernst nahm und dessen Tun deshalb sinnlos war. Betrog er sich nicht selbst, wenn er behauptete, mit dem Schreiben am meisten bewirken zu können? Er lebte ziemlich bequem in seiner geistigen Welt. Plötzlich zweifelte er sogar seine Chronik an. Was wusste er denn von den Verhältnissen in den Städten? Er hatte sich in Bremen umgesehen, aber nur wenige Eindrücke gesammelt, winzige Ausschnitte gesehen, die vielleicht typisch waren, vielleicht aber auch völlig abwegig und kurios. Immer verzweifelter wurde er, bis er sich sagte, dass er wahrscheinlich überarbeitet sei. Er musste sich für diesen Tag losreißen, sich ins Bett legen und am nächsten Morgen noch einmal über alles nachdenken - über die Städte, über sich selbst, über sein Werk. Gerade in dem Augenblick, da er von seinem Hocker aufstehen wollte, vernahm er Schritte, die sich rasch näherte. Seine überreizten Nerven ließen ihn entsetzt zusammenfahren. Wer rannte um diese Zeit noch im Schloss umher? Er wäre selbst angesichts eines Gespensts mit hässlicher Fratze nicht überrascht gewesen. In Wahrheit kam Mechthild herein, noch völlig angekleidet und in heller Aufregung. "Was ist geschehen?" fragte Otto verwirrt. Die junge Frau rang nach Atem, nicht nur des schnellen Laufens wegen. "Es geht zu Ende mit ihm. Er liegt im Sterben." Anno Domini MCCXXXII, im Mai Seine Majestät Kaiser Friedrich II nötigt Seine Königliche Hoheit Heinrich VII, seinen beim Reichstag zu Ravenna nicht anwesenden Sohn, in Aquileia mit ihm zusammenzutreffen und dort feierlich zu schwören, in seiner Politik nichts zu unternehmen, was den jüngst beschlossenen Gesetzen zuwiderläuft, sondern vielmehr alles zu tun, was ihnen förderlich ist. Anno Domini MCCXXXII Seine Majestät Kaiser Friedrich II hält sich abermals in Cividale auf und bekräftigt dort alle die Städte betreffenden Gesetze. Er verfügt darüber hinaus, dass von nun an auch der Verkauf und die Verpfändung von Grundeigentum zu den Dingen gehören mögen, welche der Zustimmung des Stadtherrn bedürfen." Otto von Oldenburg legte die Feder aus der Hand und streckte den steif gewordenen Rücken. Draußen war die Dunkelheit hereingebrochen. Er saß 137 "Wer liegt im Sterben?" "Dein Bruder. Komm mit hinüber in den Palas!" Otto starrte sie an. Er war wie gelähmt. Trotz aller Gegensätze liebte er seinen Bruder. Es gab in ihm eine geheimnisvolle Anhänglichkeit, die ihn nach jedem Streit verzeihen ließ. Und noch ein anderes Gefühl stieg in ihm auf, langsam zunächst, dann aber so mächtig, dass es ihm die Kehle zudrückte - die Furcht vor der Verantwortung für etwas, das er kaum kannte, für die Grafschaft Oldenburg. Wie ein Schlafwandler folgte er seiner Frau. II D as Obergeschoß des Palas war durch unzählige Kerzen fast taghell erleuchtet. Die Kerzen standen aber nicht der Helligkeit wegen dort. Sie hatten den Zweck, Gott, den Allmächtigen, im letzten Moment noch umzustimmen. Geweihte Kerzen als letzter, verzweifelter Versuch, seitdem der Arzt, seine Ohnmacht eingestehend, nichts mehr tat. Vor dem Bett kniete der Priester und sprach mit gedämpfter Stimme Gebete, unermüdlich, beharrlich. Gräfin Agnes saß apathisch in einem Sessel. Der neunjährige Johann weinte und versuchte vergeblich, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das völlig verunsicherte Kind war dankbar, als Mechthild und Otto hereinkamen. Die junge Frau nahm ihn zu sich und beantwortete leise seine Fragen. Christian litt seit drei Tagen unter Kopfschmerzen und Schwindelanfällen, wollte jedoch noch einiges erledigen, das (in seinen Augen) keinen Aufschub erlaubte. Seit der Erzbischof mit seinen Bürgern in Frieden lebte, wurden die Kreuzzugsvorbereitungen geradezu hektisch vorangetrieben. Boten jagten zwischen den Höfen hin und her, ritten ihre Pferde zu Schanden dabei. Der Graf vertraute auf seinen Körper, den er für kräftig hielt. Er zwang sich, am Morgen so wie immer aufzustehen. Seinen Angehörigen und Freunden versicherte er, dass sie sich um ihn nicht zu sorgen brauchten. Wenn sich das Zimmer um ihn zu drehen begann, gönnte er sich nur so lange Ruhe, wie der Anfall dauerte. An jenem unheilvollen Tag ging dann alles sehr schnell. Er brach zusammen wie vom Blitz gefällt. Seine Stirn war glühend heiß. Er phantasierte. Am späten Abend erst wurden seine Gedanken noch einmal klar. Doch da hatte der Arzt ihn schon aufgegeben. Es war dies nur noch das letzte Aufbegehren des Lebens, welches dem Tod häufig voranzugehen pflegt. Diese jähe Wende schmetterte die Angehörigen vor allem nieder, der gefürchtete plötzliche Tod. Bei jedem hätte man es erwartet, nicht bei Christian, dem immer das Glück zur Seite stand, immer die Sonne lachte. Salome, die alte Gräfin, die ganz selten die Burg verließ, sie war trotz der Krankheit ihres Sohnes zu ihrer Tochter ins Kloster Bassum gereist. Nicht von ungefähr fehlte in kaum einer Kirche die riesige Darstellung eines Christophorus, des Schutzheiligen gegen eben jenes schreckliche Ende, das keine Erlösung aus langen Leiden ist sondern ein Herausgerissenwerden mitten aus glücklichem Dasein. Otto trat an das Bett seines Bruders heran. Jetzt dachte er nur noch an ihn und war gänzlich erfüllt von Mitgefühl. "Gib nicht auf! Wenn Gott es will, lässt er ein Wunder geschehen. Ich habe 138 schon manchen wieder aufstehen sehen, auf den niemand mehr wetten wollte." Christian lächelte leicht. Sein Gesichtsausdruck hatte sich verändert. Keine Spur von Hochmut war mehr darin zu finden, nicht mehr die unerschütterliche Selbstsicherheit, in die sich ein Hauch von Härte mischte, statt dessen eine sonderbare Entspanntheit, ein beinahe übersinnlicher Glanz. "Du willst mich trösten. Dafür danke ich dir. Aber es hat keinen Sinn. Sag bitte dem Priester, dass er aufhören soll, den Allmächtigen zu bedrängen! Vielmehr soll er die letzte Ölung vorbereiten." "So sicher bist du dir, dass es das Ende ist?" "Ja, denn ich habe begriffen, aus welchem Grunde ich sterbe. Darüber möchte ich mit dir gern reden." "Ich höre dir zu." "Es gibt einen Geheimvertrag zwischen mir und dem Erzbischof von Bremen. Gerhard verzichtet darin auf alle lehnsherrlichen Forderungen gegenüber den Oldenburgern. Als Gegenleistung verpflichten diese sich endgültig und unwiderruflich zur Teilnahme am Kreuzzug gegen die Stedinger." Er schwieg und schloss für einen Moment die Augen. Otto begriff nicht recht. "Was hat das zu tun mit deiner Krankheit?" "Das fragst gerade du? Erinnerst du dich nicht mehr an unser letztes längeres Gespräch? Wie du mir ins Gewissen geredet hast und ich nichts hören wollte? Nun, du warst im Recht, damals und auch schon in den Jahren zuvor. Leider weiß ich das erst jetzt, nachdem Gottes Schwert auf mich herab gefahren ist." Otto war unbehaglich zumute. Nein, auf diese Art wollte er nicht Recht behalten. "Gott kann auch verzeihen." "Ja, das kann er. Sonst gäbe es für mich keine Hoffnung mehr. Gott vergibt dem reumütigen Sünder. Ich weiß jetzt, dass irdische Dinge nichts gelten im Vergleich zum Seelenheil. Ich habe alles von mir geworfen, bin kein Graf mehr, kein Angehöriger des Hochadels, nur noch ein einfacher, unwürdiger Mensch, der sich dem Allmächtigen anvertraut wie ein unmündiges Kind dem Vater." Otto rannen Tränen über die Wangen. "Du brauchst nicht um mich zu weinen", sagte Christian, wieder mit jenem übernatürlichen Lächeln. "Geh deinen Weg weiter! Lass dich nicht beirren! Dann wirst du eines Tages weniger zu bereuen haben als ich. Und nun lass mich mit dem Priester allein!" Gehorsam zog sich Otto zurück. Im Nebenraum traf er Mechthild mit Johann. Agnes hatte sich (auf ihre Überredung hin) zu Bett gelegt. Als er sie sah, wurde ihm schlagartig wieder bewusst, dass er nun der Graf von Oldenburg war. Christian hatte ja die irdischen Dinge von sich geworfen. Und er übernahm die Herrschaft in unruhiger Zeit. Der Kreuzzug stand bevor, jener Krieg, gegen den er mehr Abscheu denn je empfand und an dem er sich (eines von seinem Bruder abgeschlossenen Vertrages wegen) wohl beteiligen musste. "Ich kann es nicht", sagte er und verbarg sein Gesicht in den Händen. "Was ist, wenn ich ablehne, wenn ich mir den goldenen Reif nicht aufsetzen lassen?" Mechthild legte ihm den Arm um die Schultern. "Du weißt so wie jeder im Schloss, dass dir keine Wahl bleibt. Du kannst zurücktreten, sobald Johann volljährig ist. Bis dahin aber musst du ihm die Grafschaft bewahren." 139 Er seufzte und erhob sich schwerfällig. "Ja, genau so verhält es sich." Mechthild spürte, dass sie ihm noch irgendetwas Tröstendes sagen musste. "Du wirst weise Entscheidungen fällen und die Leute werden dich mögen. Und außerdem hast du eine kluge Frau." Da konnte er sogar wieder lächeln. "Meine kluge Frau werde ich jetzt wohl mehr brauchen als je zuvor." III E s war zu einer Regel in der Waldhütte-Burg geworden, dass jeden Dienstag ein Bote aus dem Stedingerland mit Franziska redete und diese die Neuigkeiten abends am Feuer weitergab. Die Bauernsöhne lauschten dabei mit angehaltenem Atem auf jedes Wort. Sie dachten an ihre Familien und sorgten sich wegen der Bedrohung, die von den Kreuzzugsvorbereitungen des Erzbischofs ausging. Die Flüchtlinge aus Bremen sahen den Lauf der Ereignisse meistens gelassener. An jenem Tage aber war die Aufregung allgemein. Schon bevor Franziska das Wort ergriff, liefen Gerüchte um. Offenbar stand der Krieg unmittelbar bevor. "Freunde! Die Universitas hat beschlossen, den Feindseligkeiten des Bremer Erzbischofs und seiner Anhänger nicht länger tatenlos zuzusehen. Noch in dieser Woche sammelt sich ein Heer." Jubel brach los. Etliche der jungen Männer hatten sich ihre Schwerter und Schilde mitgebracht und vollführten einen Höllenlärm damit. Franziska biss sich missmutig auf die Lippen. Leider war sie verpflichtet, die Begeisterung eher zu fördern als zu unterdrücken. "Diese Entscheidung ist den Stedinger-Führern nicht leicht gefallen. Krieg bedeutet, dass Frauen um ihre Männer und Kinder um ihre Väter trauern werden. Andererseits ist die Zahl der Opfer vielleicht geringer, wenn wir den ersten Schlag führen." Nun wurde sie mit Fragen bestürmt. Wem sollte der Angriff gelten? Der Stadt Bremen? Einem Kloster der Dominikaner? Einer Streitmacht des Erzbischofs, die er heimlich zusammengezogen hat? Das wusste sie jedoch selbst nicht. Sie hatte lediglich den Befehl erhalten, ihre Anhängerschaft zu einer genau bezeichneten Wiese im Stedingerland zu führen. Als unmöglich erwies sich, Freiwillige zu finden, die in der Waldhütte-Burg bleiben sollten. "Eine Handvoll Leute kann gegen einen Angriff nichts ausrichten", war die einhellige Meinung. Doch zum einen forderte die Universitas ausdrücklich eine Bewachung der Anlage und zum anderen wollte Franziska, dass Pentia und die kleine Beatrice Beschützer hatten. Am Ende entschied das Los. Während der Aufbruchsvorbereitungen herrschte eine beinahe ausgelassene Stimmung. Bedrückt waren nur Franziska und Norbert, die ihr Töchterchen zurücklassen mussten. Am Nachmittag verfügten sie, dass niemand sie stören dürfe. "Es ist nur für ein paar Tage", sagte Norbert. "Höchstens für zwei Wochen." Franziska antwortete nicht. Sie fragte sich, ob er seinen Worten selber glaubte. Zugleich überkam sie (einmal mehr) die Verwunderung darüber, noch 140 immer Anführerin zu sein. Welche Vorzüge hatte sie den anderen gegenüber, von ihrer Abstammung einmal abgesehen? Leider besaß sie nicht einmal geheimes Wissen, wie es vor allem die jungen Stedinger bei ihr vermuteten. "Es wird nicht nur für ein paar Tage sein", flüsterte sie. Beatrice schlief fest. Vorsichtig nahm sie die Kleine ihrer Schwester aus dem Arm. Sie hätte ihr zum Abschied gern noch einmal in die Augen gesehen, aber auch, dass sie nicht aufwachte, gefiel ihr gut, bedeutete es doch, dass sie sich bei ihr unbewusst geborgen fühlte, sich ihrer noch erinnerte. "Ich bin eine Rabenmutter, nicht wahr?" "Wie kannst du so etwas von dir behaupten!" widersprach Pentia, ehrlich empört. "Beatrice ist dein Kind und du wirst es groß ziehen. Ich bin nur so etwas wie eine Amme." "Ich komme bald zurück. Ich beeile mich." Sie wusste, dass sie Unsinn redete, aber ihr fiel nichts Besseres ein. Im Übrigen verstand Pentia sie trotzdem. Die Leute aus der Waldhütte-Burg sollten innerhalb des Bauernheeres ein Fähnlein bilden und waren folglich eine selbständige Einheit. Leider verfügte niemand von ihnen über Erfahrungen in einer Schlacht. Franziska hatte von ihrem Lehrer nur gelernt, mit den Waffen umzugehen. Ziemlich schwach erinnerte sie sich zudem an Übungen vor der Burg des Vaters. Damals war sie noch ein Kind gewesen, ein kleines Mädchen, das sich um die Pflichten der Männer nicht kümmern sollte. Immerhin wusste sie, dass es eine Fahne geben musste, damit sich jeder im Getümmel orientieren kann. Pentia erklärte sich bereit, sie zu nähen. Ramira, die sich mit unerklärlicher Starrköpfigkeit weigerte zurückzubleiben, sollte sie tragen. Als Motiv schlug Franziska ein Symbol der Waldhütte vor, setzte sich damit jedoch nicht durch. Nur das Wappen der Westerholts käme in Frage. Als sie das für unmöglich erklärte, einigte man sich auf eine leichte Abwandlung. Christian versuchte noch bis zum Abmarsch, die Artistin zum Bleiben zu bewegen. "Was versprichst du dir davon? Das wird bestimmt nicht spaßig." "Und warum bleibst du nicht hier? Wird's für dich lustiger sein? Außerdem: Was geht's dich eigentlich an, du treulose Tomate?" "Nun fang nicht wieder damit an!" "Ich komme mit. Wie du siehst habe ich (im Unterschied zu dir) sogar schon einen festen Platz." Sie stieß keck den Schaft der Fahne auf den Boden. "Nun gut! Dann habe ich ab jetzt auch einen Platz. Ich beschütze dich." "Monatelang flüchtest du vor mir wie vor einem Geist und nun werde ich dich nicht mehr los! Männer sind komische Menschen!" Das Waldhütte-Fähnlein traf als eines der letzten im Sammellager der Stedinger ein und wurde schon ungeduldig erwartet. Franziska sollte sich sofort im Zelt der Anführer melden. Dabei musste sie fast das gesamte Lager durchqueren. Sie war verblüfft über die gute Ausrüstung der Bauern. Alle hatten eiserne Waffen, viele sogar eiserne Brustpanzer und Beinschienen. Franziska trug ein Kettenhemd und einen sorgfältig gearbeiteten Wams aus dickem Leder. Darauf war sie stolz gewesen, doch nun kam sie sich darin beinahe ärmlich vor. Vor dem Zelt traf sie Tammo von Huntorf und erstatte ihm Meldung. "Ich fürchtete schon, auf euch verzichten zu müssen", rief er aufgeräumt. 141 Der ehemalige Schmied konnte sich nicht gut verstellen. Deshalb glaubte ihm Franziska seine Freunde über das Wiedersehen. Zugleich staunte sie, dass er sie offenbar nun ernst nahm. Als Fähnleinführer zog er sie ins Vertrauen. "Braucht ihr noch Waffen oder Rüstungsteile?" "Im Wald haben wir keine Schmiede." "Ich verstehe. Führe deine Leute dort zu diesem großen Zelt! Vielleicht finden sie etwas, was sie brauchen. Natürlich sind das nur noch Reste." Für die meisten lohnte sich der Gang. Franziska entdeckte für sich einen passenden, wenn auch nicht besonders schönen Helm sowie zwei eiserne Schalen zum Schutz der Oberschenkel. Mit ihrem leichten Wams war sie zufrieden. Auch ihr kurzes Schwert tauschte sie nicht. Es war aus gutem Stahl, schien allein für sie gefertigt zu sein und hatte ihr schon manchen guten Dienst erwiesen. Zudem sprach ein alter Aberglaube dagegen, sich von einer im Kampf geweihten Waffe ohne Not zu trennen. Für den Morgen des nächsten Tages wurden die Hauptleute und Fähnleinführer zusammen zu einem etwas abseits vom Lager befindlichen Platz bestellt. Nun, da das Bauernheer vollständig war, erläuterte Dietmar tom Diek die politische Lage und beschrieb in groben Zügen die Taktik, die er sich ausgedacht hatte. "Es ist uns gelungen, den Herzog Otto von Lüneburg für ein Bündnis zu gewinnen." Die Versammelten bejubelten den Erfolg mit Waffenrasseln. Dietmar ermahnte sie mit erhobenen Händen zur Ruhe. "Wir wissen, dass der Herzog kein wirklicher Freund von uns ist. Er steht lediglich als erbitterter Feind des Erzbischofs auf unserer Seite und hofft auf persönliche Vorteile. Für uns kam es darauf an, dass er seine Feldzüge mit uns abstimmt. Das hat er getan. Er verfügt über zwei Heere. Mit dem einen belagert er Stade, mit dem anderen zieht er gegen Bremen." Wieder unterbrach ihn anhaltender Jubel. "Der Erzbischof weiß von diesen Angriffen und ist, wie wir von zuverlässigen Gewährsmännern erfahren haben, äußerst besorgt. Seine Verbündeten im Kreuzzug helfen ihm gegen den Lüneburger nicht. In seinen Burgen westlich von Bremen steht deshalb nur noch die halbe Besatzung. Er zog seine Leute heimlich bei Nacht ab, aber einige Bauern beobachteten sie dabei." Da stand jemand auf und brüllte: "Auf die verfluchten Raubnester! Räuchern wir sie aus! Keiner dort drin soll am Leben bleiben!" Die anderen drehten sich um. Das war Wige, der da besprochen hatte. Sein Stern begann zu sinken, weil er Tammos Ausstrahlung und Dietmars Klugheit wenig entgegensetzen konnte. Er grollte innerlich, gab sich aber äußerlich sehr forsch. Kaum eine Versammlung verging, ohne dass er die Worte der Anführer bekräftigte. Denen war das oft gar nicht recht, denn die Steigerung führte meistens zu einer anderen Aussage. Auch diesmal sah Dietmar sich veranlasst zu beschwichtigen. "Aber, aber! Wir wollen kein Blutbad anrichten. Nachdem wir die Burgen zerstört haben, ziehen wir weiter." Dann kam er zu Einzelheiten. "Unser wichtigstes Angriffsziel ist die Schlutterburg. Haben wir sie in unserer Hand, können sich die kleinen Kastelle und Wachtürme in ihrer Umgebung nicht mehr lange halten." Nach der Versammlung sollte sich Franziska noch einmal persönlich bei 142 Tammo melden. Ihr Fähnlein sollte sich sowohl auf dem Marsch als auch im Kampf immer in seiner Umgebung aufhalten. Sie ahnte, dass er sie nicht in vorderster Front haben wollte. Ihr persönlich war das durchaus angenehm, ihre Leute indes empfanden es als Schande. "Vielleicht hätte ich mit Tammo reden sollen", sagte Norbert in einem stillen Winkel zu ihr. "Und du verstehst etwas von Belagerungen?" "Nein, nur ..." "Nichts weiter! Das ist jetzt ein sehr dummer Zeitpunkt, um auf Gleichberechtigung zu pochen." IV A m Nachmittag des übernächsten Tages erschienen die Vorausabteilungen des Bauernheeres vor der Schlutterburg, die wie ausgestorben wirkte. Nur ab und an zeigte sich zwischen den Zinnen der Helm eines Spähers. An der hochgezogenen Zugbrücke war aber zu erkennen, dass die Besatzung den Angriff erwartete. Völlig unbehelligt konnten die Stedinger die Burg einschließen und Stellungen bauen. Franziska stand mit ihrem Fähnlein auf einer leichten Erhebung gegenüber dem Tor. Unter ihr formierten sich zwei Sturmgruppen. Sie näherten sich, hinter gewaltigen Schutzschilden aus Holz gegen Pfeile und Armbrustbolzen geschützt, Schritt für Schritt von zwei Seiten her dem Graben. An anderen Stellen nahmen Schützen ihre Position ein, um Aktionen auf der Mauer sofort zu unterbinden. Durch die Leibwächterrolle ihres Fähnleins konnte Franziska vieles beobachten, was den meisten anderen verborgen blieb. Dietmar ging der erste Teil der Belagerung zu glatt. Die Besatzung plänkelte nicht. Sie unternahm nichts, um (tatsächliche oder vorgetäuschte) Stärke zu zeigen. Sie stellte sich regelrecht tot. Wartete sie auf ein nahendes Entsatzheer? Oder plante sie irgendeine Hinterhältigkeit? Der Abend brachte keine Antwort mehr. Die Dunkelheit senkte sich herab, ohne dass sich noch etwas ereignete. Der nächste Tag begann so, wie der vorige geendet hatte. Tammo und Dietmar bestellten daraufhin sämtliche Hauptleute hinauf auf den Hügel. Während einer langen, hitzigen Beratung wurde das weitere Vorgehen besprochen. Was dabei herauskam, blieb unbekannt, denn urplötzlich entstand eine völlig neue Lage. Eine Strickleiter rollte an der Mauer herab und daran kletterte ein Mann hinunter. Er trug keine Waffen bei sich, was er mehrmals deutlich zu erkennen gab. Die Bauern ließen ihn unbehelligt durch ihre Reihen, während er zielstrebig auf die Anführer zu lief. Er sah blass aus, bewahrte sich ansonsten aber seinen Stolz. Der Burghauptmann war er wohl nicht, eher ein durch das Los bestimmter Parlamentär. "Wir übergeben euch die Burg, wenn ihr uns in Waffen gehen lasst", sagte er trocken. Tammo und Dietmar sahen einander an. Dass die Besatzung die Waffen mitnehmen wollte, behagte ihnen nicht. Das Bauernheer war offenbar drückend überlegen. Sonst hätte die Burgbesatzung aus der sicheren Position heraus gekämpft. Andererseits galt es, die Zahl der Opfer gering zu halten. Dietmar flüsterte nach reiflicher Überlegung: 143 "Sie haben Angst wegen des Blutbades bei der Eroberung vor drei Jahren, können es sich aber nicht leisten, ohne Waffen zu ihrem Dienstherrn zurückzukehren. Wir sollten annehmen." So fiel die mächtige Burg des Erzbischofs, dazu gedacht, die Stedinger auf Dauer einzuschüchtern, ein weiteres Mal in die Hände der Bauern, diesmal gar ohne einen Schwertstreich. Während des Abzugs der Waffenknechte wäre es aber beinahe zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen. Wige versuchte, einige Leute zu einem Angriff auf die Flüchtenden aufzuwiegeln. "Sie sind in unserer Hand!" brüllte er. "Lasst sie nicht entkommen!" Nur dem besonnenen Eingreifen zweier Hauptleute war es zu verdanken, dass sich die Stedinger inmitten der allgemeinen Kreuzzugshysterie nicht durch einen offenkundigen Vertragsbruch selbst ins Unrecht setzten. Die Burg allerdings zerstörten sie diesmal gründlich. Unter Tammos Anleitung legten sie das Feuer so, dass die Flammen nicht nur die brennbaren Teile fraßen sondern durch ihre Hitze zugleich die Mauern zum Bersten brachten. Wo das nicht half, wurde unterminiert. Drei Tage nahmen sie sich Zeit für das Zerstörungswerk. Den Rest sollten die Bauern der umliegenden Dörfer erledigen. Selbstverständlich blieb der leichte Sieg nicht ohne Folgen. Wie vorausgesehen, flüchteten die Besatzungen der Wachtürme, als sie vom Fall der Schlutterburg erfuhren. An einigen Orten griff die ansässige Bevölkerung zur Selbsthilfe. Das Kernland der Stedinger war wieder frei von feindlichen Waffenknechten. Damit hätte man sich zufrieden geben und zurück nach Hause gehen können. Doch wozu den Aufwand treiben, ein starkes Heer zu sammeln und auszurüsten, wenn beim Feldzug nicht mehr herauskommt als die kampflose Einnahme einer einzigen Burg? Jetzt sollte ein wirklich großer Sieg her, der den Erzbischof nachhaltig beeindruckt. Die Anführer berieten, wohin sie sich wenden sollten. Gegen Abend weihte Dietmar die Fähnleinführer ein. "Gerade erfuhren wir, dass der Graf von Oldenburg von einem Tag auf den anderen an einer geheimnisvollen Krankheit gestorben ist. Ein Zeichen Gottes." Ein Raunen ging um. Dass dem zweiten Christian alles zu gelingen pflegte, was er anpackte, wussten sogar die Bauern. Sie hatten ihn nicht zuletzt deshalb am meisten gefürchtet unter den Gefolgsleuten des Erzbischofs. Nun also war er tot. "Sicherlich herrscht jetzt Verwirrung in der Grafschaft und diese günstige Gelegenheit sollten wir uns nicht entgehen lassen." Zunächst herrschte Stille. Oldenburg, das war ein ehrgeiziges Ziel! Dann aber setzte sich das durch die Einnahme der Schlutterburg gewachsene Selbstbewusstsein durch. "Auf nach Oldenburg!" riefen zunächst nur einige Vorwitzige. "Auf nach Oldenburg! Auf nach Oldenburg!" stimmten wenig später alle anderen ein. Die Männer waren heiß auf den Kampf, stachelten sich gegenseitig auf, hielten ihr Heer für unbezwinglich. "Auf nach Oldenburg! Auf nach Oldenburg!" Der Marsch dauerte fünf Tage, denn Dietmar bestand darauf, ihn gut abzusichern. Kleine, berittene Vorausabteilungen hielten Ausschau nach feindlichen Hinterhalten. Kundschafter versuchten, Näheres über die Lage in Oldenburg herauszufinden. Beunruhigendes ereignete sich nicht - 144 außer einem Zwischenfall, der freilich äußerst mysteriös war. Wige hatte sich am Morgen des dritten Tages geradezu danach gedrängt, eine der Vorausabteilungen anzuführen. Und ausgerechnet diese Gruppe kehrte nicht zurück. Auf einer Lichtung nahe dem Weg waren Kampfspuren zu sehen zertrampeltes Gras, zerbrochene Speere, etliche Pfeile, allerdings kein Blut, geschweige denn ein Toter oder ein Verletzter. Die Kundschafter, die Dietmar sofort in alle Richtungen ausschwärmen ließ, fanden weit und breit niemanden, der die Vorausabteilung hätte angreifen können. Deshalb redeten bald alle von Verrat. Die Anführer wollten dazu nicht Stellung nehmen, wollten auf Beweise warten. Fest stand aber bereits, dass zu jener Gruppe ausschließlich gute Bekannte von Wige gehört hatten. 145 13.Kapitel I W ilhelm wurde durch den Aufruf zur Heerfolge völlig überrascht. Der Kreuzzug gegen die Stedinger stand zwar dicht bevor, doch waren die Vorbereitungen dafür noch längst nicht abgeschlossen. Er hätte das Ganze für eine Übung gehalten, doch in der Botschaft stand unmissverständlich: "Schloss und Stadt Oldenburg sind in Gefahr." Nun fragte er sich, wie er innerhalb eines Tages aus seinen Bauern ein Fähnlein zusammenstellen sollte. Nach altem Brauch musste aus jedem Dorf nur ein Mann folgen. Als Wilhelm gegen Mittag noch immer erst sieben beisammen hatte, griff er kurz entschlossen auf jene Waffenknechte zurück, die gerade vor der Zugbrücke Ausbildung erhielten, ungeachtet des Umstandes, dass sie eigentlich zum Grafen von Wildeshausen gehörten. Im Übrigen war es den des langweiligen Übens überdrüssigen Burschen recht, dass sie mitgenommen wurden. Pferde gab es zum Glück genug. Im Eilritt erreichte das Fähnlein Schloss Oldenburg kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Da hatte der Ausguck auf dem Bergfried bereits die Vorhut der Stedinger gesehen. Unmittelbar hinter den Mannen aus Wardenburg wurde die Zugbrücke hochgezogen. Das Schloss zu Oldenburg lag außerhalb der Stadt und war durch einen eigenen Ringgraben und ein eigenes Befestigungssystem gesichert. Es ließ sich auf zwei Wegen betreten. Wer von der Stadt kam und die Vorburg durchquert hatte, gelangte zu einem Doppeltor - das Vordere Tor stand außerhalb, die Hohe Pforte innerhalb des Grabens. Der Hauptzugang befand sich gegenüber, wo die Hunte zusätzlichen Schutz bot. Sie war hier, kurz vor der Mündung in die Weser, schon beachtlich breit. Ein künstlicher Damm trennte Fluss und Graben. Im Westen floss die Haaren, ein eher dürftiges Bächlein, das aber Sümpfe bildete, die ein Fremder nicht leicht durchschaute. Graf Otto lief unermüdlich von einem Ende des Schlosses zum anderen und gab Anweisungen. Dabei kam es ihm manchmal vor, als sei nicht er es, der das alles tat, sondern ein anderer, der in seine Haut geschlüpft war. Der kleine, rundliche Mann entwickelte plötzlich Kraft und Ausdauer wie ein junger Bursche. Der dem Frieden verschworene Bücherfreund benahm sich wie ein Ritter, den das Kriegshandwerk seit Jahr und Tag ernährte. Mehr gefühlsmäßig als bewusst tat der neue Graf stets genau das Richtige. Weil er damit rechnete, dass die Bauern vor allem das Schloss angreifen würden, stellte er dem Bürgermeister der Stadt, so sehr der dagegen auch protestierte, keine Hilfstruppen bereit. Der Schutz der verrammelten Tore und der Bürgerwehr auf den Mauern musste genügen. Die verwundbare Vorburg ließ Otto räumen, deckte sie aber durch schwere Armbruste und Schleudern, die auf den am nächsten gelegenen Türmen in Stellung gebracht wurden. Der Graf hatte im Schloss eine beachtliche Streitmacht zusammengezogen. Allerdings waren seine zwölf Fähnlein recht unterschiedlich geartet. Das Pflichtkontingent aus Oldenburg - zwei Gruppen, deren Führer Oltman und Liborius hießen, ein armseliges Häuflein aus eilig zusammengetrommelten Bürgern, die lieber die Häuser ihrer Angehörigen schützen würden - lagerte im Westen an der Haaren, wo es vermutlich keinen Schaden anrichten konnte. Auf den Türmen im Norden und im Süden standen die eigenen Waffenknechte mit ihren schweren Geschützen bereit. Denen vertraute Otto am meisten. Sorgen bereitete ihm die Ostseite, wo hinter dem Graben freies Gelände begann. Fünf Fähnlein sollten dort einem denkbaren Sturmangriff begegnen. Die als unerschrocken bekannten Brüder Johann, Gieselbert und Gerhard von Apen sowie die Herren von Nethen und von Finkensolt führten das Kommando. Wilhelm von Eversten bezog mit seinen Leuten Posten links und rechts des Tores im Norden. Wilhelm von Westerholt und Nikolaus von Manste waren an den Südabschnitt befohlen. Wilhelm stand auf der Mauer, die dem Erdwall zwischen Hunte und Schlossgraben folgte. Rechts ragte das Dammtor auf mit seinen mächtigen runden Bollwerken zu beiden Seiten. Die Plattformen boten viel Platz für die Geschütze und die dazugehörige Munition aus schweren Steinen und armdicken Pfeilen. Hinter ihm befand sich das Huntetor. Die Verbindung zwischen beiden Toren über den Graben hinweg war breit und fest, damit sich ein Ausfalltrupp sammeln konnte, ließ sich aber trotzdem im Notfall teilweise hochziehen. Reckte sich der Ritter ein wenig hoch, sah er die träge fließende Hunte und dahinter das Lager der Stedinger. Die Bauern hatten sich am frühen Morgen schon einmal mit zwei Gruppen bis dicht ans Ufer herangewagt, waren aber mit einem Steinhagel vom Dammtor zurückgetrieben worden. Gerade wollte Wilhelm die Wachsamkeit seiner entlang der Mauer aufgestellten Leute prüfen, als der Graf erschien. Otto sah nicht glücklich, wohl aber zuversichtlich aus. "Ist dir etwas Bemerkenswertes aufgefallen?" Wilhelm hob die Schultern. "Man kann noch nicht erkennen, was sie planen. Nach dem gescheiterten Vorstoß haben die Anführer offenbar beraten. Jetzt eilen Kuriere durchs Lager und es entsteht Bewegung." "Was vermutest du?" "Nahe liegend wäre, dass sie unsere Verteidigung im Osten auf die Probe stellen. Doch Gewissheit bekommen wir erst in einiger Zeit." "Warten wir also ein bisschen!" Otto nutzte die sich anbietende Ruhepause, ließ sich auf einen Mauervorsprung sinken und blickte auf die Krone des Bergfrieds, wo stolz die Oldenburger Fahne wehte. "Sie lassen nicht mit sich verhandeln. Ich habe ihnen ein Angebot geschickt, aber sie fühlen sich seit der Eroberung der Schlutterburg sehr stark." "Sie sind wirklich sehr stark." "Oh ja! Hätte es keinen Verräter in ihren Reihen gegeben, wäre ich hier in eine üble Lage geraten." "Ihr seid durch einen Verräter gewarnt worden, Herr Graf?" "Er heißt Wige. Ein unangenehmer, schmieriger Kerl. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anstellen soll. Er hat sich Lohn und Schutz verdient, aber ich will ihn nicht in meiner Nähe behalten. Dem kannst du nicht drei Meter über den Weg trauen." "Seht mal, Herr Graf! Einige Fähnlein ziehen tatsächlich in Richtung Osten." Otto klopfte ihm auf die Schulter. "Das bringt mich auf einen Einfall, mit dem wir vielleicht das Schlimmste verhüten können. Sie fassen meine 147 Bereitschaft zum Verhandeln als Schwäche auf. Deshalb sollten wir ihnen zeigen, dass wir gewarnt und gut vorbereitet sind und dass sie keine Aussicht auf den Sieg haben." "Woran denkt Ihr, Herr Graf?" "An einen Plan der dich betrifft, lieber Wilhelm, dich und Nikolaus von Manste. Das dort drüben ist ohne Zweifel das Zelt ihrer Anführer. Sie haben es zwar außerhalb der Reichweite unserer Geschütze errichtet aber immer noch ziemlich nah an der Huntebrücke." "Das ist auch mir aufgefallen. Ein Ausdruck ihrer Selbstsicherheit." "Nun zu meinem Plan." Er flüsterte, als könne man ihn sonst von der anderen Seite her hören. "In einiger Zeit ist ein Großteil der Männer nach Osten abgezogen. Inzwischen sammelt ihr einen Teil eurer Fähnlein. Dann öffnen wir das Tor. Ihr gebt den Pferden die Sporen, stürmt über die Brücke, überquert die dann fast menschenleere Wiese. Ehe sie etwas unternehmen können, steht ihr vor ihrem Führungszelt." "Das ist großartig!" rief Wilhelm in aufrichtiger Bewunderung aus. "Ihr sollt sie aber nicht umbringen", fuhr Otto fort. "Ich will noch immer verhandeln. Sie sollen merken, dass jeder, wirklich jeder von ihnen seinen Kopf aufs Spiel setzt, wenn sie uneinsichtig bleiben. Darauf kommt es mir an. Kein überflüssiges Heldentum! Ein kurzer Ausfall, dann kehrt ihr zurück." "Ich habe verstanden, Herr Graf." Nikolaus von Manste war ebenso wie Wilhelm von Westerholt ein erfahrener Mann und für den Ausfall suchten sich beide die besten Leute aus. Die Operation begann geordnet und zielstrebig, wie das sonst nur bei Planspielen mit Stöckchen im Sand gelingt. Graf Otto konnte zufrieden sein. Die schweren Flügel des Tores öffneten sich knarrend. Noch ehe die Belagerer es bemerkten, galoppierten die Reiter über die Brücke, immer zwei nebeneinander und dicht aufgerückt. Am anderen Ufer fächerten sich die Ketten auf und bildeten zwei Trupps, die sich trennten, um einer noch auf der Wiese lagernden Einheit auszuweichen. Dann preschten sie schon auf das Führungszelt zu. Die Wirkung bei den Stedingern entsprach ganz den Erwartungen. Die Männer auf der Wiese waren so verwirrt über die Reiter, die da in einer Staubwolke links und rechts an ihnen vorbei jagten, dass sie ihnen wie gelähmt nachblickten. Am Führungszelt wurden immerhin Befehle gerufen. Etwa zehn Leuten gelang es noch rechtzeitig, Schwerter und Schilde zu ergreifen und sich auf ihre Pferde zu schwingen. Sie gehörten offenbar zu einer Art Leibgarde. Nikolaus von Manste hatte auf der Ostseite freie Bahn und schlug mit seinen Mannen, getreu dem Befehl, Zelt und Einrichtung kurz und klein. Dann drehte er ab und ließ Tammo, Dietmar und drei Hauptleute leichenblass vor Schrecken zurück. Wilhelm dagegen, der es mit der Garde zu tun bekam, stand als gewissenhafter, dem Althergebrachten streng verhafteter Vasall vor zwei Schwierigkeiten. Zum einen erforderte ein regelgerechter Kampf, dass jeder sich auf der anderen Seite Seinesgleichen als Gegner suchte, was aber voraussetzte, dass das feindliche Heer regelgerecht aufgestellt war. Zum anderen hatte er zu fragen vergessen, ob das Schonungsgebot für alle Bauernkrieger galt oder nur für deren Führer. Leider blieb ihm für die Entscheidungen nur ein Augenblick. Er rief noch: "Nur plänkeln!" Dann prallten die beiden Trupps zusammen und verkeilten sich ineinander. Wilhelm wählte im Getümmel als Gegner denjenigen aus, der die letzten 148 Befehle gerufen hatte. Es war ein offenbar noch recht junger Mann mit der hellen Stimme eines Knaben. Der Ritter fragte sich, ob er wirklich den Fähnleinführer vor sich hatte. Der andere war ihm körperlich klar unterlegen, führte sein kurzes Schwert aber sehr geschickt. Er vergaß auch nicht, den Schild fest am Körper zu halten, und behielt das tänzelnde Pferd gut in der Gewalt, hatte das Kriegshandwerk folglich bei einem Meister erlernt. Der Kampf dauerte nur kurz. Als Wilhelm sah, dass Nikolaus von Manste abschwenkte, befahl er seinen Leuten, sich zu lösen. Die Ausfalltrupps kehrten ebenso schnell in die Burg zurück, wie sie daraus hervorgebrochen waren. Den Stedingern musste die Operation wie der Überfall einer Gespensterschar vorgekommen sein, selbst ihren Anführern. "Ich danke dir", sagte Otto von Oldenburg, als Wilhelm ihm auf dem Wall Meldung erstattete. "Nun können wir nur noch beten, dass Gott ihren Geist endlich erleuchtet." Zwar traf schon bald die Meldung ein, dass die Stedinger ihren Vorstoß auf der Ostseite abgebrochen hätten, doch musste das nicht viel besagen. Bis zum späten Nachmittag blieb die Lage völlig undurchsichtig. Dietmar tom Diek lehnte sichtlich gereizt auch ein zweites Verhandlungsangebot des Grafen ab und gruppierte fast das ganze Heer fächerförmig vor dem nur notdürftig wieder hergerichteten Führungszelt auf der Wiese. "Dieser Narr wird doch wohl keinen Frontalangriff planen!" rief Otto. Die zahlenmäßige Größe der gegnerischen Streitmacht, die er nun überblicken konnte, blieb nicht ohne Eindruck auf ihn. Doch Wilhelm schüttelte den Kopf. "Ich halte ihn nicht für einen Narren. Er weiß spätestens seit heute Morgen, dass auf den Bollwerken des Dammtors große Geschütze stehen und wird seine Leute nicht in unsere Steine und Pfeile hinein jagen." Dennoch holte Otto vorsichtshalber Wilhelm von Eversten mit seinen Männern auf die andere Seite. Erst als die Dunkelheit sich herab senkte, übermittelte der Ausguck vom Bergfried eine erlösende Beobachtung. Hinter dem Heer wurden Wagen beladen und abgezogen. Ihnen strömten die ersten Fähnlein nach. "Ich verstehe", sagte Otto. "Jetzt denkt jeder, sie holen sich bei uns blutige Köpfe. In Wahrheit ziehen sie längst gegen eine andere Burg. Du hast recht, Wilhelm - dieser Dietmar tom Diek ist wirklich kein Dummkopf. Er hat nur einen kleinen, dicken, verträumten Grafen unterschätzt." Wilhelm hörte nur mit halbem Ohr hin. Während er sich von der Meldung des Ausgucks zu überzeugen versuchte, fiel ihm eine Fahne auf und in seiner Erinnerung tauchte ein während des Ausfalls gesammelter Eindruck auf, ein sehr kurzer, flüchtiger Eindruck. Er glaubte, auf der Seite der Stedinger sein eigenes Wappen gesehen zu haben. Das Motiv der Westerholts war zu kompliziert, als dass jemand sich zufällig dasselbe ausdenken könnte. Andererseits hatte sich das Bild so fest in seinem Kopf eingegraben, dass er auch nicht an eine Täuschung glauben mochte. Wer also benutzte das Westerholtwappen? Und vor allem: Warum tat er es? Unwillkürlich dachte er an seinen verschwundenen Sohn Arnold. Den aber hätte er sicherlich erkannt, selbst unter einem Topfhelm und hinter einem Schild versteckt. Noch als er sich erschöpft auf sein Lager streckte, beschäftigte ihn die Frage und sogar in die Träume hinein verfolgte ihn die mysteriöse Fahne. 149 II ber Nacht war Wilhelm von Westerholt ein Held geworden. Ihm und Nikolaus von Manste schrieb man die Errettung von Schloss und Stadt Oldenburg zu. Die sich um ihn neuerdings rankenden Legenden werteten ihn auf. Vornehme Familien wollten ihre Söhne als Knappen von ihm unterrichten lassen und boten ihm viel Geld dafür. Ihm (dem Rang nach) ebenbürtige Ritter ließen ihm ehrerbietig den Vortritt. Sogar der Graf von Wildeshausen schlug neue Töne an. Ohne auf den alten Streit über die Lehnshoheit anzuspielen, lud er ihn höflich zu einer Beratung ein. Auf dem Wege nach Wildeshausen gingen Wilhelm aber noch andere Dinge durch den Kopf. Er hatte sich mit allen Mitteln bemüht, hinter das Geheimnis des Westerholtwappens im Stedingerheer zu kommen, leider vergeblich. Wige, der Verräter, war verschwunden, nachdem Otto von Oldenburg ihn für seine Dienste abgefunden hatte. Einer von Wilhelms Gefolgsleuten behauptete, der Anführer der Leibgarde müsse ein Südländer sein, vielleicht ein Lombarde oder Sizilianer. Er habe sein schwarzes Haar gesehen, bevor er sich den Helm aufsetzte. Zwischen den Stedingern und dem in Süditalien weilenden Kaiser gab es immerhin gewisse Verbindungen. Aber ein Sizilianer mit dem Westerholtwappen, das ergab keinen Sinn. Wilhelm war noch immer der Ansicht, dass sein Sohn Arnold etwas damit zu tun hätte. Die Vorstellung, er könnte noch am Leben sein, war gar zu verlockend für ihn. Deshalb begann er, sich entsprechende Möglichkeiten zurechtzulegen. Vielleicht ließ er sich gelegentlich von diesem Sizilianer vertreten. Vielleicht hatte er gerade einen anderen Auftrag zu erfüllen gehabt. Der schwarzhaarige Mann erschien ihm für einen Fähnleinführer ohnehin zu jung. Burchards Verhalten beim Empfang des Gastes entsprach ganz dem Ton der Einladung. Das hatte seinen Hintergrund in zwei Nachrichten aus der zurückliegenden Woche. Die erste erfreute ihn. Otto von Oldenburg, der seit seinem Sieg über das Stedingerheer als der starke Mann in der Region galt, verzichtete freiwillig auf die militärische Führung im bevorstehenden Kreuzzug, die ihm vom Erzbischof offenbar (vertragsbrüchiger Weise!) angeboten worden war. Die zweite Nachricht dagegen beunruhigte den Grafen. Otto drängte auf eine klare Regelung des Abhängigkeitsverhältnisses der Westerholts. Diesbezüglich hatte er sich bereits mit Gerhard II, dem Lehnsherrn der Wildeshausener, in Verbindung gesetzt. Burchard musste befürchten, Wilhelm und dessen Burg bald endgültig zu verlieren. Zugleich würde sich der Einflussbereich der Oldenburger bedrohlich weit noch Süden erweitern. Wenn sich hierbei überhaupt noch etwas retten ließ, dann nur mit Hilfe der Betroffenen, der Westerholts selbst. "Otto von Oldenburg hatte großes Glück, dass ein Held wie du rechtzeitig zur Stelle war, als ihm die Bauern auf den Pelz rückten. Ich hoffe für dich, dass ihn bei der Entlohnung nicht der Geiz überkam." "Ein Vasall hat die Pflicht, seinem Lehnsherrn Heerfolge zu leisten. Er ist kein Söldner, der besonderen Lohn dafür verlangen kann." "Er hat dich mit einem Schulterklopfen nach Hause geschickt? Ist mir je im Leben so viel Ü 151 Undankbarkeit zu Ohren gekommen?! Wilhelm, glaube mir, du bist ein zu gutherziger Mensch für diese Raubtiere. Sie missbrauchen dich und ziehen dir am Ende das Fell über die Ohren. Weißt du noch nicht, dass Otto seine Hand nach deinem Land ausstreckt? Er war in Bremen deswegen." "Der Graf Otto sprach mit mir, eher er bei Seiner Eminenz vorstellig wurde. Seine Ziele sind ganz in meinem Sinne." Burchard biss sich auf die Lippen. Wie hochfahren dieser Sumpfritter sich gebärdet seit er vor Oldenburg ein paar Bauern über den Haufen gerannt hat! Zu seinem Bedauern musste er freundlich bleiben, wollte er das Spiel nicht sofort verlieren. "Deine Bescheidenheit beweist, welch ein vorbildlicher Christ du bist. Es ist aber auch keineswegs unchristlich, wenn jemand seinen gerechten Lohn verlangt. Mir jedenfalls wärest du mehr wert als ein Schulterklopfen." "Der Allmächtige bescherte mir und meinen Bauern mehrere gute Jahre. Die Scheunen sind voll. Ich brauche nichts." "Erinnerst du dich an ein Versprechen, dass ich dir bezüglich deiner Tochter Agnes gab? Ich bin noch immer entschlossen, einen Bräutigam aus dem Hochadel für sie zu suchen." Wilhelm wurde immer unbehaglicher zumute. Er wollte das Gespräch möglichst rasch beenden. "Herr Graf, ich glaube, Ihr überschätzt meinen Einfluss. Ich gab vor etwas mehr als einer Woche Otto von Oldenburg mein Wort. Nur er könnte mich davon wieder entbinden. Redet mit ihm über Euer Anliegen!" Bei der Verabschiedung quälte sich Burchard noch ein letztes Lächeln ab. Wenig später brüllte er unfromme Flüche und zertrümmerte zwei Stühle. So wie er zuvor überlegt hatte, wie er Wilhelm ködern könnte, so sann er nun darauf, sich an ihm zu rächen. Allerdings wollte er sich nicht durch eine dumme Gewalttat ins Gerede bringen und vor allem nicht seine Rolle beim Kreuzzug gefährden. Am nächsten Morgen kam er auf einen Plan, der ihm geradezu genial erschien, denn er war demütigende Vergeltung gegen Wilhelm, formale Erfüllung eines lästigen Versprechens und Bereinigen einer persönlichen Kalamität in Einem. Begeistert setzte er ihn sofort in die Tat um. Der überrumpelte Priester erklärte noch, dass er dergleichen so rasch nicht bewerkstelligen könne, dass er mindestens einen Tag für die allernotwendigsten Vorbereitungen benötige. Der Graf jedoch bestand auf seiner Forderung. "Heute Nachmittag und nicht später! Ich will keine großartige Veranstaltung. Du sprichst die üblichen Gebete. Die Messdiener schwenken ihre Weihrauchfässer. Zwei Lieder davor und danach. Ich denke, dass wir es zwischen Vesper und Abendessen hinter uns bringen können." Selten wurde die Hochzeit eines Sohnes aus dem regierenden Hochadel derart hastig und würdelos begangen wie die zwischen Wilbrand von Wildeshausen und Agnes von Westerholt. Als Zeugen mussten zwei Höflinge herhalten, die sich der Graf willkürlich auf dem Hof griff. Die Gemeinde bestand hauptsächlich aus Mägden und Knechten, die zufällig vorbeigekommen waren und aus Neugier in die Kapelle hinein geschaut hatten. Einige von ihnen jagte Burchard gleich wieder hinaus, damit sie ihre Arbeit fortsetzten. Auch das Paar selbst bot kein dem Anlass entsprechendes Bild. Wilbrand lachte idiotisch, während Agnes vor Wut kochte und (ihre viel gerühmten Manieren völlig vergessend) den Gefühlen freien Lauf ließ. 152 Zwei Wochen vergingen. Das Paar (sofern man die beiden so nennen kann) bewohnte das unterste Geschoß des Bergfrieds. Eine elende Behausung! Die den Haupthof umgebenden Gebäude verdeckten die Sonne. Selbst im Sommer fröstelte man wie in einer Höhle. Agnes empfand die Wohnung als weiteres Glied in einer Kette unvermittelt über sie hereingebrochener Erniedrigungen und hätte sie zutiefst gehasst, wäre da nicht die Nähe zu Heinrich von Wildeshausen gewesen. Dem ältesten Sohn des Grafen, der sich gemäß dem Willen des Erzbischofs wieder ständig in der Burg aufhielt, gehörte das Stockwerk direkt darüber. Wilbrand hatte, nach einem kurzen Glücksrausch am Tage der Hochzeit, rasch begreifen müssen, dass Agnes ihn als seine Gemahlin keineswegs mehr achtete als zuvor. Sie entwickelte sogar die üble Angewohnheit, ihre Launen hemmungslos an ihm abzureagieren. Jeden seiner Annäherungsversuche im Schlafgemach wies sie so rabiat zurück, dass er unübersehbare Spuren davontrug. Im ganzen Schloss amüsierte man sich schon darüber. Dass er sie um Haupteslänge überragte und mit einem Arm hätte forttragen können, hinderte sie nicht daran, ihn jämmerlich zu verprügeln. Allmählich wurde das selbst ihm, dem gutmütigen Trottel, zu dumm. Trotz seiner Einfalt hatte er herausgefunden, wo die schwache Stelle seiner hartherzigen Gattin lag. Eines Abends drohte er ihr. "Wenn du mich nicht an dich heran lässt, ist die Ehe nicht vollzogen und du bleibst eine kleine Ritterstochter." Wie von einem Tier gestochen, sprang die junge Frau auf und schlug ganz außer sich mit der bloßen Faust gegen die steinerne Wand. Der Schmerz indes brachte sie zur Vernunft. Dieser Schwachkopf hatte Recht. Sie musste sich etwas einfallen lassen. "Weißt du, wir Mädchen haben Angst vor dem ersten Mal", sagte sie, scheinbar besänftigt mit niedlichem Augenaufschlag. "Aus Angst macht man manchmal Sachen, die man hinterher bereut." Sofort war Wilbrand bereit, ihr zu verzeihen. Er fühlte sich wie in einem Traum. Sie lächelte ihm zu und nahm zwei Becher. In der Ecke stand noch ein vergessener Krug Wein. "Jetzt machen wir es uns richtig behaglich." Er wollte ihr helfen, doch das ließ sie nicht zu. "Du bist mein Gemahl und ich verwöhne dich. Setz dich dort hin und warte, bis ich fertig bin!" Sie tranken und plauderten. Noch immer lächelte sie. Er jedoch sah dieses Lächeln plötzlich nur noch wie durch einen Nebelschleier. So sehr er auch kämpfte, aufrecht zu bleiben, eine unbezwingliche Macht zog ihn zur Seite. Nachdem er auf den Boden gerollt war, entkleidete sie ihn und legte ihn ins Bett. Dann nahm sie die Kerze und schlich die Wendeltreppe hinauf. Heinrich von Wildeshausen hatte gerade sein Öllicht gelöscht - nach langem Zögern, denn in der Dunkelheit kamen die Gespenster, die ihn seit Jahren verfolgten, die geheimen Ängste, das unerklärliche Entsetzen. Während er sich hellwach auf seinem Lager hin und her wälzte, schossen ihm wirre Gedanken durch den Kopf. Todesangst und Todessehnsucht schlugen unvermittelt ineinander um. Manchmal wurde die Qual so unerträglich, dass er das Licht wieder anzündete. An diesem Abend wurde sein düsteres Grübeln durch zaghaftes Klopfen unterbrochen. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Dabei fürchtete er sich weniger vor einem Eindringling als vor der Möglichkeit, den Verstand verloren zu haben. Weil er argwöhnte, 153 niemanden vorzufinden, wagte er nicht, die Tür zu öffnen. Das Klopfen aber wiederholte sich. Durch die Spalten drang deutlich ein Lichtschein. Dann trat ein junges Mädchen mit schwarzen Haaren, blassem Gesicht und langem, hellblauem Kleid herein. Es stellte eine Kerze auf die große Truhe und setzte sich zu ihm aufs Bett. "Du fühlst dich einsam, nicht wahr?" "Du bist kein Hirngespinst? Du bist wirklich da?" "Aber ja! Du kannst mich berühren." Sie beugte sich über ihn und tupfte ihm mit einem Tuch die schweißnasse Stirn trocken. Dies und das Licht der Kerze befreiten ihn allmählich von seinem Alpdrücken. Er richtete sich halb auf und sah ihr ins Gesicht. "Agnes! Was tust du hier? Wird dein Mann dich nicht vermissen?" "Mein Mann!" In ihre Stirn gruben sich kurz zwei Falten ein. "Er schläft. Ich habe ihm ein Mittel gegeben." Jahrelang hatte Heinrich die Ritterstochter einfach übersehen. Sie war ihm wirklich nicht aufgefallen, ohne bösen Willen. Ihn hatten zu viele eigene Sorgen geplagt. Und er war zu selten in der Burg seines Vaters gewesen. An diesem späten Abend aber trat sie jäh in sein Leben. Plötzlich sah er eine Leidensgefährtin in ihr. Er verstand sehr gut, dass sie diesen Wilbrand nicht ausstehen konnte. Er begriff sogar, dass sein Vater sie mit der Ehe absichtlich verletzt hatte. "Wir müssen die Kerze so stellen, dass man sie von draußen nicht sieht", mahnte er. "Soll ich sie auspusten?" Heinrich wollte sie hindern. Sie hatte es aber schon getan und sonderbarer Weise kamen die Gespenster nicht zurück. Er spürte das junge Mädchen in seinem Arm und fühlte sich unsagbar glücklich. Natürlich kam ihm auch in den Sinn, dass er im Begriff war, einen Ehebruch zu begehen. Er hatte jedoch zuviel gelitten, um solchen Skrupeln nachgeben zu können. Mit der Ungeduld eines Hungernden, der plötzlich ein Stück Brot in den Händen hält und es dann gierig hinunterschlingt, zerrte er Agnes die Kleider über den Kopf. Sie war anderes als seine verstorbenen Ehefrauen, gab sich ihm nicht willenlos hin sondern setzte ihm, um ihn aufzustacheln, spielerisch Widerstand entgegen. Sie erschien ihm sehr stark und sehr lebendig, nicht so, als würde sie ihm bald hinweg sterben. Wilbrand schlief bis tief in den nächsten Vormittag hinein. Agnes und Heinrich nutzten das, um die Bettwäsche zu tauschen. So konnte sich dann also jeder davon überzeugen, dass Wilbrand seine Frau endlich entjungfert hatte. Am meisten sorgte er selbst dafür, dass wirklich auch die letzte Magd von dem Ereignis erfuhr. Er war sehr stolz auf sich. 154 14.Kapitel I B ischof Johannes von Lübeck brachte sein Pferd auf einem Hügel zum Stehen, um das Heer zu überblicken. Von seiner Warte aus glich es einem riesigen Wurm, so wie es sich da östlich der Weser durch die Niederungen nach Norden wand. Es war auffällig bunt, was nicht nur an den Fahnen und Wimpeln der einzelnen Einheiten lag und auch nicht nur an den zahlreichen Heiligenstandarten, die man im Hoffen auf höheren Beistand mit sich führte, sondern vor allem an der uneinheitlichen Kleidung. Dort marschierte noch nicht das eigentliche Kreuzzugsheer, nicht die von Burchard befehligte Ritterschaft, sondern eine vor allem aus Bürgerlichen bestehende Streitmacht, die den Krieg einläuten sollte, und zwar in Oststedingen. Dort gab es wenig natürlichen Schutz für die Bauern. Dort stand auch kein Heer der Stedinger, wie Spione herausgefunden hatten. Eine Gelegenheit also, dem Kreuzzug mit einem leichten Sieg ein gutes Omen voranzustellen. Der Erzbischof war sich seiner Sache so sicher, dass er das Geschehen von seinem Palast in Bremen aus leitete. Berittene Boten sollten ihn über das Geschehen auf dem Laufenden halten. Selbst das aber war mehr ein Ausdruck von Ungeduld als von Besorgtheit. Gerhard hatte durchaus nicht die Absicht, lenkend einzugreifen, vertraute vielmehr vollkommen seinen Parteigängern, allen voran dem Dominikaner Johannes. Dieser versetzte sein Pferd wieder in einen leichten Trab, um an die Spitze des Zuges zurück zu gelangen. Mit seinen zarten Händen und dem milchigen Gesicht eines jungen Mädchens wirkte er fehl am Platze. Doch außer ein paar frisch angeworbenen Landsknechten kannte ihn jeder der Männer. Und wer ihn kannte, der begegnete ihm mit größter Ehrfurcht - mit Betonung auf der zweiten Silbe des Wortes. Für den Erzbischof war in den zurückliegenden Wochen vieles, aber keineswegs alles wunschgemäß verlaufen. Der Papst hatte den Kreuzzug gegen die Stedinger genehmigt, ihn aber in seiner Bedeutung geringer eingestuft als die Palästinazüge. Das wirkte sich unter anderem auf den himmlischen Lohn aus, mit welchem die Teilnehmer rechnen durften, was für nicht wenige Ritter eine gewichtige Rolle spielte. Immerhin sollten sie in einen Krieg ziehen. Da war es nur natürlich, dass sie über ihr Seelenheil mehr nachdachten als gewöhnlich. Gerhard wollte eine noch schärfere Bulle des Papstes, um die Zögernden zu einer Entscheidung zu bringen. Gewisse Anzeichen sprachen dafür, dass Gregor IX nicht abgeneigt sei. Vielleicht war das erwartete Schreiben längst aufgesetzt und auf den langen Weg über die Alpen geschickt worden, nur eben noch nicht eingetroffen. Ein weiteres Ärgernis bildete das freche Zusammengehen des Lüneburgers mit den Bauern. Mit viel Mühe war es dem Erzbischof gelungen, den Herzog aus der Bremer Gegend zu vertreiben. Der Schwerpunkt der Fehde lag inzwischen bei Stade. Das band zwar einen beträchtlichen Teil von Gerhards Kräften, gab ihm aber die Möglichkeit, eins vom anderen zu trennen. Er beabsichtigte, Otto von Lüneburg vor Stade festzunageln und unterdessen ungestört die Stedinger anzugreifen. Als die Zeit reif war, schickte er das erste, das kleinere Heer auf den Weg. Er wollte den Vorteil der Lage nicht durch dummes Warten auf eine Papstbulle verpassen. Gottfried, der sich an ein bequemes Leben gewöhnt hatte, litt sehr unter den Strapazen des Marsches. Dabei konnte er sich über das Wetter nicht einmal beschweren. Es war ein Sommertag, der 27. Juni des Jahres 1233, aber keiner von der heißen Sorte. Kühler Wind wehte vom Meer herüber und ließ eher an einen Frühlingsmorgen denken. Der Kaufherr hatte sich bei einer Ratssitzung, während eines heftigen Streits über die Beteiligung der Bremer Bürger am Kreuzzug, zu weit aus dem Fenster gelehnt. Auf die Probe gestellt, war ihm keine Wahl geblieben, wollte er nicht sein Gesicht verlieren. Andreas hatte sich gemeldet, um seinem wütenden Gönner zu beweisen, wie sehr er in der Not mit ihm rechnen könne. Allerdings fiel ihm, dem Jüngeren und Gesünderen, die Entscheidung weitaus leichter. Der Zug geriet plötzlich ins Stocken. Als Andreas ausscherte, um die Ursache zu erkunden, sah er eine Abordnung der Bauern, die sich an die militärischen Führer gewandt hatten, aber offenbar an den geistlichen Führer Bischof Johannes verwiesen worden waren. Dieser traf soeben wieder an der Spitze des Heeres ein. "Es sieht so aus, als ob es zu Verhandlungen kommt." "Nein, das glaube ich nicht", sagte Gottfried. "Der Erzbischof will einen blutigen Auftakt für seinen Kreuzzug. Er will die Bauern einschüchtern, indem er ihnen seine Grausamkeit vorführt. Was meinst du, weshalb er ausgerechnet diesen Johannes mitgeschickt hat? Das ist ein harter Hund, auch wenn er nicht so aussieht." "Und was heißt das für uns?" fragte Andreas nachdenklich und antwortete dann selbst. "Ihr Widerstand versteift sich. Wir müssen ernsthaft kämpfen, um sie niederzuringen. Es gibt Tote ..." "Na, nun male nicht gleich den Teufel an die Wand! Die Bauern wollen verhandeln, weil sie auf verlorenem Posten stehen. Hier in Oststedingen sind wir ihnen himmelhoch überlegen." "Ich mag das nicht glauben. Sie kannten doch die Gefahr. Sollten sie sich nicht darauf eingestellt haben?" "Sie sind zwar Stedinger, hatten sich in der Vergangenheit aber viel mehr als ihre Brüder im Westen um eine friedliche Beilegung des Streits bemüht. Vermutlich waren sie der Überzeugung, der Erzbischof werde sie dafür schonen." "Was er wohl auch hätte tun sollen, wenn es sich wirklich so verhält, wie du sagst." "Zum Glück gibt es Entscheidungen, für die wir beiden nicht den Kopf hinhalten müssen, weder jetzt hier auf Erden noch dereinst an der Himmelspforte. Wir befolgen in diesem Heer nur Befehle." Andreas dachte bei sich: 'Wenn sich Johannes auf die Verhandlungen einließe, gäbe es nur noch einen Befehl - Marsch, nach Hause!' Aber er hütete sich, das auszusprechen. Tatsächlich wies Johannes von Lübeck die Abordnung der Bauern schroff zurück. Mit der Begründung, er, 156 ein Bischof, verhandle nicht mit des Satans Kreaturen, lehnte er jedes Gespräch ab. So blieb den Bauern keine andere Wahl, als sich mit dem Mut der Verzweiflung der Übermacht zu stellen. In den Dörfern läuteten die Glocken. Die Männer griffen zu Dreschflegeln, Heugabeln und Zaunslatten, zu allem eben, was sich irgendwie als Waffe eignete. Eiserne Schwerter besaßen sie nur wenige. Die Schlacht war kurz und einseitig. Die Kreuzfahrer bildeten aus Rittern und erzbischöflichen Waffenknechten eine Phalanx von Schwerbewaffneten und walzten die Bauern nieder. Die Bürgerlichen blieben in der Reserve und brauchten bis zum Schluss nicht einzugreifen. Dann fielen die Angreifer über die Frauen, Kinder und Alten in den Dörfern her und erschlugen willkürlich etliche von ihnen. Wieder galt der grausame Grundsatz aus den Albigenserkriegen: Tötet sie alle! Gott wird die Seinen heraussuchen. Am nächsten Tag schon begann Bischof Johannes von Lübeck das Strafgericht vorzubereiten. Er betrieb beträchtlichen Aufwand, um dem Ereignis Erhabenheit zu geben. Mitten auf einem freien Feld ließ er eine gewaltige Tribüne errichten, die aus der Ferne an einen Thron erinnerte. Der Thron Gottes sollte das sein. Das Jüngste Gericht sollte symbolisch vorweggenommen werden. Für die Arbeiten beanspruchte er einen Teil des Heeres, vor allem die Bürgerlichen, die sich dafür ohnehin besser eigneten als zum Kämpfen. Am Gerichtstag selbst gab sich Johannes als weiser, unabhängiger Richter. Er sprach so leise, dass ein Ritter die Worte laut wiederholen musste, damit die Menschen auf dem Platz vor der Tribüne sie überhaupt hörten. Gewalt übte er niemals aus, obgleich sie freilich auf seinen Wink hin geschah. Die Gefangenen fragte er, ob sie sich an den allgemein bekannten Ketzereien beteiligt hätten. Wer das bestritt, also leugnete, der galt als unbußfertig. Wer gestand, war natürlich ebenfalls schuldig, durfte aber immerhin darauf rechnen, nicht bei lebendigem Leib verbrannt, sondern aus Gnade vor dem Entzünden der Holzscheite erwürgt zu werden. II N eun Tage waren vergangen seit dem Angriff gegen Oststedingen. Während dort noch immer Strafgerichte wüteten, näherte sich das Hauptheer der Grenze Weststedingens. Es bestand zur Hälfte aus Rittern und Landsknechten, die den Eid auf Burchard von Wildeshausen geschworen hatten. Die andere Hälfte setzte sich zusammen aus einzelnen Fähnlein verschiedener Grafschaften. Die Oldenburger und Bruchhausener beteiligten sich nur mit einem kleinen Kontingent. Otto von Oldenburg war dadurch ins Gerede gekommen. Er hatte sich vor dem Erzbischof (wenig glaubwürdig) mit der Bedrohung seines Schlosses herausgeredet. Eine beeindruckende Streitmacht wälzte sich über eine der wenigen genügend breiten und einigermaßen befestigten Straßen dieser Gegend. Die Ritter waren gepanzert und schwer bewaffnet. Ihre bunten Helmbüsche wippten im Wind. Selbst die Pferde glänzten von blank poliertem Eisen. Für die Knappen und die Männer der Hilfstruppen reichte es immerhin noch zu Lederwämsern und Kettenhemden. Burchard hatte bei der Ausrüstung keine 157 Kosten zu scheuen brauchen, denn dem Erzbischof von Bremen war für dieses Unternehmen nichts zu teuer gewesen. Einige Meilen vor dem Heer floss die Ochtum. Anders als in Oststedingen hatten die Bauern die Grenze hier durch starke Verschanzungen gesichert. Um die Anlagen rasch erobern zu können, führten die Kreuzfahrer riesige Belagerungsgeräte mit sich. Diese würden ihnen unter anderem erlauben, zwei Behelfsbrücken zu errichten. Dass der Marsch durch die Ungetüme verlangsamt wurde, nahmen sie in Kauf. Niemand konnte daran zweifeln, dass westlich der Weser weitaus mehr Widerstand zu brechen sein würde als östlich davon. Darum scherten sich aber die wenigsten im Heer. In den Ortschaften, durch welche die Ritter zunächst kamen, standen die Bewohner (die nichts zu befürchten hatten) staunend am Rand. Sie betrachteten den Zug mit Schaudern und Ehrfurcht - etwa so wie die Verwüstungen eines Hagelschlags, welcher auf das Nachbardorf niedergegangen war. Kaum jemand von ihnen hatte je im Leben einen solchen Aufmarsch gesehen. Die Kreuzzugsteilnehmer fühlten sich geschmeichelt. Siegessicherheit pflegt immer mit einem gewissen Maß an Leichtfertigkeit einherzugehen. Die Befestigungsanlagen an der Ochtum waren nur oberflächlich erkundet worden. Burchard verließ sich ganz auf seine Belagerungsmaschinen. "Mit denen würden wir in zwei Tagen Bremen erobern!" tönte er. Unklarheiten umgaben auch das Heer der Stedinger, welches nach dem Rückzug vor Oldenburg noch für mancherlei Überraschung gesorgt hatte, inzwischen jedoch spurlos verschwunden war. Auch hierfür hatte der Graf einen Spruch bereit: "Die laufen wieder hinter ihren Ochsen her über die Äcker." Die Ereignisse in Oststedingen bestärkten ihn in seiner Hochfahrendheit. Freilich konnte er durchaus berechtigt darauf verweisen, doppelt soviel Männer zu befehligen wie seinerzeit Otto bei seinem Sieg. Burchard und sein Sohn ritten dem Heer voran, nur gedeckt durch eine besondere Einheit aus zwölf ausgewählten Rittern. Heinrich teilte die Zuversicht seines Vaters nicht. Er war während der Vorbereitungen unentbehrlich gewesen, denn er besaß jene Erfahrung und militärische Schläue, die häufig über Sieg und Niederlage entscheiden, manchmal entgegen jeder vernünftigen Voraussage. Er hatte sich mit der Kampfweise der Stedinger befasst und aufgrund seiner neuen Erkenntnisse das Heer im letzten Moment noch einmal umgeordnet. Auch Verbesserungen an den Belagerungsmaschinen waren von ihm veranlasst worden. An jenem Tage, als das Heer sich auf die Ochtum zu wälzte, hätte seine innere Verfassung freilich kaum widersprüchlicher sein können. Einerseits war er fest davon überzeugt, alles für einen Sieg Notwendige getan zu haben. Andererseits verfolgte ihn eine seltsame Verunsicherung. Dutzende Kleinigkeiten erschienen ihm wie böse Zeichen. Wie ein abergläubisches, altes Weib hielt er unentwegt Ausschau nach dem Menetekel. Besonders schlimm wurde das, als er die Trümmer der Schlutterburg auftauchen sah. Die geborstenen Mauern waren dick mit Ruß überzogen, den noch kein Regenguss abgespült hatte. Die Spuren wirkten so frisch, dass er meinte, aus den Ritzen dünne Fäden von Rauch aufsteigen zu sehen. Plötzlich glaubte Heinrich, die Zeichen zu verstehen: Sie kündigten ihm seinen Tod an. Das Heer wird siegen, er selbst aber auf einem 158 trostlosen Feld verbluten. Während die anderen die fliehenden Stedinger verfolgen, werden Tiere an ihm nagen. Er sah die Szene so deutlich vor sich, dass er nach einiger Zeit erschrocken an sich herunterblickte, verwundert darüber, noch vollständig zu sein. Niemand indes sollte ihm nachsagen können, ehrlos diese Welt verlassen zu haben. Da er nun einmal dem Tode geweiht war, wollte er wenigstens als Held sterben. Während er so grübelte, verlor er das Gefühl für die Zeit und wusste schließlich nicht einmal mehr, wo er sich gerade befand. Erst als ein Ritter ihn anstieß, fand er in die Wirklichkeit zurück. "Der Weg ist versperrt. Anscheinend hat ein Sturm Bäume entwurzelt." Heinrich hob den Kopf. Tatsächlich bildeten knapp hundert Schritt voraus etliche dicke, kreuz und quer übereinander gestapelte Stämme ein mannshohes Hindernis. Das sonderbare Gebilde sah aus, als habe ein Riese seinen Mutwillen getrieben. Dass dies das Werk eines Sturmes war, mochte der Grafensohn nicht glauben. "Wo sind wir hier?" "Noch mehr als zwei Meilen von der Ochtum entfernt." Heinrich strich sich nachdenklich übers Kinn und sah sich um. Links zog sich ein Wald mit dichtem Unterholz hin. Das war nicht ungefährlich. Immerhin breitete sich aber auf der rechten Seite freies Land fast bis zum Horizont aus. Dort zeigte sich weit und breit kein Mensch. In der Ferne erst hoben sich die Umrisse eines Dorfes ab. "Ein paar Knappen sollen sich die Wiese ansehen. Ich will wissen, ob sie die Belagerungsmaschinen trägt." Wenig später schwärmten zwanzig Männer aus. Im Heer entstand unterdessen Unruhe wegen der für die meisten unerklärlichen Stockung. "Wir sollten die Baumstämme einfach beiseite räumen und weitermarschieren", meinte Burchard. Das war nahe liegend, aber Heinrich hatte das Gefühl, als wolle eine innere Stimme ihn warnen. "Mir gefällt dieser Wald nicht", brummte er. "Ach was! Du siehst wieder einmal Gespenster." Die Hauptleute, die gewöhnlich mehr dem Sohn vertrauten, stimmten in diesem Fall dem Vater zu. "Wir stehen hier ziemlich dumm herum." Heinrich verteidigte sich: "Wir hätten Kundschafter aussenden sollen. Dann wüssten wir jetzt, was gerade hinter diesem Wald vor sich geht. Das Hindernis ist von den Bauern für uns aufgebaut worden. Vielleicht wollen sie uns nur aufhalten, um Zeit zu gewinnen. Vielleicht aber ..." Burchard unterbrach ihn, um eine spitze Bemerkung dagegen zu setzen, da meldete ein Ritter die Beobachtungen der Knappen. "Die Wiese ist an einigen Stellen sumpfig. Zumindest für die Belagerungsmaschinen müssten wir Knüppeldämme bauen." "Nein, da kommt zuviel zusammen! Das sind keine Zufälle. Vater, befehlt den Männern, sich auf eine Schlacht einzurichten!" "Das ist nicht dein Ernst! Wir machen uns lächerlich." "Sie sollen sich ihre Helme über den Kopf stülpen. Bitte, hört einmal in Eurem Leben auf den Rat Eures Sohnes!" "Oh nein! Nicht im Traum denke ich daran! Warum habe ich dich mitgenommen? Damit du die Männer mit deinen Hirngespinsten verwirrst, ihnen womöglich den Mut nimmst?" Er wollte noch mehr sagen, war kurz davor, sich in eine Orgie von 159 Beschimpfungen hineinzusteigern. Ein Aufschrei jedoch veranlasste ihn, sich wieder nach vorn zu wenden. Über den Wall aus Baumstämmen kletterten Bauern mit Schwertern und langen Spießen. Das Gespenstische daran war, dass sie aus einer schier unerschöpflichen Quelle zu kommen schienen. Die ersten besetzten den Weg. Die nächsten strömten auf die Wiese hinaus. Beide Gruppen bildeten zusammen eine breite Front. Unterdessen formierte sich hinter der ersten Reihe bereits eine zweite, dann eine dritte. Noch waren die Stedinger verhältnismäßig weit entfernt. Sie näherten sich auch nur langsam, so dass Heinrich Zeit hatte, seine Männer leidlich zu ordnen. Auf dem Weg konnten er allerdings höchstens fünf Reiter nebeneinander aufstellen und auf die tückische Wiese wollte er ohne Not nicht ausweichen. Das Heer der Kreuzfahrer stand den Regeln der Kriegskunst nach völlig falsch. Es wandte dem Feind seine schmale Seite zu statt der breiten Front. Die meisten Männer würden gar keine Gelegenheit finden, in den Kampf einzugreifen. Heinrichs entschloss sich unter diesen Umständen zu einer ungewöhnliche Taktik: Er ordnete das gesamte Heer in der Form eines riesigen Schwertes an. Die am schwersten bewaffneten Reiter beorderte er in die Spitze. Sie sollten die Phalanx der Stedinger glatt zerschneiden. Die übrigen Ritter bildeten die Schneiden. Sie mussten Angriffe von der Seite zurückschlagen. In der Mitte versteckten sich die ungenügend geschützten Knappen mit den Belagerungsmaschinen. Das alles war eher eine Verzweiflungslösung denn ein Geniestreich. Konnte es der Spitze gelingen, zu kämpfen und gleichzeitig das Hindernis zu beseitigen? Konnten die Schneiden einen massiven Angriff auf einen bestimmten Punkt zurückschlagen? Die meisten Ritter verloren ihre Waffenträger aus den Augen. Die Knappen in der Mitte wurden zusammengedrängt, dass sie fast erstickten. Das auf dem unebenen Grund schwer zu bewältigende Belagerungsgerät bildete eine tödliche Bedrohung für sie. Heinrichs Plan aber ging auf. Die Bauern auf dem Weg mussten zurückweichen. Ihre Spieße zerbrachen an den Schilden und Rüstungen der vorrückenden Panzerreiter. Auch die hinteren Reihen konnten den gewaltigen Stoß nicht abfangen. Wer sich nicht rechtzeitig in Sicherheit brachte, den zermalmten die Hufe der Streitrösser. Schritt für Schritt schob sich das Heer auf das Hindernis zu. Heinrich stellte bereits eine Gruppe von Männern zusammen, welche im Schutz der Panzerreiter die Baumstämme beiseite schieben sollten. Selbst er, der Schwarzseher, glaubte nun nicht mehr an die große Schlacht. Eine letzte Anstrengung und der Weg würde wieder frei sein. III D ie Bauern hatten ihr Lager in einer Talmulde errichtet. Dieser Platz unweit des Dorfes Hemmelskamp eignete sich dafür hervorragend. Von der Straße aus konnte er nicht eingesehen werden, weil der Ausläufer eines Waldstücks dazwischen lag. Ein fester Weg führte bis zur Ochtum, wo eine geheime Furt die Verbindung nach Weststedingen herstellte. Zwei Quellen und ein Brunnen sorgten für genügend Wasser. 160 Nur ein starker Regen hätte Schwierigkeiten bereitet. Schon seit einer Woche erwarteten die Stedinger hier die Kreuzfahrer, darauf rechnend, dass ein Mann wie Burchard von Wildeshausen keine Finessen versuchen, sondern auf brachiale Gewalt vertrauen würde, und dass sein Sohn sich dagegen nicht durchsetzen könnte. Ihr Heer war inzwischen noch stärker als seinerzeit beim missglückten Angriff gegen Oldenburg, denn das Blutbad bei den Brüdern in Oststedingen hatte die Leute in den Dörfern wachgerüttelt. Niemand kümmerte sich in dieser Stunde mehr um seine Felder. Das Hindernis auf der Straße hatten die Bauern erst am Vortag errichtet, damit die Angreifer nicht zu früh Verdacht schöpften. Dort tobte der Kampf schon. Die Wartenden im Lager hörten es deutlich, obwohl dichtes Gestrüpp einen Teil des Lärms verschluckte. Also würden auch sie selbst bald den Rittern entgegentreten. Ihre Blicke verfolgten jeden Schritt Tammos von Huntorf, der in der Mulde das Kommando führte. Dieser jedoch wartete selbst auf ein Zeichen. Oberster Befehlshaber war Dietmar tom Diek, der von einem getarnten Punkt aus die umkämpfte Straße beobachtete. Bei seinem Plan spielte die Zeit eine wichtige Rolle. Die Ritter sollten sich möglichst dicht zusammen drängen und tief in die Falle hinein laufen. Andererseits konnten die 200 Leute, welche die Sperre verteidigten, dem Druck der gepanzerten Elitetruppen nicht mehr lange standhalten. Franziskas Fähnlein lagerte am Rande der Talmulde. Dort gab es Schatten, was ein Vorteil war, seit volle Bereitschaft galt und jeder bis auf den Helm vollständig gerüstet sein musste. Die Pferde standen einige Meter entfernt an die ersten Bäume des Waldes gebunden. Um die Tiere hatte es Streit gegeben. Sie galten im Bauernheer als Privileg, das einige Hauptleute den Fremden aus der Waldhütte nicht zugestehen wollten. Tammo legte sich sehr ins Mittel, dass sie ihnen nicht weggenommen wurden. Der zum Bauernführer aufgestiegene Schmied verhielt sich seit den Ereignissen vor Oldenburg gegenüber Franziska ausgesprochen respektvoll. Seiner Überzeugung nach wäre es zu jenem peinlichen Zwischenfall nicht gekommen, hätten sich alle so mutig und entschlossen verhalten wie sie. Dass sie ein junges Mädchen war, spielte nun endgültig keine Rolle mehr. Sie wurden sogar anderen als Vorbild gepriesen. Entsprechend hatte ihr Fähnlein in der neuen Schlachtordnung auch einen anderen Platz. Es sollte nicht länger im Hintergrund bleiben sondern von Anfang an vorn mitkämpfen. Franziska behagte diese Heldenlegende überhaupt nicht. Zum einen wusste sie, dass sie nicht der Wahrheit entsprach, jedenfalls nicht in vollem Umfang. Sie war dem Überfall ohne Überlegung und Plan begegnet und wunderte sich im Nachhinein sehr, dass niemand Schaden erlitten hatte. Zum anderen mochte sie lieber (wie einst in der Waldhütte) als Vermittler auftreten. Wie kam sie dazu, Befehle zu erteilen? War der Bogen nicht schon überspannt? Und noch etwas belastete sie neuerdings - sie wusste inzwischen, dass sie vor Oldenburg ihrem Vater gegenübergestanden hatte. Während des Kampfes um das Anführerzelt war alles so schnell gegangen, dass sie die Wappen auf Kleidung und Schilden nicht wahrnahm. Beim Abzug des Heeres jedoch erkannte sie den Wimpel der Westerholts auf dem Dammtor, schöpfte Verdacht und fand schließlich die Wahrheit heraus. Wenn Wilhelm aber als Vasall der Oldenburger bei den Kreuzfahrern 161 kämpfte, steckte er vielleicht dort auf der Straße mit in der Falle. Was sollte sie tun, wenn sie in der Schlacht wieder auf ihn träfe? Was würde er tun? Bliebe ihnen überhaupt eine Wahl? Schlachten, Kriege überhaupt gehören (wie schwere Seuchen und Unwetter) zu jenen Ereignissen, in welchen der einzelne Mensch seine Bedeutung verliert, fortgerissen, ohne Gelegenheit zu wählen. Diese Sorgen lenkten Franziska immerhin von noch Schlimmerem ab, zum Beispiel von der Möglichkeit des eigenen Todes. Das Warten zerrte an den Nerven. Norbert vermochte keinen Moment still zu stehen. Zuerst versuchte er, sich irgendwie zu beschäftigen, brachte wieder und wieder seine Ausrüstung in Ordnung, sah ein Dutzend Mal nach den Pferden. Dann lief er nur noch wie ein gefangenes Tier auf und ab. Ramira hingegen saß mit ihrem Wimpel im Arm auf einem alten Baumstamm und malte mit einem Zweig Figuren in den Sand zu ihren Füßen. Die Stimmung um sie herum, die Aufregung, die Angst, nichts davon schien bis zu ihr vorzudringen. Mit dieser unnatürlichen Ruhe fachte sie ein fast in Vergessenheit geratenes Gerücht wieder an. "Sie ist doch eine Fee", raunten die Männer einander zu "Wenn es nachher in der Schlacht gefährlich für sie wird, macht sie sich einfach unsichtbar." Christian war sich in dieser Hinsicht nicht so sicher. Obwohl sie ihn ständig mit spitzen Bemerkungen aufzog, hatte er sich nicht davon abbringen lassen, bei jedem Kampf als Beschützer in ihrer Nähe zu bleiben. Wie das bei schüchternen Männern häufig vorkommt, war er in seiner ersten Liebe grenzenlos. Darüber vergaß er sogar seine eigene Verwundbarkeit. Ihn beunruhigte nur Ramiras seltsames Ver- halten. Beharrlich versuchte er, sie zum Reden zu bringen. "Was ist mit dir? Fühlst du dich nicht gut?" Keine Antwort. "Hast du Durst? Soll ich dir einen Becher Wasser holen?" Gereizt versetzte sie: "Ich habe keinen Durst. Lass mich in Frieden!" Diese grobe Abfuhr tat ihr dann aber doch Leid. "Ich denke nach. Verstehst du? Ich frage mich, ob das alles Sinn hat, dieser Krieg, das viele Blut. Am Ende werden wir doch verlieren." "Du meinst, weil wir uns gegen die von Gott eingerichtete Ordnung wenden?" "Ich weiß nicht, ob Gott das alles so eingerichtet hat. Ich weiß nur, dass die Herren am Ende immer wieder die Herren sind. Das ist eine Erfahrung. Tausende von Menschen müssen sterben, nur weil irgendwelche Leute irgendetwas ändern wollen, was nun einmal nicht zu ändern ist." "Sag das nur nicht zu laut!" "Ich sage es nur leise und nur dir weil du nicht eher Ruhe gibst." Jörg und Liemar aus Neudeich stellten sich solche Fragen nicht. Seit dem Überfall auf ihr Dorf empfanden sie, wenn sie an den Erzbischof und seine Parteigänger dachten, kaum etwas anderes als Verbitterung und Hass. Der kleinen Jule ging es inzwischen zwar etwas besser. Für ihre nächsten Angehörigen war sie wieder ansprechbar. Nach wie vor aber wollte sie nicht nach draußen gehen. Kam ein Fremder zu Besuch, versteckte sie sich sofort. Niemand wusste, ob sie jemals würde heiraten können, eine Familie gründen, Kinder großziehen. Der Durst nach Rache war noch längst nicht gestillt. Bei Jörg und Liemar verdrängte er sogar die Angst. Sie konnten es gar 162 nicht erwarten, endlich in die Schlacht ziehen zu dürfen, um möglichst viele Ritter zu töten. IV E ndlich gab Dietmar tom Diek den Befehl zum Angriff. Die ersten Gruppen standen auf und umgingen den Waldzipfel im Rücken der Ritter. Franziska schloss sich mit ihrem Fähnlein wenig später an. Zwanzig Leute gehörten an diesem Tage zu ihr, zwölf Bürgerliche und acht Bauernsöhne. Es war nicht leicht zusammenzubleiben, denn am Ende des Waldzipfels, wo äußerst zügig ein Schwenk im spitzen Winkel bewältigen werden musste, entstand ein gefährliches Gedränge Das Heer der Stedinger setzte sich (von den schon vorher ausgegliederten Männern an der Sperre einmal abgesehen) aus zwei Teilen zusammen. Auf der rechten Seite sammelten sich jene Bauern, die weder Pferde noch Rüstungen mit sich führten und nur mit Lanzen, Äxten, Schwertern sowie allerlei geeignetem Ackergerät bewaffnet waren. Ihre Verwundbarkeit glich sich dadurch aus, dass sie im morastigen Boden nicht einsanken. Sie hatten tellerartige Vorrichtungen an die Schuhe gebunden und kannten die tückischen Wiesen von zahlreichen Erkundungen her. Zu Beginn der Schlacht bot dieser Flügel allerdings ein recht wirres Bild. Die Reihen gerieten nach dem Schwenk völlig durcheinander und nur weil die Ritter diese orientierungslose Menschenherde nicht ernst nahmen, kam es zu keiner Katastrophe. Jörg und Liemar, die ihre Pferde abgegeben hatten, um auf der vermutlich entscheidenden Seite dabei sein zu können, waren lange Zeit hoffnungslos eingekeilt. Der linke Flügel blieb auf der Straße und sollte verhindern, dass sich die Kreuzfahrer aus der Umklammerung wieder befreiten. Auf dem festen Grund besaßen die Bauern aber keine Vorteile. Dietmar tom Diek wusste, dass hier der schwächste Punkt seines Planes lag und hatte versucht, wenigstens einen Teil seiner Leute ähnlich wie Ritter auszurüsten. Das war ihm jedoch nur annähernd gelungen und so blieb nur eine tiefe Staffelung als Mittel. Fünf Rotten hatte er auf der Straße hintereinander aufgestellt. Sobald die vorderste ins Wanken geriet, sollte die folgende in den Kampf eingreifen. Wer schon am Anfang zu den ersten Reihen gehörte, war dem Tod beklemmend nah, und selbst für die dritte Rotte, zu der Franziskas Fähnlein gehörte, bestand noch genug Gefahr für Leib und Leben. Im Angesicht des gewaltigen Kreuzzugsheeres verloren die Selbstbetrügereien, mit denen viele sich im Lager beruhigt hatten, ihre Wirksamkeit. Manch einer wäre in Panik geflohen, hätte er die Möglichkeit dazu gehabt. Während der rechte Flügel sich unter Tammos Kommando auf der Wiese allmählich ordnete und zu einer breiten Front auseinander zog, ging auf der Straße die Schlacht in ihre zweite Phase. Entgegen den Erwartungen hielt sich die erste Rotte verhältnismäßig lange, vielleicht weil die Ritter sich so rasch nicht neu orientieren konnten. Erst als die zweite Rotte die erschöpften Gefährten ablöste, wurde der Kampf grausam. Eine Gruppe von einem Dutzend Panzerreitern unternahm einen energischen Durchbruchsversuch. Die 163 Wucht dieses Vorstoßes riss die dritte Rotte in den Strudel des Gefechtes hinein, ehe sie den Befehl zum Eingreifen erhalten hatte. Von einem Moment zum anderen sah sich Franziska in eine Welt versetzt, die sie bislang nur von Höllendarstellungen her kannte. Links und rechts fielen dicht hintereinander zwei ihrer Kameraden vom Pferd. Dem einen schoss ein Strahl Blut aus dem Hals. Die Luft war erfüllt von einem entsetzlichen Lärm, der sich zusammensetzte aus unmenschlichen Schreien, dem Krachen zersplitternden Holzes und dem schrillen Kreischen von Metall. Da blieb auch Franziska nicht mehr sie selbst. Getrieben von Hass und Todesangst zugleich, drang sie auf die Ritter in ihrer Nähe ein. Sämtliche moralische Bedenken waren ausgelöscht. Die Kraft schien grenzenlos zu sein. Die Menschen glichen Tieren, die tollwütig um sich bissen. Ramira sollte mit ihrem Wimpel eigentlich stets in den hinteren, nicht unmittelbar am Kampf beteiligten Reihe bleiben, war aber von der Angriffswelle überrollt worden. Nun stand sie (gerüstet aber völlig unbewaffnet) mitten im Getümmel und wurde hin und her gerissen wie ein Boot auf schwerer See. Auch sie hatte dergleichen noch nie erlebt, obgleich ihr vom Schicksal ansonsten wenig erspart worden war. Bei ihr aber bewirkte der Schock, dass sie abstumpfte, sich an ihre Aufgabe klammerte und mechanisch handelte wie eine Schlafwandlerin. Als ihr ein heftiger Stoß den Wimpel entriss, setzte sie alles daran, ihn zu retten. Sie sprang vom Pferd und bekam tatsächlich den Schaft zu fassen. Als sie sich jedoch wieder in den Sattel schwingen wollte, traf sie ein weiterer Stoß. Sie wäre unter die Hufe geraten und zu Tode getrampelt worden, hätte Christian sie nicht am Arm gepackt. Franziska verlor die Übersicht. Zeitweilig glaubte sie, die Schlacht sei verloren, denn auf jeden erschlagenen Ritter kamen wenigstens fünf gefallene Stedinger. Sie wusste nicht, dass die schweren Panzerreiter, die den Durchbruch zu erzwingen versuchten, inzwischen isoliert kämpften. Der vierten und fünften Rotte war es gelungen, sich zwischen sie und die Hauptmasse des Kreuzzugsheeres zu schieben. Trotz großer Verluste auf Seiten der Bauern, begann die Schlacht sich du drehen. Die Panzerreiter erhielten keine Unterstützung mehr. Für ihre Knappen wurde die Enge auf der Straße zur Baumsperre hin so groß, dass Panik um sich griff. Auch gerieten immer mehr Ritter, so verzweifelt sie sich auch dagegen wehrten, auf die sumpfigen Wiesen. Als die vierte Rotte eine der Belagerungsmaschinen eroberte, sah Dietmar die Zeit für die dritte Phase der Schlacht gekommen und befahl Tammo, mit dem rechten Flügel vorzurücken. Das Kreuzzugsheer ließ daraufhin das gesamte schwere Kriegsgerät im Stich, und igelte sich auf einem erhöht gelegenen, trockenen Teilstück der Wiese ein. Es war noch immer stark und seine Führer hofften offenbar, die Bauern durch andauernden Widerstand allmählich zermürben zu können. Allerdings gelang das Manöver nicht wie geplant. Die noch immer zwischen den fünf schweren Rotten der Stedinger feststeckenden Panzerreiter fanden keinen Anschluss und ergaben sich. Andere Fähnlein erreichte der neue Befehl nicht rechtzeitig, so dass sie auf der Straße zerrieben wurden. Jörg und Liemar stießen gemeinsam mit hunderten ihrer Kameraden einen Schrei aus, als sie endlich in die Schlacht eingreifen durften. Dieser Schrei brachte die Kreuzfahrer auf ihrer Anhöhe zum Erschauern. Deren Ring 164 wies eine verwundbare Stelle auf. Ein zwanzig Schritt breiter versumpfter Einschnitt konnte nur mit leicht gerüsteten Männern besetzt werden. Tammo erkannte das und beorderte den größten Teil seiner Leute dorthin. Dann leitete dumpfer Trommelwirbel den letzten, den tödlichen Angriff ein. Die Stedinger mit ihren künstlich verbreiteten Schuhen überwanden den Morast im Sturm. Ihre Gegner, die sich auf diesem Gelände unsicher fühlten, wurden überrannt. Die Kreuzfahrer mussten hilflos mit ansehen, wie die Bauern ins Innere der Igelstellung eindrangen. Ihre Ordnung löste sich auf. Niemand gab mehr Befehle. Nur einige kleinere Gruppen hielten zusammen in der Hoffnung, gemeinsam besser zu entkommen. Die meisten kämpften nur noch für sich allein. Die schwer gepanzerten Ritter fürchteten panisch das Moor und drängten auf die Straße zurück, obwohl diese längst fest in der Hand der Stedinger war. Dabei spielten sich grauenvolle Szenen ab. Die Bauern und ihre Verbündeten vom linken Flügel hatten einen hohen Preis bezahlt für jenen schmalen Streifen Land. Franziska zählte nur noch zehn ihrer Leute um sich. Die anderen waren entweder tot oder lagen schwer verwundet irgendwo im Wald. Dass sie selbst nur leichte Verletzungen erlitten hatte, grenzte an ein Wunder. In den übrigen Fähnlein sah es kaum besser aus. So kam es, dass die Verteidiger keine Gnade kannten. Wer sich der Straße näherte, wurde niedergehauen, was nicht schwer war, weil die Fliehenden keine Formationen mehr bildeten. In einem Blutrausch erschlugen die Bauern über fünfzig Ritter. Während dieser letzten Phase der Schlacht hielt sich Ramira mit dem Wimpel tatsächlich dort auf, wohin sie gehörte - eine Pferdelänge hinter der Kampflinie im Rücken des Fähnleinführers. Christian blieb weiterhin bei ihr, wobei er sich der Gefahr aussetzte, als Feigling zu gelten. Beide hatten einen guten Überblick über das Geschehen, wobei ihnen nicht entging, dass sich auch Franziska an dem Massaker am Rande der Straße beteiligte. Christian war außer sich vor Entsetzen und fragte sich, ob nach diesem Tag ein Zusammenleben wie früher in der Waldhütte noch möglich sein würde. Vielleicht wäre er ohne die Verantwortung für Ramira einfach geflüchtet, den letzten Zipfel Ehre zurücklassend. Ab und zu warf er einen Blick zu ihr hinüber. Auf ihrem Gesicht zeichnete sich aber keine Gefühlsregung ab. Sie blickte starr geradeaus und ihre Gedanken schienen nur darum zu kreisen, mit ihrem Wimpel stets am richtigen Ort zu sein. V H einrich von Wildeshausen hatte jede Verbindung zum Kreuzzugsheer verloren. Er drehte sich um, hielt Ausschau nach bewaffneten Bauern. Niemand verfolgte ihn. Die Schlacht tobte weit entfernt an mehreren Stellen zugleich überall dort, wo es den Stedingern gelang, fliehenden Rittern den Weg zu versperren. Heinrich fragte sich, wieso er bis hierher hatte gelangen können. Er erinnerte sich noch daran, wie sich die Reihen auflösten und wie die stolze Streitmacht im apokalyptischen Chaos versank. Aber was war danach geschehen? Sein Grübeln fand ein jähes Ende, als die 165 Erschöpfung ihn wie ein Hammerschlag überwältigte. Seine Kraft reichte gerade noch aus, um sich vom Pferd gleiten zu lassen. Dann rollte er in ein Gebüsch und fiel in Ohnmacht. Beim Erwachen wusste er nicht, ob nur ein kurzer Zeitraum vergangen war oder womöglich ein ganzer Tag. Seine Gedanken kehrten jedoch sofort zu jener Frage vor dem Schwächeanfall zurück: Was war geschehen? Er hörte sich rufen: "Nicht zurück zur Straße! Sie werden euch in Stücke hauen." Niemand hatte seine Warnungen beachtet. Das fliehende Heer benötigte keinen Kommandierenden mehr. Wenn er aber nicht mehr gebraucht wurde, war es zweifellos an der Zeit, dass sich sein Schicksal vollendete. In dem manischen Drang, als Held zu sterben, ließ er den Schild fallen und entledigte sich sogar des Helmes. Dann warf er sich blindlings in eine zufällige Richtung und kämpfte wie im Rausch bis er sich plötzlich ohne Gegner wieder fand. Mühsam richtete er den Oberkörper auf, was ihm Schmerzen bereitete. Um die Wunden zu untersuchen, legte er den Rest seiner Rüstung ab. Dabei stellte er fest, dass die Verletzungen nicht lebensgefährlich waren. Also biss er die Zähne zusammen und erhob sich gänzlich. Über den Busch hinweg überblickte er einen großen Teil der Wiese und fand sie übersät mit reglosen Leibern. An lebenden Menschen entdeckte er nur ein paar Bauern, die den gefallenen Rittern die Ausrüstung abnahmen und auf einen Wagen luden. Sobald der Wagen einzusinken drohte, fuhren sie ihn zum Wald, wo sie ihn wieder leerten. Auf der Straße ragten die nutzlos gewordenen Belagerungsmaschinen wie Skelette riesiger Tiere auf. Schwankend kehrte Heinrich auf das Schlachtfeld zurück und hatte bald die ersten Leichen erreicht. Dabei fielen ihm wieder seine Visionen ein. Mit jedem Schritt erschien es ihm sonderbarer, dass er noch lebte, während diese Männer dort tot waren. Umgekehrt hätte es doch sein müssen: Das Heer erkämpft einen glänzenden Sieg, während er unbeachtet verblutet. Abermals ergriff ihn die irre Sehnsucht nach dem Jenseits. Er lief direkt auf die Stedinger zu. Die ließen sich aber bei ihrer Arbeit durch ihn nicht stören. Er packte einen von ihnen, schüttelte ihn und schrie: "Warum erschlägst du mich nicht? Ich bin dein Feind. Ich habe das Kreuzzugsheer angeführt." Der auf so seltsame Weise angegriffene Mann befreite sich mit einer kurzen Bewegung und wich erschrocken zurück. Dann unterhielt er sich flüsternd mit seinen Kameraden. Zweifellos hielt er den Fremden für geisteskrank. Dadurch jäh ernüchtert, beschloss Heinrich, auf der Wiese noch Verwundeten zu suchen, die ihn vielleicht brauchten. Er ging von einem der verstreut liegenden Körper zum anderen, fand allerdings niemanden, dem er helfen konnte. Schon willens, sich zu Fuß nach Wildeshausen durchzuschlagen, warf er noch einen letzten Blick auf jenen Ort, wo das stolze Heer untergegangen war, als einer der Leiber seine Aufmerksamkeit erregte. Er trat näher, drehte ihn um und prallte entsetzt zurück. Er hatte seinen Vater gefunden. In Burchards weit aufgerissenen Augen spiegelte sich noch ein Rest Verwunderung. Der Graf war bis zuletzt überzeugt gewesen, dass seine gewaltige Streitmacht gegen einen Bauernhaufen unter keinen Umständen verlieren könne. Er hatte fest daran geglaubt, an diesem Tage das Rad der Geschichte in der Hand zu halten. Die 166 Oldenburger würden abseits stehen beim Einbringen der großen Ernte. Ihr lächerlich kleines Kontingent brächte ihnen eher Hohn als Anerkennung. Diesem feigen Grafen Otto geschähe das ganz recht, ihm, dem seine besten Leute zu schade waren für ein vom Papst höchstselbst angeordnetes Unternehmen. Besonders hatte sich Burchard über das Fernbleiben des Wilhelm von Westerholt geärgert, jenes Ritters, den neuerdings alle Welt als Helden pries und der einmal sein Lehnsmann gewesen war. Heinrich hatte zu seinem Vater kein so herzliches Verhältnis, um wirklich Trauer empfinden zu können. Seine Sorge galt der Grafschaft. Um sich davon abzulenken, wandte er sich praktischen Dingen zu. Burchard durfte nicht auf dieser Wiese liegen bleiben, sondern musste ins Schloss gebracht werden. Heinrich lud ihn sich also auf die Schultern und begab sich auf den weiten Weg. Geschwächt durch die Anstrengungen der Schlacht und die Verwundungen, erreichte er aber nicht einmal das nächste Dorf. Allein hätte er sich vielleicht noch ein Stück weiter schleppen können. Das wäre ihm aber schäbig vorgekommen und so blieb er, dem ungewissen Schicksal sich ergebend, bei dem Toten sitzen. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit kam ein Trupp versprengter Ritter dort entlang. Die besorgten einen Wagen und brachten damit den alten und den neuen Grafen an ihr Ziel. Gegen Mittag des nächsten Tages traf der Zug ein. Heinrich war halbwegs wieder zu Kräften gekommen und folgte zu Pferde in einer geliehenen, schlecht passenden Rüstung dem auf einem bäuerlichen Wagen aufgebahrten Vater. Das alles sah so erschütternd aus, dass selbst Menschen, die unter Burchards Launen gelitten hatten, in Tränen ausbrachen. In der Stadt kamen die Bürgersfrauen aus den Häusern gerannt. Auf dem Hof des Schlosses strömten die Mägde und Knechte zusammen. Erst der Burgvogt sorgte dafür, dass der Graf auf ein Lager gebettet wurde, welches seinem Range entsprach. Als die Gräfin vor das Portal des Palas trat, bildeten die versammelten Leute eine Gasse. Natürlich wusste jeder, dass kaum jemand so sehr wie sie Grund zur Erleichterung hatte - und zugleich so sehr wie sie offiziell zur Trauer verpflichtet war. Kunigunde de Schodis indes schien die lauernd auf ihr ruhenden Blicke nicht wahrzunehmen. Auf ihrem Gesicht ließ sich weder Freude noch Gram erkennen. Vielleicht hatte die schreckliche Ehe in ihr jegliche Fähigkeit zu starken Gefühlen zum Absterben gebracht. Sie tat ruhig und gemessen, was Sitte und Brauch von ihr verlangten, und zog sich dann wieder in ihre Kemenate zurück. Von Agnes erwartete niemand eine besondere Geste. Sie hielt sich im Gedränge versteckt und schenkte dem Toten kaum einen Blick. In Gedanken entschlüpfte ihr sogar ein höchst sündiges Dankgebet. Allerdings war sie auch ein wenig besorgt. Heinrich sah keineswegs so entschlossen aus, wie sie das von ihm erwartete. Er war doch nun der Herr in Wildeshausen und sollte dafür sorgen, dass sich die Verhältnisse zum Besseren wendeten. Bisher hatte sie seine Anfälle von Schwermut auf die Tyrannei des Vaters zurückgeführt. Am späten Abend fand sie endlich eine Gelegenheit, mit ihm allein zu reden. Sie umarmte ihn wie eine Ehefrau und bestürmte ihn mit Fragen. Während er von dem Gemetzel am Hemmelskamper Wald berichtete, von den 200 gefallenen Rittern, von seinen Selbstvorwürfen und Zweifeln, da war sie mit einem Mal nicht mehr das gefallsüchtige Mädchen von einst sondern eine erwachsene Frau mit 167 vernünftigen Ansichten. Sie wuchs über sich hinaus, weil sie spürte, dass er sie brauchte. "Du musst deinen Schwermut überwinden!" beschwor sie ihn. "Nur du kannst die Grafschaft retten." Beigesetzt wurde Graf Burchard zwei Tage später in der Kirche des Klosters von Rastede und zwar unmittelbar vor dem Altar des Heiligen Martin. Der von Bischof Johannes geleitet Begräbnisgottesdienst stand so sehr im Gegensatz zu den grauenvollen Todesumständen auf der sumpfigen Wiese nahe der Ochtum und der kläglichen Ankunft in Wildeshausen, dass es auf die Eingeweihten geradezu zynisch wirkte. Der Erschlagene war bereits zum Spielball höherer Politik geworden, zu einem Gegenstand, über den die Mächtigen nach Gutdünken verfügten. Weil das in diesen Tagen nicht anders sein durfte, stieg er auf zu einem kühnen Helden und einem Märtyrer dazu. In ermüdenden Aufzählungen pries der Bischof die Vorzüge des Grafen. Da kam es schon mal vor, dass ein Höfling sich über einen besonders absurden Vergleich ein Schmunzeln nicht verwehren konnte. Im Grunde waren mittlerweile die meisten Leute im Schloss und in der Stadt erleichtert über Burchards Ableben. Sie erwarteten vom Sohn eine bessere, zumindest eine berechenbarere Politik. Insgeheim dachte das sogar der Bremer Erzbischof, der Lehnsherr. In die Chroniken gingen nur die salbungsvollen Lobpreisungen von der Kanzel ein, nicht die geflüsterten spitzen Bemerkungen im Kirchenschiff. Und auch zu ihrer Zeit verfehlte die Predigt ihre Wirkung nicht gänzlich. Der Sieg der Stedinger über das Kreuzzugsheer verbreitete in der Gegend Angst und Schrecken. Niemand wusste, was die Bauern nun als nächstes unternehmen würden. Wagten sie vielleicht einen neuen Angriff auf Oldenburg oder gar auf Bremen? Die Sitze der kleineren Herren und die Klöster waren ohnehin nicht mehr sicher. Und wenn unter diesen Umständen sogar ein Mann aus dem Hochadel, ein regierender Graf, sein Leben einbüßen konnte, was sollte dann ein einfacher Gefolgsmann erwarten?! Als Johannes die Stedinger als Dämonen bezeichnete, als Ausgeburten des Teufels, sprach er vielen in ihrer Angst aus dem Herzen. Auf dem Wege von Rastede nach Wildeshausen fuhren Heinrich und Agnes in verschiedenen Wagen. Sie mussten vorsichtig sein, denn sie waren schon ein wenig ins Gerede gekommen. Natürlich ließ sich eine Beziehung wie die ihre im Schloss nicht lange verbergen. Nicht das Geschwätz der Dienstleute an sich stellte die Gefahr dar. Es kam vielmehr darauf an, gewisse Regeln zu beachten, damit sich das allgemein bekannte Geheimnis nicht zum Skandal auswuchs. Agnes hatte sich dazu überwunden, ihren einfältigen Ehemann etwas besser zu behandeln. Sie unterließ es, ihn öffentlich bloßzustellen, und sie verprügelte ihn auch nicht mehr. Dafür redete sie ihm Schuldgefühle ein. Wenn sie ihn nicht an sich heran ließ (was die Regel war), dann behauptete sie, ihn damit für irgendein Vergehen zu bestrafen. Umgekehrt strich sie die kleinsten Gefälligkeiten übermäßig heraus. So erreichte sie, dass er für lächerliche Gegenleistungen willfährig ihren Befehlen gehorchte. Heinrich indes gewann durch Agnes neuen Lebensmut. Die Vorzeichen hatten ihn immer wieder belogen, im Guten wie im Bösen. Zwei blühende Ehefrauen waren ihm in kurzer Zeit hinweg gestorben, dieses blasse, ungesund schlanke Ritterfräulein 168 hingegen hielt sich mit der Zähigkeit einer Distel am Leben. Und auch er selbst weilte noch auf Erden und strafte das vermeintliche Menetekel Lügen. Vielleicht war es ihm nicht gegeben, die Zeichen richtig zu deuten. Erst seit Burchard unter dem Stein vor dem Altar des Heiligen Martin lag, vermochte Heinrich seine Grafenwürde auch innerlich anzunehmen. Während er den Kirchturm des Klosters hinter einem Hügel verschwinden sah, schmiedete er erste Pläne für die Zukunft. Zuerst wollte er die unselige Fehde mit den Bruchhausenern beenden. Dabei hoffte er, dass die gemeinsame Bedrohung durch die Stedinger seinen Onkel gesprächsbereit stimmte. Der war zwar ein wilder Geselle, aber zugleich bauernschlau. Sicherlich konnte man ihn überzeugen. Alles andere würde sich finden, die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Grafschaft zum Beispiel. Heinrich nahm sich vor, schon am nächsten Morgen mit gründlichen Überprüfungen zu beginnen. 169 15.Kapitel I S elbstgefällig reckte sich Graf Heinrich III von Bruchhausen auf der Plattform des dicken Wohnturms seiner Burg in die Höhe und ließ den Blick über das Land schweifen. "Es ist niemand zu sehen", konstatierte er schließlich, an seinen gleichnamigen Sohn gewandt. "Alles andere hätte mich auch sehr gewundert. Sie wissen genau, dass sie hier ebenso Prügel beziehen würden wie seinerzeit vor Oldenburg." Heinrich der Jüngere wiegte den Kopf. "Sie sind vielleicht inzwischen stärker. Immerhin haben sie das Kreuzzugsheer besiegt." "Ach! Was war denn das für ein Heer? Was man von der Streitmacht der Wildeshausener halten sollte, wissen wir doch aus eigener Erfahrung. Wie die Hasen habt ihr sie gejagt, damals am Otersenbach, du und dein Bruder und eine Hand voll beherzter Männer. Weißt du es nicht mehr?" "Das weiß ich sehr wohl noch. Wie könnte ich es vergessen? Aber damals waren die Wildeshausener auf sich selbst angewiesen, diesmal hat der Erzbischof sie unterstützt." "Viele Waffen vergrößern nur die Beute der Feinde, wenn die Hauptleute unfähig sind." "Mein Vetter ist nicht unfähig!" Er errötete, weil er den prüfenden Blick seines Vaters bemerkte. Das Verhältnis zwischen ihm und dem Sohn Burchards von Wildeshausen war eine besondere Geschichte. Sie hatte genau genommen schon mit ihrer Geburt begonnen. Dass man ihnen denselben Namen gab (eine Tatsache, die bei spä- teren Chronisten Verwirrung ohne Ende stiftete) war eine kleine Geste zur Vertrauensbildung in einer der wenigen Friedenszeiten. Wirklich kennen gelernt hatten sie sich erst als unternehmungslustige Jünglinge während eines Turniers in Oldenburg. Damals galten die Bruchhausener noch als bessere Bauern und wurden auch entsprechend behandelt. Heinrich von Wildeshausen dagegen stand auf dem Gipfel des Ruhmes als erfolgreicher Ritter. Die jungen Mädchen kreischten, wenn sie ihn sahen. Zwischen den Schranken lieferten sich die gegensätzlichen Vettern dann einen erbitterten Kampf, bei dem am Ende beide nicht mehr auf Leben und Gesundheit achteten und der keinen Sieger fand. Seitdem sahen sie einander mit anderen Augen, der Schönling und der Bauernsohn. "Am Otersenbach war er nicht dabei, wohl aber am Hemmelskamper Wald. Heinrich kennt sich aus. Er weiß, wie man ein Heer führen muss." "Nun reicht es aber!" unterbrach ihn der Graf mit gespielter Empörung. "Was hat er mit dir angestellt, dass du ihn plötzlich liebst wie ein schönes Weib?" Der Sohn wollte sich nicht länger aufziehen lassen und lachte, als habe er nur gescherzt. "Sicher - wenn sie mit so vielen Rittern und so guten Waffen gegen einen Bauernhaufen verlieren, müssen sie sich arg dumm angestellt haben. Wahrscheinlich waren sie leichtsinnig." "Burchard ist Opfer seines Größenwahns geworden." "Hochmut kommt vor dem Fall!" Beiden fiel ein Dutzend Geschichten über den Wildeshausener ein. Dass sie über einen Toten sprachen, störte sie wenig. Sie waren den unberechenbaren Widersacher endlich los. Das allein zählte und war ihnen Anlass zu lärmender, wahrhaft schändlicher Heiterkeit. Burchard, der zu Lebzeiten Dutzende Menschen ins Unglück gestoßen hatte, besaß im Himmel selbstverständlich nicht genügend Ansehen, um einen Blitz gegen seinen hämischen Bruder veranlassen zu können. Von irdischer Strafe blieb Heinrich III freilich nicht gänzlich verschont. Seine Frau Ermentrud erwartete ihn auf der Treppe und zog ihn in die gräflichen Gemächer hinein. "Dass Ihr Euch nicht schämt, Mann!" fauchte sie ohne Respekt. "Ihr wart so laut, dass man Euch unten im Hof gehört hat. Was sollen die Dienstleute denken?! Ihr seid der Herr in der Burg und müsst ihnen ein Vorbild sein." Der riesenhafte Graf, der sich (nach seinen eigenen Worten) weder vor Himmel noch Hölle fürchtete, er wurde plötzlich kleinlaut wie ein unartiger Junge vor der scheltenden Mutter. In den letzten Jahren hatte seine Frau immer mehr das Zepter in die Hand genommen. Ihm war allmählich klar geworden, dass sie ihn an Verstand überragte. Früher hatte er mitunter polterig auf seiner männlichen Überlegenheit beharrt. Doch das fand er nun albern. Da Ermentrud dasselbe wollte wie er, nämlich die Grafschaft wachsen und gedeihen lassen, war es das Gescheiteste für ihn, einfach auf sie zu hören. Immerhin rügte sie ihn niemals in der Öffentlichkeit. Auf dem Hof stand er als Herr und Gebieter da. Und wehe dem, der das nicht anerkannte! "Es ist nicht eben leicht, um solch einen Menschen zu trauern", verteidigte er sich vorsichtig. "Glaubt Ihr denn, mir bereitet es ein Leid, dass er tot ist, Mann?! Aber Ihr müsst Haltung bewahren, jetzt mehr den je. Sein Weg ist am Ende, unser hingegen noch längst nicht." Der Graf wurde hellhörig. "Hast du einen Plan, Frau?" "Kommt mit ins hintere Zimmer, damit uns niemand belauschen kann!" In der Kemenate dann setzte sie ihm auseinander, was sie sich überlegt hatte. "Der Erzbischof wird die Niederlage nicht hinnehmen. Mit einer solchen Schande kann ein Mann wie er nicht leben. Also gibt es schon bald einen neuen Kreuzzug." Der Graf nickte. Das leuchtete ihm ein. "Wer aber soll diesen Kreuzzug anführen? Die Wildeshausener liegen am Boden und werden so rasch nicht wieder aufstehen. Otto von Oldenburg ist allem Anschein nach ein Zauderer, vielleicht sogar ein Feigling. Er will lieber verhandeln als kämpfen. Wer also bleibt übrig?" Der Graf überlegte. Was er dachte, wagte er nicht auszusprechen. "Auf uns könnte die Wahl fallen!" kam Ermentrud ihm zuvor. "Natürlich müssen wir etwas dafür tun. Darüber werde ich noch nachdenken. Ihr aber solltet schon heute so auftreten, als wäret Ihr Euch Eurer Sache sicher." Der Graf fühlte sich durch die Belehrung keineswegs gedemütigt, war ganz im Gegenteil obenauf. Heinrich III von Bruchhausen, Kommandierender des Kreuzzugsheeres wider die ketzerischen Stedinger - das klang gut. Es klang sogar ein wenig unwirklich. Bisher indes hatte Ermentrud noch immer Recht behalten. Obwohl der Graf nicht mit einem Angriff der Bauern rechnete, war er doch nicht so leichtfertig, keine Vorbereitungen für den Ernstfall zu treffen. Er hatte ein Dutzend Ritter und etliche Mann Fußvolk zur Burg bestellt, so dass er rasch die Mauern besetzen lassen konnte. Kundschafter 171 schwärmten regelmäßig in die weitere Umgebung aus. Gegen Abend jenes Tages übernahmen die Söhne des Grafen selbst den Ritt durch die Fluren. Sie taten das gern, wobei sie sich allerdings gewöhnlich unabhängig voneinander Begleiter unter den Waffenknechten suchten. Die Rivalität hatte dazu geführt, dass sie seit Monaten nur noch dann miteinander redeten, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Dass sie plötzlich wieder zueinander fanden, hing mit einer dunklen Bemerkung ihres Vaters zusammen. "Weshalb werden die Oldenburger vor Neid erblassen?" fragte Ludolf. "Was meint er damit?" Heinrich hob die Schultern. "Es muss mit den Stedingern zusammenhängen." "Mit dem Kreuzzug! Das denke ich auch. Wir werden es besser machen als diese Deppen aus Wildeshausen." "Sofern wir uns einig sind." Ludolf blickte forschend zu seinem Bruder hinüber und fragte sich, ob der mit seiner trocken hingeworfenen Bemerkung auf etwas Bestimmtes anspielen wollte. "Selbstverständlich halten wir zusammen!" beeilte er sich zu versichern. "Ich bin manchmal ein Hitzkopf. Das gebe ich zu. Aber wenn es um die Grafschaft geht, dann kannst du dich auf mich verlassen." Er streckte Heinrich wie zum Schwur die Hand hin und dieser schlug ein. "Wir werden es ihnen allen zeigen." Eine Woche später hatte Ermentrud sich etwas überlegt, was in ihren Augen dem Aufstieg ihres Mannes förderlich sein konnte. "Reist nach Holland zu meinen Verwandten, Mann! Burchard war der Gemahl meiner Schwester Kunigunde. Obgleich sie unter ihm (Gott sei's geklagt!) arg zu leiden hatte, ist eine Blutschuld entstanden. Vielleicht wird die Familie de Schodis einen neuen Kreuzzug unterstützen. Erforscht ihre Stimmung! Und bietet Euch immer wieder als Feldherr an!" Gleich am nächsten Morgen brach der Graf auf. In Holland selbst nahm man ihn freundlich auf, sobald er sich mit einer Urkunde als ein angeheirateter Verwandter der Familie de Schodis auswies. Der Tod Burchards hatte sich dort bereits herumgesprochen und zwar in der Version des Johannes von Lübeck. Heinrich wurde mit unzähligen Fragen bestürmt. Die meisten konnte er beim besten Willen nicht beantworten. Manche erschienen ihm merkwürdig. "Ist es wahr, dass er gegen zwanzig Bauern gleichzeitig kämpfte und dass er schon neunzehn von ihnen erschlagen hatte, als der letzte ihm von hinten einen Dolch in den Rücken bohrte?" "Nun, das weiß ich nicht so genau ..." "Habt Ihr denn nicht an seiner Seite gefochten?" "Doch, doch! Das heißt, mein Platz war zur Zeit, als er starb, an einer anderen Stelle." "Ihr habt sie in die Zange genommen!" "Gewissermaßen. Ja, so könnte man es vielleicht nennen." Rasch hatte Graf Heinrich III herausgefunden, dass ein Vetter seiner Frau, ein Mann Mitte Fünfzig mit Namen Leo, inzwischen das Oberhaupt der Familie de Schodis war. Nach einer Woche ergab sich die Gelegenheit zu einem längeren Gespräch mit ihm. Leo wirkte schon auf den ersten Blick äußerst energisch. Sein Gesicht schien mit einer Axt geschnitten zu sein und ließ keinerlei Gefühlsregungen erkennen. Seine hagere Gestalt und sein ausgeprägter Gehfehler nahmen ihm nichts von seiner herrischen Ausstrahlung. Dem Grafen, der sich bei seiner Mission auf brüchigem Eis 172 fühlte, war nicht wohl in seiner Gegenwart. Während des Gesprächs war noch ein zweiter Mann anwesend, ein Feldherr, der ihm nur als Floris von Holland vorgestellt wurde. Seine rötlichen Haare ließen vermuten, dass in seinen Adern Wikingerblut floss. Er gebärdete sich allerdings keinesfalls wie ein Barbar. Gegenüber Leo de Schodis wirkte er sogar freundlich und umgänglich. Heinrich beunruhigte lediglich, dass er seine Rolle bei dieser Unterredung nicht erriet. "Ich ritt nach Holland, um mich an Eure Seite zu stellen in Eurer Trauer um den Grafen Burchard", begann er, verlor aber unter Leos stechendem Blick den Faden und brach ab. An seiner Stelle ergriff Floris das Wort. "Wir sind durch Boten des Erzbischofs von Bremen und des Bischofs von Lübeck gut unterrichtet. Schon in wenigen Monaten soll ein neuer Kreuzzug den Tod des Herrn von Wildeshausen rächen und die Ordnung an der Weser wieder herstellen. Deshalb freut es uns, Euch bei uns begrüßen zu dürfen. Angesichts Eurer angespannten Beziehungen zu dem Ermordeten erscheint uns Eure Haltung besonders löblich." Heinrich fühlte sich ertappt und versuchte wortreich, die Fehde mit dem Bruder herunterzuspielen. Ob er dabei glaubwürdig wirkte, konnte er nicht feststellen. Leo blieb ebenso undurchdringlich wie Floris verbindlich. Als er sich am Ende als weltlicher Führer des Unternehmens ins Gespräch brachte, mangelte es ihm an einem Übergang. Auf der Heimreise war er unzufrieden. Vor allem, dass die Holländer sich bereits eifrig auf den Kreuzzug vorbereiteten, gefiel ihm nicht. Vermutlich stand der Heerführer bereits fest. Vielleicht war es jener Floris. Andererseits hätte die Mission auch noch schlechter ausgehen können. In seinem Gepäck lag immerhin ein Empfehlungsschreiben des Leo de Schodis an den Erzbischof. II S eitdem Otto der Graf von Oldenburg war, hatte er nur noch selten Zeit, seine Chronik weiterzuführen. Manchmal fragte er sich auch nach dem Sinn dieser Anstrengung. Einstmals wollte er angesichts seines Unvermögens, die Gegenwart zum Besseren zu ändern der Nachwelt eine Warnung zurücklassen. Inzwischen war er ein Herrscher. Sollte er da nicht selbst bewerkstelligen, was er ursprünglich von späteren Generationen erwartet hatte? Leider war die Rechnung so einfach nicht. Schon in den ersten Monaten seiner Regentschaft hatte er die Erfahrung gesammelt, dass die Mächtigen dieser Welt offenbar über weitaus weniger Macht verfügten, als andere Menschen glaubten. Von zehn Entscheidungen stand ihm allenfalls bei einer die Wahl frei. In den anderen Fällen war er durch die Umstände festgelegt. Wer etwas bewirken wollte, musste behutsam und geduldig sein und sich mit winzig kleinen Erfolgen zufrieden geben. Als er zum Beispiel versucht hatte, den offensichtlich benachteiligten Oldenburger Handwerkern zu helfen, waren die Kaufleute mit einer Abordnung bei ihm erschienen. Sie hatten ihm zu verstehen gegeben, dass er aus verschiedenen 173 Gründen von ihnen abhängig war. Wenn die Enttäuschung über derlei Rückschläge ihn gar zu sehr niederdrückte, blieb ihm doch wieder nur seine Bibliothek als Trost. An jenem Tage fügte er der Chronik einen Abschnitt über die Ketzerverfolgung hinzu. fordert den tobenden Ketzerjäger zur Mäßigung auf. Anno Domini MCCXXXIII, fünfundzwanzigsten Juli am Während des Hoftages zu Mainz wendet sich auch Seine Königliche Hoheit Heinrich VII gegen Konrad von Marburg. Da der junge Herrscher von Geburt her ein Hitzkopf ist, gebraucht er dabei scharfe Worte. Seine Anhänger verstehen die Rede als Auftrag, dem Übel ein Ende zu bereiten. Ein paar Ritter lauern dem Ketzerjäger unmittelbar nach dem Hoftag in einem Hohlweg auf und erschlagen ihn. "Anno Domini MCCXXXII Der Herr Konrad von Marburg, von seiner Heiligkeit Papst Gregor IX zum Großinquisitor für die deutschen Lande benannt, nimmt seine Aufgabe, den falschen Lehren nachzuspüren, mit fragwürdigem Eifer wahr. Anstatt sorgfältig alle Indizien zu sammeln und die verschiedenen Gesichtspunkte verantwortungsbewusst gegeneinander abzuwägen, treibt er die Gerichtsprozesse so hastig voran, dass die Leute in Zorn geraten. Anstatt die Verirrten gütig auf den rechten Weg zurückzuführen, wie Jesus Christus, Gottes Sohn, es uns lehrte, verbrennt er sie gleich zu Dutzenden auf dem Scheiterhaufen. So geschehen zu Köln, zu Trier, zu Straßburg, zu Goslar und zu Erfurt. Anno Domini MCCXXXIII Ich vermag nicht zu sagen, ob Seine Königliche Hoheit sich seinerseits ins Unrecht setzte durch die offene Einmischung in Dinge der Kirche. Allem Anschein nach ruht Gottes Segen nicht mehr auf seiner Regentschaft. Um den Nachfolger des toten Herzogs Ludwig von Bayern zur Gefolgschaft zu zwingen, entsendet er ein Heer, das jedoch nur mäßige Erfolge erringt. Zur gleichen Zeit erheben sich unzufriedene schwäbische Vasallen wider ihn. Weil er hinter den neuen Schwierigkeiten Intrigen seines Vaters vermutet, wendet er sich auch gegen den Kaiser. Anno Domini MCCXXXIII, im Juli Der Großinquisitor gerät während seiner Jagt nach angeblichen Ketzern in solche Raserei, dass ihm der Blick für seine tatsächliche Macht und für seine Befugnisse mehr und mehr verschleiert ist. Zweifellos fühlt er sich wie der Herrgott selbst. In seiner Vermessenheit versteigt er sich zu einer Klage gegen den Grafen von Sayn. Dieser verteidigt sich und erringt bei einem Prozess durch mehrere Eideshelfer den Sieg. Konrad erkennt das Urteil nicht an und ruft eigenmächtig zum Kreuzzug auf. Das ist sogar Seiner Eminenz dem Erzbischof von Mainz zuviel und er Anno Domini MCCXXXIII Seine Heiligkeit Papst Gregor IX nimmt die Nachricht vom Tod des Großinquisitors mit Empörung auf und fordert die Bestrafung der Schuldigen. Zugleich ernennt er als Nachfolger den Herrn Konrad von Hildesheim. Der trägt nicht nur denselben Namen wie sein Vorgänger sondern ist auch von ähnlicher Wesensart. Zwar neigt er nicht wie jener zu sinnloser Raserei und 174 Größenwahn, doch glaubt er ebenfalls die Welt voll von Dienern des Satans, die es wie Ungeziefer zu vertilgen gelte." hatte ihm die Grafschaft gefestigt und reich hinterlassen. Wer aus vollen Truhen verteilen kann, dem fällt es leicht, sich Freunde zu verschaffen. Nachdem er den Marschall verabschiedet hatte, sprang ihm plötzlich ein kleines Mädchen entgegen. Es hatte wohl schon seit einiger Zeit auf diese Gelegenheit gewartet. "Spielst du mit mir?" bettelte die Kleine. "Zeigst du mir Bilder aus deinen Büchern?" Otto nahm sie auf den Arm und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. "Ich habe jetzt keine Zeit für dich, mein Schatz. Du weißt doch, dass wir heute Abend ein großes Fest feiern." "Ich finde diese Feste langweilig." "Aber es wird ganz viele Süßigkeiten geben." "Mit dir spielen ist schöner." Mechthild kam hinzu und nahm sie ihm ab. "Ich habe dir doch gesagt, dass du deinen Vater in Ruhe lassen sollst! Geh zu deiner Erzieherin!" Das gefiel Otto nun auch wieder nicht. "Eines Tages hört sie auf dich und sieht mich nicht mehr an", meinte er traurig Salome war fünf Jahre alt und er liebte sie leidenschaftlich. Andere mochten enttäuscht sein, wenn sie nur eine Tochter hatten, er nicht. Ihn störte nicht einmal, dass sie vom Aussehen her sehr nach ihm geriet, also klein und rundlich war, so dass sie niemals eine Schönheit werden konnte wie seine berühmte Schwester Kuni. "Ich müsste zufrieden sein. Die Grafschaft gedeiht. Die Leute mögen mich. Selbst diejenigen, die mir das Regieren nicht zugetraut hatten, sind inzwischen stille geworden. Aber tief in meinem Herzen weiß ich, dass ich am falschen Platz stehe." Otto wollte sich nun den Stedingern zuwenden und der Frage, ob der Erzbischof von Bremen sie zu Recht der Ketzerei bezichtigte, doch ein Diener rief ihn zu seinen Regierungsgeschäften. Am Abend sollte auf der Oldenburg ein Fest stattfinden. Die ersten Gäste waren eingetroffen und verstopften mit ihren Fahrzeugen den Hof. In den beiden Sälen wurde emsig gearbeitet. Die Tafeln und die Bänke waren aufzustellen, das schmückende Beiwerk zu befestigen. Aus der Küche drang Gewürzduft. Vor dem Portal des Palas wartete der Marschall. Die Ställe im Schloss reichten nicht aus, die Pferde der Gäste unterzubringen. Der Rat der Stadt Oldenburg versprach Abhilfe, stellte dafür aber unverschämte Forderungen. Otto überlegte kurz und sagte: "Diesmal sitze ich am längeren Hebel. Sie brauchen dringend das Privileg über den Salzhandel. Sag ihnen, dass ich sie bis zum Jüngsten Gericht schmoren lasse, falls sie nicht einen angemessenen Vorschlag unterbreiten!" Otto beherrschte seine große Grafschaft besser, als er selbst glaubte. Die Ritter achteten ihn, weil er das Schloss so geschickt gegen die Stedinger verteidigt hatte. Die Kaufleute schätzten ihn (trotz gelegentlicher Reibereien) wegen seiner Zuverlässigkeit und seiner vernünftigen Art, mit Schwierigkeiten umzugehen. Die einfache Bevölkerung schließlich mochte ihn wegen seines freundlichen, verbindlichen Auftretens. Freilich war er in einer weitaus besseren Lage als beispielsweise Heinrich der Bogener in Wildeshausen. Sein Bruder Christian 175 "Vielleicht nimmst du alles zu schwer. Du gehst härter mit dir ins Gericht als es der Herrgott dereinst tun wird." "Nein, nein! Ich bin ja gar nicht unzufrieden. Es macht mir aber eben keinen Spaß. Ich bewahre die Herrschaft nur für Johann. Wenn er alt genug ist, weise ich ihn in die Regierungsgeschäfte ein und ziehe mich allmählich nach Delmenhorst zurück." "Wenn du meinst, dass ..." Aufgeräumt umarmte er sie und drückte sie an sich, ungeachtet der Tatsache, dass Fremde ihnen zusahen. "Bedenke, dass herrschen nicht nur Feste ausrichten bedeutet! Vielleicht kommt ein Krieg, aus dem wir uns nicht heraushalten können. Vielleicht muss ich dann hunderte meiner Männer in den Tod schicken. Davon würde ich krank werden. Glaub mir das und treibe mich nicht zu falschem Ehrgeiz!" "Ja, du hast Recht! Wir dürfen niemals vergessen, dass wir nur Staub sind ohne Gottes Gnade." Der Kreuzzug gegen die Stedinger schien Oldenburg nicht zu betreffen, weder der gescheiterte noch der geplante. Jedenfalls berührte er nicht die Oldenburger Lebensart, jenen von der Mutter der letzten beiden regierenden Grafen begründeten und gepflegten vornehmen Stil, der das Herrscherhaus in ganz Niedersachen ins Gespräch gebracht hatte. Zweimal im Jahr stellten sich Adlige von nah und fern mit ihrem Anhang ein. Die Feste waren kostspielig, vor allem dann, wenn ein Turnier voraus ging. Ein Teil der Ausgaben zahlte sich allerdings aus durch die Verhandlungen, die am Rande in ungezwungener Atmosphäre geführt wurden. Diesmal hatten die Wildeshausener und die Bruchhausener abgesagt. Bei ersteren war es verständlich, bei letzteren ein Affront. Darüber aber ärgerte sich nicht einmal die alte Gräfin. Heinrich III und seine beiden Söhne waren ungehobelte Klötze. Sie zu entbehren, hatte mehr gute als schlechte Seiten. Agnes von Isenbergen trug noch Trauer, bildete aber dennoch den glanzvollen Mittelpunkt des Festes. In einem schwarzen Samtkleid, das durch Goldschmuck und Diamanten auf dezente Weise aufgeheitert war, sah sie sehr hübsch aus. Das prächtige blonde Haar verschwand nur unvollständig unter der Haube. Der Zufall wollte, dass ungewöhnlich viele Gäste ihre Kinder mitgebracht hatten. Otto sprach darüber mit seiner Mutter, die wie immer im Hintergrund die Fäden zog und ohne deren Einverständnis nichts geschah. Er überredete sie, den Kleinen im vorderen der beiden Säle ein eigenes Fest zu bieten. So kam es, dass sie sich dort unter der Aufsicht von eigens dafür abgestellten Dienstleuten nach Herzenslust bei verschiedenerlei Spielen amüsieren und austoben konnten. Die Erwachsenen fanden die Idee zunächst ein wenig sonderbar, waren dann aber begeistert davon. Der achtjährige Johann bekam dabei einen Vorgeschmack auf die Pflichten und Rechte eines Grafen. Auf dem Kinderfest fungierte er als Hausherr. Als er eine standesgemäße Partnerin brauchte, fiel die Wahl auf die kleine Salome. Die war ganz außer sich vor Freude und Stolz über die Ehre. Auch Wilhelm von Westerholt stand ohne eigenes Dazutun im Mittelpunkt. Sein Ruf wurde ihm immer peinlicher, doch leider konnte er nicht widersprechen, ohne einen Skandal auszulösen. Otto hatte ihn vor dem Fest beiseite genommen und inständig gebeten, noch eine Weile gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Die Leute liebten nun einmal die Legenden und verlangten gebieterisch nach Helden. 176 Einmal mehr musste er die Geschichte vom Überraschungsangriff auf das Zelt der Stedingerführer erzählen. Weil er das als den Wunsch seines Lehnsherrn verstand, rang er sich sogar einige Ausschmückungen ab. Natürlich kam das Gespräch auch auf den missglückten Kreuzzug und dabei unweigerlich bis zu einem ziemlich heiklen Punkt. "Drei Kerle wie Ihr hätten das Bauernpack am Hemmelskamper Wald mit Leichtigkeit zu Paaren getrieben! Warum wart Ihr eigentlich bei der Schlacht nicht dabei?" Wilhelm traf diese Frage aber nicht mehr unvorbereitet. Er entgegnete ohne Wimpernzucken: "Ich hatte an jenem unglückseligen Tag andere Verpflichtungen." Da erstarrten die Zuhörer vor Ehrfurcht und rätselten nachhaltig über die geheimnisvolle Mission des Ritters. Wenn es überhaupt etwas Gutes gab, was Wilhelm diesen Festen abzugewinnen vermochte, so war es die Möglichkeit, etwas über seinen verschollenen Sohn Arnold zu erfahren, den er bei den Stedingern vermutete. Leider musste er sich dabei mit geradezu hinterhältigen Fragen behutsam vortasten - und blieb erneut erfolglos. Hätten er doch mit den Wildeshausenern reden können! III I m August des Jahres 1233 hatten die Ritter der Grafschaft Wildeshausen Heinrich den Bogener nach Sitte und Brauch als neuen Herrscher anerkannt und ihm den Lehnseid geschworen. Chronisten späterer Jahre führten ihn als Heinrich IV auf, damit unterstellend, dass Wildeshausen und Bruchhausen eine Einheit bildeten, was aber für jene Zeit, von der hier die Rede ist, keineswegs zutraf. Graf Heinrich III von Bruchhausen hätte es als Kriegserklärung auffassen müssen, wäre der Sohn seines gefallenen Feindes ohne sein Wissen als sein Nachfolger aufgetreten, zumal er selbst einen gleichnamigen Sohn besaß. Heinrich der Bogener vermied deshalb die Nummerierung. Das Verhältnis zu den Nachbarn war ohnehin nicht seine größte Sorge, angesichts der Verhältnisse in der Grafschaft selbst. Er verstand noch immer nicht, was um ihn herum vor sich ging, spürte, dass man ihn belog, konnte es aber nicht beweisen. Der Burgvogt zum Beispiel war so einer, dem er nicht über den Weg traute. An einem trüben, windigen Herbsttag saß er ihm wieder einmal gegenüber. "Du behauptest also, unsere Getreidespeicher seien nur zur Hälfte voll, weil der Sommer zu heiß war?" "Niemand weiß, wofür der Herr im Himmel uns strafen wollte." "Immer, wenn du auf unsicheren Grund gerätst, fängst du vom Herrgott zu reden an! Der Sommer war nicht durchgängig heiß. Es gab Regentage, an denen sich die Felder erholen konnten. Woran liegt es, dass bei den Oldenburgern die Scheunen kaum ausreichen?" "Kein Feld ist wie das andere. Die Äcker unserer Bauern liegen nicht gut. Wenn es zu heftig regnet, fließt das Wasser ab, ehe es den Durst des Getreides stillt." "Kein Feld ist wie das andere! Du sagst es selbst! Deine Behauptung trifft nur für wenige Äcker zu. Hältst du mich 177 für blind? Ich bin oft genug zu den Dörfern gegangen. Ich habe die Ähren gesehen." Bebend vor Zorn sprang er auf, beruhigte sich aber rasch, als sein Blick auf die devote Miene des Burgvogts fiel. Mit jähzornigen Auftritten konnte er in Wildeshausen niemanden mehr beeindrucken. Die waren hier alle abgehärtet durch den tobsüchtigen Burchard. Mit einer Handbewegung, in der sich schon ein Anflug von Resignation ausdrückte, setzte er sich wieder auf seinen Stuhl. Blitzschnell zog im Geist an ihm vorüber, was er in den vergangenen Monaten schon alles herausgefunden hatte. Die Ritter waren jahrelang kaum kontrolliert worden und hatten den fortschreitenden Wahnsinn Burchards ausgenutzt, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Der frühere Graf war einerseits krankhaft misstrauisch gewesen, andererseits blind gegenüber wesentlichen Dingen. Die Höflinge hatten sich in Geheimbünden organisiert. Es gab heimliche Verbindungen nach Bremen zu Erzbischof Gerhard II. Wohin Heinrich der Bogener sich auch wandte, was er auch anpackte, überall stieß er auf zähen Widerstand. "Ich danke dir für deine Auskunft", sagte er erschöpft. "Du kannst gehen." Der Burgvogt verneigte sich tief, wobei sein Gesicht so undurchdringlich blieb, dass Heinrich nicht wusste, ob er ihn wirklich ehren oder vielleicht nur verspotten wollte. Wenig später begehrte ein Bote vorgelassen zu werden, der gerade aus Bruchhausen zurückgekehrt war. "Ich hoffe, du hast erfreuliche Neuigkeiten." "Ich weiß nicht, ob Ihr sie als erfreulich anseht, Herr Graf", antwortete der Mann unsicher. "Erzähl! Hat Heinrich III dich empfangen?" "Ja, ich konnte persönlich mit ihm reden. Er las sich Euer Schreiben durch und dachte lange darüber nach. Er beriet sich auch mit seiner Gattin und seinen beiden Söhnen. Ich denke, dass er Eure Vorschläge ernst nimmt und dass er sie wohlwollend prüft." Der Bote gehörte zu den wenigen Leuten im Schloss, auf welche Heinrich sich uneingeschränkt verließ. Er kannte ihn von Kindheit an und hatte als Heranwachsender manchen Streich mit ihm ausgeheckt. "Du kannst mit mir offen reden. Ich bin nicht Burchard, der die Wahrheit nicht vertrug. Sag mir bitte auch deine persönliche Meinung!" "Ich habe nichts beschönigt. Ihr braucht von den Bruchhausenern keine Feindseligkeiten zu befürchten. Das ist mehr als nichts." "... aber weniger, als wir uns ausgerechnet hatten! Er hält uns hin, weil er eigene Pläne verfolgt. Vielleicht schließt er mit uns eines Tages den Bündnisvertrag doch noch ab, vielleicht fällt er uns in den Rücken. Er ist ein Halunke." Nach diesem weiteren Rückschlag hielt es Heinrich in den Räumen des Palas nicht mehr aus. Er brauchte Luft, wollte den freien Himmel über sich sehen. Der kühle, feuchte Wind war ihm dabei angenehm. Er atmete tief durch und beruhigte sich langsam. Dann aber beging er den Fehler, sich noch einmal umzudrehen, wobei sein Blick auf drei geschlossene Fensterläden am linken Flügel des Gebäudes fiel. Dahinter befand sich die Grafenwohnung, die seit Burchards Tod nur noch von Kunigunde de Schodis genutzt wurde. Die Witwe hatte sich dorthin zurückgezogen und buchstäblich selbst eingemauert. Da niemand wusste, was sie den ganzen 178 Tag über trieb, baute sich um sie allmählich eine Legende auf. Sie habe ein Gelübde abgelegt, hieß es. Dafür wurde sie von den Dienstleuten wie eine Heilige verehrt. Es galt als Ehre, ihr das Essen vor die Tür stellen zu dürfen. Nun legte man Gelübde aber in der Regel aus einem bestimmten Anlass ab, zum Beispiel als Sühne für eine schwere Sünde. Da niemand Kunigunde selbst ein solches Vergehen zutraute, büßte sie zweifellos für einen anderen. Von den geschlossenen Fensterläden ging etwas Düsteres aus. Auf dem Schloss laste ein Fluch, munkelten die abergläubischen Frauen. So hatten sie zwar auch zu Lebzeiten Burchards schon geredet, nun aber übertrafen sie sich noch einmal selbst mit ihren Erfindungen. Heinrich lief ein Schauder über den Rücken und er musste sich abwenden. Agnes fiel ihm ein, seine Schwägerin und Freundin. Sonderbarer Weise überkamen ihn in ihrer Gegenwart nur selten Gedanken an Tod und Untergang. Ihm war, als ginge ein Zauber von ihr aus, der alle bösen Geister vertrieb. Ob jener Zauber auch diesmal wieder wirkte? Unsicher begab er sich auf die Suche nach ihr und traf sie in der Unterburg. Sie stand inmitten einer Gruppe von Handwerkern und erteilte Anweisungen. Die magere junge Frau mit den tiefschwarzen Haaren sah merkwürdig aus inmitten der stämmigen, blonden Männer. Doch sie verstand es, sich zu behaupten. Ihr half selbstverständlich, dass jeder von ihren besonderen Beziehungen zum Grafen wusste. Sie konnte ihm im Bett manches einflüstern. Sogar die selbstherrlichen Höflinge bemühten sich um das Wohlwollen der Ritterstochter. Doch Agnes besaß zudem auch ein gutes Gespür für ihre Möglichkeiten und Grenzen. Auf die Intrigen in der Oberburg ließ sie sich nicht ein. In der Unterburg hingegen konnte sie als Herrin auftreten. Heinrich bewunderte sie und hätte ihr stundenlang zusehen können. In seinen Augen beruhte ihr Erfolg übrigens auf einem dritten Vorzug. Sie litt nicht unter den Verhältnissen in der Grafschaft, weil sie sich mehr als ihre gegenwärtige Stellung nicht einmal erträumt hatte. Sie strahlte Selbstvertrauen und Zuversicht aus, was die Leute in der Unterburg ihr durch ein erstaunliches Maß an Zuneigung dankten. Der junge Graf vergaß den verlogenen Burgvogt, die gescheiterte Bruchhausen-Mission und die geschlossenen Fensterläden der Grafenwohnung. Er sah nur noch sie und als sie ihn ihrerseits bemerkte, strahlte er sie an. "Es ist eine Freude, zu sehen, wie du hier für Ordnung sorgst. Ohne dich würde mir das alles über den Kopf wachsen." Sie widersprach zwar, war aber im Stillen glücklich über sein Eingeständnis. Ihre Liebe zu ihm hatte sich keineswegs abgekühlt, seit sie ihn besser kannte und um seine Schwächen wusste. Dass er ihre Zuneigung so unbefangen erwiderte, trotz des Geredes, dem er sich dabei aussetzte, lag auch daran, dass er sie brauchte. Sie mochte es, wenn er ihr von neuen Schwierigkeiten berichtete. Er wiederum nahm sie gern als Beichtschwester und konnte inzwischen kaum noch etwas vor ihr verbergen. Selbst wenn er äußerlich so gut gelaunt war wie in diesem Augenblick, ahnte sie die Sorgen, die ihn gerade noch geplagt hatten. Als er sie bat, ihm in seine Wohnung im Bergfried zu folgen, zögerte sie nicht. Kaum war die Tür hinter ihnen zugefallen, umarmten sie einander leidenschaftlich und küssten sich auf den Mund. Die Unbeschwertheit währte 179 jedoch nur kurze Zeit, denn plötzlich kam Heinrich ein mittlerweile eine knappe Woche zurückliegender Zwischenfall wieder in den Sinn. Durch Gewohnheit unvorsichtig geworden, hatten sie mitten in einer ziemlich eindeutigen Pose den unvermittelt im Zimmer stehenden Wilbrand nicht bemerkt. "Ich kann dich nicht mehr umarmen, ohne mir einzubilden, dass er uns zusieht." "Heute stört er uns ganz bestimmt nicht." "Und das soll mich beruhigen? Sein Verschwinden ist die größte Gemeinheit, die er uns antun konnte. Weißt du etwas Neues über ihn?" Agnes schüttelte den Kopf. Wilbrand neigte schon seit mehreren Wochen dazu, sich heimlich davonzustehlen. Manchmal brach er am späten Abend noch auf. Das führte jedes Mal zu großer Aufregung, weil niemand wusste, inwieweit er noch seine Sinne beieinander hatte. Zum Glück blieb er meistens friedlich. Mehrmals brachten Bauern ihn zum Schloss zurück, weil er sich hoffnungslos verirrt hatte. Wurde er hinterher zur Rede gestellt, verweigerte er jede Begründung. Es schien, als lebe er in einer eigenen Welt, zu der er niemandem Zugang gewährte. Kaum jemand dachte darüber nach, weshalb seine einseitige Zuneigung zu Agnes (in der er viel zu lange die freundliche Schwester Franziska wieder zu erkennen geglaubt hatte) allmählich verblasste. Dass er seiner angetrauten Frau aus dem Wege ging, beseitigte verschiedene Schwierigkeiten auf bequeme Weise. Die meisten waren einfach nur froh darüber und benahmen sich umso ungezwungener. Nun aber war er spurlos verschwunden, und zwar genau seit jenem Zwischenfall. "Er wird eines Tages wieder auftauchen." "Glaubst du das wirklich?" Agnes hob die Schultern. "Was weiß ich! Wir haben ihn doch nicht davongejagt. Sein Schicksal liegt nun in Gottes Hand." Sie umarmte ihn wieder und drängte sich diesmal so dicht an ihn, dass er ihre Brüste spüren musste. Da wurde für ihn auch dieses letzte Ärgernis unwichtig. Hastig löste er die Schnüre ihres Kleides, drängte sie zum Bett und versuchte in einem langen, leidenschaftlichen Liebesakt neues Vertrauen in seine Kraft zu gewinnen. IV K aum hatte der Chor der Mönche seinen Gesang beendet, wandte sich Erzbischof Gerhard II schon vom Altar ab und bemühte sich, zum Ausgang zu gelangen. Er musste sich Gedanken eingestehen, die sich während eines Gottesdienstes nicht ziemen, schon gar nicht für einen Kirchenfürsten. Freilich war er ganz offensichtlich nicht der einzige an diesem Morgen im Dom zu Frankfurt, dem diese Sünde unterlief. Jeder spürte die gereizte Stimmung, die dem Hoftag vorausging. Eigentlich standen keine schwerwiegenden Entscheidungen an. Dem Kaiser bereitete sein Südreich so viele Sorgen, dass er die deutschen Lande vernachlässigen musste. Die Fürsten verschoben ihren nächsten Angriff gegen den König auf einen späteren, für sie günstigeren Zeitpunkt. Unruhe war erst aufgekommen in Folge eines Gerüchts, dem nach Heinrich VII seinerseits einen Vorstoß beabsichtigte, um seine gefährdete Position wieder zu festigen. Der Bremer Erzbischof 180 fürchtete nun Komplikationen für seinen zweiten Stedinger-Kreuzzug. "Es gibt Hinweise, dass die Ketzerfrage eine Rolle spielen wird", flüsterte er seinem ihn begleitenden Dompriester zu. Dabei beobachtete er voller Misstrauen, dass mehrere als königstreu bekannte Grafen absichtlich zurückblieben, zweifellos um ungestört reden zu können. "Das muss nicht heißen, dass auch unsere Angelegenheit zur Sprache kommt", entgegnete der Angesprochene. "Leider lässt es sich nicht ausschließen. Dieser junge Hitzkopf braucht ein überzeugendes Beispiel und unsere Niederlage erlaubt die Schlussfolgerung, Gott hätte auf der Seite dieser widerspenstigen Bauern gestanden." Die Versammlung begann verhältnismäßig ruhig. Der König gab vor, den Hoftag als ein großes Fest der Eintracht zu begehen. Mit umständlicher Korrektheit vollzog er die notwendigen Zeremonien. Als sich dann ein schwäbischer Adliger erhob und eine Beschwerde vorzutragen begehrte, stellte er sich verwundert. Der Edelmann behauptete, in seinem Land sei der Friede gestört, seit ein Dominikanerkonvent sich dort niedergelassen habe, und nannte auch Beispiele. Von schlimmer Willkür war die Rede, von Übergriffen auf junge Mädchen. "Sie gebärden sich wie Eroberer und achten weder das Recht noch die alten Bräuche. Will jemand sie zur Verantwortung ziehen, so drohen sie, ihn der Ketzerei zu bezichtigen." Sofort erhob sich wütender Protest seitens der anwesenden Kirchenvertreter. Die geistlichen Fürsten und die verschiedenen Mönchsorden waren sich dabei in seltenem Maße einig. Gleichzeitig aber (und mindestens ebenso laut) meldeten sich auch Männer zu Wort, welche die Aussagen des schwäbischen Adligen bestätigten. Der König hob beschwichtigend die Arme. "Wie soll ich mir eine Meinung bilden, wenn ein Stimmengewirr herrscht wie beim unseligen Turmbau zu Babel?" Kraft seiner Vollmachten als Gastgeber verfügte er, dass zuerst die Kläger zu Worte kämen. Die Berichte ähnelten einander in auffälliger Weise, steigerten sich aber fortlaufend. Selbst Bischöfe wurden nicht geschont. Einer von ihnen hatte sich angeblich mit dem beschlagnahmten Vermögen der mit seinem Segen Verurteilten schamlos bereichert. Am Ende stand der neue Großinquisitor Konrad von Hildesheim selbst im Mittelpunkt der Vorwürfe. Es war schwer nachzuprüfen, inwieweit die Behauptungen der Wahrheit entsprachen. Niemand aber konnte übersehen, dass jemand den Ablauf genau geplant hatte. Die einzelnen Beteiligten wussten wie bei einem Schauspiel ihre Einsätze und manches erinnerte an jenen Hoftag, in dessen Anschluss Konrad von Marburg erschlagen worden war. Etliche Geistliche verließen deshalb den Raum. Gerhard konnte das zu seinem eigenen Bedauern nicht tun, weil er über das letzte Ziel dieser Vorführung Bescheid wissen musste. Der König ließ unterdessen immer mehr die Maske fallen. Als die Teilnehmer vom Dominikanerorden ihre Verteidigungsreden hielten, unterbrach er sie ständig und drängte sie zur Eile. Es sei nicht genug Zeit mehr vorhanden für schwülstige Predigten. Dann ordnete er eine Pause an. Er habe genug zum Sachverhalt gehört und werde nun nachdenken, um zu einem Urteil zu gelangen. 181 Auf dem Hof standen die zwei Lager einander wie feindliche Heere gegenüber. Kein Wort wurde von der einen zur anderen Seite gewechselt. "Ich frage mich, wie weit er dieses Possenspiel noch treiben will", sagte Gerhard zum Dompriester. "Nach meinem Eindruck will er vor allem die Zuschauer niederen Standes beeindrucken. Er will Volkszorn sähen, den er später für seine Politik ausnutzen kann." "Ich verstehe ihn dennoch nicht. Was nutzt es ihm, wenn das gemeine Volk die Dominikaner misshandelt? Selbst der Tod des Marburgers war nicht von Vorteil für ihn." "All diese Fragen sind berechtigt. Vielleicht schlägt er nur um sich wie ein weidwundes Tier." Im Stillen schmiedete der Erzbischof auch Pläne für den Fall, dass sich der König ausdrücklich gegen einen neuen Stedinger-Kreuzzug ausspräche. Er konnte sich sowohl beim Papst als auch beim Kaiser beschweren. Bei Gregor IX wäre ihm der Erfolg so gut wie sicher. Bei Friedrich II käme es darauf an, was den Ausschlag gibt - die Abneigung gegen das Vorgehen der Inquisitoren oder der Gegensatz zum abtrünnigen Sohn. Zudem konnte es der Erzbischof auch auf eine Auseinandersetzung mit Heinrich anlegen, dessen Stern sank. Er betete aber, all das möge ihm erspart bleiben. Nach der Pause geschah zunächst genau das, was jeder hatte erwarten müssen - der König verurteilte mit scharfen Worten die Ketzerverfolgung in den deutschen Landen. "Ich weiß, dass es Lehren gibt, welche die Worte unseres Heilands Jesus Christus in falscher, ja gefährlicher Art auslegen, und dass es die Pflicht der Regierenden ist, Urheber und Verfechter solcher Verirrungen entschlossen zu bekämpfen. Jener Konrad von Hildesheim aber und jene Mönche vom Orden des Heiligen Dominicus sind weit davon entfernt, in der genannten Weise der Kirche zu nutzen. Vielmehr betreiben sie die Politik fremder Mächte." Diese fremden Mächte nannte er auch beim Namen. Der Papst und der Kaiser hätten einen Bund geschlossen, um nördlich der Alpen das Unterste zuoberst zu kehren. Alle Gesetze seien in Gefahr. "Seid auf der Hut!" rief er beschwörend. Seine Rede wurde leidenschaftlich und kämpferisch. Aus den hinteren Reihen antworteten ihm begeisterte Zurufe. Gerhard indes verzog geringschätzig den Mund und flüsterte: "Ich denke, er steht mit dem Rücken an der Wand. Wenn er anfängt, um das gemeine Volk zu buhlen, muss es wirklich böse für ihn aussehen." Der Dompriester nickte. "Das ist keine starke Rede, trotz der groben Worte." An diesem Eindruck der meisten adligen Teilnehmer änderte sich auch nichts, als der König ein neues Landfriedensgesetz ankündigte. Dabei konnte er mit breiter Zustimmung rechnen, denn es versprach allen Vorteile, die vom Handel lebten, nicht nur den Kaufleuten selbst. Fraglich blieb aber, wie die Bestimmungen gegen die Störenfriede durchgesetzt werden sollten. Daran waren schon etliche Erlasse dieser Art gescheitert. Kurz vor Sonnenuntergang endete die Versammlung. Die Stimmung hatte sich nicht gebessert. Noch immer standen sich die zwei Lager gegenüber und in der Luft lag die Gefahr, dass abermals einem Hoftag unmittelbar eine Bluttat folgte. Wie beabsichtigt, hatte die Rede des Königs bei den nicht stimmberechtigten Teilnehmern der niederen Stände einen tiefen Eindruck 182 hinterlassen. Blitzschnell eilte die Kunde durch die Straßen der Stadt. An jeder Ecke standen die Bürger in Gruppen wild gestikulierend beieinander. Schon in den nächsten Tagen würde die Flut die Dörfer und die Nachbarstädte erreichen. Niemand wusste, was sich aus dem Volkszorn noch entwickeln konnte. Gerhard II aber, der an diesem Tage kaum an etwas anderes dachte als an seinen Kreuzzug, konnte mit dem Ergebnis gut leben. Der König hatte die Stedinger mit keinem Wort erwähnt. Außerdem war er viel zu sehr in schwäbische und bayrische Konflikte verstrickt, um sich an der Nordseeküste in irgendwelche Angelegenheiten einmischen zu können. Vielleicht waren seine Tage ohnehin gezählt. Immerhin hatte er sich unter den Mächtigen weitere Feinde geschaffen. 183 16.Kapitel I N ach der Schlacht am Hemmelskamper Wald trennte sich Franziska mit ihren Leuten vom Hauptheer, denn Dietmar tom Diek wollte, dass die WaldhütteBurg wieder eine Besatzung erhielt. In den ersten Tagen hätten Angreifer allerdings leichtes Spiel gehabt. Nicht allein die körperliche Erschöpfung lähmte die jungen Leute, sondern auch (das sogar vor allem) der Eindruck des schrecklichen Geschehens. Sie waren gänzlich unvorbereitet in den Todesstrudel gerissen worden, die Bürgerlichen ebenso wie die Bauernsöhne. Selbst Franziska, die sich schon seit mehreren Jahren allein durchschlagen musste, ging es nicht anders. Sie hatte Hässliches erlebt und auch getan. Niemals aber war ihr etwas widerfahren, was sich mit dem Geschehen am Hemmelskamper Wald vergleichen ließ. Nachdem sie einen Tag lang reglos vor der Haupthütte gesessen hatte, ungekämmt und ohne etwas zu essen, begann Norbert sich um sie zu sorgen. Trotz seiner eigenen Erschütterung redete er ihr zu. "Uns trifft keine Schuld. Die Kreuzfahrer sind ins Land der Stedinger eingedrungen." Christian stand nur fünf Schritte entfernt. Seine innere Spannung war so groß, dass er die Beherrschung verlor. "Du machst es dir leicht!" schrie er. "Alle Schuld abwälzen! Ich habe dich und die anderen beobachtet. Ihr seid nicht nur Befehlsausführer gewesen. Die Ritter wollten fliehen. Ihr hättet sie nur laufen lassen brauchen. Es war nicht nötig, sie zu erschlagen." Dann fiel er in ähnlicher Weise auch über Franziska her. Plötzlich aber riss ihn jemand am Arm herum und gab ihm eine kräftige Ohrfeige. Verblüfft erkannte er Ramira, der er niemals so viel Kraft zugetraut hätte. "Halt endlich den Mund!" fuhr sie ihn an. "Fühle dich nur nicht als Heiliger, weil du dich beiseite geschlichen hast!" Ein paar Flüche brummend, trollte er sich. Nun jedoch zerriss das Geschrei eines Kindes die Stille. Beatrice war inzwischen fast zwei Jahre alt und hatte sich zu einem niedlichen kleinen Mädchen entwickelt. Sie besaß die schwarzen Haare der Mutter, allerdings nicht deren Widerstandkraft. Mit ihrem schmalen, blassen Gesichtchen geriet sie eher nach ihrer Tante Agnes, der Freundin des Grafen von Wildeshausen. Im Unterschied zu dieser war sie jedoch sehr empfindsam. Die behutsame Fürsorge der anderen Tante Pentia hatte diese Eigenschaft eher verstärkt als abgemildert. Schon der Tod eines Vogels konnte ihr Alpträume bereiten. Zudem übertrugen sich die Stimmungen der Erwachsenen in geradezu verwirrendem Maße auf sie. Bei Christians Entgleisung war sie sofort in helle Aufregung geraten. Pentia beugte sich zu ihr herab und redete lange beruhigend auf sie ein. Dann ging sie mit ihr ins Haus, wobei sie den anderen einen vorwurfsvollen Blick zuwarf. Nach einer Woche hatte sich Franziska so weit erholt, dass sie wieder ihre Rolle als Anführerin wahrnahm. Das war allen eine große Erleichterung, denn hundert Fragen des Alltags erforderten Entscheidungen. Es gab sieben Verwundete. Drei von ihnen brauchten ständig Pflege. Weil Pentia und Ramira die Pflichten über den Kopf wuchsen, mussten einige Männer sich zu Frauenarbeiten herablassen, so gern sie sich auch davor drückten. Doch Franziska litt nahezu ständig unter Kopfschmerzen. Ein Gebräu aus verschiedenen Kräutern, welches Ramira ihr manchmal gab, half nur zeitweilig und rief manchmal Magenbrennen und Übelkeit hervor. Nach einer weiteren Woche wurde Franziska zum Empfang neuer Anweisungen zu den Anführern der Universitas beordert. Als sie aufbrach (ohne Begleiter übrigens), litt sie noch mehr als gewöhnlich. In der Nacht zuvor hatte sie von grünen, schuppigen Ungeheuern geträumt, welche einige ihrer Kameraden fraßen - genau diejenigen, die am Hemmelskamper Wald gefallen waren. Während die Bestien sie zerkauten, schrieen sie: 'Du hast uns hierher geführt. Wir verfluchen dich.' Im Bemühen, sich abzulenken, lief sie zügig und hielt erst inne, als sie keine drei Schritte weit mehr sehen konnte. Zum Schlafen legte sie sich an Ort und Stelle zwischen den Bäumen nieder. Am nächsten Tag fühlte sie sich etwas besser, so dass sie im Stedingerland hellwach war. Ihr fiel auf, dass auf den Feldern viel weniger Leute arbeiteten, als zu dieser Jahreszeit notwendig gewesen wäre. Dafür sah sie auf den Wegen etliche Bauern in Waffen, die keiner sinnvollen Beschäftigung nachgingen. Der Krieg hatte das Marschland und seine Menschen verändert. Die durch den Erzbischof betriebene neuerliche Aufrüstung verhinderte, dass wieder normales Leben einzog. In Neudeich wollte Franziska sich für einen Tag ausruhen. Der Bauer Jörg und seine Frau Luise erinnerten sich noch gut an sie und begrüßten sie mit ehrlicher Freude. Später trafen auch Liemar und Gudrun ein. Die junge Frau trug ein auffälliges Kleid mit allerhand Zierrat. Man hätte sie darin durchaus für ein unverheiratetes Mädchen halten können und manch einer fragte sich, ob sie ihrem Mann treu war. Die kleine Jule half am Herd. Nach Luises Anweisungen holte sie Geräte und Zutaten heran. Sie tat das gewissenhaft, doch ohne ein Wort zu sprechen und überhaupt in der Art einer beweglich gewordenen Puppe. Am Abend setzten sich Jörg und Liemar mit Franziska zusammen. "Ich hatte gehofft, nach dem Sieg würde sich alles zum Besseren wenden", sagte die Anführerin aus der Waldhütte. "Die Männer kehren auf den Acker zurück, die Frauen besorgen ohne Angst den Haushalt. Unterwegs aber..." "Nichts hat sich gebessert", fiel Jörg ihr verbittert ins Wort. "Der Krieg hat jetzt erst richtig begonnen." "Wie soll das enden? Wann ist alles wirklich vorbei?" Franziska dachte unwillkürlich an Ramira und deren Warnungen. Inzwischen hatte sogar Liemar viel von seiner Zuversicht verloren. "Das ist wie mit den Drachen aus den Märchen. Schlägt man ihnen einen Kopf ab, wächst ein anderer nach." Bauer Jörg fügte hinzu: "Nur noch der Schutz der Grenzen ist wichtig. Was das Heer braucht, wird sofort herangeschafft, auf das Ausbessern der Deiche aber darf man die Universitas nicht mehr ansprechen." "Und das meint er wörtlich!" rief Liemar, zunehmend aufgebracht. "Wenn du sie tadelst, nennen sie dich Verräter." "Ihr habt die Universitas doch einst gelobt für ihre Umsicht und ihre Gerechtigkeit." "Seitdem dieser Wige übergelaufen ist, trauen sie jedem alles zu. Sie sind schrecklich misstrauisch geworden." "Was ist eigentlich aus Wige geworden?" 185 "Dietmar tom Diek hat ihn in Bremen aufspüren und entführen lassen." "Und dann?" "Er wurde gefoltert und anschließend lebend in ein Sumpfloch geworfen - zur Abschreckung." Eine längere Pause entstand, ehe Bauer Jörg zusammenfasste: "Das Misstrauen vergiftet das Leben bei uns. Du kannst deinem Nachbarn nicht mehr trauen. Vielleicht ist er ein Spitzel der Universitas und zeigt dich beim nächsten Streit an. Umgekehrt reden manche Bauern nicht mehr miteinander, weil sie sich gegenseitig für Spitzel halten, ohne es zu sein." Franziska war nun noch mehr beunruhigt hinsichtlich ihrer Vorladung. Wollte man etwas von ihr verlangen, was sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren konnte? Wie sollte sie sich verhalten? Grundsätzlich "Ja!" sagen und hinterher nach Auswegen suchen? Unüberwindliche Schwierigkeiten erfinden? Das Haus der Anführer glich inzwischen einer kleinen Flachlandburg. Die Verteidigungsanlagen waren fertig gestellt. Dem Hauptgebäude fehlte für einen Palas allenfalls der Turm. Auch die Umgangsformen hatten sich verfeinert. Tammo von Huntorf, der ehemalige Schmied, wirkte ungezwungen und gut gelaunt. Er begrüßte die junge Ritterstochter wie eine langjährige Bekannte. "Ich fand noch gar keine Gelegenheit, dir für deinen Beitrag zu unserem großen Sieg zu danken. Dein Mut ist schon sprichwörtlich geworden. Es heißt, dass durch dich das göttliche Wunder eine jedermann sichtbare Gestalt annahm." Franziska hatte sich vorgenommen, Auseinandersetzungen zu meiden. Durch den sonderbaren Tonfall indes ließ sie sich zu einer gewagten Entgegnung herausfordern. "Ich bin keine Heilige Jungfrau. Ich habe unverheiratet ein Kind. Den Dank verdienen die, welche auf dem Schlachtfeld verblutet sind." Der Bauernführer musterte sie forschend. Doch letztlich gefiel ihm ihre Ehrlichkeit und so drohte er ihr, eher wohlwollend als tadelnd, mit dem Finger: "Hüte deine Zunge, damit sie dich nicht eines Tages in Schwierigkeiten bringt!" Dann führte er sie in einen Nebenraum, wo Dietmar tom Diek und ein Hauptmann warteten. Dazu aufgefordert, berichtete sie mit einem Dutzend Sätzen kurz und knapp über die Lage in der Waldhütte-Burg. Die Männer nickten. "Was denkst du, weshalb der Graf von Wildeshausen euch unbehelligt lässt?" fragte Dietmar dann. "Es ist schwer, unbemerkt bis zu uns vorzudringen. Da wir keinen Schaden anrichten, lohnt der Aufwand nicht." Beim letzten Satz bemerkte sie, wie ein Lächeln über Dietmars Gesicht huschte. Zweifellos hatte er Pläne mit ihr und ihren Leuten. Darüber sprach er aber vorläufig nicht. Er wies lediglich darauf hin, dass die Waldhütte-Burg weiterhin wichtig sei für die Stedinger, und stellte weitere (frisch geschmiedete) eiserne Waffen in Aussicht. Nach Neudeich zurückgekehrt, erzählte Franziska sofort von ihren Erlebnissen. Sie war erleichtert, denn sie hatte Schlimmeres erwartet. Jörg und Liemar allerdings warnten sie besorgt wegen ihrer spitzen Bemerkung gegenüber Tammo. "So etwas kann lebensgefährlich sein." "Ach was! Nicht bei Tammo. So sehr kann ich mich in ihm nicht täuschen." Bauer Jörg schüttelte den Kopf. "Weißt du, ob hinter einem Pfeiler ein Lauscher gestanden hat? Der ist 186 vielleicht zu Dietmar gegangen und vor dem musst du dich in Acht nehmen." Auf dem Weg zurück zur WaldhütteBurg ließ Franziska immer wieder die Szenen bei den Anführern an sich vorüberziehen und versuchte, sich auf Einzelheiten zu besinnen, auf Gesten, hingeworfene Bemerkungen. Sie fand aber nichts, was die Ansicht Jörgs und Liemars untermauerte. Drei Monate später glich die Waldhütte-Burg wieder einem friedlichen Dorf. Franziska hatte die Vorladung der Universitas fast wieder vergessen und litt auch nur noch selten unter Kopfschmerzen. Da platzte ein Befehl herein, der alle (und besonders die junge Fähnleinführerin) jäh wieder daran erinnerte, dass sie eben doch noch immer Teil eines Heeres waren, unter kriegsähnlichen Bedingungen. Die Anweisung war kurz und unmissverständlich. Franziska sollte mit ihren Leuten und einigen Mann Verstärkung die zwischen Oldenburg und Wildeshausen gelegene, strategisch bedeutsame Wardenburg erobern. Der Hauptmann erwähnte nebenher, dass sie sich dort ja gut auskennte. Sie wusste nicht, ob er sie mit diesem Zynismus kränken wollte oder wirklich nicht begriff, was er ihr da zumutete. Einen Moment lang erwog sie, ob sie sich rundheraus weigern sollte, sah aber bald ein, dass ihr die Entscheidung nicht frei stand. Da war nicht nur die Universitas, der sie einen Eid geschworen hatte, sondern da redeten auch ihre Anhänger mit, die sich Vorteile versprachen von dem Unternehmen. II D er Aufbruch wurde mehrmals verschoben. Der Herbst ging vorüber mit mehreren Stürmen und reichlich Regen. Mitte Dezember fiel der erste Schnee des Winters. Nach Weihnachten stellte sich strenger Frost ein. Die Waldhütte-Burg wirkte wie ausgestorben, weil ihre Bewohner sich in die Häuser verkrochen. Fenster und Türen waren mit Fellen und zerschlissenen Kleidungsstücken verstopft. Nur der Rauch, der aus den Kaminschornsteinen stieg, kündigte von Leben. Die Stedinger erfochten noch einige Siege, schlugen allerdings keine Schlacht mehr, welche jener am Hemmelskamper Wald auch nur annähernd gleich kam. Mitte Januar begann Franziska schon zu hoffen, die Universitas würde auf die Eroberung der Wardenburg verzichten. Als jedoch der Frost etwas nachließ (ohne dass der Boden deshalb auftaute), traf, zusammen mit zwanzig bewaffneten Bauernsöhnen als Verstärkung, der endgültige Befehl zum Abmarsch ein. Auf Schleichwegen erreichte die kleine Einheit unbemerkt den Wald, der an das die Burg umgebende Kulturland grenzte. Dann sandte die Fähnleinführerin als Wanderer verkleidete Kundschafter aus, welche die schlechte Nachricht brachten, dass sich in der Gegend etliche fremde Waffenknechte aufhielten. Die Grafen hatten Vorsorge getroffen. Mit Gewalt ließ sich da nichts gewinnen, denn für eine Belagerung waren sie viel zu schwach. Nach längerem Überlegen entschloss sich Franziska zu einer List. Sie teilte ihre Anhängerschaft auf in sieben Gruppen von je drei bis vier Leuten. Die sollten sich verhalten, als wären sie heimatlose Gesellen oder der versprengte Rest eines geschlagenen 187 Heeres. Zunächst schlugen sie den Weg nach Oldenburg ein und zeigten der Burg die Seite. Die Besatzung ging vorsichtshalber in Stellung. Als die sonderbaren Eindringlinge an der nächsten Gabelung jedoch nach links abbogen und die Lethe überquerten, so dass sie in einen schlauchförmigen Landstrich hineingerieten, aus dem sie wegen des Vehnemoors auf der anderen Seite nicht wieder heraus kamen, amüsierten sich die Männer auf den Mauern. Vor diesen Feinden (wenn sie denn welche waren) brauchten sie sich nicht in Acht zu nehmen. Die waren offenbar fremd. Im Westen war die Burg durch die Sümpfe des Lethebogens zuverlässig geschützt. Während die Waffenknechte ihre Posten nach und nach wieder verließen, sammelte Franziska ihre Leute im Schutze eines kleinen Waldstücks um sich. "Hört genau zu!" sagte sie, unnötiger Weise mit gedämpfter Stimme. "Es muss nachher alles sehr schnell gehen." Die anderen nickten. "Durch den Sumpf führt nur ein einziger, kaum erkennbarer Pfad. Ich gehe voran und ihr folgt mir als Kette. Erst zehn Schritt vor der Pforte kommen wir wieder auf festen Boden. Dort lösen wir die Kette auf und stürmen die niedrige Mauer des Wirtschaftshofes." "Und wie erreichen wir den Haupthof?" wollte Norbert wissen. "Es gibt doch sicherlich auch eine Mauer zwischen den beiden Höfen." "Das Verbindungstor ist immer offen." "Und wenn nicht?" "Alles andere ist noch viel unsicherer. Kommt jetzt!" Während sich die Kette formierte, redete Christian auf Ramira ein, um sie zum Zurückbleiben zu bewegen. "Geht das schon wieder los?!" fauchte sie ihn an. "Warum bist du immer gleich beleidigt?" "Ruhe jetzt!" mischte Franziska sich ein "Wer wann wo und wofür eingesetzt wird, bestimme ich." Nach diesem Machtwort des Fähnleinführers sprach niemand mehr. Um den von der Burg aus gut zu überblickenden Sumpf schnell überwinden zu können, ließen alle die entbehrlichen Teile ihrer Ausrüstung zurück. Dazu gehörte auch der Helm, der die Sicht behinderte. Zum Schutz musste der Schild genügen. Franziska hob ihr kurzes Schwert und rannte los. Es sah lustig aus, wie der Trupp sich einer großen Schlange gleich im Laufschritt den geheimen Pfad entlang wand. Der groteske Anblick war vielleicht der wichtigste Grund, weshalb in der Burg niemand Alarm schlug. Auf dem Gelände des Wirtschaftshofes hielten sich nur drei Waffenknechte auf, welche dienstfrei hatten und verschlafen am Backofen lehnten. Die Pforte ließ sich ohne Anstrengung aufstoßen, weil der Eichenbalken nicht in der dafür vorgesehenen Halterung lag. Allerdings handelten die drei Verteidiger vorbildlich. Weil sie auf verlorenem Posten standen, versuchten sie, das Tor in der Zwischenmauer zu erreichen. Als ihnen das nicht gelang, riefen sie einer Magd zu, sie solle es verriegeln. "Ich habe es geahnt!" keuchte Norbert. Noch herrschte auf dem Haupthof heilloses Durcheinander. Doch von der Zwischenmauer aus boten die Angreifer im Wirtschaftshof für Bogenschützen ein gutes Ziel. Franziska war nahe daran, die Flucht zu befehlen, als Ramira plötzlich den Schild fortwarf, auf das Tor zu lief und (ohne auf die Rufe des entsetzten Christian zu achten) einem Eichhörnchen gleich darüber hinweg kletterte. Von innen her konnte sie es ohne weiteres öffnete, denn die 188 Magd hatte zwar den Riegel vorgeschoben, doch niemand war stehen geblieben. Auf dem Hof entstand dann eine sonderbare Situation. Verteidiger und Angreifer bauten sich drohend auf. Zwischen ihnen bildete das Brunnenhaus eine Art Grenzmarkierung. Alle hielten die Schwerter blank in den Händen, blieben aber wie angewurzelt stehen. Die "Ich bin nicht blind. Du hast dich den Stedingern angeschlossen?" "Ja, Vater." Wilhelm nickte bedächtig. "Sie sind es, die dich hierher geschickt haben?" "Ja. Sie wollen die Burg um jeden Preis besitzen." Wilhelm nickte abermals. "Ich werde mit dir noch reden, später!" Dann stapfte er die Treppe hinunter und wandte sich auf dem Hof an seine Männer: "Wir sind unaufmerksam gewesen und haben uns von bewaffneten Stedingern überrumpeln lassen." Einige der Waffenknechte riefen: "Noch haben wir nicht verloren. Befehlt Ihr den Angriff, hauen wir sie in Stücke." "Der Feind steht schon innerhalb der Mauern. Da ich vor meinem Lehnsherrn für euch verantwortlich bin, habe ich die Übergabe bei freiem Abzug ausgehandelt." Nun brach ein Sturm des Protestes los. "Diese Schande werdet Ihr uns nicht antun! Wir brauchen vor diesen Tölpeln nicht zu fliehen." "Ich habe es so beschlossen." Wenig später zogen die Angehörigen der Burgbesatzung in voller Rüstung und Bewaffnung ab. Hinter der Zugbrücke wandten sie sich nach Norden, denn sie standen (anders als ihre Vorgänger) in den Diensten der Oldenburger. Dass Graf Otto die Wardenburg hatte verstärken lassen, hing übrigens weniger mit den Bauern als mit den südlichen Nachbarn zusammen. Die unklaren Zustände in Wildeshausen seit dem Tod Burchards und das neue Selbstbewusstsein der Bruchhausener erfüllten ihn mit Sorge. Mit den Waffenknechten zogen auch Martha und Rotbert. Wegen des Verteidiger waren sowohl der Zahl als auch der Bewaffnung nach überlegen, fühlten sich aber unsicher wegen der Überrumpelung. Die Angreifer standen in Gefahr, bei einem länger dauernden Gefecht den Kürzeren zu ziehen. Franziska suchte in der Menge ihren Vater, entdeckte ihn jedoch nicht. Da lief sie plötzlich, zur Verblüffung von Freund und Feind, entlang einer Lücke zwischen den niedrigen Gebäuden auf der Nordseite und der Mauer zum Turm. Auch dort war die Überraschung so groß, dass sie niemand aufhielt. Erst vor der Burgherrenwohnung wurde sie gepackt. Doch Wilhelm gab seinen Leibwächtern ein Zeichen, sich zurückzuziehen. Dann starrten beide, Vater und Tochter, sich eine Zeitlang an, ohne ein Wort über die Lippen zu bringen. "Ich dachte, dass sich dein Bruder Arnold hinter der Fahne verbirgt", sagte der Ritter schließlich. "Auf Arnold braucht Ihr nicht mehr zu warten, Vater. Ich kann jetzt aber nicht viele Worte verlieren." 189 Durcheinanders, welches den Aufbruch begleitete, fand die Mutter nicht einmal Gelegenheit, ihre verloren geglaubte Tochter zu umarmen. Wilhelm wollte später folgen. Die Mägde und Knechten blieben überhaupt. Sie beruhigten sich rasch, seit sie die Angreifer in Augenschein nehmen konnten und ihresgleichen in ihnen sahen. Franziska wartete gehorsam in der elterlichen Wohnung. Während sie auf den Hof hinunter schaute, wurde ihr bewusst, welch eigenartige Dinge sich da abspielten. Wilhelm hatte die Lage fest im Griff. Während er die Burg an die Stedinger übergab, befehligte er Freund und Feind gleichermaßen - und sowohl die einen als auch die anderen hörten auf ihn. Er war kein Mann der großen Politik, hatte immer nur sein kleines Land zwischen den Mooren am Ende der Welt geliebt. An dieses Land und an seine Bewohner dachte er auch jetzt. Er wollte den Krieg davon abhalten. Als die letzten Waffenknechte über die Zugbrücke an der Lethe geritten waren, kam er in den Turm zurück und erteilte seiner Tochter Anweisungen. "Du meldest deinen Hauptleuten, dass du die Burg nach hartem Kampf erobert hast." "Ja, Vater." "Bei der Verwaltung kannst du dich auf die Dorfältesten verlassen. Spiel dich nicht als Herrin auf, sondern höre auf ihren Rat!" Er redete streng mit ihr, doch sie spürte zugleich, dass er sie ernst nahm und ihr die Aufgabe zutraute. Erst ganz zuletzt erkundigte er sich, warum er auf Arnold nicht mehr länger warten solle, und ließ sich ausführlich von dem Mord an ihm im Geheimgang der Burg von Wildeshausen berichten. Damit war seine Hoffnung auf ein Wiedersehen mit dem Lieblingssohn endgültig dahin. Aber er hatte Franziska zurück. Und er war (trotz allem) stolz auf sie. Dass sie der Statthalter der Stedinger in seinem Land wurde, sah er an als ein Geschenk des Himmels. "Was ist aus Pentia geworden?" "Sie hat mich die ganze Zeit über begleitet. Es geht ihr gut. Ich werde sie in den nächsten Tagen hierher holen." Von ihrem unehelichen Kind erzählte sie nichts. Am nächsten Morgen, nachdem er sich ein letztes Mal überzeugt hatte, dass in seiner Burg alles an seinem Platz war, verabschiedete er sich. Etwas in ihm drängte ihn, sie wenigstens kurz an sich zu drücken, doch er versagte es sich. Zärtlichkeiten führten nach seiner Überzeugung nur dazu, dass die Kinder zimperlich wurden. Da ihn seine Tochter vertreten sollte, musste er sie wie einen Sohn behandeln. III G enau in dem Moment, als Wilhelm von der Plattform des Turms aus nicht mehr zu sehen war, setzten bei Franziska die Kopfschmerzen wieder ein. In der darauf folgenden Nacht schlief sie keinen Moment und fürchtete, den Verstand zu verlieren. Schon am nächsten Tag aber ging es ihr wieder besser und sie ritt über die Dörfer, wie sie das in ihrer Kindheit bei ihrem Vater und auch schon bei ihrem großen Bruder gesehen hatte. Am Westerholthof, dem alten Sitz der Familie, der nun von Bauern in Pacht genommen war, stiegen in ihr Erinnerungen an unbeschwerte Tage auf. Umgekehrt hatten auch die Leute 190 sie noch nicht vergessen. Eine Frau nötigte sie, mit ins Haus zu kommen, eine Kleinigkeit zu essen und sich zwei in der Zwischenzeit zur Welt gekommene Kinder anzusehen. Auch in Achtermeer, dem Dorf am Ende des Kulturlandzipfels, traf sie auf diese Herzlichkeit, obwohl die Bauern dort als Sturköpfe verschrien waren. Am nächsten Tag inspizierte sie (nun schon beinahe ohne Kopfweh) den nördlichen Zipfel der Herrschaft - Oberlethe sowie die Landstriche Depenstroh, Wiebersriehe und Am Wittemoor. Am dritten Tag hatte sie sich in ihre neue Rolle bereits gut hinein gefunden. Sie war auf vertrautem Grund und Boden. Wie von Wilhelm vorhergesagt, unterstützten die Dorfältesten sie bereitwillig. Solange sie sich nicht über die alten Bräuche hinwegsetzte, konnte sie dieses Land eine Zeit lang fast ohne Mühe regieren. Im Süden, wo sich das Nutzland links und rechts der Lethe meilenweit erstreckte, empfing man sie bereits als Herrin - ohne besondere Ehrung aber mit Respekt, genau so, wie das seit Jahr und Tag hier üblich war. Während sich Franziska den Verwaltungsaufgaben widmete, führte Norbert das Fähnlein. Seit die Burg eingenommen war, gab es für die Männer zunächst keine sinnvolle Aufgabe mehr. Die Oldenburger wollten vermutlich den von Erzbischof Gerhard mehr den je betriebenen Kreuzzug abwarten und unternahmen nichts, um das verlorene Gebiet zurückzuerobern. Zum Glück hatte es Norbert nicht mit verwilderten Landsknechten zu tun sondern mit Männern, die lieber Nützliches taten, als zu trinken und zu würfeln. Der Vorschlag, die Straßen auszubessern und die marode Lethebrücke zu erneuern, kam von ihnen selbst. Sie stellten nur eine Bedingung - sie wollten Land in Aussicht gestellt bekommen. "Das würde sie sehr anspornen", sagte Norbert am Abend zu seiner Freundin. "Können wir uns darauf einlassen?" Franziska legte den Kopf in die Hände und überlegte. "Es wäre hinterhältig, ihnen etwas zu versprechen, was wir ihnen in Wahrheit nicht geben können. Ich darf die eigenen Bauern nicht verärgern." "Ich verstehe. Bei uns in der Stadt sind die Leute auch nicht erfreut, wenn Fremde kommen und ansässig werden wollen." "Morgen spreche ich das mal in Littel an. Dort wollen die Bauern Land gewinnen und schaffen es allein nicht." "Das wäre etwas für die Stedinger. Mit dem Entwässern kennen sie sich aus." "Und was wird aus den anderen?" Norbert hob die Schultern. "Entweder sie machen mit oder sie kehren zurück nach Bremen. Zwingen können wir sie nicht." Die Bauern in Littel wollten die Fremden erst in Augenschein nehmen, ehe sie sich entschieden. Während der Erneuerung der Lethebrücke, kam öfter jemand von ihnen vorbei und sah zu. Weil der Fleiß und das Geschick der Burschen aus dem Marschland sie überzeugten, wurden sie zugänglicher. Dennoch musste Franziska noch mehrere Nachmittage geduldig mit Vertretern des Dorfes reden, ehe ein verbindlicher Vertrag zustande kam. Die Eigentumsverhältnisse von buchstäblich jedem im Plan vorgesehenen neuem Feld waren zu klären. Die feierliche Siegelung der fertigen Urkunde fand auf dem Hof der Wardenburg statt. Vor dem Brunnenhaus stand ein Tisch. Rechts und links davon verfolgten jeweils fünf Zeugen der betroffenen Parteien die Amtshandlung. Franziska war eigenartig zumute, als sie das schwere 191 Familiensiegel in die Hand nahm. Ob ihr Vater wohl guthieße, was sie tat? Er hatte ihr alle Rechte und Pflichten übertragen. Sie durfte in seinem Namen handeln. Dennoch blieb ein Zweifel, denn sie regierte auch als Statthalter der Universitas, die hier auf Oldenburger Gebiet nichts bestimmen durfte. Gleichwie! Sie konnte nicht mehr zurück. Also drückte sie das Siegel auf das Wachs. Uneingeschränkte Freude bereitete ihr eine andere ihrer Pflichten. Pentia war inzwischen mit Beatrice auf die Wardenburg umgezogen. Franziska ließ es sich nun nicht mehr nehmen, jeden Tag mit ihrer Tochter zu spielen. Wer in dieser Zeit etwas von ihr begehrte, wurde abgewiesen. Keine Nachricht war wichtig genug dafür. Anfangs verhielt sich die Kleine zurückhaltend. Sie sah die Mutter als eine fremde Frau an und suchte ständig nach Pentia. Doch das änderte sich allmählich, denn sie sehnte sich im Grunde sehr nach Liebkosungen. Die abweisende Art, die mitunter bei ihr auftrat, rührte wohl daher, dass sich die Männer in der Waldhütte-Burg nicht genug auf ihre empfindsame Seele eingestellt hatten. Für grobe Späße war sie nicht geschaffen. "Soll ich dir das Brunnenhaus zeigen?" flüsterte Franziska ihr ins Ohr, während sie sie auf dem Arm hielt. Das Mädchen nickte. "Aber du musst selber laufen. Du bist nämlich schwer." Das Brunnenhaus der Wardenburg, eine scheußliche Fehlplanung des größenwahnsinnigen Burchard, war für Beatrice ein richtiges Schloss, gerade groß genug, um noch nicht davor zu erschrecken. Die Erkundung erforderte eine Menge Zeit. Die Pfeiler, die den steinernen Baldachin trugen, mussten untersucht werden, und zwar jeder der sechs einzeln. In einen waren Zeichen eingeritzt. Franziska staunte, als die Kleine sie ihr zeigte. Sie selbst hatte sie noch nie gesehen, obwohl sie zweifellos alt waren. Beachtung verdienten auch die Eiszapfen, die sich in einer schattigen Ecke dem Tauwetter zum Trotz noch hielten. Ins Innere des Bauwerks zu gehen, erforderte bereits einiges an Mut. Da gab es zunächst eine Barriere - zwei ein wenig zu hoch geratene Stufen, die Beatrice auf Händen und Füßen krabbelnd überwand. Dann umrundete sie den Ziehbrunnen nicht weniger als zehnmal. Sehr interessant war auch die große Kurbel mit dem im Ungewissen verschwindendem Seil. Mit dieser Vorrichtung konnte sie nichts anfangen. Franziska ließ sie deshalb in das tiefe Loch hinein blicken, was ihr aber nicht behagte. Lustiger war, wie die Mutter mit der Kurbel einen Eimer Wasser herbeizauberte. Nach vier Wochen hatte sich das Leben in solchen Maße normalisiert, dass Uneingeweihte den Machtwechsel nicht bemerkten. Ein wandernder Krämer erkundigte sich immer wieder nach Wilhelm und war noch bei seiner Weiterreise überzeugt, der Ritter liege krank im Bett, was die Familie verheimlichen wolle. Dass die Zeit der Stedingerherrschaft dennoch im Gedächtnis der Leute blieb, lag ausgerechnet an Ramira, die Dank eines Zufalls einen erstaunlichen Aufstieg erlebte. Beim Stöbern im Obergeschoß des Herrenhauses entdeckte sie eine hinter Mehlsäcken in Vergessenheit geratene Truhe. Diese enthielt fast nur wertlosen Plunder ausbesserungsbedürftige Kleider, bunte Tücher, Reste von Brokat, billigen Schmuck. Die Gauklerin, der niemand eine sinnvolle Aufgabe zuwies, nähte sich nun aus dem Material phantasievolle Kostüme. Eines Tages erschien sie als Prinzessin auf dem Hof. 192 Die Verwandlung war unglaublich, gemessen an den bescheidenen Mitteln, die ihr zur Verfügung standen. Ihr rotgoldenes Lockenhaar fiel ihr offen auf die Schultern. Nur ein mit kleinen Steinen besetzter Reif, der in der Sonne funkelte, hielt es in Stirnhöhe zusammen. Das Kleid war aus hellblau gefärbter Seide. Den zerfaserten unteren Saum verbarg eine prächtige Brokatborte. Ein Gürtel mit handtellergroßen Gliedern wirkte beinahe zu klobig für ihre zierliche Taille. Den Umhang hatte sie aus einem Dutzend verschiedenen Fellstücken gefertigt. Ein Fürspann aus Silber (das einzige Stück von Wert) hielt ihn am Hals zusammen. Ramira trug aber nicht nur fürstliche Kleidung, sie benahm sich auch ihr entsprechend - so als spielte sie eine Rolle in einem Schauspiel. Da der Hof jedoch keine Bühne war, löste der Auftritt eine Welle heiterer Neugier bei den Mägden und Knechten aus, die sofort ihre Arbeit aus der Hand legten. Wäre die Gauklerin unsicher geworden, hätte man sie gnadenlos verspottet. Doch sie verzog keine Miene und bahnte sich mit königlicher Hochnäsigkeit ihren Weg. Schon am nächsten Tag ging wieder das alte Gerücht um, sie sei eine Fee. Vielleicht hatte es ein Spaßvogel aus der Waldhütte in harmloser Absicht in die Welt gesetzt. Da jedoch zufällig gerade in jenen Wochen die ersten Frühlingsblumen durch die dünn gewordene Schneedecke brachen, breitete es sich auch unter den Bauern der Gegend aus und eine Welle der Verehrung setzte ein. Anders als nach ihrer Ankunft in der Waldhütte förderte sie die Legende diesmal. In einer Ecke des Lagerraums, worin sie die Truhe entdeckt hatte, richtete sie sich eine Residenz ein. Franziska sah sich das alles eine Weile mit an, dann nahm sie die Freundin beiseite und fragte sie, was sie sich dabei eigentlich denke. Diese gab ihr allerdings eine Antwort, die sie verstummen ließ. "Was glaubst du, wie lange der Zauber hier anhält? Vier Wochen noch, vier Monate? Irgendwann jagen sie uns davon. Ich kann dir nur raten, dich zu amüsieren wie ich, solange du es noch kannst - anstatt Urkunden zu schreiben, die sowieso im Feuer landen!" Ob sich Ramira tatsächlich amüsierte, sei dahingestellt, ihre selbst gewählte Rolle geriet aus dem Ruder. Sie wurde zu Festen genötigt, zu Kindstaufen, zu Hochzeiten, zu Hauseinweihungen. Erfahrene Bauern erbaten sich Ratschläge zu Dingen, von denen sie nicht das Geringste verstand. Allerdings war sie als Gauklerin auch Meisterin der Täuschung. Kam sie mit Worten nicht weiter, nahm sie die Leier und sang. Ihre melancholischmystischen Lieder trafen das Lebensgefühl der Leute im Land zwischen den Sümpfen. Die hörten ihr ehrfürchtig zu und legten in jedes Wort eine besondere Bedeutung hinein. Nur Christian ärgerte sich. Dabei gönnte er ihr den Erfolg durchaus. Er fürchtete jedoch, als entbehrliches Überbleibsel einer vergangenen Zeit beiseite geschoben zu werden. Seiner Meinung nach beruhen zwischenmenschliche Beziehungen allein auf gegenseitiger Abhängigkeit. Liebe ließ er nur als Beschreibung eines romantischen Wunsches gelten (obgleich er für das rothaarige Gauklermädchen genau das fühlte, was man gemeinhin darunter versteht). Bald stand für ihn fest, dass sie auf ihn, den schüchternen Jungen, immer hochmütiger herabblicken würde, je mehr sich ihre Position als gute Fee festigte. 193 Tatsächlich musste er sich, wollte er mit ihr reden, ihrer knapp bemessenen Zeit wegen, immer erst anmelden. Das verbitterte ihn, da er selbst bei Franziska, die den Ritter Wilhelm vertrat, ohne weiteres vorsprechen durfte. Erst recht konnte Norbert sich meistens kurzfristig losreißen von seinen Pflichten, um mit seinem alten Freund kurz zu plaudern. "Habe ich es nicht immer gesagt, dass ein Mann mit Weibern nichts als Ärger bekommt?!" kehrte er zurück zu seiner alten Überzeugung. "Nun bin ich also durch das Leben einmal mehr auf diese Wahrheit gestoßen worden!" Einmal verwünschte er Ramira mit grimmigem Zorn. Ein andermal redete er sich ein, sie sei ihm völlig gleichgültig. Zuweilen nahm er sich auch vor, ihr Grobheiten an den Kopf zu schleudern. Tatsächlich aber schlich er in großen Bogen wortlos um sie herum und grämte sich. 194 17.Kapitel I I n Bökenbraken war der Teufel los. Auf dem Anger herrschte ohrenbetäubender Lärm, weil ein paar Dutzend Menschen sich gleichzeitig Gehör zu verschaffen versuchten. Die beiden Söhne des Grafen von Bruchhausen, die auf je einer Wassertonne standen, waren längst nicht mehr zu verstehen. "Nördlich der Huntemündung haben sie fünf Dörfer gebrandschatzt." "Und jetzt sind sie mit einem Heer auf dem Wege hierher." "Es war ein Fehler, die Holländer hier anzusiedeln. Das sind Fremde." "Was soll das Gejammer? Sie sind nun einmal da und wir müssen uns gegen sie wehren." Das Wetter stand übrigens im krassen Gegensatz zur Stimmung der Leute. Man konnte schon Frühlingskleider anziehen, wenngleich erfahrene Bauern meinten, der Winter werde sich noch einmal zurückmelden. An einen Spaziergang dachte an diesem Sonntag freilich niemand. Im Durcheinander der Meinungen setzte sich allmählich folgende Ansicht durch. "Wir Dörfler kommen gegen ein ganzes Heer nicht an. Die Herren müssen uns schützen. Dafür entrichten wir unsere Abgaben. Was ist mit dem zweiten Kreuzzug, von dem alle Welt redet? Die Adligen legen die Hände in den Schoß." Unvermittelt richtete sich der von Heinrich dem Jüngeren und Ludolf entfesselte Sturm gegen sie selbst. Sie hatten die Bauern aus Bökenbraken und den umliegenden Dörfern zusammengerufen und ihnen eingeredet, von den Stedingern bedroht zu sein. Die Leute waren zunächst misstrauisch gewesen, denn sie hatten bisher keine schlechten Erfahrungen mit den Marschlandbewohnern von der Weser gesammelt. Nur mit Lügen war es den Grafensöhnen gelungen, den Volkszorn doch noch zu entfachen. Von da an dauerte es dann allerdings nicht mehr lange, bis ihnen die Lage entglitt. "Wir wollen euch doch helfen!" schrie Ludolf aus Leibeskräften. "Wir sind ja hierher gekommen, weil wir euch nicht vergessen haben." "Was will der Graf unternehmen?" fragte der Dorfschulze. "Wir stellen ein Heer auf, brauchen dazu aber eure Hilfe. Ihr wollt doch nicht, dass fremde Landsknechte eure Felder verwüsten." "Landsknechte sind wie die Cholera." "Nur Männer der Grafschaft sollen dazugehören. Jedoch kann euch niemand zwingen, zu den Waffen zu greifen. Ihr müsst euch freiwillig melden!" Wieder schwoll der Lärm an. Nun aber entwickelte sich die Stimmung in die gewünschte Richtung. Vor allem die jüngeren Leute wollten beim Krieg dabei sein und feierten den Sieg mit blutrünstigen Sprüchen schon im Voraus. Zur selben Zeit beriet sich Heinrich III im Turm seiner Burg mit seiner Frau Ermentrud. Die Art, wie seine Söhne die Bauern aufwiegelten, gefiel ihm von Tag zu Tag weniger. Er hatte ohnehin nur halbherzig seine Zustimmung gegeben. "Durch diese Hitzköpfe geraten wir vielleicht früher in einen Krieg, als uns lieb sein kann." "Warum sorgt Ihr Euch, Mann, da doch alle Zeichen für uns sprechen?" Ermentrud gab ihre spröde Art auf und sprach ungewohnt beschwörend. "Ihr werdet der Erste unter den Grafen der Gegend sein." Heinrich wandte sich verblüfft um, ließ sich aber schließlich mitreißen. Das war schon ein großer Traum! Er stellte sich eine neue Burg vor, eine viel größere, an einer anderen Stelle. Ein steinerner Palas mit einem prächtigen Saal! Die mächtigsten Adligen der Gegend kommen zu den Festen, auch der Graf von Oldenburg, dieser dicke, weichliche Otto, der sich verschätzt hat. "Ihr müsst noch einmal nach Holland reisen, Mann." Ermentruds Stimme riss ihn aus seinen Träumen. "Ja, gewiss! Ich werde mich bei Leo de Schodis in Erinnerung bringen." "Fallt nicht mit der Tür ins Haus! Lasst ihn nicht zu früh merken, dass Ihr Feldherr werden möchtet!" Das war freilich leichter gesagt als getan. Dieser Leo mit dem scharfkantigen Gesicht war Heinrich unheimlich. Wenn er durch den Raum ging und dabei das Bein nachzog, kam er ihm vor wie der Teufel in Person. Der Bruchhausener kannte sich auch in den holländischen Machtverhältnissen nicht aus. Auf den ersten Blick gehörte die Familie de Schodis keineswegs zu den mächtigsten Fürstenhäusern. Allem Anschein nach aber verstand es deren Oberhaupt, sich durch persönliche Beziehungen Einfluss zu verschaffen. Der Graf aus Deutschland hatte leider nicht viel anzubieten und war im Grunde ein Bittsteller. Heinrich gab zunächst vor, sich für den Kreuzzug nur seines erschlagenen Bruders wegen zu interessieren. "Sind die Ritter aus Brabant und Flandern dem Aufruf gefolgt? Wollen sie sich wirklich einer Sache annehmen, die sie selbst kaum betrifft?" Über Leos hartes Gesicht huschte ein Lächeln. Die Züge wirkten dadurch aber nicht freundlicher. "Ich will nicht den Glaubenseifer der holländischen Adligen in Frage stellen", fügte Heinrich vorsichtshalber hinzu. "Mitunter jedoch muss ein Mensch sich zwischen zwei gleichermaßen wichtigen Forderungen entscheiden." Leo wurde immer fröhlicher, vielleicht auch hämischer. "Die Ritter erkennen die besondere Bedeutung dieses Kreuzzugs. Das Beispiel an der Weser könnte anderen Bauern zum Vorbild dienen. Ein Feuer muss man bei seiner Entstehung bekämpft." Fast beiläufig schloss er mit den Worten: "Die Heere sammeln sich bereits." "Die Heere? Sind es gar mehrere?" "Zwei sind es hier im Norden - eines in Brabant und eines in Flandern. Eine dritte Streitmacht steht am Rhein." Heinrich war für einen Moment sprachlos. Wenn sich die Heere schon sammelten, musste es auch bereits Hauptleute geben. "Das werden meine Gemahlin und deren leidgeprüfte Schwester mit Erleichterung und Freude hören", sagte er und merkte sofort, dass er nicht gut heuchelte. "Kann ich mit den Heerführern reden?" "Die Streitmacht aus Brabant wird durch den Herzog selbst befehligt. Zu seinem Stellvertreter ernannte er kürzlich Floris von Holland." "An Letzteren erinnere ich mich von meinem vorigen Besuch her und es beruhigt mich, einen Mann wie ihn unter den Befehlenden zu wissen. Ich hatte einen ausgezeichneten Eindruck von ihm." Sein säuerliches Gesicht sagte das Gegenteil. Doch er besaß bessere Aussichten, als er ahnte. Leo de Schodis hatte sich nach ihm erkundigt und hielt ihn für einen fähigen und tapferen 196 Kämpfer. Allerdings waren die politischen Verflechtungen in Holland so vielschichtig, dass er trotz seiner Beziehungen einem Schützling nur begrenzt helfen konnte, zumal wenn es sich um einen Fremden handelte. Dass er sich dennoch bemühen wollte, lag an seiner Sorge um den Erfolg des Kreuzzuges. Nach seinem Geschmack tummelten sich unter den Führern zu viele vornehme Männer des Hochadels. Der Bruchausener hatte sich immerhin mit einer Hand voll Leuten in einer winzigen Burg gegen seine übermächtigen Verwandten behauptet. "Ich werde ein Schreiben an den Herzog verfassen und darin ausdrücklich auf Euch hinweisen." "Wie meint Ihr das?" fragte Heinrich, nun völlig überrascht. "Ich gehe davon aus, dass Ihr das Blut Eures Bruders rächen wollt, und halte es für meine Pflicht, Euch zu helfen." Mit dem Herzog von Brabant traf der Gast von der Weser in dessen Schloss zusammen. Er wurde zu einem Festmahl geladen. Obwohl ein Diener ihm einen besonderen Platz zuwies, blieb unklar, ob er tatsächlich geehrt werden sollte. Heinrich neigte eher zu der Annahme, dass der Hofstaat regelmäßig in dieser Weise zusammenkam. Die große Tafel war überfüllt mit Köstlichkeiten, wobei die ungewöhnliche Zahl exotischer Gerichte auffiel. Die Holländer unterhielten Handelsbeziehungen, die selbst bei den Bremer Kaufleuten Neid erweckten und die dem Herzog von Brabant in mehrfacher Hinsicht nutzten. Er mästete sich an den Steuern, tätigte selbst gewinnbringende Geschäfte und kaufte Waren aus fernen Ländern zu günstigen Preisen. Heinrich sah, wie der Gastgeber an einer der Stirnseiten thronte und vor eifrig beipflichtenden Zuhörern seine Ansichten zu irgendeinem Gegenstand darlegte. Aufwändig und elegant gekleidet, stellte er seinen Reichtum und seine Bedeutung zur Schau. Vermutlich war er eitel und geltungssüchtig. Letzteres mochte auch die Erklärung sein, dass er sich hatte zum Heerführer ernennen lassen. Heinrich konnte sich diesen Schönling nicht in einer Rüstung vorstellen, geschweige denn im Getümmel einer Schlacht. Da war Floris von Holland aus anderem Holz geschnitzt. Nicht grundlos hatte man ihn dem Herzog an die Seite gestellt. Vielleicht wurde ja auch ein Haudegen wie der Graf von Bruchhausen noch gebraucht. Mit neuen Hoffnungen traf Heinrich nach dem Festmahl mit den beiden Männern in einem Nebenraum zusammen. Er übergab das Schreiben des Leo de Schodis und verfolgte gespannt ihren Gesichtsausdruck, während sie es lasen. Doch der Herzog, der sich für Einzelheiten nicht interessierte, reichte die Rolle Schulter zuckend sofort an Floris weiter. Dieser wiederum wollte selbstverständlich keinen Konkurrenten und überspielte seine Verärgerung nur unvollkommen durch Höflichkeitsfloskeln. II E igentlich wollte Heinrich III gleich am nächsten Morgen abreisen. Der Herzog jedoch hielt ihn zurück, vielleicht wegen einer Bitte des Leo de Schodis. Er solle sich wenigstens noch das Lager ansehen. Als Begleiter erhielt er einen Mann, den man anderenorts für einen 197 Handwerksmeister hätte halten können. Er hieß Gerhard von Diest, gehörte einem eher unbedeutenden Adelshaus an, genoss aber eine besondere Stellung im Heer, weil er sowohl über ungewöhnliches technisches Wissen als auch über Organisationstalent verfügte. Ein Kriegsmann war er im Grunde nicht. Nur weil er vom Schicksal (in der Person des Herzogs) dazu bestimmt war, einen Kreuzzug vorzubereiten, gab er dafür sein Bestes. Anfangs hielt Heinrich wenig von ihm. Im Unterschied zu seinem Namensvetter, dem Erzbischof von Bremen, war der Edelherr von Diest ein freundlicher Mensch. Angesichts seiner Aufgabe wirkte er beinahe zu geschwätzig. Doch allmählich lernte der Bruchhausener ihn schätzen. Sie erreichten eine Bucht, die (jeweils vorübergehend) teilweise als Hafen, teilweise als Werft ausgebaut war. "Der Schlachtplan steht noch nicht fest", erklärte Gerhard. "Wir erwägen aber die Möglichkeit, vom Wasser her anzugreifen." Heinrich blickte sich um. "Hier entsteht eine beachtliche Flotte!" "Wir haben bis jetzt vierundneunzig Schiffe, die halbfertigen mitgerechnet. Am Ende sollen es über dreihundert sein." "Alle in dieser Größe?" "Ja. Eine Flotte aus kleinen Schiffen, wie ein Hornissenschwarm! Wichtig ist, dass wir die Boote an der Küste entlang heil bis zur Wesermündung bringen. In einen Sturm dürfen wir mit ihnen nicht geraten." Zwei Tage später ließ sich Heinrich erneut bei Leo de Schodis anmelden. Für sich allein wäre er weniger hartnäckig gewesen. Er hatte die Bettelei gründlich satt, ahnte jedoch die vorwurfsvollen Blicke seiner Frau Ermentrud nach einem Misserfolg. Dass er richtig entschieden hatte, merkte er bald. Leo fühlte sich durch Floris von Holland brüskiert. In sein vertrocknetes Gesicht stieg für einen Moment die Zornesröte. Nunmehr war es für ihn eine Sache der Ehre, dem Bruchhausener doch noch eine ehrenvolle Stellung zu verschaffen. Er setzte ein Schreiben auf und versiegelte es. "Übergebt das Arnold von Gavre!" "Wer ist das?" "Einer der Hauptleute des Heeres aus Flandern. Lasst Euch von meinen Dienern zu ihm führen!" Das Lager in Flandern wirkte weniger gepflegt als der Flottenhafen in Brabant. Reiterei und Fußvolk sammelten sich dort. Die Männer saßen zwischen den Zelten und vertrieben sich die Zeit mit Glücksspiel und Wein. Als Heinrich bei den Kommandierenden eintrat, sah er, dass auch Arnold von Gavre, der Heerführer, kein vornehmer Herr war. In seiner abgenutzten braunen Lederkleidung hätte man ihn für den Hauptmann einer Räuberbande halten können. Doch dieses Eindrucks schämte er sich nicht. Auf dem Kopf trug er einen Filzhut mit einer Adlerfeder. Darunter quollen dichte, schwarze Haare hervor und fielen wirr in Stirn und Nacken. Auch sein Gebaren war grobschlächtig. Den Gast knurrte er zur Begrüßung an: "Du siehst nicht so aus, als ob du bei uns im Heer kämpfen willst. Was willst du also?" Wortlos reichte der Bruchhausener das Schreiben des Leo de Schodis herüber. Arnold von Gavre überflog es kurz und warf es dann verächtlich auf einen Tisch. "Der hat mir gar nichts zu sagen. Mag er mich anschwärzen, wenn es ihm gefällt! Ich lasse mich nicht erpressen." Nun wurden zwei Männer aufmerksam, die sich bisher im Hintergrund gehalten hatten. Die 198 Gebrüder von Bethune wirkten im Aussehen und Benehmen wie Zwillinge, obwohl sie ein Jahr trennte. Auch sie trugen verwegene Kleidung, waren allerdings blond. "Wer will dich anschwärzen?" fragten sie wie aus einem Munde. "Ein Wichtigtuer!" Mit einer Handbewegung deutete Arnold von Gavre an, dass es nicht lohne, lange darüber zu reden. So stand es um Heinrichs Anliegen erneut nicht gut. Anders als im Palast des Herzogs fühlte er sich diesmal aber auf sicherem Grund, denn diese drei Hauptleute waren im Wesen wie er. Vermutlich hätte er sich an ihrer Stelle ähnlich verhalten. Nunmehr jeden höfischen Anstand fahren lassend, packte er den verdutzten Arnold von Gavre am Kragen, schüttelte ihn und erklärte: "So lasse ich nicht mit mir reden!" Beinahe hätte er eine Prügelei ausgelöst. Doch letztlich war dies die einzig mögliche Art, sich hier Respekt zu verschaffen. Am Abend saß er wieder an einer reich gedeckten Tafel. Die aber erinnerte kaum an das Festmahl des Herzogs. Auf rohem Holz und unter freiem Himmel standen große Schalen mit fettigem Braten. Die Männer spießten die Stücke mit ihren Messern auf und warfen die Knochen hinter sich. Der Wein floss in Strömen. Beim dritten Becher verbrüderte sich Heinrich mit Arnold von Gavre und den beiden Edelleuten von Bethune. Nach dem sechsten spielte das Schreiben des Leo de Schodis wieder eine Rolle (obwohl es jetzt niemand mehr verständlich vorlesen konnte). Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass der oberste Feldherr für das Heer aus Flandern noch gesucht wurde, da die drei Hauptleute, die das Lager befehligten, als nicht vornehm genug galten. Heinrich kam eher in Frage. Arnold von Gavre, der lieber ihn wollte als irgendeinen hochmütigen Spross aus dem Hochadel, gab ihm Ratschläge. "Verlass dich nicht auf Leo, sondern rede über die Angelegenheit mit dem Herzog! Den kostet es nichts, dich zu unterstützen. Vielleicht macht es ihm sogar Spaß, sich in die Angelegenheiten von Flandern einzumischen." Heinrich bedankte sich und brach sofort zum Schloss des Herzogs auf. Dort allerdings musste er sich einen Tag lang gedulden, weil gerade eine Abordnung aus dem Rheinland eingetroffen war. Entschädigt wurde er durch die Gespräche, die er zufällig verfolgen konnte, und durch die Eindrücke, die er sonst noch sammelte. Das dritte Heer stand den anderen beiden offenbar kaum nach, weder was die Zahl der Ritter noch was die Ausrüstung anging. Wer die Mittel bereitstellte, blieb im Dunkeln. Zweifellos waren mehrere mächtige Kirchenfürsten beteiligt. Um sich abzustimmen, hatten sich der Feldherr Dietrich von Cleve und sein Stellvertreter Adolf VII von Berg persönlich auf die Reise nach Holland begeben. Heinrich sah beide nur im Vorübergehen und fand keine Gelegenheit, sie zu sprechen. Dietrich von Cleve erinnerte in seiner Art an Floris von Holland, war aber wenigstens einen Kopf größer - ein Riese, nach dem sich die Leute umdrehten. Adolf von Berg hatte seine besten Jahre hinter sich. Sein Gesicht war zerfurcht wie das des Leo de Schodis. Allerdings brannte in den Augen noch das Feuer des erfahrenen Kämpen. Auf der Heimreise hatte Heinrich von Bruchhausen allen Grund zur Zufriedenheit. Wie von seiner Frau Ermentrud vorausgesagt, war ihm das Schicksal immer in den entscheidenden Momenten beigesprungen. Eine Urkunde des Herzogs sicherte ihm das Kommando über die Truppen aus 199 Flandern zu, sobald diese an der Weser einträfen. Mit Arnold von Gavre und den Gebrüdern von Bethune würde er dann Hauptleute haben, denen er vertraute. Einflussreiche Männer sorgten dafür, dass der Kreuzzug gut vorbereitet wurde. Ein abermaliger Misserfolg schien ausgeschlossen. Dennoch gab es da etwas, das Heinrich beunruhigte. Der neue Kreuzzug war eine Angelegenheit von Fremden geworden - aus Brabant, aus Flandern, aus dem Rheinland. Er, der Bruder des Märtyrers Burchard, musste betteln, um in angemessener Stellung teilnehmen zu dürfen. Wer auch immer die Fäden im Hintergrund zog, ob der Erzbischof von Bremen, der Papst oder noch ein anderer, er hatte die Herrscher der betroffenen Gegend einfach übergangen. Wer bürgte dafür, dass sich dieser kommende Krieg wirklich nur gegen die Stedinger richtete? Gegen seinen Bruder hatte die Burg von Bruchhausen standgehalten, für jene Heere dort im Westen war sie im Ernstfall nur ein lästiges Hindernis auf dem Wege. Im Grunde war es heller Wahnsinn, einen solchen Sturm zu entfesseln wegen ein paar Meilen Marschland. III H einrich der Bogener schreckte hoch durch wildes Geschrei, das vom Hof her zu ihm herunter drang. Er saß im Keller des Palas, wo die Truhen mit den Dokumenten standen, und überprüfte Urkunden, da er den begründeten Verdacht hegte, darunter seien Fälschungen aus der Zeit seines Vaters. Der Lärm störte ihn, doch er dachte sich nichts dabei. Vielleicht war ein Pferd durchgegangen. Erst, als er überhaupt keinen Gedanken mehr fassen konnte, stieg er über eine Holztreppe hinauf in die Eingangshalle, um die Ursache zu ergründen. Auf dem Hof hatte sich eine Menschenmenge versammelt und brüllte etwas im Chor. Verwundert, aber noch immer arglos, trat er vor die Tür, wo ihn ein Orkan von Schmährufen empfing. Der Tumult galt also ihm! Doch was wollten all diese Leute? Nur zwei kamen ihm bekannt vor. Vielleicht gab es Beschwerden wegen der zuweilen tatsächlich empörenden Selbstsucht einiger seiner Ritter. Dann hörte er genauer hin und begriff endlich. "Warum müssen die Bruchhausener Euren Vater rächen?" "Lasst uns gleichfalls ein Heer aufstellen!" Heinrich war von dem Aufruhr völlig überrascht. Er wusste zwar, dass seine beiden Vettern in der Nachbargrafschaft Stimmung gegen die Stedinger entfachten und dass sich dort etliche Bauernsöhne freiwillig meldeten, um der angeblichen Gefahr entgegenzutreten. Dass die Welle aber so rasch zu ihm herüber fluten würde, darauf hatte er sich nicht vorbereitet. Im Übrigen bezweifelte er, dass die Schreihälse die Meinung der Mehrheit vertraten. Wer hatte diesen Leuten eigentlich den Zutritt zum Haupthof gewährt? Wo blieben die Waffenknechte? Warum griffen sie nicht ein, da doch offensichtlich ihr Burgherr bedrängt wurde? Um Zeit zu gewinnen, hob Heinrich beschwichtigend die Arme und rief: "Selbstverständlich werde ich meinen Vater rächen. Schon lange plane ich, ein Heer aufzustellen. Ehe ich aber damit 200 beginnen kann, muss ich verschiedene Vorbereitungen veranlassen." "Was sind das für Vorbereitungen? Die Lehensritter bringen die Ausrüstung für sich und ihre Knappen mit." Der Graf dachte über die Antwort einen Moment zu lange nach. Schon setzten wieder vereinzelt Schmährufe gegen ihn ein. Zu seinem Glück tauchten im letzten Moment die Waffenknechte doch noch auf und bereiteten dem Spuk ein vorläufiges Ende. Heinrich gab sich freilich nicht der schwachen Hoffnung hin, dass die Sache damit endgültig erledigt sei, und rief sofort seine engsten Vertrauten im Rittersaal zusammen. "Was erlauben sich diese Halunken?!" rief er aufgebracht und lief vor Zorn auf und ab. "Sie kennen weder Respekt noch Höflichkeit. Man sollte herausfinden, wer sie sind, und sie bestrafen." "Das wäre im Augenblick nicht klug", gab jemand zu bedenken. "Weshalb?" "Die Stimmung in der Grafschaft ist schlecht. Hinter dem Zwischenfall stehen vermutlich nicht nur einige wenige Hitzköpfe." Heinrich schüttelte den Kopf. "Was versprechen sich diese Leute von einem Krieg gegen die Stedinger? Hat der erste Kreuzzug nicht genug Schaden angerichtet?" "Ein zweiter Kreuzzug würde die Leute von anderen Ärgernissen ablenken." Heinrich kehrte zu seinem Stuhl zurück. "Dergleichen hilft uns nur für kurze Zeit", erklärte er resignierend. "Es wäre glatter Selbstmord, würden wir uns jetzt ernstlich an einem Krieg beteiligen. Die Waffen unserer Ritter sind zu einem Großteil alt und unbrauchbar. Was uns der Erzbischof gab, ist in der Schlacht am Hemmelskamper Wald verloren gegangen, und noch einmal will er uns nicht helfen, warum auch immer. Wir müssten bei den Bürgern Bremens Anleihen aufnehmen. Leider stehen wir aber bei einigen Kaufherren ohnehin tief in der Kreide. Wir sind schon regelrecht abhängig von ihnen." Zwei Wochen lang versuchte der Graf, weiter so zu regieren wie bisher und sich um den Kreuzzug nicht zu bekümmern. Die aufgehetzten Bauern aber kamen wieder, wie es zu befürchten gewesen war, und zwar in einem geradezu bedrohlichen Aufmarsch. Sie brachten dicke Knüppel mit, sogar einige Schwerter und sie hatten unterwegs etliche Gleichgesinnte aufgelesen. Die Waffenknechte an den Toren stellten sich ihnen in den Weg, merkten aber, dass sie ohne Blutvergießen kaum Erfolg haben würden, und ließen es nicht zum Äußersten kommen. Der Graf beobachtete die Zusammenrottung von seiner Wohnung im Bergfried aus. Zweifellos waren diese Leute nicht mit Versprechungen zu befriedigen. In ihrem Aufstand kam mehr zum Ausdruck als die Unzufriedenheit über eine zu lasche Einstellung zum Kreuzzug. Der neue Herrscher war allgemein unbeliebt. Inwieweit bestimmte Edelleute dazu beigetragen hatten, sei dahingestellt. Jedenfalls genügte inzwischen jeder Anlass für eine offene Rebellion. Während sich der Hof mit Leuten füllte, übermannte Heinrich das Gefühl, der Lage nicht mehr gewachsen zu sein. Obwohl er sich bewusst war, wie kläglich er damit handelte und wie sehr er mancher Leute Erwartungen in ihn damit enttäuschte, sammelte er resignierend ein, was er an Essbarem im Turm fand, knotete es in einen Umhang und schlich sich ins Erdgeschoß. Von dort aus gelangte er über eine Klappe im Boden in ein Kellergewölbe, das wiederum der Ausgangspunkt für den 201 Geheimgang war. Unterdessen gerieten die Eindringlinge im Hof völlig außer Rand und Band. Sie benahmen sich wie Eroberer, richteten Zerstörungen an, provozierten Prügeleien. Die Bewohner der Burg wollten sich das nicht länger gefallen lassen. Da aber der Graf unauffindbar war, herrschte lange Verwirrung und Uneinigkeit. Schließlich scharte der Vogt alle verfügbaren Waffenknechte um sich und ließ gewaltsam Ordnung schaffen. In den folgenden Tagen griff Anarchie um sich. Da Heinrich ungeklärte Verhältnisse zurückgelassen hatte, konnte der Vogt auf keine Vollmachten verweisen. Das nahmen andere Höflinge zum Anlass, ihn zu verdrängen. Allzu viel brachte ihnen das aber nicht ein, weil die Ritter vom Lande ihnen die Unterstützung und natürlich auch die Abgaben verweigerten. Im Schloss selbst wurden die Mägde und Knechte aufsässig. Agnes hatte immerhin noch ein paar persönliche Anhänger. Das waren vor allem Männer, die sie ihrer Anmut wegen bewunderten. Für die Mehrzahl der Höflinge allerdings galt sie ohne den Grafen als das Ritterstöchterchen aus dem Land der Sümpfe (wenn nicht gar als Hure). Genug damit beschäftigt, sich selbst zu schützen, konnte sie sich nicht mehr um die Ordnung in der Vorburg kümmern. Übrigens ahnte sie, wo sich Heinrich aufhielt, denn sie kannte die Gänge aus jener Zeit, als sie (frisch verliebt) dort unten nach den Spuren alter, romantischer Legenden gesucht hatte, und sie wusste, dass er während des Aufruhrs im Turm war. Sie verbot sich jedoch, der Frage auf den Grund zu gehen. Er musste freiwillig aus seinem Versteck kommen. Wie oft hatte sie als Heranwachsende davon geträumt, in Wildeshausen mehr zu sein als ein armes Mädchen, dem nicht einmal der Schmuck gehörte, den es trug! Nun war sie praktisch die Herrin, weil sich niemand sonst aus der Grafenfamilie mehr sehen ließ. Aber sie hatte sich das alles ganz anders vorgestellt. Auf diesem Schloss lastete wohl tatsächlich ein Fluch. Zum ersten mal in ihrem Leben fragte sie sich ernsthaft, ob die Einfachheit in der Burg ihrer Eltern vielleicht doch das bessere war. Als Heinrich wieder auftauchte, fragte sie ihn nicht, wo er gewesen sei. Die Höflinge unterwarfen sich ihm erstaunlich bereitwillig. In den Tagen der Anarchie hatten sie gemerkt, dass ihre Einkünfte litten, wenn es überhaupt keine Ordnung mehr gab. Aber die heimlichen Betrügereien ließen sich nun kaum noch eindämmen. Der Graf gab es auf, die Urkunden zu prüfen. Wenn er auf Fälschungen stieß und die Schuldigen dann doch nicht zur Rechenschaft ziehen konnte, führte ihm das nur einmal mehr seine Ohnmacht vor Augen. Zu einem Aufruhr des Kreuzzugs wegen kam es übrigens nicht mehr. Diejenigen, die im Kampf gegen die Stedinger zu Ruhm und Reichtum gelangen wollten, bildeten auf eigene Faust mehrere Fähnlein und unterstellten sich den Bruchhausenern. Niemand hinderte sie daran. Im Gegenteil, als Heinrich über einen Boten von seinem Namensvetter und Oheim um eine nachträgliche Genehmigung ersucht wurde, erteilte er diese ohne jede Bedingung. IV 202 B ischof Johannes von Lübeck, der zugleich Prior des ersten Konvents der Dominikaner in Bremen war, hatte eine neue, schneeweiße Kutte angelegt und auch auf seinem Gesicht spiegelte sich die Heiterkeit eines Festtages wider. Er stand am Fenster jenes Zimmers, welches Gerhard II wie kein anderes im Palast liebte, und blickte hinab in den von Sonne überfluteten Hof. Seine feingliedrigen Hände umfassten dabei fast zärtlich ein Kruzifix aus Ebenholz. "Dieser Tag gehört uns", bemerkte er, tief in Gedanken versunken. Der Erzbischof verstand nicht recht, worauf sein Gast anspielte, mochte aber auch nicht danach fragen. Er ahnte, dass Johannes ihm dann eine philosophische Rede halten würde und ihm fehlte der Sinn für solche Art, die Welt zu sehen. Dennoch verband die beiden Männer weit mehr als die Gesinnung. Es gab Momente, in denen Gerhard sich eingestand, in seinem Denken und Handeln sehr irdisch gebunden zu sein. Da er (nach seiner Überzeugung) auf Erden unermüdlich für Gott kämpfte, empfand er das nicht als Makel. Aber er wünschte, dass seine Taten ins rechte Licht gesetzt würden durch einen, der dafür wohlklingende Worte fand. "Die Holländer haben uns nicht enttäuscht. Ihr Glaubenseifer ist lobenswert", bemerkte Johannes weiter, während er sich vom Fenster wegdrehte und gemessen zu einem Stuhl schritt. Dazu konnte sich Gerhard ohne weiteres äußern. "Ich war es leid, die große Aufgabe durch das Gezänk jener Kleingeister gefährdet zu sehen. Die Oldenburger drücken sich mit unverschämten Lügen vor ihren Pflichten. In Wildeshausen herrschen haarsträubende Zustände. Und dieser Emporkömmling aus Bruchhausen, der sich plötzlich anbiedert, dessen Ziele sind leicht zu durchschauen." Er redete sich in Eifer und achtete nicht darauf, welchen Gegensatz er dabei zu seinem vornehmen Gast bildete. "Ich will sie vorerst nicht mehr sehen, alle drei nicht. Sie sollen um meine Gunst betteln. Das werden sie nämlich nötig haben nach unserem Sieg. Ich bin hier der Herr." Er hielt die markige Rede vor allem für sich selbst, denn dass er Johannes damit nicht beeindrucken konnte, das wusste er. Der Dominikaner verfügte über eine unerschütterliche innere Zuversicht. Selbst ein Unglück wie die Schlacht am Hemmelskamper Wald vermochte ihn nicht aus dem Gleichgewicht zu werfen. Nach seiner Überzeugung vollzog sich alles auf Erden nach Gottes ehernem Plan. Der Allmächtige hatte im ersten Kreuzzug nicht die aufrührerischen Bauern belohnt, sondern die verdorbenen Wildeshausener bestraft. Nun, da die Arbeit verrichtet war, konnte er das einstige Werkzeug zerbrechen. Beide Männer schwiegen eine Zeitlang. Dann lenkte Johannes das Gespräch auf einen anderen Gegenstand: "Der neue Generalinquisitor hält sich in der Stadt auf?" "Ja. Er traf vor zwei Tagen ein." "Ihr hattet schon eine Gelegenheit, mit ihm zu reden?" "Wir sprachen über den bevorstehenden Kreuzzug. Der Heilige Vater wünscht gewisse Einzelheiten zu erfahren." Johannes zog die Augenbrauen hoch. "Eine weitere Untersuchung? Ich glaubte, Gregor habe sich inzwischen zur Genüge von der Ketzerei der Stedinger überzeugt." Gerhard strich sich ein wenig ratlos übers Kinn. "Ich kenne Konrads Auftrag nicht genau." "Was haltet Ihr von ihm? Er trägt denselben Namen wie sein Vorgänger, der Märtyrer - Konrad von Marburg, Konrad von Hildesheim. Nomen est omen?" "Ihr solltet Euch Eure Meinung aus eigenem Erleben bilden. Ich habe ihn eingeladen. Er müsste bald hier sein." Tatsächlich meldete ihn ein Diener wenig später an. "Herr Konrad von Hildesheim, Generalinquisitor seiner Heiligkeit Papst Gregor IX." Auf den ersten Blick wirkte der neue Konrad weit weniger forsch als der sprichwörtlich gnadenlose Marburger. Langsam, fast zögerlich trat er ein. Dann verharrte er einen Moment, als wisse er nicht, wie ein Erzbischof zu begrüßen sei. Auch von Statur her war er eher ein Kaufmann als ein Ritter. Das alles stimmte Johannes skeptisch, doch ließ er sich nichts anmerken. "Ich hoffe, Ihr konntet den Tag im Sinne Eures Auftrages nutzen." "Ich bin an keinen besonderen Auftrag gebunden. Allerdings fand ich vieles vor, was mich erfreute. Das werde ich vor Seiner Heiligkeit nicht unerwähnt lassen." "Darf ich fragen, worauf Ihr anspielt?" "Auf den Kreuzzug selbstverständlich. Ich bin beeindruckt vom Eifer Seiner Eminenz bei der Bekämpfung der Ketzerei. Mancher hätte nach der schweren Niederlage im ersten Krieg sein Vertrauen in Gottes Gerechtigkeit verloren." In seine Augen kam Feuer. "Die Nachwelt wird es Euch danken. Ungeheuerlich wären die Folgen, bliebe der Sieg jener auf Abwege geratenen Bauern unwidersprochen." Johannes tauschte einen kurzen Blick mit Gerhard. Konrad von Hildesheim war also doch aus dem gleichen Holz geschnitzt wie sein Vorgänger. Der Erzbischof wagte nun, etwas offener zu reden. "Haltet Ihr es für möglich, dass dem Kreuzzug noch etwas im Wege stehen könnte." "Wenn es so sein sollte, dürft Ihr, Eminenz, Euch davon nicht beeindrucken lassen." In diesem Moment kam abermals der Diener herein. "Eine Abordnung des Rates der Stadt." Gerhard zog unwillig die Stirn in Falten. "Was wollen diese Leute schon wieder? Sie sollen warten." Dann überlegte er es sich anders und rief den Diener zurück. "Nein, später habe ich erst recht keine Zeit. Mögen sie gleich hereinkommen." Gottfried verneigte sich ehrerbietig, in seinen Augen aber spiegelte sich bereits ein gewisses Maß an Gereiztheit. "Eminenz, Ihr hattet uns vor Jahresfrist vertraglich zugesichert, uns sämtliche Burgen an der Weser von Hoya bis ans Meer zu übergeben. Nur mit der Hälfte von ihnen ist das bislang geschehen. Die Besatzungen der Euch noch immer unterstehenden Bollwerke schikanieren und behindern unsere Schiffe. Wir bitten Euch ..." "Will der Rat andeuten, dass ich mich an abgeschlossene Verträge nicht halte? Die Gründe für die Verzögerungen nannte ich bereits vor zwei Wochen." Durch Gottfrieds Körper ging ein Beben. Für einen Moment sah es so aus, als wolle er mit geballten Fäusten auf den Kirchenfürsten losgehen. Dieser aber blieb völlig unbeeindruckt. Herrisch stand er da, wie eine steinerne Figur. Der Abordnung blieb nichts anderes übrig, als sich einmal mehr mit vagen Versprechungen abspeisen zu lassen. Johannes und Konrad befürworteten die strenge Haltung. 204 "Die Bürgerlichen müssen eine harte Hand im Nacken spüren, sonst werden sie übermütig", meinte der Bischof. Der Generalinquisitor wollte Genaueres wissen über jenen Vertrag. "Diesen Brocken habe ich ihnen hingeworfen, damit sie sich dem Kreuzzug anschließen", antwortete der Erzbischof. "Aber ich bin enttäuscht von ihnen. Das ist die Art der Krämer sie begehren alles und wollen nichts geben dafür." "Insofern braucht auch Ihr Euch nach den Vereinbarungen nicht bis in die letzte Einzelheit hinein zu richten", schloss Konrad. Im weiteren Verlauf des Nachmittags stellten die drei Kirchenmänner immer mehr Gemeinsamkeiten in ihren Ansichten und Zielen fest. Der letzte Rest Misstrauen gegenüber dem Abgesandten des Papstes verschwand. 205 18.Kapitel I D as Land war flach wie das Watt, doch mittendrin ragte kegelförmig ein Berg auf. So sonderbar, wie er in dieser Gegend insgesamt wirkte, mutete auch sein Gipfel an. Drei Gebilde standen dort, die das Sonnenlicht grell zurückwarfen. Ihre Form ließ sich aus der Ferne nicht bestimmen, doch mit Phantasie konnte man sie für die drei Golgatha-Kreuze halten. Mitten durch eine öde Landschaft, in der nur einige wenige Dörfer sich verloren, zog sich, nahezu schnurgerade, eine erstaunlich gut ausgebaute Straße. Auf dieser fuhren fünf prächtige Kutschen, die - den Wappen an den Türen nach bedeutenden Fürsten gehörten. Offenbar hatten es die Herren eilig, denn die Kutscher trieben ihre Pferde mit Peitschenknallen an. Am Fuße des Berges verschmälerte sich die Straße und verlor sich schließlich in der Wiese. Da außerdem der Hang steil anstieg, konnten die Pferde ihre Last nicht mehr ziehen und die Männer mussten den Weg, gegen ihre Gewohnheit, zu Fuß fortzusetzen. Erstaunlicher Weise nahmen sie die Strapazen bereitwillig auf sich. Während sie (zumeist auf Händen und Füßen kriechend) ihre fülligen Leiber Meter um Meter nach oben schleppten, verfärbten sich ihre Gesichter dunkelrot und über die Stirnen rann der Schweiß. Als sie dem Ziel ganz nahe waren, erwiesen sich die drei Figuren als vergoldete Skulpturen, was die Männer aber nicht störte. Im Gegenteil! In ihre Augen trat der Ausdruck wilder Gier und ihre Gesichter verzerrten sich zu bösartigen Fratzen. Vor ihnen tauchte unterdessen ein behaartes Wesen auf mit Hörnern auf dem Schädel und einem langen Quastenschwanz am Hintern. "Hebe dich hinweg, Satanas!" schrie der Papst und fuhr hoch von seinem Lager. "Zurück in die Hölle mit dir, hinterhältiger Versucher!" Er erwachte endgültig und beruhigte sich. Ein Traum hatte ihn genarrt. Niemals würde sich der Teufel leibhaftig in die Gemächer des Heiligen Vaters wagen! So rief er denn nach seinen Dienern und begann ohne Hast sein normales Tagewerk. Allerdings gingen ihm die Visionen der Nacht nicht aus dem Sinn. Sooft er Zeit zum Nachdenken fand, erinnerte er sich wieder daran. Hatte womöglich Gott, der Allmächtige, über den Traum mit ihm gesprochen? Um sicher zu gehen, nahm er einen Priester beiseite und beriet sich mit ihm. "Könnte es sein, dass in der Geschichte eine Botschaft verschlüsselt ist?" "Ja, das halte ich für möglich. Jene Fürsten erweckten den Anschein, als strebten sie dem gekreuzigten Heiland zu, begehrten in Wahrheit aber das Goldene Kalb. Vielleicht soll der Traum Euch, Heiliger Vater, vor falschen Frömmlern warnen. Manche Leute umschmeicheln Euch und prahlen selbstgefällig mit ihren Taten für Gott, womit sie nichts anderes beabsichtigen, als ihre Gier nach Reichtum und weltlichen Genüssen zu überdecken. Konntet Ihr einen der Herren erkennen?" "Nein, leider nicht." Das stimmte nicht ganz. Die Männer hatten sehr wohl Gesichter besessen, Gregor konnte sich nur nicht mehr erinnern. Erst beim Zubettgehen wurden die Bilder in seinem Kopf wieder klarer, so als löse sich ein Nebel vor ihnen auf. Einer der Fürsten war ganz sicher ein Erzbischof aus dem Norden Deutschlands. Nach und nach erstand die ganze Angelegenheit vor ihm. Die Bauern, die keinen Kirchenzehnt mehr entrichteten und angeblich Priester misshandelten. Gerhard II von Bremen, der einen Kreuzzug gegen sie unternommen und eine Niederlage erlitten hatte. Der Herzog von Brabant, der sich seit einigen Monaten mit verwunderlichem Eifer für die Ausmerzung der Ketzerei an der Weser einsetzte. Ist das die Botschaft des Traumes? Sind Gerhard und seine Anhänger jene Leute, die sich gottesfürchtig geben und dabei selbstsüchtig nur ihre eigenen Ziele verfolgen? Gregor hatte einem neuerlichen Kreuzzug bereits seine Zustimmung erteilt. Nun kamen ihm Bedenken. Vielleicht war alles ganz anders, als er (den Berichten vertrauend) bisher glaubte. Er stellte sich eine Räuberbande vor, die sich erst gemeinsam auf ein Opfer stürzt und dann in Streit um die Beute gerät. Der Sieg der Bauern, eine Frucht der Gier ihrer Gegner? Gregor mochte diese Stedinger nicht. Ganz bestimmt hatten sie sich der Ketzerei schuldig gemacht. Doch man darf den Teufel nicht mit dem Beelzebub austreiben. Unvorstellbar die Folgen einer abermaligen Niederlage binnen eines Jahres! Der Papst entwarf einen eigenen Plan. Durch Verhandlungen beruhigt sich die Lage. Ein Vertrag regelt das Verhältnis zwischen den Bauern und dem Erzbischof. Allmählich verschwindet das Misstrauen und es ist wieder möglich, in den Dörfern zu missionieren. Die Dominikaner werden auf ihre besondere Aufgabe sorgfältig vorbereitet. Sie gewinnen die Herzen der Bauern und trennen allmählich die Unverbesserlichen von den Belehrbaren. Hinrichtungen kommen nur ausnahmsweise vor, so dass sie abschrecken ohne zum Aufstand zu reizen. Dies war die Lehre aus den schrecklichen Albigenserkriegen. Die Kämpfe hatten damals im Süden Frankreichs ganze Landstriche verwüstet und dem Ansehen der Kirche schweren Schaden zugefügt. Noch immer mussten die Brüder aus den Orden der Franziskaner und der Dominikaner unendlich viel Geduld aufbringen, um das Zerstörte neu aufzubauen. Gewalt allein ist im Ringen um die Reinheit des christlichen Glaubens ein schlechtes Mittel, zumal wenn sie ohne Aufsicht von weltlichen Herren angewendet wird. Gregor wusste, dass ihm seine Bedenken spät kamen, wahrscheinlich zu spät, um den Krieg noch zu verhindern. Immerhin aber brach sein Legat in diesen Tagen planmäßig in die deutschen Lande auf, um Verhandlungen zu verschiedenen Gegenständen zu führen. Bei dieser 207 Gelegenheit sollte er sich mit dem Erzbischof von Bremen in Verbindung setzen und den Kreuzzug verbieten. Der Bote erreichte den Würdenträger am nächsten Morgen buchstäblich im letzten Moment. Sein Wagen stand bereits am Tor und der Kutscher redete mit den Wächtern. Und er war nicht erfreut über den Auftrag. Schon beim Überfliegen des Schreibens erkannte er das Undankbare an dem Unterfangen. "Ich werde tun, was ich kann", erklärte er lakonisch. Im selben Moment setzte sich die Kutsche wieder in Bewegung und rumpelte unter dem Torbogen hindurch hinaus aus der Stadt Rom. II H einrich der Bogener ritt über die Dörfer, um nach dem Rechten zu sehen. Seit jenen unglückseligen Tagen, die er in den Geheimgängen seines Schlosses zugebracht hatte, auf der Flucht vor seinen eigenen Untertanen, war es erstaunlich ruhig um ihn geworden. Die Aufrührer gehörten inzwischen zum Kreuzzugsheer Heinrichs III von Bruchhausen und es hieß, dass sie auch dort unangenehm auffielen. Unter den Rittern und Höflingen von Wildeshausen hatte sich (ohne Eingreifen des Grafen) eine vom Burgvogt geführte Gruppe durchgesetzt. Heinrich der Bogener war klug genug gewesen, sich mit diesen Leuten gut zu stellen. Dabei verzichtete er zwar endgültig auf einen Teil seiner Autorität, erreichte aber stabile Verhältnisse, wie sie selbst zu Zeiten seines Vaters niemals geherrscht hatten. Während einige wenige Familien sich weiterhin nach Belieben bereichern konnten, mussten alle anderen notgedrungen nun wieder ehrlich leben. Die Speicher füllten sich. In die Schatzkammer kehrten wie von Geisterhand spurlos verschwundene Gegenstände zurück. Völlig zufrieden war der Graf natürlich nicht, denn er fühlte sich zuweilen wie eine Puppe in der Hand eines mutwilligen Kindes. Er wusste nicht einmal so genau, wer in Wahrheit das Sagen hatte. Dass der Burgvogt ihm gegenüber als Führer und Sprecher der Gruppe auftrat, besagte nicht alles. Viele Gerüchte gingen um. Einige Diener behaupteten, die herrische Gemahlin des Burgvogts ziehe heimlich die Fäden. Heinrich der Bogener war zu klug, um sich auf den Frieden zu verlassen. Aber er genoss seine Wiederauferstehung. Agnes von Westerholt begleitete ihn, so wie sie es häufig tat. Wilbrand war inzwischen für tot erklärt worden. Das brachte ihr zwar gewisse Einschränkungen, weil sie nun als Witwe galt, eröffnete ihr aber die Möglichkeit, eines Tages rechtmäßige Gräfin zu sein. Leider empfand Heinrich eine abergläubische Scheu vor der Ehe. "Wenn ich dich heirate, wirst du bald sterben", versicherte er ihr, sobald sie ihn darauf vorsichtig ansprach. Auch die Höflinge, von denen er abhing, missbilligten den Plan. Sie drängten den Grafen vielmehr zu einer gewinnbringenden Partie. Somit ruhten die Hoffnungen der jungen Frau in erster Linie auf einer Schwangerschaft. In unzähligen Gebeten schon hatte sie Gott und alle Heiligen um ein Kind angefleht. Bisher vergebens! Allmählich beschlich sie die Angst vor der Unfruchtbarkeit. Sollte sie durch solch ein Unglück kurz vor ihrem großen Ziel 208 scheitern? Doch nein, das mochte sie nicht glauben! Sie war entschlossen, den lieben Gott buchstäblich zu belagern. Nicht zum ersten Mal hatte sie durch Hartnäckigkeit das scheinbar Unmögliche schließlich noch erreicht. "Es ist nicht zu trocken und nicht zu feucht", sagte Heinrich, während er den Blick schweifen ließ. "Wenn das so bleibt, werden wir eine gute Ernte haben." Die Saat des Hafers auf den Äckern zu ihrer Rechten war bereits abgeschlossen. Gegenüber bestellten fünf Bauern ein Feld mit Gerste. Als sie den Grafen sahen, verneigten sie sich kurz und setzten ihre Arbeit dann fort. "Gott hat genügend Plagen über Wildeshausen ausgeschüttet", sagte Agnes. "Nun sind die Verfehlungen der Vergangenheit gesühnt." "Den sieben mageren Jahren folgen die sieben fetten." In diesem Moment zog eine Staubwolke seine Aufmerksamkeit an. Sie stieg hinter einem Dorf auf und ließ sich durch nichts erklären. "Was ist das?" rief Heinrich. Agnes hob die Schultern. Bald aber erkannten die beiden gepanzerte Männer, die über ein frisch bestelltes Feld ritten und es dabei verwüsteten. Einem ersten Trupp folgte ein zweiter. Dahinter am Horizont zeigte sich ein dritter. Ein ganzes Heer rückte heran. "Was haben diese Leute in meinem Herrschaftsbereich zu suchen?" rief der Graf. "Ich lebe mit niemandem in Fehde." Unterdessen hatte der erste Trupp das Dorf erreicht. Ob die Bauern sich widersetzten, war schwer zu sagen. Vermutlich beugten sie sich der rohen Gewalt. Heinrich indes packte der Zorn und er gab seinem Pferd die Sporen. "Bleibe du hier! Ich werde diese Gesellen zur Rede stellen." Agnes überhörte absichtlich, dass sie zurückbleiben sollte, und folgte ihm in einem gewissen Abstand. Vor dem Ettertor beluden vier Männer einen behelfsmäßig gebauten Wagen mit Mehlsäcken und riefen sich dabei kecke Sprüche zu. Den heranpreschenden Heinrich beachteten sie zunächst nicht. Selbst als er sie ansprach, ließen sie sich in ihrer Beschäftigung nicht stören. "Woher stammt dieses Mehl?" wiederholte der Graf seine Frage mit drohendem Unterton. Einer der vier bequemte sich zu einer beiläufigen Antwort. "Das ist zur Versorgung der Truppe beschlagnahmt. Uns trifft keine Schuld. Wir führen hier nur Befehle aus." "Befehle? Wer befielt dergleichen in einem meiner Dörfer?" "Adolf von Berg." Heinrich folgte dem Fingerzeig und fand in der Nähe des Angers die beiden Feldherren des rheinischen Kreuzzugsaufgebots Adolf VII von Berg und Dietrich von Cleve. "Veranlasst sofort, dass die Bewaffneten die Gegend verlassen!" brüllte er, ohne sich mit Grußformeln aufzuhalten. "Ihr seid mit Euren Leuten ohne meine Erlaubnis in mein Land eingedrungen. Ich sehe Euch als Feind an und werde mich entsprechend verhalten." Die beiden wandten sich ihm zu und betrachteten ihn einen Augenblick lang sehr verwundert. Sie schienen darüber zu rätseln, warum er in solche Erregung geraten war. "Hinter uns liegt ein beschwerlicher Marsch" sagte Dietrich dann. "Wir brauchen Verpflegung." "Nicht aus meinem Dorf." "Woher sonst? Selbstverständlich wird Euch der entstehende Schaden ersetzt. Wir sind doch keine Räuber." "Auf die lächerliche Entschädigung verzichte ich. Verschwindet! Sonst 209 werdet ihr die Schwerter meiner Leute zu fühlen bekommen." "Ihr seid allem Anschein nach ein ungestümer junger Mann, aber für derart dumm halte ich Euch denn doch nicht." Heinrich biss die Zähne aufeinander und war zum Äußersten entschlossen. Mit blankem Schwert trat er auf einen Ritter zu, der gerade eine Tür aufbrechen wollte. "Fort hier oder ich spieße dich auf wie eine Wildsau!" Der Mann prallte vor Überraschung zurück. "He, lass mich in Frieden! Bist du überhaupt einer von uns?" Er vergaß, dass er ebenfalls eine Waffe trug. Das vor Wut verzerrte Gesicht des Grafen beeindruckte ihn sichtlich. Einige seiner in der Nähe stehenden Kumpane waren weniger ängstlich, bildeten einen Halbkreis und drohten: "Störe uns nicht und mache uns nicht wütend - oder du siehst bald durchlöchern wie ein Stück Käse aus." "Wohlan! Dann versucht es, mich zu durchlöchern!" Die Mischung aus Zorn und Ohnmacht ließ ihn, der vor kurzem vor seinen widersetzlichen Bauern in den Geheimgang geflüchtet war, plötzlich tollkühn werden. Vermutlich hätte er tatsächlich nicht eher geruht, bis er ein Märtyrer seiner maroden Grafschaft geworden wäre. Doch abermals geschah etwas Überraschendes. Eine junge Frau warf sich zwischen die Schwerter und verhinderte den Kampf. Die Waffenknechte waren normalerweise nicht zimperlich. Der Kleidung nach hatten sie es aber mit einer Herrin zu tun und ein gewisses Maß an ritterlichem Anstand gebot sich während eines Feldzuges zu Ehren des Heilands. Jemand bemerkte unbeholfen: "Das ist gefährlich! Wir hätten Euch verletzen können." Agnes sah nicht nach links und nicht nach rechts. Sie packte den verdutzen Heinrich am Arm und zog ihn hinter sich her aus der Belagerung. Dabei kam er wieder zur Vernunft. Beide schwangen sich auf ihre Pferde und galoppierten zum Tor hinaus. Da platzte es aus Agnes heraus: "Bist du nicht mehr bei Verstand? Wolltest du allein ein ganzes Heer besiegen?" "Entschuldige! Der Zorn hat mich überwältigt." "Und was tun wir jetzt?" "Wir reiten zum Schloss. Wenigstens das soll ihnen nicht in die Hände fallen." Sofort nach seiner Ankunft veranlasste Heinrich der Bogener die Vorbereitung zur Verteidigung. Die Höflinge standen dabei uneingeschränkt auf seiner Seite, denn immerhin lagerten im Schloss auch ihre eigenen Reichtümer. Leider standen nur wenige Männer zur Verfügung. Die schweren Steinschleudern, die vergessen in einem Winkel des Vorburghofes verrotteten, waren unbrauchbar. Man hätte rechtzeitig die durchgerosteten Beschläge erneuern müssen. Der Graf schlug vor, nur die Oberburg zu halten und die vor gelagerten Abschnitte kampflos aufzugeben, setzte sich damit jedoch nicht durch. "Dann erkennen sie unsere Schwäche!" warnte jemand. "Wir sollten Holzfiguren auf die Mauern stellen, um sie zu täuschen," schlug ein anderer vor. Noch ehe eine Einigung über die Taktik erzielt war, trafen die Kreuzfahrer aus dem Rheinland vor den Mauern ein. Dabei trat die tatsächliche Größe des Heeres zutage. Reiter und Fußvolk zusammengerechnet, bestand es aus annähernd tausend Mann. Wer 210 sich mit dieser Streitmacht anlegen wollte, musste gut gerüstet sein. Für die Wildeshausener traf das nicht zu. Dennoch lehnte Heinrich, noch immer wütend über die erlittene Demütigung, erst einmal ab, als Dietrich von Cleve Zuwendungen aus den Speichern des Schlosses verlangte. Nicht einmal auf einen verhältnismäßig günstigen Handel ließ er sich ein. So nahm die Belagerung ihren Fortgang. Mit Leichtigkeit riegelten die Rheinländer die Tore ab. Fast spielerisch eroberten sie dann die ausgedehnte Unterburg. Trotz aller Täuschung der Verteidiger waren sie sich ihrer Sache sicher. Doch die Einnahme des gesamten Schlosses planten sie gar nicht. Ohne sich anzustrengen, warteten sie ab, wie sich alles zu ihren Gunsten entwickelte. Der Graf zierte sich lange, stand aber allein da, seit die Höflinge von dem Angebot der Kreuzfahrer wussten. Das Getreide zu verkaufen, war ihnen recht, zumal sie hofften, sich das Geld später in die eigene Tasche stecken zu können. Heinrich bekam Tag und Nacht Schauergeschichten über die Gegner erzählt. Diese Leute seien zu allem fähig. Ein Blutbad würden sie anrichten und sich dann viel mehr nehmen, als sie bislang forderten. Schließlich gab er nach. Die Kreuzfahrer verschwanden wieder aus der Umgebung des Schlosses. Für das weitere Umland indes war der Spuk noch längst nicht vorbei, denn die Feldherren erkannten schnell, dass ihnen hier niemand ernsthaft die Stirn bieten konnte. Wenn sie etwas benötigten, bedienten sie sich in den Dörfern. Sie forderten Tribut wie in einem besetzten Land. Nicht einmal kirchliche Einrichtungen waren sicher. Der Abt des Klosters von Rastede beklagte sich bitter beim Bremer Erzbischof. Der beeilte sich, eine großzügige Entschädigung zu zahlen, um einer Beschwerde beim Papst vorzubeugen, dessen Legat sich angemeldet hatte. Am Grundübel änderte das nichts. Der Feldzug, der vorgeblich den Märtyrer Burchard rächen sollte, ruinierte zuerst die Grafschaft Wildeshausen. III R uhm und ein langes Leben unserem Feldherrn!" brüllte Arnold von Gavre. Seine Stimme war schon deutlich verändert von den Ehrungen der zurückliegenden Stunden. Auch den Bethune-Brüdern hatte der Wein zugesetzt. Während sie sich erhoben, stützten sie sich gegenseitig. Nur Heinrich III hielt noch immer wacker durch. Vermutlich war seine Trinkfestigkeit diejenige seiner Eigenschaften, die ihm am ehesten den Respekt der Holländer verschaffte. Über diese wenig schmeichelhafte Erklärung mochte er aber nicht nachdenken. Da hörte er lieber auf die Sprüche, welche die Männer ihm widmeten. Sogar gereimte Hymnen gab es darunter, holperig und ziemlich inhaltsleer, doch nicht ohne einen gewissen urwüchsigen Charme, wie er fand. "Unser Heinrich schlägt den Ketzern den Schädel ein, ja, jucheh, so wird es sein." Arnold ließ sich schwer auf die Bank zurück fallen und legte dem Grafen einen Arm um die Schultern. Er gehörte zu jener Sorte von Menschen, die von einem gewissen Grad der Betrunkenheit an ein unbezwingliches Bedürfnis nach Zuwendung verspüren. 211 "Du bist ein Freund. Ich sage das nicht zu jedem. Eigentlich kann ich die Deutschen nicht leiden. Aber, du, du bist ein Freund." Am anderen Ende der Tafel war die Stimmung weniger brüderlich. Dort saßen unter anderen die Söhne des Grafen, denen das Treiben ringsum Unbehagen bereitete. In Arnold von Gavre und den Bethune-Brüdern sahen sie Konkurrenten. Diese drei Fremden hatten sie buchstäblich von der Seite des Grafen gedrängt. Mit welchem Recht? Beide zweifelten stark daran, dass die Adligen aus dem Bremer Umland gegen die Stedinger überhaupt auf Hilfe angewiesen waren. Aber selbst im Falle, dass es sich so verhielte, hatten die Ankömmlinge die verdammte Pflicht, die Sitten der Gastgeber zu achten und sich unterzuordnen. Stattdessen gebärdeten sie sich, als seien sie selbst nun die Herren. "Das sind ja sonderbare Gestalten, die da in Flandern das Kreuz ergriffen haben." "Diebe und Räuber, denen zu Hause der Boden unter den Füßen heiß geworden ist. Sieh sie dir doch einmal genau an! Von denen würdest du keinem dein Kind anvertrauen." "Das nenne ich sauber! Die Holländer knüpfen die Verbrecher nicht auf so wie wir, sondern schicken sie in Christi Namen in andere Länder." Die beiden taten sich keinen Zwang an und störten sich auch nicht daran, dass die Geschmähten jedes ihrer Worte verstehen konnten. Die zunehmend finsteren Gesichter spornten sie sogar noch an. Im Grunde legten sie es regelrecht an auf eine handfeste Auseinandersetzung. "Sie fallen über die Dörfer her wie einstmals Etzel mit seinen Hunnen." "Schlimmer noch." Nicht ganz einig waren sie sich bei den betroffenen Orten. Aber deswegen stritten sie sich nicht. Nun, diese Halunken räuberten und vergewaltigten halt überall, wohin sie kamen! Irgendwann war einer der Fremden mit seiner Geduld am Ende. "Nehmt das sofort zurück!" brüllte er schräg über die Tafel hinweg. "Die beschlagnahmte Wurst werden wir bezahlen und vergewaltigt haben wir niemanden." Ludolfs Antwort ließ nicht lange auf sich warten. "Fehlt euch Jammerlappen der Mut, eure Schandtaten einzugestehen?" Der andere sprang mit flammendem Blick auf und riss dabei einen Teil der Tafel um. Drei Becher flogen durch die Luft. Diejenigen, über die sich der Weinregen ergoss, waren sofort bereit, sich an der entstehenden Prügelei zu beteiligen. Ehe die Feldherren begriffen, was ihnen gegenüber vor sich ging, wirbelten bereits die Fäuste. Ludolf hatte zunächst gewisse Vorteile, weil er so ungestüm wie kein anderer zuschlug. Seine Lage verschlechterte sich aber drastisch, als sich die von ihm Getroffenen voller Verbitterung gegen ihn zusammenschlossen. Ein satter Hieb in den Magen nahm ihm die Luft. In einem Moment der Unaufmerksamkeit ging seine Nase in Trümmer. Das wiederum wollte Heinrich der Jüngere nicht ungesühnt lassen. In diesem Fall überdeckte der Familiensinn alle Rivalität mit dem Bruder. "Alle Bruchhausener zu mir!" rief er. Bald waren wenigstens zehn Männer auf jeder Seite in die Schlägerei verwickelt. Und das Handgemenge drohte auszuarten. Beide Parteien fühlten sich in ihrer Ehre verletzt. Norddeutschland gegen Holland, so lautete nun das Motto. Zum Glück hatte niemand eine eiserne Waffe in Reichweite. Allerdings waren einige auf den Einfall gekommen, die Tafel zur Herstellung von Knüppeln zu zerlegen. 212 Wollten die Heerführer verhindern, dass ihre Leute sich vor der Schlacht schon gegenseitig dezimierten, mussten sie schleunigst eingreifen. Die BethuneBrüder waren dabei keine Hilfe. Sie regten sich über den Lärm auf, begriffen aber nicht einmal, woher er kam. Arnold von Gavre hingegen schien plötzlich wieder nüchtern geworden zu sein. "Wollt ihr wohl aufhören, ihr Höllenhunde!" brüllte er. Dabei warf er sich mutig zwischen die Streithähne. Der Graf von Bruchhausen unterstützte ihn. "Benehmt euch anständig! Was sollen unsere Gäste von uns denken?" Allmählich gelang es den beiden tatsächlich, Frieden zu stiften, und Arnold vermochte sich noch zu einer kurzen Ansprache aufzuraffen. "Denkt an die Beute! Sie wird gewaltig sein und alle Verluste mehr als ausgleichen." Sein Bedürfnis nach Harmonie brach wieder durch. Er war sich nicht zu schade, zu einem Dutzend Bruchhausener Rittern persönlich zu sprechen. Mit feuchten Augen trat er vor sie hin und nötigte sie, mit ihm anzustoßen. Ludolf wollte sich der trunkenen Anbiederei mit einer spitzen Bemerkung entziehen. Ein strenger Blick seines Vaters indes hinderte ihn daran. Wirklich beseitigt waren die Gegensätze nicht. Die Angehörigen der verschiedenen Heere gingen einander aus dem Wege. Die zertrümmerte große Tafel wurde ersetzt durch zwei kleinere, eine für die Bruchhausener, eine für die Holländer. Über den Zwischenraum wanderten giftige Blicke hin und her. Heinrich der Jüngere und Ludolf beruhigten sich erst, als sie aufgefordert wurden, noch einmal über die Neuigkeiten aus Bremen zu berichten. "Ihr wart also gestern in der Stadt und habt den päpstlichen Legaten gesehen?" "Richtig. Als wir am Palast ankamen, fuhr er gerade mit seiner Kutsche davon, und für einen Moment konnten wir sein Gesicht erkennen." Ludolf ergänzte seinen Bruder: "Er hatte schlechte Laune, sehr schlechte Laune." "Und von einem Diener wissen wir, dass die Fetzen geflogen sind", nahm Heinrich den Faden wieder auf. "Gerhard soll gebrüllt haben wie ein Besessener." "Und der Legat hat tatsächlich im Namen des Papstes den Kreuzzug verboten?" "Ja, das hat er. Aber Gerhard wird sich an das Verbot nicht halten." "Dafür kann ihn der Papst seines Amtes entheben." "Kann er, wird er aber nicht. Damit würde er nämlich die Ketzer aller Herren Länder rebellisch machen." Obwohl keiner der Männer Papst Gregor je gesehen hatte, beharrten alle auf ihrer Meinung über ihn und sein künftiges Verhalten. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf sich die Bruchhausener beinahe noch untereinander in die Haare geraten wären. 213 19.Kapitel I G raf Otto wirkte etwas sonderbar zwischen den vollständig gerüsteten und schwer bewaffneten Rittern, die auf dem Hof von Schloss Oldenburg zum Aufbruch bereit neben ihren Streitrössern standen. Seit seinem schon beinahe legendären Sieg über die Stedinger kam jedoch niemand mehr auf den Einfall, über ihn zu lachen. Selbst, dass es ihm beim Befehlen an Stimmgewalt mangelte, tat seiner Autorität keinen Abbruch. Wenn er redete, herrschte völlige Stille. Wer trotzdem nichts verstand, erkundigte sich hinterher nach allen Einzelheiten. "Ihr verstärkt die Kette am Zwischenahner Meer. Nikolaus von Manste führt das Kommando. Leider weiß ich nicht, ob das Heer aus Brabant schon bis dorthin vorgedrungen ist. In jedem Fall müsst ihr euch klug verhalten. Ihr dürft den Kreuzfahrern nicht den Durchzug verweigern. Ihr habt aber das Recht, gegen Plünderungen und Übergriffe mit aller Härte vorzugehen. Wenn sie irgendetwas dringend benötigen, sollen sie dafür reichlich bezahlen." Die Ritter schlugen mit dem Schwert gegen den Schild zum Zeichen, dass sie entschlossen waren, ihrem Lehnsherrn unter Einsatz ihrer ganzen Kraft zu dienen. Dann ließen sie sich von ihren Knappen in den Sattel heben und trabten polternd vom Hof über die beiden Zugbrücken an der Hunte. Otto blickte ihnen nach und fühlte sich nicht gut dabei. Zum einen fürchtete er einen Zusammenstoß mit den Kreuzfahrern, zum anderen schämte er sich eines Hintergedankens. Er ging davon aus, dass die Holländer auf ihrem Marsch bis an den Rand des Stedingerlandes immer den Weg des geringsten Widerstandes wählen würden. Am Zwischenahner Meer, weitab von größeren Ortschaften, winkte ihnen keine nennenswerte Beute. Der Aufmarsch der Oldenburger Streitmacht reichte vermutlich, sie am Durchzug zu hindern. Natürlich würden sie dann einen anderen Weg benutzen. Beschämt erinnerte sich der Graf an jenes bösartige Gebet, welches den heiligen Florian zum Anzünden des Nachbarhauses ermunterte. Doch er trug in erster Linie die Verantwortung für seine Grafschaft - mit ihren Feldern, Dörfern und Menschen. Die Umgebung der Oldenburg sah aus wie mitten im Krieg. Otto ahnte, welche Gefahr da von Westen her drohte, und hatte buchstäblich jeden verfügbaren Mann aufgeboten. Am Zwischenahner Meer wartete ein ganzes Heer. An den anderen, für gepanzerte Reiter und Belagerungsgeräte geeigneten Straßen wachten Gruppen von fünf bis zehn Rittern und noch einmal doppelt soviel Fußvolk. Diese Gruppen standen über berittene Kuriere miteinander in Verbindung. Falls es irgendwo zu Schwierigkeiten kam, ließ sich rasch ein zweites Heer zusammenziehen. Einige Meilen vor Oldenburg schließlich sollte in zwei Tagen eine Art Schild für den äußersten Notfall aufgespannt werden. Für dieses dritte Heer waren vorerst nur wenige Männer vorgesehen. Aus den im Falle einer Niederlage zurückflutenden Teilen der anderen Heere ließ es sich aber deutlich vergrößern. Während Otto noch auf dem Hof stand und zum Tor hinüber blickte, das gerade wieder verriegelt wurde, legte ihm jemand die Hand auf die Schulter. Erschrocken fuhr er herum, lächelte aber dann, weil er seine Frau erkannte. Mechthild war für ihn in diesen Tagen besonders wertvoll, denn sie kümmerte sich fast allein um den Alltag im Schloss und um die wirtschaftlichen Fragen der Grafschaft. "Die Männer, die du gerade verabschiedet hast, reiten zum Zwischenahner Meer, nicht wahr?" "Ja. Damit ist das Heer dort vollständig. Ich fürchte aber, dass der Herzog von Brabant sich beim Erzbischof beschwert." "Gerhard weiß, dass wir unsere Lehnsleute zu den Waffen rufen, und er gab uns dafür ausdrücklich seinen Segen." Otto musste lachen. "Jetzt machst du einen Scherz! Gerhard glaubt, dass wir für den Kreuzzug rüsten. Wie wollen wir ihm erklären, dass unsere Ritter nicht an der Grenze zum Stedingerland stehen sondern genau auf der anderen Seite? Wollen wir sagen, dass sie sich in ihrer Heimat verlaufen haben?" "Er weiß bestimmt längst, was hier gespielt wird. Doch er kann vorläufig nicht viel gegen uns unternehmen, weil er seine Kräfte woanders braucht." "Und nach dem Sieg?" "Die Fremden sind eine Plage. Gerhard wird sie nach Hause schicken, sobald sie ihre Schuldigkeit getan haben. Wir hingegen sind dann immer noch stark." Otto blieb skeptisch. "Es haben schon bedeutendere Herren gemeint, dass sie stark seine - bis man sie eines besseren belehrte." "Wir können erwägen, was wir wollen - am Ende gelangen wir doch immer wieder zu denselben Ergebnissen." "Ja, damit hast du wohl Recht." Ein Ritter, den er durch einen Diener zu sich bestellt hatte, beanspruchte seine Aufmerksamkeit - Wilhelm von Westerholt. "Ich habe eine besondere Aufgabe für dich. Die Wardenburg ist bekanntlich noch immer in der Hand der Stedinger und dieser Umstand bringt uns vielleicht in Schwierigkeiten. Die Kreuzfahrer könnten auf den Einfall kommen, sie gewaltsam zu erobern. Wir müssten sie dann in unser Land lassen, mit allen Folgen." "Was genau soll ich tun?" fragte Wilhelm. Otto blickte ihn aufmerksam an. Die Frage war überflüssig, denn die Antwort lag auf der Hand. Der Graf wusste aber, dass die Burg von der Tochter des Ritters gehalten wurde. "Wir könnten die Burg selbst zurückerobern und den Holländern zuvor kommen." "Wenn Ihr mich für würdig und geeignet befindet, diese Aufgabe zu erfüllen..." "Wenn du lieber an einem anderen Platz stehen würdest, hätte ich dafür Verständnis." Der Vasall indes schüttelte energisch den Kopf. Da die Wardenburg nun einmal seine Burg sei, käme kein anderer in Frage, in ihr die alte Ordnung wiederherzustellen. Nur, was die Anzahl der benötigten Gefolgsleute betraf, erbat er sich Bedenkzeit. Wilhelm ließ sich seine Gefühle nicht anmerken, doch in seinem Innern brodelten sie umso mehr. Bisher, als die Dinge noch in der Schwebe waren, hatte er sich eingeredet: 'Da Franziska die Burg verwaltete, gibt es nichts zu befürchten! Komme ich zurück, wird sie mir sagen, was sich inzwischen ereignet hat, und einfach zurücktreten. Sie ist eine gehorsame Tochter.' Nun stiegen Zweifel in ihm auf. Er hatte wochenlang nichts mehr von ihr gehört. Vielleicht 215 war sie gar nicht so frei, dass sie ihm die Burg ohne weiteres übergeben konnte. Vielleicht hatten die Stedinger Macht über sie gewonnen und sie der Familie entfremdet. Wenn die Bauern aus dem Wesermarschland schlimme Ketzer waren, wie es der Erzbischof behauptete, wenn sie gar mit dem Teufel im Bunde standen, dann verfügten sie vielleicht auch über Magie. Sie könnten Franziska verhext haben. In seiner Verzweiflung wandte er sich an Martha, was er im Zusammenhang mit seinen Vasallenpflichten selten tat. "Ich muss doch meine Pflicht erfüllen!" sagte er. "Ja, das musst du", antwortete sie ihm. Dabei aber warf sie ihm einen langen Blick zu, der mehr offenbarte als ihr Mund. Am nächsten Morgen meldete er sich schon zeitig beim Grafen und erklärte, mit zehn Gefolgsleuten auskommen zu wollen. Otto zog erstaunt die Augenbrauen hoch. "Mit nur zehn Männern? Hast du bedacht, dass die Eroberung der Burg nicht misslingen darf?" "Jawohl, das habe ich bedacht. Ich bürge mit meiner Ritterehre dafür, dass ich Euch, Herr Graf, die Burg innerhalb der nächsten drei Tage zurückgewinne." Otto nickte. Er konnte sich nicht vorstellen, was Wilhelm plante, doch er vertraute ihm. Dass er für diese Angelegenheit weniger Männer bereitstellen musste, als eingeplant, kam ihm gelegen. "Gottes Segen sei mit dir und deiner Anhängerschaft!" sagte er, damit die endgültige Entscheidung fällend. "Du wirst noch heute aufbrechen." II E s gab Tage, da war Beatrice die leibhaftig gewordene Zumutung. Franziska fragte sich, woher ihre Launenhaftigkeit kam. Bei einer verwöhnten Prinzessin auf einem Schloss mit zahlreichen Räumen und Scharen von Dienstboten hätte sie das verstanden. Ihr Töchterchen aber war in einer Hütte mitten im Wald zur Welt gekommen. Hatte die Kleine vielleicht unter dem gelegentlichen Mangel gelitten? Nein, auch das nicht, denn Pentia war stets für sie da gewesen, so dass sie immer erhalten hatte, was sie brauchte - an Essen, Trinken und Kleidung und auch an Liebe. Aber es blieb nun einmal eine Tatsache, dass sich das Mädchen ungewöhnlich entwickelte. Franziska gelangte am Ende ihrer Überlegungen immer zu der Überzeugung, selbst der Schuldige zu sein. Dieser Gewissensbisse wegen war sie eine besonders geduldige und nachgiebige Mutter, was wiederum Beatrice nicht entging, und was sie gelegentlich schamlos ausnutzte. "Warum willst du den Brei nicht essen? Hast du keinen Hunger?" "Mag nicht!" krähte die Kleine und schüttelte energisch den Kopf. "Wenn du jetzt nichts isst, kriegst du später Hunger." "Mag nicht!" wiederholte Beatrice mit der Sturheit eines kleinen Tyrannen, der um seine Macht weiß. "Tu's mir zuliebe! Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du deinen Brei isst." Das Mädchen zögerte. Manchmal war der Mutter die eigene Tochter beinahe unheimlich. Kann ein so kleines Kind einen Erwachsenen bewusst demütigen und womöglich dann noch erwägen, wann es genug des bösen Spiels ist? 216 Viele hätten wohl empfohlen, den Trotzkopf mit ein paar Ohrfeigen zu überzeugen. Doch genau das brachte Franziska nicht fertig. Sie lag fast auf den Knien vor Beatrice, als Norbert sichtlich aufgeregt hereinkam. "Bewaffnete nähern sich der Burg." "Wie viele sind es? Wollen sie uns angreifen?" "So genau weiß das noch niemand. Vielleicht ist die Gruppe, die wir gesehen haben, nur die Vorhut." Die Kleine ärgerte sich, nicht mehr beachtet zu sein, und begann, gellend zu schreien. Franziska war nahe daran, den Kopf zu verlieren, da kam Pentia herein. Kaum hatte Beatrice sie erspäht, hörte sie mit dem Weinen auf und stürmte der Tante entgegen. Die Mutter stellte sich abermals die Frage, wie boshaft ein Kind sein kann. Ohne Absicht sagte Pentia fast genau dasselbe wie ihre Schwester kurz zuvor. Beatrice sollte ihr zuliebe den Brei essen - und sie tat es. Andererseits nahm die Kleine häufig auch Wohltaten von Franziska dankbar an. Das alles wirkte gerade so, als wisse sie genau Bescheid über die Verwandtschaftsverhältnisse und wolle mit der leiblichen Mutter stückweise eine Rechnung begleichen. Von der Plattform des Turms aus waren etwa zehn Reiter zu erkennen. Ihre Rüstungen und Waffen erzeugten Lichtblitze, sobald das Sonnenlicht in einem bestimmten Winkel auf sie fiel. Offenbar hatten sie es nicht eilig. Sie folgten jener Straße, die von Oldenburg nach Wildeshausen führte, über die man aber auch die Wardenburg erreichte. Erst an der Abzweigung würde sich ihr wahres Ziel herausstellen. "Es ist immer noch nur diese eine Gruppe", bemerkte Norbert. "Wahrscheinlich ziehen sie vorbei", entgegnete Franziska. "Vielleicht bringen sie etwas Wertvolles nach Wildeshausen." Doch kaum hatte sie das gesagt, zuckte sie zusammen und starrte nun nur noch schweigend zu den Reitern hinüber. "Was ist mit dir?" wollte Norbert wissen. "Was hast du gesehen?" "Ich bin mir noch nicht ganz sicher", flüsterte sie nach einer ganzen Weile. "So rede doch! Du machst mir ja Angst!" "Der Ritter an der Spitze der Gruppe trägt eine Fahne mit dem Wappen der Westerholts. Das könnte Vater sein." "Der Graf von Oldenburg will die Gegend zurück haben. Damit mussten wir rechnen." "Das meine ich nicht. Sieh doch! Wenn er die Burg belagern will, benötigt er viel mehr Leute. Um uns zu überraschen, dürfte er sich nicht so offen zeigen. Und vor allem: Er hat Frau und Kind mitgebracht! Der Jüngling dort hinten ist Rotbert." "Und was schließt du daraus?" fragte Norbert. "Er will, dass ich ihm die Burg übergebe." Unterdessen sprach sich die Nachricht vom Anrücken einer geheimnisvollen Gruppe bewaffneter Männer in der Burg herum. Immer mehr Leute kamen auf die Plattform und bedrängten Franziska mit Fragen. "Was hat das zu bedeuten? Müssen wir kämpfen?" Etwas gereizt befreite sie sich aus dem Kreis und stieg die enge Wendeltreppe des Turms herunter, bis sie auf dem Hof anlangte. Manches von Wilhelms Befürchtungen entsprach durchaus der Wahrheit, wenn auch nicht alles. Tatsächlich konnte sie seine Erwartungen nicht so leicht erfüllen. Zunächst war sie sich nicht sicher, ob ihre Leute ihr bei einem solchen Befehl die Treue halten würden. Sie hatte der Universitas einen Eid geschworen. Übergabe ohne Not war glatter Verrat. 217 Sie erinnerte sich der grausamen Bestrafung des Verräters Wige und der strengen Bestimmungen seit seiner der Flucht vor der Belagerung Oldenburgs. Es konnte durchaus unter den jungen Stedingern einen Spitzel geben. Der erste Mensch, den sie wieder bewusst wahrnahm, war ihre Freundin Ramira. Die Gauklerin hatte in den zurückliegenden Tagen ihr Feenkostüm weiter verbessert. Besonders gelungen war ihr dabei der Haarschmuck. Ein sehr feines, fast unsichtbares Netz hielt ein Geriesel verschiedenfarbig glitzernder Steinchen fest. Wenn die Sonne schien, wurden die Betrachter ganz wirr vor Lichtblitzen und anderen geheimnisvollen Effekten. "Wer hoch fliegt, wird tief fallen", warnte Franziska. Ramira indes schüttelte seelenruhig den Kopf. "Ich fliege nicht, ich genieße lediglich den letzten Tag als adliges Fräulein. Gerade weil ich noch auf dem Boden stehe, mache ich das." "Was meinst du mit dem letzten Tag?" Ramira zuckte, verständnislos ob der Frage, mit den Schultern. "Stell dich doch nicht so an! Das Stück ist zu Ende. Wir ziehen den Vorhang zu, packen die Puppen in den großen Holzkasten und gehen heim." "Mein Gott! Wie du das sagst! Wir haben leider kein richtiges Zuhause." Schweigend umarmte Ramira ihre Freundin und flüsterte: "Das Leben geht weiter. Es passiert Gutes und Schlechtes, immer im Wechsel. Übrigens habe ich eine Idee, wie wir die Burg an deinen Vater verscherbeln, ohne dass die von der Universitas uns was anhaben können." Franziska löste sich mit einem Ruck und riss ungläubig die Augen auf. "Wirklich?" "Es wird höhere Gewalt sein." Dann erklärte Ramira im Flüsterton ihren Plan. Franziska war sofort begeistert davon und fragte verwundert: "So etwas fällt dir ganz plötzlich ein?" "Oh nein! Ich habe von Anfang an immerzu daran gedacht, wie wir hier wieder herauskommen." III I mmer noch sehr langsam näherten sich die Reiter der Burg. Franziska befahl, die Zugbrücke hochzuziehen und die Mauern zu besetzen. Sehr viele wehrfähige Männer standen nicht zur Verfügung, doch da auch die Angreifer nicht zahlreich waren, reichten sie aus. Witze flogen hin und her über den armseligen Haufen, der da anzuklopfen wagte. Ein wenig Verwirrung entstand nur, als Christian über eine Strickleiter die Mauer hinunter kletterte und ohne Waffen zu den Belagerern hinüber lief. "Welchen Grund gibt es denn, mit denen zu verhandeln?" murrten die Männer. "Sie werden selber merken, dass sie uns nicht beeindrucken können." Doch Franziska klärte sie alsbald auf: "Er verhandelt nur zum Schein. In Wahrheit spioniert er sie aus. Ich will wissen, ob ein größeres Heer im Anmarsch ist. Vielleicht müssen wir die anderen Männer herbeirufen." Das sah jeder ein und tatsächlich blieb Christian nur kurz bei den Rittern auf der Wiese. Den Mienen und Gesten nach war es zu einer Auseinandersetzung gekommen, die zum Abbruch der Gespräche geführt hatte. Etwas derartiges berichtete der 218 Parlamentär dann auch, als er über die Strickleiter wieder die Mauerkrone erreichte. Und er fügte hinzu: "Sie fühlen sich sehr sicher, was bedeuten könnte, dass sie auf Verstärkung warten." "Ist dir noch etwas Besonderes aufgefallen?" gab Franziska ihm ein neues Stichwort. "Nein, nur ... es war mir dort irgendwie unheimlich." Mehr sagte er nicht, aber die vage Andeutung regte die Phantasie an. Niemand witzelte mehr, alle waren irgendwie angespannt, obwohl sich eigentlich nichts zum Schlechten entwickelt hatte. In dieser sonderbaren Atmosphäre sorgte Ramira für große Unruhe, als sie plötzlich in ihrem besten (selbst genähten) Kleid und mit all ihrem (unechten) Schmuck die Mauer entlang lief. "Was tust du hier?" wurde sie alle drei Schritt gefragt. Sie gab jedoch keine Antwort. Ihr Gesicht war bleich und sie sah so aus, als konzentriere sie sich auf irgendetwas mit aller Kraft. "Sie versucht, einen Zauber zu bannen", gaben sich die Männer selbst die Antwort und ein kalter Schauer lief ihnen über den Rücken. Eigentlich stand Ramira bei den jungen Stedingern und den Bürgerssöhne in nicht so hohem Ansehen wie bei den einfacher denkenden, für Hokuspokus eher einzunehmenden Bewohnern der Dörfer. In gewissem Umfange aber hatte sie mit ihrer Ausstrahlung auch sie erreicht. In diesen Stunden der Unsicherheit und der Verwirrung herrschte sie über alle. Die erwartungsvollen Blicke richteten sich nicht mehr auf Franziska und Norbert, die militärischen Führer, sondern auf die vermeintliche Magierin. Ihre Körpersprache ließ Böses ahnen. Über der Zugbrücke begann sie unvermittelt am ganzen Körper zu zittern. Sie wehrte sich, ballte die Fäuste. Letztlich aber schien das Unsichtbare stärker als sie zu sein. Sie wich erschöpft zurück, versuchte es ein zweites Mal, scheiterte wieder. Schließlich kehrte sie taumelnd auf den Hof zurück. Ansprechbar war sie immer noch nicht. Die Burgbesatzung voll beklemmender Zweifel zurücklassend, verschwand sie im Palas. Wenig später kam sie in ihrem zerlumpten Gauklerinnengewand zurück. Dabei starrte sie ängstlich immerfort zum Tor hinüber, so als sähe sie etwas Schreckliches, was die anderen nicht wahrnahmen. Plötzlich verbarg sie mit einem Aufschrei ihr Gesicht hinter den Armen. Im selben Moment fiel die Zugbrücke krachend herunter und gab den Angreifern den Weg auf den Hof frei. Als Wilhelm und seine Gefolgsleute in die Burg hinein ritten, war an Widerstand nicht zu denken. Die Verteidiger ließen ihre Waffen fallen und rannten kopflos umher. Manche flüchteten nach draußen auf die Wiese. Andere warfen sich vor dem alten und neuen Burgherrn in den Staub und bettelten um Gnade. Es dauerte recht lange, bis alle wieder zur Vernunft kamen. Niemals hätte Franziska mit einem derart durchschlagenden Erfolg des Planes ihrer Freundin gerechnet. Sie erkannte aber auch neidlos an, dass Ramira ihre Rolle mit unglaublicher Vollkommenheit gespielt hatte. Die Zeit der Legenden war vorbei. Mit Wilhelm von Westerholt hatte auch der normale Alltag wieder Einzug gehalten. Von den Alteingesessenen fragte sich mancher, ob ihm die Ereignisse der zurückliegenden Wochen von einem Traum vorgegaukelt worden waren. Auch Franziska erging es so. Ihr 219 Vater hatte wieder von der Burgherrenwohnung Besitz ergriffen und bestellte sie zu sich. Gehorsam folgte sie dem Knecht, der sie holen kam, und fand überhaupt nichts Ungewöhnliches dabei. Das Gespräch knüpfte unmittelbar an das vorangegangene, ein paar Wochen zurückliegende an. Franziska hatte Burg und Land vorübergehend für den Ritter verwaltet und erstattete nun Bericht. Sie fühlte sich sogar noch ein Stück weiter zurückversetzt. Mit neun Jahren war sie zur Erziehung nach Wildeshausen geschickt worden und seither hatte sie nur noch zweimal vorübergehend auf dem Hof ihrer Kindheit gelebt. Wenn es ihr schlecht ging, so erinnerte sie sich noch immer mit Wehmut an jene glückliche Zeit, als sie sich noch völlig geborgen fühlen konnte in dem kleinen Land zwischen den Sümpfen. In wenigstens jedem zweiten dieser niemals verblassenden Bilder stand ihr Vater im Mittelpunkt. Sie hatte schon als ganz kleines Mädchen leidenschaftlich gern für ihn gearbeitet. Die Arbeit war die einzige Möglichkeit, seine Zuwendung zu erlangen. Obgleich sie ihn liebte, bekam sie stets Herzklopfen, wenn sie vor ihm stand. Auch diesmal erwartete sie beinahe ängstlich seine Antwort, nachdem sie ihren Bericht beendet hatte. Leider konnte sie sein Gesicht nicht sehen, weil er am Fenster stand und nach draußen blickte. Doch als er sich umdrehte, stellte sie sofort erleichtert fest, dass er zufrieden war. Dass er dann trotzdem nur die Fehler erwähnte, hatte nichts zu bedeuten. Ein ausdrückliches Lob erteilte er niemals. Er hielt sich ohnehin nicht lange bei den zurückliegenden Wochen auf, weil die Zukunft ihn mehr bewegte. "Willst du in der Burg bleiben?" erkundigte er sich. "Ich werde nicht bleiben können, Vater. Die Fremden, die Ihr hier seht, sind meine Leute und ich bin ihr Anführer im Heer der Stedinger. Sie wären mit Recht enttäuscht von mir, würde ich sie im Stich lassen." Wilhelm atmete hörbar ein und aus. Da war wieder so eine Frage, bei der er mit sich im Widerstreit lag. Er hätte an ihrer Stelle genau so gehandelt. Ein Hauptmann darf niemals seine Leute im Stich lassen. Andererseits war der Ritter - nach allem, was er durch seinen Aufenthalt in der Nähe Ottos von Oldenburg wusste - fest davon überzeugt, dass die Bauern diesmal unterliegen würden. Durfte er seine Tochter in ein Gemetzel ziehen lassen? Gab es nicht auch eine Vaterpflicht? Franziska erriet seine Gedanken und baute ihm eine Brücke. "Die Männer aus Stedingen werden vielleicht nicht gehen, wenn ich sie nicht begleite. Sie haben noch ihre Waffen bei sich und könnten Ärger bereiten." Der Vater sah sie scharf an. Mit ihrer Befürchtung konnte sie Recht haben. Trotzdem war ihm klar, dass sie sich opferte. "Aber Pentia wird bleiben ... und dieses Kind!" Obwohl er nicht direkt gefragt hatte, beichtete Franziska ihm nun auch noch dieses Geheimnis. Abermals blieb er sehr ruhig. "Du siehst gewiss ein, dass ich das nicht gutheißen kann", bemerkte er lediglich. Als drei Tage später die Stunde des Abschieds kam, fühlte auch Franziska, dass dieser zweite Kreuzzug für die Bauern unter einem schlechteren Stern stand als der erste - weil sie ihren Vater kannte und weil sie sich jäh erinnerte an Ramiras Worte vor der Schlacht am Hemmelskamper Wald. Da brauchte sie gar nichts zu wissen von den Heeren 220 aus dem Westen. Aber sie nahm sich Wilhelm zum Vorbild und zeigte niemandem, was sie dachte. 221 20.Kapitel I D ie Ochtum, ein dürftiges Flüsschen, das sich zum Transport schwerer Lasten nicht eignete, hatte seit Beginn der Feindseligkeiten zwischen den Stedingern und dem Bremer Erzbischof ständig an Bedeutung gewonnen. Hinter dem Wasserlauf lagen die Dörfer in einer baumlosen Ebene völlig ungeschützt. Ein siegreiches Heer konnte (ein gewisses Maß an Ortskenntnis vorausgesetzt) bis tief ins Innere des Marschlandes vordringen, ohne auf ein weiteres natürliches Hindernis zu stoßen. Da die Universitas um diese Verwundbarkeit wusste, hatte sie im Laufe der Jahre immer mehr Verteidigungsanlagen erbauen lassen. An den Brücken standen inzwischen Türme, die sogar manch einer Burg zur Ehre gereicht hätten. Anders als vor Jahresfrist standen die Bauern diesmal nicht einer einzigen großen Streitmacht gegenüber sondern einer Gruppe aus mehreren Heeren, von denen jedes beachtet werden musste. Sie planten deshalb keine kühnen Vorstöße ins feindliche Land. Die Angreifer sollten sich vielmehr direkt an den Befestigungsanlagen die Zähne ausbeißen. Ein Schwerpunkt in der Verteidigungslinie war die einzige für Panzerreiter passierbare Brücke bei Hasbergen. Der Ort lag ein Stück vom Fluss entfernt, denn früher war der Ufersaum stark versumpft gewesen. Später hatten die Bewohner einen Streifen des Landes entwässert und eine Straße sowie die Brücke gebaut. Noch später waren beiderseits der Straße (wiederum durch Entwässerung) einige Felder entstanden. Schilfbarrieren zeigten an, wo das Kulturland endete und die noch unberührten Sümpfe begannen. Beim Bau der künstlichen Befestigungsanlagen hatten die Stedinger die natürlichen Gegebenheiten ausgenutzt. Der Fluss ersetzte den Graben und an den schwer passierbaren Mooren genügte ein knapp mannshoher Wall. Die beiden aus Baumstämmen errichteten Türme schützten die Brücke, die am meisten gefährdete Stelle. Sie hatten mehrere Stockwerke. Von der oberen Plattform aus und durch ein Dutzend Schießscharten konnten die Verteidiger den Angreifern übel mitspielen. Es gab sogar besondere Vorrichtungen, um ein durch Brandpfeile ausgelöstes Feuer rasch zu löschen, ohne dass sich dafür jemand ungeschützt dem Feind zeigen musste. Tammo von Huntorf trug die Verantwortung für mehrere Meilen Grenze. Zwar rechnete er fest damit, dass die Schlacht bei Hasbergen geschlagen werden würde, doch musste er, um vor Überraschungen sicher zu sein, zwölf Gruppen aus zehn bis zwanzig Mann von seinem Hauptheer abzweigen und zu den gefährdeten Punkten beordern. Während er entlang der Front nach dem Rechten sah, ritt er stets einen prächtigen Schimmel, von dem es hieß, er sei eine Kriegsbeute und habe einmal einem Grafen gehört. Genau wusste das niemand. Die Geschichte war nicht einmal sehr wahrscheinlich, denn ein Pferd gewöhnt sich selten so schnell an einen neuen Herrn. Doch die meisten glaubten gern an sie. Der größere Teil der knapp 4000 Mann umfassenden Streitmacht der Stedinger wurde von Dietmar tom Diek befehligt und stand einige Meilen weiter nördlich an der Einmündung der Ochtum in die Weser. Die Gegend erschien für eine große Schlacht zwar denkbar ungeeignet, weil das von den Flussläufen sowie mehreren kleinen Waldstücken und Moorstreifen zerschnittene Gelände einem Ritterheer keine Möglichkeit zur Entfaltung bot, doch lagerten (warum auch immer) gerade hier die meisten der Kreuzfahrer. Genau genommen lagerten sie nicht, sondern vollführten ständig (manchmal bei Fackelschein mitten in der Nacht) verwirrende Manöver. Immer neue Formationen entstanden und aus keiner davon ließ sich ein sinnvoller Plan ableiten. Deshalb hatte Dietmar entschieden, in verhältnismäßig zentraler, zugleich aber geschützter Stellung den weiteren Lauf der Ereignisse abzuwarten. Er hoffte, das entscheidende Manöver der Feinde rechtzeitig zu durchschauen und seine Leute dann noch entsprechend aufstellen zu können. Franziska saß mit ihrem Fähnlein etwas abseits auf einer kleinen Anhöhe. Sie lagerten schon seit ein paar Tagen hier und hatten sich inzwischen aus Zweigen und Laub fünf behelfsmäßige Behausungen gebaut. Da das Wetter gut war, reichte ihnen das aus. Einen dicken Regen wollten sie allerdings lieber nicht erleben. Rechts vor ihnen ragten die beiden Türme beiderseits der Brücke auf. Dahinter war die Straße gut zu erkennen. Eigentlich handelte es sich nur um einen Fahrweg. Die Wagen der Bauern hatten zwei Spuren tief in den unbefestigten Untergrund gewalzt. Die Umrisse der Häuser von Hasbergen verschwammen im Dunst des Frühnebels. Auf der Fläche zwischen Dorf und Fluss war kein einziger Mensch zu sehen, was etwas sonderbar wirkte, weil es auf Stedingerseite hinter den befestigten Wällen von Leuten wimmelte. "Nur gut, dass wir hier oben bleiben dürfen!" bemerkte Christian. "Die stehen sich da unten ja gegenseitig auf den Füßen herum." "Freue dich nicht zu früh!" dämpfte ihn Norbert. "Was Tammo uns erlaubt hat, kann er den anderen nicht so einfach verbieten." "Du meinst, die kommen alle hier hoch?" "Nicht alle - bloß jeder zweite." Missmutig versetzte Christian einem Stein einen Tritt und beobachtete, wie weit er rollte. Die Langeweile drückte zunehmend allen aufs Gemüt, doch fiel er mit seiner schlechten Laune dennoch auf. Nachdem er den fünften Stein in Richtung Fluss geschossen hatte, wurde es Norbert zuviel. "He, was ist los mit dir? So rasch werden sie uns nun auch wieder nicht auf den Pelz rücken." "Ach, lass sie doch! Wenn sie uns wenigstens die Pferde nicht weggenommen hätten! Das waren unsere Pferde. Mit welchem Recht ..." "Das richtet sich nicht gegen uns. Die Pferde sind ..." "Na, wo sind sie? Ich weiß es nicht, du weißt es nicht, niemand hier weiß es. Sie sind weg." "Sie sind nicht weg, sie sind woanders. Wir brauchen sie hier nicht." Mit diesen Worten wandte er sich brüsk ab. Er hatte keine Lust, sich als Sündenbock herzugeben für jemanden, der offenbar Streit suchte. Und während er überlegte, wohin er sich wenden sollte, fiel ihm auf, dass er Franziska nicht sah. Er begab sich also auf die Suche und entdeckte sie nach einiger Zeit abseits der anderen in einer Mulde. "Warum versteckst du dich?" "Weil ich meine Ruhe haben will." 223 "Ich bin gerade vor Christian geflüchtet, weil er heute unausstehlich ist." "Wann darf man denn schlechte Laune haben, wenn nicht kurz bevor man sich totschlagen lässt?" Er setzte sich zu ihr. "Solche bösen Worte kenne ich gar nicht von dir." "Ich habe genug von dem allen", sagte sie. "Warum bin ich nicht auf der Wardenburg geblieben? Ist sie nicht mein Zuhause?" "Wir alle haben uns gewundert darüber. Aber wir haben uns auch gefreut. Wir vertrauen dir." Sie seufzte. "Am Vorabend der Schlacht darf man nicht an den Tod denken, weil man ihn sonst herbeilockt." "Genau so ist es!" Er legte einen Arm um ihre Schulter. "Lass uns an das Leben danach denken! Ich nehme dich mit nach Bremen. Dort angekommen, müssen wir selbstverständlich erst einmal unsere Verhältnisse in Ordnung bringen. Beatrice soll nicht zum Gespött der gehässigen Leute werden." Franziska wurde hellhörig und befreite sich von seinem Arm. "Nach Bremen? Was soll ich denn dort?" "Nun ja, weil ..." "Weil eine Frau ihrem Mann nachfolgen soll?" Da drohte abermals ein Streit. Bei Franziska war Norbert jedoch zu größerer Geduld bereit als bei Christian. Zudem hörte er sich an diesem Tag viel lieber ihre Vorwürfe an als ihre düsteren Todesahnungen. "Es sollte nur ein Vorschlag sein. Du weißt, dass ich dich zu nichts zwingen würde." Er wäre seiner Freundin auch auf ihre Burg gefolgt, fürchtete aber, dass ihre Eltern sich gegen die Ehe ihrer Tochter mit einem Bürgerlichen stemmen würden. "Schon gut!" lenkte sie ein. "Wir reden darüber nach der Schlacht. Heute sollten wir uns nur schwören, dass wir uns einen anständigen Lebensunterhalt suchen. Ich möchte lieber arm sein, als weiterhin ..." Sein Kuss verschloss ihr den Mund und sie ließ es geschehen. Christian, der nun keinen Gesprächspartner mehr hatte, tobte seinen Zorn wieder an Steinen aus. So recht erklären konnte er sich nicht, was da in ihm vorging. Mit dem Krieg hing es wohl nicht allein zusammen. Er musste sich regelrecht zwingen, den Ernst der Lage gegenwärtig zu behalten. In der Nacht hatte er in einem wüsten Alptraum nicht grimmige Kreuzfahrer vor sich gesehen, sondern schillernde Feen, die ihn umtanzten und dabei mit Spottversen überschütteten. Rasend vor Wut war er dabei geworden. Die Feen bestanden aber aus Luft. Wenn er sich eine von ihnen greifen wollte, stießen seine Arme auf keinerlei Widerstand. Er konnte durch die sonderbaren Wesen glatt hindurch laufen. Allerdings bildeten sie immer gleich wieder den Kreis um ihn. Unbewusst kam er Ramira immer näher, bis er ihr gegenüberstand. Sie blickte ihn aus ihren klaren grau-blauen Augen starr an. Er empfand das als Herausforderung und stichelte: "Warum bist du nicht dort geblieben, wo man dich verehrt? Dich hätte bestimmt niemand gezwungen, an einer Schlacht teilzunehmen." Sie verbog geringschätzig die Mundwinkel und drehte sich weg, ohne ihn einer Antwort zu würdigen. "Kennst du mich nicht mehr?" empörte er sich. "Du ödest mich an!" fauchte sie zurück. 224 "Ich öde dich an, ja?!" schrie er außer sich, ohne sich um die anderen zu kümmern, die durch den Lärm auf ihn aufmerksam wurden. "Gut, ich werde dich bestimmt nicht mehr belästigen. Und wenn du mich auf Knien ..." "Auf Knien? Ha, davon träumst du, nicht wahr?" Sie hatte sich ihm wieder zugewandt und drang nun wie eine Furie auf ihn ein. "Hör auf, mir deine Wohltaten aufzudrängen! Hörst du? Und lass dir nicht einfallen, mich während der Schlacht zu beschützen! Wenn ich Gefallen daran finde, ins Gras zu beißen, dann ist das verdammt noch mal meine Sache. Ich trage den Wimpel. Das ist meine Aufgabe, und die werde ich erledigen. Allein!" Er prallte erschrocken zurück. Während sie ihn mit flammendem Blick ansah, traute er ihr allen Ernstes zu, ihn vor den Augen der Kameraden zu verprügeln. Und dagegen hätte er sich wahrscheinlich nicht einmal gewehrt. Sein Zorn schlug um in tiefe Niedergeschlagenheit. Er lief ein Stück und ließ sich dann einfach fallen. Auf dem Rücken liegend, starrte er den Himmel an. Weiße Wolken zogen langsam vorüber und ihm kam die Idee, dass jede von ihnen einen Teil seines Lebens darstellte. In der einen meinte er ein Werkzeug seines Stiefvaters zu erkennen, in einer anderen ein Haus aus der Waldhütte-Burg. Vor allem die verpassten Gelegenheiten waren es, die ihn beschäftigten. Er wurde von einer schrecklichen Angst vor dem Tode gepackt. Wenn er jetzt stürbe, hätte er niemals richtig gelebt, so schien es ihm. II A m frühen Morgen des 27. Mai 1234 besetzten Waffenknechte das Dorf Hasbergen. Sie gehörten zu jenem Teilheer, welches die Kreuzfahrer aus Bruchhausen, Wildeshausen und Flandern umfasste und von Graf Heinrich III kommandiert wurde. Offensichtlich war eine Absprache mit dem Schulzen vorausgegangen, denn die Bauern öffneten freiwillig das Ettertor und die Ritter richteten keine Zerstörungen an. Der Heerführer wollte lediglich sicher sein, dass sich die kämpfenden Stedinger während der zu erwartenden Schlacht dort nicht festsetzten. Die Hasbergener wiederum hatten keine Wahl, auf welche Seite sie sich stellten. Tammo von Huntorf war durch Kundschafter gut unterrichtet und hatte schon am Vorabend die Vorbereitungen auf den Waffengang eingeleitet. Franziska und ihr Fähnlein waren vom Hügel herab an den Wall beordert worden und zwar eine knappe halbe Meile nördlich der Brücke. Dort bildeten sie zusammen mit etwa 150 anderen eine Reserve. Südlich der Brücke lagerte eine zweite Gruppe dieser Art. Tammo rechnete damit, dass die Angreifer sich auf die beiden Türme konzentrieren würden. Auf dem Höhepunkt der Schlacht sollte die Reserve einen Zangenangriff in den Rücken der Kreuzfahrer unternehmen. Da die meisten Stedinger im Gegensatz zu den Rittern keine eisernen Rüstungen trugen, stellte die Ochtum für sie kein großes Hindernis dar. Sie konnten den Fluss schwimmend oder auf winzigen Flößen rasch überwinden. "Ich frage mich, ob es klug war, ihnen das Dorf zu überlassen", raunte Norbert. "Sie können sich jetzt Zeit lassen und uns beobachten. Wir dagegen haben keine Möglichkeit mehr, sie zu vertreiben." 225 "Wie willst du das Dorf verteidigen? Bei dieser Trockenheit könnten die Ritter die Schlehdornhecke in Brand stecken - und die Häuser gleich mit." "Du hast Recht. Trotzdem gefällt mir das alles nicht. Irgendwie sitzen wir hier in der Falle." Christian und Ramira hatten fast zwanzig Schritt voneinander entfernt Stellung bezogen. Die Gauklerin wirkte wie immer erstaunlich ruhig. Der Wimpel lag neben ihr. Die Leute aus der Reserve waren streng angewiesen, sich dem Feind nicht zu zeigen. Norberts Annahme, dass die Ritter abwarten würden, bestätigte sich nicht. Kaum hatten sie Hasbergen fest in der Hand, marschierten sie in breiter Front über den trocken gelegten Streifen auf den Fluss zu. Offenbar wussten sie über das Gelände gut Bescheid, vielleicht durch ortskundige Bauern, die für Lohn Auskünfte gaben. Von den Türmen her wehte ihnen ein Pfeilregen entgegen, doch die Geschosse blieben in den Schilden stecken oder prallten von den Rüstungen ab. Auch die Knappen und Waffenträger waren gut geschützt. "Da nutzen nur Steinschleudern", sagte Franziska. "Warum haben sie die nicht gebaut? Es gibt doch geschickte Handwerker in ihren Dörfern." "Sie sind keine Ritter", entgegnete Norbert. "Ihnen fehlt in mancher Hinsicht die Erfahrung." Aus der Nähe richteten die Pfeile dann allerdings doch einigen Schaden an. Nachdem die Kreuzfahrer den Fluss erreicht hatten, begannen ihre Schwierigkeiten. Um ans andere Ufer sie gelangen, mussten sie entweder die Brücke erobern oder einen neuen festen Übergang bauen. Dreimal gelang es Gruppen von zwanzig bis dreißig Mann zwar, auf den Deich hinauf zu klettern. Dort aber schlug ihnen dann erbitterter Widerstand entgegen. Die Schlacht verlief ganz nach Tammos Plan. Die Ritter erlitten erste Verluste und es war angesichts ihrer fortlaufenden Misserfolge zu hoffen, dass ihre zunächst unerschütterlich scheinende Moral allmählich abnehmen würde. Vielleicht hatte der eine oder andere die Katastrophe am Hemmelskamper Wald miterlebt. Aus Ungeduld wartete Tammo aber nicht ab, bis sich die Waage noch mehr zur Seite der Bauern hin neigte, sondern befahl schon bald den Zangenangriff. Die Reserve beiderseits der Brücke überstieg den Wall, überwand den Fluss und drang auf die Kreuzfahrer von der Flanke her ein. Die Wirkung war jedoch geringer als erwartet, denn während die Stedinger vorrückten, hatten die Kreuzfahrer genügend Zeit, sich neu aufzustellen. Jeder dritte von ihnen sicherte hinten und an der Seite ab, während die anderen den Kampf um die Brücke fortsetzten. Was beim Durchqueren des Flusses noch ein Vorteil gewesen war, erwies sich im Gefecht als entscheidender Nachteil. Die Bauern hatten Mühe, den gepanzerten Gegnern Schaden zuzufügen. Umgekehrt waren sie selbst mit ihren Lederwämsern und leichten Kettenhemden sehr verwundbar. Um nicht in den sicheren Tod zu rennen, fochten sie nicht mit letzter Entschlossenheit. Mit Plänkeln aber konnten sie das Ritterheer nicht in Verlegenheit bringen. Es wurde nicht wie am Hemmelskamper Wald auf engen Raum zusammengedrückt, sondern verschaffte sich ohne große Mühe den Platz, den es brauchte. Gegen Mittag hatten die Angreifer den Durchbruch noch immer nicht geschafft, weder an der Brücke noch an einer der anderen Stellen, an denen sie ihn versuchten. Allerdings entstand zunehmend der Eindruck, dass sie die Oberhand gewännen. Sie stürmten nicht mehr blindlings, sondern gingen ziel- 226 strebig vor. So brachten sie zwei Steinschleudern in Stellung, mit denen sie die beiden Türme buchstäblich weich klopften. Irgendwann würden sie in sich zusammenfallen. Tammo begriff, dass er alles auf eine Karte setzten musste, wollte er die Stellung halten. Gedeckt durch die hohen Bollwerke scharte er seine besten Leute um sich und stattete sie für einen Ausfall mit den wenigen vorhandenen Pferden aus. Die anderen sollten sich bereithalten, um zu Fuß zu folgen, sobald sich eine Möglichkeit dafür ergebe. Und diesmal gelang die Überraschung. Die Stedinger trafen ihre Feinde in einem Moment, als sie sich gerade nach einem Vorstoß zurückzogen. Die Brücke und ein großer Bereich davor waren frei. Blitzschnell hatte Tammo mit seiner Schar beides erobert. Von diesem Moment an trug die Schlacht einen anderen Charakter. Hatte sie zuvor beinahe behäbig gewirkt und auf beiden Seiten wenige Opfer gefordert, wurde sie nun unerbittlich und blutig. Die Ritter, sich überlegen fühlend, wollten nicht zurückweichen, die Bauern, von ihren nachrückenden Kameraden gedrängt, konnten es nicht. Tammo, dem als Heerführer einige Fehler unterlaufen waren, zeichnete sich als Kämpfer durch seine Kühnheit und seine urwüchsige Kraft aus. Zur Unterstützung griffen die Reserven von den Seiten her ebenfalls wieder an. Ob der Ausfall wirklich erfolgreich verlaufen wäre, wenn die Ritter wie bisher ihre kaltblütige Ruhe bewahrt hätten, lässt sich im Nachhinein schwer sagen. Aber auch auf ihrer Seite spielte ein Feldherr eine wichtige Rolle - als Unglücksbringer. Graf Heinrich III von Bruchhausen ärgerte sich schon seit einiger Zeit maßlos, dass die Eroberung der Brücke samt der sie beschirmenden Türme nicht gelang. Der Ausfall nun machte ihn rasend. "Warum erschlagt ihr diese räudigen Hunde nicht?" brüllte er. Zugleich gab er seinem Streitross die Sporen und stürmte bis ganz nach vorn. Dort spaltete er mit wuchtigen Schwertstreichen in dichter Folge drei Bauern den Kopf. Dass er sich durch die Reihen des verachteten Packs hindurch schob wie ein heißes Messer durch ein Stück Butter, brachte ihn zum Frohlocken. Er übersah dabei jedoch, dass er mitten in die von der Brücke her heran drängenden Stedinger geriet und dass von seinen eigenen Leuten niemand ihm folgte. Plötzlich trafen ihn die Hiebe von allen Seiten. Irgendwann verwundete ihn einer davon tödlich. Er starb bei einer sinnlosen Tollkühnheit. Die Bauern gewannen nun Oberwasser. Tammo schien sich zu vervielfachen. Mal hier mal dort war sein schneeweißes Pferd zu sehen. Und überall, wo es auftauchte, wichen die Ritter schon bald zurück. Sie flüchteten nicht, verloren nicht völlig den Kopf, gaben aber Schritt für Schritt immer mehr Gelände preis und gerieten in eine immer schlechtere Lage. Etwa auf halbem Wege zwischen Hasbergen und der Ochtum wurden sie eingekreist. III T rotz aller weingeschwängerten Verbrüderungen waren die Gräben zwischen den Bruchhausenern und Wildeshausenern auf der einen Seite und den Holländern aus Flandern auf der anderen auch unmittelbar vor dem Aufbruch des Heeres noch tief gewesen. Sie hatten 227 sogar die Wahl eines Führers verhindert. Die einen wollten nach wie vor nur Heinrich III folgen, die anderen mit derselben Sturheit nur Arnold von Gavre. Allerdings bestand Erzbischof Gerhard energisch darauf, dass alle zusammen marschierten und kämpften. Er bekam einen Wutanfall, als er von den neuerlichen Kindereien erfuhr, und hob (weil er den Bruchhausener als Schuldigen ansah) selbstherrlich den Holländer auf den Schild. Daraufhin zettelten die für ihre Wildheit berüchtigten Wildeshausener (jene, die seinerzeit Heinrich den Bogener in den Geheimkeller getrieben hatten) einen regelrechten Aufstand an. Dabei erwiesen sich die Einheimischen als überlegen. Arnold von Gavre fürchtete um sein Leben, trat freiwillig zurück und beruhigte seine Leute. Erst der Ausfall der Bauern mit seinen Folgen hatte das Heer zusammengeschmolzen. Die Frage nach dem Heerführer war vom Schicksal endgültig geklärt worden. Die durch Heinrichs Tod verunsicherten Ritter aus Wildeshausen und Bruchhausen hätten den (vor drei Tagen bei ihnen noch tief Reihen der Kreuzfahrer zu bringen. Der Widerstand versteifte sich. Der Ausgang der Schlacht war wieder offen. Hin und wieder versuchten die Stedinger, ihre Reihen an einer bestimmten Stelle zu verstärken und durch eine energische Attacke einen Vorteil zu erreichen. Das glückte ihnen aber ebenso wenig wie den Rittern der Ausbruch aus dem Kessel. Bliebe das den ganzen Nachmittag über so, musste der unterliegen, dessen Kräfte zuerst erlahmten, und wer das sein würde, ließ sich schwer voraussagen. Arnold von Gavre wollte sich darauf nicht einlassen und suchte nach einem Ausweg. Dabei verfiel er auf eine List. Er ritt ein ganz besonderes Streitross, einen prächtigen Rappen aus besonderer Zucht, noch stattlicher als Tammos Schimmel. Das Tier trug neben seinem gerüsteten Herrn noch einen eigenen Panzer, ohne darunter zusammenzubrechen. Schon oft hatte Arnold damit in einer fremden Stadt den Anlass für einen Menschenauflauf gegeben. Natürlich rankten sich auch schon Legenden darum. Der verwegene Holländer ließ sie sich gern erzählen und amüsierte sich köstlich darüber. Auf die ungeheure Wirkung seines Rappen setzte er nun sein ganzes Vertrauen. Er wendete ihn, weil er von hinten noch größer aussah, und ließ ihn dann rückwärts gegen die Reihen der Stedinger gehen. Tatsächlich waren die Bauern für einen Moment so entsetzt über das vermeintliche Ungeheuer, dass sie das Kämpfen vergaßen. In ihrem Ring entstand eine Lücke, welche von nachrückenden Rittern sofort vergrößert wurde. verhassten) Holländer auf Knien angefleht, sie zu retten, wäre dafür Zeit gewesen. Tatsächlich gelang es Arnold von Gavre, wieder Ordnung in die 228 Der weitere Verlauf der Schlacht erinnerte an das Auseinanderbiegen eines Hufeisens, wie es halbnackte Muskelmänner zuweilen auf Jahrmärkten vorführten. Arnold feuerte seine Leute unablässig an und schlug auch selbst kräftig drein. Die Bauern erkannten die Gefahr und versuchten mit allen Mitteln, die Bresche wieder zu schließen. Dabei jedoch vernachlässigten sie eine Stelle auf der gegenüberliegenden Seite. Den Rittern gelang ein zweiter Durchbruch. Das Heer der Stedinger war damit in zwei Teile zerschnitten. Wenig später schoss einer der Kreuzfahrer mehrere brennende Pfeile steil gen Himmel - ein verabredetes Zeichen. Tammo von Huntorf verwirrte das, denn nach seiner Überzeugung hätte eine Reserve spätestens während der Einkreisung eingegriffen. Doch wieder irrte er sich, denn Arnold von Gavre, dieser mit allen Wassern gewaschene Teufelskerl, der sich schon in der halben Welt herumgeschlagen hatte, er war (anders als der Bauernführer) kaltblütig genug gewesen, die Wende der Schlacht abzuwarten für den tödlichen Schlag. Wie die Reiter der Apokalypse tauchten die Bethune-Brüder mit ihren Leuten, in eine Staubwolke gehüllt, hinter Hasbergen auf, ritten einen Bogen und fielen dann dem südlichen Teil des Stedingerheeres in den Rücken. Für eine wirkungsvolle Abwehr blieb keine Zeit mehr. Schon beim ersten Ansturm wurden Dutzende Bauern niedergemetzelt. Die anderen liefen kopflos in alle Richtungen davon und wurden gejagt wie Hasen. Franziska und ihre Gefährten gehörten zum nördlichen Teil des Heeres. Wo sie waren, hatte sich seit einiger Zeit nichts Besonderes mehr ereignet. Sogar vom Auseinanderbrechen des Belagerungsringes spürten sie nicht viel. Die ihnen gegenüber stehenden Ritter wirkten müde und waren nur darum bemüht, die Stellung zu halten. Das Geschrei auf der anderen Seite aber entging ihnen nicht und sie ahnten, dass dort etwas Schreckliches geschah. Es dauerte nicht lange, da wurden sie auch selbst von der tödlichen Welle erfasst. Der Untergang des südlichen Heeres bewirkte, dass sich die gesamte Streitmacht der Kreuzfahrer nunmehr dem nördlichen zuwandte. Der Druck wurde übermächtig, die Bauern mussten zurückweichen. Unglücklicherweise endete kurz hinter ihnen der trocken gelegte Landstreifen. Mit Entsetzen merkten sie, wie ihre Füße mit jedem Schritt tiefer einsanken. Die Ritter folgten ihnen nicht, blieben aber als eiserne Mauer stehen und versperrten ihnen den Rückweg. Armbrustschützen machten sich ein Vergnügen daraus, die Fliehenden abzuschießen. An einen Zusammenhalt der Fähnlein war nicht mehr zu denken. Franziska erkannte für einen Moment den Wimpel, den Ramira eigensinnig selbst jetzt nicht fortwarf. Aber wo waren die anderen? Es gab einige Wege durch den Sumpf. Die aber kannten nur wenige und ein einziger falscher Schritt konnte den Tod bedeuten. "Wir müssen weg von hier!" rief jemand. Franziska drehte sich um und erkannte Norbert. "Wenigstens du bist noch hier", sagte sie erleichtert. "Wir müssen weg!" wiederholte er eindringlich. Der schmale Saum, auf dem ein Mensch gerade noch Halt finden konnte, war schon mit Leichen übersät. Wie die anderen liefen die beiden auf und ab, ohne wirklich zu entkommen. Nur durch Zufall stießen sie dabei auf einen Ortskundigen, der sich gerade 229 anschickte, eine Gruppe zu führen. Die Armbrustschützen bemerkten das aber und töteten einen nach dem anderen. Das Grauen, das Franziska nun erlebt, überstieg noch die Eindrücke von der Schlacht bei Hemmelskamp. Norbert wurde unmittelbar neben ihr von einem der Bolzen genau in den Kopf getroffen. Sie wollte sich über ihn werfen, doch jemand stieß sie von hinten vorwärts nicht weil er sie retten wollte, sondern weil sie ihm den Weg versperrte. Irgendwann fand sie sich an einem Ort wieder, von dem aus sie keinen Kreuzfahrer mehr sah. Aber auch ihre Begleiter waren verschwunden. Wohin? Wo hatte sie sie verloren? Wie viele waren am Ende noch übrig? Sie wusste es nicht. Und schon drängten sich ihr die nächsten Fragen auf. Durfte sie an diesem Fleck bleiben oder musste sie weiter fliehen? In welche Richtung konnte sie fliehen? Sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Hasbergen lag mit ziemlicher Sicherheit südlich von ihr. Wo das war, bestimmte sie mit Hilfe der Sonne. Als nächstes prüfte sie, ob sie eine Verletzung erlitten hatte, denn Kriegswunden verursachten manchmal rätselhafter Weise keine Schmerzen. Offenbar war alles in Ordnung mit ihr. Nur eine unsägliche Erschöpfung drückte sie zu Boden. Sie wusste, dass sie sofort einschliefe, würde sie dem Drang nachgeben, sich hinzulegen. Also schleppte sie sich vorwärts - immer in nördlicher Richtung. Als sie dabei den Fluss erreichte, schwamm sie hindurch. 230 21.Kapitel I D ie Erschöpfung spiegelte Franziska Trugbilder vor. Immer wieder glaubte sie, gerüstete Reiter von vorn auf sich zukommen zu sehen. Sie hatte eine panische Angst, sich zu verirren und versehentlich zum Ort des Gemetzels zurückzulaufen oder von den Kreuzfahrern eingeholt zu werden. Die kamen mit ihren Pferden, wenn sie wollten, schnell voran, zumal sich ihnen wohl niemand mehr entgegen stellen konnte. Sie meinte, schon endlos lange unterwegs zu sein, ohne einen Menschen getroffen zu haben. Da sah sie plötzlich Häuser, wenn auch (statt eines vollständigen Dorfes) nur eine Siedlung mit wenigen niedrigen Hütten. Dass sich niemand darin regte, beunruhigte sie zunächst und ließ sie einen Augenblick lang zögern hineinzugehen. Doch dann überwog die Hoffnung gegenüber den Bedenken. Es stellte sich heraus, dass die Siedlung von ihren Bewohnern überstürzt verlassen worden war. In den leeren Häusern hatten Überlebende der Schlacht Unterschlupf gefunden, unter ihnen Ramira und Christian. Sie saßen nebeneinander an eine Wand gelehnt und wirkten wie aus Holz geschnitzte Figuren. Ihre Kleidung war bis zum Hals hinauf von Schlamm durchtränkt, der allmählich zu einem brüchigen Kokon trocknete. In den Gesichtern glichen dunkle Streifen einer Bemalung mit magischen Zeichen. Franziska trat an die beiden heran. "Habt ihr euch wieder versöhnt?" Sie spürte, wie unsinnig diese Frage unmittelbar nach dem Gemetzel von Hasbergen war. Ihr Gehirn arbeitete nicht mehr richtig. Es verweigerte den Dienst wie ein scheuendes Pferd. Den anderen beiden erging es aber ähnlich. "Wir hatten noch keine Zeit", entgegnete Christian tonlos. "Das holen wir nach, wenn wir im Himmel sind." Und Ramira fügte hinzu: "Der Wimpel ist im Moor geblieben. Tut mir leid. Du musst dir von deiner Schwester einen neuen nähen lassen." Franziska wollte noch fragen, wie die beiden entkommen waren, doch ihr fehlte selbst dazu die Kraft. So setzte sie sich neben sie und schloss die Augen. Mochte da kommen, was will! Wieder herausgerissen aus ihrem Dämmer wurde sie durch das Geschrei eines Mannes. Zunächst dachte sie, die Kreuzfahrer näherten sich der Siedlung. Doch als sie genauer hinhörte, verstand sie, dass von Tammo die Rede war. "Er sammelt das Heer wieder. Der Krieg ist noch nicht verloren." "Was für ein Heer will er denn sammeln?" sagte Christian vor sich hin. Franziska blickte zu ihm hinüber. Nein, sie konnte sich auch keine zweite Schlacht mehr vorstellen, vor allem keine siegreiche. Doch noch weniger wollte sie an die endgültige Niederlage glauben. Sie schloss wieder die Augen und sah Tammo an der Spitze einer gewaltigen Streitmacht. Das Heer der Ritter prallte davon ab wie ein Stück Holz von einer Wand. Diese Traumgespinste begleiteten sie auch noch, als alle gemeinsam aufbrachen. Sie schloss sich an, ohne zu wissen warum. Offenbar hatte jemand die Führung übernommen. Sie fragte nicht danach, war gleichgültig gegenüber dem Schicksal geworden. Die Nachricht, dass Tammo von Huntorf die versprengten Reste des bei Hasbergen geschlagenen Heeres sammle, beruhte auf einem Gerücht, von dem niemand wusste, wie es entstanden war. Die Führung über die Leute in der Siedlung hatte einer der Hauptleute übernommen. Dessen Pläne beruhten in Wahrheit auf der Annahme, dass der größere Teil der StedingerStreitmacht im Norden noch bereit stünde. Wenn es noch eine Wende in diesem Krieg geben sollte, konnte sie nur von dort ausgehen. Somit erschien es als das Klügste, dem Heer des Dietmar tom Diek entgegen zu ziehen. An jenem Schicksalstag war aber auch dort, an der Mündung der Ochtum in die Weser unweit des Dorfes Altenesch, die Zeit nicht stehen geblieben. Die Bauern erwachten am frühen Morgen in der selbst gewählten Enge zwischen den beiden Flüssen. Wie schon seit fast einer Woche hatten sie die Nacht neben ihren Waffen verbracht, jederzeit bereit, aufzuspringen und zu kämpfen. Am anderen Ufer der Flüsse begannen die Ritter wieder mit ihrem Verwirrspiel. Die Aufstellung der Kreuzfahrer ergab noch immer keinen erkennbaren Sinn. Zwei Drittel von ihnen hatten um das Dorf herum noch weniger Bewegungsfreiheit als die Stedinger. Sie waren in etlichen mehr oder minder großen Gruppen über ein ziemlich weiträumiges Gebiet verteilt. Es gab in dieser Gegend nur kleine Stücke zusammenhängenden Landes mit genügend festem Untergrund. Dort saßen die Männer fest wie auf Inseln. Am anderen Ufer der Weser, wo sich die übrigen Ritter aufhielten, gab es immerhin eine Wiese, die sich zur Entfaltung eignete. Hier aber bildete die Weser ein nahezu unüberwindliches Hindernis. Sie führte verhältnismäßig viel Wasser und wälzte sich als breites dunkles Band vorbei. Eine Brücke führte nur über die Ochtum. Nach Überzeugung der Stedinger drohte ihnen vorläufig allein dort eine Gefahr. Hin und wieder zeigten sich auf einem Hügel mehrere Gestalten. Das war immerhin etwas Neues. Die Bauern rätselten, wer sie wohl seien und wonach sie Ausschau hielten. Einiges sprach dafür, dass es sich (unter anderen) um die Heerführer handelte, also um den Herzog von Brabant und um Adolf VII von Berg. Vielleicht berieten sie sich mit einigen ihrer Hauptleute dort oberhalb des möglichen Schlachtfeldes. Hieß das nun, dass der große Angriff bevorstand? Wenig später bestellte auch Dietmar tom Diek seine Hauptleute zu sich. Er fragte sie der Reihe nach, was sie von der gegenwärtigen Lage hielten. Die meisten rechneten mit einem Angriff noch an diesem Tag, als dessen Ziel sie die Ochtum vermuteten - wenn nicht an der Brücke so an einer auffällig schmalen Stelle einige hundert Schritt stromaufwärts. Die Männer, die östlich der Weser lagerten, sahen sie als Reserve an. "Vielleicht sollten wir ihnen zuvorkommen", warf Dietmar ein. "Sie stehen dort bei Altenesch nicht gut. Die Gruppen können sich gegenseitig kaum helfen." "Sie einzeln angreifen und nacheinander aufreiben?" "Das wäre eine Möglichkeit. Sagt mir eure Meinung dazu!" Stille trat ein. Die Männer wussten nicht, ob der Plan ernst gemeint war. Der schlaue Dietmar stellte sie gelegentlich auf die Probe, um sich von ihren Fähigkeiten zu überzeugen und sie zum Überlegen anzuregen. "Ich vermute, dass sie mit so etwas rechnen und sich darauf eingerichtet haben", begann schließlich einer vorsichtig. "Woran denkst du?" "Fallen, Hinterhalte..." 232 Ein anderer sagte: "Die Gruppen können einander zwar nicht helfen, stehen aber in Verbindung. Sie verständigen sich durch Zeichen." "Ich seid also dagegen? Bedenkt, dass wir vielleicht wertvolle Zeit verlieren, wenn wir nur abwarten!" Von Zweifeln geplagt, entschieden sich am Ende zwei Drittel gegen den Plan. Dann äußerte sich Dietmar selbst. "Sie haben tatsächlich Fallen gegraben. Ich weiß es durch Kundschafter. Die Stellung erscheint für einen Angriff tatsächlich wenig geeignet. Dafür lässt sie sich umso besser verteidigen. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als abzuwarten. Erst, wenn sie sich bis zum Wasser wagen, können wir ihnen etwas anhaben. Vermutlich läuft ihr Plan darauf hinaus, dass wir die Geduld verlieren und dann ins offene Messer laufen." Am späten Vormittag kam Bewegung ins Kreuzfahrerheer. Die beiden größten Gruppen marschierten auf die Ochtum zu, die anderen rückten nach. Das Ziel war die Brücke, wo die Stedinger eine starke Verteidigung aufgestellt hatten. Da es allerdings (anders als bei Hasbergen) keine Türme gab und auch nur einen niedrigen Wall, befahl Dietmar, den Rittern keine Zeit zu geben, sich festzusetzen. Die Bauern strömten in großer Zahl ans andere Ufer und bildeten dort einen Brückenkopf, noch ehe ihre Gegner dort eintrafen. Zu Beginn des Gefechts waren die Stedinger den Kreuzfahrern der Zahl nach leicht überlegen. Dafür hatten jene die besseren Waffen. Um einen Vorteil zu erringen, verstärkten beide Seiten allmählich ihr Aufgebot. Bei den Bauern kam Verstärkung über die Brücke heran, bei den Rittern griffen nach und nach die anderen Gruppen ins Geschehen ein. So entwickelte sich aus einem Scharmützel eine regelrechte Schlacht. Kurz nach Sonnenhöchststand neigte sich die Waage auf die Seite der Stedinger. Die einzelnen Gruppen der Kreuzfahrer standen sich gegenseitig im Weg. Die Bauern konnten ihre Reihen schneller auffüllen. Ihre Überlegenheit vergrößerte sich und führte dazu, dass sie Land gewannen, erst langsam, Schritt für Schritt, dann immer schneller. Dabei liefen die Ritter Gefahr, in ein für sie ungünstiges Gelände abgedrängt zu werden. Vielleicht hatten ihre Hauptleute das eingesehen. Jedenfalls ließen sie zum Rückzug blasen. II D er Sieg, der verhältnismäßig wenig Opfer gekostet hatte, hob bei den Stedingern die Stimmung. Angesichts der verwirrenden Manöver ihrer Feinde waren sie unsicher geworden. Nun fühlten sie sich wieder wie in den Tagen nach der Schlacht am Hemmelskamper Wald. Gott stand auf ihrer Seite, denn sie verteidigten ihr Land und ihr gutes Recht. Musikinstrumente wurden hervorgeholt. Einige Bauern bildeten einen Kreis. Wer es konnte, führte einen Tanz vor. Mitten in das fröhliche Treiben hinein platzte ein Alarmruf, den zunächst fast jeder (seiner Unglaubwürdigkeit wegen) für falsch hielt: "Sie greifen von der Weser her an!" Wie konnte das sein? Wie konnten die Ritter den breiten Fluss überwunden haben? Und doch war es so. Die Bauern wussten noch nichts von der Flotte kleiner und mittelgroßer Boote, welche 233 die Holländer entlang der Nordseeküste heran geführt und in der Weser nahe der Mündung geankert hatten. Während der Manöver blieb sie stets unauffällig im Hintergrund und wurde erst am Vormittag des 27. Mai an den Schauplatz des Entscheidungskampfes beordert. Zu dieser Zeit waren die Bauern zu sehr mit den Geschehnissen an der Ochtum beschäftigt, um das Verhängnis, das sich auf der anderen Seite ihres Lagers anbahnte, genügend wahrzunehmen. Als sich die Ritter in der Schlacht um die Brücke zurückzogen, schlug die große Stunde des Gerhard von Diest. Der Erfinder und Organisator, für den der Krieg nichts anderes war als eine technische Herausforderung und der dabei kaum andere Mittel anwendete als er es für eine Handelsmission ins ferne Nowgorod getan hätte, er sollte das Zünglein an der Waage werden, der handelnde Arm des Schicksals, das sein endgültiges Urteil über das Staatswesen der Universitas Stedingorum sprach. Gemessen an den Menschenmassen, die sich dort bei Altenesch in Waffen gegenüberstanden, befehligte er eine lächerlich kleine Abteilung. Die allerdings bestand ausschließlich aus Leuten, die er sich persönlich ausgesucht hatte und die seine Anweisungen äußerst schnell und genau ausführten. Ehe die vom Ufer aus zusehenden Bauern begriffen, was da vor ihren Augen vor sich ging, formierten sich etwa hundert Boote zu einer breiten Behelfsbrücke, welche tatsächlich von einem Ufer der Weser bis zum anderen reichte. Kaum war der Übergang vollendet, stürmten auch bereits die ersten Ritter darüber hinweg. Um die Boote nicht übermäßig zu belasten, ließen sie ihre Pferde zurück. Die Stedinger wehrten sich zwar gegen den Ansturm, waren aber noch immer zu überrascht, um planvoll handeln zu können. So gelang es den Kreuzfahrern nun ihrerseits einen Brückenkopf zu errichten und damit das Werk des Gerhard von Diest zu sichern, über das pausenlos Verstärkung eintraf. Die übrigen Boote kamen ein Stück weiter nördlich zum Einsatz, wo sie einen Großteil der Verbände aus dem Raum Altenesch auf die Ostseite der Weser brachten. Die sollten von dort aus ebenfalls in den Brückenkopf hineinstoßen. Das Lager der Stedinger wurde auf der sträflich vernachlässigten Flussseite ungeheurem Druck ausgesetzt. Erst hundert Schritt vom Ufer entfernt, gelang es den Bauern, wieder eine Verteidigungslinie aufzubauen. Beinahe wären sie einfach überrannt worden. Die Ritter hatten durch ihre Kriegslist einen großen Vorteil erreicht, die Schlacht aber noch nicht entschieden. Die Behelfsbrücke trug nur eine begrenzte Zahl gerüsteter Männer gleichzeitig und wurde auch bei vorsichtiger Belastung immer wieder beschädigt. Während der Ausbesserungen kam der Marsch ans andere Ufer ins Stocken. Die Stedinger fanden dadurch Gelegenheit, ihr Heer umzustellen. Dietmar tom Diek begriff, dass die Ritter sich (wenn er nichts dagegen unternähme) allmählich zu einem furchtbaren, eisernen Keil formieren würden. Die Bauern mussten unbedingt versuchen, den Brückenkopf zu beseitigen und die Boote zu versenken. Doch am späten Nachmittag, als es endlich gelungen war, die ganz auf die Ochtum ausgerichteten Einheiten auf die andere Seite des Lagers zu beordern, wagte der Heerführer den Angriff nicht mehr. Das Bewusstsein, auf welch dumme Art er sich hatte übertölpeln lassen, nagte noch immer an seinem Selbstbewusstsein. Zudem bedrängte ihn sein Gewissen. Durfte er fast dreitausend ihm 234 vertrauende Menschen in den möglichen Tod hetzen? Um diese Zeit traf Tammo von Huntorf mit knapp fünfzig, dem Gemetzel von Hasbergen entronnenen Männern ein. Mehr Pferde hatte er nicht auftreiben können und zu Fuß war die Strecke an einem Nachmittag nicht zu bewältigen. Beide Bauernführer hatten sich ihr Wiedersehen anders vorgestellt. Dietmar erfuhr, dass es das kleinere Heer nicht mehr gab, und Tammo sah das größere, auf das er seine letzte Hoffnung gesetzt hatte, in äußerster Bedrängnis. "Könnte es sein, dass uns die Ritter des Arnold von Gavre in den Rücken fallen? Hattet ihr sie dicht hinter euch?" "Nach meinem Eindruck ist eine Vereinigung der Heere nicht vorgesehen. Arnold von Gavre erobert gerade das südliche Stedingen." "Schlimm genug! Das bedeutet, dass wir kein Rückzugsland mehr haben. Wenn wir heute nicht siegen, sind wir verloren." "Uns kann nur noch ein Wunder retten!" "Ja. Ich lasse das Signal zum Angriff geben. Bis zum Abend wird sich entschieden haben, ob Gott noch mit uns ist oder nicht." Er verließ das Zelt, kam aber noch einmal zurück. "Sag deinen Leuten, sie sollen nichts über Hasbergen erzählen." Tammo nickte. Die Schlacht um den Brückenkopf sollte alles übertreffen, was sich bisher während des Krieges zwischen den Stedingern und dem Erzbischof zugetragen hatte. Mehr noch: Um im Bremer Umland Vergleichbares zu finden an Heldentum und an Schrecken, an Größe und an Wahnsinn, muss man weit zurückblättern im Buch der Geschichte, vielleicht bis in jene Zeit, als die Franken Tausende Sachsen töteten, um deren Herzog Widukind in Wildeshausen zur Unterwerfung zu zwingen. Es war dabei eine seltsame Ironie des Schicksals, dass sich dort auf deutschem Boden am Ende Holländer gegenseitig abschlachteten, die Siedler, die vor ein paar Generationen die Heimat verlassen hatten, um in der Fremde ihr Glück zu machen, und die Nachkommen der Zurückgebliebenen. Wie viele entfernte Verwandte mochten sich dabei in wildem Hass gegenüber gestanden haben? Was den Bauern bei ihrem Aufbäumen ungeheure Kräfte verlieh, war paradoxer Weise gerade die Ausweglosigkeit, die sie spürten. Obwohl Tammo seinen Leuten tatsächlich verboten hatte, über das Desaster von Hasbergen zu reden, wusste bald jeder Bescheid. Andererseits glaubte niemand an die Menschlichkeit der Kreuzfahrer. Wenn es also zu sterben galt, so sollte der Tod zumindest würdig sein. Der Ansturm war so wuchtig, dass die Ritter bis fast an den Fluss zurückgeworfen wurden. Dort ging es dann allerdings auch für sie um Leben und Tod - Siegen oder in den Fluten der Weser ertrinken. Als die Lage für die Kreuzfahrer am gefährlichsten war, kam über die Behelfsbrücke eine besondere Art von Verstärkung heran. Mitten zwischen Männern in Rüstungen schritt in würdigem Ernst völlig unbewaffnet eine Gruppe von Geistlichen aus verschiedenen Orden in ihren langen Kutten und Talaren. Sie stellten sich hinter die Kämpfenden und sangen, so laut sie konnten: "Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen" sowie "Heiliger Gott! Heiliger, starker, heiliger, barmherziger Heiland! Übergib uns nicht dem bitteren Tod!" Etliche von ihnen bezahlten ihren freiwilligen Eifer mit dem Leben, doch sie starben ohne Klagen in der frommen Gewissheit, als Märtyrer gefallen zu sein. Und 235 sie waren ein Teil des Irrsinns, den jener Nachmittag gebar. Keine Taktik zählte mehr. Niemand schonte seine Kräfte. Jeder dachte nur noch daran, den Feind zu töten. Viele Bauern opferten sich dafür sogar selbst. Sie sprangen einen Ritter an und stießen ihm, während sie selbst ein Dutzend Mal durchbohrt wurden, den Dolch unter dem Helm genau in den Hals. Die Verluste auf beiden Seiten waren entsetzlich. An einigen Abschnitten ebbten die Kämpfe ab, weil Dutzende übereinander liegende Leichen die Fronten trennten. Auf der Seite der Heldentum der Stedinger hätte daran noch etwas ändern können. Noch immer versuchte Dietmar tom Diek zu tun, was in der neuen Lage geboten schien. Er ritt zwischen seinen Truppen umher, gab Anweisungen, munterte auf. Bald jedoch wurde er zum Spielball einer allgemeinen Fluchtbewegung. Selbst auf sein Pferd griff die Panik über. Es bäumte sich auf und warf den Reiter ab. Der Feldherr stürzte und brach sich beide Beine. Unfähig, sich wieder aufzurichten, wurde er von den eigenen Leuten zu Tode getrampelt. Als sich das Schicksal der Stedinger bei Altenesch schon längst entschieden hatte, war die Gruppe mit Franziska und ihren Freunden noch immer unterwegs, um sich den vermeintlich glücklicheren Brüdern anzuschließen. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit sahen sie ein, ihr Ziel an diesem Tag nicht mehr zu erreichen, und schwärmten aus, um nach geeigneten Herbergen zu suchen. Plötzlich erschienen Reiter am Horizont. Ramira, gewarnt vom besonderen Gefühl der Gaukler für Gefahr, wollte sofort davonlaufen. Dabei aber hätte sie ihre Freundin Franziska im Stich lassen müssen, die noch unter dem Eindruck von Hasbergen stand und sich nicht zurechtfand. Selbstverständlich blieb nun auch Christian. Die Ritter hatten es eilig. Vermutlich lautete ihr Auftrag, zügig bis tief ins Marschland einzudringen, um dort versteckte Truppen der Stedinger aufzuspüren. Das hinderte sie jedoch nicht, all jene zu jagen, die sich unvorsichtig verhielten. Christian fand einen umgestürzten Baum - kein vorzügliches Versteck, aber immer noch das Beste weit und breit. Ramira führte Franziska beim Arm dorthin. Leider entdeckte sie einer der Reiter, ehe sie sich hinter die Deckung geworfen hatten, und sprengte im vollen Galopp auf sie zu. Christian Stedinger fiel Tammo von Huntorf. Die Entscheidung fiel wieder durch das Eingreifen einer Reserve. Die Bauern achteten schon längst nicht mehr auf die Brücke über die Ochtum. Nicht einer von ihnen stand mehr dort, als Dietrich von Cleve seine Rheinländer über sie hinweg führte. Aber letztlich geschah ohnehin nur das, was früher oder später hatte geschehen müssen. Im Grunde war der Krieg mit dem Brückenschlag über die Weser entschieden gewesen. Kein noch so großes 236 konnte mit knapper Not den Hufen des Pferdes ausweichen. Franziska hatte weniger Glück. Das Schwert traf sie am Kopf, zwar nur mit der flachen Seite, jedoch mit voller Wucht. Sie fiel um wie ein vom Blitz gefällter Baum und blieb regungslos liegen. Ramira beugte sich über sie, um sich die Wunde anzusehen. Sie besaß ein wenig Erfahrung im Heilen mit einfachen Mitteln. Die Verletzung sah nicht schlimm aus. Lediglich ein paar dünne Fäden Blut sickerten zwischen den dichten, schwarzen Haaren hervor. Doch das war nur der erste flüchtige Eindruck. Franziska kam nicht wieder zu sich. Ihr Atem wurde immer schwächer und setzte schließlich ganz aus. Nun packte Ramira die Verzweiflung. "Wach auf! Bitte, wach auf!" schrie sie immer wieder. Christian zog sie ein Stück beiseite, weil er fürchtete, sie würde den Verstand verlieren. Dann untersuchte er die Verwundete selbst noch einmal. Als er sich umdrehte, sah er, dass Ramira auf den Knien lag und inbrünstig betete - darauf hoffend, dem Allmächtigen noch ein Wunder abtrotzen zu können. Er sah aber auch, dass die Reiter sich noch immer in der Nähe aufhielten und nach Opfern suchten. "Komm! Wir müssen fort. Für Franziska können wir nichts mehr tun. Ihr Herz schlägt nicht mehr." "Wir können sie doch nicht einfach hier liegen lassen!" "Nur ihr Körper liegt hier. Ihre Seele ist bei Gott." Dann zog er sie mit Gewalt hinter sich her - erst hinter den Baumstamm, dann bis zu einem leeren Stall, in welchem sie die Nacht verbrachten. III R amira und Christian erfuhren erst Wochen später, was sich tatsächlich am 27. Mai bei Altenesch zugetragen hatte. Da sie aber überall auf kleine Trupps von Kreuzfahrern trafen, die sich offenbar im Land der Stedinger ungehindert bewegen konnten, mussten sie von einer Katastrophe ausgehen. Sie suchten nicht mehr nach Kameraden. Nur noch das eigene Leben zählte. Das zu retten, war schwer genug. Sie kannten sich nicht aus, wussten nicht, aus welcher Richtung ihnen die größte Gefahr drohte, hatten seit über einem Tag nichts mehr gegessen. Viele Bauernfamilien verließen aus Angst vor den Kreuzfahrern überstürzt ihre Häuser, auch jenseits der Grenzen des Marschlandes. Nun irrten sie auf den Wegen umher. Andere verbarrikadierten sich - in der lächerlich anmutenden Absicht, ihr Hab und Gut zu verteidigen. Dann gab es noch die Unredlichen, die den allgemeinen Aufruhr ausnutzten, um zu stehlen. Freilich waren letztere nicht in jedem Falle gemeine Schurken. Auch Ramira und Christian reihten sich unter ihnen ein, als sie in einem offen stehenden Haus ihren Hunger stillten. Über den Tod ihrer besten Freunde Franziska und Norbert redeten die beiden kein einziges Mal. Umso öfter dachten sie daran. Für die Gauklerin war der Verlust noch größer als für den Bürgerssohn. In ihrem bisherigen Leben hatte ihr das Schicksal immer wieder die wichtigsten Menschen im ungünstigsten Augenblick entrissen. Meistens war eine verhältnismäßig glückliche Zeit vorausgegangen. Abstürze nach großen Hoffnungen zermürben. Sie 237 rauben nach und nach den Glauben, dem Fluch je zu entkommen. Christian fühlte den schwindenden Lebenswillen bei seiner Freundin. Jetzt wünschte er sich eine ihrer wütenden Attacken oder wenigstens einen ungerechten Vorwurf. Tatsächlich lief sie völlig gleichgültig neben ihm her und er hätte wahrscheinlich mit ihr anstellen können, was er wollte. Dabei war es unmöglich, sie aufzumuntern. Sprach er sie an, antwortete sie einsilbig oder gar nicht. Ihm blieb nichts anderes zu tun, als sie immer weiter mitzuschleppen. Am dritten Tag nahm der Alptraum noch immer keine Ende, im Gegenteil. Sie gelangten in ein Gebiet, durch das die Kreuzfahrer schon einmal gezogen waren. Von mehreren Dörfern zeugten nur noch die qualmenden Reste der Häuser. Und immer wieder fanden sie Tote, in Gruppen oder allein, Männer und Frauen, auch Kinder. Allem Anschein nach wollten die Sieger das Land der Stedinger nicht nur erobern sondern gänzlich entvölkern. Unklar war nur, ob noch jemand den Befehl führte oder ob sich der Krieg schon verselbständigt hatte und die Trupps auf eigene Faust plünderten. Ein paar Meilen weiter verstopfte eine beträchtliche Zahl flüchtender Bauernfamilien die Wege. Das Durcheinander stieg noch dadurch, dass verschiedene einander widersprechende Gerüchte umgingen. Die Menschen strömten mal in diese, mal in jene Richtung und rannten sich dadurch beinahe gegenseitig um. Ramira und Christian blieben in dem Knäuel stecken. Allerdings hatte der unfreiwillige Aufenthalt auch etwas Gutes - sie trafen Bekannte aus dem Dorf Neudeich wieder. Bauer Jörg drängte sich zu ihnen durch und sprach sie an. "Kenne ich euch nicht von der Hochzeit her?" Die beiden nickten. Kaum aber hatten sie ein paar Sätze gewechselt, wurden sie in ein Feld abgedrängt und Jörg fürchtete, seine Angehörigen aus den Augen zu verlieren. "Kommt mit!" schlug er vor. Sie folgte ihm und erfuhren, dass die Bewohner von Neudeich geschlossen aufgebrochen waren. Weil der Bruder des Erzbischofs sie seinerzeit von Norden her überfallen hatte, wollten sie sich in Richtung Süden retten. Dabei wären sie jedoch unweigerlich auf jene Reiter gestoßen, vor denen Ramira und Christian gerade flohen. "Ihr müsst schnellstens umkehren!" rieten sie eindringlich. "Seit ihr ganz sicher? In der Angst irrt man sich leicht." "Wir haben sie gesehen - dreißig Mann. Sie waren uns zeitweilig dicht auf den Fersen." Jörg strich sich nachdenklich übers Kinn. "Wenn sie so nah sind, können wir ihnen mit den Frauen und Kindern nicht mehr entkommen." Beklommenes Schweigen breitete sich aus. Dann war Liemar derjenige, der den Bann brach. "Sagtet ihr, dass es ungefähr dreißig Männer sind?" "Vielleicht auch vierzig." "Wenn sich nun ebenso viele Männer bei uns fänden, könnten wir uns ihnen in den Weg stellen. Wir haben noch unsere Waffen." "Aber sie sind viel besser ausgerüstet als ihr", warnte Christian. "Sie werden euch allesamt töten." "Mag sein, dass sie das am Ende tun. Aber dazu werden sie Zeit brauchen..." Die Neuigkeiten sprachen sich rasch herum und es geschah etwas Erstaunliches. Obwohl sich kaum jemand an diesem Tage noch einer 238 Illusion hingeben konnte, meldeten sich mehr Freiwillige als notwendig. Tatsächlich sollte niemand von ihnen überleben. Die meisten starben während des Scharmützels. Einige wurden verwundet, gefangen genommen und später als Ketzer verbrannt. Ihr Plan aber ging auf. Sie beschäftigten die Ritter nicht nur bis in den Abend hinein, sie erweckten in ihnen auch die Annahme, dass die Stedinger noch nicht endgültig niedergerungen seien. Aus Furcht vor einem Hinterhalt rückte die Schar von nun an sehr viel vorsichtiger und damit langsamer vor. Die Flüchtenden gewannen einen ausreichend großen Vorsprung. Die von den regierenden Herren in Auftrag gegebenen Chroniken enthalten derlei Heldentum nicht. Verzeichnet sind die Taten eines Arnold von Gavre, eines Gerhard von Diest, eines Dietrich von Cleve. Der Mut der Gegner wird erwähnt, wo er geeignet erscheint, den Ruhm zu steigern. In Wahrheit aber stand die Moral von Männern wie Jörg und Liemar weit über jener der Kreuzfahrer, denn sie zogen in den sicheren Tod, damit ihre Familien leben konnten. Eine Frau schenkte Ramira und Christian frische Kleidung. Die war nicht nur sauberer sondern verwandelte die beiden zudem in Dorfbewohner, was ihnen eine mildere Behandlung versprach, falls sie doch noch den Kreuzfahrern in die Hände fielen. Als sie mit der Gruppe weiter zogen, sahen sie auch die kleine Jule wieder. In den zurückliegenden Monaten hatte sie sich in der Geborgenheit ihres Dorfes soweit erholt, dass jemand, der sie nicht von früher her kannte, sie einfach für ein besonders scheues Kind hielt. Durch die Flucht aber wurden die Erinnerungen in ihr wieder wach. Sie benahm sich eigenartig, war zuweilen unberechenbar. Eine Zeitlang lief sie brav neben Luise her, dann rannte sie plötzlich voller Angst davon und hörte auf niemanden mehr. Einmal geriet sie dabei in eines jener tückischen Sumpflöcher, die einen Menschen in kurzer Zeit völlig verschlingen können. Christian warf sich ohne zögern flach auf den Boden und kroch dann bis dicht an das Loch heran. Zugleich band er sich den Strick ab, der seinen Kittel zusammenhielt. Den warf er nun dem Kind zu. "Knote ihn dir fest ums Handgelenk!" rief er. Zum Glück war Jule wieder ansprechbar und tat, was er ihr anwies. Zwei andere Männer packten ihn dann bei den Beinen und zogen ihn zurück auf die Straße. Mehrere Tage lang waren die Flüchtenden unterwegs. Obwohl sie keinen Kreuzfahrern mehr begegneten, wurde der Marsch zu einem Gang durch die Hölle. Sicherheitshalber mieden sie die Dörfer, auch noch, als sie das Stedingerland längst hinter sich gelassen hatten. Dadurch litten sie Hunger. Etliche Frauen und Kinder brachen zusammen und mussten von den anderen mitgeschleppt werden. Schließlich waren alle so geschwächt, dass sie aller Gefahr zum Trotz, ein paar Männer ins nächste Dorf schickten. Zu ihrem Glück hatten sie inzwischen das Gebiet der Friesen erreicht. Die waren den Stedingern freundlich gesonnen und versorgten die Ankömmlinge mit dem Notwendigsten. Zur gleichen Zeit, als die Bewohner von Neudeich nach Norden zu den Friesen flüchteten, bestatteten die Kreuzfahrer die bedeutendsten unter ihren Toten in der Kirche von Warfleth. Zwei wurden dabei besonders geehrt Heinrich III, der Graf von Bruchhausen, der bei Hasbergen gefallen war, und Gerhard von Diest, der Hauptmann der Bootsflotte, den bei Altenesch auf recht merkwürdige Weise sein Streben nach 239 Vollkommenheit ins Verderben geführt hatte. Auf dem Höhepunkt der Schlacht um den Brückenkopf kamen die Bauern einmal so dicht ans Wasser heran, dass sie einige Boote versenken konnten. Gerhard bemerkte das und wollte den Schaden schnellstens beheben. Seine Leute rieten ihm, zu warten, bis die Ritter wieder die Oberhand gewonnen und etwas Raum zurückerobert hätten. Darauf aber wollte er sich nicht einlassen. Nach einem kurzen Streit lief er selber los. Er starb allerdings nicht durch einen Pfeil oder einen Speer. Vielmehr verlor er durch einen heftigen Stoß das Gleichgewicht, stürzte zwischen zwei Boote und wurde zerquetscht. 240 22.Kapitel I E inige Wochen waren vergangen seit den Gemetzeln bei Altenesch und Hasbergen. Um eine Seuche vorzubeugen und vielleicht auch, um das Grauen des Krieges wenigstens äußerlich zu mildern, hatte der Erzbischof schon bald die Räumung der Schlachtfelder angeordnet. Viertausend Leichen waren geborgen worden, in der Mehrzahl Bauern. Die tatsächliche Zahl der Opfer aber lag wesentlich höher, denn blutige Kämpfe hatte es auch anderenorts gegeben und die erschlagenen Frauen und Kinder wurden durch die Chronisten grundsätzlich nicht berücksichtigt. In einem Blutrausch waren die Sieger über dutzende eroberte Dörfer hinweggefegt, alles niederhauend, was sich bewegte. Es rächte sich nun, dass viele Kreuzfahrer Fremde waren, Männer also, denen gleichgültig sein konnte, wenn sie nur verbrannte Erde zurückließen. Ein Fürst, der die Hand auf einen fruchtbaren Landstrich legt, will ihn nicht menschenleer vorfinden. Wer durch das ehemalige Stedingen ritt (sofern er es wagte) fühlte sich in die Unterwelt versetzt. Aus zerschmetterten Häusern ragten einzelne Balken heraus, wie Arme, die Hilfe herbeiwinken wollten. Hier und dort qualmte noch ein Scheiterhaufen. Das waren riesige Holzstöße, auf denen die Ketzerjäger gleich zehn oder fünfzehn Mann auf einmal den Flammen übergeben hatten. Wem das noch immer nicht genügte, der lief durch eines der Geisterdörfer, trat vielleicht auch durch eine der schwarz geränderten Türen. Vielleicht fand er einen gedeckten Tisch vor, vielleicht ein paar verkohlte Leichen, die noch auf der Schlafbank neben dem Herd lagen. Später wüteten die außer Rand und Band geratenen Heere auch in den Grafschaften Wildeshausen und Bruchhausen. Die Ritter und Waffenknechte taten sich dabei zu Banden zusammen. Die Cholera hätte kaum weniger Schaden anrichten, kaum weniger Schrecken verbreiten können. Längst tat sogar der Erzbischof alles, um die von ihm selbst herbeigeholten Dämonen auszutreiben. Das gelang ihm letztlich nur, indem er die Feldherren und Hauptleute durch großzügige Zuwendungen für sich gewann. Erst nach dem Abzug der Holländer konnten Pläne geschmiedet werden für eine Ordnung nach dem Krieg. Erzbischof Gerhard II wusste, dass er mit der Zerschlagung der Universitas Stedingorum die unumschränkte Herrschaft über den mittleren Teil der Nordseeküste noch immer nicht erreicht hatte, denn es gab da ja noch die Oldenburger. Es war ihm (zu seinem großen Bedauern) nicht gelungen, den Grafen Otto in den Kreuzzug zu verstricken. Da dessen einsatzbereite Ritter seit dem Abzug der Holländer eine Macht darstellten, konnte er ihn schwerlich übergehen. Also bestellte er ihn zu Verhandlungen in seinen Palast. Bevor Otto aufbrach, beriet er sich noch einmal mit seiner Frau Mechthild. Er fühlte sich keineswegs uneingeschränkt im Recht. Gottes Gedanken sind nun einmal nicht der Menschen Gedanken. Woher wollte er also wissen, dass er sich an jenem Feldzug wider die ketzerischen Bauern nicht doch hätte beteiligen müssen, ungeachtet des Unglücks, welches dadurch über seine Grafschaft hereingebrochen wäre? Das sind die schwierigsten Entscheidungen, wenn man in jedem Falle ein Gebot missachten, ein Gesetz übertreten muss. Welche Pflicht hat den Vorrang? Sogar die Geistlichen widersprachen einander. "Die Einladung sieht auf den ersten Blick freundlich aus, aber an einigen Formulierungen spürt man die wahre Absicht. Er wird mich abkanzeln, wird unter Androhung schwerer Kirchenstrafen seine Forderungen stellen. Und leider bin ich nicht so abgebrüht wie mein Vater. Ich würde eine Exkommunikation nicht länger als eine Woche aushalten, würde zu Kreuze kriechen. Zu einem Helden bin ich nicht geschaffen, auch wenn das neuerdings einigen Leuten so vorkommen mag." "Ich verstehe deine Zweifel. Andererseits müssen wir uns fragen, welche Wahl uns eigentlich bleibt, wenn wir wie bisher auch weiterhin Schaden von unserer Grafschaft abwenden wollen. Der Erzbischof wird jede unserer Schwächen für seine Politik ausnutzen. Denke nur daran, wie er mit seinen Verbündeten, den Wildeshausenern und Bruchhausenern umspringt! Er hat sich ihrer bedient und nun, da sie (nicht zuletzt durch seine Schuld) schwer getroffen am Boden liegen, nun lässt er sie im Stich. Gerhard ist ein gefährlicher Mann." "Was also empfiehlst du mir?" "Ich kann für dich nichts entscheiden, zumal ich nicht weiß, was er dir zu sagen gedenkt. Ich kann dir nur raten, dir keine Schuldgefühle anmerken zu lassen. Du solltest hart bleiben, wie sehr auch immer er dich bedrängt." "Ich soll mich beteiligen an diesem widerlichen Gerangel? Das kannst du nicht wirklich wollen!" "Wahrscheinlich geht es längst nicht mehr nur um das Land der Stedinger. Ich fürchte, Gerhard will die Schwäche seiner Nachbarn ausnutzen, um sich noch sehr viel mehr anzueignen. Sicherlich streckt er die Hand auch nach unserem Besitz aus." Die Verhandlungen im Palast des Erzbischofs zu Bremen begannen sonderbar. Gerhard II hatte eine Vorführung arrangiert, mit der er den nach seiner Überzeugung hoffnungslos weltfremden Otto ein für allemal einschüchtern wollte. Er steckte ein paar seiner Diener in prächtige Gewänder und befahl ihnen, sich als Abgesandte des Papstes auszugeben. Im Übrigen hatten sie seine Worte möglichst nachdrücklich zu bestätigen. Der Graf von Oldenburg wurde dann vom Beginn seiner Ankunft an mit ungewöhnlichen Anweisungen und merkwürdigen Gerüchten bedrängt. Ehe er über das eine zu Ende nachgedacht hatte, ereilte ihn schon das nächste. Tatsächlich verunsicherte ihn das mit der Zeit. Als er endlich Einlass ins Audienzzimmer erhielt, war aus seinem Kopf alles verschwunden, was er sich als Widerrede zurechtgelegt hatte. "Der Heilige Vater ist ungehalten über dein Verhalten", hörte er den Erzbischof streng sagen. "Äußerst ungehalten", echote einer der vier Männer, die links und rechts Aufstellung genommen hatten. "Und er hat es mir anheim gestellt, dich in angemessener Weise zur Verantwortung zu ziehen." Gerhard ließ eine längere Pause entstehen, während der er seinen Gesprächspartner scharf beobachtete. "Ich habe lange nachgedacht, um zu einer, alle Umstände berücksichtigenden, Entscheidung zu gelangen. Um ehrlich zu sein - ich erwog sogar, dir die Grafenwürde auf Lebenszeit abzuerkennen." Eigenartiger Weise fand Otto trotz dieser Drohungen seine Fassung wieder. Etwas, das er nicht hätte benennen 242 können, beruhigte ihn, sagte ihm, dass seine Zeit noch kommen würde an diesem Tag. Vielleicht lag es daran, dass der Kirchenfürst überzog. Das alles erinnerte gar zu sehr an einen Gauklerauftritt auf dem Jahrmarkt. "... Ich habe mich aber an unseren Herrn Jesus Christus erinnert, der in seiner Güte selbst den ärgsten Sündern verzieh, um ihnen die Gelegenheit zu geben, sich zum Guten zu ändern. Allerdings wird es von deinem Verhalten in den nächsten Monaten abhängen, wie mein endgültiges Urteil lautet." Beim letzten Satz stieg in Otto ein Verdacht auf. In den nächsten Monaten musste die Entscheidung über die Aufteilung des von den Kreuzfahrern eroberten Landes fallen. Der Graf sah sich die angeblichen Abgesandten des Papstes genauer an und fand seine Vermutung bestätigt. Spontan entschloss er sich, den Erzbischof in ähnlich plumper Weise in die Parade zu fahre. "Eure Eminenz täten gut daran, sich nicht durch eine offenkundige Lüge selbst herabzusetzen", sagte er mit einem liebenswürdigen Lächeln. Gerhard verstummte mitten im Satz. Dabei beeindruckte ihn weniger die Tatsache, ertappt worden zu sein, als die Respektlosigkeit, mit welcher der Graf sich gegen ihn auflehnte. Die Bemerkung kam einer Kriegserklärung gleich. Er brauchte Zeit, sich zu beruhigen, und trat ans Fenster, wie es seine Gewohnheit war, wenn er die Beherrschung zu verlieren drohte. Dann schickte er die Diener mit einer Handbewegung hinaus. "Bist du dir sicher, dass nicht morgen sein kann, was heute noch nicht ist?" "Ich bin mir sicher, dass regierende Herren wie wir nicht reden sollten wie junge Dorfpriester. Wir wissen beide, worum es geht." "Drücke dich deutlicher aus!" "Gern! Der Kreuzzug hat nur zwei wirklich mächtige Männer in der Gegend übrig gelassen - Euch, Eminenz, und mich. Wir sollten uns auf Einflussgebiete einigen." Gerhard lachte gekünstelt und rief voller Entrüstung: "Was gibt es da zu bereden? Willst du beanspruchen, was du dir nicht in der geringsten Weise verdient hast?!" Otto setzte an Stelle einer Antwort wieder sein herausforderndes Lächeln auf. Wohl war ihm nicht bei dem Spiel, was er da trieb. Wenn es wirklich zum Äußersten kam, hatte der Kirchenfürst die besseren Aussichten auf den Sieg. Dabei würde nicht nur die Zahl der Ritter entscheiden. Andererseits konnte der Graf nicht plötzlich zurückzuweichen. "Nichts wirst du bekommen!" schnaubte Gerhard. "Nicht ein einziges Feld! Ich schwöre es! Und ich werde Mittel finden, dich zu züchtigen." Dann läutete er nach einem Diener und ließ seinen Gast hinaus geleiten. Der rüde Hinauswurf war allerdings nicht das Ende der Verhandlungen sondern in gewisser Weise deren Anfang. Erzbischof Gerhard erwog die verschiedenen Möglichkeiten, die ihm offen standen, und gelangte dabei (so schwer es ihm auch fiel) zu dem Entschluss, sich mit den Oldenburgern zu einigen. Er hätte die Verbündeten aus dem Kreuzzug, allen voran die Wildeshausener und die Bruchhausener, noch einmal aufbieten können. Doch dazu hätte er sie wieder zu Kräften kommen lassen müssen - was er unbedingt vermeiden wollte. Das übersichtliche Kräfteverhältnis kam ihm gelegen. Zugleich verhielt Otto sich klug. Er richtete ein Schreiben an den Erzbischof, in welchem er diesem den Anspruch auf die Vorherrschaft in der 243 Region zubilligte. Obwohl er jedes Eingeständnis von Schuld vermied, sowohl was den Kreuzzug, als auch was den Besuch in Bremen betraf, ebnete er damit den Weg für neue Gespräche. Gerhard konnte den Grafen, der sich gedemütigt hatte, abermals einladen. Auch bei den Verhandlungen selbst vermied Otto alles, was die Stimmung wieder hätte anspannen können. Im Grunde feilschte er halbherzig. Als der Erzbischof ihm das an seine Grafschaft unmittelbar angrenzende Nordstedingen als Abfindung anbot, stimmte er beinahe hastig zu. II E in prunkvoller Raum kann unter gewissen Umständen sehr trostlos wirken. Heinrich der Bogener empfand das so, als er mit dem Burgvogt in einer Ecke des Rittersaals saß. Es war mit der Grafschaft in Folge des Kreuzzugs so weit gekommen, dass selbst Landadlige Not litten, weil die Bauern sich (ihrer Verluste wegen) weigerten, ihre Abgaben zu entrichten. "Was sollen wir tun?" fragte der Graf. "Wir könnten die Schulzen zur Rechenschaft ziehen." Der Burgvogt schüttelte den Kopf. "Die Bevölkerung in den Dörfern ist gereizt. Wenn wir Gewalt anwenden, droht uns ein Aufstand." "Aber wenn wir die Ungesetzlichkeiten durchgehen lassen, werden sie mich als unfähig ansehen und erst recht zum Teufel jagen." "Ja. So ist es. Leider!" Heinrich hatte den Burgvogt früher nicht gemocht und wäre nie auf den Einfall gekommen, eines Tages mit ihm im selben Boot zu sitzen. Doch sie hatten sich wohl auch beide verändert in den zurückliegenden Monaten. Sie waren gealtert. "Nein, nein! Es ist unwürdig, sich so treiben zu lassen. Ich werde noch heute übers Land reiten und nach dem Rechten sehen." Er war tatsächlich entschlossen, noch eine äußerste Anstrengung zu unternehmen, um seine Grafschaft zu retten. Nicht zuletzt vor Agnes fühlte er sich dazu verpflichtet. Ihr gegenüber galt es, die Schande zu tilgen, die er durch seine Flucht in den Geheimgang auf sich geladen hatte - auch oder gerade weil sie ihm das niemals vorwarf. "Ich werde die Ordnung wiederherstellen", bekräftigte er und stand auf. Als er aber sein Pferd aus dem Stall holen wollte, hielt ihn der Diener Boleke auf. "Herr Graf, Eure Vettern sind soeben eingetroffen. Sie wollen so bald als möglich mit Euch sprechen." Heinrich begriff zunächst nicht, wer gemeint sein mochte. Dann jedoch erkannte er am Zaumzeug eines fremden Pferdes, das ein Knecht zur Futterkrippe führte, das Wappen der Bruchhausener. "Gut! Ich gehe sofort wieder hinauf." Heinrich der Jüngere und Ludolf trugen als Zeichen ihrer Trauer ausschließlich Kleidung aus grobem Gewebe. Inwieweit sie tatsächlich Kummer empfanden, wusste kaum jemand so genau, doch waren die meisten der boshaften Gerüchte, die das mit Hinweis auf den Ehrgeiz der beiden anzweifelten, sicherlich erfunden. Es gab bessere Erbschaften. Der urwüchsige Landesvater fehlte überall. Die Söhne waren nicht in gleichem Maße 244 fähig, für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen. "Wir grüßen dich, lieber Vetter", sagte Heinrich der Jüngere. Auch Ludolf entbot einen Gruß. Das Lächeln allerdings geriet ein wenig verzerrt. Der Weg zur Burg des ehemaligen Erzfeindes war den beiden nicht leicht gefallen. Umso mehr fragte sich Heinrich der Bogener, was sie wohl dazu getrieben haben mochte. "Ihr seid mir willkommen! Was kann ich für euch tun?" "Das ist mit drei Worten nicht gesagt. Wir sind müde vom Reiten." Der Graf von Wildeshausen führte die beiden persönlich in ein schönes Zimmer im Palas und ließ sie dann allein. Am nächsten Tag fanden die Verhandlungen statt. Die Stimmung war am Anfang naturgemäß gespannt, löste sich aber im weiteren Verlauf allmählich. Die Farben des Sommers, die lustigen Lieder, die ein paar Musikanten in Schellenkostümen vorspielten, und (nicht zuletzt) ein paar Becher Wein hellten die düsteren Mienen der Brüder aus Bruchhausen auf. Sie begannen, von ihren Erlebnissen während des Kreuzzugs zu berichten und fanden willige Zuhörer. Heinrich der Bogener hatte die sechs einflussreichsten Ritter seiner Grafschaft als Zeugen aufgeboten. Außerdem saßen von seiner Seite her noch der Burgvogt und weitere drei Hofbeamten mit an der Tafel. Die Gruppe der Gäste bestand aus insgesamt sieben Personen. Freilich brachte dieses Gelage wenig im Hinblick auf das Ziel der Verhandlungen. Über die wichtigen Dinge mochten die drei maßgeblichen Männer nur untereinander hinter verschlossenen Türen reden. Dabei zeigte sich dann, dass die Feindschaft der Väter in den Söhnen fortlebte. Immer wieder drohten die Gespräche zu scheitern. Nur die persönliche Achtung, welche die beiden Heinriche voreinander hatten, glättete die Wogen dann. Andererseits sprachen etliche Vernunftgründe für ein Zusammengehen der Betrogenen des Kreuzzugs. Die Oldenburger waren übermächtig geworden. Noch regierte dort ein friedliebender Graf. Was aber würde geschehen, wenn diesem ein machtbesessener Mann von der Art des im Kirchenbann gestorbenen Moritz folgte? Nach einer Woche wurde im Rittersaal ein historischer Vertrag abgeschlossen. Heinrich der Bogener von Wildeshausen sowie die Brüder Heinrich der Jüngere und Ludolf von Bruchhausen besiegelten nichts Geringeres als die Union, das heißt die Verschmelzung der Grafschaften. Schritt für Schritt sollten in der Zukunft alle noch bestehenden Hindernisse und Gegensätze abgebaut werden. Bewusst offen gelassen war die Frage, wer das am Ende dieses Weges entstandene Gebilde regieren sollte. Schwarzseher meinten, dass somit der Keim zum Scheitern schon im Vertragstext selbst enthalten sei. Am Abend nach der Abreise der Gäste traf sich Heinrich der Bogener mit Agnes von Westerholt, und nach langer Zeit tat er das wieder ohne ein unterschwelliges Gefühl der Scham. Er konnte immerhin von sich behaupten, schon Monate zuvor den Vorschlag für ein Bündnis unterbreitet zu haben. Nun waren die seinerzeit so überheblichen Bruchhausener darauf zurückgekommen, wohl nicht auf Knien aber auch alles andere als triumphal. Heinrich fühlte sich als Sieger. In der Art, wie Agnes ihm entgegen kam, spürte er, dass sie das genau so sah. Sie konnte wieder stolz sein, zu ihm zu gehören. 245 Ganz frei von abergläubischer Furcht hatte ihn der Unionsvertrag aber nicht werden lassen. Tief in seinem Unterbewusstsein blieb ein Stachel. Der ließ ihn zum Beispiel zurückzucken, als Agnes wieder einmal die Hochzeitsfrage berührte. Er war fest überzeugt, dadurch die bösen Geister zurückzurufen. Andererseits konnte er auch nicht ablehnen, ohne sein Gesicht zu verlieren. Er wand sich lange und flüchtete sich schließlich in Halbheiten. Die Verlobung sagte er zu und bekannte sich auch wirklich zwei Wochen später in aller Öffentlichkeit zu der Ritterstochter. Die eigentliche Hochzeit hingegen schob er hinaus mit der Behauptung, es fehle vorläufig an Mitteln, um sie standesgemäß feiern zu können. III R amira saß etwa abseits des Weges auf einem Stein und starrten den Bauern nach, die mit ihren geschulterten Arbeitsgeräten zu ihren Feldern gingen. Gegen die Sonne wirkten sie schwarz und erinnerten an Schattenrisse. Die junge Gauklerin fühlte in sich eine vollkommene Leere. Sie hatte Hunger, konnte sich aber nicht entschließen, nach Essen Ausschau zu halten. Das wäre ohnehin nur auf Betteln hinaus gelaufen. Sie hatte in ihrem Leben schon oft gebettelt. In einer großen Stadt wie Köln war das freilich eine andere Sache. Dort gab es viele Bettler und viele reiche Leute, die durch Almosengeben ihr schlechtes Gewissen beruhigten. In einem Dorf dagegen hatten Bettler nichts verloren. Dort durfte nur essen, wer auch arbeitete, ausgenommen ganz kleine Kinder, sehr alte Leute und sehr kranke Menschen. Ramira kam mit den bäuerlichen Arbeiten nicht zurecht und war zu stolz, sich bei den Kindern und Schwachsinnigen einordnen zu lassen. Lieber hungerte sie. Auch das hatte sie gelernt. Christian war zwar auch nicht der Geschickteste, biss sich aber leidlich durch. Es hätte ihn nicht gestört, den Lohn mit seiner Freundin zu teilen. Sie wehrte sich aber verbissen dagegen und allmählich musste er sich um sie sorgen. Sie, die ohnehin zierlich war, magerte noch weiter ab und bekam ein spitzes Gesicht, aus dem die klarblauen Augen stechend wie bei einem religiösen Fanatiker heraus schauten. Christian argwöhnte, dass sie den Tod nicht mehr fürchtete, dass sie schon halb entschlossen war, ihrer Freundin Franziska in die andere Welt zu folgen. Als er sie dort auf dem Stein sitzen sah, verließ er kurz entschlossen die Schlange der Bauern und ging zu ihr. "So kann das nicht weiter gehen", sagte er, mehr zu sich selbst. Auf ein Gespräch konnte er nicht hoffen. Ramira antwortete seit einigen Tagen nur noch einsilbig und wirkte abwesend dabei. Ihm blieb nur, einen Monolog zu halten. "Du willst dem allen ein Ende machen und vielleicht hast du es ja schon bald geschafft. Danach kommst du sicherlich ins Paradies. Jesus liebt die Leidenden und du musstest im Leben genug ertragen. Aber weißt du auch, dass ich allein deinetwegen die Frauen nicht mehr hasse? Durch dich bin ich ein anderer Mensch geworden. Da gibt es plötzlich Träume und Pläne, auf die ich vor ein paar Jahren bestimmt nicht gekommen wäre. Du hast mich manchmal ziemlich ungerecht behandelt. Aber ich habe es mir gefallen 246 lassen. Findest du das nicht auch irgendwie sonderbar? Nun ja, ich bin ganz verrückt vor Angst, dich zu verlieren. Ich brauche dich." Er seufzte und ließ sich rücklings ins Gras fallen. "Vielleicht bin ich selbstsüchtig. Ich darf nicht über dich und dein Leben bestimmen. Aber ich will trotzdem, dass du weißt, was du da anrichtest." Er konnte nicht sehen, wie Ramira leicht zu zittern begann und wie sich (was selten bei ihr vorkam) ihre Augen mit Tränen füllten. "Warum ist das nur alles so schwer", flüsterte sie nach einer Weile. Da fasste er sich ein Herz und nahm sie fest in die Arme. "Wir gehen weg aus Friesland. Wir gehen irgendwohin, wo es dir besser gefällt. Willst du das?" Er spürte, wie sie nickte. Sie warteten allerdings noch eine Woche, damit sie ihren Hungerstreik aufgeben und wieder zu Kräften kommen konnte. Außerdem blieb ihnen dadurch Zeit, über ein halbwegs sinnvolles Ziel nachzudenken. Sie entschieden sich für die Wardenburg. Dort wollten sie zwar nicht bleiben, dort war ihnen aber eine Unterkunft sicher. Und sie würden Neuigkeiten erfahren. Wohin konnten sie sich gefahrlos wenden? Wüteten die Inquisitionsgerichte noch immer? Schließlich gab es da eine traurige Pflicht zu erfüllen. Der Ritter und seine Frau wussten wahrscheinlich noch nichts vom Tod ihrer Tochter. Auf der Wiese vor der Zugbrücke betreute Pentia gerade die kleine Beatrice und ein paar andere Kinder. Sie war sehr erfinderisch bei den Spielen und die Kleinen dankten es ihr, indem sie vor Vergnügen kreischten. So dauerte es einige Zeit, bis jemand Christian und Ramira überhaupt bemerkte. "He! Kennst du uns nicht mehr?" Pentia blickte sich um und stutzte. Dann fiel sie den Freunden stürmisch um den Hals. "Als ich von diesen schrecklichen Schlachten hörte, hatte ich keine Hoffnung mehr, euch jemals wieder zu sehen. Und nun seid ihr da! Ich sage Vater Bescheid, damit er euch willkommen heißt. Gebt für mich auf die Kinder Acht!" Christian und Ramira fanden keine Gelegenheit, sie auf die schlimme Botschaft vorzubereiten. Auch später, als Wilhelm und Martha kamen und die Gäste in den Wohnturm einluden, mochten sie die Stimmung nicht zerstören. Schließlich aber mussten sie dann doch die Wahrheit sagen, denn natürlich wollten die beiden vor allem hören, wie es ihrer Tochter ergangen war. Christian sah Ramira an und fragte wortlos, ob sie wirklich alles erzählen sollten. Sie bat ihn (ebenso wortlos), nicht zu beschönigen, denn sicher hätten die aufmerksamen Eltern ihre frommen Lügen durchschaut. So berichtete er also, wie die Reiter plötzlich aufgetaucht waren und wie er gemeinsam mit seiner Freundin versucht hatte, die verstörte Franziska hinter einen umgestürzten Baum in Sicherheit zu bringen. "Leider entdeckte uns einer von ihnen. Alles ging so schnell..." Wilhelm fiel das Sprechen schwer. Dennoch sagte er: "Ihr braucht euch nicht zu entschuldigen. Es war nicht eure Schuld. Hatte sie wenigstens ... einen leichten Tod?" "Ich denke, sie begriff gar nicht recht, was geschah", antwortete Ramira. "Das Schwert traf sie am Kopf. Sie fiel um und bewegte sich nicht mehr. Ich beugte mich noch über sie, sah mir die Wunde an." 247 "Sie schrie immer wieder 'Wach auf! Wach auf!'", ergänzte Christian. "Aber das Herz schlug nicht mehr." "So ist sie also auf dem Schlachtfeld geblieben?" fragte Wilhelm. Das junge Mädchen starrte beklommen vor sich auf den Fußboden. "Wir konnten ihr doch nicht mehr helfen. Ich habe noch für sie gebetet. Leider wollte der Allmächtige kein Wunder für uns tun." "Ich zerrte Ramira mit Gewalt bis zu einem leeren Stall", beendete Christian den Bericht. "Ich wollte sie nicht auch noch verlieren." Wilhelm beruhigte die beiden abermals: "Ich werfe euch nichts vor." Er meinte das durchaus ehrlich. Allerdings war er von der Nachricht so erschüttert, dass er sich zurückzog und erst am nächsten Tag wieder sehen ließ. Zwei Wochen lang fanden die Flüchtlinge in der Wardenburg ein Zuhause. Der Ritter und seine Frau bestanden darauf, dass sie blieben. Ramira fürchtete allerdings, bald wieder in derselben demütigenden Lage zu sein wie zuvor in Friesland. Deshalb kam ihnen der erstaunliche Bericht eines wandernden Kaufmanns gerade recht. Seiner Darstellung nach gab es in Bremen einen Mangel an Arbeitskräften. Die Bremer hatten sich (in der trügerischen Hoffnung auf reichen Lohn) mit vielen Freiwilligen an den Kreuzzügen gegen die Stedinger beteiligt. Weil es ihnen aber an Geschick, guten Waffen und Rüstungen mangelte, waren ungewöhnlich viele von ihnen aus den blutigen Schlachten nicht zurückgekehrt. "Die Meister suchen händeringend nach jungen Leuten, die ihnen zur Hand gehen." "Aber ein paar Fragen nach der Vergangenheit werden sie doch wohl trotzdem stellen?" warf Christian misstrauisch ein. "Sie werden sich hüten!" Der Kaufmann lachte. "Ganz im Vertrauen: Nach fünf verrückten Jahren hat in Bremen jeder irgendwie Dreck am Stecken. Die einen haben mit dem Stadtherrn finstere Geschäfte abgeschlossen, die anderen gegen ihn Verschwörungen angezettelt. Die einen haben ihre Nachbarn für eine fremde Angelegenheit in den Tod gehetzt, die anderen heimlich mit den Bauern verhandelt. Wer kennt sich da noch aus? Damit nicht alles zu Grunde geht, haben sich die Bürger stillschweigend auf eine Übereinkunft geeinigt: Niemand fragt nach der Vergangenheit." Christian war aber noch immer nicht gänzlich beruhigt. "Die Meister wollen Gesellen, die das Handwerk schon einigermaßen beherrschen." "Wenn sie solche kriegen. Die meisten sind bescheiden geworden. Wer nicht gerade zwei linke Hände hat, lässt sich immerhin ausbilden." "Wir sollten es wenigstens versuchen", mischte Ramira sich ein. Irgendetwas musste sie schließlich tun, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und da erschien ihr die große Stadt immer noch mehr Möglichkeiten bereit zu halten als ein Dorf oder eine abgelegene Burg. Christian ließ sich leicht umstimmen. Am nächsten Tag saßen die beiden schon auf dem Wagen des Kaufmanns auf dem Wege nach Bremen. IV 248 E iner der ersten Menschen, den Christan bei seiner Rückkehr in die Heimatstadt traf, war Andreas, der Gesinnungsgenosse aus den romantischen Tagen unbedarfter Rebellion. Er ging erstaunlich gut gekleidet und versuchte zunächst, die Begegnung zu vermeiden. Sein Pech war, dass ihm der Wagen des Kaufmanns den Rückzug versperrte. Nun stellte er lärmende Freude zur Schau. "Sei gegrüßt, du Herumtreiber!" rief er. "Du hast dir eine gute Zeit fürs Heimkehren ausgesucht." Dabei bemühte er sich, den Anhänger einer Halskette zu verbergen - bis ihm klar wurde, dass er sich lächerlich machte. Er gab den Anhänger frei, während auf seinem Gesicht ein Ausdruck herausfordernden Trotzes erschien. 'Sieh mal an!' dachte Christian bei sich. 'Da hat also jemand das Lager gewechselt!' Wirklich überrascht war er eigentlich nicht darüber, den einstigen Gefolgsmann Gottfrieds nun als einen Beamten des Erzbischofs anzutreffen. Er hatte Andreas schon immer als Duckmäuser angesehen, als völlig unzuverlässigen Gesellen ohne eigene Meinung und ohne Gewissen. Es war nur folgerichtig, dass er nun dem Sieger des Kreuzzugs zu Munde redete. Aus Boshaftigkeit stellte Christian sich aber dumm und erkundigte sich mit feinem Lächeln: "Wie geht es Gottfried? Du kommst doch sicherlich noch ab und an mit ihm zusammen." Andreas lief rot an. Um nicht sein Gesicht zu verlieren, musste er sich auf das Spiel einlassen. "Ich denke, er hat keinen Grund, sich zu beklagen. Letztlich bekommt jeder, was er verdient. Natürlich laufen in dieser schlechten Zeit auch bei ihm die Geschäfte nicht mehr so gut. Seit dem Kreuzzug muss er die Arbeit in der Kanzlei allein erledigen. Das ist wohl ein bisschen zuviel für ihn." Endlich war der Kaufmannswagen beiseite gerollt und er konnte sich verabschieden. Christian nahm sich vor, ihn bei der nächsten Begegnung einfach zu übersehen. Viel mehr als dieser schäbige Verräter beschäftigte ihn die Bemerkung über Gottfried. Das war nichts weniger als ein Fingerzeig Gottes. Leider hatte sich Christian seinerzeit auf eine nicht eben anständige Weise davongeschlichen. Konnte er nun einfach dort wieder auftauchen und tun, als wäre nichts gewesen? Es fiel ihm schwer, zu Kreuze zu kriechen. Für Ramira aber rang er sich dazu durch. Auch Gottfried hatte sich in den zurückliegenden Monaten verändert, freilich in anderer Weise als Andreas. Ruhig und bedächtig war er auch früher schon gewesen. Nunmehr aber drückte sich darin nicht mehr die Siegessicherheit eines von Erfolgen verwöhnten Menschen aus sondern die Weisheit eines von schweren Niederlagen gezeichneten. Dabei ließen sich seine Verletzungen nicht genau benennen. Dass er dem Rat nicht mehr angehörte, bezeichnete er selbst als Segen. Angesichts der Demütigungen, die er hatte hinnehmen müssen, glaubte ihm Christian das aufs Wort. Auch die Geschäfte liefen nicht so schlecht wie von Andreas angedeutet. Dank zäher Arbeit brauchte er keinen Ruin zu befürchten. Es war wohl vor allem der Verrat, der ihn verbitterte. Nicht nur Andreas hatte ihm den Rücken gekehrt, als sich der Sieg des Erzbischofs abzeichnete. Und der hatte es nicht einmal in der schäbigsten Art getan. Seit Gottfried wusste, wie niederträchtig Menschen sein können, fiel es ihm schwer, überhaupt noch jemandem zu vertrauen. Andererseits kannte er nun den Wert der Schwärmer, mit denen sich kaum große Siege erringen ließen, die oft unbequem waren, die aber auch in schlechten Zeiten nicht umfielen. Christian wurde völlig anders empfangen, als er erwartete hatte. Er fand keine Gelegenheit, die vorher zu Recht gelegten Entschuldigungen vorzubringen. Gottfried bestand darauf, dass er eine Schuld abtragen müsse. Großzügig bot er den beiden seine Hilfe an, damit sie in Bremen Fuß fassen konnten. Dabei bestätigte er im Wesentlichen, was der Kaufmann gesagt hatte. Es gab genügend Arbeit in der Stadt, sogar für ein junges Mädchen wie Ramira, das noch nie mit einem Handwerk in Berührung gekommen war. Christian jedoch merkte, dass er sie gern selbst behalten wollte und sagte: "Warum sollen wir uns woanders umschauen, wenn wir hier bei dir gebraucht werden?" Da lächelte Gottfried und holte einen Krug guten Wein, um auf das Wiedersehen anzustoßen. Christian konnte Lesen, Schreiben und Rechnen. Er hatte es seinerzeit geradezu heimlich gelernt, aus Trotz gegen seinen Stiefvater, den ungebildeten Tischlermeister. Für seine Arbeit in der Kanzlei brauchte er dieses Wissen nur wieder zu beleben. Er spürte, wie er sich von Tag zu Tag besser zu Recht fand, und war guter Dinge. Ramira hätte Gottfrieds Frau im Haus unterstützen können. Das lehnte sie aber ab. Noch hegte sie die Hoffnung, in der Stadt etwas Besseres zu finden. Möglichkeiten, den Lebensunterhalt zu verdienen, gab es tatsächlich genug. Zu ihrem Leidwesen war jedoch nichts dabei, was ihr wirklich zusagte. Überall hätte sie sich auf die unterste Sprosse einer langen Stufenleiter verweisen lassen müssen. Als sie nun eines Tages wieder einmal schwer enttäuscht heimkehrte, kam Christian auf einen Ausweg. "Du bist ein kluges Mädchen. Ich könnte dich in die Kanzleiarbeit einweisen. Wenn die Geschäfte wieder bessere gehen, sind hier zwei Leute gut beschäftigt." Sie stutzte und war sich einen Moment lang nicht sicher, ob er sich vielleicht einen Scherz mit ihr erlaubte. "Ich meine das ernst", versicherte er jedoch. "Wenn du einverstanden bist, rede ich gleich morgen mit Gottfried." Auch der Kaufherr wusste zunächst nicht, ob er lachen oder nachdenken sollte. Irgendwie fand er den Vorschlag abwegig. Zwar gab es etliche Frauen in Bremen, die sich mit der Buchhaltung auskannten, doch das waren Bürgerstöchter mit einer entsprechenden Erziehung von Kindheit an, keine Gauklerinnen. Er traute Ramira einfach nicht zu, die Kunst des Lesens je zu erlernen, vom Schreiben und Rechnen erst gar nicht zu reden. Andererseits wollte er nicht im Wege stehen und so gab er mit mildem Lächeln seine Zustimmung. Natürlich war sich auch Christian seiner Sache nicht sicher. Insgeheim fürchtete er, seine Schülerin würde nicht recht vorankommen und ihm dann Vorwürfe machen. Doch Ramira widerlegte alle Vorurteile. Sie entwickelte gewaltigen Ehrgeiz und erwies sich als begabt. Christian musste sich eingestehen, vor Jahren nicht so rasch begriffen zu haben. Der Unterricht war für beide bald mehr Vergnügen als Anstrengung. Das Lesen übten sie anhand eines derb-lustigen Büchleins, das vergessen in den Tiefen eines Schubkastens herumlag. Ohne, dass sie sich dessen bewusst wurden, kamen sie einander immer näher, nicht nur gefühlsmäßig sondern auch körperlich. Wenn er ihr beim Entziffern eines schwierigen Wortes half und sich zu ihr herüber beugte, spürte er ihren Atem auf der Wange. 250 Das Buch trieb sie einander in die Arme und diente gleichzeitig als Ausrede. Das Schreiben übte sie häufig allein. Zeigte er ihr aber etwas Neues, ließ sie sich auch mal von ihm die Hand führen. Übrigens fühlte sie sich dabei niemals bevormundet. Die unverhoffte Möglichkeit, in die geheime Kunst der Reichen einzudringen, hatte sie sichtlich besänftigt. Sie war Christian dankbar und bereute im Stillen ihre Angriffslust in den zurückliegenden Monaten. Die Kanzlei lag im Haus ein wenig abseits. Jemand, der Ruhe brauchte, um schwierige Berechnungen anzustellen, hatte dort einen vorzüglichen Arbeitsplatz. Für Christian und Ramira war er zugleich ein verschwiegener Winkel. Gottfried kam nur zu bestimmten Zeiten zu ihnen. Zudem verriet ihn rechtzeitig eine knarrende Treppe. Keiner von beiden bedrängte den anderen. In ihrem Unterbewusstsein war noch immer viel an Bedenken übrig geblieben. Ihr Verstand hätte sich vermutlich niemals für ein Zusammengehen entschieden. In einem besonderen Moment aber regierten ganz andere Kräfte in ihnen. Als er ihr wieder einmal die Hand beim Schreiben führte, berührte er ungewollt ihre Brust. Dabei riss sich in ihm etwas los. Sein Herz begann wie wild zu schlagen. Er starrte Ramira mit großen runden Augen an, sich jäh wieder erinnernd, dass sie ein Mädchen war - mit allem, was zu einem Mädchen gehörte. Eine Kleinigkeit hätte den Augenblick ohne Folgen vorübergehen lassen, ein erschrockener Blick, eine Abwehrbewegung. Es wäre leicht gewesen, ihn abzukühlen. Und umgekehrt bildete sie sich bis zuletzt ein, die Liebe nicht wirklich zu wollen. Tatsächlich aber ließ sie bereitwillig zu, was geschah. Er streifte ihr hastig die Kleider über den Kopf und nahm sie auf dem Fußboden. Sicherlich hatten sich Paare schon kunstvoller und vergnüglicher vereinigt als Christian und Ramira an jenem Nachmittag in der Kanzlei. Doch mit dem einen mal war ein Bann gebrochen. Von nun an küssten und umarmten sie einander mit der Selbstverständlichkeit Langverliebter. Es stand keine abergläubische Scheu mehr zwischen ihnen. Sobald sie sich vor Störungen sicher wähnten, entkleideten sie sich, um sich zu liebkosen. Besonders reizvoll fanden sie es, völlig nackt ein paar Seiten zu lesen. Ab wann Gottfried wusste, was sich in seiner Abwesenheit in der Kanzlei abspielte, blieb unklar. Vielleicht verdächtigte er die beiden schon zu einer Zeit, als sie dort noch keusch nebeneinander lernten und arbeiteten. Eines Tages jedenfalls konnte er beim besten Willen nicht mehr die Augen verschließen. Er fürchtete, ins Gerede zu kommen, und bestellte das Pärchen zu sich. "So kann das nicht bleiben", sagte er ungewohnt streng. "Entweder ihr trennt euch zu dieser Stunde - oder ihr heiratet." Sie blickten ein wenig erschrocken drein. Über eine Hochzeit hatten sie noch nicht nachgedacht. Aber sie mussten Gottfried Recht geben. In einem Handelshaus dürfen keine losen Sitten einreißen. Die Geschäftspartner argwöhnen sonst, man gehe dort auch mit dem Geld leichtfertig um. "Wir werden heiraten", erwiderten beide fast gleichzeitig. V 251 I n der Wardenburg zog unterdessen wieder der Alltag ein. Wilhelm und Martha trauerten um ihre mittlere Tochter, doch sie redeten nicht darüber. Wozu auch? Lautes Klagen und Jammern war doch im Grunde nur eine Art Eitelkeit. Mochten andere sich vor aller Welt mit geheuchelter Elternliebe brüsten! Zudem versündigt sich, wer nur an das Schlechte denkt und Gottes Wohltaten übersieht. Wilhelm und Martha hatten in den Monaten des Krieges auch etwas gewonnen - ihr erstes Enkelkind. Beatrice war noch immer sehr auf ihre Tante geprägt, kam aber allmählich in ein Alter, wo sie von selbst mutiger und auch vernünftiger wurde. Neugierig wagte sie sich immer öfter, immer länger und immer weiter von Pentia weg. Mit einer gewissen Vorsicht versuchte sie auch, erste Freundschaften mit Kindern ähnlichen Alters zu schließen. Von den Erwachsenen fasste sie vor allem zu den Großeltern Vertrauen. Sowohl Wilhelm als auch Martha hatten jene Ruhe und Ausgeglichenheit, welche kleinen Kindern die Scheu zu nehmen pflegt. Trotz aller Empfindsamkeit besaß Beatrice auch Durchsetzungsvermögen. Sie begriff, dass sie als besonders niedlich galt und mit einer bestimmten Art zu lächeln eine Menge erreichen konnte. Insofern trug sie auch ein paar Züge ihrer zweiten Tante Agnes. Was aus ihr einmal werden, wie sie sich entwickeln würde, das wagte niemand vorherzusagen. Wilhelm bemerkte einmal: "Es ist wohl Schicksal, dass meine Nachkommen alle ein wenig verdreht sind." So neigte sich der August des Jahres 1234 dem Ende entgegen. Zu dieser Jahreszeit gab es viel Arbeit auf den Feldern. Auch Wilhelm stand auf, noch ehe die Sonne am Horizont erschien. Wenn er heimkehrte, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, war er müde und erschöpft. Deshalb schenkte er dem Benediktiner, der ihm auf dem Burghof begegnete, keine Beachtung (obwohl es selten vorkam, dass sich in diese Gegend ein Mönch verirrte). Was er auch begehrte, es sollten sich diesmal andere darum kümmern! Doch der Geistliche ließ sich nicht abschütteln. Kurz vor der Tür zum Turm holte er ihn ein, vertrat ihm den Weg und schlug mit einem Ruck die Kapuze zurück. "Nein! Das kann nicht sein." Er trat erschrocken zwei Schritte zurück. "Ich bin zu lange in der Sonne gewesen." "Ich dachte, Ihr freut Euch, Vater." "Ja ... aber ... Wie kommt es, dass du noch am Leben bist? Zwei deiner Freunde haben berichtet, du seiest tot. So etwas sagte doch niemand zum Spaß!" "Ihr meint Christian und Ramira. Sie haben im Grunde nicht gelogen." "Das verstehe ich nicht." "Ich muss Euch eine sonderbare Geschichte erzählen, Vater, eine, die Ihr mir vielleicht gar nicht glauben werdet. Aber das will ich nicht hier unten auf dem Hof tun." Wilhelm hatte sich wieder einigermaßen gefasst und führte Franziska hinauf in die Burgherrenwohnung. Da Martha sich noch im Wirtschaftshof aufhielt, war er mit seiner Tochter allein. "Wie also kannst du für deine Freunde tot gewesen sein, wenn du doch in Wahrheit jetzt vor mir sitzt?" Franziska suchte nach einem Anfang und spielte verlegen mit dem Seil der Kutte, mit der sie sich tarnte. "Vielleicht sollte ich Euch damit gar nicht behelligen ..." "Ich hatte für immer von dir Abschied genommen. Was soll mich jetzt noch erschüttern?" "Ich habe alles gesehen. Ich lag auf der Erde, über meine Stirn rann Blut. Ramira beugte sich über mich und versuchte, mir zu helfen. Als ich trotzdem nicht wieder zu mir kam, schrie sie: 'Wach auf! Wach auf!' Ich wollte sie beruhigen, wollte ihr sagen, dass sie sich um sich selbst kümmern soll, da es mir doch gut ging. Aber sie verstand mich nicht." Franziska wurde sichtlich erregt. Ihr Vater indes fand ihre Rede so widersprüchlich, dass er um ihren Verstand fürchtete. Trotzdem hörte er weiter aufmerksam zu. Eigenartiger Weise sagte sie haargenau dasselbe wie zuvor Christian und Ramira. Woher wusste sie das alles? Franziska fuhr fort: "Christian legte mir später sein Ohr an die Brust, um zu hören, ob mein Herz noch schlägt. Ramira kniete mitten auf dem Feld nieder, um für mich zu beten. Welch ein Leichtsinn! Das hätte ihr das Leben kosten können! Dann endlich haben sie sich in diesen Stall gerettet." Franziska rang nach Atem, so sehr litt sie noch im Nachhinein unter dem dramatischen Geschehen. Für Wilhelm aber gab es keinen Zweifel mehr, dass sie wirklich Bescheid wusste. Allein, wie das möglich war, das konnte er sich noch immer nicht vorstellen. "Du lagst mit geschlossenen Augen auf der Erde und dein Herz schlug nicht mehr. Trotzdem hast du alles gesehen?" "Ich wünschte, ich könnte Euch eine einleuchtende Erklärung dafür geben, Vater, aber leider bin ich selber ratlos. Ich schwebte über meinem eigenen Leib. Gewissermaßen hatte ich einen ... neuen Körper." Sie suchte nach Worten. "Dieser Körper war eigenartig ... Ich hatte keine richtigen Hände mehr, keine Hände zum Zufassen. Das merkte ich, als ich Ramira hinter diesen Baumstamm ziehen wollte. Es ging nicht. Ich griff durch sie hindurch." "Das muss schrecklich gewesen sein!" "Nein, nein! Ich war unsagbar glücklich. Trotz der schweren Verletzungen fühlte ich keinen Schmerz." "Und was geschah dann? Wann bist du in deinen richtigen Körper ... zurückgekehrt?" "Erst später. Nachdem sich Christian und Ramira gerettet hatten, geriet ich in einen Sturm, der mich in einen riesigen Schlauch hinein zog." Misstrauisch blickte sie kurz zu ihrem Vater auf, ob der ihr noch zuhörte. Sie mutete ihm immerhin eine Menge zu. "Ich kam in ein Land aus einem wunderbaren Licht und sah viele Leute, die ich kannte, auch meinen Bruder Arnold ... und Raimund, einen Freund aus Köln." Sie wurde wieder ganz aufgeregt. Das Erlebnis packte sie mit aller Macht. "Ich konnte mich mit ihnen verständigen, ohne zu reden. Und ich sah auch so ein ... Wesen, das mich durch mein Leben führte. Das heißt: Mir passierten bestimmte Sachen noch einmal und ich spürte dabei zugleich, was die anderen fühlten." Für einen Moment grub sich eine Falte in ihre Stirn. Es war ihr unangenehm, mehr darüber zu erzählen. Deshalb sagte sie lediglich: "Ich weiß jetzt, dass ich vieles anders machen muss." "Du hast mit Jesus Christus gesprochen?" fragte Wilhelm erschrocken. Franziska hob unsicher die Schultern. "Ich weiß nicht, wer das war. Er sagte seinen Namen nicht. Und er drohte mir auch nicht mit der Hölle, sondern führte mir das alles einfach nur vor, ohne ein Wort. Ich will mich nicht deshalb ändern, weil ich Angst habe, sondern weil ich mich schäme. Eigentlich fürchte ich mich überhaupt vor nichts mehr - nicht vor dem Sterben, nicht vor den Menschen, nicht einmal vor dem 253 Elend. Ich weiß ja, dass ich am Ende meines Lebens in dieses wunderschöne Land komme." Franziska war in ihren Gefühlen hin und her gerissen. Wenn sie sich in die Lage ihres Vaters versetzte, erschien ihr der Bericht albern und unglaubwürdig. Er ähnelte nicht einmal den frommen Heiligenlegenden. Vielleicht hätte sie ihn für sich behalten sollen, um nicht übergeschnappt zu wirken. Doch genau das konnte sie nicht. Sie mussten jemandem von ihrem Erlebnis erzählen, sogar auf die Gefahr hin, nicht ernst genommen zu werden. Das Erlebnis hatte ihr Leben schlagartig von Grund auf verändert. Und es war wirklich, auch wenn es sich nicht vernünftig erklären ließ. "Und warum bist du nicht dort geblieben?" Franziska zuckte zusammen. Ach, ja sie war noch nicht am Ende ihrer Geschichte. "Ich wollte nicht, wegen Arnold und Raimund. Wir konnten dort oben, wie gesagt, nicht richtig miteinander sprechen. Ich fühlte aber, dass sie mich zurück schickten. Sie selbst haben seinerzeit vieles unerledigt gelassen und bereuen ihren Tod deshalb. Sie meinten, dass ich auf der Erde noch gebraucht werde. So flog ich dann eben durch den Schlauch hindurch zu meinem richtigen Körper zurück. Ich schlug die Augen auf und sah mich auf diesem Feld liegen." Sie holte tief Luft. Alles Weitere konnte sie berichten, ohne die Zweifel ihres Vaters befürchten zu müssen. "Die Reiter waren fort, aber der Kopf tat mir furchtbar weh und ich musste mich ständig erbrechen. Zum Glück bin ich zäh wie eine Katze. Ich schleppte mich vorwärts, immer weiter. Ein Zeitgefühl hatte ich nicht mehr. In einem verlassenen Bauernhaus fand ich Brot und Käse. Einmal gab mir jemand Wasser. Fragt mich nicht, wie ich zu unserer Waldhütte-Burg kam! Am Ende war ich jedenfalls dort. Ich hoffte, ein paar Gefährten zu finden, aber leider traf ich niemanden an. Allerdings konnte ich mich ein paar Wochen lang erholen. Es gab alles, was ich zum Leben brauchte." Wilhelm schwieg lange. Was seine Tochter ihm da alles erzählt hatte, überstieg sein Vorstellungsvermögen. Letztlich begriff er nur, dass sie auf wunderbare Weise aus einer sehr großen Gefahr gerettet worden war. Dafür dankte er Gott in einem stillen Gebet. Um überhaupt etwas zu sagen, erkundigte er sich nach der ungewöhnlichen Verkleidung. "Ich wusste nicht, dass die Kreuzfahrer schon wieder verschwunden sind, und dachte, dass sie einen Geistlichen nicht behelligen würden. Die Kutte fand ich in der Waldhütte-Burg. Sie stammt wohl aus einem von den Stedingern überfallenen Kloster." Der Ritter sah sie scharf an. "Hast du einen besonderen Grund, dich zu verstecken?" "Ich war Fähnleinführer..." Er bereute bereits seine Worte. "Ich verstehe. Sie haben die Leute im Dutzend auf den Scheiterhaufen gebracht, ohne nach ihrer Schuld zu fragen." Franziska ahnte, was ihrem Vater durch den Kopf ging. Er suchte nach dem besten Weg, sie zu beschützen. Sie hatte aber längst eine Entscheidung getroffen, die ihm diese Last abnahm. "Ich weiß nicht, ob mich jemand behelligen wird, aber ich möchte auf keinen Fall, dass die Familie unter dem leidet, was ich allein verantworten muss. Nur für ein paar Tage möchte ich in der Burg bleiben. Dann ziehe ich weiter." 254 "Das erlaube ich dir nicht!" brauste Wilhelm auf. Franziska lächelte geheimnisvoll. "Dieses eine Mal muss ich Euch widersprechen, Vater." "Wohin willst du denn gehen?" "Um ehrlich zu sein: Ich weiß es selbst noch nicht. Ich weiß aber, dass meine Wanderung letztlich ein Ziel haben wird." "Du redest schon wieder so ... sonderbar." "Verzeiht mir, Vater!" "Geh jetzt schlafen! In deinem Zimmer im Herrenhaus wohnt jetzt Pentia mit der Kleinen, aber ich denke, dass auch für dich noch Platz ist." Pentia und Martha ging es ähnlich wie Wilhelm, als Franziska ihnen von ihren Erlebnissen berichtete. Auch sie konnten wenig damit anfangen und hätten eine Wahnvorstellung auf Grund der schweren Verletzung angenommen wenn da nicht jenes unerklärbare Wissen über Christian und Ramira gewesen wäre. Das schuf Momente peinlichen Schweigens. Franziska aber sammelte eine noch schmerzlichere Erfahrung als dieses unterschwellige Misstrauen. Wenn sie sich mit ihrer Schwester unterhielt (und das tat sie sehr häufig in diesen Tagen) dann fühlte sie manchmal unvermittelt einen langen, fragenden Blick auf sich ruhen. Anfangs wunderte sie sich einfach nur darüber und wollte sich bei passender Gelegenheit danach erkundigen. Später begriff sie, dass sie sich wohl verändert hatte, und zwar so sehr, dass die anderen damit nicht umgehen konnten. Das wiederum stimmte sie traurig. Sie erinnerte sich an die Wochen der Genesung in der Waldhütte-Burg. Wie oft hatte sie da hellwach auf dem Stroh gelegen und sich das Wiedersehen mit ihren Angehörigen vorgestellt. Es gab da so viel, was sie bereinigen wollte. Zum Beispiel wusste sie nun, wie viel Schuld sie selbst trug, dass Pentia der Kindheit so langsam entwachsen war. Niemand vermochte das Unbehagen in Worte zu fassen. Franziska hatte sich nicht zum Schlechten verändert. Sie war verständnisvoller als früher. Manchmal schien es, als könne sie sogar Gedanken lesen. Und sie lehnte neuerdings jede Form von Gewalt ab. Ihr Schwert, das Geschenk des Stefanus aus Köln, hatte sie in der Waldhütte-Burg geradezu feierlich vergraben. Das alles war lobenswert, aber es passte in den Augen der anderen nicht zu ihr. Nur einem einzigen Menschen schien zu gefallen, was der Hieb des Ritters aus ihr hatte werden lassen. Das war Beatrice. Das übersensible kleine Mädchen schien zu spüren, dass ihre Mutter von einer Reise in eine wunderbare Welt zurückgekehrt war. Anstatt ihr scheu aus dem Wege zu gehen, schlich sie sich wie unter einem Bann immer wieder in ihre Nähe und starrte sie aus großen runden Augen an. Sie setzte sich auch zu ihr auf den Schoß und schmiegte sich mit inbrünstigem Seufzen an. Doch gerade das führte schließlich dazu, dass Franziska ihren Aufbruch vorverlegte, dass sie regelrecht flüchtete. Es war nicht zu übersehen, wie sehr Pentia unter dieser Versöhnung zwischen Mutter und Tochter litt. Höchstens eine Woche hätte noch gefehlt bis zu einem ernsten Zerwürfnis zwischen den Schwestern. Dabei wollte Franziska nichts weniger, als ihr wehtun. Sie musste fort. Das Schicksal hatte sie gezwungen, ein neues Leben zu beginnen, und das war offenbar nicht möglich an den Orten des alten. Beim Abschied versicherten alle, dass sie ruhig noch eine Weile bleiben könne. In einem Monat sei es immer noch früh genug für die Wanderschaft. Sie habe gewiss ihre Verletzung noch 255 nicht richtig auskuriert. Das schlechte Gewissen regte sich. Doch Franziska zerstreute alle Bedenken mit einer Art zuversichtlichen Lächelns, das keinen Widerspruch zuließ. Sie folgte einem inneren Drang und es war sinnlos, sie aufhalten zu wollen. Bevor sie wirklich aufbrach, befriedigte sie aber noch ein kindliches Bedürfnis. Sie wollte noch einmal den alten Westerholthof sehen, auf den sich unzählig viele ihrer Erinnerungen bezogen. Dort war sie auch zur Welt gekommen. Sie trug bereits ihre Wanderkleidung - einen langen Mantel aus derbem Stoff mit einer direkt am Kragen fest genähten Kapuze, in welchem sie sich notfalls ebenso verbergen konnte wie in der Mönchskutte. Sie hatte freilich nicht erwartet, dass sie die wetterfeste Kleidung während ihres kurzen Umweges bereits brauchen würde. Das Wetter in dieser Gegend war manchmal launisch. Urplötzlich zogen sich dicke Wolken zusammen und türmten sich zu bleigrauen Blöcken, gewaltigen Felstrümmern gleich. Aus ihnen heraus ergoss sich der Regen in solcher Menge über das weite, flache Land, dass man meinen konnte, eine neue Sintflut wolle Mensch und Tier ersäufen. Doch wenn Franziska es sich genau bedachte, konnte sie dem Unwetter durchaus eine gute Seite abgewinnen. Die karge Landschaft zwischen den Sümpfen, ihre Heimat, zeigte sich ihr als Abschiedsgruß von ihrer typischen Seite. Fremde mochten erschrecken vor den Sumpflöchern, in denen es brodelte, vor den tintenschwarzen Mooren, mochten meinen, dies sei der Vorhof zur Hölle! Die junge Ritterstochter klatschte in die Hände vor Vergnügen. Und lediglich, um sich nicht zu erkälten, zog sie sich die Kapuze über den Kopf, bis nur noch Mund, Nase und Augen zu sehen waren. 256 Nachtrag Das Reich I n der Mitte des Jahres 1234 fand in Boppard am Rhein eine geheime Zusammenkunft mit weit reichenden Folgen statt. Vielleicht hätten die Beteiligten durch ausgewogene Entscheidungen der weiteren Geschichte des staufischen Kaisergeschlechts und des Reiches einen anderen Verlauf gegeben. König Heinrich VII jedoch war finster entschlossen, die Auseinandersetzung mit seinem Vater, Kaiser Friedrich II zu suchen. Es ist nicht mehr bekannt, wer im Einzelnen seinerzeit erschien. Sicher kamen die schwäbischen Ministerialen, die den jungen, ungestümen Herrscher schon seit Jahren zu immer waghalsigeren Abenteuern drängten. Sicher hatten einige Städte ihre Abgesandten geschickt. Auch der Wortlaut der Beschlüsse liegt im Dunkeln. Waren Heinrich und die Unversöhnlichen in seiner Umgebung wirklich ermächtigt worden zu ihren späteren Taten? Hatten gar kaiserliche Agenten den König in eine Falle gelockt? Vom September an führte Heinrich Verhandlungen mit den Todfeinden seines Vaters, den Städten des Lombardischen Bundes in Norditalien. Er bemühte sich sogar um ein Zusammengehen mit Papst Gregor IX (worauf dieser sich allerdings nicht einließ). Friedrich trafen diese Feindseligkeiten in einem ungünstigen Moment. Kriegsmüde strebte er seit Monaten eine friedliche Beilegung der Lombardenfrage an. Die unerwartete Hilfe aus Deutschland gab nun aber den auf Kampf eingeschworenen Parteien neuen Auftrieb. Als der Kaiser im Frühjahr des Folgejahres nach Deutschland aufbrach, um der Rebellion die Stirn zu bieten, konnte er nur wenige Ritter aus Norditalien abziehen und mitnehmen. Er musste (wie schon einmal 23 Jahre zuvor als Otto IV aus dem Geschlecht der Welfen sein Gegner gewesen war) vor allem seine Persönlichkeit, seine geradezu mystische Ausstrahlung in die Waagschale werfen. Und abermals wechselten die Ritter in Scharen das Lager. Ohne ein einziges ernsthaftes Gefecht erreichte Friedrich im Sommer die Stadt Regensburg, wo er Hoftag hielt und die Fürsten beruhigte, indem er seine fürstenfreundlichen Gesetze der zurückliegenden Jahre bekräftigte und zugleich die fürstenfeindlichen Neuerungen seines Sohnes verwarf. Anschließend zog der Kaiser weiter zur Pfalz Wimpfen. Dorthin befahl er auch den jungen König, der sich in der Burg Trifels verschanzt hatte. Heinrich begriff, dass er Gefahr lief, wie ein gewöhnlicher Verbrecher gejagt zu werden, und unterwarf sich. Im Juli 1235 setzte ihn ein Fürstengericht als deutschen Herrscher ab. Als Gefangener wurde er nach Apulien geführt und dort unter Arrest gestellt. Als er sich später das Leben nahm, kümmerte das kaum jemanden. Dennoch war sein Untergang mehr als die Tragödie eines einzelnen Menschen. Heinrich blieb für lange Zeit der letzte deutsche Herrscher, der sich ernsthaft um die Zügelung der Fürsten bemühte. Vielleicht hätte er mit mehr Unterstützung den Untergang der Staufer und das Interregnum verhindern können. Friedrich hatte das jedoch (von seinem über allem geliebten Apulien aus) niemals verstanden. Bremen und seine Umgebung I m Jahre 1236 bestimmte Erzbischof Gerhard II, dass fortan in Bremen an jedem Sonnabend vor Himmelfahrt mit einer Prozession an die Schlacht bei Altensch zu erinnern sei. Daraus entwickelte sich eine Tradition, die bis zur Reformation lebendig blieb. Dem Gedenktag hatte aber von Anfang an Zwiespältigkeit angehaftet. Der Sieg über die Ketzer und der Triumph des rechten Glaubens war mit Tausenden Toten erkauft worden und es hatte sich vieles ereignet, was Gott schwerlich wohlgefällig sein konnte. Die Bremer Bürger fühlten sich ohnehin als Verlierer. Der Stadtherr hatte sie mit großen Versprechungen für den Kreuzzug begeistert, erinnerte sich seit seinem Triumph jedoch nur noch widerwillig daran. Zugleich tat der Erzbischof alles, um das Marschland wieder zu besiedeln. Auf sein Betreiben hin nahm der Papst schon bald den Bann von den überlebenden Stedingern. Rückkehrwillige Bauern lockte er mit guten Verträgen. So kam es, dass selbst Familien, die unter dem Krieg schwer gelitten hatten, letztlich doch die zur Versöhnung ausgestreckte Hand ergriffen. Sie konnte nicht auf Dauer als Gäste in fremder Leute Dörfer leben. Nach und nach verschwanden die Ruinen. Im Jahr 1236 regelte der Erzbischof die Besitzverhältnisse für das eroberte Marschland neu und erklärte die bestehenden Verträge für nichtig. Dabei ging es ihm weniger um eigenen Gewinn als um Berücksichtigung veränderter Machtverhältnisse. Die Bürger Bremens verloren auch noch jene kleinen Geschenke, die er ihnen kurz nach Kriegsende noch zugebilligt hatte. Die friesischen Rüstringen (stolze, den Stedingern durchaus ähnliche Bauern) erhielten überraschend das Stadland - wohl aus politischen Erwägungen heraus. Den Löwenanteil heimsten einmal mehr die Oldenburger ein, die Gerhard als Verbündete brauchte gegen die Welfen, die ihn von Braunschweig aus bedrängten. Otto hielt sich übrigens an seinen Vorsatz, die Grafschaft nur zu bewahren für seinen Neffen Johann. 1252, als dieser volljährig war, zog er sich zurück und widmete sich bis zu seinem Tode wieder mit ganzer Kraft dem, was ihm am nächsten stand, den Büchern. Der Union zwischen Wildeshausen und Bruchhausen, dieser Zweckgemeinschaft zweier ungleicher Partnern, war erwartungsgemäß kein langes Leben vergönnt. Bereits im Jahre 1237 brach sie auseinander. Allerdings kam es nicht wieder zu blutigen Feindseligkeiten wie zu den Zeiten Burchards. Die einen wie die anderen hatten genügend eigene Sorgen. Heinrich der Bogener (nunmehr Heinrich IV) setzte alles daran, seiner ruinierten Grafschaft wieder den Glanz früherer Jahre zu geben. Heinrich der Jüngere, der (als Heinrich V) in Bruchhausen die Herrschaft übernahm, musste sich der immer dreisteren Anfeindungen seines raubeinigen Bruders erwehren. Im Jahre 1241 zettelte Ludolf eine Verschwörung an. Mit großzügigen Versprechungen hatte er einen Teil der Ritterschaft für sich gewonnen. Der Nachteil Heinrichs bestand vielleicht gerade in seiner größeren Redlichkeit. Er kämpfte tapfer, ging aber nicht bis 258 zum Äußersten, setzte gewisse Mittel aus Überzeugung nicht ein. Die Grafschaft, die ohnehin nur ein Splitter der alten Herrschaft Ammerland-Oldenburg war, wurde noch einmal geteilt. Der bisherige Stammsitz hieß fortan Altbruchhausen und war nun Residenz Ludolfs, Heinrich V baute sich eine eigene Burg und nannte sie Neubruchhausen. Letztlich schadete das beiden. Die beiden neuen Grafschaften waren schwach. Am Anfang des 14.Jahrhunds erloschen sie von selbst. Heute erinnern nur noch die Namen zweier Dörfer an sie. Nachdem Gerhard II im Jahre 1258 gestorben war, wählte das Domkapitel mit Hildebold von Wunsdorf einen Vetter des Grafen Johann von Oldenburg zum neuen Erzbischof. Die beiden verstanden sich so gut, dass andere Fürsten eine Gefahr darin sahen. Bischof Simon von Paderborn focht die Wahl an und versuchte, das Amt seinem eigenen Bruder zuzuschanzen. Dabei schreckte er nicht davor zurück, die wieder erstarkten Stedinger als Parteigänger zu werben und auszurüsten. Deren erster Schlag richtete sich aber weder gegen Bremen noch gegen Oldenburg sondern gegen Wildeshausen. 24 Jahre nach Altenesch erlebten die Bauern noch einmal einen eindrucksvollen Sieg. Sie eroberten Schloss und Stadt. Heinrich IV musste fliehen. Mit Hildebolds Hilfe konnte er allerdings rasch ein neues Heer aufbieten, mit dem er dann nahe der Ortschaft Hatten die Streitmacht des Paderborner Bischofs entscheidend besiegte. Jetzt zeigte sich, dass der neue Erzbischof aus anderem Holz geschnitzt war als sein Vorgänger. Anstatt die alte Feindschaft neu aufleben zu lassen und womöglich einen weiteren Krieg vom Zaun zu brechen, stieg er in Verhandlungen ein, anfangs vermittelt durch die Rüstringer. Unter klar festgelegten Bedingungen verzieh er den Bauern aus dem Marschland und gewann sie für sich. Die später ausgehandelte Einigung sicherte den Frieden dauerhaft. Heinrich IV allerdings war von seiner Niederlage und seiner Vertreibung tiefer beeindruckt als von seinem Sieg und seiner Rückkehr. Er hatte zwar jahrelang durchaus erfolgreich regiert, jedoch niemals seine Anfälle von Schwermut völlig überwunden. Immer wieder geschah es, dass er sich tagelang zurückziehen musste. In der Hoffnung, dass Gott ihn von seinem Leiden befreie, stiftete er einen beträchtlichen Teil seines Besitzes dem Kloster Segenthal und zog sich zunehmend in die Religion zurück. Die Grafschaft entglitt ihm derweil. 1270, nach immerhin 37-jähriger Herrschaft, gab er endgültig auf. Er verfügte, dass sein Lehen nach seinem Tode vollständig in die Verwaltung des Bremer Erzbistums übergehe. Als Gegenleistung ermöglichte ihm Hildebold eine Pilgerfahrt nach Jerusalem und erfüllt ihm damit seinen sehnlichsten, seit früher Jugend gehegten Wunsch. Über den Verlauf der Reise ist wenig bekannt. Fest steht nur, dass der Graf nicht zurückkehrte, das Testament gültig wurde und Wildeshausen seine Selbständigkeit für immer verlor. Von der einst stolzen Burg ist nicht mehr als der Rest eines Grabens geblieben. Auf dem Hügel über der Hunte steht heute ein protziges Kriegerdenkmal, welches die Katastrophen jüngerer Vergangenheit verherrlicht. 259