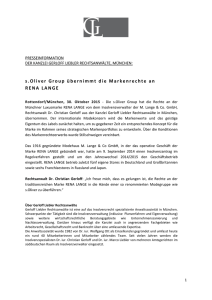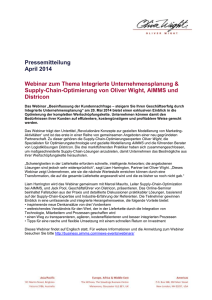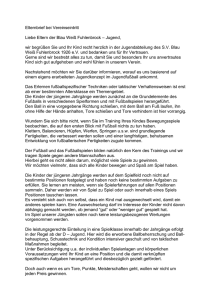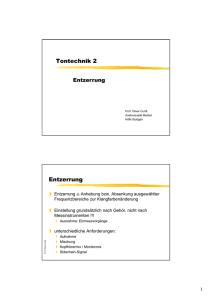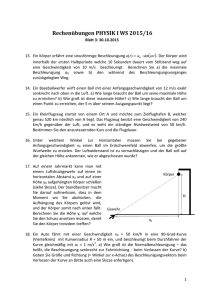(c) Oliver Uschmann 2013 - E-Werk
Werbung

(c) Oliver Uschmann 2013 Oliver Uschmann Überleben beim Fußball Expeditionen am Ball (VÖ: März 2014, Heyne Hardcore) (vorläufiger Entwurf, falscher Untertitel) (c) Oliver Uschmann 2013 Das Buch Ein Buch der Überleben-Reihe pünktlich zur WM 2014. Eine Rückkehr zum Format des ersten Teils, Überleben auf Festivals, mit „Gattungen“ von Spielern, Besuchern, Veranstaltungen, Ritualen auf und abseits des Feldes sowie satirischen Erläuterungen der wichtigsten Phrasen beim Reden über das Spiel. Sowie: Kurzporträts von 27 Ländern, die größtenteils auch in Brasilien mitspielen werden. Kurze, knackige Karikaturen in Text, die quer durch das Buch von Karikaturen in Bild begleitet werden, beigesteuert vom bekannten und bissigen Cartoonisten Michael Holtschulte. Ein Buch, das der Menschheit mittels humoristischer Überspitzung wirklich mal erklärt, was ein „Sechser“ oder ein „Neuner“ ist, was es bedeutet, „gegen den Ball“ zu spielen und wieso man manchen „Krimi“ heute nur noch so anschauen kann, dass man anderen Männern beim Anschauen zusieht. Ein Buch, das Aktive und Publikum neu einteilt und erklärt, was ein „Floh“, ein „Bollwerk“ oder ein „Manischer“ ist, wo die Schiedsrichter wirklich ausgebildet werden und warum Portugal stets überschätzt wird. Ein Buch, dessen Material dem Autor so sehr in den Schoß fällt, wie die vielen markanten Details in Überleben auf Festivals, denn ebenso, wie er sich ein Leben lang mit Rockmusik beschäftigt hat, hat der Fußball sein Leben geprägt – auch, wenn dies in den Serien um die Romanhelden Hartmut sowie Finn nur beiläufig Ausdruck findet und der Schritt in den Sportjournalismus nie gelang. Fakt ist: Oliver Uschmann ist ein Fußball-Nerd. Ein Besessener. Einer, der sämtliche Spieler aller Teams und Länder kennt, alle Phrasen und Pointen eingeatmet hat und den Tonfall, die Seele, die Faszination dieser Welt genauso in eine humoristische Hommage zu verwandeln vermag wie die Rockwelt im ersten Buch. (c) Oliver Uschmann 2013 Einer, dessen Vater 40 Jahre lang als Spieler und Trainer bis zur damaligen 3. Liga agierte und seinem Sohn für immer die Erinnerung an das Klackern von Stollen auf braunen Umkleidefliesen und den Geruch von Frantz Branntwein an Männerwaden bescherte. Einer, der die Stimmung und den Vibe in den kleinen Stadien des Amateursports genauso kennt wie die Facetten der großen Show … von der obskuren, perfekt zu karikierenden Fachsimpelei am Stammtisch oder bei der Liga Total! Spieltaganalyse bis hin zu Fankurve und Ultra-Kultur als letztem Refugium rustikaler männlicher Entfesselung. Das Buch zieht dabei durch den Kakao, was der Autor selbst liebt. Es verschreckt die Zielgruppe nicht, sondern erzeugt am laufenden Band „kenn ich auch, hätte ich aber nie so sagen können!“-Effekte. Vor allem aber drängt es nach draußen, da sich in Oliver Uschmanns Leben über 30 Jahre lang Fußballpointen angesammelt haben, die bislang keinen freien Auslauf bekamen. (c) Oliver Uschmann 2013 Die Kapitel Das Buch unterteilt sich in sechs große Abschnitte mit jeweils neun Kapiteln bzw. 27 Kapiteln im Länderabschnitt. Die Aktiven Der 6er * Der 9er * Der 10er * Der Beau * Das Bollwerk * Der Floh Der Schiedsrichter * Der Torhüter * Die Vision Das Publikum Die Alten * Die Couch Potatoes * Der Fachmann * Die Hooligans Der Manische * Die Menschen auf der Gerade * Die Sänger * Die Ultras Die VIPs Die Veranstaltungen Das 0:0 * Der Abstiegskampf * Die Bolzplatzpartie * Das Finale Das Kreisligaspiel * Der Krimi * Das Public Viewing * Das Spaßspiel Das Qualifikationsspiel Rituale und Phänomene auf und um den Platz Die Anreise * Das Ignorieren * Das Pleitegehen * Das Reden * Das Rotzen Das Schrumpfen * Die Schwalbe * Die Verwandlung * Das Warten auf die Action Die wichtigsten Phrasen und ihre Bedeutung „Die Null muss stehen!“ * „Sie müssen die Räume eng machen.“ „Er dringt einfach nicht mehr zur Mannschaft durch!“ „Wichtig ist das Spiel gegen den Ball.“ * „Es gibt keine Kleinen mehr.“ „Wenn er rauskommt, muss er ihn haben!“ * Er kriegt das vom Kopf her einfach nicht hin!“ * „Auf dem Papier haben sie die bessere Mannschaft.“ „Wenn der runterkommt, ist Schnee dran!“ (c) Oliver Uschmann 2013 Die Länder Äthiopien * Albanien * Argentinien * Australien * Belgien * Brasilien * China * Costa Rica * Dänemark * Deutschland * Elfenbeinküste * England Frankreich * Ghana * Griechenland * Iran * Island * Italien * Jamaika Japan * Kamerun * Kolumbien * Kroatien * Mexiko * Niederlande Norwegen * Österreich * Portugal * Russland * Schottland * Schweden * Schweiz * Spanien * Südafrika * Tunesien * Turks- und Caicos-Inseln * Uruguay * USA * Wales (wird noch gekürzt) Sonderkapitel / Nachwort Es wird eventuell noch ein Schlussteil angefügt. „1. Verlängerung“ Ein Gastkapitel zum Thema „Das Derby“ von Rüdiger Alke „2. Verlängerung“ Ein kleiner Artikel von mir zum Thema „Fantasiefußball“, der auch im Core-Magazin steht. „Elfmeterschießen“ Eine obskure Liste Ferner am Ende eine Auflistung aller Orte, an denen das Buch entstanden ist (Hotels, Imbissbuden, Rasthöfe), da es fast vollständig auf Tournee geschrieben wurde. Es folgen nun je drei Kapitel aus jedem Überabschnitt (c) Oliver Uschmann 2013 Die Aktiven Der Beau Stellen Sie sich vor, Uwe Seeler macht Werbung für die Unterwäsche von Giorgio Armani. Oder Berti Vogts. Lasziv räkelt sich der Terrier in einem gläsernen Mailänder Studio auf schwarzem Samt, nur bekleidet mit den eng sitzenden Pants, der Schriftzug stramm an Bertis erotischen Hüften: Emporio Armani. Ein Mann, der die Welt erobert. Schwer denkbar? Für David Beckham kein Problem. Der Brite war mal Weltfußballer und ist jetzt in der Hauptsache Designerinnen-Mann … das ist die Entsprechung zur Spielerfrau. Wo Spielerfrauen allerdings selten aufs Feld springen, färbt der Beruf seiner Gattin auf David Beckham ab: Zog er für Armani nur blank, hat er für H&M sogar eine eigene Unterhosenkollektion entworfen. Sie heißt David Beckham Bodywear. Bei Berti Vogts hätte sie wahrscheinlich Papas praktische Schlüpfer geheißen. David Beckham, der den Männern durch seine krankhaft sorgsame Körperpflege und seinen ausgeprägten Sinn für Mode rund um die Jahrtausendwende den manierierten Trend der Metrosexualität bescherte, ist das Paradebeispiel der Spielergattung „der Beau“. Standen Fußballer früher für Schweiß und Zotteln, stehen einige von ihnen heute für gepflegtes Haar und Duft. Hugo Boss bestäubt für seine Kampagne „Stil über das Spiel hinaus“ die deutschen Nationalspieler Mario Gomez, Lukas Podolski und Serdar Tasci mit seinen Parfüms. Den Mario mit Boss Bottled, den Lukas mit Motion White Edition und den Serdar mit Hugo Man, einem seit 1995 angebotenen Klassiker, dessen Flakon an eine Feldflasche erinnern soll, um seine Männlichkeit zu betonen. Leider hat Tascis wohlriechende Männlichkeit nicht zum Dauerstammplatz in der Nationalelf ausgereicht. Neben den paradiesisch duftenden Achseln haben Beaus wie Mario Gomez oder Serdar Tasci auch noch die Haare schön. Das wiederum ist ein Trend, der auf den ersten, hundertprozentigen Vollbeau der deutschen Nationalmannschaftsgeschichte zurückgeht: Oliver Bierhoff. Der heutige (c) Oliver Uschmann 2013 Team-Manager der Nationalmannschaft – von Karl-Heinz Rummenigge liebevoll „die Ich-AG vom Starnberger See” genannt – hatte zu seiner aktiven Zeit als Spieler bis zu acht Werbeverträge gleichzeitig; der berühmteste davon war sicherlich der Deal mit dem Haarpflegegiganten Wella. Blond gewellt und perlweiß lächelnd teilte er sich den Rasen damals noch als einziger Beau mit Maurergesicht Dieter Eilts oder Schießschartenblick Thomas Hässler. Selbst Sturmkollege Jürgen Klinsmann war als bebender Blondschopf im Vergleich zu ihm nur ein bäuerlicher Bäckermeister. Da der Beau vor allem auf seine Frisur und die Unversehrtheit seines apollinischen Körpers achten muss, arbeitet er auf dem Feld wenig. Er kann sich nicht leisten, schon nach zehn Minuten wie ein Ackergaul zu stinken. Zwar gibt es noch kein Geruchsfernsehen, doch er weiß: Kleben ihm die Haare zu kletschig im Gesicht, greift in der Shampoofirma schon der Marketingleiter zum Hörer. Eigens für Oliver Bierhoff wurde daher bei der Europameisterschaft 1996 das „Golden Goal“ erfunden (und danach sofort wieder abgeschafft) – eine Regel, die dem Beau wie keiner anderen Spielergattung zu Gute kommt. Durch dieses eine Tor, das ein Spiel in der Verlängerung sofort entscheidet, kann der Beau als Held in die Geschichte eingehen, auch wenn er sonst nichts getan hat und seine unattraktiven und sponsorenfreien Kollegen längst hechelnd am Boden liegen. Mit seinem goldenen Tor schoss Beau Bierhoff die Deutschen das letzte Mal zu einem internationalen Titel. Sie dankten es ihm mit dem Amt des TeamManagers und Beteiligungen an rund 500 deutschen Firmen, darunter allein 27 DAX-Unternehmen. Bierhoffs eigene Agentur managet neben Meistertrainer Jürgen „Kloppo“ Klopp auch den Koch der deutschen Nationalmannschaft, Denzel Washington, die Scorpions und Batman. Die Haare sitzen bei der ganzen Arbeit weiterhin perfekt. Für aktuelle Beaus ist Oliver Bierhoff daher bis heute ein Vorbild, sportlich wie finanziell. Zählen kosmetisch herausgeforderte Arbeitsfußballer wie protestantische Puritaner ihre gelaufenen Kilometer pro Spiel, führt Gomez darüber Buch, wie viele unnötige Schritte auf dem Platz er (c) Oliver Uschmann 2013 vermieden hat. Auch, um gegenüber dem Boss von BOSS bei den jährlichen Sekttreffen in Metzingen belegen zu können, dass er seinen duftenden Körper nicht unnötig für dieses Fußballspiel ruiniert. Gomez ist trotz (noch) fehlendem Titel mit der Nationalelf der beste Beau-Erbe von Bierhoff, gelingt ihm doch mit minimalem Aufwand eine maximale Anzahl von Toren und somit das, was jeder Beau gleich im doppelten Sinne perfekt drauf hat: Jederzeit gut auszusehen. Die Beaus im Defensivbereich haben es damit schwerer. Einem Mats „Orlando Bloom“ Hummels merkt man an, wenn er den Ball unnötigerweise dem Gegner überlässt, weil er sich wie jeder Beau lieber der Raum- als der Manndeckung verschreibt, weil es die Frisur und die Nerven schont. Ein Ansatz, der dem eingangs erwähnten Berti Vogts sein Leben lang fremd war. Er hing nicht nur als besessener, kleiner, sabbernder „Terrier“ die ganzen 90 Minuten lang beißend und kratzend an den Fersen des Gegners – er sah dabei auch genauso aus. Die Kollektion Papas praktische Schlüpfer hat er nie entworfen. Er machte Werbung für Danone Obstgarten. Das Bollwerk Ich sitze im Bordbistro des Intercity auf dem Rückweg von zwei Vorlesetagen. Ich will arbeiten, aber ich kann nicht. Ich bin schwach. Müde, weich und schwach. Durch meine verklebten Augen beobachte ich meinen Tischnachbarn. Er ist stark. Wach, hart und stark. Auf seinem stahlgebürsteten Laptop gestaltet er coole Werbelogos in stoischer, eiserner Konsequenz. Wahrscheinlich hat er in den letzten Tagen weniger geschlafen als ich, aber er arbeitet. Neben seinem linken Handgelenk mit der schwarzen Militäruhr, die den Umfang einer Untertasse hat, steht eine Dose Red Bull. Um seinen muskulösen Hals hängt eine zum Schmuck umfunktionierte Fahrradkette. Sein schwarzer Kinnbart reicht ihm bis zum T-Shirt. Er erinnert an einen kaukasischen Krieger oder an den Gitarristen von Anthrax. Kurzum: Wäre dieser Mann ein Fußballer, würde er zur Gattung Das Bollwerk gehören. (c) Oliver Uschmann 2013 Bollwerke sind Männer in der Innenverteidigung, die grundsätzlich ihren Job machen. Immer. Sie kennen keine Schwäche, keine Müdigkeit, kein Zaudern. Sie irritieren den gegnerischen Angreifer nicht durch ihre Schönheit wie der im vorherigen Kapitel vorgestellte Beau, denn sie sind nicht schön, und sie haben das auch nicht nötig. Ein Mann der Gattung Bollwerk ist immer schon genau da, wo der Stürmer gerade hinwill, und der Stürmer weiß: Wenn ich jetzt weiterlaufe, kommen die Schmerzen. Die fürchterlichen Schmerzen. Der Bollwerkmann muss gar nicht viel mehr tun, als im Weg stehen. Er ist ein Baum, eine Statue, eine Wand. Rennt man als Stürmer in ihn hinein, ist jede Berührung so, als fahre man mit Vollgas gegen einen Brückenpfeiler. Das beste Bollwerk, das der deutsche Fußball jemals hatte, hieß Jürgen Kohler, Weltmeister von 1990 und einer jener Männer, die schon mit 25 aussahen, als hätten sie 45 Jahre Lebenserfahrung. Die Wurzeln dieses Ausnahmeverteidigers liegen beim SV Waldhof Mannheim, einem Traditionsverein, den heute kaum noch ein junger Mensch kennt, der aber auch zu seinen Glanzzeiten nicht glänzte, sondern Sinnbild für harten, unnachgiebigen Arbeitsfußball war. Ein Club, der auch Nationalverteidiger Christian Wörns hervorbrachte, der rund eine Generation nach Kohler für Angst und Schrecken im deutschen Hinterland sorgte. Oder Dieter Schlindwein, genannt „Eisen-Dieter“, der sich beim letzten Spiel seiner Karriere stilecht mit der roten Karte verabschiedete. Ja, Waldhof Mannheim, ein Club wie eine Kampfsportschule, die Cobra Kai des Ballsports. Ein Verein, der die Fremdenlegion beherbergen würde, wäre sie in Deutschland beheimatet. Ein Verein wie ein Ascheplatz. Jürgen Kohler jedenfalls hatte als Verteidiger eine Aura wie kein Zweiter. Betrat er den Rasen, begannen Gegner und Grashalme zu zittern wie australisches Sensitivgras. Seine Funktion in der Mannschaft nannte man damals nicht bloß Verteidiger, sondern Vorstopper. Eine Position, die ausgestorben ist wie der Säbelzahntiger oder der grundehrliche Politiker. Ein Wort wie gemeißelt: Vorstopper. Will sagen: Ihr könnt ruhig versuchen, uns anzugreifen, der Jürgen stoppt euch dann schon mal, bevor ihr überhaupt soweit seid. Jürgen Kohler kannte keine Schwächen, keine Formtiefs. (c) Oliver Uschmann 2013 Wenn Jürgen Kohler rannte, stand er eigentlich auf der Stelle und drehte den Erdball unter sich hinweg wie ein Laufband. Wenn er schläft, bleibt bis heute das Licht an, weil die Dunkelheit Angst vor ihm hat … mal abgesehen, davon, dass Jürgen Kohler niemals schläft, sondern nur aus Höflichkeit auf den Tagesbeginn wartet. Jürgen Kohler kann Drehtüren zuknallen. Jürgen Kohler verzehrt Steaks, ohne vorher die Kuh zu schlachten. Jürgen Kohler hat bis Unendlich gezählt - zwei Mal! Jürgen Kohler bringt Zwiebeln zum Weinen. Ist eines Tages seine Zeit gekommen, wird der Tod nicht den Mut haben, es ihm zu sagen. Was viele nicht ahnen: Bollwerke sind eigentlich recht sensibel. Wer Jürgen Kohler jemals in die Augen sah, wird das wissen, nur dass es aus Furcht nie einer tat. Eine Chance hatte man bei der TV-Übertragung seines Abschiedsspiels ( S. XY) zum Karriereende am 12. Oktober 2002 in Dortmund. Da standen dem guten Mann die Tränen der Rührung in den Augen und auch ich flennte bei diesem Anblick in meiner Bochumer Studentenwohnung bitterlich, obwohl ich gerade meine heftigste Männlichkeitsphase hatte: Hinter mir auf dem Schreibtisch standen die Gesamtausgabe der Werke von Hardcore-Macho-Philosoph Friedrich Nietzsche und eine Flasche Jack Daniels. Denn so hart die Bollwerke auf dem Feld auch sind, so liebevoll und sanft sind die abseits der Seitenlinie. Bernd Hollerbach zum Beispiel, ehemals Hamburger SV. Er war sogar zu heftig, um Nationalspieler zu werden, schließlich wollte man nicht zulassen, dass ein Deutscher bei einer Weltmeisterschaft ein paar Jahrzehnte nach Kriegsende wieder auf freiem Feld fremde Völker dezimiert. Wo Jürgen Kohler so gut war, immer schon vor dem Stürmer an Ort und Stelle zu sein, musste Bernd Hollerbach häufig erst noch hin. Der Stürmer war also schon vorbei und Bernd verfolgte ihn, die nächste Blutgrätsche im Sinn. Was dann passierte, war oft von solcher Grausamkeit, dass die ARD bei der Sportschau aus heiterem Himmel Testbilder einspielte. Zahllose Partien des Hamburger SV wurden damals von vorneherein erst ab 18 freigegeben. Beim Eingang ins Stadion gab es Passkontrollen und psychologische Prüfungen auf die seelische Belastbarkeit der Zuschauer. Bernd Hollerbach war auf dem Rasen die (c) Oliver Uschmann 2013 Kanonen von Navarrone, der Wirbelsturm Kyrill, der Napalmregen am Morgen. Und er hatte kein schlechtes Gewissen. Im Gegenteil. Den Designer seiner Autogrammkarte beauftragte er, ihn als Ritter zu zeichnen, komplett mit Rüstung. Eine Idee, die sich womöglich der ehemalige Frankfurter und heutige Herthaner Maik Franz zum Vorbild nahm, der unter dem Künstlernamen Iron Maik auftritt und auch seine Webseite so genannt hat. Schaut man sich die genau an, findet man beim König der roten Karten allerdings einen lieben, treuen Menschen vor, der seine Freizeit am liebsten mit Frau und Kind verbringt und sich für den Verein Kinderträume und den Förderverein zur Unterstützung der onkologischen Abteilung der Kinderklinik in Karlsruhe einsetzt. Bernd Hollerbach wiederum, so erzählte mir der Bochumer Kultspieler Michael „Ata“ Lameck einmal aus erster Hand, war „nur auf dem Rasen“ der gnadenlose Krieger. Pfiff der Schiri ab, war auf Knopfdruck wieder freundschaftliche Kumpeligkeit angesagt. „Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Bielefeld, der Ausstieg bitte in Fahrtrichtung links.“ Der bärtige Designer im Bordbistro arbeitet immer noch. Ich hänge in den Seilen. Wahrscheinlich spielt er privat Basketball. Oder eben, Vorstopper, auch, wenn es nicht mehr so heißt. Die letzten Bollwerke im deutschen Fußball bestechen weniger durch Härte, als durch reine Körpergröße. An einem Per Mertesacker kommt auch keiner vorbei, außer er gehört zur Gattung „Der Floh“ ( S. XY) und ist so klein, dass der lange Per ihn dort oben gar nicht sehen kann. Meine Augen fallen zu. Der Grafikgigant zieht ein neues Red Bull aus der Tasche. Der Wirt will ihm sagen, dass Fremdverzehr hier nicht erlaubt ist, aber er traut sich nicht. Schließlich arbeitet der Riese gerade. Das Spiel ist noch nicht abgepfiffen. Der Floh Das absolute Gegenteil des Bollwerks ist der Floh. Der Floh tritt in zwei Varianten auf – der offensiven und der defensiven. In der defensiven heißt er auch „Wadenbeißer“. Berti Vogts war ein solcher, Untergattung (c) Oliver Uschmann 2013 „Terrier“. Er setzte sich am Gegner fest und verfolgte ihn wie ein kleiner Kläffer den Postboten. Wie hartnäckig solche Wadenbeißer sein können, sieht man auch daran, dass er sich als Trainer die letzten Jahre damit beschäftigt hat, eine solide Fußballkultur in Aserbaidschan aufzubauen. Der Wadenbeißer unserer heutigen Nationalmannschaft ist Philipp Lahm, Untergattung allerdings nicht Terrier, sondern eher Jagdhund, wenn man bedenkt, wie schnell er zu offensiven Flügelläufen ansetzen kann. Zu voller Blüte und absolutem Weltruhm gelangen Spieler der Gattung „Floh“ allerdings vor allem als Stürmer oder 9er. Der berühmteste Floh der Welt ist natürlich Lionel Messi, mehrfacher Weltfußballer und einer der fünf besten Spieler aller Zeiten. Der 1,69 Meter kleine Supertechniker maß im Alter von 13 Jahren erst 1,40 Meter und wuchs aufgrund einer Hormonstörung (Somatotropinmangel) auch einfach nicht mehr weiter. Seine Eltern wanderten im Alter von 13 Jahren mit ihm nach Spanien aus, wo ein Jugendtrainer des FC Barcelona das Talent des kleinen Lionel erkannte und der Club ihm sofort einen Vertrag anbot sowie die teuren Behandlungskosten für die Hormontherapie übernahm. Seither verzaubert der Mann, der namensgebend für die ganze Gattung auch von Sportjournalisten „der Floh“ genannt wird, die Fußballwelt durch seine unglaubliche Wendigkeit und seine Ballsicherheit bei gleichzeitigem Tempo. Er umspielt Gegner wie Slalomstangen, dribbelt Verteidiger in ein Schleudertrauma und läuft an einem Abwehrriesen der Gattung „Bollwerk“ ein bis zwei Mal auf und ab, bevor er weiterrennt und das Tor macht. Viele kleinwüchsige Offensivkräfte, die sich als Stürmer nicht durch körperliche Präsenz oder Kopfballstärke durchsetzen können, haben sich Lionel Messi zum Vorbild genommen und sich auf die Vollendung ihrer Spieltechnik konzentriert, so dass auch deutsche Flöhe wie Mario Götze oder Marco Reus bereits in jungen Jahren zu den teuersten Spielern der Welt gehören. Zwei Erkenntnisse lassen sich aus dem evolutionären Aufstieg der Flöhe im Fußball für das Leben gewinnen. Erstens: Übung macht den Meister. Zweitens: Als Meister gilt schon, wer einfach seinen Job macht. (c) Oliver Uschmann 2013 Erstens: Meister fallen nicht vom Himmel. Sie entstehen durch Training. Das ist in der Musik so, das ist in der Literatur so, in der Wissenschaft, im Sport. Wunderkinder gibt es nicht. Selbst Mozart, der schon mit sechs Jahren seine erste Symphonie komponierte und für den dieses Wort überhaupt erst erfunden wurde, hat sich am Klavier die Fingerkuppen wund geübt. Wer als Mathematiker eines Tages komplizierte Beweise führen will, muss erst mal Jahre lang studieren, um das Problem, das er zu lösen gedenkt, überhaupt zu verstehen. Ich für meinen Teil benötigte rund 2.500 Seiten Training, bis das erste Wort von mir irgendwo veröffentlicht wurde. Der Psychologe Anders Ericsson prägte die Faustregel, dass man rund 10.000 Stunden üben muss, um in einer Sache meisterlich zu werden. Jede Stunde mehr führt einen dann Richtung Genie. Im Fußball ist das offensichtlicher als in anderen Bereichen. Lionel Messi begann seine Profession mit fünf Jahren und hat dann ab dem 13. Lebensjahr in der heftigen Mühle des FC Barcelona im Grunde nichts anderes mehr getan, gesehen, gefühlt und gedacht als Fußball, Fußball, Fußball. Die großen Talente der Gegenwart werden nicht mehr als Teenager irgendwo auf der Straße entdeckt, sondern durch sehr früh greifende Züchtung direkt bei den Spitzenclubs ausgebildet. Pionierarbeit leistete hier die Akademie von Ajax Amsterdam, in der alle Schüler konsequent das Gleiche einüben: Technischen und kreativen Offensivfußball im Spielsystem 4-3-3. Selbst für Schriftsteller gibt es heute einen sichere Methode, auf geradem Weg vom Jungtalent zur Buchmessen-Attraktion zu werden: Sie studieren Poetik an den Literaturinstituten von Tübingen, Hildesheim oder Leipzig und haben mit diesem Diplom im Rücken den ersten Buchvertrag so gut wie in der Tasche. Wer zielstrebig ist, fleißig bis fanatisch und clever genug, beim Üben auch zu lernen (!), der wird seinen Weg machen. Ob er dann auch noch den letzten Funken hat, um in die absolute Weltspitze vorzustoßen, ist eine andere Frage. Als gut bezahlter Profi von seinem Können zu leben, wird allerdings zu 99,9% gelingen. Im Grunde ist es wie in der Musik: Technisch bräsige Sänger, Gitarristen oder Schlagzeuger können durch ihren ureigenen Stil oder eine dramatische Lebensgeschichte ihren Weg (c) Oliver Uschmann 2013 machen und sogar Legenden werden: als einer von tausend. Technisch virtuose Musiker werden ohne Seele in ihrem Spiel zwar häufig nicht zur Legende, machen aber auf jeden Fall ihren Weg in der Branche, weil man sie unbedingt braucht. Was uns zum zweiten Punkt führt. Zweitens: Fehler vermeiden reicht schon. Was macht eigentlich so ein Lionel Messi, das uns immer wieder verzaubert? Was löst diese Glücksgefühle aus, ihn einfach spielen zu sehen? Es ist die simple Tatsache, dass er die Dinger reinmacht! Dabei sollte das für einen gut bezahlten Stürmer eigentlich selbstverständlich sein, oder? Ist es aber nicht. Bei „Meistern“ im Handwerk findet sich unter zehn Malern, Installateuren, Automechanikern oder IT-Fachleuten immer nur einer, der wirklich weiß, was er tut und perfekte Arbeit abliefert. Die anderen stehen mit den Händen in den Hüften im Hausflur und sagen: „Besser geht das nicht bei der verwinkelten Decke.“ Oder: „Wenn Sie den Herd nicht sachgemäß nutzen, kann ich auch nichts dafür. Was kochen Sie auch so viel?“ Meine Frau und ich haben schon Zimmerleute erlebt, die ein Parkett abschleifen, als ob sie sich zum Nachbarn durchfräsen wollen und Server-Anbieter, die aus Versehen 250 Foren löschen. Im Zivildienst arbeitete ich für einen Arzt, der was konnte und einen, der nett war. Auf der Autobahn verlor meine Frau fast mal ein Rad, weil der Mechaniker vergessen hatte, alle Schrauben fest anzuziehen. Bei einem Langstreckenflug USA Großbritannien sind Ende September 2012 beide Piloten einfach eingeschlafen, da sie anscheinend der Auffassung sind, fliegen wäre in der Luft nicht unbedingt die wichtigste Aufgabe. Im letzten Hotel, in dem ich unterkam, konnte ich mit meiner Zimmerkarte alle (!) Türen öffnen, da die Rezeptionistin beim Codieren des Streifens offensichtlich überfordert war. Und die beste, die mit Abstand großartigste Zusammenfassung deutscher Dienstleistungsmoral hörte ich von einer Bäckereifachverkäuferin in der Shopping Mall FORUM am Bahnhof von Wolfenbüttel. Die Dame antwortete auf eine Brötchenbestellung mit den Worten: „Ich bin nicht da, ich will nach Hause!“ (c) Oliver Uschmann 2013 Profifußballer werden geringfügig besser bezahlt als Bäckereifachverkäuferinnen, spielen aber ebenfalls häufig so, als wollten sie sagen: „Ich bin nicht da, ich will nach Hause!“ Verteidiger spielen ohne Not einen Rückpass zum Torwart, der im Fuß des Gegners landet. Mittelfeldspieler verlieren den Ball an den Gegner, weil sie gerade Siesta halten wie spanische Piloten. Stürmer ballern selbst bei so genannten hundertprozentigen Chancen den Ball über das Tor und werfen danach brüllend den Kopf in den Nacken, als könne der Fußballgott ( S. XY) dort oben im Himmel was für ihre Inkompetenz. Es ist wie bei den „Meistern“ des Handwerks: Läuft ein „professioneller“ Stürmer alleine auf den Keeper zu, kann man sich als Fan oder Trainer noch lange nicht sicher rein, dass er trifft. Anders bei Menschen wie Messi. Sie heben den Ball mit der Fußspitze über den Torwart oder tanzen ihn aus, manche von ihnen spielen vor lauter Unterforderung kurz vorm Tormachen einfach noch einen Doppelpass mit sich selbst. Sie machen ihren Job. Fehlerlos. Immer. Und sie sind meistens Flöhe. Der einzige Mensch in unserem Leben, der stets einen herausragenden Job ohne Ausfälle macht, ist eine Frau. Unsere Zahnärztin Dr. Carla Hellkuhl aus Lüdinghausen hat sich unter sämtlichen Dentisten Deutschlands als die größte Virtuosin am Angststuhl erwiesen. Schrieben meine Frau und ich jemals ein Buch mit dem Titel Kompetenz – das rarste Gut der Welt, bekäme sie das erste der zwanzig Kapitel. Frau Dr. Hellkuhl ist ein „Floh“, zu dem wir aufsehen … und das nicht nur, weil sie die perfekte Größe für ein Laufstegmodel hat. (c) Oliver Uschmann 2013 Das Publikum Die Couch Potatoes Die am meisten verbreitete Art, in Deutschland Fußball zu gucken, besteht darin, sich faul auf dem Sofa zu fläzen und dabei über die müden Beine der Sportler zu schimpfen. Ob nun Männerfreunde in Trikots, den Blick gebannt auf dem Plasmafernseher und die Bierflaschen auf den aneinandergepressten Schenkeln abgestellt, Rentner in Wintergärten und Vorzelten auf Campingplätzen oder ganze Familien mit Vätern, Onkeln und Opas, über deren breite Schultern kleine Jungs klettern wie Kapuzineräffchen: Eine Gruppe von Menschen vor der grün gefärbten Glotze ist das Bild, das Außerirdische zu sehen bekommen sollten, um einen Einblick in unsere Gesellschaft zu bekommen. Zoomen die Aliens mit ihrer Analyselupe aus den Wohnzimmern und Wintergärten wieder heraus und auf die Straße zum gleichzeitig stattfindenden Public Viewing stellen sie erstaunt fest, wie sehr sich die Stubenhocker von den Frischluftfanatikern unterscheiden. Die Couch Potatoes heißen schließlich nicht umsonst Sofakartoffeln. Sie erhielten ihren Namen einst aufgrund ihrer Körperform, die von abenteuerlichen Asymmetrien geprägt ist. Straffer Bierbauch und schlaffe Oberarme, fleischige Wangen und kaum auf gleicher Höhe stehende Augen, Haare in Nase und Ohren, fliehende Stirn, die riesigen Füße untergebracht in Badeschlappen von der Größe illegaler Flüchtlingsbote. Kurzum: Die Couch Potatoes bilden den körperlichen Normalfall, man könnte sie ihrer Physis nach genauso gut „Couch Kürbisse“, „Couch Avocados“ oder „Couch Turnbeutel“ nennen. Sie sind das absolute Gegenteil der schönen, strahlenden, lachenden, athletischen und werbespottauglichen Menschen, denen beim Public Viewing ( S. XY) das Betreten der Fanmeilen erlaubt wird, um attraktive Bilder fürs Fernsehen zu kriegen; all dieser durchtrainierten Werbetexter und Sonnenmilch-Models aus Berlin-Mitte, die mit Fußball gar nichts am Hut haben und speziell für Spiele der deutschen Nationalmannschaft gecastet werden, während die Couch (c) Oliver Uschmann 2013 Potatoes sich alles ansehen, was ihnen einen Grund gibt, auf dem Sofa sitzen zu bleiben – von der „besten zweiten Liga der Welt“ bis hin zu Übertragungen publikumsfreier Regionalligaspiele in Niedersachsen durch Sondersendungen des NDR. Dabei sind die Sofakartoffeln gar nicht mal so unbeweglich, wie es in den ersten acht Minuten einer Partie scheinen mag, wenn die Teams auf dem Platz sich noch gemächlich abtasten und auf dem Sofa erst ein halber Liter Bier und 300 Gramm Chips ihren Weg in den Leib der menschlichen Kartoffel gefunden haben. Nimmt das Spiel Fahrt auf, entstehen schließlich unter den faulen Fläzenden Regungen und Verwirbelungen, als rühre ein Sturm im vorher windstillen Gewässer. Die Couch Potatoes geraten in Erregung und vollführen je nach Spielverlauf mehrere Dutzend Male einen der folgenden Moves: Hard Headshaking Auslöser: Fehlpass, unschlüssiger Pass, Rückpass auf Torwart Bewegung: Zurücklehnen des Oberkörpers und starkes Schütteln des Schädels in einer Weise, als wolle man freihändig eine lästige Brille loswerden. Shake & Snort Auslöser: Vergebene Torchance, „unberechtigte“ gelbe Karte Bewegung: Heftiges Kopfschütteln plus lautes, sehr speichelintensives Prusten. Benetzt im Laufe des Abends sämtliche Möbel, Flaschen und Mitmenschen mit einem feinen Film aus Speichel und Mundsud. Hand Thrower Auslöser: Vergebene Torchance, „unberechtigte“ rote Karte Bewegung: Die Hände werden beide gleichzeitig mit einem heftigen Ruck nach vorne geworfen, als wolle man sie von den ausgestreckten Armen abschießen wie zwei Extrawaffen, die in den Fernseher auf das Feld fliegen, den Schiri abwatschen und ähnlich eines Bumerangs wieder zurückkommen. (c) Oliver Uschmann 2013 Headhand Drums Auslöser: Vergebener Elfmeter, unerwartete Niederlage kurz vor Schluss Bewegung: Die Hände werden zunächst mit beiden Handflächen flach vor die Stirn geklatscht. Danach wandern sie schnell weiter auf den Kopf, wo die Finger entweder das Resthaar rupfen oder einfach nur rhythmisch auf den eigenen Schädel einschlagen, während aus den Mündern unbegreifliche Flüche und Laute entweichen. Diese vier Standard-Moves sind selbstverständlich in Stärke, Dauer und Intensität variierbar und können in besonders dramatischen Spielsituationen zu sogenannten „Combos“ zusammengeführt werden, wie man sie aus Kampfvideospielen kennt, wo es für direkt aufeinanderfolgende Aktionen glitzernde Bonuspunkte hagelt. Die Couch Potatoes drücken ihre Empörung über das Geschehen auf dem Feld nicht nur durch das Ausführen schwungvoller Moves aus. Sie begleiten die Partie gleichzeitig mit verächtlichen Kommentaren. Dies ist ein weiterer Unterschied zu den Happy-Go-Lucky-Figürchen beim Public Viewing, die bereits einen einfachen Pass von Sami Khedira wie ein Tor bejubeln, weil Sami sie mit seiner Frisur an sie selbst erinnert und auch gut an einem sonnigen Freitagnachmittag im Alfa Romeo-Cabrio vor der Agentur vorfahren könnte. Als Kenner und Könner im Geiste sind die Couch Potatoes wie strenge Väter aus den Fünfzigern – sie kritisieren lieber Hundert Mal, bevor sie einmal loben. Zugleich aber betrachten sie wie der strenge Nachkriegsvater damals seine elf Söhne, jeden Spieler auf dem Platz als ihre eigene Familie. Daher sagen Couch Potatoes im Gespräch über die Fußballprofis auf dem Bildschirm sogar dann manchmal „wir“, wenn diese kolossal gescheitert sind. Das ist ungewöhnlich, da es in Deutschland eher üblich ist, das „wir“ nur bei großen Erfolgen zu verwenden. „Wir sind Papst!“, lautete die legendäre Schlagzeile der BILD nach der Wahl Joseph Ratzingers zu Gottes (c) Oliver Uschmann 2013 Stellvertreter auf Erden. Als dieser kündigte, war allerdings nirgendwo ein Aufmacher „Wir treten zurück!“ zu finden. Im Fußball läuft es häufig gleich. „Wir sind im Finale!“, freut sich das Land und beim Gegenteil: „Die Mannschaft ist rausgeflogen!“ Unter väterlich strengen Sofakartoffeln hört man jedoch tatsächlich Sätze wie: „Wie können wir da in der 15. Minute so sträflich die linke Seite offen lassen???“ oder: „Mit so einer Einstellung, wie wir sie heute an den Tag gelegt haben, fliegen wir schon in der Vorrunde raus!“ Am Ende sind sie sich – den Bierkasten geleert und die Hauskatze knisternd in den leeren Chipstüten nach Restkrümeln nestelnd – bei sanftem Vibrieren des Bauchfetts und der hängenden Wangen sicher: „Da war heute von uns überhaupt keine Laufbereitschaft zu sehen! Keine Laufbereitschaft. Mann, Mann, Mann …“ Meine größte Zeit als Couch Potatoe hatte ich in meinem ersten Jahr als Student. Ich hauste in einem Wohnheim, das von außen wie ein kleiner Borgwürfel aus Star Trek aussah – ein quadratischer, asbestverseuchter Klotz mit Fenstern, komplett verschalt mit schwarzen Schieferplatten. Das Sofa für mich und die anderen Kartoffeln stand in der Wohnheimbar im Erdgeschoss. Wir schrieben die Neunziger. Es waren unschuldige, urtümliche Zeiten, in denen der Wirt der Wohnheimkneipe noch keine Bollywood-Filmnächte oder ironisch gebrochene Marathonsessions südamerikanischer Seifenopern veranstaltete, sondern mit mürrischen Mundwinkeln und Aufnähern von Rot-Weiß Essen auf seiner Jeansjacke (womit die Mundwinkel erklärt wären …) hinter dem Tresen stand, halbherzig Gläser putzte und jedes Fußballspiel über Premiere (so hieß damals Sky) laufen ließ, das er finden konnte. Die Couch Potatoes und ich hingen derweil in dem brutal ausgeleierten Sofa, das einen mangels Federung bis auf den Kneipenboden sacken ließ. Ein gnadenloses Möbelstück. Da der Hintern darin tiefer sackte als die Oberschenkel, hatten großgewachsene Kartoffeln Mühe, an ihren eigenen Beinen vorbei zum Fernseher zu schauen. Die hoch angewinkelten Beine hätten für einen guten Blick weit nach links und rechts abgespreizt werden müssen, wo ihr Raum allerdings durch die Beine des Nebenmanns oder die hohe Sofalehne begrenzt wurde. (c) Oliver Uschmann 2013 Saß man einmal drin in dieser schicksalhaften Kuhle aus Stoff und Muff, war ein Aufstehen aus eigener Kraft im Grunde nicht mehr möglich. Diese Tatsache kam mir gut gelegen, als ich eines Tages aufgrund privater Probleme und pechschwarzer Bedrückung beschloss, in die innere Emigration auszuwandern. Ich schloss im vierten Stock des Wohnheims mein Zimmer ab, blieb noch einen Augenblick an der Klinke stehen, atmete schwer aus, ging die Treppen hinab in die Bar, versank im Sofa – und blieb. Ich verschmolz mit dem Sofa wie ein Insekt, das im Maul einer gigantischen Kröte langsam zersetzt wird und sah nur noch kleine Fußballer, wie sie entlang meiner Kniescheiben schossen und gestikulierten. Ich aß nicht, trank nicht, während mein Blick zu den unwirklichsten und unwichtigsten Spielen wanderte, die das Nischen-PayTV hergab. Nach Norwegen in die vom Eisregen durchtoste Tippeligaen. Zu Freundschaftsspielen zwischen Chile und Bolivien auf dem südamerikanischen Kontinent. In winzige Stadien von Siegen, Burghausen oder Ahlen, in denen irgendein Lokalsender zwei Kameras aufgestellt hatte. Die ersten paar Tage fanden alle es lustig und skurril. Wechselnde Gäste setzten sich neben mich, inspizierten meinen starren, auf den Fernseher gehefteten Blick, zogen an meinen Ohrläppchen und zogen mir an der Nase und den Brustwarzen. Nach einer Woche hörte ich im akustischen Nebel hinter dem Stadion Gespräche über „Polizei“, „Psychiatrie“ und „Angehörige“. Mitte der zweiten Woche richtete der Wirt seine ersten wirklich ernsten Worte an mich. Sie klangen gehaltvoller als sein gewohntes Gemurre, ich glaube, er hatte hinter seiner harten Fassade überhaupt noch nie so intim mit jemandem gesprochen. Seine Sorge verpackte er in typisch männlichen Humor, eine Art kecken Fatalismus. Das Sofa sei „eh schon hin“, hörte ich ihn sprechen, „das muss sowieso raus, aber ich kann dich nicht mit auf den Sperrmüll packen“. Dem widersprach ich und sagte ihm, er dürfe mich ruhig auf die Straße stellen, so wie ich verwachsen bin mit dem Sofa. Ich hatte so viele Sorgen, ich würde dann im Regen einfach auf meine Entsorgung warten. Gesagt, getan. Der Wirt holte sich die Hilfe zweier hochgewachsener HispanistikStudenten aus der Appartementwohnung im Erdgeschoss, wuchtete mich samt Sofa auf die Wiese am Rande des Bürgersteigs, wartete noch ein paar (c) Oliver Uschmann 2013 Sekunden mit in die Hüfte gestemmten Armen ab und ging dann kopfschüttelnd wieder ins Haus. Derart fußballfrei geworden und ohne Input durch den durchkickenden Fernseher, hatte ich Gelegenheit, im Wechsel der Wetter und der Gezeiten über meine scheinbar hoffnungslose Lebenslage nachzudenken. Nach einer Weile – die Sonne briet täglich das alte Sofaleder und der Regen weichte es wieder auf – kam der Wirt erneut aus dem Wohnheim, strich sich mit der linken Hand durch den Dreitagebart, so dass es klang wie eine Bürste auf einer groben Wohnwagenfußmatte und hielt mir mit der rechten ein Buch hin. „Hier“, sagte er, „vielleicht findest du darin eine Lösung.“ Mit gegerbtem Gesicht blinzelte ich in die Sonne, die Silhouette des Wirtes darin wie ein Schatten, und nahm das Buch. Es war ein Sammelband mit Fußballersprüchen. Und nach drei weiteren Tagen – die Ratten knabberten nachts schon an meinen Zehnägeln – fand ich ihn. Den einen Satz, der alles relativierte, was mir Sorge und Gram bereitete. Den einen Satz, der mich bis heute beschäftigt und trägt, da ich ihn in seiner endlosen Weisheit niemals vollständig begreifen werde, der aber eine Ahnung in sich trägt, die bereits reicht. Ein Gefühl, als habe man durch ihn beinahe alles verstanden, als fehle nur noch ein Schritt. Er stammt von unserem deutschen Kaiser, Franz Beckenbauer, und er lautet: „Der Grund war nicht die Ursache, sondern der Auslöser.“ Ich klappte das Buch zu, stand auf, ging in die Bar, setzte mich an die Theke, orderte ein Bier, schaute zum Fernseher und fragte den Wirt, als sei nichts gewesen: „Na? Was wird gespielt?“ Die außerirdischen Beobachter ziehen aus derlei verschiedene Arten, auf Sofakartoffelweise Fußball zu schauen, den Schluss: Der (männliche) Homo Sapiens braucht die kleinen Männchen im Fernsehen entweder, um miteinander nicht über seine Sorgen reden zu müssen oder, um alleine nicht über seine Sorgen reden zu müssen. Ein letzter, sportlicher Aspekt aber entgeht den Aliens bei dieser durchaus richtigen Schlussfolgerung: Es sind die meckernden, mosernden, Moves machenden Couch Potatoes, die (c) Oliver Uschmann 2013 tatsächlich als Einzige auf dem Planeten das Geschehen während des Spiels korrekt zu deuten vermögen. Während der Schiedsrichter nie alles gleichzeitig sehen kann, die Fans im Stadion parteiisch und abgelenkt sind, die Spieler lügen und die Moderatoren trotz bester ihnen vorliegender Bilder in Gedanken längst ihren nächsten Satz planen, haben die Sofakartoffeln den Blick und die Ruhe, Zeitlupen und Naheinstellungen präzise zu deuten. Bevor die FIFA also noch Jahre benötigt, um den Chip im Ball oder den Videobeweis zu erlauben, kann sie auch gleich in Zusammenarbeit mit den Herstellern neuer Smart-TVGeräte eine spezielle Couch-Potatoe-Beteiligungs-Fernbedienung erfinden, bei der Millionen von Kartoffeln dem Schiedsrichter bei einer schwierigen Entscheidung per Blitzvoting zur Hand gehen. Im Falle einer Abstimmung von 98% zu 2% für den Elfmeter der deutschen Nationalmannschaft im Finale trotz offensichtlicher Schwalbe durch einen doppelt eingesprungenen Kruse darf der Schiedsrichter dann immer noch sein Veto einlegen. Alles in allem jedoch würde die geballte Aufmerksamkeit und Intelligenz des ebenso faulen wie fanatischen Schwarms den Fußball in ganz neue Dimensionen führen. Die Menschen auf der Gerade Im Sommer tragen sie saubere Kurzarmhemden von Sinn Leffers oder Peek & Cloppenburg. Im Winter ziehen sie die leicht angegrauten Köpfe zwischen die Krägen ihrer schwarzen Fleece-Mäntel und pusten mit spitzen Lippen auf die dampfende Stadionwurst. Sie sind friedlich und freundlich. Sie sind alte Männerfreunde mit stabilen Ehen und erwachsenen Kindern. Töchtern, die Sabrina heißen oder Celine und die in Spanien Wirtschaft studieren oder wenigstens Pädagogik in Münster. Sie sind aber auch Familien mit Oma, Opa, Eltern und Enkel, die einfach so ins Stadion kommen und vorher nicht das Ritual der Verwandlung ( S. XY) durchlaufen. Manchmal sieht man unter ihnen sogar Männer, die alleine im ergonomischen Schalensitz hocken – ohne Freunde, Kind und Kegel – und sich in Ruhe das Spiel anschauen, als müssten sie sich von etwas oder von jemandem erholen. Sie sind Väter mit erwachsenen (c) Oliver Uschmann 2013 Söhnen, die sich nach Jahren wieder annähern, indem sie gemeinsam ins Stadion gehen. Sie sind Cliquen von Freundinnen, die statt ins Shopping Center in die Fußballarena fahren, weil sie privat selber spielen und, wenn sie ehrlich sind, am Samstag am liebsten hochklassige Männerspiele sehen. Sie sind alle: Die Menschen auf der Gerade. Die Gerade mit den vielen Sitzplätzen ist im Stadion das, was das Wohnviertel mit den Einfamilienhäusern oder Doppelhaushälften in der Gesellschaft ist. Die bürgerliche Mitte. Die Menschen auf der Gerade haben weder mit der reichen Elite hinter den Fenstern der VIP-Lounge zu tun noch mit der Basis der singenden, tobenden und Fahnen schwenkenden Fans in der Kurve oder gar der Subkultur der Ultras. Die Menschen auf der Gerade wollen nicht auffallen und machen alles in einem gemütlichen Modus. Bier holen, Wurst essen, das Stadionklo aufsuchen, selbst während der Partie – sie haben keine Angst mehr, etwas zu verpassen und bewegen sich mit der Gelassenheit von Koala-Bären oder Wasserbüffeln. Die Menschen auf der Gerade lassen sich nicht hetzen. Sie sind angekommen. Begibt man sich zwischen sie, sollte man genau das Gegenteil von dem tun, was in der Kurve angesagt ist. Wo man dort negativ auffällt, wenn man nicht singt, grölt, springt und flucht, ist Ruhe in der Gerade genau das Richtige. Nur wenige tragen hier einen Fanschal oder ein Trikot, um sich zu einer Mannschaft zu bekennen und selbst wenn, springen sie bei einem Tor des eigenen Teams nicht sofort auf, rammen der vor ihnen sitzenden Lehrerin die Kniescheibe in den Nacken und brüllen, auf dass die Spucke über die Fleece-Mäntel fliegt: „Ihr – könnt – nach – Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt nach Hause faaaaaaaaaaaaaaaaahrn!!!“ Wer sich eine Karte für die Gerade kauft, muss sich einfach vorstellen, er ginge gar nicht in ein Fußballstadion, sondern auf den Weihnachtsmarkt. Die geruhsame Art, mit der man dort plaudernd vor dem Glühweinstand steht, mit vereinzeltem Lachen und Nicken, Grüßen und Grinsen – sie ist genau angemessen für die wohltemperierte Stimmung auf den kultivierten, geordneten Sitzplätzen. (c) Oliver Uschmann 2013 Jetzt kann man natürlich sagen: Was will man in einem Stadion mit ein paar Tausend Schlaftabletten, die sich höchstens bei Weltmeisterschaften dazu bewegen lassen, eine Laola mitzumachen, sich ansonsten aber während der Partie so unparteiisch und unaufgeregt über das Spiel unterhalten, als ginge es dabei um nichts und als wäre es ihnen tatsächlich Recht, wenn „der Bessere“ am Ende gewinnt? Wofür braucht man diese Menschen? Weil das Leben dialektisch ist. Will sagen: Es gibt keinen Tag ohne die Nacht. Das Salz wäre ohne Suppe ungenießbar. Klänge alles wie Heavy Metal, wäre nichts mehr wirklich hart. Und ohne Spießer existierten keine Rebellen. Das gilt sogar für das Wohnviertel, in dem meine Frau und ich leben, als kleiner Welt für sich. Unser Haus liegt an einem Ende der verkehrsberuhigten Zone, es ist sozusagen die Südkurve, von der aus wir auf die zwei geraden Tribünen schauen, die von den Häusern der Nachbarn rechts und links des Pflasters gebildet werden, unterbrochen nur von der Zufahrt durch die Querstraße. Am anderen Ende des Weges liegt dann wieder ein Anwesen, die Nordkurve sozusagen. Die Leute, die dort leben, kennt niemand so richtig. Sie haben ihren Teich mit einem Sonnensegel aus militärischer Tarnfleckplane überspannt und statt Blumen oder Rosenstöcken stehen bei ihnen Stahlskulpturen im Steingarten. Uns kennen die Nachbarn durchaus, halten uns aber trotzdem für komisch. Für anders. Sind wir ja auch. Die Nachbarn von den zwei Geraden, sie arbeiten ganz normal. Als Krankenpfleger, Lehrer, Polizisten, Buchhalter. Und sie sind Mitglied in allen dörflichen Clubs. Schützenverein, Tennisverein, Heimatverein. Meine Frau und ich sind nirgendwo Mitglied und „arbeiten“ kann man das, was wir machen, aus Sicht dieser Menschen auch nicht nennen. Was soll das? Bücher schreiben? Die meiste Zeit sehen die Nachbarn mich, wie ich im Garten mit mir selbst Fußball spiele oder den Kater aus dem Apfelbaum pflücke, während Sylvia in ihrem virtuellen kleinen Dorf im Videospiel Animal Crossing auf dem Nintendo DS ihr Haus verschönert, Spekulation mit Rüben betreibt und einen seltenen Skorpion jagt oder, wahlweise, oben in (c) Oliver Uschmann 2013 ihrem Atelier mit großem, farbverschmierten Kittel abstrakte Motive auf die Leinwand bringt oder am Schreibtisch über den schwersten Logikrätseln der Menschheit grübelt, die sie mit ihrem IQ braucht, denn beim Verein Mensa Deutschland für Hochintelligente, da ist sie Mitglied. Ich übrigens nicht. Ich bin Hochbegabtinnengatte. Wir jedenfalls, „die komischen Künstler“ am einen und die Militärsegelfreaks am anderen Ende der Straße sind sozusagen die Ultras des Alltags, von den Nachbarn auf der Gerade gleichermaßen mit Respekt wie mit Skepsis beäugt. Denn – schaut man im Stadion einmal ganz genau in die Augen der sanften Sitzplatzreservierer stellt man fest, dass ihr Blick hin und wieder weg vom Spiel Richtung Fankurve wandert. Dann schauen sie sich an, wie die wilden Horden dort aus sich herausgehen und bekommen heimlich unter ihren Hemden und Mänteln eine Gänsehaut. Sanft legen sie den Kopf zur Seite und drehen ihr Ohr den wuchtigen Schallwellen entgegen, die aus den Kehlen und Trommeln der Ultras branden, während sich gigantische Banner entfalten oder sogar bengalische Feuer gezündet werden, die die Menschen auf der Gerade offiziell ganz böse finden müssen, während sie tief in sich drin dieses Brennen im Bauch spüren, dieses Feuer, das sie nicht mehr ausleben, weil sie „vernünftig“ geworden sind, Menschen von Maß und Mitte, die Fußballfreund gewordene Dreieckshandflächengeste von Angela Merkel. Das Schöne beim Fußball ist, dass jeder in der Geraden dieses Feuer ausleben und wieder den Platz wechseln könnte. Schon nächsten Samstag könnte er sich verwandeln, die Fanklamotten entstauben, Position beziehen, eine Stehplatzkarte kaufen, die Stimme mit Wicküler und Whiskey vorschmieren und einfach wieder grölen, als wäre seine wilde Zeit gestern gewesen. Und die Menschen bei uns im Viertel, sie könnten sich an den Schreibtisch setzen und über die verrücktesten Erlebnisse im Dienst Bücher schreiben oder uns aufs Diktiergerät sprechen, damit wir es für sie tun. Oder sie könnten alle nervigen Büsche aus ihrem Garten reißen, stattdessen Steine legen, Störche aus Stahl aufstellen und einen Fahnenmast in den Boden rammen, an dem sie jeden Tag eine (c) Oliver Uschmann 2013 vollkommen unsinnige Flagge hochziehen, nur um endlich mal verrückt, seltsam und anders zu sein. Umgekehrt kann jeder, der der Kurve müde ist, Schal und Kutte gegen Fleece-Kragen und Hemd tauschen, seine Stimme schonen und in die Gerade wechseln. Hauptsache ist, dass es neben denen an den Rändern und in den Kurven auch immer genug Menschen auf der Gerade gibt. Denn ohne die Geraden als stabile Seitenwände, da bräche wohl das ganze Stadion zusammen. Die Hooligans Ich muss gestehen: Ungefähr ein Jahr lang war ich ein Hooligan. Keiner wusste davon. Denke ich heute an diese Phase meines Lebens zurück, reibe ich die Kerbe, die mein Kinn unter dem Ziegenbart spaltet. Wir trafen uns mit anderen auf Wiesen und Parkplätzen, im Stadtpark und hinter Turnhallen. Zwanzig Leute, ungefähr, auf jeder Seite. Erlaubt waren Fäuste, Füße, Stöcke und Knüppel. Keine Messer, kein Glas, aber auch keine Baseballschläger, die den Hooligans so gerne im Kopf klischeeverseuchter Zeitungsredakteure angedichtet werden. Die Momente auf dem Weg zum Ort des Geschehens waren fast genauso gut wie der Kampf an sich. Blieb uns ausreichend Zeit, liefen wir sogar Umwege, damit es länger dauert. Damit wir ein paar Minuten mehr das Gefühl auskosten konnten, durch die ganz normale Welt mit ihren Tankstellen und Fahrradständern und Blumenkästen zu laufen und dabei aber kein ganz normaler Teil mehr von ihr zu sein. Alles um uns herum verwandelte sich in diesen Augenblicken in ein Spielfeld, einen Parcours, ein Filmset für eine Schlacht mit echtem Blut. So, wie es besonders reizvoll ist, wenn es für einen Ego-Shooter wie Counter Strike eine Map rund um einen Supermarkt von ALDI gibt und sich ein Ort, in dem „zivilisierte“ Menschen einkaufen, plötzlich in eine Kulisse für eine Schlacht verwandelt. Sich anzuziehen zuvor, die Trainingsjacke zu schließen und zu wissen: Ich gehe nicht laufen, ich gehe mich schlagen. Alle Regeln darüber, was machbar ist, denkbar, erlaubt, über Bord zu werfen. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Wie ein Schicksal, das man mit den anderen Jungs (c) Oliver Uschmann 2013 teilt. Ein auserwählt sein. Anders als der brave Rest auf den Schützenfesten und dem Rummel, der laut ist und grölt und trinkt, aber diese Grenze niemals übertreten würde. Als Notwehr oder Affekthauerei vielleicht, panisch und unkoordiniert, rasend nach außen und mit der Angstpipi in der Hose nach innen. Aber niemals systematisch, regelmäßig, einmal die Woche. Unter uns gab es alles. Söhne von Medizinern. Söhne von Anwälten. Söhne von Altenpflegern. Im Alltag halfen wir alten Omas über die Straße, gossen sorgfältig im Garten die Blumen und kraulten stundenlang unsere Katze. Aber hier, in der Konfrontation mit dem Gegner, ließen wir uns auf andere Art auf unsere Mitmenschen ein. Wir lernten sie kennen, wie Männer sich kennenlernen sollten. Ihre Angst, ihre Wut, ihre Ausdauer. Wir wussten, wie sie rochen, ganz nah und wie sich ihre Knochen anfühlten unter der dünnen Schicht von Haut. Viele von uns waren hagere Bohnenstangen, keine Muskelmänner. Wir schlugen mit rudernden Armen aufeinander ein wie heute die Unterhemdenträger beim „Violent Dancing“ auf Konzerten von Hatebreed oder Terror. Wir waren uns nah. Wie sagt Seraph, der Beschützer des Orakels, in Matrix Reloaded ganz richtig? „Man kennt jemanden erst, wenn man mit ihm gekämpft hat.“ Eine Menge Leute denken, beim Hooliganismus geht es um Hass. Das stimmt nicht. Es geht um Selbstbehauptung. Viele von uns waren eben keine Außenseiter, keine Opfer, keine Benachteiligten wie Cass, das jamaikanische Waisenkind aus Legend of a Hooligan, täglich von seinen Mitschülern und seinen Lehrern in den 50er-Jahren gemobbt, verprügelt und gedemütigt und das erste Mal im Leben Respekt erfahrend, als er als Mitglied der Inter City Firm von West Ham United zum gefürchteten Hooligan aufsteigt. Wir waren eher wie Elijah Wood in seiner Rolle als Matt Buckner in Hooligans. Klein, kultiviert, klug und geprägt von Müttern, die uns sagten: „Du hast es doch gar nicht nötig, dich zu schlagen.“ Oder, noch besser: „Der Klügere gibt nach.“ Hass als Grundgefühl war in uns überhaupt nicht vorhanden. Nur der Drang, bei allen Pflichten und Regeln und Bevormundungen wenigstens (c) Oliver Uschmann 2013 einmal in der Woche zu leben. Es zu spüren, das Dasein. In seiner ursprünglichsten Art. Hätten wir damals schon den Film 66/67 gekannt, wären uns wohl die Worte der Hauptfigur Florian (Fabian Hinrichs) über die Lippen gekommen, der dort seiner kultivierten Freundin erklärt, was die kindische „Klopperei“ überhaupt darstellt. Loyalität, Schulter an Schulter. Den Versuch, „eine archaische, fast schon ausgestorbene Grundtugend auszuüben.“ Zugegeben, dieser Florian aus Deutschlands bestem Hooliganfilm, ist ein ziemlich krankes Arschloch. In einer Szene zerschlägt er einem längst Wehrlosen das Gesicht so sehr, dass es selbst seine Leute entsetzt. Das haben wir nie getan. Für uns galt immer, was der ehemalige Hamburger Hooligan Alexander Hoh in seinem Lebensbericht In kleinen Gruppen, ohne Gesänge schreibt. Wenn einer am Boden liegt, hörst du auf. Und unterwegs sein mit den Jungs, mit der „Firma“, wie sich HooliganVereinigungen nennen, das ist nicht nur der Kampf, nicht nur das Match. Auch Unsinn machen, Mist bauen wie die Kinder, sinnlos und frei. Manchmal sogar mit dem Gegner, gemeinsam, nach der Schlägerei. Was heute in Polen passiert, auf dem Balkan oder gar in Brasilien, wo Hooligan-Vereinigungen bewaffnete Gangs sind, sie sogar aufeinander schießen – wir hätten es nicht ahnen können. Eines muss ich außerdem zugeben: Ich selbst habe sehr häufig im Getümmel gestanden, ohne selbst viel zu tun. Wie ein Schauspieler in einer Filmszene, der kurz innehält und sich umsieht, während um ihn herum die Orks aufstieben und die Köpfe in Zeitlupe fliegen. Wie ein Soldat in einem Kriegsspiel wie Operation Flashpoint, der die anderen neun Teammitglieder die Schüsse abgeben lässt und selber kaum feuert. Ich hatte kein großes Bedürfnis, den Klang eines gebrochenen Nasenbeins häufig zu hören, so wie andere, auf beiden Seiten. Das olympische Motto „Dabeisein ist alles“ hatte für mich seine ganz eigene Bedeutung. Das ist nun alles lange her. (c) Oliver Uschmann 2013 Die großen Hooligan-Firmen aus Manchester, West Ham, Eindhoven, Rotterdam oder Cardiff existieren immer noch. Unsere kleine Truppe aus Wesel ist längst Geschichte. Sie hieß „Klasse 4a“, war stationiert an der Grundschule und traf sich mit der konkurrierenden Firma „4b“ zur Keilerei auf Wiesen und Parkplätzen, im Stadtpark und hinter Turnhallen. Eine Nase brach dabei nie. Und die Kerbe in meinem Kinn, unter dem Bart, stammt von der kleinen, mit feuchtem Moos bedeckten Mauer in der Nähe des Häuserblocks meiner Oma, auf der ich beim Balancieren ausrutschte und mit dem Kopf aufschlug. Es waren wilde Zeiten. (c) Oliver Uschmann 2013 Die Veranstaltungen Das Bolzplatzspiel Jedes Mal hatte ich Angst. Und jedes Mal wollte ich hin. Auf den Bolzplatz, die Keimzelle des Fußballs, die Basis aller Basen, den wichtigsten Ort in der Entwicklung vom Jungen zum Mann. Zu unserem Bolzplatz gingen wir damals immer mit fünf Jungs. Alle hatten aufs Pöhlen, aber keiner entsprach den nötigen Anforderungen an Körperkraft, Selbstbewusstsein und Machotum. Die braucht man, wenn’s auf den Bolzplatz geht. Denn auf dem Bolzplatz, da warten schon die Gegner. Und die sind aus ganz anderem Holz geschnitzt. Das Holz, aus dem wir gefertigt wurden, war brüchig wie Pressspan. Unsere Mütter hatten uns nicht zur Härte erzogen. Sie sagten immer so Sachen wie: „Der Klügere gibt nach!“ Oder: „Ihr habt es doch gar nicht nötig, zu hauen. Das ist unter Eurer Würde.“ So kamen wir dann also ganz würdevoll am Bolzplatz an und zitterten wie Espenlaub, wenn Serkan und seine Jungs schon mit dem Fuß scharrten. „Was seid ihr so spät, ihr Mongos?“, begrüßte er uns dann und seine Kollegen lachten. Sie alle lebten in den Mietburgen ein paar hundert Meter weiter nach Norden, vorbei an den Altglascontainern, der Trinkhalle, der Spielhölle und dem Wettbüro. Unser zu Hause erreichte man in die andere Richtung. Sie gingen auf die Hauptschule. Wir aufs Gymnasium. Sie hatten Muskeln, überall. Nicht so viele wie Bodybuilder, aber man konnte sie sehen, lauter definierte Hügel. Bizeps, Trizeps, sogar Bauchmuskeln. Mustafa, der als einziger keine Muskeln hatte, war dafür ein Schrank. Er hatte die Statue eines Wrestlers, der nicht wie The Rock oder The Edge als Athlet auftritt, sondern als Attraktion von Körperfülle. Die kleinen Augen in seinem großen Kopf saßen wie Knöpfe über den runden Wangen. Sein Haar war fettig, seine Oberarme muskelfrei, aber dafür breiter als die meisten jungen Birken hinter dem Bolzplatzzaun. (c) Oliver Uschmann 2013 Wir sahen alle aus wie verbogene Fahrradständer oder Sonnenschirme, von denen der Schirm selbst weggeflogen ist. Wir waren hagerer und kleiner. Unsere Mütter hatten während der Schwangerschaft nicht etwa mehr gegessen, damit wir was auf die Rippen kriegen, sondern im Gegenteil mit dem Essen aufgehört, was ja selbst bei Fußballprofis zum Schrumpfen der Spieler ( S. XY) führt. Vor allem aber hatten wir das Gefühl, dass die Welt kein Platz ist, in der wir was zu bestimmen haben. Und der Bolzplatz schon gar nicht. Im Spiel gegen Serkans Truppe galt es nun, ständig abzuwägen, wie weit man überhaupt gehen kann. Ein Bolzplatzspiel kennt keinen Schiedsrichter. Es lebt vom gegenseitigen Vertrauen aller Beteiligten, die richtigen Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Das klappt natürlich nicht. Holte Serkan einen von uns von den Beinen, hieß es statt Elfmeter: „Stellt euch nicht so an, ihr Mädchen!“ Wagte es einer von uns, die Knöchel oder Schienenbeine der offensiven Osmanen auch nur zu berühren, schrien sie im Kollektiv auf und bildeten sofort ein Rudel um einen, brüllend und empört, so dass einem das Herz in die Hose rutschte und niemand sich traute, zu sagen, dass da gerade wirklich nichts wahr. Noch härter, als auf einem Bolzplatz zu spielen ist es, den Bolzplatz überhaupt erst mal zu bekommen. Diesem Problem sieht man sich jedes Mal ausgesetzt, wenn man statt auf seinen Stammplatz auf irgendeinen anderen geht. Immer sind dann schon ein Dutzend andere da, die spielen und spielen und dabei so tun, als stünden da nicht seit einer Stunde schon fünf krumm gewachsene Jungs hinterm Zaun und würden bettelnd gucken. Irgendwann erbarmen sie sich dann und sagen: „Wollt ihr mitmachen?“ Dann läuft man auf den Platz wie ein junger, mit dem Schwanz wedelnder Hund und freut sich schon, obwohl man weiß: Jetzt kommt erst mal das schlimmste Ritual überhaupt. Mannschaften wählen. Lassen einen Fremde mitspielen, stellen sie nämlich nicht die eigene Gruppe geschlossen gegen die Gäste, sondern glauben, es sei besonders gerecht und angemessen, die Teams erst mal neu zu wählen. Zwei selbst ernannte Kapitäne laufen dann aufeinander zu und setzen einen Fuß (c) Oliver Uschmann 2013 genau vor den anderen, ohne Lücke. Wer zuerst so auskommt, dass seine Fußspitze auf dem Schuh des Gegenübers landet, darf mit dem Wählen beginnen. Und dann steht man da, ein menschliches Wiesenkraut, und wartet. Junge für Junge wird für die Teams nominiert, während man schließlich selbst als ungeliebtes Mängelexemplar übrig bleibt und der Captain einer Mannschaft laut seufzend winkt und sagt: „Ja, dann mach halt bei uns mit.“ Dieses Gefühl, auf dem Bolzplatz irgendwie immer der Außenseiter zu sein, der mitmachen darf, den aber keiner wirklich gebrauchen kann, hört niemals auf. So war ich im Frühjahr 2011 zum Beispiel in Tunesien als Gast unseres Bekannten Anouar, der als Chefanimateur in einem sehr preisgünstigen Hotel mit Riesengelände arbeitet. Als er mitbekam, dass ich gerne Fußball spiele, brachte er mich wie einen kleinen Jungen zum täglichen Spiel der Animateure und Hauspagen auf dem Bolzplatz in Strandnähe. Die Animateure trugen Trikots von Ronaldo, Figo oder Puyol und sahen aus wie gnadenlos gute Liebhaber, die jedes Wochenende zwölf Touristinnen vernaschen. Sie waren alle rund zehn bis fünfzehn Jahre jünger als ich. Anouar befahl ihnen mit seiner tiefen, arabischen Stimme, mich mitmachen zu lassen. Die Animateure ließen es zu. Nicht nur, weil Anoaur ihr Boss und Ernährer ist, sondern auch, weil sie sich dachten: Immerhin ist dieser Oliver ein Deutscher. Und den Deutschen, denen liegt der Fußball im Blut. Wir spielten fünf gegen fünf mit acht Männern in jedem Team und fliegendem Wechsel. Eine Partie dauerte ohne Pause am Stück genau 25 Minuten. Die Sonne brannte auf den Platz und meinen kahlen Schädel, während das Mittelmeer an den Strand brandete. Eine struppige Katze pinkelte gegen die Ruine eines Toilettenhäuschens. Am Strand priesen Teenager mit Pferden den Touristen Ausritte für Wucherpreise an. Die tunesischen Animateure spielten anders als damals Serkan, Mustafa und ihre Gang. Sie mussten nicht treten oder foulen. Sie ließen den Ball laufen wie eine Flipperkugel. Dass ein Pass in meine Richtung kam, den ich wiederum irgendwo hin hätte weiterspielen sollen, bemerkte ich immer erst an dem enttäuschten Ausruf, als der Ball schon längst vorbei war. Ich (c) Oliver Uschmann 2013 versuchte, mitzuhalten, doch es war zwecklos. Was konnte ich auch erwarten? Diese Männer waren Tunesier. Und Animateure! Diese Jungs traten morgens um acht ihren Dienst an, spielten mit den Kindern der Gäste, zockten mittags in der Hitze Fußball, flirteten nachmittags mit den jungen Müttern oder den solo angereisten Frauen, tanzten nachts bis um 3 Uhr in der Hoteldisko und verschwanden danach mit dem Date ihrer Nacht auf dem Zimmer, um die Dame dort bis um 7:25 Uhr so artistisch zu verwöhnen, als würden sie zusätzlich zum unfassbaren Liebesknochen noch vier Armen und zwei Zungen gleichzeitig zum Einsatz bringen. Dann schliefen sie 18 Minuten und standen wieder auf. Der Bolzplatz ist ein Test. Ein ehrlicher Spiegel. Er sagt dir: Du wirst niemals ein Serkan sein oder ein Anouar. Er sagt dir aber auch: Aber wehe, du strengst dich nicht an. So geschah es damals eines Tages, dass ich, als sich Serkan und seine Jungs wieder mit breiter Brust um mich herum rudelten, da ich es gewagt hatte, ihn leicht am Trikot zu ziehen, aus heiterem Himmel meinen Rücken gerade machte, meine Augen mit Feuer füllte, die Oberlippe leicht schürzte wie Billy Idol und einfach zurückbrüllte: „Das war gar nichts, Alter! Und das weißt du auch!!!“ Diese Aussage unterstrich ich noch, indem ich Serkan das erste Mal mit dem Finger auf die Brust tippte. Eine Brust, die ich in den fünfzig Spielen zuvor noch niemals berührt hatte. Für eine Sekunde war Ruhe. Auf dem Platz, auf der Straße, im Wald. Meine Freunde erstarrten vor Angst. Sie dachten: Jetzt verwandelt sich Serkan in einen reißenden Zahnzyklopen und beißt mir den Kopf ab. Die Baumwipfel stellten das Rascheln ein und ein Hund, der gerade eben neben dem Stromkasten außerhalb des Zauns sein Bein gehoben hatte, kniff die Augen zusammen und hielt ein. Serkan atmete ruhig und langsam aus, hielt sich ein Nasenloch zu, rotzte aus dem anderen einen Popel auf den Boden hinter sich, drehte sich wieder zu mir, strich sein Trikot glatt, sah mir tief in die Augen und sagte dabei laut zu seinen Leuten: „Gut. Dann weiter!“ Was sein Blick mir aber gleichzeitig sagte, war: „Weiter so. Womöglich wirst du doch noch zum (c) Oliver Uschmann 2013 Mann.“ Die Tunesier wiederum klopften mir zwei Jahrzehnte später auf die Schulter und sagten: „Hast dich tapfer geschlagen.“ Zwar hatte ich so gut wie keinen Pass sauber angenommen und meinen einzigen Treffer dadurch erzielt, dass ich über den Ball gestolpert und mit ihm ins Tor gefallen war, aber immerhin: Ich war die ganze Zeit gerannt. Bei 30 Grad im Schatten. Als Nordlicht. Der Bolzplatz lehrt das Überleben. Beim Fußball. Und auch darüber hinaus. Auf dem Bolzplatz, der bei uns zu Hause oben auf dem Hügel am Ende des Rapsfeldes liegt, habe ich eben Geräusche gehört. Das typische „Pling!!!“ des Balles, wenn er auf den Zaun trifft. Meine Ohren bewegen sich bei diesem Geräusch jedes Mal. Sylvia sagt: „Geh hoch. Du willst es doch.“ Ich habe Angst. Aber ich will hin. Abspeichern. Bis später. Der Krimi 23. Mai 1999. Das Finale der Champions League in London. Bayern gegen Manchester United.90 Minuten sind vorüber. Rund um die Bank der Münchener werden schon die Kartons bereitgestellt und aufgerissen. Darin: Die vorgedruckten T-Shirts und Mützen mit der Aufschrift: Champions-League-Sieger 1999. Es werden drei Minuten Nachspielzeit gegeben, aber das bringt die Kartonaufreißer nicht aus der Ruhe. Bayern hat alles im Griff. Das ganze Spiel über waren sie drückend überlegen, die beste Mannschaft der Welt, glanzvoll und souverän. Vor zehn Minuten hat Lothar Matthäus den Platz verlassen. Er ist 38 Jahre alt und beendet sein letztes großes Finale für den FC Bayern mit dem weltwichtigsten Vereinstitel. Denkt er. Denken alle. Dann fallen zwei Tore für Manchester. Innerhalb von 103 Sekunden. Niemand kann es begreifen. Spieler fallen (c) Oliver Uschmann 2013 ins Gras wie Fichten beim Sturm Kyrill. Die Kartonaufreißer erstarren zu Stein wie vom Blick der Medusa getroffen. Die Presse wird das Finale später „Die Mutter aller Niederlagen“ nennen und damit ausnahmsweise mal nicht übertreiben. 20. Mai 2000. Letzter Spieltag der Bundesliga-Saison in Unterhaching. Bayer 04 Leverkusen ist Tabellenerster und hat drei Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. In der Gastkabine hat die Werkself bereits die vorgedruckten T-Shirts gelagert. Was soll schon noch schiefgehen? Sie haben es selbst in der Hand. Die erste Meisterschaft in der Geschichte der Leverkusener wäre ihnen nur noch zu nehmen, wenn sie hier, in der Provinz von Unterhaching verlieren. Sie haben Weltstars im Team, Michael Ballack führt sie an. Die Schale ist sicher. Denkt er. Denken alle. Dann fallen zwei Tore für Unterhaching. Das erste davon schießt Michael Ballack selbst. Eigentor. In der 21. Minute. Die Leverkusener werden es ausgleichen, da ist sich Deutschland sicher. Sie werden aufholen. Stattdessen gibt ihnen Markus Oberleitner in der 72. den Gnadenstoß. Spiele wie diese, die im letzten Moment kippen oder aber so enden, wie es vorher absolut niemand erwartet hätte, nennt man Krimis. Zum einen aufgrund ihrer Spannung, besonders, wenn der Fall erst ganz zum Schluss aufgelöst wird und der Täter – also der Sieger – plötzlich doch jemand anderes ist. Zum anderen, weil sie im Fernsehen zu den letzten Sendungen gehören, die es noch schaffen, fast die gesamte Bevölkerung von der Straße vor den Bildschirm zu holen. Das gelingt in Zeiten des Internets und der 600 Digitalsender bekanntlich sonst nur noch dem Tatort. Problematisch wird es jetzt, wenn derlei bedeutsame Spiele nicht mehr vom ganzen Volk geguckt werden können, weil sie nur noch im Pay TV laufen. So wie zum Beispiel die Partie Dortmund gegen Malaga am 9. April 2013, das Viertelfinale der Champions League. Am Abend des Spiels habe ich eine Lesung in der putzigen Buchhandlung Greif zu Eberbach. Kaum fertig mit meiner Show, stürze ich durch die vom Regen glitzernden Kopfsteinpflastergassen des Fachwerkstädtchens am Neckar ins Hotel und (c) Oliver Uschmann 2013 greife hektisch nach der Fernbedienung, um den Rest der Partie zu sehen. Und dann ist es wieder soweit: Keine Übertragung, nirgends. Die Sendeverträge sahen für das Viertelfinale vor, die Bayern frei zu zeigen und die Dortmunder verschlüsselt. Meine Schultern sinken hinab. Schließlich aber fällt mir ein, dass diese Umstände des Bezahlfernsehens eine ganz neue Art von Sendung hervorgebracht haben, bei der man nicht live das Spiel anschaut, sondern andere Männer, die sich live das Spiel anschauen! Der Mobilat Fantalk auf Sport1 ist diese skurrile Notlösung. In der Essener Sportkneipe 11 Freunde sitzen dann der Moderator Thomas Herrmann sowie mehrere Sportprominente zusammen, darunter Stammgäste wie Thomas Helmer, der Bochumer Trainer Peter Neururer oder der ehemalige Wolfsburger und Hamburger Profi Stefan Schnoor. Rund um diesen zentralen Stammtisch herum versammeln sich in der Kneipe normale Fans und schauen sich alle gemeinsam das Spiel im Pay TV an, das wir als Zuschauer nicht sehen dürfen. Wir selbst betrachten die Kneipe vielmehr aus Sicht des Hauptfernsehers an der Wand. Das Spiel bildet sich durch die Kommentare als Kopfkino in unserem Schädel. Wie beim Radio, nur mit dem Unterschied, dass wir die gesamte Gestik und Mimik der Kommentierenden beobachten können und dass diese nicht rein sachlich bleiben, sondern immer dann, wenn gerade wenig passiert, Anekdoten aus dem Sport erzählen und sich gegenseitig mit rauen, kratzigen Stimmen und verschmitzt funkelnden Augen aufziehen, wie Sportsmänner es vor dem Fernseher nun einmal tun. Der Mobilat Fantalk ist Fußballgucken zweiten Grades, die quadratische Gleichung des Gratisfernsehens in Zeiten ausgesperrter Übertragungen. Am Abend des 9. April in Eberbach setze ich mich also ins Hotelzimmer und schaue gebannt dabei zu, wie einige andere Männer ein Spiel gucken, weil sie Pay TV haben. Das Spiel ist ein Krimi. Dortmund scheitert, wie es aussieht, ausgerechnet gegen den Außenseiter Malaga. Nach 90 Minuten liegen sie 1:2 zurück. Keiner kann es fassen, nicht die Männer in der Bar im Fernsehen, nicht ich neben meinem Hotelbett und nicht die Menschen (c) Oliver Uschmann 2013 irgendwo im Nachbarhaus, die fluchen und stampfen. Wie „eiskalt“ der Konter der Spanier zur Führung wirklich war, kann ich nicht beurteilen. Auch nicht, ob der Torschütze so überdeutlich im Abseits stand, dass es eigentlich nicht hätte zählen dürfen. Ich habe es ja nicht gesehen und muss glauben, was man mir sagt. Wie sehr Malaga nun den Rest der Zeit mauert und den eigenen Strafraum zustellt, kann ich mir ebenfalls nur vorstellen. Eines aber scheint sicher – Dortmund bräuchte zum Weiterkommen noch ganze zwei Tore in der Nachspielzeit und wird sie nicht machen. Die Besucher der Bar auf dem Bildschirm schütteln mit den Köpfen und pressen die Lippen zusammen. Thomas Helmer ist „mehr als skeptisch“, ob hier noch ein Wunder geschehen kann. Thomas Herrmann beginnt so enttäuscht wie gemächlich, Ballbesitzstatistiken auszuwerten. Man spricht über die Fehler, die Dortmund gemacht hat und die Schelte, die es in den kommenden Tagen geben wird, als plötzlich einer „jetzt aber!“ ruft und aus heiterem Himmel das 2:2. fällt. Im Hotelzimmer bleibt mir der Löffel, mit dem ich gebackene Bohnen aus der Dose schaufle, im Mund stecken. Thomas Herrmann sagt: „Noch drei Minuten!“ Er klappt seine Finger aus. Dann wiederholt er es wie ein Mantra noch weitere zwei Mal. „Noch drei Minuten! Noch drei Minuten!“ Im Nachbarhaus brüllt einer: „Jockel! Komm wieder her! Sie haben ausgeglichen!“ Rote Bohnensoße tropft mir aus dem Mundwinkel auf den runden, lasierten Zimmertisch. Für einen kurzen Augenblick bringt die Kamera des Mobilat Fantalk einen zweiten Fernseher ins Bild, der ebenfalls in der Kneipe hängt. Auf ihm sieht man, wie sich eine Laola durch das Dortmunter Stadion zieht. Für ein paar Sekunden wird auf Vollbild aufgeblendet. Wenige Sekunden Pay TV for free. Entweder eine subversive Tat von Sport1 oder eine Gesetzeslücke, die es erlaubt, Bilder einzublenden, solange sie nichts mit dem Geschehen auf dem Feld zu tun haben. Thomas Helmer fragt: „So, was ist denn los hier? Wollen wir den BVB mal nicht ein bisschen anfeuern?“ Die Kneipe beginnt zu johlen und zu klatschen, doch die Stimmung versiegt schon nach wenigen Sekunden, weil niemand daran glaubt, dass Dortmund nun in den restlichen zwei Minuten noch ein Tor erzielen kann. Und schließlich, nur wenige Momente später, springt Thomas Herrmann auf, die Augen auf dem Fernseher, die Nasenflügel flatternd, aufgeregt und (c) Oliver Uschmann 2013 außer sich wie ein ganz normaler Fan. „Er macht das Ding!“, schreit er, „er macht das Ding!“, und ich hüpfe im Hotelzimmer auf dem Stuhl herum, fluche „Wer denn? Wer denn? Und wie?“, da der fürs Kommentieren bezahlte Kommentator gar nicht mehr richtig kommentiert und werfe glasige, rote Bohnen Richtung Wand, die wie glitzernde Riesenpopel an der Tapete kleben bleiben. Die Kneipe im Fernsehen rastet aus. Alle. Fans und Ex-Profis, Experten und der Moderator. Mikrofone übersteuern vor lauter Gebrüll und Taumel. Thomas Helmer ruft: „Unfassbar!“ Stefan Schnoor bricht in hysterisches Lachen aus. Die Wiederholung des Tores durch Felipe Santana belegt anscheinend, dass auch das Dortmunder Tor abseits war und die Männer am Stammtisch freuen sich über diese ausgleichende Gerechtigkeit. Nach diesem Krimi im Hotelzimmer der verregneten Kleinstadt bin ich irgendwie seltsam zufrieden. Wegen des Sieges, sicher, aber vor allem, wegen der Art der Sendung. Das indirekte Schauen war intensiv. Es regte die Phantasie an. Die Männer in der Bar beim Leiden und Jubeln zu beobachten? Pure Emotion. Ich stelle mir vor, wie es wäre, würde man einen echten Krimi auf diese Art übertragen. Der Tatort ist ans Pay TV verkauft und läuft nicht mehr im ersten. Phoenix überträgt daraufhin im freien Fernsehen den Ibuprofen Mörder-Talk. Der Moderator Markus Lanz sitzt mit ehemaligen TatortDarstellern, Fernsehexperten und echten Polizisten in einer Kneipe zusammen und schaut umringt von Kriminalfans den Film, den wir nicht sehen dürfen. Der Fall bildet sich durch die Kommentare als Kopfkino in unserem Schädel. Wie beim Hörspiel, nur mit dem Unterschied, dass wir die gesamte Gestik und Mimik der Kommentierenden beobachten können und dass diese nicht rein sachlich bleiben, sondern immer dann, wenn gerade wenig passiert, Anekdoten von früheren Drehtagen oder dem Alltag bei der echten Kripo erzählen und sich gegenseitig mit intellektuellen Kommentaren die Egos kraulen, wie Medienmänner es vor dem Fernseher nun einmal tun. Was schade wäre. Amüsanter fände ich es, würden sie stattdessen so reden, wie normale Menschen es vor dem Fernseher am (c) Oliver Uschmann 2013 Sonntagabend tun und – den Blick gebannt auf dem Bildschirm abseits der Kamera – sagen: „Es ist die Schwägerin, das ist doch ganz klar!“ „Ach komm, was machst du denn jetzt? Es ist der Bruder!“ „Der Bruder? Niemals!“ „Wie soll es denn die Schwägerin sein, wenn …?“ „Warte, warte, warte. Guck da! Da! Da! Sie wartet hinterm Vorhang. Die sticht ihn auch noch ab gleich. Ich glaub, mein Schwein pfeift! Sie sticht ihn ab!“ Sonst bin ich ja kein großer Tatort-Fan, aber ich glaube, diese Art von Krimiübertragung würde ich mir zur Gemüte führen. Ob sich allerdings ganz am Ende, wenn der vermeintliche Täter sich doch noch in der Nachspielzeit als unschuldig entpuppt, ebenfalls so viel Stimmung in der Kneipe breitmachen würde wie bei den Fußballfreunden, wage ich zu bezweifeln. Das WM-Qualifikationsspiel Während ich mich fußballerisch grundsätzlich nur auf Bolzplätzen der Ruhrstadt oder mit Betriebsmannschaften in Soccerhallen herumtrieb, spielte ich in meiner Jugend als Vereins- und Turniersport Tischtennis. Nun war es in dieser Disziplin so, dass selbst innerhalb der Spielklasse, in welcher sich meine Mannschaft herumtrieb, die Leistungsunterschiede so groß waren wie anderswo zwischen drei Ligen. Spitzenreiter der damaligen Kreisklasse im Jugendtischtennis war zum Beispiel der SV Ringenberg, ein Dorfclub im Vergleich zur Größe der Kreisstadt Wesel, in welcher wir ansässig waren. Ringenberg war lediglich ein Ortsteil des angrenzenden Hamminkeln und dieses damals, zu Beginn er 90er, noch nicht einmal berechtigt, den Titel „Stadt“ zu tragen. Ringenberg selbst war mit seinen damals vielleicht 1600 Einwohnern ein Kuhdorf gegen unsere pulsierende Metropole am Niederrhein, besäße es nicht das Schloss, in dem Hochzeiten und Kunstausstellungen stattfinden, wüsste niemand überhaupt von seiner Existenz, größere Laster würden bei Stau auf der A3 (c) Oliver Uschmann 2013 einfach drüber weg fahren und sich fragen, was das gerade für sein seltsamer Hubbel gewesen sei. Gegen die Jungs vom SV Ringenberg waren wir vom Weseler TV II so was wie New Yorker gegen ein paar Farmersöhne aus Ohio. Ihre Turnhalle war klein und finster und sie roch nach dem abgeblätterten Leder von einsam vor sich hin rottenden Böcken und Kästen. Es waren ja keine Schüler mehr da, um die Böcke zu bespringen, niemand pflanzte sich fort in Ringenberg, das fand alles nur in Wesel statt, man konnte gleichsam froh sein, wenn es an Spieltagen im Winter überhaupt Licht in der Halle gab. Ja. Und dann begannen die Spiele. Und Ringenberg wurde zu New York und wir wurden nicht mal zu Farmersöhnen aus Ohio, sondern zu dreckigen, zahnlosen Gehilfen irgendeiner Rinderzucht in Weißrussland, die austauschbar sind wie namenlose Melkautomaten. Die Höhe, in der wir die Spiele verloren, hätte selbst bei Reinhold Messner Sauerstoffmangel ausgelöst. Wir waren derart chancenlos gegen die spielerischen Fähigkeiten dieser Nerds aus dem Dorf mit dem Schloss, die wahrscheinlich mangels Diskothek, Club, Freizeitzentrum oder sonst einer Form von Leben zwanzig Stunden am Tag trainierten, dass wir uns auf der Heimfahrt, betroffen vom bitteren Schweigen des Coachs, fragten, ob wir überhaupt den selben Sport wie die Jungs aus Ringenberg ausüben. Ähnlich schlimm ging es bei Turnieren zu, bei denen alle Sportler aus dem Bezirk oder dem Kreis gegeneinander antraten wie Tennisspieler bei Wimbledon, wo die erste Runde 128 Teilnehmer hat. Natürlich traf man auch dort als Frischfleisch zum Ausweiden sehr früh auf einen der „gesetzten“ Spieler, den langen Ralle zum Beispiel, Kapitän der Mannschaft aus Ringenberg, ein Mal im Jahr freigelassen aus dem muffigen Dunkel seiner Halle, um die langen Arme und Beine im grellen Neonlicht der Zentralhalle zum Einsatz zu bringen und mich mit 0:21 und 2:21 von der Platte zu schicken. Meine Schuhe quietschten auf dem Hallenboden, während ich als positiv denkender Mensch Stolz darüber (c) Oliver Uschmann 2013 verspürte, dem Ringenberger Ralle zwei ganze Punkte abgeluchst zu haben. So wie das Tischtennis meiner Jugend in den frühen 90ern funktionieren auch die Spiele zur WM-Qualifikation, die weltweit die Wartezeit auf das eigentliche Turnier verkürzen. Sicher gibt es auch in dieser Phase spannende Partien Spiele zwischen einander ebenbürtigen Nationen, die sich gegenseitig bereits ausschalten können, weil sich mal wieder unerwartet die Isländer oder irgendwelche Hochbegabten aus dem Balkan dazwischen geschlichen haben und einem der Favoriten bei einer Niederlage desselben den ansonsten sicheren Platz 2 wegnehmen. Aber im Grunde hat die WM-Qualifikation nur einen Zweck – in mühseliger Kleinarbeit all die Teams auszusortieren, die sowieso niemals eine Chance gehabt hätten, an der Endrunde teilzunehmen. Die WM-Qualifikation ist wie die parlamentarische Demokratie oder ein interaktives Kennenlernspiel bei einem Seminarwochenende. Wenn Brasilien gegen Peru antritt oder die armen Armenier den spanischen Conquistadoren zum Fraß vorgeworfen werden, entspricht das der Behauptung einer Kanzlerin oder eines Seminarleiters, jede Stimme würde gehört. Das wird sie ja auch, aber dann macht die Kanzlerin sowieso, was sie will und der Seminarleiter zieht seinen Stiefel durch, egal, was die Teilnehmer beim Kennenlernspiel als „Erwartungen und Wünsche“ geäußert haben. Ein typisches Teilnehmerland an einer WM-Qualifikation ist San Marino. Die meisten wissen von der Existenz dieses Staates sowieso nur, weil er an der WM-Qualifikation teilnimmt, womit ein werbetechnischer Vorteil dieser Veranstaltung schon mal geklärt wäre. San Marino ist grob gesagt nur unwesentlich größer als Ringenberg, dafür allerdings wesentlich sonniger, es gehört auch nicht zum grauen Hamminkeln, sondern zum vitalen Italien, und es ist – das immerhin bleibt Rekord – der älteste Staat der Welt. San Marino nimmt an Qualifikationen teil, um zu verlieren. Das geht auch nicht anders, denn der Leistungsunterschied zwischen all den (c) Oliver Uschmann 2013 Profifußballern der größeren Sportnationen und den Hobbykickern des kleinen Landes ist noch größer als der zwischen uns Weselern und den finsteren Ringenbergern. Ebenso gut könnte man einen Verein aus der Landesliga Odenwald oder Südbaden in die WM-Qualifikation schicken, den TSV Unterschüpf zum Beispiel, oder den Vfb Gaggenau. In der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2010 kassierte San Marino allein gegen Polen (0:10), Tschechien (0:7) und die Slowakei (0:7) satte 24 Tore. Kein einziger der san-marinesischen Fußballspieler besitzt daheim noch einen Kompass, selbst dann nicht, wenn Campen und Trampen seine Hobbys sind, denn sobald sich der Zeiger nach Osten dreht, bekommt er Schnappatmung und duckt sich, weil er den harten Schuss eines Mannes, dessen Namen auf „-owksi“ oder „czek“ endet, bereits kommen sieht. Die gesamte Qualifikationsrunde beendete das kleine Land mit einer Bilanz von 0 Punkten und einem Tor aus 10 Spielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das eine Tor genauso stolz machte wie mich meine zwei Punkte gegen den Ringenberger Ralle bei den Kreismeisterschaften. Der italienische Kleinstaat San Marino teilt sich den letzten Platz der Fußballweltrangliste mit dem bergigen Bhutan, in dessen zerfurchten Höhen des Himalaya Fußball überhaupt nur auf fünf Plätzen möglich ist, alle davon in einem Zustand wie hierzulande Kreisligaplätze, deren Beschriftung abblättert und in deren Vereinsheimkühlschrank die hinterste Flasche Cola als Ablaufdatum den März 1997 verzeichnet, da der Vorrat immer wieder von vorne aufgefüllt wird, aber niemals bis hinten abverkauft wurde. Plätze nach europäischem Profimaßstab sind in Bhutan nicht vorhanden. Ein Stadion ist in Planung, ähnlich wie der immerwährende weltweite Frieden oder das Raumschiff Enterprise. Es wird kommen, das Stadion, irgendwann, später als der immerwährende weltweite Frieden, aber immerhin früher als der Berliner Hauptstadtflughafen. Da Länder wie Bhutan oder San Marino also offensichtlich keine Chance haben, jemals über die Qualifikation hinaus in die Endrunde der Weltmeisterschaft zu gelangen, sollen nach Informationen des Instituts für geheime Generalstabsplanungen (IfgG) in Guggenheim führende (c) Oliver Uschmann 2013 Umweltpolitiker innerhalb der EU an einem Erlass arbeiten, der die absolut hoffnungslosen Fußballzwerge künftig von der Teilnahme an der Qualifikation ausschließt. „Den Kommissaren der Europäischen Union ist klar, dass eine solche Vorgehensweise einerseits den Antidiskriminierungsgesetzen zuwider läuft“, berichtet Professor Günther Grieshold vom IfgG, „allerdings betrachten sie in diesem Fall die Einsparungen im Energiebereich als zwingenderen Aspekt.“ So habe die Kommission bei führenden Klimawissenschaftlern eine Studie in Auftrag gegeben, die belege, dass beim Ausschluss chancenloser Teams von der Qualifikationsrunde durch den Ausfall von rund 127 Spielen ganze 79.992 mg CO2 eingespart werden könnten. Mit Berufung auf interne Gesprächsprotokolle bestätigt Professor Grieshold die Worte eines der Kommissare, der in der Sitzung auf überzeugende Weise die Frage und mit großem, weltschweren Seufzen die Frage in die Runde geworfen haben soll: „Wollen wir künftigen Generationen, die aufgrund unserer Sünden unter gläsernen Schutzkuppeln leben, etwa sagen, dass es uns wichtiger war, Fußballspiele wie Myanmar gegen Osttimor auszurichten, während langsam der Himmel verbrannte?“ Angeblich soll die geheime EU-Kommission bereits in noch geheimere Gespräche mit der FIFA eingetreten sein und dieser im Gegenzug für den Ausschluss der kleinen Länder von der WMQualifikation enorme Finanzspritzen für die Umrüstung westlicher Stadien auf Ökostrom und Biobratwurst versprochen haben. Der niederländische Regisseur Johan Kramer, der von den Planungen zufälligerweise an einer Brüsseler Hotelbar Wind bekam, hat bereits die Gründung einer Protestgruppe angekündigt, um den Fußball der Zwergstaaten zu bewahren. Er drehte 2002 die Dokumentation The Other Final über das Spiel Bhutan gegen Montserrat in Thimphu, das parallel zum Finale der Weltmeisterschaft stattfand und für beide Länder ein bedeutsames, historisches Ereignis darstellte. Es bescherte Bhutan einen triumphalen 4:0-Sieg mit drei Toren ihres „Stars“ (Vorname) Dorji. Die FIFA weigerte sich damals, die in jeder Hinsicht ambitionierte Veranstaltung mit auch nur einem Cent zu unterstützen. Die EU- (c) Oliver Uschmann 2013 Kommissare sehen den Weltverband daher auch schon im Rückblick „auf einem guten, vernünftigen Weg.“ (c) Oliver Uschmann 2013 Rituale und Phänomene auf und um den Platz Das Rotzen auf den Rasen Für meine Frau ist es das Ekligste, was ein Mann tun kann. Und das Unmöglichste. Selbst Soldaten, die mit der Railgun ganze Bataillone aus dem Weg mähen, so dass ihnen das Blut der Zerschossenen ins Gesicht spritzt, sind ihr lieber als das Rotzen und Spucken. In Bochum, zur Studienzeit, hatte ich zwei Balkone weiter einen Nachbar, der dafür sorgte, dass ich meiner Frau in ihrer Abneigung gegen das menschliche Lamatum absolut beipflichten muss. Herrn Beifang. Stand Herr Beifang hinter seinen Blumenkästen, hörte man schon, wie es sich anbahnte. Mit einem zunächst leisen und dann stetig lauter werdenden Gurgeln holte er die giftgrüne Galle von ganz tief unten, von dort, wo niemals Licht ist, malochte sie Zentimeter für Zentimeter seine Kehle hinauf und schmetterte sie schließlich über die Petunien hinweg auf den Rasen des Gemeinschaftsgartens. Was der Bochumer Nachbar Beifang damals mit dem Garten anstellte, vollzieht jeder Fußballer ausnahmslos mit dem Rasen auf dem Platz. Es gibt kein live übertragenes Fußballspiel auf der ganzen Welt, in der die Kamera nicht mehrfach spuckende Sportler zeigt. Selbst, wenn die Chefs von Sat1, ZDF, ARD und Sport1 ihren Kameraleuten unter Androhung von Strafen zwingen würden, Rotzbilder zu vermeiden, wäre es den armen Männern und Frauen statistisch unmöglich, 90 Minuten lang so zu filmen, dass nicht doch irgendwo ein Klumpen fliegt. Warum ist das so? Der Grund scheint zu sein: Die ganze Rennerei. Wenn der Mann läuft, muss er spucken. Bei Frauen ist das nicht so. Wer weiß, warum? Des Mannes Körper aber drängt ihn dazu, den Ballast loszuwerden. Ich sage das unter dem Eindruck, dass ich heute, wo ich dieses Kapitel schreibe, das erste Mal seit langer Zeit wieder joggen war. Ich bin mit meinen Jugendromanen auf Lesereise durch die Schulen von Niedersachsen. Habe ich so gegen 13 Uhr Feierabend, muss ich das (c) Oliver Uschmann 2013 aufgestaute Adrenalin nach den ganzen Auftritten vor vollen Aulen und Sälen irgendwie loswerden. Meistens gehe ich Schwimmen, im Stadtbad oder im Hotelpool, oder ich schwinge drei, vier Mal meine 16-KiloKettlebell (ein Kanonenkugelgewicht mit Griff) vor dem laufenden Fernseher im Hotelzimmer, zertrümmere dabei die Nachttischlampe, die Garderobe und Teile der Fensterdekoration und denke mir: Das reicht fürs Erste. Manchmal aber sticht mich der Hafer und ich gehe laufen, obwohl ich längst nicht mehr dafür geschaffen bin. Ich bin alt und gebrechlich. Als ich jung war, schob man noch Disketten in Commodore-Computer, die 512 MB Festplattengröße hatten. Als ich jung war, lief Mac Gyver im Fernsehen und Hans Meiser mit seinem Notruf und bei Quelle verkauften sie noch täglich Leerkassetten. Als ich jung war, sah man Rudi Völler noch als Spieler in der Nationalmannschaft. Ich bin in einem Alter … wäre ich Profifußballer, könnte man mich höchstens noch der Gattung „Der Heimkehrer“ ( S. XY) zuordnen. Trotzdem lief ich heute Nachmittag los, stadtauswärts Richtung Waldwohnviertel, wider alle Vernunft. Schon nach drei Kilometern stach es in meiner Brust, und ein Brand loderte in meiner Kehle, als stemmten boshafte Zwerge meinen Kehlkopf samt Stimmbändern mit heißen Schaschlikspießen nach oben. Schwindel ließ mich wanken, der Schmalz presste mit jedem Schritt aus meinen Ohren, mir wurde schlecht. Ich japste. Und dann: Rotzte ich. Weil das nicht anders geht bei Amateuren, die sich selbst überschätzen, keinerlei Kondition haben und dann nach vier Kilometern Lauf in eine Richtung begreifen, dass sie den Rückweg nicht mehr schaffen und mangels Geld in der taschenfreien Sporthose neben einem Stromkasten vor einem bürgerlichen Miethaus niedersinken und so lange jammern und winseln, bis der gutherzige Besitzer sich erbarmt und mit seinem Bully rüber zum Hotel fährt. Aber: Fußballprofis haben Ausdauer. Bei denen sticht keine Brust, brennt keine Kehle, lodert kein Feuer in den Tiefen. Und schon gar nicht nach vier Kilometern. Gute, fleißige Mittelfeldspieler bringen es auf bis zu 11 oder 12 Kilometer Laufdistanz pro Spiel. Trainieren sie unter Felix Magath und rollen somit täglich einen (c) Oliver Uschmann 2013 Medizinball von 200 Kilo Gewicht den Todeshügel hinauf, könnten sie auch 30 oder 40 Kilometer zurücklegen, wenn es denn sein müsste. Profis sind Leistungsmaschinen aus pumpendem Ausdauergewebe. Muskeln mit Gesicht. Lungen auf Beinen. Profis also – die müssten nicht spucken. Und tun aber es doch. Der eigentliche Grund, warum sie es machen ist also nicht die tatsächliche Anstrengung, sondern die wortlose Geste, die dahinter steckt und die sagt: „Seht her, wie ich maloche!“ Das Rotzen ist die Entsprechung zu vielen anderen Gesten im Alltag, mit denen Männer demonstrieren wollen, dass sie sich unglaublich abmühen. Das „Arme in die Hüften stemmen“ auf Baustellen zum Beispiel, vor allem auf privaten, wo Udo oder Lutz oder Manfred oder einer der anderen Schwippschwager, die „zum Helfen“ gekommen sind, den ganzen Tag nur Saufen, Wurstsalat essen und dann – nach dem Schieben einer Karre oder dem Anreichen eines Ziegels – schon die Arme in die Hüften stemmen, laut auspusten und sich seufzend nach hinten lehnen, als hätten sie bereits jetzt von der unfassbaren Anstrengung Rückenschmerzen. Oder damals, das „den Kopf schwer in die Hände legen“ bei Arbeiten in der Schule oder beim Erledigen der Hausaufgaben. Natürlich hatte man nicht so harte Geistesarbeit zu erledigen, dass man die Stirn in den Händen vergraben und sich die Augen rot reiben musste … aber man wollte, dass der Lehrer oder die Mutter daheim sehen, wie sehr man leidet. Für sie. Der Fußballer will das Gleiche. Der Trainer, die Fans, der Vorstand und die eigenen Mitspieler – sie alle sollen denken, dass man kurz davor ist, die Lunge selbst blutrot herauszuwürgen. Es ist ein Gruppenzwang, denn wer als einziger von 11 Spielern in der Mannschaft nicht rotzen würde, käme ähnlich faul rüber wie einer, der nicht schwitzt. Daher gibt es die eklige Spuckerei nicht in Sportarten, die keinem Gruppenzwang ausgesetzt, aber mindestens genauso anstrengend sind. Oder hat irgendjemand schon mal einen Roger Federer kurz vor dem Aufschlag gemütlich und laut in die Stille hinein auf den Tennisplatz speien sehen? (c) Oliver Uschmann 2013 Als mich heute Nachmittag nach dem Joggen der gutherzige Bullybesitzer würdelos und waschlappenweich vor der Tür des Hotels ablieferte und ich an der Rezeption vorbei mit milchigen Augen und hängender Zunge zum Fahrstuhl kroch, überkam mich schließlich zum Thema Spucke in meinem Erschöpfungsdelirium eine Vision. Wenn sich, so dachte ich, der Rasen großer Fußballstadien im Laufe der 90 Minuten mit der Rotze von mindestens 22 verschiedenen Männern füllt, wenn jeder von ihnen pro Partie bis zu hundert Mal spuckt und wenn hin und wieder Spieler eingewechselt werden, die – kaum, dass sie zehn Meter gelaufen sind, das Grün erstmals mit ihrem Auswurf begrüßen – dann dürfte es folglich 250 bis 300 verschiedene Stellen auf dem Platz geben, an denen sich die Spuren des Sportlerlebens finden lassen. Wäre der Platz ein Tatort, könnte ein Forensiker bei genauer Durchsuchung des Rasens somit das Genmaterial millionenschwerer Profis finden und einsammeln, achtlos hinterlassen zwischen den Halmen. Und was ist nun, so dachte ich, während der Aufzug kam, sich die Türen öffneten und ich hineinkroch wie ein Terminator mit abgerissenen Beinen, der nur noch Kabel hinter sich herzieht … was ist also nun, wenn das längst geschieht, mit dem Einsammeln des Genmaterials? Was ist, wenn die Chinesen und die Nordkoreaner sich nach dem Spiel die DNA eines Messi, eines Ribéry oder eines Balotelli schnappen könnten, um dann in ihren geheimen Laboren in Peking und Pjöngjang lauter neue Fußballgenies zu klonen? Mit den Fähigkeiten der Stars und den Gesichtern der Einheimischen? Und wer sagt uns, so dachte ich, während der Fahrstuhl nach unten statt nach oben fuhr, dass dies nicht schon längst geschieht? Ist es nicht so, dass wir in den letzten zehn Jahren viel mehr Flitzer hatten als zuvor, also in genau der Zeit, in der die Genetik so richtig Fahrt aufgenommen hat? Und kann es nicht sein, dachte ich, dass diese Flitzer, wenn sie angezogen sind und lange Fanschals um die Arme geschlungen haben, in Wirklichkeit Agenten sind, die bei ihrem wilden Gerenne über den Platz mit den Fransen am Schal durch den Rasen streifen, da es Spezialfransen zum Aufsammeln von Spucke sind? Fransen, die der DNA-Sammler dann nach der Entlassung durch die Stadion- (c) Oliver Uschmann 2013 Security schnell abschneidet, eintütet und beim nächsten Postamt per Express Richtung Osten schickt? Wer weiß denn, dachte ich, und der Fahrzug öffnete sich und spuckte mich um Untergeschoss des Hotels im Fitnessraum aus, als wolle er mich verspotten … wer weiß denn, ob die asiatischen Messis, Ribérys und Balotellis nicht schon längst wie erwachsene Embryos in ihren Brutkästen schwimmen und nur darauf warten, die Chinesen oder die Nordkoreaner spätestens bei der WM 2022 in Quatar zum Sensationssieg zu führen? „Wer weiß es denn?“, sagte ich nun auch laut und starrte auf die in weiße Hotelfrotteeschlappen gekleideten Füße eines braun gebrannten, sportlichen Vin Diesel-Verschnitts vor den Butterfly-Pressen und Saunatüren. „Wer weiß es denn?“ Der Mann nahm mich auf, trug mich wie ein Klapprad nach oben, fragte an der Rezeption nach meiner Zimmernummer und sagte, bevor er mich zudeckte: „Schuster, bleib bei deinen Leisten.“ Ich glaube, ich sollte nicht mehr joggen gehen. Das Schrumpfen der Spieler Früher sahen Fußballprofis grundsätzlich älter aus, als sie waren. Das fällt einem erst im Nachhinein auf, wenn man selbst erwachsen ist, in seinen Pass schaut und feststellt, dass man mit 36 Jahren als Profisportler längst daran denken müsste, seine Karriere gemächlich bei einem Fünftligisten oder in Dubai auslaufen zu lassen. Heute erscheinen einem 36 Jahre nicht viel, aber damals, als man noch ein Junge war, galten selbst 25-jährige schon als „alt“. Die größten in der Schule, die aus der Oberstufe, hatten nicht mal eine 2 vorne stehen, und sie rauchten bereits zwischen den Müllcontainern und steckten den Mädchen mit den glänzenden Lippen und den übergroßen Ohrringen zwischen zwei Zügen an der Lucky Strike glücklich die Zunge in den Hals. 1990, als Deutschland in Italien Weltmeister wurde und Frank Rijkaard unserem Rudi Völler zwischen die Locken in den Nacken spuckte, war ich 13 Jahre jung und verbrachte die Ferien mit meinen Eltern sowie Onkel und Tante in Mittenwald. Wir hatten eine Pension gemietet, deren Hausflur und Garten mein Vater, (c) Oliver Uschmann 2013 mein Onkel und ich regelmäßig mit Fußbällen kaputt schossen. Vasen, Lampen, Flaschen und Pflanzen gingen regelmäßig zu Bruch, während wir die kommenden Spiele der WM schon mal simulierten. Ich selbst spielte zu der Zeit wahlweise Pierre Littbarski aus dem deutschen Team oder den Überraschungsstar des Turniers, Roger Millard aus Kamerun. Als das Team um Franz Beckenbauer am Abend des 12. Juni tatsächlich den Titel holte, fluteten die Menschen in dem kleinen, idyllischen Ort aus den Ferienpensionen und Fachwerkhäusern und fuhren Hupkolonnen, deren Dröhnen in allen Flanken des Gebirges widerhallte. Ausgerechnet ein Abwehrspieler hatte das 1:0 gegen Argentinien mit einem Elfmeter klargemacht. Andreas Brehme, damals Kaiserslautern, ein Mann, der schon länger dabei war, sich aber im Prinzip im selben Alter befand wie heute ein Lukas Podolski, ein Andres Iniesta oder ein Sebastian Kehl. Und das ist eben das Unglaubliche. Stellt man heute ein Foto von Andreas Brehme neben die eben genannten, könnte man sich gut vorstellen, wie Herr Brehme mit dem Lukas, dem Andres oder dem Sebastian an der Hand in die Sparkasse marschiert und sagt: „Guten Tag, ich möchte gerne das Sparkonto für meinen Sohn auflösen.“ Nahezu jeder Weltmeister von 1990 ginge ganz locker als Papa heutiger, gestandener Profis durch. Guido Buchwald wirkte mit seinen 26 Jahren wie ein gutmütiger Geografielehrer im 20. Berufsjahr. Thomas Häßler hätte man sich gut als gestandenen, ehemaligen Mitreisenden von Kirmesfahrgeschäften vorstellen können, der als „junger Mann“ auf den Aushang reagiert hatte und erst zwei Jahrzehnte später wieder von der Raupe abgesprungen war. Und Rudi Völler sah nicht nur wegen seiner epochenresistenten Frisur damals schon genauso aus wie heute. Schaut man noch weiter in die Fußballhistorie zurück, verstärkt sich dieser Eindruck sogar. Ein Günther Netzer mit seiner Tolle, ein Berti Vogts mit seinem Mönchshaarkranz oder ein Uwe Seeler mit seinem Mainzelmännchenkopf – sie waren alle bereits als junge Männer in vollem Umfang die alten Männer, die sie heute sind. Der Fußball – dieser harte, körperliche, Haut und Herz gerbende Sport – ließ Männer früher altern und tatsächlich schon wie Männer aussehen, wenn sie kaum zehn Jahre (c) Oliver Uschmann 2013 mehr auf dem Buckel hatten als ich flaumloser Teenager, der mit Papa und Onkel zwischen Bergen und Bächen die Pension zerschoss. Im 21. Jahrhundert ist das genau umgekehrt. Heute sehen die meisten Spieler aus wie Kinder und Jugendliche, allenfalls wie die hippen, hübschen und manchmal sogar heißen Mittzwanziger, die sie tatsächlich sind, niemals aber wie mürrische Malocher, die bereits ein paar Jahrzehnte als Steiger oder Stellwagenführer auf dem Buckel haben. Beträte Andreas Brehme nicht mit Sebastian Kehl oder Andres Iniesta die Sparkasse, sondern mit Marco Reus, Julian Draxler oder Mario Götze, würde der Bankbeamte sich über den Schalter beugen, den kleinen Mann neben Herrn Brehme auf dem alten Rautenteppich der Filiale erkennen und sagen: „Das ist aber schön, Sie haben Ihren Enkel mitgebracht.“ Sahen Völler und Vogts schon in jungen Jahren aus wie alte Sportvorstände, werden Götze und Draxler auch in alten Jahren immer noch aussehen wie gerade eben aus der B-Jugend geschlüpft. Der hochmoderne Tiki-TakaFußball spanischer Prägung, der „kleine, leichte und wendige Spieler erfordert“ und den klassischen Hünen oder Stoßstürmer überflüssig macht, ist in Folge des massiven Schrumpfens junger Männer entstanden und nicht etwa, weil die sportliche Evolution es so wollte. Mitnichten haben irgendwann Pepe Guardiola oder Joachim Löw eine neue Art des Spiels erfunden und daraufhin die passenden Spieler dafür gezüchtet. Kurzpassspiel, Tiki-Taka, schnelles Rotieren – die neue Schönheit des Fußballs ist in Wahrheit eine Notlösung. Eine verzweifelte Reaktion darauf, dass es im Nachwuchs nur noch Spieler gibt, die das Körperbild und Laufverhalten von Speedy Gonzalez, der kleinen Maus aus Mexiko, haben. Jeder Trainer muss mit dem arbeiten, was er vorfindet. Die Frage ist: Wie konnte es dazu kommen? Die Antwort lautet: Schuld sind die Mütter. Und die Mode. Der Zeitgeist. Wer in den 50ern oder den frühen 60ern geboren wurde, war Kind der Kriegsgeneration, Sohn einer Trümmerfrau. Die Trümmerfrauen haben Häuser und Heimat aus Schutt und Schrott wieder aufgebaut, warme Mahlzeiten zwischen Ruinen hergestellt und das Wirtschaftswunder (c) Oliver Uschmann 2013 möglich gemacht. Sie hatten eine gesunde Haltung zu Körper und Nahrung und zählten sie Kalorien, dann nur, um herauszufinden, ob sie sich und ihren Jungen heute annähernd genug zugeführt hatten. Als das Land wieder aufgebaut war, begann der Verfall. Junge Frauen fingen an, sich Zeitschriften zu kaufen und sich ein Model wie Twiggy zum Vorbild zu nehmen, die erste Magersüchtige der Modegeschichte, eine Ikone ihrer Epoche. Im Grunde keine Frau, sondern ein burschikoser Strich in der Landschaft. Die Modeschöpferin und Parfümerfindern Coco Chanel stieß in dasselbe Horn. „Eine Frau“, sagte sie und meinte es womöglich noch feministisch, „kann nie zu schlank und nie zu reich sein.“ So fing es also an, dass die Mütter keine Muttis mehr waren und schon gar keine Trümmerfrauen. Statt an Häusern und Heimen bastelten sie fortan an ihrem eigenen Körper herum und hörten sogar dann auf, ihren Instinkten zu folgen, wenn es dringend nötig ist – in der Schwangerschaft. Mit einem kleinen, künftigen Fußballer im Bauch hatten sie immer noch die Gelüste, die jede Schwangere hat, gingen ihr aber – die Frauenzeitschrift auf dem Nachttisch – nicht mehr nach. Schrie ihr Körper „Gurke mit Nutella!!!“, schlichen sie zum Kühlschrank, nahmen sich die Gurke und ließen die Nutella weg. Wurden sie trotzdem rund, weil der Mario, der Marco oder der Julian beim Wachsen nun mal ein wenig Platz weg nehmen, regte sich in ihnen der Groll gegen die Verschandelung ihres Körpers durch den frechen Mittelstürmer und sie aßen noch weniger, um dem Unbill entgegenzuwirken. So fehlen den jungen Männern seit einigen Jahrzehnten eine Menge Nährstoffe. Ihre Mütter setzen sie auf Zwangsdiät im eigenen Körper. Das Ergebnis sind winzige Körper, Fliegengewichte, mangelnder Bartwuchs und Tiki-Taka-Fußball. Erste Ansätze dieses Trends sahen mein Vater, mein Onkel und ich 1990 in Mittenwald allenfalls bei Andreas Möller. Der war bekanntlich Zeit seiner Karriere als weinerliche Heulsuse verschrien und hatte schon damals etwas Bubenhaftes. Heute würde man sagen, er war ein Emo. Und immer haarlos im Gesicht. Die wenigen Männer, die heute im Fußball noch Gesichtsfell tragen, wie etwa der Mittelfeldmacho Andrea Pirlo von Juventus Turin, ziehen zur Belohnung sogar leisen Spott auf sich. „Wie (c) Oliver Uschmann 2013 man bei der Oscar-Verleihung gesehen hat, scheint der Vollbart wieder in Mode zu kommen“, sagte Thomas Müller mit einem Schmunzeln auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel der Bayern gegen den italienischen Meister. Ausgerechnet Thomas Müller, der zwar keinen Bart trägt, aber aussieht wie aus der Zeit gefallen. Jung, freilich, aber jung, wie man in den 50ern jung war. Thomas Müller könnte mit einer Lederjacke in Denn sie wissen nicht, was sie tun oder American Graffiti mitspielen. Im Augenblick, in dem diese Zeilen entstehen, liegt neben Kaffeetasse, Schlabberlatz und Kugelschreiber eine aktuelle Ausgabe von Europas meistverkaufter Sportzeitschrift, zufällig aufgeschlagen an einer Stelle, an der rechts ein Foto der aktuellen Nationalmannschaft und links ein Bild aus der Bundesligasaison 1976/77 abgedruckt ist. Auf dem Schwarzweißfoto geht der Belgier Roger van Gool kraftvoll zum Ball. Der erste Spieler in der Geschichte der Liga, für den eine Millionen Mark gezahlt wurden. Vier Jahre machte der Rechtsaußen dem 1. FC Köln große Freude. Sein Gegner auf dem alten Foto sieht aus wie Tom Selleck in Magnum: Breiter Schnauzer, dunkle Koteletten, markante Wangenknochen. Van Gool selber ließ sich die Koteletten als Wangenbart bis zum Kieferrand wachsen und hatte ein Antlitz wie ein Holzschnitt. Beide Männer wirken dreifach so alt wie Götze, Schmelzer und Schweinsteiger auf dem Foto gegenüber. Bastian Schweinsteiger erinnert mich zudem seit seiner Existenz im Profifußball unglaublich an die Tochter unserer Hausvermieterin, die während meiner Kindheit mit ihrer Mutter und Schwester die zweigeschossige Wohnung unterm Dach bevölkerte. Eine gewisse Beruhigung stellt sich ein, wenn man sich vor Augen führt, dass die kleinen, leichtgewichtigen und bartlosen Fußballmäuse trotz ihres offensichtlichen Testosteronmangels keine Balletttänzerinnen sind. Dribbelkünstler Patrick Herrmann etwa, der angibt, bei seinem ersten Profieinsatz gerade mal „66 Kilo“ gewogen zu haben, beging in der vergangenen Saison die meisten Fouls für Borussia Mönchengladbach. Als Mittelfeldzauberer! „Ich gehe halt in jeden Zweikampf voll rein“, (c) Oliver Uschmann 2013 kommentierte er diese altmodische Härte. Und mag auch er wie die meisten seiner Kollegen sehr jung aussehen, hat er im Gegensatz zu ihnen eine an Billy Idol oder alte Wildwest-Cowboys erinnernde, grob, groß und gefährlich wirkende Mundpartie. Ein Beißer, sozusagen. Womöglich hat seine Mutter beim nächtlichen Gang an den Kühlschrank als erste nach vielen Jahrzehnten die saure Gurke nach listigem Schulterblick endlich mal wieder ins Nutellaglas getaucht. Das Warten auf die Action Es gibt ein großes Geheimnis unter den meisten Menschen, die Fußball gucken. Niemand spricht darüber. Keiner würde es jemals zugeben. Und doch ist es wahr: Die Mehrheit langweilt sich beim Zusehen. Der größte Teil der Zeit ist keine große Unterhaltung. Der größte Teil der Zeit ist Warten auf die Action. Seien wir ehrlich: Den Menschen aus dem alten Rom, die sich regelmäßig im Circus Maximus versammelten, um den Gladiatoren zuzusehen, wie sie von Löwen zerfleischt werden, würden beim Anblick eines Fußballspiels entweder in Gelächter ausbrechen oder in Ohnmacht fallen. „Was soll das sein?“, würden diese alten Römer fragen. „Die spielen sich doch bloß gemütlich den Ball zu!“ Einen kleinen, einen winzigen Hauch, eine vage Ahnung von dem, was früher bei öffentlichen Spektakeln üblich war, würden diese Leute erkennen, wenn es zwischen zwei Spielern in den Zweikampf geht. Oder eine Torraumszene kommt. Doch wann kommt die schon? Es gibt Phasen in Fußballspielen, da passiert 25 Minuten lang nichts. Überhaupt nichts. Die Reporter sagen dann: „Die Mannschaften sind noch in der Abtastphase.“ Bei einer 25 Minuten langen Abtastphase wären die Menschen im alten Rom längst auf die Barrikaden gegangen. Sie schimpften und buhten schon, wenn sich die Gladiatoren im Duell gegeneinander auch nur länger als zehn Sekunden ohne Schlag umkreisten. Nach 10 Minuten hatten die Torwächter längst schon die Löwen und anderen Bestien in die Arena gelassen. Und nach 25 Minuten war nicht nur die Abtastphase schon längst gelaufen, sondern auch die Auffressphase bereits vollendet. (c) Oliver Uschmann 2013 Gerade bei Männern ist es erstaunlich, dass sie so viel Geduld haben. In einem durchschnittlichen Fußballspiel gibt es mit viel Glück drei Tore, zwölf Ecken, ein paar Freistöße und eine Handvoll harter Fouls und Karten. Nur alle paar Jahrzehnte passiert außergewöhnliches und ein Torwart beißt einem Mittelfeldspieler das Ohr ab. Oft passiert auf dem Platz so wenig, dass die Fernsehkameras sich Nebenschauplätze suchen. Jürgen Klopp etwa, wie er gerade wieder zur Bestie verwandelt, den vierten Offiziellen mit dem Kopf voraus unter seine Trainerbank faltet oder Jürgen Klinsmann, der damals bei einem wütenden Tritt gegen eine Werbetonne mit dem gesamten Bein im harten Plastik stecken blieb und sich den Oberschenkel aufriss. Würde in einem Ballerfilm so wenig passieren wie beim Fußball, bestünden Terminator 2, The Transporter oder Delta Force zu 85% aus Dialogen und Landschaftsaufnahmen. Wäre Fußball ein Porno, gäbe es darin gerade mal drei Sexszenen in 90 Minuten. Den Rest der Zeit spräche der Klempner mit seiner halbnackten Kundin über energiesparende Heizungen und Flanschbreiten. „Das Palaver, das Menschen beim Fußballgucken schon wegen der kleinsten gelben Karte machen, entspringt der freudigen Erregung, dass endlich überhaupt mal was passiert“, sagt meine Frau, und ich denke, da hat sie Recht. Eine Ausnahme von dieser Regel machen allerdings zwei Menschengruppen im Publikum, die sanftmütig und ruhig die gesamten 90 Minuten genießen. Der Fachmann ( S. XY), dem in diesem Buch ein einzelnes Kapitel gewidmet ist, und ich. Ich habe nämlich beim Schauen von Fußball eine ganz seltsame Empfindung, die womöglich niemand teilt und wenn doch, dann möge man mir einen Leserbrief schreiben, damit ich weiß, dass ich nicht so allein bin. Ich warte nicht nur nicht ungeduldig auf die Action – ich finde die unspektakuläre Ruhe zwischendurch sogar besonders gut. Den langweiligen Rückpass. Die uninspirierte Flanke. (c) Oliver Uschmann 2013 Das unspektakuläre Klären. Es beruhigt mich, es ist wie Meditation. Spiele ich FIFA 13 auf der PlayStation 3 wähle ich eben gerade nicht die großen und spektakulären Mannschaften aus und simuliere auch nicht die bedeutsamen Finalspiele. Ich setze mich auf das Sofa, entscheide mich für den SV Sandhausen, Twente Enschede, Wacker Innsbruck oder irgendeinen vollkommen unbekannten Zweitligisten aus Frankreich oder Drittligisten aus England, wähle als Gegner eine ähnlich graue Maus und spiele dann gemütlich in der Defensive den Ball hin und her. Wie das sein kann, weiß ich nicht. Eine Erklärung mag darin liegen, dass es mir schon reicht, einfach nur Spieler zu aktivieren, die in Wirklichkeit gar nicht sooft drankommen oder wenig Fernsehzeit haben. Spiele ich doch mal mit Dortmund, Bayern oder Barcelona, stelle ich die zweite Garnitur auf den Platz. Ich freue mich, wenn ich am Joypad jemanden einsetze, von dem ich irgendwo im Sonderheft des Kicker mal ein Wort gelesen habe. Es fühlt sich dann an, als hätte ich nach langer Zeit einem vernachlässigten Freund geschrieben oder statt Burger King in einer Stadt auf Tournee absichtlich die kleine Imbissbude besucht. Das allein ist es aber nicht, das gilt ja nur für deutsche Mannschaften. Spiele ich mit LB Châteauroux aus der französischen Ligue 2 oder gar Al Faisaly aus der saudi-arabischen Profiliga, kenne ich die Spieler nicht und kann daher auch keine Wiedersehensfreude empfinden. Ich denke, meine seltsame Freude am Unspektakulären hat damit zu tun, dass die Action und das Große mir Druck machen. In der Musik zum Beispiel höre ich gerne die Platten bekannter Bands, die als „schwächste“ oder „unwichtigste“ in ihrem Schaffen gelten. Das nimmt mir irgendwie den Zwang, sie gut finden zu müssen. Natürlich plätschert ein Ballbreaker von AC/DC belangloser vor sich hin als ein Back In Black (auch wenn diese Band scheinbar immer gleich klingt) und natürlich ist ein spätes Soloalbum von Paul McCartney nicht so gottgleich wie ein Rubber Soul der Beatles. Aber das ist es ja gerade! In der alten Videothek meiner Jugend war es ein Hobby von mir, am Wochenende gerade eben nicht den neuesten Blockbuster zu leihen, sondern irgendeinen innovationslosen (c) Oliver Uschmann 2013 08/15-Film mit Michael Dudikoff, der laut Filmmagazin „lieblos runtergedreht“ wurde und von dem Dudikoff selber sagte: „Ich mache einen Film und vergesse ihn wieder.“ Beim Wrestling bedauere ich es sehr, dass in den Fernsehshows von Raw oder Smackdown! heutzutage immer sofort Star gegen Star kämpft und es nicht mehr das gibt, was in den 90erJahren jede Sendung erst mal ganz gemächlich eröffnete: Kämpfe eines Stars gegen einen absoluten No-Name-Kämpfer, einen so genannten „Jobber“, der kein Image hatte, keine Figur darstellte, nur einen stinknormalen Namen wie Mike Jackson trug und in jedem Fall ohne jede Chance verlieren würde. Romane, die den Buchpreis bekommen, lasse ich für „ordentliche“ Thriller links liegen, da sie mich einschüchtern. Bekommt ein Videospiel im Test überall nur mittelmäßige Noten, werde ich sofort darauf aufmerksam. Meine Lieblingsformulierung aus 25 Jahren Phrasendrescherei in den Fachmagazinen zu Musik, Film oder Spielen, die bei uns daheim schon zum geflügelten Wort geworden ist, lautet: „Grundsolide Genrekost für Fans.“ Fußball, das ist in der Mehrheit der Spiele und der Zeit auf dem Platz, nicht mehr und nicht weniger als grundsolide Genrekost für Fans. Und die meisten davon Warten auf die Action. Deswegen schaut auch keiner ernsthaft Aufzeichnungen von Spielen, die er nicht live sehen konnte und wenn doch, macht er es wie beim Porno: Er spult zur Action vor. Ich nicht. So, nun beende ich dieses Kapitel. Mein Teller ist auch leer. Die Pizza Gorgonzola war grundsolide. Ich sitze nicht bei einem Edelitaliener, sondern im Ali Baba Grill in Engen, einer kleinen Stadt im Schwarzwald. Da zurzeit die Nationalteams in der WM-Qualifikation spielen, fielen am Wochenende die erste und die zweite Bundesliga aus. Sport1 zeigte also vorgestern statt des üblichen Montagabendspiels aus der 2. Liga als Ersatz die Partie Kickers Offenbach gegen Hessen Kassel. Ein Spiel aus der vierten Klasse, der Regionalliga Nordwest. So unspektakulär, dass der Klempner überhaupt nicht zum Rohrverlegen kommt. (c) Oliver Uschmann 2013 Es muss sich dennoch gelohnt haben, denn ohne Quote macht ein Fernsehsender gar nichts. Womöglich gibt es doch ein paar Menschen, die so sind wie ich. (c) Oliver Uschmann 2013 Die wichtigsten Phrasen und ihre Bedeutung „Die Null muss stehen!“ Unter Fußballfans kann man niemals etwas falsch machen, wenn man sich als Realist gibt. Also, in Deutschland. Skepsis ist schließlich unser zweiter Vorname und wer im Leben als abgeklärt und erwachsen gelten möchte, sagt Sätze wie: „Mach erst mal eine ordentliche Ausbildung, Junge!“ Oder: „Wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen!“ Ein Satz dieser Güteklasse im Fußball lautet: „Die Null muss stehen!“ Das reicht eigentlich schon. Laut in die Runde gepoltert darf man danach sein Glas abstellen und noch ein wenig nachnicken, den Blick an den Leuten vorbei zur lockeren Schraube in der Garderobe neben dem Eingang der Kneipe, die Augen leicht getrübt vom Bier und zugleich klar vor Realitätssinn. Will man noch einen drauflegen, setzt man nach zwei Sekunden Sprechpause neu an und sagt: „Es ist doch so: Offensive gewinnt Spiele, aber Defensive gewinnt Titel.“ Wie wahr diese Weisheit ist, erlebte ich im Sommer 2004 in einem italienischen Restaurant in Berlin-Wedding. Am Vormittag hatte ich für 180 Euro im Monat eine winzige Wohnung zur Untermiete in Pankow ergattert, in der ich bald ein Jahr lang leben würde, um mein Praktikum in Berlins größter Werbeagentur anzutreten. Mein Nachtzug heim in den Ruhrpott ging erst um Mitternacht. Als Freund aller Stadtviertel, die man nicht auf Postkarten sieht, schlurfte ich den Rest des Tages durch Kreuzberg, Friedrichshain, Neukölln und eben Wedding, misstrauisch beobachtet von den Einheimischen, einer latent bedrohlichen Mischung aller möglichen Subkulturen von Asselpunk bis Gangster-Rapper. In einer Pizzeria nahe des Cineplex Alhambra fand ich Zuflucht, Wärme und vor allem: Fußball. In einem kleinen Fernseher sah ich beim Mümmeln meiner mächtigen Margarita das Viertelfinale der Europameisterschaft: Griechenland gegen Frankreich. Es war eine Sensation, dass die Griechen damals überhaupt bis unter die letzten acht vorgedrungen waren. Nun bestaunte ich gemeinsam mit dem Wirt, seinem Bruder, seinem anderen Bruder, seinem dritten Bruder, seinem Schwager und seines Schwagers (c) Oliver Uschmann 2013 Bruder, wie die Helden aus Hellas sogar die haushoch favorisierten Franzosen beseitigten. Fünf Tage später besiegten sie die Tschechen im Halbfinale. Am 4. Juli errangen sie unter den ungläubigen Augen der ganzen Welt den Europameistertitel gegen die Portugiesen. Die Anzahl der Tore, welche die Griechen gegen Frankreich, Tschechien und Portugal benötigten, lautete: Drei. Eins pro Spiel. Das reicht vollkommen aus, wenn, ja wenn … hinten die Null steht. Der Schöpfer des griechischen Wunders 2004 war bekanntlich ein Deutscher. Otto „Rehakles“ Rehhagel, ein Mann wie ein Baum, mit der Stimme eines Nebelhorns, den Gesichtszügen eines Höhenkamms und dem Selbstbewusstsein eines germanischen Gottes. Und: Mit einer Überzeugung. Offensive gewinnt Spiele. Defensive gewinnt Tore. Wie keiner vor ihm, trainierte Rehhagel seine Mannschaft darauf, so trocken, humorlos und hart zu verteidigen, dass der Gegner 90 Minuten lang gegen eine Burgmauer rennt. Rehhagel war es egal, wie diese Strategie auf das Publikum wirkte und wie sehr die Kritiker schimpften. Er scherte sich nicht darum, dem Fußball angeblich die Schönheit zu nehmen. Er wollte nicht schön spielen, sondern mit einem Personal den Titel gewinnen, dass technisch dazu eigentlich gar nicht in der Lage war. Brauchte es auch nicht. Denn hinten stand die Null. Die Gegner verzweifelten an der Zwecklosigkeit ihrer Angriffe, und den Griechen genügte jeweils ein präziser Wespenstich hinein in das offen liegende Nervensystem. Etwas Vergleichbares erlebte ich in meiner Zeit als Vereinsspieler im Tischtennis, wo einer von 100 Gegnern sich auf reine Verteidigung verlegt hatte. Solche grausamen Menschen beklebten ihre Schläger mit den zwei fiesesten Belägen überhaupt. Auf der einen Seite lange Noppen, die dafür sorgen, dass der zurückgeschlagene Ball eiert wie ein Matrose auf Landgang, auf der anderen Seite Anti-Spin, ein Spezialmaterial, das den Schnitt aus den Angriffsbällen nimmt. Beide Beläge verzichten in so einem Fall auf die gelbe Gummiunterlage, um noch mehr Tempo rauszunehmen. (c) Oliver Uschmann 2013 Jedes Rückspiel, das von so einem Spielgerät kommt, klingt wie pures Holz. KLOCK! KLOCK! Wer so ein Spiel beherrscht, steht einfach nur da und bringt alles, aber auch wirklich alles, was man ihm um die Ohren schießt, mit stoischem Blick wieder zurück. KLOCK! KLOCK! Man wird vollkommen wahnsinnig, weil es gegen diese Defensive kein Mittel gibt und es sich anfühlt, als würde man vom Ball verfolgt wie von einem besessenen Hund, den man aus dem Haus jagt und der sofort wieder knurrend hinter einem steht, obwohl man gerade die Tür geschlossen hat. KLOCK! KLOCK! Man weiß rational, dass man den buddhistischen Irren auf der Gegenseite nur besiegen kann, indem man eben nicht ständig schmettert und sich zu Fehlern provozieren lässt – und dann passiert es doch wieder, da man nach fünfzig Ballwechseln im Schneckentempo schlichtweg denkt, dass es nie mehr endet. Man sieht die Jahre draußen vor der Turnhalle vorüberziehen. Man weiß, man sieht seine Freunde nie wieder, die Familie, und Oma, „die wird ja auch nicht jünger“, wie Mutter immer sagt. Prozessionen der Trauer werden an der Halle Richtung Friedhof vorüberziehen, die Oma aufgebahrt, und drinnen, hinter dem dreckigen Milchglas, wird immer noch das KLOCK! KLOCK! Der Partie ertönen, da der tibetanische Geduldsmensch mit den langen Noppen alles zurück auf die Platte bringt, da er nie essen und trinken muss und da sein Bart nicht wächst, während man selber schon über ihn stolpert. Genauso ist es den Gegnern der Griechen bei der EM 2004 ergangen und auch, wenn es so aussah, als wäre dieser Trend eine Eintagsfliege gewesen, hat Otto Rehhagel in Wirklichkeit die eine, große Wahrheit des Fußballs damit manifestiert. Defensive gewinnt Titel. Bis heute. Spanien wurde (c) Oliver Uschmann 2013 2010 zwar vorne heraus mit schönem Tiki-Taka Weltmeister, hatte aber mit Pique und Puyol auf dem Höhepunkt ihrer Kraft auch das beste Innenverteidigungsduo der Welt. Italien erkämpfte sich den WM-Titel 2006 mit knüppelharten Typen wie Cannavaro und Materazzi in der Verteidigung. Bayern München gewann 2012/2013 das Triple auch deshalb, weil sich für die Abwehrreihe Lahm – Dante, Boateng – Alaba mit Javi Martinez und Schweinsteiger als Sechsern und Manuel Neuer als Torwart alle Clubs der Welt zu der Zeit ein Bein ausgerissen hätten. Überträgt man das Prinzip „Die Null muss stehen!“ auf das Leben, fallen einem zwei wichtige Bereiche ein. Die Finanzen und die Ordnung. Reichtum – so begreift es der Nachfolger von Rehakles im Geiste – ist nicht die reine Höhe des Einkommens, sondern die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. In Berlin sollte ich in den Monaten nach dem denkwürdigen griechischen Abend beim Italiener in der Musikbranche und in der Werbewelt Menschen kennenlernen, die 1 Millionen Euro im Jahr einnahmen, aber 1,5 Millionen ausgaben. Ständig nah am Herzinfarkt und vollkommen verwirrt darüber, warum sie eigentlich Schulden haben, waren sie ärmer als die Menschen aus der Buchbranche oder der Kleinkunst, die mir begegneten und die es irgendwie schafften, von 25.000 Euro im Jahr noch 8.000 zur Seite zu legen, weil sie ihre Kosten auf ein Minimum reduzierten. Sie hatten begriffen, was es heißt, wenn die Defensive funktioniert. In Sachen Ordnung wiederum bedeutet „die Null muss stehen!“ die ebenso bittere wie wahre Erkenntnis, dass es Arbeit bedeutet, Ordnung überhaupt nur aufrechtzuerhalten. Tut man nichts, kippt alles in den Abgrund und schneller, als man denkt, steht jede freie Fläche im Haus mit Sachen zu und die Fruchtfliegen fressen den Dachstuhl. Das Käsebrot von letzter Woche findet sich auf der Rückseite des Steuerordners unter den Prospekten auf dem Schreibtisch und der Fernseher fällt aufgrund von Wandschimmel aus der Verankerung. Wer stets nur „angreift“ – also sich um alles Mögliche kümmert, statt erst mal zu spülen, zu waschen und den Müll rauszubringen – mag wichtige, neue Geschäftskontakte knüpfen, kann sie aber niemals zu sich nach Hause einladen, da sie sich sonst genötigt fühlen, auf der Stelle den (c) Oliver Uschmann 2013 RTLII-Messie-Hilfstrupp zu holen. Wer immer nur Akquise macht, aber über das, was gewesen ist, keine Buchhaltung führt, hat irgendwann den Steuerfahnder vor der Tür, der alle Gewinne zunichtemacht. Wer (wie viele Workaholics) über die Arbeit sogar sich selbst und seinen Körper vernachlässigt, mag das Dreifache an Terminen unterkriegen, sieht sich aber irritierten Blicken ausgesetzt, da ihm unbemerkt die Popel in der Nase hängen und sich an den Haaren, die aus den Ohren wachsen, gerade eine Spinne abseilt. Ordnung in Haus, Hof, Papieren und am Mann erfordert ständiges Pressing und Druck gegen den Ball, ist aber essenziell für ein würdevolles Leben. Es ist Arbeit, dafür zu sorgen, dass die Null steht. Am Ende zahlt es sich aus. Als ich an dem Sommerabend in Wedding mit vollem Bauch und beeindruckt von der griechischen Leistung die Pizzeria verließ, dachte ich an diese Erkenntnis und sah auf dem Weg zum Bahnhof plötzlich überall Baustellen. Die abgeplatzten, gelben Fliesen in der U-Bahn-Station. Eine Schaukommode für Plakate mit kaputter Scheibe. Ein Fahrkartenautomat, dessen Geldschlitz mit einem längst festgetrockneten Kaugummi verklebt wurde. Alles marode. Alles unter null. Und ich dachte mir: Der Staat kapiert es nicht, mit der Defensive. Er baut gigantische, neue Bahnhöfe aus achtzig Trilliarden Tonnen Glas und Stahl. Er baut Philharmonien, neue Flughäfen, Prestigeobjekte. Alles eine große, schillernde, glamouröse Offensive. Aber hinten, in der Fläche, da geht alles den Bach runter. Hinten steht keine Null. Der Nachtzug kam eine halbe Stunde zu spät. Als ich gegen 1 Uhr in der Koje einschlief, träumte ich von der alten Tischtennisturnhalle, und das Geräusch der Bahnschwellen wurde im Traum zu einem steten, gnadenlosen … KLOCK! KLOCK! KLOCK! … KLOCK! (c) Oliver Uschmann 2013 „Wenn er rauskommt, muss er ihn haben!“ Der Torwart hat beim Fußball scheinbar die einfachste Aufgabe. Er steht zwischen den Pfosten, beobachtet in Ruhe das Spiel und wartet ab, bis der Ball auf ihn zufliegt. Er muss weniger laufen, hat mehr Zeit, zu reagieren und da, wo ihm die Zeit nicht bleibt, gilt der Schuss, wenn er reingeht, im Nachhinein sowieso als „unhaltbar“. So denkt sich das der Laie. Nichts könnte unwahrer sein. Wer nach außen wie sogar nach innen ein echtes Verständnis für den Fußball entwickeln möchte, sollte sich klarmachen, wie schwer es der arme Torhüter hat. Und er (oder sie) sollte sich einen Satz merken, der im Doppelpass zwar dazu führt, ins Phrasenschwein spenden zu müssen, der aber abseits von professionellen Fußball-Talkshows im Fernsehen unter normalen Fans immer gut kommt: „Wenn er rauskommt, muss er ihn haben!“ Dieser Satz ist – laut, vorwurfsvoll und mit Betonung auf dem „raus“ wie auf dem „haben“ – immer dann zu äußern, wenn folgende Spielsituation eintritt. Die Abwehrreihe hat nicht aufgepasst oder sich doof angestellt. Ein oder zwei Angreifer des Gegners sind durchgebrochen und nicht im Abseits. Oder ein Mittelfeldspieler des Gegners hat gerade einen schönen, hohen Pass über die Köpfe der Abwehrspieler gelupft und ein Stürmer läuft los und wird diesen hohen Pass gleich aufnehmen. In diesem Augenblick muss der Torwart in Sekundenbruchteilen entscheiden, was er nun angesichts der dunklen Bedrohung tut. Stehenbleiben? Oder Rauskommen? Bleibt er stehen, macht er sich auf der Torlinie so breit wie möglich, fletscht die Zähne und hofft, dass der Stürmer so nervös wird, dass er danebenschießt. Das war rund 100 Jahre lang die Taktik des Titanen Oliver Kahn, der so lange Nationaltorhüter war wie vor ihm Helmut Kohl unser Bundeskanzler. Kahn blieb stets dort, wo sein Lebensraum nun einmal war – im Tor –, es sei denn, das Tor wurde gerade gar nicht (c) Oliver Uschmann 2013 angegriffen und er hatte Zeit, aufs Feld zu laufen und einem Gegner das Ohr abzubeißen oder die eigenen Mannschaftskameraden zu Motivationszwecken zu würgen wie Homer Simpson seinen Sohn Bart, bis ihm die Augen aus dem gelben Schädel quellen. Lief ein Angriff auf das bayerische oder deutsche Tor, stand Kahn … und stand … und stand. Während er stand, fixierte er den Gegner mit den Augen und brachte ihn völlig aus dem Konzept. Was viele nicht wissen: Oliver Kahn war ein Telepath. Er vermochte es, in den Kopf eines Gegners einzudringen und ihm schreckliche Bilder ins Gehirn zu speisen. Der Stürmer sah dann für eine Sekunde keinen Menschen mehr im Tor vor sich stehen, sondern glaubte, er renne auf das riesige Maul eines vorsintflutlichen Ungeheuers zu oder auf den größten aller Fische, das Wassermonster im Ozean des Planeten Naboo in Star Wars – Episode 1. War der Angreifer etwas willensstärker, konnte Oliver Kahn keine komplett neuen Phantasien in seinen Kopf pflanzen, aber zumindest sein eigenes Aussehen ins Groteske verzerren. Sein blonder Schopf mutierte dann zur Mähne, seine Augen zu den funkelnden Jagdscheinwerfern eines Löwen in der Savanne und sein ohnehin großer Mund zu einem aufgerissenen Brüllen mit scharfen Zähnen. Da an seinem rechten Schneidezahn ohnehin noch ein Fetzen Haut vom Ohr Heiko Herrlichs klebte, war dieses Drohgeste gleich doppelt glaubwürdig. Heißt man nicht Oliver Kahn und fühlt man sich außerdem dem „modernen Spiel“ verpflichtet und entscheidet sich nicht fürs Stehenbleiben, sondern fürs Rauskommen. Wobei dieses Spiel gar nicht so modern ist, wie es immer heißt, wenn man bedenkt, dass Deutschlands „Torhüter des Jahrhunderts“, Sepp Maier, zu seiner Zeit Ende der 60er bis Anfang der 70er stellenweise der König der Rauskommer war. Solche Details vergessen die Menschen allerdings schnell. Der „moderne“ oder sagen wir dann besser, der „flexible“ Torwart verlässt jedenfalls häufig seine Grundlinie und rennt auf das Geschehen zu. Entweder auf den ballführenden Angreifer oder auf den hoch Richtung Tor fliegenden Ball, den gleich einer annehmen könnte. Rennt er auf den ballführenden Angreifer zu, dient das dem Zweck, „den Winkel zu verkürzen“. Je näher (c) Oliver Uschmann 2013 der Stürmer dem Torwart kommt, desto schwerer kann er an ihm vorbeischießen. Und alle versuchen ja, links oder rechts am Torwart vorbeizuschießen, denn wo talentierte Ärzte nach einigen Jahren des Studium und der praktischen Übung als Assistent Operationen am offenen Gehirn ausführen können, sind 99% der Fußballer auch nach einem Jahrzehnt der Züchtung im Sportinternat nicht fähig, den Ball einfach mit der Fußspitze vom Rasen zu heben und über den Torwart drüber zu lupfen. Im Grunde beherrscht das immer nur ein Spieler pro Generation, zurzeit Lionel Messi … oder jeder zehnjährige Junge auf den Straßen von Rio und Búenos Aires. Rennt der Torwart nicht auf einen ballführenden Stürmer, sondern auf den hoch Richtung Strafraum fliegenden Ball zu, muss er ihn mit den Fäusten wegboxen, bevor ein Angreifer ihn einköpfen oder weiterleiten kann. In diesem Fall trifft er mit seinen Fäusten häufig statt des Balls den Angreifer oder einen eigenen Verteidiger in der Spielertraube. In den wenigen Fällen, in denen Oliver Kahn in seiner Karriere mal „rauskam“, stand nach der „Faustabwehr“ im Umkreis von 25 Metern niemand mehr. Der Torhüter hat es also deshalb so viel schwerer, als der eingangs erwähnte Laie immer denkt, weil er bei jedem Angriff eine gewichtige Entscheidung treffen muss. Eben: Stehenbleiben oder Rauskommen. Bleibt er stehen, gibt ihm kaum jemand die Schuld am Tor, da die Situation auf der Grundlinie der beim Elfmeter ähnelt. Kommt er aber raus und kann das Tor trotzdem nicht verhindern, liegt die Schuld grundsätzlich bei ihm. Denn, was sagen wir dann? „Wenn er rauskommt, muss er ihn haben!“ Dass dieser vorwurfsvolle Satz immer so gut funktioniert, liegt vor allem am Nachfolger Oliver Kahns in der Legendengalerie des deutschen Fußballs, Manuel Neuer. Der gilt seit Jahren als „bester Torhüter der Welt“ und verkörpert das „moderne Spiel“ zugleich wie kein Zweiter. Er kommt so gerne und so häufig raus, dass man den Eindruck bekommt, der beste Keeper der Welt könne das Torwartsein überhaupt nicht leiden und wolle viel lieber mitspielen. Getrieben von heilloser Hibbeligkeit benimmt sich (c) Oliver Uschmann 2013 der ehemalige Schalker Ultra aus der Nordkurve wie ein Junge auf dem Bolzplatz, der zwar eigentlich Torwart spielt, aber bei Aktionen seiner Mannschaft immer mit nach vorne rennt. Rückpässe seiner Verteidiger liebt er über alles, da er sie ja mit dem Fuß annehmen muss und die ungeliebten Hände dabei weglassen darf. Gerne wartet er daraufhin ab, bis sich ein Angreifer nähert, um ihn wie früher auszufummeln. „Als Feldspieler ist er gut genug für die 3. Liga“, heißt es in der Presse immer und wenn er kann, bereitet er mit weiten Einwürfen sogar direkt Tore vor. Weitwurf liebt er sowieso, da bekam er bei den Bundesjugendspielen immer die „Ehrenmedaille“ (tz, Oktober 2011). Ferner spielt er, wo er kann, nebenbei Tennis, bis ins 14. Lebensjahr sogar im Verein. Muss er im Tor einfach nur warten, dass endlich was passiert – was bei Bayern sehr oft vorkommt – nimmt seine innere Unruhe unglaubliche Ausmaße an. Er löst dann im Kopf Algorithmen und mathematische Rätsel, diktiert Aufsätze und Gedichte in sein kaum sichtbares, über das Vereinswappen eingenähte Diktiergerät oder gräbt mit den Stollen heimlich dezente Stolperlöcher für die Angreifer, die er mit der gelösten Grasnarbe lose wieder bedeckt wie eine Klappfalle im Dschungel. Kommt er dann schließlich raus und wehrt einen Angriff erfolgreich ab, müssen ihn seine Kollegen aus der Verteidigung jedes Mal bremsen, beim Konter nicht mit nach vorne zu laufen. Gelingt es ihm nicht, beim Rauskommen das Tor zu verhindern, wird es ihm als einzigem Torhüter der Welt ein jedes Mal verziehen. Zwar ruft auch dann jeder Fan vor dem Fernseher auf dem Sofa oder in der Kurve „Mann, wenn er rauskommt, muss er ihn doch haben!“, an seinem Status als Stammkraft in der Nationalmannschaft ändert das aber aufgrund von Löws paranoider Personalpolitik ( S. XY) nichts. Dort bliebe er sogar dann unangetastet, wenn er sich beim Angriff des Gegners umdrehen und versuchen würde, den Ball mittels eines Fallrückziehers aus dem Tor zu dreschen. Ich für meinen Teil nutze den Torhüter-Satz privat, um unserem Kater Vorwürfe zu machen. Darf er schließlich zwischendurch in den Garten und erspäht dort augenblicklich eine fiepende, zwischen dem Storchenschnabel und den Thujen verborgene Maus, gelingt es ihm meistens nicht, sie zu (c) Oliver Uschmann 2013 kriegen, obschon er bei den Übungsrunden mit dem Laserpointer im Haus den huschenden, kleinen Punkt sogar bekommt, wenn dieser an der Zimmerdecke neben dem Halogenstrahler zuckelt. „Boah!“, rufe ich dann laut über die Hecke, „wenn du schon rausdarfst, musst du sie haben!“ Man darf als Trainer eben auch nicht lockerlassen. „Wenn der runterkommt, ist Schnee dran!“ Der Ball fliegt hoch in der Partie Bochum gegen Barcelona. Sie findet natürlich nicht in Wirklichkeit statt, sondern auf der PlayStation. Ich spiele die Jungs aus dem Ruhrpott und Michael die Spanier. Der Moderator des Spiels, Manni Breuckmann, sagt: „Wenn der wieder runterkommt, dann ist Schnee dran!“ Michael drückt auf Pause und springt von der Couch auf: „Da war er!“ „Wer?“ „Der Spruch! Mit dem Schnee!“ Tatsächlich. Ist mir noch nie aufgefallen. Spiele ich alleine gegen die Konsole, kam er bislang nicht vor. „Wie geil!“, sagt Michael, ungewöhnlich erfreut. Die meisten Spieler der beliebten Reihe FIFA halten nur wenig von den Kommentaren, die von den echten Fußballmoderatoren Manni Breuckmann und Frank Buschmann für das Game eingesprochen wurden. Es sind tausende von Sätzen und Einzelworten für viele verschiedene Situationen, die mal passend und mal nicht ganz so passen geladen werden. Aber selbst Tausende reichen freilich nicht aus, um es so klingen zu lassen, als sei der Kommentar tatsächlich individuell der Partie angepasst. Spielt man viel, wiederholt sich alles irgendwann. Das nervt die meisten. Ich finde es gut. Der Grund, warum ich es gut finde, ist meine Kindheit. Also die, die ich bis weit über die 18 Jahre hinaus gestreckt habe. Mein Vater hatte seine aktive Laufbahn hinter sich, als Spieler sowieso, aber auch als Trainer. Wenn ich meine Eltern fortan am Wochenende besuchte, ging ich mit ihm als Besucher sonntags zu den Spielen des örtlichen Vereins. Wir kauften Kuchen mit Kaffee oder Bier mit Wurst und gesellten uns zu den Alten ( (c) Oliver Uschmann 2013 S. XY) an der Blechbande. Dieses Rudel forscher Männer sagte auch nicht mehr Sätze als die vorprogrammierten Stimmen in der Konsole. Im Grunde sogar viel weniger. Wie alle Fußballgucker, auch und gerade in den Amateurligen, hatten sie für jede Spielsituation eine feste Phrase. Schoss in den ersten fünf Minuten noch keine Mannschaft aufs Tor, sagten sie: „Die tasten sich erst mal noch ab.“ Entschied sich das Heimteam, heute mal keinen Fußball zu spielen, sondern den Gegner nur durch Rennen, Beißen und Treten niederzuringen, sagten sie: „Beim Fußball gibt es keinen Schönheitspreis zu gewinnen.“ Oder wahlweise: „Fußball ist kein Mädchenpensionat.“ Geriet die Mannschaft unter Druck und bekamen im eigenen Strafraum ständig den Ball um die Ohren geschossen, senkten sie ihre Stimme, schüttelten mit kullernden Augen den Kopf und dröhnten: „Oh Mann, da hinten brennt es lichterloh!“ Während solche Sätze einfach nur die Lage polemisch in Worte fassen, tragen andere eine witzige Pointe in sich. Sie überspitzen und erschaffen ein originelles Bild. Daher liebte ich es besonders, als mein Vater das erste Mal sagte: „Wenn der runterkommt, ist Schnee dran!“ Ich lachte mich kaputt, begeistert und zufrieden. Es fühlte sich an, als glitzerten Flocken auf seinem Schnauzbart, mitten im August. Da war ich fünf und schlürfte auf den Stufen hinter der Bande eine Caprisonne Kirsch. Dreizehn Jahre später, die Ellbogen auf dem Geländer und ein Bier in der Hand, sagte mein Vater den Satz vom Schneeball immer noch. Und ich lächelte. Die Regel, einen Witz nicht zwei Mal zu machen, ist im Fußball vollkommen aufgehoben. Die Tatsache, dass die programmierten Stimmen auf der PlayStation immer dasselbe sagen, passt insofern sogar gut zur Wirklichkeit. Der Small Talk am Spielfeldrand dient nicht dem Informationsaustausch oder dem Erkenntnisgewinn über das Spiel. Er dient dazu, sich gegenseitig verbal das Fell zu kraulen. Die Männer könnten ebenso gut lediglich Geräusche von sich geben wie Lemuren, Schimpansen oder Koboldmakis. Wobei diese Tiere wahrscheinlich, würde man ihre Sprache übersetzen, viel mehr Verschiedenes erzählen als der Homosapiens. Allerdings – das ist ganz wichtig für das Überleben an der (c) Oliver Uschmann 2013 Bande – dürfen die Phrasen nicht willkürlich angewendet werden. „Wenn der runterkommt, ist Schnee dran!“ zum Beispiel gilt nur für Bälle, die sehr steil in den Himmel fliegen und nur sehr langsam wieder heruntergekommen. Sie gilt nicht für Torschüsse, die weit über die Querlatte gehen. Sie gilt nicht für großzügig geschlagene Flanken. Ferner ist sie unpassend bei hohen Ecken, Lupfern oder normalen Torwartabschlägen. Im Grunde genommen gibt es nur zwei Situationen, in denen sie angebracht ist. Erstens: Der Torwart schlägt den Ball nicht normal ab, sondern übertrieben steil, fast senkrecht nach oben, was meistens ein Versehen ist und bei Profis so gut wie niemals vorkommt. Zweitens: Ein Stürmer zieht Vollspann ab und ein Verteidiger bringt ganz eng den Fuß dazwischen, so dass der Ball davon abspringt und statt geradeaus in den Himmel saust. Beide Szenen kommen selten vor, weshalb die Schneeballphrase ihre weihnachtliche Frische nicht bei jedem Spiel entfalten kann. Auch im echten Leben lerne ich mit der Zeit Menschen, die immer das Gleiche sagen, mehr und mehr zu schätzen. Klar habe ich als Schriftsteller das Bedürfnis, interessante Gespräche zu führen und beim Schreiben selber werfe ich immer wieder einen Blick auf das große Faltblatt mit verbotenen Phrasen und verbrauchten Metaphern, die man in einem Roman auf keinen Fall verwenden darf. Und ein Grund, warum ich meine Frau so liebe ist, dass die Gespräche, die ich mit ihr führe, selbst am Handy unterwegs und bei rauschendem Fahrtwind schon nach fünf Minuten zu Themen wie Platons Höhlengleichnis, Quantenphysik oder der Suche nach der Weltformel führen. Aber so, im Alltagsleben, unter Halbfremden, da gibt es eine Weisheit in der Wiederholung. Die Entlastung der Menschen von der Anstrengung, beim Sprechen jedes Mal auch noch denken zu müssen. Man weiß eben, (c) Oliver Uschmann 2013 was man im Supermarkt, beim Bäcker oder gar beim SchnittchenEmpfang auf der Buchmesse so zu sagen hat. So wie man, wenn man mal ganz entspannt gar nicht denken will, beim Fußball an der Bande einfach die Phrasen aneinanderreiht: „Das war ein Auftakt nach Maß.“ „Im Fußball ist alles möglich.“ „Man merkt, dass sie es wollen.“ „Die Tagesform wird heute entscheidend sein.“ Klingelt bei uns an der Haustür der Postbote, beginnt automatisch folgender Ablauf: Ich: Hallo. Postbote: Hallo. Ich: Wetter heute, oder? Postbote: Ja, Wetter. Ich: Aber ist ja angenehm. Postbote: Man kann es sich nicht aussuchen, oder? Ich: Nein. Man steckt nicht drin. Postbote: Ein paar Kataloge habe ich auch noch. Ich: Immer her damit. Die Wirtschaft muss auch leben. Und so weiter. Locker und angstfrei kann man sich fallen lassen in das Hin und Her vorprogrammierter Wendungen und innerlich dabei ganz woanders bleiben. Nach langen Nachtsitzungen am Rechner soll es schon vorgekommen sein, dass ich diesen Dialog an der Tür im Schlaf geführt habe, ohne einen Fehler zu machen. Hat man mir gesagt. Ich weiß nichts darüber. In Freundeskreis oder Herkunftsfamilie wird es sogar zum Charaktermerkmal, welche Sätze ein Mensch immerfort wiederholt. Sie sind so etwas wie die persönliche Titelmelodie, ein Markenzeichen. Meine Großmutter väterlicherseits etwa lobt sich, seit ich sie kenne und die (c) Oliver Uschmann 2013 menschliche Sprache verstehen kann, selber dafür, dass sie „mit den Leuten immer Späße macht“ und mit niemandem streiten kann. „Die kennen die Oma!“, sagte sie schon, als sie vom Alter her noch keine Oma war, und sitze ich heute bei ihr als meiner letzten lebenden Verwandte dieser Generation, wiederholt sie jedes Mal die Geschichten von der ehemaligen Nachbarskatze, die von ihrem Frauchen mit dem Stock geschlagen wurde, meiner Oma allerdings im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hand fraß. Ich höre es mir zu Ende an, jedes Mal und weiß, die Story endet mit den Worten: „Ja, Oliver. Du weißt das ja. Wir sind halt verrückt mit den Tieren.“ Wir, die Katzenfreunde. Ich kann den gesamten Text seit Jahren nachsprechen. Ich habe sie sehr, sehr lieb. Einen anderen Text, den ich auswendig nachsprechen kann, ist sämtlicher Dialog aus Quentin Tarantinos Film Jackie Brown, den ich stets in Hotels als DVD bei mir trage und in den Laptop schiebe, sobald ich Stress habe. Wiederholung beruhigt mich, wie ein Kind, das seine Hörspiele immer und immer wieder hört, nur dass die Lieblingssätze der Tarantino-Figuren kaum kindertauglich sind. Der Gangster Ordell Robbie (Samuel L. Jackson) erzählt seinem Kumpel Louis (Robert deNiro) im Film ständig ungefragt seine Lieblingsphrasen über Handfeuerwaffen. Ich kann jede einzelne davon mitsprechen. „AK-47. The very best there is. When you absolutely, positively got to kill every motherfucker in the room, accept no substitutes.” Solche Sachen sage ich in Hotels laut vor mich hin, noch im Flur auf dem Weg zum Frühstück, in breitestem Gangster-Englisch. Die Leute gucken seltsam, aber was soll’s. Ich brauche mein beruhigendes Mantra. Also brummele ich weiter: „That there is a TEC. Little cheap-ass spray gun made outta South Miami.“ Der pure Buddhismus. Michael und ich haben bei FIFA 13 eine neue Partie angefangen, aber es geht nicht voran, weil ich kaum ernsthaft spiele, sondern die ganze Zeit nur versuche, Manni Breuckmann noch mal zu dem Spruch mit dem Schnee am Ball zu bewegen. Aber es klappt nicht. „Du kannst es nicht erzwingen“, sagt Michael. (c) Oliver Uschmann 2013 „Der Ball muss nur hoch genug“, sage ich. „Stell dich noch mal mit einem Spieler vor mich und lass die Pille abprallen.“ „So geht das nicht“, sagt Michael. Ich versuche einen hohen Abstoß. Manni Breuckmann sagt gar nichts. Ich grummele. Es klingelt an der Tür. Der Postbote. Michael schaltet im Wohnzimmer kurzfristig auf den TV-Kanal um. Ich öffne die Tür und sage: „Hallo.“ Dann nehmen die Dinge ihren Lauf. (c) Oliver Uschmann 2013 Die Länder Deutschland – Die humorlosen Streber Es gibt ein großes Geheimnis unter den meisten Menschen, die Fußball gucken. Niemand spricht darüber. Keiner würde es jemals zugeben. Und doch ist es wahr: Die Mehrheit wünscht sich manchmal heimlich, unsere Deutschen würden endlich mal einen auf den Sack kriegen. Natürlich nur in den unwichtigen Spielen! Das ist klar. Denn gerade in diesen Partien benimmt sich die deutsche Nationalmannschaft so nervig wie die Schulstreber früher in der Klasse. Die, die vor und nach jeder darüber klagten, wie schwer alles sei und dass sie bestimmt versagt hätten und dann doch wieder je-de-s ver-fluch-te Mal ihre glatte Eins bekamen. Ich schreibe diesen Text einen Tag nach dem letzten Gruppenspiel der Deutschen in der WM-Qualifikation gegen Schweden. Es ging um nichts mehr, nur um die Ehre und die Schweden gingen 2:0 in Führung. Der ungeschlagene Tabellenführer Deutschland drohte, das erste Mal besiegt zu werden und das, obwohl die Schweden ohne ihren Leitwolf Ibrahimovic antraten. Und dann? Macht André Schürrle alleine drei Tore! Und die Deutschen insgesamt fünf! Aus einem 0:2. Und so läuft das immer! Sie verlieren solche Spiele einfach nicht. Gehen sie in Rückstand, aktiviert sich wie von selbst das Strebernaturgesetz. Zwerggegner bezeichnen sie erst Recht als „schwer“, lassen dann eine ganze Halbzeit lang zu, dass die Außenseiter ihnen ein 0:0 abzwingen und hauen dann am Ende, als hätten sie einfach nur gewartet, wieder ein paar Buden rein. Spielerisch viel schöner und ansehnlicher als früher, ist der deutsche Fußball unverändert humorlos. Er hat das Verlieren nicht eingeplant und stets alle Mittel parat, es rechtzeitig zu verhindern. Die Gegner wiederum scheitern an der Urangst aller Länder dieser Welt, dass die Deutschen am Ende doch ihre Interessen durchsetzen. Die Nationalmannschaft im Fußball folgt da dem Beispiel der Kanzlerin. Sie lächelt harmlos durch und am Ende finden sich alle Minister, die ihr gefährlich werden konnten, in der Arbeitslosgkeit wieder. Nur in Finalspielen, da gilt die Regel von Gary Lineker aufgestellte Regel „Ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen die (c) Oliver Uschmann 2013 Deutschen“ nicht mehr. Da haben die Streber seit nunmehr 14 Jahren Angst vor ihrer eigenen Courage. Irland – Die grünen Hobbits „Die Iren sind in der Stadt.“ Das war noch nie ein bedrohlicher Ausruf. Während englische Fans je nach Tagesform dazu fähig sind, eine Stadt wie Dresden wieder in den Zustand von 1944 zu versetzen, sind die Green Boys grundsätzlich friedlich. Friedlich und lukrativ. Die Kneipen und Gaststätten des Spielortes, in dem die irische Nationalmannschaft zu Gast ist, verzeichnen am Tag des Spiels den fünffachen Umsatz, ohne dass vor ihrer Tür auch nur eine einzige Geranie aus dem Bottich gerissen wird. Der Alkohol, den sich die Iren fässerweise in den Hals schütten, hat überhaupt keine Auswirkung auf ihr Aggressionszentrum. Ihre Augen bleiben lieb und zutraulich wie die verspielter Hunde. Ihre Lippen öffnen sich zum Absingen rustikaler Lieder ohne Pause. Mit ihren angewinkelten Armen suchen sie nach Schunkelpartnern und mit dem Kopf nach der nächsten großen Schulter zum bierseligen Anlehnen. Die Iren sind die Hobbits unter den Menschen. Sogar das absolute Rauchverbot in Kneipen, das ausgerechnet das Land der Pubs 2005 als erstes in der ganzen Welt (!) einführte, nahmen sie hin (das wäre bei den Pfeifenfreaks im Auenland schwieriger geworden), ohne die Regierung zu stürzen. Im Oktober 2013 verließen sie nach nur zwei Jahren wieder den Euro-Rettungsschirm und hatten alle nötigen Reformen erledigt, ohne jeden Tag mit manischen „Merkel = Hitler“-Plakaten durch die Straßen zu stampfen. Die „Boys in Green“ auf dem Rasen sind ähnlich einfach zu nehmen. Ihr Fußball ist rustikal schlicht und voller Herzblut. In Musik gesprochen, tanzen die Brasilianer Samba, die Franzosen geben die Drama Queen des Chanson und die Iren machen aus jeder Partie einen herzhaften Irish Folk-Abend. Der irische Kapitän und Gallionsfigur Roy Keane spielt seit Ende des Bürgerkriegs von 1921 für die kernigen Kelten. Ihren größten Erfolg bei der Weltmeisterschaft 1990, wo sie es bis ins Viertelfinale schafften und dort an Italien scheiterten, werden sie in absehbarer Zeit nicht (c) Oliver Uschmann 2013 wiederholen, was weder die Spieler noch die Fans aus der Ruhe bringt. Man hat ja Zeit. Vor allem für noch ein Bierchen. Oder fünf. Portugal – Die majestätischen Mitfavoriten Eines der wichtigsten Worte beim Fußball, das bislang in diesem Buch noch nicht vorkam, lautet: „Mitfavorit“. Bei einer WM werden die teilnehmenden Teams üblicherweise in drei Mengen aufgeteilt. Vier, höchstens fünf Mannschaften gelten als „Favoriten“ auf den Titel. Bei der WM 2014 dürften das Brasilien, Spanien, Deutschland, Argentinien und die Niederlande sein. Ach, was … wenn man ehrlich ist, sind es im Grunde immer Brasilien, Spanien, Deutschland, Argentinien und die Niederlande. Diesem „Favoritenkreis“ steht eine große Menge an „Außenseitern“ und wegzuräumenden Statisten gegenüber. Aber dazwischen, als Puffer, kleben die „Mitfavoriten“, auch „der erweiterte Favoritenkreis“ genannt. Hier leben die Mannschaften, denen man jedes Mal einen Titel zutraut, auch, wenn es unwahrscheinlicher ist. Frankreich, England, Italien … und Portugal. Allein: Im Gegensatz zu ihren Kollegen haben die Portugiesen noch nie irgendeinen Titel gewonnen. Noch nie! Wie kann es dann sein, dass sie jedes Mal wieder als „Mitfavorit“ gehandelt werden? Die Antwort lautet: Sie sehen so aus. Würden sie ihre Rolle ablehnen und wütend fragen: „Was? Sehe ich aus wie ein Favorit?“, könnte man diese Frage klar mit „Ja!“ beantworten. Und das gilt nicht nur für den Weltstar Christiano Ronaldo, der Torhüter wie Frauen weltweit weinen lässt, sondern für alle. In der Verteidigung steht dort mit Pepe das angsteinflößendste Bollwerk ( S. XY) der ganzen Fußballwelt, ein gnadenloser Menschenzerleger. Linksaußen wiederum das Gegenteil: Fábio Alexandre da Silva Coentrão. Eine Mischung aus Jürgen Klinsmann und dem ganz jungen Rod Steward. Im Mittelfeld: João Moutinho, der portugiesische Bradley Cooper, der problemlos eine Rolle in Hangover 4 übernehmen könnte. Oder Nani, ein unglaublich viriler Athlet, der den Kampfsport-Tanz Capoeira beherrscht und eine Zeit lang auch als Torjubel benutzte. Eine Figur, wie man sie in (c) Oliver Uschmann 2013 einem Martial Arts-Videospiel oder einer neuen Folge von Bloodsport im Halbfinale gegen Jean-Claude van Damme antreten lassen könnte. Gegen solche Männer wirkt beim Gegner die Eifersucht … und die ist stark. Daher wird für Portugal auch weiterhin nur der Titel der am besten aussehenden Elf übrig bleiben. (c) Oliver Uschmann 2013 Der Autor Oliver Uschmann weiß, worüber er schreibt. Als Sohn eines passionierten Spielers und Trainers (Jürgen Uschmann), der es als junger Mann bis in die damalige 3. Liga schaffte, begleitete ihn der Fußball sein Leben lang. Er selbst blieb Bolzplatz-Held, Hobbykicker und Nerd. Seit Jahrzehnten studiert er die KickerSonderhefte wie Bibeltexte, spielt Fantasiefußball mit imaginären Ligen im Garten, führt laut Interviews mit sich selbst hinter der Hecke und verbringt keinen Tag ohne Ball am Fuß oder FIFA 13 auf der PlayStation. In den Romanen zu Hartmut und ich sowie der Jugendbuchreihe Finn spielt Fußball immer wieder eine Rolle. Gemeinsam mit seiner Frau Sylvia Witt versorgt Uschmann das Publikum vom Dorf im Münsterland aus mit Romanen und Ratgebern für junge Menschen von 11 bis 99, interaktiven Webseiten, Schreibworkshops, Textcoaching sowie Briefen und Päckchen ans eigene Publikum, wenn es Fehler in den Büchern entdeckt oder einfach nur nett geschrieben hat. Die Bücher werden in WG-Küchen und LKW-Kojen ebenso gelesen wie in Schulen oder Unis. Sie gewinnen Literaturpreise und haben trotzdem schon über 500.000 Exemplare verkauft. Zur „Hui-Welt“ der Hartmut und ich-Romane gab es 2010 mit Ab ins Buch! auf dem Kulturgut Haus Nottbeck sogar eine große Event-Ausstellung mit Lesungen, Konzerten, Begegnung … und einem großen Fußballtag, versteht sich. www.hartmut-und-ich.de // www.wortguru.de www.facebook.de/oliveruschmann Uschmann wälzt sich nach simuliertem Foul an sich selbst