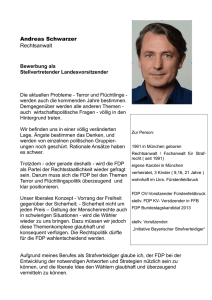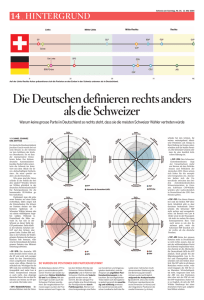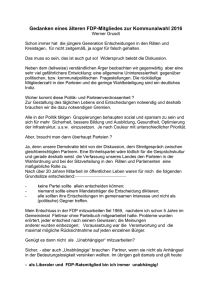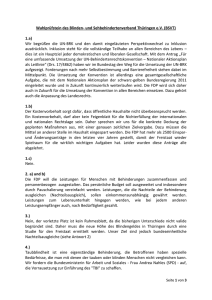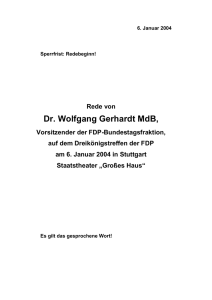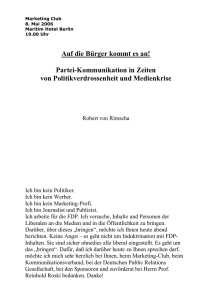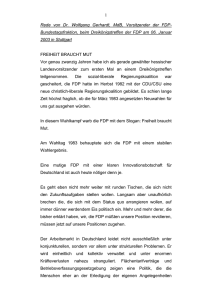Opposition als Chance
Werbung
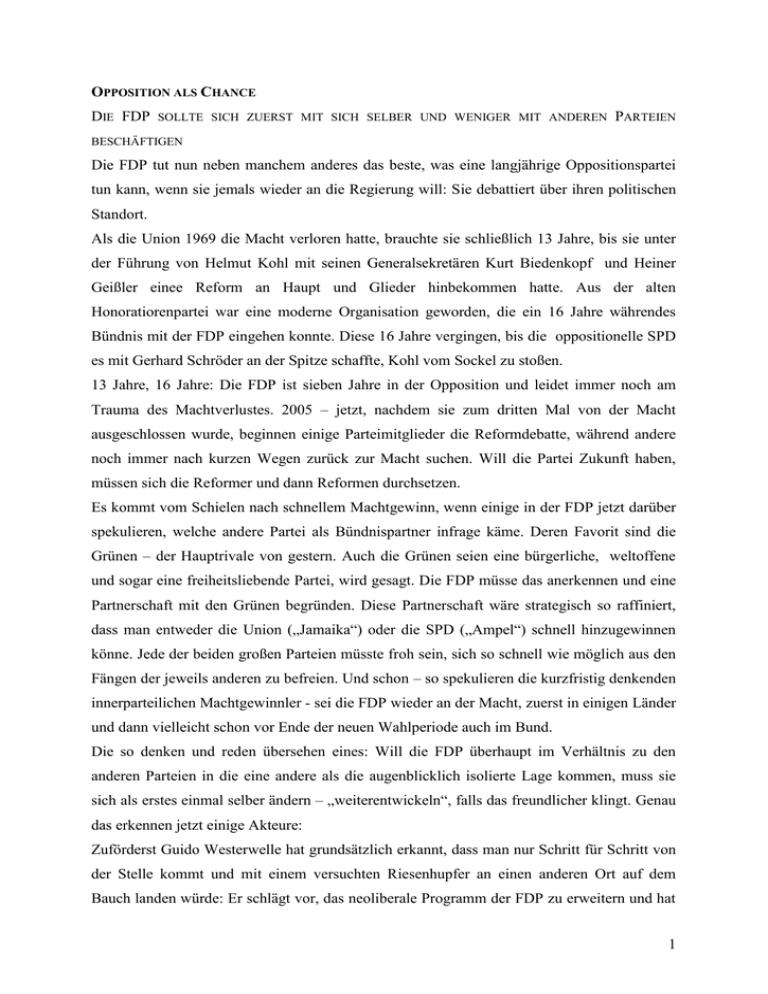
OPPOSITION ALS CHANCE DIE FDP SOLLTE SICH ZUERST MIT SICH SELBER UND WENIGER MIT ANDEREN PARTEIEN BESCHÄFTIGEN Die FDP tut nun neben manchem anderes das beste, was eine langjährige Oppositionspartei tun kann, wenn sie jemals wieder an die Regierung will: Sie debattiert über ihren politischen Standort. Als die Union 1969 die Macht verloren hatte, brauchte sie schließlich 13 Jahre, bis sie unter der Führung von Helmut Kohl mit seinen Generalsekretären Kurt Biedenkopf und Heiner Geißler einee Reform an Haupt und Glieder hinbekommen hatte. Aus der alten Honoratiorenpartei war eine moderne Organisation geworden, die ein 16 Jahre währendes Bündnis mit der FDP eingehen konnte. Diese 16 Jahre vergingen, bis die oppositionelle SPD es mit Gerhard Schröder an der Spitze schaffte, Kohl vom Sockel zu stoßen. 13 Jahre, 16 Jahre: Die FDP ist sieben Jahre in der Opposition und leidet immer noch am Trauma des Machtverlustes. 2005 – jetzt, nachdem sie zum dritten Mal von der Macht ausgeschlossen wurde, beginnen einige Parteimitglieder die Reformdebatte, während andere noch immer nach kurzen Wegen zurück zur Macht suchen. Will die Partei Zukunft haben, müssen sich die Reformer und dann Reformen durchsetzen. Es kommt vom Schielen nach schnellem Machtgewinn, wenn einige in der FDP jetzt darüber spekulieren, welche andere Partei als Bündnispartner infrage käme. Deren Favorit sind die Grünen – der Hauptrivale von gestern. Auch die Grünen seien eine bürgerliche, weltoffene und sogar eine freiheitsliebende Partei, wird gesagt. Die FDP müsse das anerkennen und eine Partnerschaft mit den Grünen begründen. Diese Partnerschaft wäre strategisch so raffiniert, dass man entweder die Union („Jamaika“) oder die SPD („Ampel“) schnell hinzugewinnen könne. Jede der beiden großen Parteien müsste froh sein, sich so schnell wie möglich aus den Fängen der jeweils anderen zu befreien. Und schon – so spekulieren die kurzfristig denkenden innerparteilichen Machtgewinnler - sei die FDP wieder an der Macht, zuerst in einigen Länder und dann vielleicht schon vor Ende der neuen Wahlperiode auch im Bund. Die so denken und reden übersehen eines: Will die FDP überhaupt im Verhältnis zu den anderen Parteien in die eine andere als die augenblicklich isolierte Lage kommen, muss sie sich als erstes einmal selber ändern – „weiterentwickeln“, falls das freundlicher klingt. Genau das erkennen jetzt einige Akteure: Zuförderst Guido Westerwelle hat grundsätzlich erkannt, dass man nur Schritt für Schritt von der Stelle kommt und mit einem versuchten Riesenhupfer an einen anderen Ort auf dem Bauch landen würde: Er schlägt vor, das neoliberale Programm der FDP zu erweitern und hat 1 dafür die Begriffe „neosozial“ und „ökologisch“ genannt. Der Ansatz ist richtig, nur ist dem noch wenig konkret gefolgt: - Die FDP gilt als Partei der sozialen Kälte, weil sie die Politik des Rückbaus des Sozialstaates und der Freisetzung unternehmerischer Tätigkeit konsequent – das heißt „neoliberal“ – verfolgte. Sie muss eine soziale Perspektive entwickeln, wie eine solche Politik gerecht sein kann – z. B. indem sie Arbeitsplätze schafft. Hier bedarf es einer ebenso ausgefeilten wie vor allem politisch überzeugenden Argumentationskette wie bei der Begründung des neoliberalen Ansatzes selber. Ob das gelingt, daran haben manche Zweifel. Aber die FDP muss es versuchen, sonst kommt sie nicht von der Stelle. Vor allem braucht sie Politiker, denen die soziale Gerechtigkeit für die Öffentlichkeit offensichtlich ebenso eine Herzensangelegenheit ist wie vielen anderen eine neoliberale Ordnungspolitik. Mit dem Begriff allein „neosozial“ ist es nicht getan: er kann nur der Wegweiser für einen Reformstrang sein. - Mit der Umweltpolitik könnte die FDP auf ein Territorium zurückkehren, das sie einst selber entdeckt, aber seit dem Wechsel 1982 verlassen hatte. Die Ziele des Schutzes der Natur müssten gleichwertig neben die ökonomischen treten und auf anderen Wegen als über Quoten und Abgaben zu erreichen sein. Wie eine am Liberalismus orientierte Partei sich das vorstellt, wäre interessant zu wissen, und gäbe es hierzu Vorschläge, würde das die allgemeine Debatte befruchten. Mit dem Wunsch nach programmatischer Ausweitung über die Wirtschaft hinaus zur sozialen Gerechtigkeit und zur Ökologie weist Westerwelle seine Partei auf einen erfolgversprechenden Pfad. Ob sie ihn gehen wird? Richtig an diesem Ansatz ist vor allem, den ersten Schritt vor dem zweiten zu tun. Aber da stolpert der Parteivorsitzende selber. Ein offensichtlich tief sitzendes Trauma bringt dazu, jede Kooperation mit den Grünen kategorisch abzulehnen. Was haben die Grünen ihm getan? Soll er sich doch um die FDP kümmern- wie er es ja eigentlich will und die Grünen sich selber überlassen! Denn auch sie haben die Aufgabe, sich neu zu erfinden. Erst seit Wochen stehen sie ohne Macht da, und es ist an ihnen, zu zeigen, ob „grün“ eine politische Idee ist oder nur – wie der Berliner FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Lindner etwas voreilig meint – „eine Art Lebensgefühl“. Man sollte die Konkurrenz nicht unterschätzen. Klüger wäre es, abzuwarten, ob die Grünen es schaffen, eine Partei der milieunahen Gesellschaftsreformen zu werden oder ob sie dabei scheitern. Andere FDP-Funktionäre wieder verfallen in altes Wunschdenken der FDP zurück, und behaupten, man könne den Großparteien, vor allem der Union, nennenswerte Wählerschichten 2 abnehmen. Natürlich, der Wettkampf der Parteien um Wählerzuspruch darf nie aufhören. Aber „Augenmaß“ im Sinne Max Webers kann auch hier nichts schaden. Noch ist nicht klar zu erkennen, ob die Union eventuell gerade dabei ist, sich unter ihrer nüchternen Kanzlerin neu zu erfinden als Partei der Pragmatiker in allen Schichten der Bevölkerung. Im übrigen ist die schiere Organisationsgröße der Union wie auch der SPD ein Garant ihrer Immunität gegen Schwächungen von außen. Der FDP ist zu raten, jetzt nicht von neuen Bündnissen zu träumen, sondern mehr davon, wie sich diese Partei modernisieren ließe. Zeit dafür hat sie. So schnell wird die große Koalition nicht scheitern, als dass es morgen schon der FDP als Partner bedürfte. Die Opposition ist nicht nur wichtig im parlamentarischen System; sie bietet auch die Chance der Erneuerung. Und diese sollte nicht nur inhaltlich sein, sollte auch organisatorische Aspekte haben. So beispielsweise könnte sich die FDP überlegen, ob sie nach amerikanischem Vorbild Vorwahlen bei den Kandidatennominierungen zulässt. Es liegt in der Natur der Sache, dass auch eine im Reformprozess stehende Partei immer wieder Koalitionsentscheidungen treffen muss. Nur müssen die nicht von grundsätzlicher bündnispolitischer Bedeutung sein. Zur Zeit gibt es eine SPD/FDP und mehre CDU/FDPKoalitionen in den Ländern. Diese haben regionale Bezüge und könnten einmal wichtig werden für grundsätzliche Positionierungen. Aber da stehen noch andere Optionen an: Nachdem es bei den Wahlen 2006 in BadenWürttemberg klar sein dürfte, dass die FDP dort wieder das Bündnis mit der CDU suchen wird, sieht es in Berlin und übrigens auch in Mecklenburg-Vorpommern anders aus. Ein Wechsel von „rot-rot“ zu einer anderen Konstellation wird in der Hauptstadt wohl nur mit einer „Ampel“ oder mit „Jamaika“ gehen. Da würde die nach ökologischer Perspektive dürstende FDP viel nachdenken müssen, wenn die CDU in Berlin Klaus Töpfer nominiert und eine berlinfreundliche, kosmopolitische und umweltorientierte Perspektive zugleich böte. Selbst dieser Weg wäre jedoch nur eine Option, die sich der Gesamtpartei neben anderen auftäte. JÜRGEN DITTBERNER 3