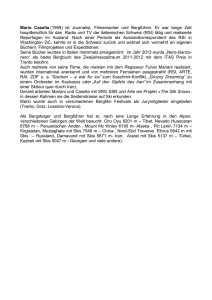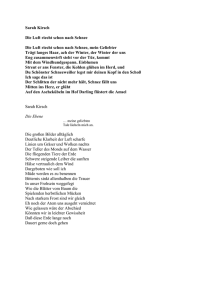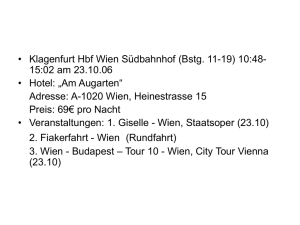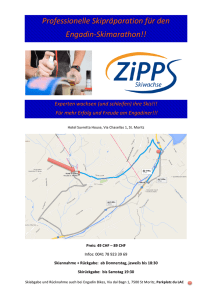Die Angst beim Bergsteigen - alpirando / bergsteigen und wandern
Werbung

Der Umgang mit der Angst beim Bergsteigen Walter Josi Bergsteigen gilt als Risikosportart. Allein in der Schweiz sterben jährlich über 100 Menschen bei genau dieser Tätigkeit. Sie werden von Steinen, Eisbrocken und Blitzschlag getroffen, sie stürzen in Gletscherspalten, über Felswände und Firnflanken, sie werden von Lawinen begraben oder sie verirren sich. Die Aufzählung ist unvollständig; wesentlich häufiger noch sind Unfälle mit Verletzungsfolgen und sogenannte Fast-Unfälle. Die Risiken beim Bergsteigen sind unbestreitbar höher als etwa beim Fussballspielen. Jeder Bergsteiger weiss das und nimmt dies mehr oder weniger bewusst in Kauf. Die meisten Bergsteiger üben diese Tätigkeit aus - nicht weil, sondern obwohl sie gefährlich ist. Die Faszination übersteigt eben die Angst vor dem Unfall. Ich unterscheide im folgenden zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Angst: eine objektiv begründbare einerseits und eine subjektive, irrationale Angst. Beide Formen begleiten den Bergsteiger ständig in seinem Planen und Tun. 1. Die objektiv begründbare Angst geht von dem oben skizzierten komplexen Bedrohungsszenario aus. Für diese Angst gibt es eigentlich kein passendes Wort. Ich spreche hier lieber von Furcht oder Respekt, aber beide Begriffe sind unscharf und nicht ganz zutreffend. Der Einfachheit halber spreche ich im folgenden von „Respekt“. - Er bewahrt mich vor falschen Entscheidungen und Draufgängertum. Dieser Respekt ist grundsätzlich positiv zu werten, wir können kaum zu viel davon haben. Er ist (über)lebenswichtig. Aus dieser Grundeinstellung begegne ich der Natur zurückhaltend, eben „respektvoll“; der Berg ist in jedem Fall stärker als ich. Darüber hinaus ist eine gewisse Systematik sehr hilfreich, um die Risiken einer Tour auf ein vernünftiges Mass zu reduzieren. Vorbereitung. Ich informiere mich über die aktuellen Verhältnisse (Wetter und Lawinen). Dank Internet stehen mir heute ausgezeichnete Grundlagen zur Verfügung, die mir eine detaillierte Prognose für die bevorstehende Tour ermöglichen. Ich informiere mich weiter über den genauen Wegverlauf mit Karte, Fotos und Routenbeschreibungen. Ich ergänze dieses Wissen mit Direktauskünften, allenfalls Rekognoszierung. Dank meiner Erfahrung kann ich diese Fülle von Informationen verarbeiten und einen Plan mit verschiedenen Varianten ausarbeiten. Der Faktor Mensch. Wo liegen meine Stärken, wo meine Schwächen? Wer kommt mit mir? Was darf ich meinen Gästen zumuten? Erarbeiten eines „Worst-Case-Szenarios“. Defensives Verhalten. Ich baue eine „Sicherheitsreserve“ ein, vor allem mit Gruppen. Redundanz sämtlicher Vorkehrungen: doppelt genäht hält besser. Training: ich bereite mich physisch und psychisch auf die geplante Tour vor. In einer Analyse nach der Tour vergleiche ich den Tagesverlauf mit meiner Planung. Wo hat es Ueberraschungen gegeben und warum? Habe ich die Probleme der Tour im Vorfeld richtig erkannt? - Eine weitere vorzügliche Weiterbildung sind Unfallberichte. So lernen wir mit der Zeit, uns im richtigen Moment zu „fürchten“, wann es Zeit ist weiter zu gehen und wann umzukehren. Diese Form von Angst ist einem tiefen und schönen Berg-Erlebnis überhaupt nicht abträglich, im Gegenteil. Es verhält sich ein bisschen wie in der Liebe: der respektvolle Umgang mit dem Partner „Berg“ beschenkt den Verliebten (und kann sein Leben retten). 2. Im Gegensatz dazu korreliert das subjektive Angstgefühl nicht zwingend mit der objektiven Gefährdung, oft ist es sogar gegenläufig. Dieses irrationale, metaphysische Gefühl überfällt uns plötzlich und oft scheinbar unmotiviert. Auch wenn ich beim Klettern einer überhängenden Stelle genau weiss, dass hier ein Sturz völlig harmlos wäre, bekomme ich unter Umständen schweissnasse Finger. Interessanterweise passiert mir das in freier Natur viel weniger als in der Kletterhalle. Kopf und Bauch sind nicht immer im Einklang. Andere Menschen werden von unerfindlicher Höhenangst geplagt oder halten plötzlich die Einsamkeit nicht mehr aus. Dieses unmittelbare Angstgefühl hat vielleicht letztlich mit einer tiefer liegenden, allgemeinen Lebensangst zu tun. Im Alltag verdrängen wir normalerweise den Gedanken an den eigenen Tod. Dabei ist nichts auf Erden so sicher wie genau dies. Wir alle werden sterben und zwar schon relativ bald, zumindest in absehbarer Zeit. Stell dir deine Lebenszeit anhand eines Sekunden-Zählwerks vor; bei deiner Geburt beginne dieser Count-down bei 10'000'000'000. Dieser Vorrat an Sekunden ist bei jedem Leser inzwischen schon mehr oder weniger geschrumpft. Aber niemand wird je erleben, wie dieses Zählwerk auf 0 stellt, ja mit Sicherheit wird niemand von uns die Zahl 1000'000'000 nur annähernd erreichen! - Der Tod ist in unserer Gesellschaft tabuisiert und ritualisiert. Dabei ist er im Hinterkopf immer irgendwie präsent. Doch diese Todes-Angst oder Lebens-Angst hilft mir überhaupt nicht, am Berg das Richtige zu tun. Wohl besser ist es, mich mit meinem Tod in ruhigen Momenten auseinander zu setzen und mit meinen philosophischen und spirituellen Ressourcen zu konfrontieren. Hier am Berg sind solche Gefühle absolut hinderlich. Der bewusste Umgang mit dieser unmittelbaren Angst ist nicht nur eine grosse Herausforderung; sie ist ohne Zweifel Teil der Faszination Bergsteigen. Sie lässt mich den Alltag vergessen und ganz auf das „hier und jetzt“ konzentrieren. Der bewusste Umgang mit dieser Angst schliesst deren Ueberwindung mit ein, ist aber weit mehr. Welche Stategien habe ich dabei als Bergsteiger und Bergführer? Wahrnehmung. Zunächst ist es wichtig, die Angst überhaupt wahr zu nehmen, bei meinen Gästen und bei mir selber. Angst haben ist nicht „cool“; dies äussert sich auf sehr verschiedene Weise. Die einen werden ganz still, vielleicht bleich, andere werden sehr redselig. Ernst nehmen. Angst kann man nicht wegdiskutieren. Das viel gehörte „Du musst keine Angst haben“ nützt dem Geängstigten überhaupt nichts. Ob jemand in einer Gruppe Angst aussprechen kann, hängt sehr stark vom Gruppenklima ab. Ich versuche als Leiter dies zu thematisieren, indem ich zum Beispiel eine Gruppe Anfänger beim Klettern frage: „Hat jemand Angst?“ Ich halte dann (vielleicht ganz allein) zögerlich meine Hand auf und sage „ich“. Jawohl ich habe Angst, dass jemand von uns herunterfällt und sich verletzt oder sogar stirbt. Klettern ist gefährlich; wir können aber das Mögliche tun, damit nichts passiert. Und damit bin ich am Anfang meiner Instruktion. Rational bleiben. In einer Situationsanalyse versuche ich die realen Gefahren zu erkennen. Ich erinnere mich an analoge Situationen und versuche das Richtige zu tun. Mit jedem Schritt gewinne ich die Sicherheit zurück. In der Gruppe informiere ich die Teilnehmenden stufengerecht über die aktuellen Risiken und schlage die nötigen Massnahmen vor. Wenn immer möglich, lasse ich den Rückzug offen. „Lieber für fünf Minuten ein Angsthase, als ein Leben lang tot“. Flow. Der amerikanische Psychologe Csikszentmihalyi hat diesen Begriff geprägt. In seinen zahlreichen Veröffentlichungen beschreibt er das sogenannte Flow-Erlebnis als einen Zustand höchster Konzentration und Glückseligkeit. Alles fliesst wie von selbst; Hunger, Durst, Müdigkeit und Angst sind weit weg, die Zeit scheint aufgehoben. Im krassen Gegensatz zum Rausch ist das Flow ein Zustand von sehr präziser Selbstkontrolle und Selbstwahrnehmung. Flow ist kein Dauerzustand. Es sind Glücksmomente, wie wir sie zum Beispiel in der Musik, im Tanz oder im Spiel wiederfinden. Beim Bergsteigen verbindet sich das Flow- mit einem ganzheitlichen Naturerlebnis. 3. Es gibt jedoch am Berg immer wieder Momente, wo das subjektive Angstgefühl mit der objektiv begründbaren Furcht zusammen trifft. Die objektiv gefährliche Situation wird dann auch subjektiv als gefährlich wahr genommen: der sogenannte Ernstfall. Die Angst zeigt ihr hässliches ungeschminktes Gesicht: „...Es war ein wunderbarer Wintertag, dieser 26. Januar 2001. Dabei verhiess die Wetterprognose eigentlich wenig gutes: sehr durchzogen, am Nachmittag einige Aufhellungen im Westen. Frühstück gab es deshalb erst um 8 Uhr, im Hotel Edelweiss. Eine klare Wintersonne flutete über die Grate des Val Ferret, welch eine Ueberraschung! Im Tal war es windstill; nur die kleine Schneefahne an der Tour Noir als Erinnerung an die stürmischen Vortage. Wie ich dieses Tal liebe! Ungezählte Tage habe ich sommers und winters hier schon verbracht. Ein „coming-home“ jedesmal. Schon bald ziehen drei fröhlich plaudernde Skitouristen von La Fouly auf der Langlaufloipe taleinwärts. Seit vielen Jahren darf ich Claudia und Bruno auf Skitouren begleiten. Wir sind Freunde geworden. Wir geniessen den herrlichen Morgen, die frisch verschneite Landschaft, das Knirschen des Schnees unter den Skis. Vor uns lockt die perfekte Silhouette der „Dotse“. Wir entscheiden uns jedoch nach einem kurzen Halt, dem urprünglichen Ziel dem „Petit Col Ferret“ treu zu bleiben. Das Lawinenbulletin meldet immerhin „erheblich“ oberhalb 2000 m. Wir wollen uns nicht durch das Wetter verführen lassen und auf der „sicheren Seite“ bleiben. Aufstieg durch unverspurten Neuschnee, welch ein Genuss. Ja es hat geschneit, aber weniger als erwartet, so etwa 20 – 25 cm dürften es sein, und kaum Triebschneeansammlungen auf dieser Höhe. Dabei ist es kalt, herrlich kalt in diesem viel zu warmen Winter. In einer Traverse spüren wir den harten Untergrund, die Skis wollen wegrutschen. Da auf der nächsten Kuppe tauchen wir unvermittelt ein in die Lichterflut der Morgensonne. Kurzer Halt: Sonnenbrille, Harscheisen, ein Schluck aus der Flasche und ... Entlastungsabstände! Vor der nächsten Geländekante ein Blick zurück: Claudia ist ca 20 m hinter mir, Bruno ist soeben gestartet. Der Schnee ist immer noch pulverig leicht, wird jedoch etwas tiefer, das Gelände ist leicht coupiert, mit kleinen Bäumen durchsetzt. Vorsichtig überquere ich die nächste Runse... als plötzlich das Schneebrett abreisst, kaum 2m über mir. Jetzt geht alles sehr schnell. Mein erster Gedanke, bergwärts abzuspringen und wegzutreten erweist sich als untauglich. Schon ist alles in Bewegung. Ich unterlasse den Versuch, erblicke aber gleichzeitig ein Bäumlein, keine 3m unter mir. Mit einem Sprung rette ich mich in diesen Baum in der Hoffnung, dass die Lawine unter meinen Skis weggleitet; doch der Baum ist dürr und bricht unter meiner Last. Mit viel Holz in der Hand lande ich in der Lawine und zwar ziemlich kopfvoran. Ich gerate in eine Rotationswalze, meine Skis werden nun zu verhängnisvollen Fesseln. Und plötzlich ist auch viel mehr Schnee um mich herum. Ich spüre einige harte Schläge in meiner Bauchgegend. Wann endlich kommt diese Lawine zum Stehen? Ich versuche mich einzukugeln, die Hände vor die Atemwege zu bringen. Aber immer neue Schläge verhindern eine Kontrolle über meinen Körper. Da endlich kehrt Ruhe ein. Ja ich bin noch bei Bewusstsein, fühle aber sehr heftige Schmerzen. Meine beiden Hände sind vor meinem Gesicht. Sie sind aber einbetoniert: Es gelingt mir nicht, sie auch nur einen Millimeter zu bewegen. Meine Lunge ist zusammengedrückt und es ist stockfinster. Aber atmen, ganz fein atmen, doch das kann ich noch. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich diese Situation erlebt habe. Nein ein Horrorerlebnis war es eigentlich nicht, oder nicht nur. Der Tod in den Bergen ist für mich nicht der Inbegriff des Schreckens, zu sehr gehört für mich der Tod auch zum Leben. Eine Grenzerfahrung mit Höhen und Tiefen, mit Schreckensmomenten und Durchblicken aber schon. Die ersten Momente stürzten mich in ein wahres Wechselbad der Gefühle. Zuerst war nichts anderes als der instinktive Ueberlebenswille. Mit dem gebrochenen Baum im Arm kam die Phase des Aufbegehrens: „was mir muss das passieren? auf dieser harmlosen Tour?“ dann des „Nicht-WahrhabenWollens“: das kann nicht sein, da komme ich doch raus. Aber ich kam nicht raus! Spätestens mit dem Stillstand in der Lawine wurde mir die ernste Lage richtig bewusst. Mein Ego kühlte sich ziemlich schnell ab und es folgte eine Phase des nüchternen Rechnens: ja, nun bist du wirklich verschüttet, du bist zwar verletzt aber du atmest noch. Es ist das einzige, was dir in dieser Situation helfen kann. Also begann ich mit meiner Zunge an einer Atemhöhle zu „schlecken“. Der Aktionsradius war ziemlich bald erschöpft: mit Hauchen versuchte ich diese Höhle etwas zu erweitern. Aber mit der Zeit schlich sie sich ein, die Angst, die Todesangst, dann Verzweiflung. Sie grinst mich an mit ihrer hässlichen Fratze, diese grauenvolle Angst. Ich schreie mehrmals aus Leibeskräften. Ich ersticke fast. Ja, ich werde jetzt hier sterben, in dieser lausigen Lawine. Mein ganzes Leben passiert im Zeitraffer vor mir. So vieles möchte ich noch gut machen. Dann die Resignation: So sterbe ich halt, jeder Mensch muss einmal sterben, ich bete... Dann wieder warten. Nein ich will leben. Meine Familie braucht mich noch. Ich denke an meine Lieben, an Freunde. Ich habe noch viel zu tun. Ich will leben, ich werde überleben. Sie werden mich finden mit meinem Barryvox. Habe ich es überhaupt eingeschaltet? Ja, ich erinnere mich an die LVS-Kontrolle am Bach heute morgen. Und fliegen können sie auch bei diesem Wetter. Warten und wieder warten, warum kommen sie nicht?.... und übrigens bin ich kurz eingeschlafen, ach ja die Unterkühlung. Und in die Hoffnung auf das Ueberleben mischt sich irgendwie eine tröstliche Gelassenheit, dass ich jetzt auch sterben könnte. Es ist nicht in meiner Macht. Langsam überschreite ich den Strom des Bewusstseins... Ja, und jetzt wird es wieder hell. Verschleiert erkenne ich wundervolle Farben: blaue, gelbe und rote Jacken und darin schemenhaft Gesichter, freundliche Gesichter, die mir zusprechen. Wieder Schlaf, dann noch das vertraute Rattern des Helikopters und ein wundervolles Gefühl des Weggetragen-werdens. Ich bin gerettet! Das Aufwachen auf der Intensivstation im Spital von Sion ist sehr sanft. Gedämpftes Licht, die ruhige und freundliche Stimme des Pflegers. Und da kommen sie schon, meine Liebsten: Barbara, Miriam und Rebecca. Wunderbar seid ihr da. Sie tönen sehr besorgt. Ich beruhige sie, mir geht es gut.“ Ich hatte Glück im Unglück. Bei nur „mässiger Lawinengefahr“ (unter 2000m) konnte ich nicht ahnen, dass unter dem Schnee in dieser Runse Wasser floss. Dieses war nicht nur Mitursache des kleinen Schneebretts, zusammen mit dem kalten Schnee (minus 11 Grad) bildete sich ein sogleich steinharter undurchdringlicher „Beton“. Trotz des geringen Ausmasses dieser Lawine (Breite 10 m), landete ich nach Kollision mit verschiedenen kleinen Bäumchen 2 m unter dem Schnee, unfähig richtig zu atmen und mit erheblichen inneren Verletzungen. Nach 70 langen Minuten wurde ich gerettet, blau im Gesicht und in bewusstlosem Zustand. Vor und während der Operation erhielt ich 16 Liter Blut und 8 Liter Plasma verabreicht. Kein Wunder erkannten mich meine Lieben kaum, mit meinem aufgedunsenen Kopf. Zum Glück war meine Kerntemperatur auf 27 Grad abgesunken, ich wäre wohl sonst erstickt und verblutet. Dank dem goldrichtigen Handeln meiner Gäste, dank moderner Medizin und Rettungstechnik, aber noch vielmehr dank einer göttlichen Vorsehung durfte ich diesen Unfall überleben.