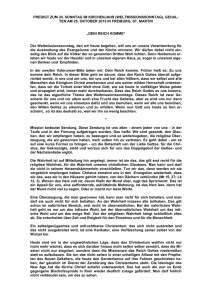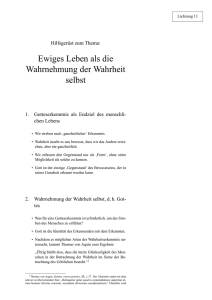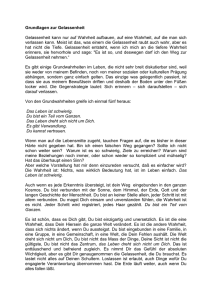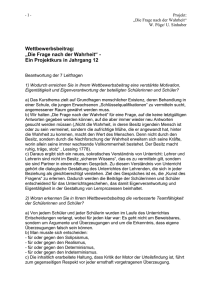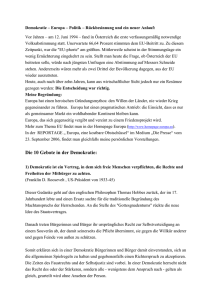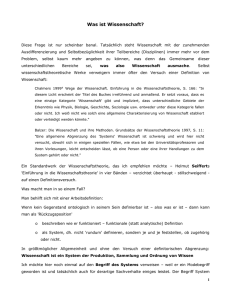1.1 Was bedeutet "Wissen"? / 1.2 Das Problem der "Wahrheit"
Werbung

1.1 Was bedeutet "Wissen"? Lassen wir uns bei unserer Annäherung an die Bedeutung von "Wissenschaft" zunächst ganz naiv vom Wortsinn leiten, so geht es in der Wissenschaft offensichtlich um Wissen. Nun kann "Wissen" aber einmal als Hauptwort (Substantiv) zum anderen als Tätigkeitswort (Verb) verstanden werden. Dies macht sofort einsichtig, daß auch "Wissenschaft" üblicherweise in doppelter Bedeutung gebraucht wird, nämlich (a) einmal für das "Wissen" (also eine Menge von Sätzen) selbst, zum anderen (b) für das (systematische) Unterfangen, zu solchen Sätzen zu kommen z.B. indem spezifische Erfahrungen so systematisiert werden, daß bestimmte Sätze über Sachverhalte ausgesagt werden können, oder indem mit solchen Sätzen operiert wird, diese verbreitet werden etc. Zu beiden Bedeutungen je ein Definitions-Beispiel aus klassisch-populären Werken: a) "Wissenschaft, Gesamtheit des Wissens; nach Gebieten oder Lehrsätzen systematisch geordnete Erkenntnis oder Kenntnis mit dem methodischen Streben ihrer Erweiterung." (Knaurs Lexikon, 1951) b) "Wissenschaft ist Forschung und Lehre in allen Gegenstandsbereichen. Forschung ist geistige Tätigkeit einzelner oder von Gruppen mit dem Ziel, in methodischer, systematischer und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen. Lehre ist Darstellung der Ergebnisse und Methoden der Forschung mit dem Ziel, fachliches Wissen zu vermitteln und zu wissenschaftlichem Denken zu erziehen." (Der neue Brockhaus 1971) Diese beiden Definitionen können uns dazu dienen, einführend einige klärende Fragen aufzuwerfen: Ist denn Wissenschaft "die Gesamtheit des Wissens", wie (a) behauptet? Immerhin weiß ich, daß meine Tante Emma mir vorgestern einen Brief geschrieben hat und mir darin erzählt, daß ihr Bruder Paul in den Alpen Urlaub macht. Ist mein Wissen um diesen Brief, mein Wissen von Onkel Pauls Urlaub also, ein Teil "der Wissenschaft", und ist der Brief damit ein wissenschaftliches Dokument? Oder nehmen wir den Bäcker, der mir gegenüber wohnt: Er weiß viel darüber, wie man Brot macht und noch so einiges mehr, wahrscheinlich hat er selbst einiges ausgetüftelt, was seine Arbeit effektiver macht. Ist das alles Wissenschaft? Diese Fragen würden wir zunächst "selbstverständlich" verneinen: Solche Tätigkeiten und ihre Ergebnisse sowie ein solches Wissen werden wir nicht zur Wissenschaft zählen. Aber so einfach, wie es scheint, ist die Grenzziehung keineswegs. Was wäre nämlich, wenn sich plötzlich herausstellte, daß Tante Emma Jahrzehnte unter Pseudonym Literatur veröffentlicht hat; oder wenn Onkel Paul in den Alpen ein Attentat auf den Staatschef von X begeht? Dann rücken beide ins Licht des öffentlichen Interesses und der Brief, sowie die darin geschilderten Sachverhalte können für Literaturwissenschaftler oder Politikwissenschaftler mit herangezogen werden, werden also zum Gegenstand wissenschaftlichen Handelns (damit sind sie allerdings noch keine Wissenschaft). Aber warum muß es sich denn um spektakuläre Geschehnisse handeln? Könnte es nicht gerade aus psychotherapeutischer Sicht auch interessant sein, die Lebensgeschichte von Tante Emma zu rekonstruieren, in der vielleicht dieser Brief eine wichtige Rolle spielt? Eine solche Rekonstruktion wäre allerdings nicht wissenschaftlich interessant, wenn es wirklich nur um Tante Emma, als diese einmalige Person, ginge - sondern nur dann, wenn Tante Emmas Lebensgeschichte irgendwie typisch oder zumindest exemplarisch für etwas Allgemeines wäre, was mit der Rekonstruktion gezeigt werden soll (z.B. die Beziehung zwischen der Lebensgeschichte und der Entwicklung von Krebs oder bestimmten Wahnbildern). Ebenso kann natürlich das Wissen des Bäckers von gegenüber und das, was er sich ausgetüftelt hat, für Arbeitsmediziner oder für Organisationspsychologen etc. von hohem Interesse sein, und Basis für wissenschaftliche Erkenntnisse werden - aber wohl nur dann, wenn sich daraus irgend etwas für andere ableiten läßt. Diese Argumentation zeigt, daß Wissen in einem bestimmten Zusammenhang mit allgemeinen Problemen stehen muß und auf eine bestimmte Weise erfaßt und aufbereitet sein muß, um als Wissenschaft zu gelten. Was nun, um auf die zweite Definition einzugehen, wenn der Bäcker seine neuen Erkenntnisse, die er ausgetüftelt hat, in methodischer, systematischer Weise gewonnen hat, und wenn er dieses Wissen, z.B. über besonders schmackhafte Brotsorten, auf Notizzetteln so festgehalten hat, daß jeder diese Rezepte nachprüfen kann? Oder was wäre, wenn ein Eremit in den Bergen auf geniale Weise, durch systematisches, methodisches Nachdenken Wissen erworben hat, das er prinzipiell jedem auch zur Nachprüfung vermitteln könnte - wenn nur jemand käme, und ihn fragen würde? Auch bei diesen Beispielen würden wir uns wohl weigern, bereits von "Wissenschaft" zu sprechen. Einerseits ist die Frage der "Schmackhaftigkeit" wohl eher Ansichtssache (was noch deutlicher wäre, wenn der Bäcker über seine Gefühle beim Brotbacken geschrieben hätte), andererseits sind Notizzettel, oder das Wissen im Kopf das Eremiten, keine akzeptablen Formen, um die Bezeichnung "Wissenschaft" zu vergeben. Aber auch diese Zuordnung würde sich ändern, wenn der Bäcker seine Erkenntnisse in Bezug zu "einschlägigen" Fragestellungen bringt (z.B. "Schmackhaftigkeit" in Relation zur Verdaubarkeit, oder in Relation zur Kauffreudigkeit der Kunden etc.), hierzu systematisch Befunde gesammelt hat und diese in "einschlägigen" Fachzeitschriften publiziert. Analoges gilt für den Eremiten. Ob etwas im Rahmen von Wissenschaft als "Wissen" angesehen werden kann, hängt somit nicht nur vom Wissen in den Gehirnen einzelner oder mehrerer ab, sondern auch von den Formen, in denen dieses Wissen niedergelegt und seine Entstehung dokumentiert ist, ferner aber auch von dem Bezugsrahmen, in dem es verwendet werden kann. Dies läßt sich gut anhand einer Kritik von Georges Devereaux (1984: 27) an einer Untersuchung von Gebhard u.a. (1958) verdeutlichen: Gebhard u.a. hatten, gestützt auf die Daten des bekannten "Kinsey Reports" (eine großangelegte amerikanische Umfrage über männliches und weibliches Sexualverhalten), versucht, wissenschaftlich zu belegen, daß "Abtreibung nicht traumatisierend wirkt". Devereaux wendet m.E. zu Recht ein, daß diese Aussage (unabhängig davon, ob sie richtig oder falsch sei) keine wissenschaftliche Aussage über den behaupteten Untersuchungsgegenstand sei. Die Daten beziehen sich nämlich darauf, wieviele Frauen sagten (und/oder glaubten) daß eine Abtreibung sie im psychologischen Sinne nicht traumatisiert habe und wieviele dies nicht sagten (und/oder glaubten). Devereaux argumentiert nun, daß der entscheidende Irrtum darin liegt, "daß die Autoren es versäumen anzugeben, zu welchem Universum des Diskurses ihre Daten gehören. Sie nahmen an, daß ihre Daten ins Feld der Psychiatrie gehörten, während sie in Wirklichkeit aufgrund der einfachen Tatsache, daß keines ihrer Objekte eine gültige psychiatrische Selbstdiagnose stellen, ins Feld der Meinungsforschung gehörten. Daher registrierten die Autoren in dieser Hinsicht nichts, was auch nur entfernt zu dem Thema gehörte, das zu untersuchen sie vorhatten". Devereaux bestreitet nicht, daß es sich um ein durchaus interessantes Ergebnis der Meinungsforschung handelt. Wir sehen aber an diesem Beispiel, wie sehr man aufpassen muß, worüber man spricht und was das "Wissen" wirklich bedeutet: Etwas über die Meinungen der befragten Frauen auszusagen, wäre korrekt gewesen, hierzu liegt das "Wissen" vor; etwas über Traumatisierungen auszusagen, war hingegen Unsinn (wenn auch selbst in wissenschaftlichen Abhandlungen solche Fehler man spricht von Artefakten, vgl. Kap. 5.4 und 6.4 - vorkommen, und in der populären Aufarbeitung von wissenschaftlichen Ergebnissen leider sogar typisch sind). Im Rahmen von Wissenschaft entsteht Wissen durch einen typischen Erfahrungsprozeß, der sich von der Alltagserfahrung insbesondere in folgenden 4 Aspekten unterscheidet: a) Spezifische Fragestellungen: Die Frage nach dem Verhalten von Metallen im Zusammenhang mit Säuren oder der Erwärmung eines Drahtes im Zusammenhang mit dem elektrischen Strom sind für den Sozialwissenschaftler (in dieser Rolle) in der Regel uninteressant - im Gegensatz zur Frage der Interaktion zwischen Menschen und zwischen sozialen Systemen, deren Einfluß auf Wahrnehmung, Denken, Verhalten, die Genese pathologischer Formen, usw. Vice versa gilt entsprechendes für den Physiker oder den Chemiker. Das bedeutet gleichzeitig, daß der Wissenschaftler entsprechend seiner Disziplin für die Behandlung der aufgeworfenen Fragen eine ganz spezifische Wirklichkeit konstituiert: für die Psychologen gehören z.B. "Übertragung" und Abwehrmechanismen" oder "Triangulation" und "Joining" zur professionellen Realität. Für die Konstitution dieser spezifischen Realität benötigt man zunächst: b) Spezifische "Interaktionsinstrumente": Die Schnittstelle, an der der Alltagsmensch mit seiner Umwelt in Kontakt tritt, sind seine Rezeptoren in Auge, Ohr etc. Für unser naturwissenschaftlich-technisch beeinflußtes Weltbild scheint es selbstverständlich zu sein, daß Wissenschaft insbesondere auf einer technischen Weiterentwicklung solcher "Interaktionsorgane" zu "Interaktionsinstrumenten", bzw. der Erschließung völlig neuer Wirklichkeitsbereiche durch solche Instrumente beruht: Mikroskop und Fernrohr als technologische "Verbesserungen" des Auges, Mikrophon und Verstärker als "Ergänzungen" zum Ohr, Elektronensynchrotons (=riesige Elektronen-Beschleuniger), um mit Elementarteilchen "in Kontakt zu treten", Reagenzien zur "Interaktion" mit den Gebilden der Chemie etc. Der Psychologen verwendet aber für die Untersuchung seiner Fragestellung in der Regel nicht technische Apparate der Naturwissenschaftler sondern spezifische, seinem Untersuchungsgegenstand angepaßte Fragebögen, Beobachtungsschemata, ggf. sogar experimentelle Instrumente insbesondere aber auch seine natürlichen, für das Alltagsleben geeigneten Sinnesorgane (z.B. bei Beobachtungen von Therapieabläufen, bei sozialen Experimenten, oder für die Inhaltsanalyse von Dokumenten). Denn für ihn ist ja gerade das Alltagsleben ein zentraler Bereich vieler seiner Fragestellungen. Das bedeutet aber keineswegs, daß seine Fragestellungen identisch mit den Fragen des Alltags wären, noch daß er diese mit Methoden der alltäglichen Lebensbewältigung bearbeiten würde. Vielmehr "sieht" er seinen Gegenstandsbereich durch die Brille seiner Fragen, Methoden und Begrifflichkeiten und Theorien - und diese kognitive "Brille" gehört zu seinen o.a. spezifischen "Interaktionsinstrumenten". Es wird, im übertragenen Sinne, nicht mit den Augen des Alltags "gesehen", sondern z.B. mit den Augen des Kategoriensystems. Mit den spezifischen Fragestellungen und den dafür spezifischen "Interaktionsinstrumenten" sind verbunden: c) Spezifische Handlungsmuster: Die wissenschaftsspezifischen "Interaktionsinstrumenten" müssen adäquat und sinnvoll eingesetzt werden - und dieses "sinnvoll" meint natürlich nicht den Sinn, der schon in der Alltagswelt vermittelt wurde. Denn auch die Instrumente des Psychotherapieforschers z.B. gehören kaum dieser Alltagswelt an. Daher erfordert deren adäquater Einsatz auch typische Handlungsmuster. Zu diesen Handlungsmustern gehört dann aber auch die systematische Planung und Organisation dieser Erfahrung: Eine wissenschaftliche Befragung besteht eben nicht darin, daß Tante Emma, Onkel Fritz oder einige Leute, die man zufällig auf der Straße trifft, angesprochen werden. Bei der Fixierung bzw. Dokumentation der Erfahrung, bei ihrer Aufbereitung, Zusammenstellung, weiteren Bearbeitung (z.B. mittels statistischer Modelle), bei der Ergebnispräsentation, der Argumentation und der Distribution (z.B. mittels wissenschaftlicher Zeitschriften) sind ebenfalls bestimmte Handlungsmuster zu berücksichtigen, die nicht der Alltagswelt entstammen. Der Sinn dieser Handlungsmuster wird von der Gemeinschaft der Wissenschaftler (insgesamt oder einer bestimmten Fachdisziplin oder innerhalb noch kleinerer Gruppen), der "scientific community" ebenfalls von Generation auf Generation weitergegeben. Dabei ist die Bezeichnung "Generation" hier ebenfalls nicht als Alltagsbegriff zu verstehen noch bezieht sie sich auf das "übliche" Leben - von der biologischen Geburt bis zum biologischen Tod. Sondern der Begriff bezieht sich auf das "wissenschaftliche" Leben, für das in unserer WissenschaftsKultur in der Regel das Studium die Sozialisationsphase und z.B. die Promotion den entscheidenden Initiationsritus (=Aufnahmeritus als "Gleichwertiger" in eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe - hier eben die "scientific community") darstellt. Im Zusammenhang mit diesen spezifischen Handlungsmustern stehen nun wieder: d) Spezifische Sprache und Wissensbestände: Die wissenschaftliche Erfahrung innerhalb einer Disziplin ist, wie klar geworden sein dürfte, von der Alltagserfahrung sehr verschieden. Um über diese Erfahrung reden zu können, um der Folgegeneration deren Sinn zu vermitteln oder um klare Handlungsanweisungen geben zu können, bedarf es daher offensichtlich auch einer spezifischen Sprache. Man stelle sich nur vor, man wollte über Ergebnisse an einem Elektronensynchrotron in der Alltagssprache kommunizieren: Man könnte fast kein Teil, keine Beobachtung benennen, geschweige denn Zusammenhänge beschreiben und anderen, für ähnliche Versuche, mitteilen. Hier zeigt sich auch schon, daß offensichtlich die Mathematik eine besondere Fachsprache ist, um bestimmte Zusammenhänge kurz und präzise darzustellen und, gerade im technischen Bereich, exakte Handlungsanweisungen geben zu können. Auch die wissenschaftliche Sprache hat also insbesondere die Verständigung über diese spezifischen Erfahrungen zu gewährleisten, die Kommunikation sicherzustellen und damit gemeinsames Handeln zu ermöglichen. Der gesamte Prozeß vollzieht sich dabei vor dem Hintergrund (fach-)spezifischer Wissensbestände, zu deren Vermehrung, Erprobung und Veränderung das gesamte soziale Unternehmen "Wissenschaft" durchgeführt wird. 1.2 Das Problem der "Wahrheit" Wenn man Menschen unterschiedlicher Ausbildung danach fragt, welche Eigenschaften denn das Wissen haben soll, das im Rahmen der Wissenschaft erworben wird, so wird man als einen zentralen Aspekt sinngemäß hören, daß es darum ginge, zunehmend die Wahrheit über diese Welt zu entdecken. Beginnen wir die Diskussion dieser Vorstellung mit dem Wort "entdecken": Von der Wortbedeutung ausgehend steht dahinter die Sichtweise, daß "etwas" bereits da-ist (wenn auch verdeckt), das nur ent-deckt werden muß. Ähnlich, wie man ein Kind aufdeckt, das verborgen unter einer Decke schlummert. Und dieses bereits Da-Seiende ist in diesem Zusammenhang offenbar die "Wahrheit" (über die "Wirklichkeit"). Dieser "substantivistische" Wahrheitsbegriff (wie er in der Fachsprache der Philosophie treffend heißt) unterstellt also, daß es "Wahrheiten an sich" gibt, die zwar erkannt und ausgesagt werden können, die aber auch ohne eine solche Erkenntnis so da-sind, denen die Erkenntnis also nicht wesentlich ist. Das "Entdecken" hat sogar unmittelbaren Bezug zu der Übersetzung des griechischen Begriffes für Wahrheit "aletheia", der schon Anfang dieses Jahrhunderts von dem Wissenschaftsund Naturphilosophen Nicolai Hartmann (1882-1950) als "Entbergung" übersetzt wurde (andere Übersetzungen sind: Offenbarung, Unverborgenheit). Diese Übersetzung kommt der obigen Auffassung offensichtlich sehr nahe - so gibt es denn auch nach Hartmann "echte Erkenntnis einer realen Welt". Dennoch zeigt die ausgedrückte Beziehung "Wahrheit über diese Welt" in der obigen Aussage, daß sich nach üblichen Vorstellungen die Wissenschaft sich auf eine wie immer geartete "Welt" oder "Wirklichkeit" beziehen solle, und es daher nicht um "Wahrheit" allein gehen könne. Es findet sicher auch Konsens, daß diese "Welt" oder "Wirklichkeit" nicht per se "wahr" oder "falsch" sein kann (dabei ist es hier noch gleichgültig, wie wir "Welt" oder "Wirklichkeit" verstehen). Der Tisch kann nicht "wahr" sein. Auch die - angenommene Tatsache (oder der Sachverhalt) , daß der Tisch im Zimmer steht, kann nicht "wahr" sein: Der Tisch ist so, wie er ist, und ein Sachverhalt verhält sich eben so, wie er sich verhält - der es liegt eben ein anderer Sachverhalt vor. "Wahr" (oder "falsch") kann nur eine Aussage über eine Tatsache sein, also z.B. die Aussage: "der Tisch steht im Zimmer". Wenn der Tisch nun "tatsächlich" nicht im Zimmer steht, so ist nicht irgendein Sachverhalt "falsch", sondern der Sachverhalt ist dann eben, daß der Tisch nicht im Zimmer steht. Hingegen wäre die Aussage, "der Tisch steht im Zimmer" dann falsch. Man beachte aber, daß die Aussage: "die Tatsache, daß der Tisch im Zimmer steht, ist falsch" selbst weder falsch noch richtig sein kann, sondern schlicht sinnlos ist. Abgesehen vom rein substantivistischen Wahrheitsbegriff, der meist auf den religiösen bzw. mystischen Bereich beschränkt ist (und als Substanz eben auch als Mehrzahl auftreten kann: "Es gibt Wahrheiten"), kann Wahrheit also nur eine Eigenschaft von satzförmigen Aussagen sein (und kann daher auch nur im Singular "Wahrheit" auftreten). In der obigen Aussage ist "Wahrheit über die Welt" also durch "wahre Sätze über die Welt" zu ersetzen bzw. zu präzisieren. Und es schein wenig Probleme zu machen, die Wahrheit dieses Satzes festzustellen z.B. indem man sich ins fragliche Zimmer begibt und einfach nachsieht. Doch so einfach ist es mit Wahrheit leider nicht: Denn die Erörterung eben zeigte bereits, daß grundsätzlich zu unterscheiden ist zwischen a) dem Sachverhalt selbst, (hier z.B.: der Tisch steht im Zimmer) b) der Aussage über diesen Sachverhalt (hier der Satz: "Der Tisch steht im Zimmer") und c) der Beziehung zwischen (a) und (b) Die Frage, die durch (c) aufgeworfen wird, wie also die Beziehung zwischen einer Aussage über einen Sachverhalt und diesem Sachverhalt selbst ist, wird als Kernfrage der Wahrheitstheorien bezeichnet. Die wichtigsten Beantwortungsvorschläge (oder Klassen solcher Vorschläge) sind dabei die folgenden: i) Korrespondenztheorie: Sie geht davon aus, daß Wahrheit in einer Übereinstimmung zwischen Aussage und Sachverhalt besteht. Das Hauptproblem aber ist, daß sich (a) und (b) auf völlig verschiedenen Ebenen befinden. So ist ein brauner Tisch (a) wohl fraglos etwas anderes als ein Satzgebilde (b) über diesen Tisch ("Der Tisch ist braun"). Was also soll "Übereinstimmung" heißen? Ist dies nicht selbst wieder eine Aussage, nämlich der Form: "Zwischen dem Sachverhalt, daß der Tisch braun ist, und der Aussage: 'Der Tisch ist braun' besteht Übereinstimmung." Nun müßte man aber wiederum die Wahrheit dieser Aussage wiederum feststellen - ein Prozeß, der ohne Ende so weiter ginge. Völlig unklar ist auch, welcher Sachverhalt eigentlich mit der Aussage "Der Tisch ist nicht braun" (und allen anderen Negationen auch) "korrespondieren" soll - so fragt schon Ludwig Wittgenstein: "Gibt es negative Sachverhalte?" Ein weiterer Kritikpunkt wäre, daß Wahrheit als Übereinstimmung etwas Endgültiges suggeriert. Dies widerspricht aber nicht nur der Wissenschaftsgeschichte, in der sich "Wahrheiten" immer wieder als "falsch" erwiesen haben oder doch zumindest bezweifelt worden sind. Auch handelt man sich damit die Beweislast ein, daß für eine einmal festgestellte Übereinstimmung nun für alle Zeiten kein begründeter Zweifel mehr möglich sein wird. ii) Kohärenztheorie: Sie verlegt die Wahrheit einer Aussage in die Übereinstimmung (=Kohärenz) bzw. Widerspruchsfreiheit mit allen möglichen Aussagen innerhalb eines logischaxiomatischen Systems. Die "Wirklichkeit" bzw. die "Welt" ist das Gesamt möglicher Aussagbarkeiten. Damit wird zwar die Feststellung der Übereinstimmung möglich, aber zum einen können die Axiome (Voraussetzungen) des Systems selbst nicht dem Wahrheitskriterium unterzogen werden, zum anderen sind mehrere Systeme denkbar, die jeweils in sich kohärent sind, zwischen denen aber dennoch Widerspruch besteht (was die meisten abendländischen Wissenschaftler nicht akzeptieren würden, obwohl sich gerade in dieser Hinsicht neuerlich ein deutlicher Trend abzeichnet, östlichen Philosophien folgend, Widersprüche zwischen in sich kohärenten Aussagensystemen "auszuhalten" - sie quasi als unterschiedliche aber gleich akzeptable Perspektiven auf den gleichen Betrachtungsgegenstand aufzufassen). iii) Konsenstheorie: Sie verlegt Wahrheit in die Übereinstimmung - den Konsens zwischen allen, die dieselbe Sprache sprechen und hinsichtlich des behaupteten Sachverhaltes kompetent sind. Hier wird Wahrheit am stärksten von den drei Ansätzen mit dem Geltungsanspruch zusammengebracht, der nur in der argumentativen Diskussion - dem Diskurs - eingelöst werden kann. Problematisch ist hier allerdings, wie ein "Konsens" letztlich festgestellt werden kann, bzw. ob im Falle des Anzweifelns eines solchen, über die Frage, ob nun ein "Konsens" vorliegt oder nicht, wieder ein Konsens herzustellen wäre - und so ohne Ende. Ein ähnlicher Kritikpunkt mündet in die Frage, wer eigentlich die "Kompetenten" sind, die entscheiden, ob jemand "kompetent" für den Diskurs ist - und wer entscheidet wieder über deren Kompetenz, bzw.: wie wird hier ein Konsens über die Kompetenz hergestellt? In jeder der drei Gruppen von Wahrheitstheorien gibt es wieder unterschiedliche Ansätze und Sonderformen. Auch besteht keineswegs Einigkeit bei Philosophen hinsichtlich der obigen Aufteilung (so ist z.B. die pragmatistische Wahrheitstheorie des Psychologen W. James: "Wahr ist, was sich bewährt", kaum in dieses Schema einordbar). Es dürften aber zumindest einige Grundfragen und Probleme deutlich geworden sein. Übereinstimmung besteht jedenfalls bei allen obigen Positionen, daß Wahrheit keine Eigenschaft von Dingen sondern von Sätzen ist, daß Wahrheit an Erkenntnissubjekte (Menschen) gebunden ist und - ganz offenbar schon wegen der Sätze - mit Verständigung zwischen diesen Menschen zusammenhängt. Mit dieser Feststellung, daß "Wahrheit" sich nur auf satzförmige Gebilde beziehen kann und von der Verständigung zwischen den Sprechern abhängt, wird für die Wissenschaft die soziale Ebene bedeutsam. Ein solcher Bezug auf soziale Konventionen reduziert aber den Anspruch mancher Wissenschaftler, ihre Forschung "objektiv" in dem Sinne durchzuführen, daß möglichst nur "die harten Fakten" und weniger so unklare Gebilde wie "soziale Übereinkünfte" eine Rolle spielen sollen. Wenn aber letztlich eine wissenschaftstheoretisch einwandfreie Korrespondenz zwischen Sprache (Theorie) und Sachverhalt nicht möglich ist, so müssen theoretisch-empirische Aussagen einerseits zunächst auf die Ebene möglicher Erfahrungen transformiert werden (Transformation 1)- etwa in Form von Prognosen über Erfahrungen, die unter bestimmten Bedingungen (besonders auch: bestimmten BeobachterHandlungen) eintreten sollten. Im Beispiel mit dem Tisch wäre die Prognose, daß jemand, der sich in den fraglichen Raum begibt, diesen Tisch wahrnehmen müßte. Hierbei stellt sich u.a. als Methodenproblem die Frage, ob die (zunächst ebenfalls auf der sprachlichen Ebene abgeleiteten) Bedingungen, unter denen die Erfahrungen auftreten, einerseits adäquat verstanden und in Handlungsoperationen umgesetzt werden. Andererseits muß das Erfahrene auf die Ebene der Sprache rücktransformiert werden (Transformation 2) werden, wobei sich u.a. das Problem der Glaubwürdigkeit stellt. Beim "Tisch im Zimmer" ist dies wohl weniger ein Problem. Was aber sind die Bedingungen, unter denen bestimmte physikalische Erfahrungen prognostiziert werden - oder, problematischer noch, unter denen bestimmte transpersonale Erfahrungen gemacht werden können? Wie stellt man fest, ob Patient A "eine Schizophrenie hat"? Offenbar liegt die einzige Möglichkeit, diese Kluft zwischen Sprache und Erfahrung zu überwinden in der Zuflucht zu so "unempirischen" und "unwissenschaftlichen" Aspekten wie "Vertrauen" in die "Kompetenz" und "Glaubwürdigkeit" der Forscher. Dies darf als ein schmerzlicher Schnitt in die scheinbar so glatte Oberfläche "harter Wissenschaft" angesehen werden. Denn mit den beiden notwendigen Transformationen zwischen der Sprach- und der Erfahrungsebene wird Wissenschaft untrennbar mit menschlichen Handlungen verbunden. Natürlich kann man die erstere Transformation elegant mit der Forderung nach "systematischer Methodik" und letztere mit der nach "intersubjektiver Nachprüfbarkeit" versehen. Dennoch können auch solche Begriffe nicht darüber hinwegtäuschen, daß diese Transformationen weit entfernt von jeder Algorithmisierbarkeit sind (d.h. fernab von formal faßbaren oder zumindest in eindeutige Regeln gießbare Vorgehensweisen). De facto ist der Grund, warum man Professor K eine bestimmte Forschungsaufgabe überträgt und nicht dem kleinen Fritz, daß letzterer möglicherweise viel zu "schlampig" und "unsystematisch" arbeitet, viel zu "unerfahren" ist, etc. Andererseits vertraut man K, daß er seine Erfahrungen wahrheitsgemäß berichtet - dazu gehört neben der Vermeidung wissentlicher/ unwissentlicher (Ver-)Fälschung auch z.B. eine angemessene sprachliche (ggf. z.B. formal-sprachliche) Repräsentation und Interpretation seiner Erfahrung. Unabhängig davon, ob eine (empiriebezogene) Theorie also "eigentlich" richtig ist und unabhängig von den konkreten Erfahrungen, kann ein Scheitern der Überprüfung dieser Theorie im Einzelfall allein schon durch die eine, die andere oder beide beschriebene Transformationen verursacht werden. Zwar gibt es Regeln, hier allzu unangenehme Pannen einzudämmen - z.B. "Replikation" (d.h. Wiederholung) gerade bei unerwarteten Ergebnissen. Doch einerseits setzt die praktische Bedeutung des Begriffes "unerwartet" voraus, daß elaborierte Theorien über das Erwartete vorhanden sind (das dürfte für die Physik in großen Teilen der Fall sein, für die Human- und Sozialwissenschaften, also auch die Psychotherapie, hingegen kaum). Andererseits werden systematische Fehler in der Forschungsgemeinschaft (die sich also ebenfalls replizieren) hiervon kaum berührt. Wissenschaft - und damit verbundene Aspekte wie "Wahrheit", "Erfahrung", "Erkenntnis", etc. - haben somit nur Sinn in Bezug auf sozial interagierende Erkenntnis-Subjekte. Wissenschaft im heutigen Sinne ist zudem ohne die "Wissenschaftler-Gemeinschaft" ("scientific community") bzw. "Forscher-Gemeinschaft" ("community of investigators") und ihren akzeptierten Fragestellungen, Lösungs-Methoden sowie Interaktions-Gewohnheiten (z.B. spezifische PublikationsOrgane) nicht denkbar. Man mag darin auf den ersten Blick eine Schwächung gegenüber einer vom Funktionieren der Sozialgemeinschaft unabhängigen "objektiven" Wissenschaft sehen. Man sollte sich aber klarmachen, daß ein EinzelIndividuum seine Erfahrungen nicht als Wissen fixieren oder diese auch nur thematisieren: Wie der Soziologe Niklas Luhmann (1971:52) zu Recht herausarbeitet, würde nämlich überhaupt keine Erkenntnis möglich sein - d.h. eine "Distanzierung des unlösbar in seinem Erleben lebenden Subjekts von seinen Erlebnisinhalten" - wenn alle Menschen (und Forscher) die Welt auf identische Weise erfahren würden. Erst die Erfahrungsunterschiede schaffen die Perspektiven, die von rein subjektiven Sinnstrukturen abstrahieren und damit gemeinsam intendiertes Handeln gegenüber einer als intersubjektiv verstandenen Außenwelt ermöglichen. Oder, frei nach Berger & Luckmann (1970:11), der Gegenstand der Erkenntnis wird fortschreitend deutlicher erst durch die Vielfalt der Perspektiven, die sich auf ihn richten. Die extremste Formulierung zur Intersubjektivität der Wahrheit und Erkenntnis hat wohl Charles S. Peirce (18391914), der Begründer des "Pragmatismus" gegeben: "Individualismus und Falschheit sind ein und dasselbe." Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen erscheint es allerdings angemessener zu sagen: Dem Einzel-Individuum würde sich die Frage nach "Wahrheit" oder "Falschheit" nicht stellen; sie wäre sinnlos, da, wie eben gesagt, ein solches EinzelIndividuum in der Unmittelbarkeit seines Erlebens verhaftet bliebe und somit keine Trennung zwischen unmittelbarer Erfahrung und Erfahrenem möglich wäre. Es sei betont, daß dieser Argumentation natürlich ein ganz bestimmtes Wissenschaftsverständnis zugrunde liegt, das weder im Detail von allen geteilt wird, noch historisch gesehen immer so war. 3.4 Exkurs zum Verhältnis von Psychotherapie und Wissenschaft Wissenschaftler haben mit Psychotherapeuten gemeinsam, daß sprachliche Kommunikation zu den zentralen Bestandteilen ihrer Tätigkeit gehört - weit mehr als es bei Handwerkern, Kraftfahrern oder Bauern der Fall ist. Gleichwohl ist die erkenntnisleitende Blickrichtung, unter der (professionell) Welt erfahren und zu sprachlicher Kommunikation verarbeitet wird, zwischen Wissenschaftlern und Psychotherapeuten gemeinhin völlig gegensätzlich: Wissenschaft, so wird gesagt, habe den Blick auf Gesetzmäßiges, Prognostizierbares und auf mögliche Gemeinsamkeiten in den Phänomenen zu richten, und damit von der Individualität und der Einmaligkeit der Abläufe in dieser Welt zu abstrahieren. So betonte z.B. Wolfgang Pauli, PhysikNobelpreisträger und einer der führenden (wenn nicht gar der) Quantentheoretiker seiner Zeit, in der Einleitung zu einem Symposium anläßlich des Internationalen Philosophenkongresses in Zürich 1954: "Ich behaupte nicht, daß das Reproduzierbare an und für sich wichtiger sei als das Einmalige, aber ich behaupte, daß das wesentlich Einmalige sich der Behandlung durch naturwissenschaftliche Methoden entzieht. Zweck und Ziel dieser Methoden ist es ja, Naturgesetze zu finden und zu prüfen, worauf die Aufmerksamkeit des Forschers allein gerichtet ist und gerichtet bleiben muß". Dieser Sichtweise würden wohl auch heute noch nicht nur viele Naturwissenschaftler, sondern auch Geistes- und Sozialwissenschaftler überwiegend zustimmen. Im Gegensatz dazu haben Psychotherapeuten immer einen einzelnen Menschen (oder ein Paar, eine Familie) vor sich, ausgezeichnet durch eine individuelle Geschichte. Zwar lassen sich Ähnlichkeiten - ja sogar manche Gleichheiten - zur jeweils individuellen Geschichte anderer finden. Aber für ein tieferes Verständnis und für eine angemessene, würdevolle Begegnung, geht es eben gerade um diese Einmaligkeit, die sich aus dem Vergleichbaren spezifisch hervorhebt. Ohne Zweifel weiß auch der Psychotherapeut im Rahmen klinisch-psychologischer Theorien um "Gesetzmäßigkeiten": Er mußte die derzeit im Abendland gängigen Vorstellungen über Krankheitsentstehung und -verläufe studieren; er kennt die diagnostischen Kategoriensysteme, mit Hilfe derer er sich mit anderen Psychotherapeuten über seine Patienten Erfahrungen verständigen kann, weil solche Kategorien auf einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund im Umgang mit menschlichem Leid verweisen, er hat sich mit Kriterien und Konzepten wirksamer Interventionen auseinandergesetzt, kurz: Er kennt die Psychotherapie auch als eine Wissenschaft, in der es um allgemeine Naturgesetze geht - also um Reproduzierbares hinsichtlich der psychischen, psychosomatischen und sozialen Natur des Menschen. Dabei wird gerade bei den diagnostischen Kategoriensystemen die Tendenz abendländischer Wissenschaft deutlich, den Erkennenden aus der Beschreibung des Erkannten auszublenden: Fast ausschließlich werden "Krankheits-" oder "Störungsbilder" so beschrieben, als handle es sich um ontisch feststehende Eigenschaften der Betroffenen; wobei man noch nicht einmal über das wundersame Entgegenkommen der Natur staunt, dem Diagnostiker eine so gut handhabbare Anzahl von Kategorien zu liefern: Denn üblicherweise wird mit der Verwendung von Diagnose-Systemen wie selbstverständlich vorausgesetzt, daß weder jeder Mensch von jedem anderen diagnostisch zu unterscheiden "ist", was Milliarden Kategorien zur Folge hätte, noch daß das allen Menschen und ihren Krankheitsverläufen grundlegend Gemeinsame einer einzigen Kategorie zuzuordnen "ist". Vielmehr ordnen Diagnose-Systeme die Phänomene ("Persönlichkeiten", "Krankheiten" und der "Verläufe" etc.) stets einer gut handhabbaren Kategorien-Anzahl zu. Welches Erkenntnisinteresse aber dahinter steht, gerade jenes Set an Phänomenen zur Bildung einer bestimmten Kategorie und zur Abgrenzung gegen andere aus der phänomenalen Komplexität zu abstrahieren, bleibt meist verborgen: In der klinischen Literatur geht es fast ausschließlich darum, wie wir ein bestimmtes "Störungsbild" von einem anderen unterscheiden, und kaum jemals warum (vgl. Kriz 1989). Auch der Psychotherapeut ist daher in das soziale und kognitive Gefüge der Wissenschaft eingebunden. Aber in der konkreten therapeutischen Situation bildet dieses Wissen bestenfalls einen allgemeinen kognitiven Hintergrund, vor dem er handelt (oder, in manchen Psychotherapieformen, wie z.B. der Verhaltenstherapie, aus dem er einen Teil seines "Handwerkszeuges" abgeleitet hat). Er kann daher beispielsweise seinem Patienten nicht als einem "Depressiven" begegnen, der genau in die diagnostische Kategorie 300.40 DSM III-R fällt mit den damit zusammenhängenden Vorstellungen über Entstehung und Verlauf von Krankheit. Vielmehr kann der Psychotherapeut nur zu einem einmaligen Menschen Kontakt herstellen, und er wird dessen einmalige Lebensgeschichte implizit oder explizit berücksichtigen müssen und ihn, bestenfalls, im Verlauf der psychotherapeutischen Kontakte auf allen Wegen und "Umwegen" - jenseits lehrbuchartiger "Krankheitsverläufe" - begleiten. Es scheint so, als folge aus diesen gegensätzlichen Perspektiven - der Wissenschaftler, der das Allgemeine, Reproduzierbare der Welt und der Psychotherapeut, der das Einmalige, Individualgeschichtliche, zur Sprache bringt - auch zwangsläufig ein unterschiedlicher Umgang mit eben dieser Sprache: Auf der einen Seite Sprache als Abbildung von Welt auf der anderen Seite hingegen Sprache als Beziehungsstifter. Daß eine solche Schlußfolgerung aber fehlgeht, hat ein anderer Quantenphysiker und ebenfalls Nobelpreisträger, Werner Heisenberg, bereits 1955 so ausgedrückt: "Wenn von einem Naturbild der exakten Naturwissenschaften in unserer Zeit gesprochen werden kann, so handelt es sich eigentlich nicht mehr um ein Bild der Natur, sondern um ein Bild unserer Beziehung zur Natur." Dabei ist mit "unserer Beziehung zur Natur" wohl kaum ein abstrakter Sachverhalt, etwa im Sinne einer mathematischen Relation, gemeint, sondern die Art und Weise des sich inBeziehung-Setzens. Selbst in den Naturwissenschaften geht es demnach um eine Begegnung mit (dem nichtmenschlichen Teil) der Natur. Dies setzt sich deutlich ab von dem Irrtum (seitens großer Teile der abendländischen Wissenschaft), der Mensch könne sich bei dieser Beziehung als Erkennender ausklammern bzw. sich als Teil selbst aus dem Ganzen lösen oder es gar beherrschen. Eine naturgerechtere Wissenschaft (die den Menschen als Teil der Natur versteht und damit dann wie selbstverständlich auch menschengerechter wäre) würde daher als eine wichtige Grundqualität ein ganzheitliches In-BeziehungTreten-Können erfordern - im Sinne des bekannten Philosophen Martin Buber, daß das Ich sich erst und nur in der Begegnung mit dem Du ergibt und umgekehrt. Entsprechend liegt nach Maurice Friedman (einem der führenden Buber-Interpreten), die Bedeutung Bubers besonders in dessen Kritik "an der Herrschaft des Ichs des Forschers über das Es des untersuchten Gegenstandes in der heutigen Wissenschaft: Wissenschaft wurde zur unpersönlichen Manipulation, die wesentlich beteiligt ist am Verschwinden Gottes und an der Massenvernichtung selbst" (Hampden-Turner 1986: 124). Nun ist es gängige psychotherapeutische Erfahrung, daß viele, wenn nicht die meisten, Patienten ganz wesentlich darunter leiden, nicht oder nur verängstigt, verkrampft, verstümmelt, verbogen in Beziehung treten zu können - zu Partnern, Eltern oder Kindern, zu den Mitmenschen, zur Mitwelt sowie, sehr oft und damit verbunden, zu sich selbst. Ein wesentliches Kennzeichen dieser Störung in der Beziehungsfähigkeit besteht darin, daß statt des Sich-Einlassens versucht wird, die Beziehung unter Kontrolle zu bringen. Je mehr Angst jemand empfindet, desto höher wird sein Sicherheitsbedürfnis sein; jedoch glossiert schon der Volksmund diesen meist untauglichen Versuch mit: "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" - ist es ebenso gängige menschliche Erfahrung, daß es selten längerfristig gelingen kann, Sicherheit dadurch zu erlangen, daß Kontrolle ausgeübt bzw. erhöht wird von. In psychotherapeutischen Praxen sind denn auch kaum Menschen anzutreffen, die zuviel Vertrauen erfahren haben bzw. selbst zu viel Vertrauen zeigen, im Gegensatz zur Fülle jener Menschen, die zuviel Kontrolle erfahren haben bzw. die unter ihrem eigenen Hang nach Kontrolle leiden. Es ist bemerkenswert, wie in der abendländischen Wissenschaft gerade Kontrolle und das Verbergen der eigenen Motive und Emotionen hinter einer "richtigen" Methodik als "Tugenden" einer sauberen Vorgehensweise propagiert werden. Ich bin daher in einer längeren Abhandlung (Kriz 1996) der Frage nachgegangen, ob Angst bzw. Angstabwehr nicht auch ein wesentliches Motiv sein dafür könnte, sich überhaupt dem Programm abendländischer Wissenschaft zu verschreiben und den Beruf des Wissenschaftlers zu wählen. So provokativ diese Frage vielleicht klingen mag, so ist sie zumindest keineswegs neu: So hat z.B. Maslow ein Kapitel seiner "Psychologie der Wissenschaft" mit dem Titel: "Die Pathologie der Erkenntnis: Angstmildernde Mechanismen der Erkenntnis" überschrieben; und er hat in einem anderen eine Liste von 21 "krankhaften", "primär angstbedingten" Formen im Bedürfnis, "Erkenntnisse zu gewinnen, zu wissen und zu verstehen", zusammengestellt. Ein weiteres Kapitel läßt er mit den zusammenfassenden Sätzen beginnen: "Wissenschaft kann demnach der Abwehr dienen. Sie kann primär eine Sicherheits-Philosophie sein, ein Absicherungssystem, ein kompliziertes Mittel, Angst zu vermeiden..." (Maslow 1977:57). Bedenkt man die grundlegende Weltsicht der "Väter" der modernen abendländischen Wissenschaft, Francis Bacon, Rene Descartes und Isaac Newton, so dienen diese nicht gerade als Gegenbeispiel: Bacon, als Generalstaatsanwalt von König James I. mit Hexenprozessen und -verhören gut vertraut, propagierte die experimentelle Methode mit Bildern wie: "die Natur auf die Folter zu spannen, bis sie ihre Geheimnisse preisgibt", "sie auf ihren Irrwegen mit Hunden hetzen" und sie "sich gefügig und zur Sklavin machen". Diese Formulierungen zeugen nicht gerade von Souveränität, geschweige denn von einer achtungsvollen, dialogischen Haltung, in der Beziehung zur Mitwelt. Und auch die Hexenprozesse, aus denen diese Metaphern stammen, können eher als Versuche von Angstabwehr der mächtigen Männer verstanden werden - Angst vor dem Weiblichen, dem Archaischen, dem für sie Fremden, und Angst vor dem Verlust an Kontrolle - statt als Zeichen von Souveränität. Descartes Unterscheidung von res cogitans und res extensa (grob gesprochen, die Trennung in Geist und Körper, oder besser: in Bewußtseinswelt und mechanistisch, physische Welt) führte bekanntlich dazu, daß in seinen Schulen (aber keineswegs nur dort) die lebenden Organismen nicht nur mit Maschinen verglichen, sondern letztlich als nichts anderes als Maschinen behandelt wurden. Einer Schilderung der cartesianischen Schule von Port-Royal durch Nicolas Fontaine um 1700 ist zu entnehmen, wie dort Tiere an ihren vier Pfoten auf Bretter genagelt, sie bei lebendigem Leibe seziert, und ihre Schmerzschreie als Lärm von Federn in Uhrwerken verstanden wurden und sich die Forscher noch über jene lustig machten, die, "unwissenschaftlich", den Tieren Schmerzen unterstellten. Bedenkt man, daß für menschliche Säuglinge und Kleinkinder Gefühlsansteckung und anthropomorphisierende Identifikation eher typisch sind (d.h. diese bei Schmerzensschreien, Weinen etc. mit gleichen Gefühlen reagieren), so muß den erwachsenen Wissenschaftlern eine bemerkenswerte Ausblendung und Abwehr gelungen sein - die in fataler Weise an die Rechtfertigung des Haltens und Mißhandelns von Sklaven durch "fromme" Amerikaner erinnert, nach der "Neger" eben keine "richtigen Menschen" wären und das "Liebe Deinen Nächsten" der Bibel natürlich für sie nicht zuträfe, oder an die Ermordung von Millionen Juden in deutschen Konzentrationslagern durch, so die Beschreibungen, teilweise "liebevolle Familienväter", oder die Ausblendungen und Abwehrmechanismen bei den heutigen Folteren in aller Welt. Daß Deutsche und Japaner im 2. Weltkrieg an KZ-Häftlingen bzw. Kriegsgefangenen grausamste Menschen-Experimente zur "medizinischen Forschung" unternahmen, schließt den Bogen zur Wissenschaft wieder auch wenn diese Extreme keineswegs als typisch für "die Wissenschaft" hingestellt werden sollen. Isaac Newton letztlich, der die experimentelle Methode und Induktion Bacons mit der Deduktion Descartes verband und als Leitfigur abendländischer Wissenschaft gilt, betonte insbesondere die Bedeutung mathematischer Abstraktion und kategorialer Verallgemeinerung. Der Einzelfall hat in dieser Sichtweise nur als Beispiel für etwas Allgemeines Wert, wie bereits oben mit dem Pauli-Zitat belegt wurde. Beispiele sind, wie schon Maslow hervorhebt, anonym, entbehrlich, nicht einzigartig, nicht unantastbar, sie haben keine eigenen, nur ihnen allein zukommenden Namen. Zu "Beispielen" wird daher ganz gewiß keine dialogische Beziehung hergestellt. Gleichzeitig dienen solche kategorialen Verallgemeinerungen als Basis für Regelmäßigkeiten und damit auch für Prognose und Kontrolle, und helfen somit wesentlich, die Angst vor dem stets Neuen, Unberechenbaren, zu vermindern (vgl. Kriz 1993). Diese, hier nur kurz skizzierte, Haltung abendländischer Wissenschaft gegenüber der Mitwelt hat unser gesellschaftliches Weltbild bis in die Gegenwart hinein geprägt. Obwohl sich dieses Bild durch neuere Erkenntnisse gerade an der Forschungsfront der modernen Naturwissenschaften in den letzten Jahrzehnten inzwischen radikal gewandelt hat (s.u.) wird es von manchen Wissenschaftlergruppen sogar immer noch als "Vorbild" hingestellt, leider auch innerhalb der Psychologie und der Medizin. Auch im psychotherapeutischen Feld ist die Vermittlung von Selbst-Kontrolle viel populärer - und erscheint als "effektiver" - als die von Selbst-Vertrauen. Gerade in jüngerer Zeit gewinnt im Zusammenhang mit der Diskussion um ein Psychotherapeutengesetz und der Kassenzulassung in Deutschland eine Strömung Oberhand, die vorgibt, "tatsächliche, objektiv nachgewiesene Wirkungen" erheben und bewerten zu können, "wie wirksam ... Therapieform A wirklich (ist)", d.h. "die Spreu vom Weizen zu trennen, indem objektive Fakten über die Wirkung und Wirkungsweise einer Therapieform" festgestellt werden (alle drei Zitate, ernstgemeint, aus einem derzeit häufig zitierten Buch über die Wissenschaftlichkeit von Psychotherapie - Grawe et al. 1994) so, als gäbe es keine Auffassungsunterschiede, sondern als wäre es ein ewig gültiges Naturgesetz, was überhaupt als Ziel einer Therapie angesehen werden soll...... 4.2 Zur Kulturabhängigkeit von Erkenntnis und Wissenschaft Gerade die Psychotherapie wendet sich oft Realitätsbereichen zu, die von der Alltagswelt deutlich entrückt sind. Selbst in kaum als "pathologisch" empfundenen Bereichen geht es eher um die "weichen" Realitäten in Form von Interpretations- und Deutungsmustern innerhalb eines spezifischen Sozialgefüges (Familie, Paar, Arbeitsgruppe etc.), als um die "harten" Fakten, denen sich Naturwissenschaftler in der Regel zuwenden. Wie weit aber reicht eigentlich die Verbindlichkeit selbst der "harten Fakten? Der in der bisherigen Argumentation betonte Zusammenhang zwischen Handlungen, Erfahrungen und Sprache läßt vermuten, daß in anderen Kulturen, mit anderer Sprache, anderen Handlungsgewohnheiten und einer anderen Umwelt auch die Realität der Lebenswelt anders sein könnte. Dies macht schon die Differenzierung der Begriffe hinsichtlich eines Erfahrungsbereiches deutlich: So unterscheidet der "Flachländer" gewöhnlich nur zwischen "Schnee" und "Eis"; der Skifahrer hat mehrere Begriffe für verschiedene Formen des Eises/Schnees, und der Eskimo hat über hundert Begriffe, mit denen er seine unterschiedlichen Erfahrungen hinsichtlich Schnee/Eis ausdrückt. Diese Unterscheidungen sind für ihn offensichtlich lebensrelevant, es sind Erfahrungen, die er anderen möglichst präzise mitteilen will und muß, weil mit unterschiedlichem Handeln darauf reagiert werden muß. Gleichzeitig dienen diese vielen Begriffe dazu, daß die EskimoKinder in der Sozialisation auf die vielen unterschiedlichen Formen von Schnee/Eis hingewiesen werden und diese als unterschiedlich wahrnehmen lernen - Unterschiede, die wir zunächst überhaupt nicht bemerken würden und erst in der Lebenswelt der Eskimos nach und nach wahrnehmen und dann auch mit den unterschiedlichen Begriffen belegen könnten. Sprache strukturiert also die Erfahrung mit der Umwelt, und die Erfahrung mit der Umwelt strukturiert Sprache. In extremster Form ist diese Perspektive in Form der sog. Sapir-Whorf-Hypothese der "linguistischen Relativität" bekannt geworden. Damit ist gemeint, daß Denken und Weltsicht durch die Sprache bestimmt sind. Whorf untersuchte insbesondere indianische Kulturen...und stellte bei seiner Untersuchung der HOPI-Indianer fest, daß deren Sprache sehr anders strukturiert ist als unsere (SAE = Standard Average European = Standard-DurchschnittsEuropäisch). So kommt die Sprache der Hopis weitgehend ohne Raum-Zeit-Begriffe aus, stattdessen spiegeln die Wörter eine Anschauung wieder, nach der alles im Fließen ist und zwischen zwei großen Formen, dem schon Manifestierten und dem noch nicht Manifestierten unterscheidet. Substantive bezeichnen in der Hopi-Sprache nicht Allgemeinklassen (Haus, Lampe) sondern individuelle "Gegenstände", und die Allgemeinheit wird durch das Verb ausgedrückt. Ebenso kann ein Hopi Verben ohne Substantive verwenden. Hingegen müssen wir in unserer Sprachstruktur stets jemanden als "Täter" für das Tätigkeitswort benennen - z.B. müssen wir sagen "es blitzt" obwohl völlig unklar ist, wer oder was das "es" sein soll und daher "blitzt" inhaltlich (aber eben nicht grammatisch) viel angemessener wäre. Ohne hier auf Details eingehen zu können, ist wohl einsichtig, daß die "Welt" der Hopis damit auch anders strukturiert ist als die unsere, wobei die Beziehung zwischen Sprache und Realität koevolutionär zu sehen ist: In der Sozialisation wird den HopiKindern zwar mit dieser Sprache auch eine bestimmte Weltsicht vermittelt, aber dies kann nur mit der Bewährung in sinnvollem Handeln verbunden sein. Nicht (nur) die Sprache der Hopis ist daher anders als unsere, sondern die Kultur und die gesamte Umwelt ist es. Damit erhebt sich die Frage: Wie stark ist der Einfluß von Wissenschafts"kulturen" auf die Konzeption von Realität? Und darüber hinaus: Wie stark ist wiederum der Einfluß der Kultur auf die Wissenschaft? Die Wissenschafts- und Kulturgeschichte belegt nun an zahlreichen Beispielen, daß die sozialen und kulturellen Einflüsse keineswegs auf den Bereich der Alltagserfahrung beschränkt sind. Ein eindrucksvolles Beispiel stellen die Beobachtungsreihen des Saturnringes durch Galilei und Huygens dar: Beide zählten sicher zu den hervorragendsten Naturwissenschaftlern ihrer Zeit und keiner würde wohl bezweifeln, daß sie es an Sorgfalt und geschulter Beobachtungsfähigkeit nicht mit heutigen Wissenschaftlern (z.B. auch Psychologen) aufnehmen könnten. Doch obwohl beide bemüht waren, das Beobachtete so genau und objektiv wie möglich wiederzugeben, und obwohl ihre Instrumente weitaus besser waren, als heutige billige Warenhausfernrohre (mit denen heute jeder Hobbyastronom "den Saturnring" deutlich "sehen" kann), zeichneten Galilei und Huygens vom "Gesehenen" Bilder, von denen viele aus heutiger Sicht "unmöglich gesehen" beurteilt werden müssen. Aus der Astronomie gibt es weitere Beispiele, wie mit der Veränderung der Theorien über das Beobachtete sich auch die Beobachtungen (nochmals: von hervorragend geschulten Wissenschaftlern) radikal änderten. Dies zeigt, daß "Sehen" und "Beobachten" und "Aufzeichnen" - auch von geschulten Wissenschaftlern - nicht von der Auffassung und der kognitiven Repräsentanz dessen zu trennen ist, was als "Wirklichkeit" hypothetisch der Wahrnehmung unterstellt wird. Gerade wenn man die Selbstverständlichkeit "unserer" wahrgenommenen und erfahrenen Wirklichkeit als gesellschaftlich-kulturelle Leistung zu würdigen weiß, kann man der Gefahr entgehen, diese kulturrelative Leistung mit ontischobjektiver (und damit alleingültiger) Wirklichkeit zu verwechseln. Ersteres eröffnet die Fragen nach "neuen Wirklichkeiten" (als Basis jedes Paradigmawechsels), letztes würde die zulässigen Fragen und Methoden auf das jeweils gerade vorherrschende Paradigma (oder zumindest: die Paradigmen) beschränken: Was es nicht geben kann, braucht dann auch nicht untersucht zu werden. Mit einer solchen Haltung ist aber der Schritt von pragmatisch reflektierter und sinnvoller Beschränkung zu "wissenschaftlicher" Beschränktheit nicht mehr weit. Es ist wohl nicht verwunderlich, daß es auch aus dem Bereich der Medizin, Psychologie Psychotherapie zahlreiche Beispiele für die Kulturabhängigkeit dessen gibt, was als "wissenschaftliche Wahrheit" ausgegeben wird. Einer der "Klassiker" sind die zahlreichen Forschungsarbeiten zur Untermauerung der "Polygenie-Theorie" im letzten Jahrhundert, mit der u.a. die Sklaverei verteidigt wurde. Mit genauesten Meßmethoden "bewiesen" Forscher wie Morton oder Broca (nach dem wir heute noch das motorische Sprachzentrum im Vorderhirn benennen) die "angeborene Dummheit" der "minderwertigen Rassen". Man sollte diese Beispiele ausführlich bei Gould (1983) nachlesen, da sie einen tiefen Einblick in die Exaktheit der Forschung geben (z.B. wurden Mittelwerte von Schädelmessungen auf 1/1000 Millimeter genau bestimmt) und so zeigen, daß die Ideologie in der Wissenschaft keineswegs an oberflächlicher "Schlamperei" zu erkennen ist. Ebenfalls bei Gould (1983) nachzulesen ist die Theorie des Arztes S. A. Cartwright, 1851 auf einem medizinischen Kongreß in Louisiana vorgetragen, wonach als Ursache der häufigen Fluchtversuche von Sklaven eine Geisteskrankheit "Drapetomanie" (d.h. der irre Wunsch, wegzulaufen) "entdeckt" wurde. Wir sind heute geneigt, über diese absurden "Irrtümer" des letzten Jahrhunderts zu lächeln. Doch fallen uns diese vor allem als "absurd" auf, weil sich unsere Ansicht über Sklaverei und Rassen gewandelt hat. Was aber ist mit den Ansichten gegenwärtiger Humanwissenschaft - wie können wir sicher sein, daß man in 100 Jahren nicht über unseren heutigen absurden Irrtümer lacht? Nur weil unsere wissenschaftlichen Ansichten ins gegenwärtige Weltbild passen? Wodurch ist z.B. unsere Ansicht über "Schizophrenie" fundierter als über "Drapetomanie"? Mit den heutigen Diagnosemöglichkeiten würden wir nämlich auch die "Drapetomanie" noch besser diagnostizieren können als vor 100 Jahren: Ein Sklave, der gerade im Begriff ist, einen Fluchtversuch zu begehen, wird erhöhten Herzschlag und Blutdruck aufweisen, er transpiriert erhöht, bestimmte "ungewöhnliche" Gedanken gehen durch seinen Kopf (die man vielleicht mit allerneuesten Methoden sogar an der Durchblutung bestimmter Hirnareale differentialdiagnostisch belegen kann). Ist diese Betrachtung viel anders, als z.B. die wohl berechtigte Problematisierung in einem Standardlehrbuch der klinischen Psychologie (Davison & Neale 1988, S. 35): "Einen Patienten, der sich der Realität entfremdet hat und halluziniert, beschreibt man als schizophren. Wenn wir dann fragen, warum sich der Patient der Realität entfremdet hat und halluziniert, lautet die Antwort häufig, das tue er, weil er schizophren sei. Mit 'Schizophrenie' wird also ein bestimmtes Verhalten, aber zugleich auch eine Ursache für eben dieses Verhalten bezeichnet. Ein klares Beispiel für einen Circulus vituosus - den man in der Wissenschaft unbedingt vermeiden sollte." Abschließend zu diesem Abschnitt noch ein kurzer exemplarischer Blick auf die Vorstellungen von "Krankheitsursachen" - ein gutes Beispiel dafür, daß Wissenschaft keineswegs ein einer stetigen Vermehrung "wahrer" Erkenntnis besteht: Am 13. August 1865 starb in Wien der Arzt und Geburtshelfer Ignaz Semmelweis (nach dem in Wien heute ein Klinik benannt ist). Er war nur 47 Jahre alt, und starb infolge einer Verletzung, die ihm vermutlich bei einer Auseinandersetzung mit einem Wärter zugefügt wurde: Semmelweis war nämlich 14 Tage zuvor von drei "Kollegen" in die "Landes-Irrenanstalt" eingewiesen worden - wie die kürzlich aufgefundene Krankenakte zeigt, ohne untersucht worden zu sein, und ohne daß das Einweisungszeugnis die Andeutung einer Diagnose enthielt . Semmelweis war verbittert, weil viele Kollegen die Kontaktinfektion, als Ursache des Kindbettfiebers, und seine entwickelten Desinfektionsmethoden nicht anerkannten. Und er hatte in offenen Briefen angedroht, diese Kollegen als Mörder hinzustellen, wenn sie seine Lehre nicht befolgen würden. Den wissenschaftlichen Beweis für die Richtigkeit seiner Thesen erbrachten erst später die Bakteriologen, und Semmelweis wurde (postum!) als "Retter der Mütter" verehrt (Quelle: "Die Zeit" Nr. 33, 1995). Nun hatte man also eine "Wahrheit" - doch bei Thure von Uexküll (1963) finden wir die andere Seite: "Als man sich z.B. zu Beginn der bakteriologischen Ära auf die Entdeckung immer neuer Erreger konzentrierte, geriet die alte Erfahrung von den Widerstandskräften des Körpers in Vergessenheit. Man glaubte mit der Entdeckung des Erregers das Problem der Infektionskrankheiten gelöst zu haben. Es bedurfte drastischer Hinweise, um die Medizin daran zu erinnern, daß sie mit den neuen Entdeckungen nur einen Teilbezirk erfaßt hatte. Der erboste Hygieniker Pettenkofer (nach dem z.B. in München eine Straße benannt ist J.K.) trank damals eine Kultur lebender Cholerabazillen und bewies durch sein Überleben den Gegnern, daß der Erreger allein noch keine Cholera ausmacht." Solche Einsichten förderten die Beachtung und Entwicklung der "Psychosomatik", d.h. die Erkenntnis, daß es vielleicht nicht der einzig richtige Blickwinkel sein könne, Descartes folgend den Menschen in einen Körper und eine Psyche (und soziale Eingebundenheiten) auseinanderzudividieren. Magengeschwüre, Herz-Kreislauferkrankungen und viele andere Volkskrankheiten wurden zunehmend im Lichte dieser Psychosomatik gesehen. Am 27.9.1988 wurde Hugo, die "Human Genome Organization" gegründet. Es geht um die Kartierung des menschlichen Genoms, d.h. die Darstellung sämtlicher Gene des menschlichen Körpers. Dafür müssen auf den 2x23 Chromosomen-Sätzen des Menschen mit ca. 50.000-100.000 Genen die insgesamt rund 3 Milliarden Basenpaare der DNA (fadenartige, zu einer Doppelhelix verdrillte Substanz, aus der die Gene bestehen und die als Träger der Erbinformation gilt) in ihrer Abfolge festgestellt werden. Dies klingt wie ein übliches wissenschaftliches Unterfangen. Doch um den allein in den USA für dieses Projekt aufgewendeten Etat von 28 Mill. Dollar zu durchzusetzen, bedarf es beachtlicher Ideologisierungen (sonst könnte noch jemand auf die Idee kommen, mit dem Geld ein paar weniger Menschen in New York und sonst in den USA - wenn schon nicht in der 3. Welt - verhungern zu lassen). Diese Ideologie wird deutlich, wenn man die Begründung für die "Antwort der Europäer" auf dieses Projekt, nämlich mit einem Etat von 60 Millionen DM die Gene zu erforschen, ansieht: Da es höchst "unwahrscheinlich ist, die umweltbedingten Risikofaktoren auszuschalten", und um eine "Weitergabe der genetischen Disponiertheit an die folgende Generation zu verhindern" muß man soviel wie möglich über die Faktoren der genetischen Disposition lernen, hieß es in dem Papier, das auch dem Deutschen Bundestag zur Beschlußfassung vorlag (Drucksache 11/3555 vom 24.11.88 - glücklicherweise wurde diese Beschlußvorlage mit seinen entlarvenden Formulierungen rechtzeitig gestoppt, das Genom-Programm, nun geschickter "verkauft", allerdings nicht). Zu verhindern gilt es, danach und auf diesem Wege, Krankheiten wie Krebs, schwere Psychosen, Herzkrankheiten, Diabetes, Autoimmunkrankheiten etc. Krankheiten also, von denen in der gleichen Schrift betont wird: "Diese Störungen haben eine starke Umweltkomponente". Doch bevor man der Industrie Auflagen macht, weniger Schadstoffe zu produzieren oder das Geld investiert um stressfreiere Lebensund Arbeitsbedingungen zu erreichen, versucht man offenbar lieber, den Menschen zu züchten, der den Schäden einer rücksichtslosen Plünderung und Vergiftung dieses Planeten standhält (oder wie sonst ist die Verhinderung von Dispositionen an die folgende Generation zu verstehen?). Über die Triebfeder in unserer Kultur für solche Weichenstellungen wissenschaftlichen Forschens möchte ich hier nicht spekulieren - es genügt vielleicht abschließen aus der Beschlußvorlage zu zitieren: "...was bedeutet, daß fortgeschrittene Technologien mit hohem Mehrwert ... gefördert werden sollen. Begründete Schätzungen gehen davon aus, daß der potentielle europäische Markt für DNA-Sonden in den nächsten 10 Jahren einen Wert zwischen 1 und 2 Mrd. ECU/Jahr aufweisen wird." Daß Wissenschaft also nicht nur aus "Liebe zu Wahrheit" und aufgrund wissenschaftstheoretischer Kriterien auf bestimmten Wegen zur Erkenntnis voranschreitet, war vielleicht dem Leser auch schon vorher klar. Da eine Abhandlung über Forschungsund Wissenschaftsmethodik zwangsläufig den normativen Aspekt von Wissenschaft eher in den Fokus rückt, müssen redlicherweise auch solche Exkurse die Perspektive ergänzen. Als Kontrast werden sich der folgenden beiden Kapitel wieder den eher normativen Konzepten von wissenschaftlichem Handeln zuwenden. 7. Probleme und Fragen der Psychotherapie-Forschung ..... Die Schwierigkeiten der Psychotherapie-Forschung liegen m.E. vor allem darin begründet, daß oft so getan wird, als handele es sich um rein methodische Fragen, während dahinter schwerwiegende und keineswegs konsensfähige inhaltliche - um nicht zu sagen: weltanschauliche - Vorentscheidungen liegen. Konsens findet man sicher darin, daß es in der Psychotherapie-Forschung (abgesehen von zahlreichen Spezialfragen) um zwei Hauptfragen geht, nämlich (a): "wirkt eine bestimmte Psychotherapie überhaupt (und wenn ja: wie effektiv)"?; (b): "wirkt Vorgehensweise A besser als Vorgehensweise B"? Die letztere Frage ist typisch für sog. Therapievergleichsstudien, bei der ersteren geht es um Therapieerfolg, bzw. Evaluation (Bewertung einer Maßnahme). Beide Fragen klingen ganz "einfach und unschuldig" und scheinen naturwissenschaftlichen Fragestellungen ziemlich ähnlich zu sein - etwa: "bewegt sich ein Objekt überhaupt (und wenn ja: mit welcher Geschwindigkeit)?", bzw.: "bewegt sich Objekt A schneller als Objekt B?" Doch der Ähnlichkeitsschein trügt gewaltig! Während nämlich "Bewegung", "Geschwindigkeit" und "Geschwindigkeitsdifferenz" in der Physik für alle verbindlich operational (d.h. unmittelbar auf Beobachtungs-Handlungen bezogen) definiert ist, gilt dies für keinen der o.a. Begriffe in Bezug auf Psychotherapie. Wir haben aber bewußt diese "naiven" Fragen gewählt, weil daran die eigentlichen Fragen deutlich werden: Wie wird "Therapie-Erfolg" überhaupt definiert und gemessen? Ein kleiner Blick in die Debatte klinischer Psychologie zeigt, daß dies keineswegs klar ist. Schon hinsichtlich der inhaltlichen Ziele, was überhaupt erstrebenswert ist, herrscht keineswegs Konsens. Auch wenn man sich hinreichend einig sein wird, daß die Sozialgemeinschaft (d.h.: die Kassen) eher nur für eine Reduktion von Lebens- und Arbeitsfähigkeit beeinträchtigenden Symptomen aufkommen solle (statt z.B. für "Persönlichkeitsentwicklung"), so sind Fragen der Finanzierung und von Therapiezielen doch zweifellos keine methodisch-statistischen Fragen, so daß man einfach unter einer bestimmten Perspektive "drauflosmessen" könnte, um dann Allgemeines über die "Wirkung" von Psychotherapie von sich zu geben. Außerdem geht es keineswegs nur um den - im Mainstream gering geschätzten und eher lächerlich gemachten - Aspekt von Persönlichkeitsentwicklung: für das große Spektrum sog. "chronischer Krankheiten" - angefangen von schwerer Schizophrenie, Hirnschädigungen, Asthma, Diabetes, etc. - oder andere nicht (mehr) heilbare Krankheiten wie z.B. Krebs hat sich das Konzept der "Bewältigung" durchgesetzt, bei dem eben eine "Ausheilung" der Primärsymptome nicht als sinnvoller Therapie-Erfolg angestrebt werden kann, sondern eben eine Erhöhung der "Lebensqualität" und ein "erträglicher Umgang" mit der Krankheit. Doch wie sind diese - ebenfalls wohl nicht von jedem gleich verstandenen - Begriffe zu definieren? Und selbst dann, wenn man hinsichtlich der Konzept-Definitionen weit mehr Einigkeit hätte, als faktisch vorherrscht: Wie werden diese denn nun konkret operationalisiert und gemessen, d.h. an welchen konkreten empirisch erfaßbaren Größen wird das Konzept denn festgemacht? Werden - wie meist üblich Tests und Fragebögen eingesetzt, greift die bereits im 1. Kapitel referierte Problematisierung von Devereaux: zu welchem Universum des Diskurses gehören überhaupt die erhobenen Daten? Sind Fragebogen-Daten eher als Meinungen oder klinische Diagnosen zu werten? Therapie-Forscher setzen "selbstverständlich" das letztere voraus - worin und wann ist dies begründet? Es sei beachtet, daß alle diese Fragen zwar erörtert aber nicht geklärt werden können. Denn man kann hinsichtlich dieser Fragen zwar Entscheidungen herbeiführen, aber mit guten Gründen hätte man sich meist natürlich auch anders entscheiden können. Oft werden allerdings nicht einmal die getroffenen Entscheidungen als solche dokumentiert, sondern es wird so getan, als wäre die Definition des Erfolgs, dann dessen Operationalisierung und dann die Messung inhaltlich so selbstverständlich, daß man nun eine formale Methode einfach "anwenden" könne. Nachdem man diese Entscheidungen (explizit oder implizit) getroffen hat, taucht die nächste Gruppe an Fragen auf, über die entschieden werden muß (und auch diese sind wieder keineswegs "selbstverständlich"): An welchen Patienten werden die Messungen überhaupt durchgeführt? Nimmt man an, daß die Therapiemethode A bei allen Patienten gleich wirkt? - Eher wohl nicht! Doch wonach wählt man aus? Reicht es, eine bestimmte "Symptomgruppe" zu wählen? Und warum wird diese abgegrenzt - es ist nämlich wiederum keineswegs "selbstverständlich", daß unsere klinischen Klassifikationen, auf der Ebene von Krankheitsverläufen gewonnen, auch die optimalen Klassifikationen für Therapieverläufe sind. Geht es eher um möglichst homogene Symptome, oder um eine homogene Schwere von Beeinträchtigungen, oder um einen homogenen Verlauf der bisherigen Krankengeschichten, oder um homogenen "sozialen Support" (der erheblich mit dem Therapie-Verlauf interagieren dürfte) oder.., oder..? Auch dieses sind keine statistisch-methodischen Fragen, sondern es stehen unterschiedliche inhaltlich-theoretische Vorstellungen dahinter wenn man sich für das eine oder das andere entscheidet - und wieder ist eine Entscheidung etwas anderes als die algorithmisierte Durchführung einer Methode. Welche Therapeuten von Richtung A läßt man nun die zu beforschenden Therapien durchführen? Eine möglichst repräsentative Auswahl? (Woher gewinnt man die Basisinformation dafür?) Oder nimmt man möglichst erfahrene Therapeuten? (was heiß das - und: wie realistisch ist es anzunehmen, daß erfahrene Therapeuten genau "Methode A" in "Reinkultur" vertreten?). Wählt man (was wohl realistisch ist) jene, die man gerade bekommen kann: Sind das dann nicht eher jene, die vielleicht unter Patientenmangel leiden (und vielleicht überzufällig Anfänger sind oder andere Eigenschaften aufweisen, die sie nicht gerade zu den Aushängeschildern für Therapieform A machen)? Wenn diese Fragen nun alle entschieden sind: Was bleibt, als kleine "Zwischenbilanz", eigentlich noch von der AusgangsFrage übrig, (z.B.) "ob und wie effektiv Therapiemethode A wirkt?" Was wir nach den bisherigen Entscheidungen erwarten könnten, wäre Information darüber, wie Patienten der Gruppe B, nach den Kriterien C, D und E... zusammengestellt, hinsichtlich Antworten und Beobachtungen der Variablen F, G und H... bei Therapeuten mit den Eigenschaften I, J und K... sich verändern. Beantwortet das noch unsere obige Frage - bzw. ist diese Information noch als angemessene Basis anzusehen, um Aussagen über "die Therapieform A" zu machen? Dabei hätten wir nun noch fast jene Fragen vergessen, um die in der Literatur über Psychotherapie-Forschung gemeinhin so viel Aufhebens gemacht wird: Soll man einen Vergleich "vorher"/"nachher" (d.h. ein prä-post-design) durchführen, oder aber eine Verlaufsstudie (panelanalyse), bei der zu vielen Zeitpunkten die Information erhoben wird? Wie soll eine Kontrollgruppe zusammengesetzt sein, die den Therapie-Erfolg gegen Zufallseinflüsse bzw. Spontanremission sichert (d.h. gegenüber der Tatsache, daß sich auch bei einem Teil der unbehandelten Patienten nach einer Zeit "Besserung" einstellt s.u.)? Wie groß soll die Stichprobe an Patienten sein? (Nun, jedenfalls größer als in den meisten Therapiestudien, ... denn bei den üblicherweise aus der Literatur zu erwartenden Effektstärken und den üblicherweise verwendeten statistischen Tests reichen 20-30 Personen keineswegs aus, die Nullhypothese: "kein Effekt" zu verwerfen - nebenbei: dies gilt noch radikaler bei Therapievergleichsstudien, wo es um Unterschiede in den Effekten geht). Doch diese, in diesem Absatz skizzierten, Fragen sind vergleichsweise zu den vorher aufgeworfenen eher trivial, da es sich hier tatsächlich eher (wenn auch nicht vollständig) um statistisch-methodische Fragen handelt, bei denen die Kriterien daher (vergleichsweise) klar sind und deren adäquate Beantwortung zum Handwerkszeug des Forschers gehören sollte. Weit schwieriger und unklarer ist es da schon wieder, statt der Wirkung einer Therapieform A die zweite obige Frage, nach dem Therapie-Vergleich zu stellen. Denn nun müssen nicht nur sämtliche oben aufgeführten Entscheidungen (mit den dahinter liegenden theoretischen Vorstellungen und Problemen) getroffen werden. Sondern zusätzlich ist natürlich die Frage zu entscheiden, hinsichtlich welcher Aspekte (bzw. welches Aspekte-Raumes) ein solcher Vergleich überhaupt stattfinden könnte. Erinnern wir uns: Die obigen Entscheidungen führten sinnvollerweise zu einer, für A ganz spezifischen Auswahlkombination aller dieser Entscheidungsaspekte. Wenn dieselbe Entscheidungssequenz analog für Therapieform B durchgeführt wird, bleiben dann überhaupt irgendwo Überschneidungen, um über einen Vergleich etwa aussagen zu können? Nun, wer nur statistische Modelle im Kopf hat und von klinischer Psychologie nichts versteht, könnte auf die Idee kommen, alles per Zufall auszuwählen - d.h. Patienten werden per Zufall auf zufällig ausgewählte Therapeuten der Schulen A und B aufgeteilt und die Veränderungen werden mit zufällig gezogenen Kategorien, Tests etc. bestimmt. Abgesehen davon, daß diese Vorgehensweise fernab jeder praktischen Realisierung liegen würden, gäbe es zwei Möglichkeiten: entweder man hat ein vollständiges Design, in dem alle Kategorienkombinationen vertreten sind, oder man führt tatsächlich nur eine Zufallsauswahl durch. Im ersten Fall muß man nur ein Dutzend der oben aufgeworfenen Entscheidungsfragen (die keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit erheben!) mit je 5 Abstufungen bzw. Alternativen berücksichtigen, um die Absurdität zu erkennen: Es ergeben sich 512, das sind über 244 Millionen, Kombinationen. Man müßte also eine "Stichprobe" vom Umfang mehrerer europäischen Staaten erheben, um pro Kombination auch nur jeweils einen einzigen Menschen zu untersuchen. Im zweiten Fall wären die Untersuchungs- (und Kontroll-)-gruppen zwar klein (aber: s.o.), jedoch was sagt es aus, wenn Therapieform A bei anderen "Störungen" etc. hinsichtlich anderer Kriterien "besser" abschneidet als Therapieform B? Dies wäre wie die Aussage, daß Geigenunterricht effektiver ist als Klavierunterricht, nachdem man einige Kinder, die ein Instrument lernen wollten, zufällig auf verschiedene Lehrer an Geigen- und an Klavierschulen aufgeteilt hätte, und nach einem Jahr Eltern, mit unterschiedlichen Vorstellungen darüber, was überhaupt die Sinn des Musikunterrichtes sein könnte, die "Erfolge" beurteilen ließ. Diese eher anekdotische Schilderung einiger Probleme und Schwierigkeiten beim direkten Vergleich nur zweier TherapieAnsätze hat wohl deutlich werden lassen, welche immensen theoretischen und konzeptionellen Defizite aufzuarbeiten wären, bevor die obigen Fragen einigermaßen kompetent entschieden werden können und man "loslegen" könnte herumzurechnen. Es sollte auf der Hand liegen, daß es da nicht unbedingt leichter ist, Meta-Analysen durchzuführen, d.h. Analysen, in die "Ergebnisse" zahlreicher anderer Studien eingehen, um zu einer Gesamtaussage zu kommen. Das Wort "Ergebnisse" wurde deshalb in Anführungszeichen gesetzt, weil eben jedes "Ergebnis" einer solchen Einzelstudie implizit oder (selten) explizit die gesamte Entscheidungssequenz über alle oben aufgeworfenen Fragen (und weitere) enthält. Hier stellen sich zusätzlich Fragen ein, wie: Welche Studien werden einbezogen? Wie begründet sich die Auswahl? Wie wird mit unterschiedlichen Stichproben, mit unterschiedlicher Anzahl von Erfolgskriterien umgegangen (d.h. ist eine Studie an 50 Personen genau so aussagekräftig wie eine an 1000, und ist eine Studie mit nur 1 klaren Effekt nur 1/10 so wichtig zu nehmen wie eine andere mit 10 nachgewiesenen Effekten)? Wie werden Abhängigkeiten berücksichtigt (sind 10 fast gleiche Kriterien 10 mal so wichtig wie nur 1 in einer anderen Studie)? Wir wollen es bei diesen Fragen bewenden lassen. Es blieb wohl kaum verborgen, daß ich der gegenwärtigen Psychotherapie-Forschung, je komplexer sie betrieben wird (d.h. je mehr implizite Entscheidungen eingehen) desto skeptischer gegenüberstehe. Neben den hier angerissenen Fragen gibt es nämlich noch viel grundlegendere, wie z.B. welche Modelle von "Ursache-Wirkung" wir unseren Überlegungen zugrundelegen. Wenn wir ernst nehmen, was die moderne naturwissenschaftlich fundierte Systemtheorie uns lehrt (und was in vorangegangen Kapiteln skizziert wurde), dann sind in komplex vernetzten Systemen diskontinuierliche Verläufe zu erwarten - und Psychotherapieforscher reden auch gern davon, daß die unterschiedlichen Faktoren, die den Erfolg einer Therapie beeinflussen, miteinander vernetzt sind. Daraus würde aber folgen, daß z.B. keine Gruppenvergleiche derart durchgeführt werden dürfte, daß die Veränderungen auf Datenniveau aggregiert (d.h. zusammengefaßt - etwa über Mittelwertsbildung) werden. Je nach individuellem Ausgangspunkt (der zu erheben wäre) kann nämlich ggf. eine "große Ursache" dann keine Wirkung eine "kleine Ursache" eine große Wirkung entfalten. Auch solche Fragen müßten natürlich vorher explizit geklärt werden, bevor man nach irgendwelchen "statistischen Verfahren" etwas "berechnet" (und damit natürlich unwissentlich in dieser Frage eine bestimmte Stellung bezieht - meist jene, daß man nicht von diskontinuierlichen Verläufen und damit, entgegen der verbalen Beteuerungen, auch nicht von vernetzten Prozessen ausgeht). ... Solange diese Fülle an inhaltlichen Fragen nicht geklärt ist (und oft nicht einmal angemessen diskutiert wird) nützen selbst (oder: gerade?) die aufwendigsten "Untersuchungen" wenig; sie verhindern eher eine redliche Psychotherapie-Forschung. Oder, provokanter ausgedrückt: Solange wir in der Erforschung und wissenschaftlichen Debabtte, was überhaupt unter Psychotherapie-Effekten zu verstehen ist, so weit am Anfang stehen, kann die großangelegte und wissenschaftspolitisch brisante "Sammlung" von Effekten eben nur Effekt-Hascherei sein. Aus diesen Gründen würde ich selbst auch eher für eine stärkere Grundlagenforschung in diesem Bereich plädieren.. Die Praktiker beeindruckt die gegenwärtige Psychotherapie-Forschung ohnedies nicht, wie in zahlreichen Arbeiten der Forscher beklagt wird. Der Therapeut, der zu seiner und der Patienten Zufriedenheit behandelt, wird seine Vorgehensweise und Weltsicht nicht deswegen wechseln, weil eine Untersuchung unter (für ihn) nicht genau geklärten Umständen bei einem Klientel (das er schwerlich beurteilen kann) hinsichtlich einiger Kriterien (von denen er vielleicht manche keineswegs teilt) die statistische Nullhypothese, daß Therapie nicht wirkt (wovon er jeden Tag sowieso das Gegenteil erfährt) "signifikant" zurückweisen konnte. 8. Epilog: Zur Psychotherapie der Wissenschaft Bereits in Abschnitt 3.4 wurde in einem Exkurs zum Verhältnis von Wissenschaft und Psychotherapie einiges ausgeführt - und damit dieser Epilog quasi vorbereitet. An dieser Stelle möchte ich daran anküpfend gern die Aussage von Maslow (1977) in seinem Werk "Psychologie der Wissenschaft" aufgreifen, wo er (sinngemäß) fragte: Warum fragen wir eigentlich immer wieder, ob die Psychotherapie auch wissenschaftlich genug sei? Warum fragen wir nicht lieber, ob die Wissenschaft psychotherapeutisch genug ist? Und mit dieser Fragestellung die Betrachtungsperspektive bei den Erörterungen über Wissenschaftsmethodik in der Psychotherapie umkehren. Berücksichtigen wir, daß in der Entwicklungsgeschichte dieses Planeten bereits vor 3 Mrd. Jahren erste Lebensformen auftraten, es seit fast einer halben Million Jahre den Homo sapiens, und seit immerhin über 100.000 Jahren den sogenannten "Homo sapiens sapiens", den modernen Menschen, gibt, so währt das nun gut 300 jährige Programm abendländischer Wissenschaft, bezogen auf die Dauer eines Tages, weit weniger als eine Minute in der Menschheitsgeschichte - in der Geschichte des Lebens sogar nur wenige Millisekunden. Bedenkt man nun noch, daß die Völker des Abendlandes weniger als 1/5 der Weltbevölkerung ausmachen, muß festgestellt werden, daß eine historisch und geographisch verschwindend kleine Minderheit mit ihrem Wissenschaftsprogramm in geradezu unglaublich kurzer Zeit diesen Planeten mit seinen Menschen und der Mitwelt an den Rand des Abgrundes geführt hat. Daß dieses Programm seit Anbeginn durch seine Leitfiguren, Bacon, Descartes und Newton, vor allem von Kontrollbedürfnissen gekennzeichnet ist, wurde ebenfalls in 3.4 kurz skizziert. Kontrollbedürfnisse - d.h. Sicherheit vor allem über Kontrolle statt z.B. über Vertrauen herstellen zu wollen finden wir im Alltag im Zusammenhang mit Angstabwehr. In der Tat ist es für Psychotherapeuten bemerkenswert, wie verblüffend die klinisch beschriebenen Mechanismen zur Angstabwehr jenen Prinzipien entsprechen, die in der abendländischen Wissenschaft als "Tugenden" einer sauberen Methodik propagiert werden: Möglichst weitgehende Ausschaltung von Unvorhersehbarem und Unkontrollierbarem, Reduktion von Einflußvariablen, möglichst weitgehende Prognose der Ergebnisse von Handlungen, maximale Kontrolle dessen, was passieren kann, Verbergen der eigenen Motive und Emotionen hinter einer "richtigen" Methodik, Beschränkung der Erfahrungen auf jenen Bereich, der durch "zulässige" Fragen und Vorgehensweisen vorab definiert ist. Ob wir daher so stolz auf die Errungenschaften dieser abendländischen Wissenschaft sein sollten, wie wir uns selbst und der Welt immer noch weitgehend ungebrochen über alle Medien verkünden und dabei in kultur- und wissenschaftsimperialistischer Manier die Lebenswelten anderer Völker und Kontinente mit diesem Kulturprogramm zunehmend erobern, werden wohl erst ferne Generationen beurteilen können. Ganz gewiß aber ist die ethische, moralische und soziale Entwicklung des Menschen weit hinter dem analytischwissenschaftlichen Fortschritt zurückgeblieben. Denn die abendländische Wissenschaft hat nicht nur theoretisch ein beispiellos todbringendes Potential geschaffen - sie realisiert auch zunehmend diese Möglichkeiten: Die Entwicklung von Massenvernichtungsmitteln sowie deren Einsatz in zwei Weltkriegen dieses Jahrhunderts, in deutschen Gaskammern, und auf zahlreichen weiteren Schauplätzen in dieser Welt, die Zerstörung der Mitwelt durch eine Wirtschafts- und Technik"Entwicklung", die selbst bei gesicherten und elementaren Zusammenhängen, wie beim CO2-Ausstoß oder der Abholzung der Regenwälder, nicht den kurzfristigen Eigennutz als oberstes Handlungsprinzip zu überwinden vermag, der Einsatz von medizinischen Erkenntnissen zur Perfektionierung von Foltermethoden oder zur Herstellung biologischer Kampfstoffe, sind wenige Beispiele dafür, daß dem Menschen die Folgen seines Wissenschaftens längst über den Kopf gewachsen sind. Der Mensch bedürfte somit dringend einer "Nachsozalisation" (wie dies Psychotherapeuten allgemein bei schweren Persönlichkeitsstörungen des Menschen fordern), um die Diskrepanz zwischen wissenschaftlich-technischer und ethisch-sozialer Entwicklung zu mildern und um zu versuchen, Schlimmstes zu verhindern. Meine These ist nun, daß eine psychotherapeutische Haltung, die wesentlich die Begegnungsfähigkeit ins Zentrum der Entwicklung stellt, als ein Wegweiser für eine lebensgerechtere Wissenschaft dienen könnte. Ich habe die Haltung abendländischer Wissenschaft exemplarisch an der Art und Weise der Wissenschaftler-Kommunikation festgemacht - denn auch Wissenschaft ist, wie wir sahen, wesentlich durch Kommunikation bestimmt. Sprache, die vorgibt, vor allem eine äußere Welt abzubilden, in welcher der Abbildende scheinbar nicht vorkommt, ermöglicht eine Distanzierung vom eigenen Erleben und eine Verschleierung eigener Motive. Sie macht unantastbarer und den Akteur weniger durchschaubar, als wenn in der Sprache die Beziehung des Sprechenden zu dem, wovon und worüber er spricht, auch explizit zum Ausdruck kommt schlechte Richter und Professoren neigen hierzu, etwa wenn sie einen Urteilsspruch erläutern oder die Tatsachen ihres Faches darstellen, und sich dabei hinter dem Gesetz oder der Methodik verbergen, um keine Ver-Antwort-ung übernehmen zu müssen, d.h. keine Antwort auf die Frage: "Wo stehst denn Du, der uns dies verkündet?" Ein treffendes Beispiel für die therapeutisch wirkende Funktion von Sprache findet man in Martin Bubers Schrift "Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre". In der ersten Geschichte dieses Buches erzählt Buber, wie Rabbi Schneur Salman, der Raw (Rabbiner) von Reusen in Petersburg gefangen saß, und wie sich der Oberste der Gendarmerie zu ihm in die Zelle begibt, um einen angeblichen Widerspruch in der jüdischen Glaubenswelt aufzudecken: Zuletzt fragte er: "Wie ist es zu verstehen, daß Gott der Allwissende zu Adam spricht: >Wo bist Du?<" "Glaubt Ihr daran", entgegnete der Raw, "daß die Schrift ewig ist und jede Zeit, jedes Geschlecht und jeder Mensch in ihr beschlossen sind?" "Ich glaube daran", sagte er. "Nun wohl", sprach der Raw, "in jeder Zeit ruft Gott jeden Menschen an: >Wo bist Du in Deiner Welt? So viele Jahre und Tage von den Dir zugemessenen sind vergangen, wie weit bist Du derweil in Deiner Welt gekommen?< So etwa spricht Gott: >Sechsundvierzig Jahre hast du gelebt, wo hältst du?<" Als der Oberste die Zahl seiner Lebensjahre nennen hörte, raffte er sich zusammen, legte dem Raw die Hand auf die Schulter und rief: "Bravo!" Aber sein Herz flatterte Buber führt dazu u.a. aus: "Auf die sachliche Frage, die, mag sie hier auch ehrlich gemeint sein, doch im Grunde keine echte Frage, sondern nur eine Form der Kontroverse ist, wird eine persönliche Antwort erteilt, oder vielmehr, statt einer Antwort erfolgt eine persönliche Zurechtweisung". Nun mag man sich an der "Zurechtweisung" reiben, denn auf den ersten Blick erscheint eine Zurechtweisung weniger dem dialogischen Prinzip als eher der Haltung des Obsiegens in der Kontroverse zu entsprechen. Bedenkt man aber, daß in dieser Geschichte der Rabbi der Gefangene ist und nimmt die Reaktion des Hauptmanns als Maßstab für die Beurteilung, so findet man, daß es in dieser "Zurechtweisung" nicht um ein Obsiegen geht, sondern daß diese durchdrungen ist von "Weisheit" und "Weisung" auf den "rechten" Weg - dessen genaue Zielrichtung wohl nur der so Zurechtgewiesene selbst finden kann. Es geht also nicht um Zielvorgabe, sondern um die Aufforderung nach diesem Ziel überhaupt zu suchen. Gerade in dieser Beschreibung Bubers wird das Elend besonders deutlich, wie heutige Wissenschaft jungen Studenten an den Universitäten allzuoft entgegentritt. Denn zur Charakterisierung dieser Studiensituation könnte man Bubers Beschreibung genau umdrehen: Auf eine persönlich relevante Frage, die ehrlich gemeint ist, erfolgt eine sachliche Antwort, die aber im Grunde gar keine echte Antwort enthält, sondern oft nur eine Zurechtweisung (hier nun aber im Dienste der Angstabwehr) ist - besonders dann, wenn die gestellte Frage droht, die Regeln der Logik und Methodik oder die Grenzen der Fachdisziplin (oder gar nur die des Professors) zu überschreiten. In einer solchen Studiensituation sind die Ziele dann durch die Koryphäen des Faches meist längst vorgegeben; Suchen erscheint oft unerwünscht und wird als ein Zeichen von Unsicherheit und Inkompetenz diskreditiert, während die möglichst perfekte Reproduktion der mit den Zielen kompatiblen Ergebnisse mit guten Noten belohnt wird. Daß eine solche Studiensituation den Dialog nicht fördert, liegt auf der Hand. Für Psychotherapie hingegen ist die beschriebene Begegnung im Gefängnis typisch (wenn auch bei Buber idealtypisch verdichtet): Der Therapeut will von seinem Gegenüber mit seinen "Fragen" selten etwas wissen, was er nicht weiß - und selbst dann nicht aus bloßer Neugier oder um jenen etwas abzufragen - sondern er will, um nochmals Buber zu zitieren, "im Menschen etwas bewirken, was eben nur durch eine solche Frage bewirkt wird, vorausgesetzt, daß sie den Menschen ins Herz trifft, daß sich der Mensch von ihr ins Herz treffen läßt." Mit diesen Ausführungen sollte keineswegs die pragmatische gegen die semantische Sinnhaftigkeit ausgespielt werden gewöhnlich sind beide Aspekte in Zeichenprozessen von Bedeutung. Entgegen der Einseitigkeit in weiten Bereichen der Wissenschaft, mit der die logisch-semantische Funktion von Sprache propagiert wird, sollte hier auf die Perspektive fokussiert werden, daß Sprache eben auch als eine Umgebung verstanden und gebraucht werden kann - begleitend und gestaltend - in der Menschen Erfahrungen machen. Im Rahmen von Wissenschaft finden wir diesen Aspekt noch am ehesten in den empirischen bzw. experimentellen Grundlagen eines Faches vermittelt: So und so müsse man vorgehen, um eine bestimmte Erfahrung zu machen. Wie aber bereits am Beispiel von Bacon und Descartes gezeigt wurde, führt diese Vermittlung von spezifischen Bedingungen für bestimmte Erfahrungen auf lebensfeindliche Abwege, wenn sie nicht zugleich vom dialogischen Prinzip getragen wird. Unter den Bedingungen der Angstabwehr verkommt ein Methodenkanon zudem oft zu dogmatischen Abgrenzungen des Erlaubten, statt Möglichkeiten dafür bereitzustellen, Erfahrungsräume zu vergrößern, d.h. die Methoden dienen dann eher dazu, Erfahrungen auszugrenzen oder gar zu verhindern - besonders, wenn sie das gerade herrschende Weltbild des Faches in Frage stellen könnten. Im Hinblick auf eine lebensgerechtere Wissenschaft möchte ich vorschlagen, die therapeutische Leitfrage: "Wie mag es jemandem gehen, der das sagt, was er sagt?" auch für wissenschaftliche Kommunikation, etwas abgewandelt, zu verwenden und zu fragen: "Was mag jemand wirklich meinen welche Erfahrung will er transportieren, was beschäftigt ihn, welche Grundfragen leiten ihn - der das sagt, was er sagt?" Das würde bedeuten, bei der Aufnahme der Information weniger sofort nach Schwächen und Gegenargumenten zu suchen, sondern danach, was sich mit den eigenen Erfahrungen und Sichtweisen zu neuen Bildern kombinieren läßt. Dies ist keineswegs ein Plädoyer für "unkritische" Wissenschaft, in der Unklarheiten sich beliebig vermehren, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte. Vielmehr werden Inhalte hinsichtlich ihres Beitrages zum gemeinsamen Verständnis von "Lebenswelt" (oder eines Ausschnittes daraus) hinterfragt und können geklärt bzw. modifiziert werden. Ideen müssen sich dann nicht primär gegen andere behaupten oder in destruktive Konkurrenz zu diesen treten, sondern können (in konstruktiver Konkurrenz) miteinander kombiniert zu komplexeren und tieferen Einsichten führen. Moderne Wissenschaft und Wissenschafts-Mythen Gerade für die Erforschung und Beurteilung von Psychotherapieverfahren ergibt sich hier ein sehr wesentliches Problem. Denn bei diesem Gegenstandsbereich kann nicht die strenge, reduktionistische Laborforschung zum Tragen kommen, in der durch geschickte experimentelle Anordnung (oder durch statistische Aufbereitung) fast alle bis auf wenige Variablen kontrolliert werden können. Zumindest solange noch nicht geklonte Therapeuten an geklonten Patienten eine streng manualisierte Vorgehensweise vollstrecken, ist das Modell der Pharma-Forschung mit beliebig reproduzierbaren reinen Substanzen bzw. Substanzkombinationen eine der vielen irreführenden Fiktionen (weitere s.u.). Wenn wir aber die gegebene Komplexität akzeptieren, können wir uns nicht den neuen Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaften und Mathematik in Hinblick auf solche komplexen Systeme verschließen. Hier hat sich nämlich in den letzten drei Jahrzehnten ein radikaler Wandel im Verständnis des wissenschaftlichen Vorgehens - einschließlich der Grenzen und Möglichkeiten - vollzogen, die viele scheinbar gesicherte Erkenntnisse über “allgemeingültige” Prinzipien wissenschaftlicher Methodik ins Reich der Mythen verbannte. Leider ist dieser gravierende methodologische und methodische Wandel in den modernen Naturwissenschaften von der Psychologie noch zu wenig zur Kenntnis genommen worden. Obwohl die inhaltlichen Forschungsergebnisse und richtungen zunehmend die komplexe Vernetztheit auch des psychologischen Gegenstandsbereiches - und hier durchaus auch der klinischen Psychologie - untermauern: Sei es die Berücksichtigung der Vernetzung von Neuronal-, Humoral- und Immunsystem, die Beziehungen von kognitiven Bewertungen, Stress und vielen Körperparametern, die Rückkopplungen zwischen individuellen Bewertungsstrukturen und sozialen Interaktionsmustern und so fort. Angesichts des Entwicklungsstandes in den Naturwissenschaften gerade im Hinblick auf solche komplexen Systeme ist es bestürzend, wie sich in der klinischen Psychologie noch zahlreiche Vorstellungen halten können, denen zwar die wissenschaftlich Grundlage inzwischen entzogen ist, die aber als wirksame Mythen die Debatte immer noch beherrschen. Ich möchte einige dieser zentralen (teilweise miteinander verwobenen) Mythen kurz aufzählen (wobei ich manche Phänomene hier nur anführe ... 1.) Objektivitäts-Mythos: Dieser wurde bereits kurz angeführt und beinhaltet den Glauben, man könne Fakten und “die Welt” so erkennen, wie sie “wirklich” sind. Statt dessen kommen wir nicht umhin, im Rekurs auf die Gemeinschaft (auch: die scientific community) uns der Verantwortung für unsere Entscheidungen zu stellen. Um es mit Heisenberg zu sagen: “Wenn von einem Naturbild der exakten Naturwissenschaften in unserer Zeit gesprochen werden kann, so handelt es sich eigentlich nicht mehr um ein Bild der Natur, sondern um ein Bild unserer Beziehung zur Natur.” Wir müssen uns somit z.B. der Diskussion stellen, welche Beziehung wir zu Phänomenen wie “Krankheit”, “Gesundheit”, “Heilung”. “Therapie” etc. haben - und können diese Fragen nicht über die Wahl von statistischen Parametern oder Items entscheiden (sondern nach den Entscheidungen dann die Parameter und Items entsprechend entwickeln). Der Anspruch in der Psychotherapie-Debatte, man wolle “objektiv feststellen”, was “tatsächlich” wirke, steht jedenfalls im Kontrast zur Bescheidenheit der modernen Physik. 2.) Analyse-Mythos: Der Glaube, daß durch analytische Zerlegung, Erforschung der Teile und dann wieder deren synthetische Zusammenfügung, in jedem Fall ein Ganzes untersucht werden kann, hat sich als Trugschluß erwiesen (und damit auch die unbedingte Suche nach “Wirkfaktoren”). Vielmehr haben Phänomene, wie die Emergenz, gezeigt, daß Systeme wesentliche Eigenschaften aufweisen können, die nicht aus den Teilen erklärbar sind (was z.B. auch schon die Gestaltpsychologie betonte). Nur wenn Teile artifiziell rückkopplungsfrei gehalten werden können, lassen sich diese nicht-linearen Einflüsse vermeiden. 3.) Homogenitäts-Mythos: Nicht nur, daß die o.a. Frage “ist Therapierichtung A wirksam..?” einen Pharma-Mythos über die Homogenität therapeutischen Handelns seitens einer bestimmten Richtung “A” voraussetzt; wesentlich neu kam mit der Systemtheorie die Erkenntnis, daß die nicht-linearen Rückkopplungen (typischerweise) zu qualitativen Sprüngen führen können. Das klassische Prinzip “natura non facit saltus” (die Natur mache keine Sprünge), das im Kleinen schon durch die Quantenmechanik widerlegt wurde, hat sich nun allgemein als Trugschluß erwiesen. Ursache-Wirkungs-Verläufe sind damit ebenfalls keineswegs homogen (größere Ursachen führen keineswegs immer zu größeren Wirkungen). Die “Geschichte” selbst einfacher physikalischer und chemischer Systeme muß wesentlich berücksichtigt werden (was in der Therapie z.B. gegen Manuale sprechen würde). 4.) Design-Mythos: “Verum et factum conventur” (Wahr sein und Hergestellt sein ist dasselbe - das von VICO 1710 eingeführte Verdict, das über Jahrhunderte das credo abendländischer Wissenschaft war) mußte zugunsten der Erkenntnis verworfen werden, daß selbstorganisierte Systeme zwar verändert werden können, aber nur entsprechend den inhärenten Strukturmöglichkeiten. Wieder müssen beispielsweise Physiker und Chemiker einfachen, “toten” Systemen mehr typische Eigenart zugestehen, die sich jeder designhaften Veränderung widersetzt, und die es durch Umgebungsbedingungen zu fördern (und nicht “herzustellen”) gilt, als der behavioristische Mainstream noch vor kurzem dem Menschen theoretisch zubilligen wollte. Nebenbei: auch in diesem Aspekt liegt nochmals begründet, daß sich Therapeuten “der Richtung A” nicht designhaft ausbilden lassen: Selbst weitgehend sklavisch Manuale vollstreckende Therapeuten wären immer noch Menschen mit spezifischen Eigenarten. Und nachdem selbst die VT die Bedeutung der therapeutischen Beziehung betont, kommen hier andere Aspekte mit auf den Plan, die den Therapieverlauf beeinflussen, als es im Manual vorherbestimmbar wäre (jedenfalls ist mit “Beziehung” gerade nicht eine “technische Vollstreckung” thematisiert). 5.) Genauigkeits-Mythos: Der Glaube, daß man nur genau genug messen müsse - oder genügend detaillierte Kenntnisse besitzen - um etwas genau vorhersagen zu können, ist tief in der klassischen Wissenschaft verbreitet gewesen. Mit dem Homogenitätsmythos zusammen bildete dies die Grundlage des Erfolges der Differentialrechnung in vielen technischen Anwendungsbereichen: Noch so komplizierte Verläufe lassen sich demnach letztlich, bei immer kleiner (genauer) werdenden Teilstücken durch gradlinige Übergänge annähern. Doch auch diese Ansicht hat sich - in dieser Allgemeinheit - durch die moderne Forschung als Mythos erwiesen: Bei rückgekoppelten Systemen ist mit fraktalen Verläufen zu rechnen - was faktisch bedeutet, daß auch eine immer weiter vorangetriebene Auflösung nur jeweils neue “Kompliziertheiten” zutage fördert. Selbst sehr einfache, von jedem Mittelschüler für wenige Schritte ausrechenbare Gleichungen, können im weiteren Verlauf unberechenbar werden (“determinstisches Chaos”). Auch diese Eigenschaften sind für lebende Systeme eher typisch - d.h. ihre Bedeutsamkeit und Wirksamkeit kann nur über artifizielle Ausklammerung der Rückkopplungen begrenzt werden. 6.) Kausalitäts-Mythos: Natürlich wollen und sollen Therapeuten (wie auch Systemwissenschaftler) etwa bewirken - Kausalität ist also nicht einfach “aufgehoben”. Allerdings mußte die klassische Vorstellung von Kausalität wesentlich modifiziert werden: Wie bereits genannt, können, je nach spezifischer Geschichte des Systems, kleine Ursachen zu großen Wirkungen führen (und umgekehrt), qualitative Sprünge können auftreten und Ordnung muß z.B. nicht dadurch hergestellt werden, daß Ordnung eingeführt wird, sondern daß (recht unspezifische) Umgebungsbedingungen gewährleistet werden, unter denen ein System seine inhärente Ordnung selbst realisiert. “Aufgehoben” ist also das Primat von lokaler Kausalität - die z.B. zur Anwendung kommt, wenn man eine verbeulte Blechbüchse wieder ausbeulen will. Bei einem Wasserfall aber läßt sich eine unerwünschte Kaskaden-Struktur ebenso wenig lokal “ausbeulen”, wie eine Kerzenflamme (im Gegensatz zum Stummel) einem Design in Form eines Osterhasen angepaßt werden kann. Genau dies eben sind die Unterschiede zwischen dynamischen und statischen Systemstrukturen. Prozesse des Lebens einschließlich biologischer, medizinischer, psychischer und interaktioneller Aspekte - sind aber nur als dynamische Systeme angemessen zu beschreiben. Die Leitideen von BlechbüchsenInterventionen als Reparatur einer Krankheit lassen sich nur unter extrem restringierten Bedingungen verwirklichen. Es gibt noch einige weitere überkommene Vorstellungen über das, was “wissenschaftlich” heißt - Vorstellungen, die zwar die Debatte um die Psychotherapieverfahren mit dem Anspruch von “naturwissenschaftlichen” Ideale durchgeistern, die aber von den heutigen Naturwissenschaftlern und Wissenschaftstheoretikern längst revidiert worden sind. Bereits aus den aufgeführten Aspekten aber folgt, daß wir methodisch wie methodologisch sehr viel vorsichtiger in den Aussagen über Ergebnisse und Effekte sein müssen, als es manche vollmundige Behauptungen mit Verweis auf gesammelte Signifikanzsterne wahrhaben wollen. Ich weiß, daß manche Gesundheitspolitiker und Vertreter der Krankenkassen uns zu einfachen Antworten auf ihre Fragen drängen. Es scheint am Zeitgeist zu liegen, daß angesichts einer immer komplexer werdenden Welt besonders die reduktionistischen, klaren, ohne von Bedenklichkeiten eingeschränkten Wahrheiten und Lösungen gesucht werden. Ob etwas “so oder aber so ist”, muß demnach “ohne wenn und aber” entschieden werden. Versucht man hingegen, der Komplexität nur etwas gerechter zu werden indem man beginnt, differenzierend zu erklären, “das hängt davon ab, wie...”, so steht man schon im Geruch, nicht “genügend zu wissen” um die Frage “ein für allemal endgültig klar zu beantworten.” So wenig, wie die Physiker dazu gedrängt werden können, nun endlich einmal klar zu entscheiden, ob Licht denn nun “wirklich Welle oder Teilchen ist”, sollten wir uns drängen lassen zu entscheiden, ob Verhaltenstherapie nun wirklich besser als Gesprächspsychotherapie ist (selbst wenn es reale Therapeuten geben sollte, die als “die” Repräsentanten “der” Verhaltenstherapie bzw. “der” Gesprächspsychotherapie anzusehen wären). Vielmehr sollten auch wir uns damit begnügen, daß je nach den Umständen unterschiedliche Therapeuten unterschiedlich vorgehen werden - Umstände, zu denen die Geschichte, einschließlich der Vorlieben und Befürchtungen, der Patienten, deren soziale, kulturelle, materielle und berufliche Eingebundenheiten, die bisherige Krankheitsentwicklung, die Persönlichkeit und Geschichte mit den spezifischen Vorlieben, Fähigkeiten und persönlichen Grenzen des Therapeuten gehören (um nur wenige Aspekte zu nennen). Worum es eher gehen sollte, ist, wie sicher gestellt werden kann, daß diese unterschiedlichen Therapeuten in unterschiedlichen Richtungen jeweils eine gute Ausbildung haben, die ihnen verantwortliches und kompetentes Handeln ermöglicht. Nimmt man beispielsweise einige der o.a. Aspekte, so wird man finden, daß die Berücksichtigung dieser Prinzipien moderner naturwissenschaftlicher Erkenntnis recht typisch ist für das, was humanistische Psychologie - also z.B. Gestalt- und Gesprächspsychotherapie - wesentlich ausmacht. Es sei gleichzeitig daran erinnert, daß noch vor nicht allzu langer Zeit diese Prinzipien moderner naturwissenschaftlicher Erkenntnis von manchem Psychologen als “schwärmerisch” belächelt und als eher “unwissenschaftlich” diffamiert wurden. Auch die Gesprächspsychotherapie wird heute im Kreise der kompetenten Wissenschaftler im Bereich klinischer Psychologie und Psychotherapie zwar als wissenschaftlich fundiert angesehen aber leider nicht etwa deshalb, weil sie diese Prinzipien in hohem Maße umsetzt und sehr differenzierte Konzepte dazu entwickelt hat, sonder vor allem deshalb, weil sie zusätzlich auch noch mit den klassischen Methoden genügend Signifkanzsterne zusammengesammelt hat ... Es ist allerdings ein Problem, daß Psychotherapien, die eher solchen systemtheoretischen Konzepten folgen - wie z.B. die Gesprächspsychotherapie oder die Familientherapie - gemessen am Alltagsverständnis, keine “einfachen” Konzepte sind. Ich habe kürzlich (Kriz 1998b) in anderem Zusammenhang auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die sich unserer Sprach- und Denkstruktur angesichts vieler wesentlicher Erkenntnisse dieses Jahrhunderts stellen: Typisch für eine systemische Betrachtungsweise ist nämlich im Wesentlichen prozeßhaftes Geschehen statt verdinglichter Objekte, Rückkopplung und Nicht-Linearität in diesen Prozeßverläufen sowie ein nichtlokales Verständnis von Kausalität. Unsere abendländische Sprache (genauer: SAE, d.h. standard average european) ist hingegen typisch verdinglicht und a-prozessual, bringt somit Objekte und Relationen zwischen ihnen ”zur Sprache”, und vermittelt lokale Kausalitäten -und dies liegt eben auch den Metaphern zugrunde, mit denen wir wesentlich die Welt begreifen. Die “Absurditäten”, “Widersprüche”, “Ungereimtheiten” moderner Physik lassen sich daher eben nicht angemessen in üblicher Sprache vermitteln sondern nur durch abstrakte mathematische Formalismen - vor deren Beurteilung sich Laien ehrfurchtsvoll zurückhalten. Im Bereich der klinischen Psychologie und Psychotherapie sind allerdings solche Formalismen in hohem Maße unüblich. Wie sollen aber z.B. einem Krankenkassenvertreter, der sich auf seinen “gesunden Menschenverstand” beruft, vermittelt werden, daß manche Therapiekonzepte auch dann (oder: gerade dann) “wissenschaftlich fundiert” und hoch “wirksam” sein können, wenn sie den üblichen Ursache-Wirkungs-Prinzipien, Aufteilung in abhängige und unabhängige Variablen etc. nicht in jedem Fall folgen. Am Beispiel der Gesprächspsychotherapie hat sich leider gezeigt, daß tausende erfolgreich behandelter Patienten (was sich ja anhand der Krankenakten verifizieren läßt) sowie viele auch mit “klassischen” Designs erbrachte Wirksamkeitsstudien manche Kassenvertreter in ihrer Skepsis gegenüber einem so komplexen Konzept wie der “Aktualisierungstendenz” nicht überzeugen konnte. Da das Wissen aus der interdisziplinären Systemforschung nur ganz langsam in die Allgemeinbildung diffundiert, wird dieses Sprach- und Denk(und Metaphern-)Problem noch eine erhebliche Zeit grundsätzlich bestehen bleiben - auch wenn erfreulicherweise mit dem neuen Gesetz endlich nur Wissenschaftler über “die Wissenschaftlichkeit” befinden werden.