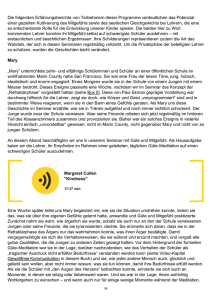Mary Douglas : Kosmologie von unten - E
Werbung

Mary Douglas : Kosmologie von unten Autor(en): Pfrunder, Peter Objekttyp: Article Zeitschrift: Du : die Zeitschrift der Kultur Band (Jahr): 53 (1993) Heft 11: Denkerinnen : endlich diese Wirklichkeit PDF erstellt am: 28.10.2017 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-306378 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Mary Douglas nimmt sie sich Ethnologinnen wie Um die Gesellschaft zu verstehen, studiert Mary Douglas Anthropologie. Alsjunge Forscherin Margaret Mead zum Vorbild. Bei den Lele in Afrika, zum erstenmal im Feld tätig, muss dass sie als Frau für die Erforschung der Mary sie erfahren, Rituale nicht zugelassen wird. Sie macht aus der Not eine Tugend und wendet sich den Lele-Frauen Douglas, geboren zu. Das Resultat: eine Studie über Reinheitsvorstellungen und Tabus, «Reinheit und Gefährdung», die ihren internationalen Ruf weit über 1921, lehrte seit Beginn Fachkreise hinaus begründet. Peter Ffrunder besuchte die emeritierte Anthropologin, die sich nach wie vor mit gesellschaftlichen Phänomenen der fünfziger Jahre an den wie der Darstellung von Gefahr auseinandersetzt, bei London. Universitäten Oxford und London, nach ihrer Emeri¬ tierung 1977 in den Ver- Kosmologie von unten 1949. Der einigten Staaten. Heute sation Abschied nimmt und per kleine Raddampfer löst sich Unilever-Lastwagen in eine völlig vom Pier, stampft gemächlich in lebt sie in England. Als isolierte Gegend fährt; wie sie mit den breiten Kongo-River hinaus den Bewohnern eines Lele-Dorund nimmt Kurs aufs Landes¬ Anthropologin mit dem fes Freundschaft schliesst und innere. Eine junge weisse Frau an sich in einer Hütte aus Bam¬ Bord schaut zu, wie die pittoreske Schwerpunkt Afrika ist sie bus und Palmblättern einrichtet; Szenerie der afrikanischen Stadt wie sie eines Nachts vor der allmählich einer üppigen Ufer¬ besondersan der Methode Türöffnung - extragross für den wildnis Platz macht. Sie ist al¬ Gast aus Europa - das bedroh¬ leine unterwegs, und sie freut logie der Sozialwissen liche Fauchen eines Leoparden sich auf ihr grosses Abenteuer. hört, mit einer Trommel Not¬ Zwei Wochen lang wird sie mit schatten interessiert signale gibt und von den herbei¬ dem Paddlesteamer flussaufwärts eilenden Männern ausgelacht fahren, um am Kasai, einem Sei¬ wird, weil der Leopard nur ein zufrieden grunzendes Schwein tenarm des Kongo, den Lele zu ist. Vor Leoparden, beschwich¬ begegnen, jenen Menschen, über die sie zu Hause so viel gelesen tigt man sie, brauche sie ohne¬ hat. Endlich, nach langen Vor¬ hin keine Angst zu haben, denn alle Leoparden seien in Wirklich¬ bereitungen, ist die Feldfor¬ keit Hexer, und die könnten ja schung in greifbare Nähe gerückt. «Einmal täglich legte der doch nur einem Lele Schaden Dampfer bei einem Dorf an; ich zufügen. Heute blickt Mary Douglas war beeindruckt von der Schön¬ heit der Frauen und Männer, die auf eine erfolgreiche Karriere zu¬ rück. Sie war Dozentin und Professorin an unser Boot mit Brennholz und Nahrung englischen und amerikanischen Universitä¬ versorgten. Als wir im Gebiet der Lele an¬ gekommen waren, holten mich zwei Missio¬ ten, ist noch immer «part-time Visiting Pro¬ fessor» in Princeton, hat unzählige Bücher nare mit langen Barten ab; ich hatte ihnen meinen Besuch angekündigt und durfte und Aufsätze veröffentlicht und sich im Be¬ einen Monat lang bei den Nonnen auf ihrer reich der Anthropologie weltweit als heraus¬ Station bleiben, um die Sprache zu lernen, ragende Persönlichkeit profiliert. Der lange denn es gab weder Grammatik- noch Wör¬ Marsch durch die akademischen Institutio¬ terbücher. Der einzige Lele, der ein wenig nen hat ihre Kräfte aber keineswegs auf¬ Französisch sprach und mich unterrichten gezehrt. Die hellen Augen sind noch immer voll von der forschenden Offenheit, mit der konnte, hatte eine Hasenscharte...» sie als 28jährige nach Afrika reiste. Konzen¬ VIERUNDVIERZIG JAHRE SPÄTER er¬ triert hört sie zu und denkt nach, bevor sie zählt Mary Douglas noch immer lebhaft spricht. Eine selbstbewusste, kultivierte In¬ und leidenschaftlich von der Feldforschung tellektuelle. Was aber suchte sie 1949 bei den Lele? im ehemaligen Belgisch-Kongo. Wir sitzen auf der schattigen Veranda ihres Londoner Wonach forscht eine junge weisse Frau in einer fremden, exotischen Kultur? Vorstadthauses, ein sonniger Junimorgen, frisch und klar. Die 72jährige Sozialwissenschaftlerin ist sichtlich bewegt, als sie sich MARY IST FÜNF JAHRE ALT, als sie von ihren Eltern nach Hause geschickt wird. Ihr an die Erlebisse bei «ihrem» Volk erinnert. Mary im Land der Lele : Es fällt nicht schwer, Vater arbeitet im «Indian Civil Service», sich vorzustellen, wie sie nach ihrer Ankunft einer Verlängerung des British Empire in Burma. Doch in den zwanziger Jahren gilt am Kasai-River so bald als möglich vom letz¬ das tropische Klima als ungesund für weisse ten Aussenposten der europäischen Zivili- LÉOPOLDVILLE, '^rt 22 Kinder, ausserdem fehlt es an Schulen, und so ziemt es sich, Mary bei ihren Grosseltern in England aufwachsen zu lassen. «Es war eine ausgesprochen friedliche Zeit, ich war abgeschirmt vom richtigen Leben. Alte Leute sind viel gelassener, haben die grossen Probleme hinter sich. Nie hatten wir Diskus¬ sionen ums Geld, nie hörte ich ein wirklich grobes oder zorniges Wort.» In der Geborgenheit sehnt sich die kleine Mary aber auch nach der exotischen Welt, in der ihre Eltern leben. Das Gefühl, nicht dort zu sein, wo sie eigentlich hin¬ gehört, begleitet sie. Es holt sie wieder ein, als sie 1943 in Philosophie, Politikwissen¬ schaft und Ökonomie abschliesst. Rund¬ herum tobt der Zweite Weltkrieg, und die frischgebackene Oxford-Absolventin sieht sich unnütz draussen stehen. Sie meldet sich beim Colonial Office in London, in der Ab¬ sicht, den Kolonien zu helfen und ihre Un¬ abhängigkeit vorzubereiten. «Ein grosser Irrtum.» Wenn es einen Ort gibt, wo wäh¬ rend des Krieges absolut nichts los ist, dann das Colonial Office. Ein weiteres Mal fühlt sich die junge, tatendurstige Frau vom Le¬ ben abgeschnitten. Mary ist frustriert, sie langweilt sich. Immerhin begegnet sie im Colonial Office einigen Anthropologen, unter ihnen Au¬ drey Richards und Raymond Firth, und be¬ ginnt sich für ihre Arbeit zu interessieren. Bis jetzt hat sie nicht einmal gewusst, dass es so etwas wie Anthropologie gibt. Als sie ihre Bücher liest, ist sie begeistert. Zielstrebig kehrt Mary nach dem Krieg nach Oxford zurück, um bei Meyer Fortes, Max Gluckman und E. E. Evans-Pritchard Anthropologie zu studieren. Macht sie nun das Abseitsstehen zum Programm? Dreht sich die Anthropologie nicht immer wieder um die Erfahrung des Aussenseiters, der Aussenseiterin? «Ja, aber bei der anthropologischen Ar¬ beit ist man zugleich mittendrin. Nehmen Sie Audrey Richards' Buch (Land, Labour and Diet in Northern Rhodesia), das ich damals gelesen hatte. Es geht darin um den Alltag in einigen Bemba-Dörfern, in denen sich die Frauen selber organisieren müssen, während sich die Männer in den Kupfer¬ minen abrackern. Richards' Beschreibun¬ gen lassen den Leser, viel mehr als andere wissenschaftliche Bücher, durchaus von innen her am Geschehen teilhaben. Auch Evans-Pritchards Buch über die Nuer nähert sich in einem philosophischen Sinn dem In¬ nersten der Kultur. Hinter meinem Interesse für Anthropologie steckt wohl auch der Wunsch, eine Gesellschaft aus dem Innern heraus zu verstehen. Natürlich war ich als weisse Feldforscherin in Afrika eine Aussenseiterin, es war mir klar, dass ich niemals ganz akzeptiert würde. Und dennoch hatte ich nie wirklich das Gefühl, ausgeschlossen zu sein.» INNEN UND AUSSEN. Ins Fremde vor¬ dringen und zugleich intensiv mit dem Eigenen konfrontiert sein: Mary Douglas weiss um die Projektionen, die aus dieser Ambivalenz entstehen können. Bei ihrem Wunsch, die Lele zu besuchen, sind auch romantische Vorstellungen im Spiel. Ge¬ wiss, 1949 gibt es gute wissenschaftliche Gründe, nach Afrika zu gehen. Die bestan¬ denen Anthropologen in Oxford sind alle¬ samt Afrikanisten, die grossen Theorien beruhen durchwegs auf Feldforschungen in Afrika. Mary interessiert sich vor allem für die matrilinearen Gesellschaften Zentral¬ afrikas und hofft, durch die Arbeit im Feld einige theoretische Lücken zu schliessen. Als sie auf einem Kongress einen belgischen Kolonialbeamten trifft, der ihr von den Lele vorschwärmt, ist ihr klar, dass sie an den Kasai-River will. «Ein abgelegenes Gebiet, ein unberührtes Volk, Pfeil und Bogen, Viel¬ männerei, exotische Riten und Menschen, die sich rot bemalen - das tönte alles furcht¬ bar aufregend.» Dank ihrer familiären Bezie¬ hungen zu den Kolonien hat sie keine Angst davor, als Frau allein ins Innerste Afrikas zu reisen. Für die junge Anthropologin ist der Umgang mit fremden Kulturen etwas Selbstverständliches, sie weiss, dass sie sich auch ausserhalb Europas zu Hause fühlen kann. Ermutigt und angespornt fühlt sie sich überdies durch die starke Tradition von Frauen, die als Feldforscherinnen berühmt geworden sind. Ja, Margaret Mead ist auch ihr ein Vorbild. Bei den Lele wird sich Mary allerdings bewusst, dass sie für die vorgesehenen For¬ schungen stark benachteiligt ist. «Die Män¬ ner organisierten alle wichtigen rituellen Ereignisse. Als Frau hatte ich absolut keine Chance, in die streng gehüteten Geheim¬ nisse der Männerbünde eingeweiht zu wer¬ den. Keine Frau wäre dazu imstande gewe¬ sen, auch wenn sie die Sprache besser be¬ herrscht hätte. Dabei wären die Kulte unent¬ behrlich gewesen für ein umfassendes Ver¬ ständnis des Lele-Weltbildes. Eigentlich ge¬ hörte ich für die Männer nicht einmal zu den Frauen, ich war sozusagen ein ge¬ schlechtsloses Wesen.» Dafür lernt Mary die Lele aus einem an¬ deren, durchaus faszinierenden Blickwinkel kennen; sie hat Zugang zum Alltag der Frauen, der einem männlichen Anthropo¬ logen verschlossen geblieben wäre. «Es war die Perspektive des Underdog. Aber daraus ergibt sich nur ein unvollständiges Bild der Lele-Kultur.» Nach einem Jahr reist die Forscherin mit dem unbefriedigenden Gefühl wieder ab, die Hexerei zu wenig verstanden zu haben. Trotzdem kann sie ihre Aufzeichnungen zu einer soliden, klassischen Monographie ver¬ arbeiten und in Oxford und London eine akademische Laufbahn beginnen. Die ent¬ scheidenden Fragen ergeben sich aus dem Vergleich mit den Arbeiten ihrer Kollegen: Warum fehlt bei den Lele und anderen Völ¬ kern Zentralafrikas der Ahnenkult, der sonst so zentral ist? Warum haben Hexerei und Schuldzuweisungen so grosse Bedeutung? «Dies ist in erster Linie eine Unter¬ suchung über Autorität - oder vielmehr: über ihr Versagen», lautet der erste Satz des Buches «The Lele of the Kasai», in dem sie 1963 die Ergebnisse ihrer Feldforschung präsentiert. Mary Douglas hat beobachtet, wie sich die Lele-Gesellschaft durch gegen¬ seitige Schuldzuweisungen ständig aufrieb und selbst zerstörte, während ein Nachbar¬ volk, die Bushong, sinnvolle Institutionen geschaffen hatte zur Bewältigung seiner Konflikte. «Ich begann mich dafür zu inter¬ essieren, unter welchen Bedingungen die Mitglieder einer Gesellschaft aufhören, sich in feindliche Parteien zu zersplittern und sich gegenseitig zu bekämpfen. Wie entsteht Solidarität? Der Horror vor einer in sich verfeindeten Gesellschaft prägte meine gan¬ zen späteren Forschungen.» LANGE ZEIT muss Mary Douglas aller¬ dings ihre wissenschaftlichen Ambitionen zurückstellen, als Mutter von drei Kindern bleibt ihr kaum Zeit für regelmässiges Publi¬ zieren. Erst viel später führt sie der Blick¬ winkel des Underdog, die Perspektive der politisch machtlosen Lele-Frauen, zu origi¬ nellen neuen Erkenntnissen. 1966, siebzehn Jahre nach dem Aufenthalt bei den Lele, legt sie das Buch «Purity and Danger» vor und macht sich damit weit über die Fachgrenzen hinaus einen Namen. Mary Douglas zeigt, dass Schmutz relativ ist und auf Grenz¬ linien verweist, mit denen eine Gesellschaft sich selbst und ihr Weltbild organisiert: «Schmutz als etwas Absolutes gibt es nicht: er existiert nur vom Standpunkt des Betrach¬ ters aus. Wenn wir uns davon fernhalten, so geschieht das nicht aus feiger Furcht und noch weniger aus Grauen oder heiligem Schrecken. Ebensowenig lassen sich alle unsere Massnahmen zur Beseitigung und Meidung von Schmutz mit unseren Vorstel¬ lungen von Krankheitsverursachungen er¬ klären. Schmutz verstösst gegen Ordnung. Seine Beseitigung ist keine negative Hand- lung, sondern eine positive Anstrengung, die Umwelt zu organisieren.» Reinigungsrituale aller Art, sagt Mary Douglas, dienen dazu, eine ihrem Wesen nach ungeordnete Erfahrung zu systemati¬ sieren. Schmutz ist also das Nebenprodukt dieses systematischen Ordnens und Klassifizierens von Sachen. Aus den kulturell be¬ dingten Schmutzvorstellungen lässt sich da¬ her ein Reinheitssystem ermitteln, dessen Symbolgehalt unübersehbar ist - ein Rein¬ heitssystem, in dem sich letztlich auch Vor¬ stellungen über Sein und Nichtsein, Gestal¬ tetes und Ungestaltetes, Leben und Tod spiegeln. Aber wie gelangt die Forscherin von ba¬ nalen, alltäglichen Handlungen zu den ge¬ sellschaftlich bedingten Auffassungen über die Wirklichkeit? Und was hat das alles mit der Underdog-Perspektive der Lele-Frauen zu tun? «Dass ich als Frau bei den Lele von eini¬ gen männlich dominierten Bereichen aus¬ geschlossen blieb, war vielleicht auch eine Chance. Ich verbrachte die meiste Zeit mit den Frauen oder mit alten und kranken Männern, die nicht auf die Jagd durften. Es war wie im Wartezimmer einer Arztpraxis. Die Leute berichteten mir von ihren Be¬ schwerden und zählten auf, was sie nicht essen durften. Allmählich konnte ich auf die tieferliegenden Vorstellungen über Schmutz, Abscheu und Verunreinigung schliessen. Indem ich den Alltag der LeleFrauen teilte, fiel mir auch auf, dass sie untereinander häufig zerstritten waren. Sie beschuldigten sich gegenseitig, Tabus ver¬ letzt zu haben und dadurch unrein gewor¬ den zu sein. Ansteckungsängste waren aus¬ serordentlich verbreitet. Wenn eine Frau krank war, verdächtigte sie eine andere, mit ihrem Mann geschlafen zu haben. Die Er¬ klärung für die Krankheit lautete dann, die Angeschuldigte habe auf dem Bett der Frau gelegen und es durch die Verletzung eines Tabus verunreinigt. Der Kontakt mit dem Bett habe die Frau schliesslich krank ge¬ macht. So erfuhr ich von all den physischen Kontakten, die die Frauen für gefährlich hielten; sie waren immer sehr besorgt um die Sicherheit ihrer Kinder, denn überall im Le¬ ben witterten sie schreckliche Ansteckungs¬ gefahren.» DIE ETHNOGRAPHISCHE BESTANDS¬ AUFNAHME bei einem Eingeborenen¬ stamm ist nutzlos, wenn sie keine Rück¬ schlüsse auf unsere eigene Gesellschaft er¬ laubt: Dieses Postulat steht über dem gesam¬ ten Schaffen von Mary Douglas, und sie weiss, dass es dazu einer klaren theoreti¬ schen Durchdringung des gesammelten Ma¬ terials bedarf. Konkrete Beobachtungen müssen in abstrakte Modelle gegossen wer¬ den. Mary Douglas bleibt nicht beim ober¬ flächlichen Vergleich zwischen dem Früh¬ jahrsputz in unseren Städten und dem S. 23 24: Muda Mathis, Der Dienstag (mit Renatus Zürcher) Swazi-Ritual zur Feier der Erstlingsfrüchte stehen: «Natürlich gibt es einen Zusammen¬ hang zwischen diesen Ritualen, mit denen verschiedene Gesellschaften ihre Umwelt organisieren. Jedesmal geht es darum, den unterschiedlichen kognitiven Systemen Ausdruck zu verleihen, das herrschende Weltbild in die Tat umzusetzen. Aber das ist banal und hat mich nie besonders beschäf¬ tigt. Die wirklich interessante Frage lautet doch: Woher kommen alle diese grund¬ legenden Vorstellungen und Überzeugun¬ gen, wie die Welt beschaffen sei? Wie ist es möglich, dass sich ein bestimmtes Weltbild durchsetzt? Wie entstehen die Klassifikations- und Wissenssysteme, die das Denken und Handeln des Individuums in be¬ stimmte Bahnen lenken?» Auf diese Weise dringt die Anthropo¬ login in immer tiefere und fundamentalere Schichten der Analyse vor; sie distanziert sich zunehmend von einer anschaulich be¬ schreibenden Ethnographie. Und doch blei¬ ben ihre Erfahrungen im Feld unterschwel¬ lig präsent. Noch mit ihrem letzten grossen Werk, «How Institutions Think» (1986), in dem sie komplexe erkenntnistheoretische Fragen erörtert, schlägt Mary Douglas eine Brücke zu den Lele: «Dies ist das erste Buch, das ich nach meinen Arbeiten über die Feld¬ forschung in Afrika hätte schreiben sollen.» Jedes ihrer Bücher sei gewissermassen die nachträgliche Einleitung zum jeweils voran¬ gehenden Buch, eigentlich hätte sie also in umgekehrter Reihenfolge schreiben müs¬ sen, zum Abschluss dann «The Lele of the Kasai». Wie bezeichnend für diese Forscherin. Weit entfernt vom persönlich gefärbten, halbliterarischen Stil, mit dem die Anthro¬ pologie heute Aufsehen erregt - und erwar¬ tet man von Frauen etwas anderes als Sub¬ jektivität? -, bleibt Mary Douglas selbst die grosse Abwesende in ihren Büchern. Sogar im Gespräch ist sie hinter ihrer distinguier¬ ten, intellektuellen Erscheinung schlecht in den Vor¬ dergrund zu rücken. Und diskret sind in ih¬ rem Haus die äusseren Zeichen, die auf die Erforschung exotischer Welten und fremder Kulturen hindeuten. Keine furchterregen¬ den Masken im Wohnzimmer, kein Speer¬ arsenal an der Wand. «Ich weiss, eine Reihe von jüngeren An¬ thropologen macht meiner Generation den Vorwurf, wir wollten bei unserer Arbeit Ob¬ jektivität vortäuschen. Aber die meisten, die sich selbst in ihre Forschungen einbringen, tun dies schlecht; ihre Ichbezogenheit finde ich schlicht langweilig, diesen Leuten fehlt es an echten Forschungsaufgaben. Nichts gegen Selbstreflexion, aber das muss be¬ herrscht sein. Victor Turner zum Beispiel hat sich in faszinierender Weise selbst mit einbezogen, indem er seine Beziehung zu den Informanten thematisierte. Ich hätte fassbar. Sie scheut sich, Privates das so nicht geschafft.» EXPLORATIONS IN COSMOLOGY lau¬ tet bereits 1970 der Untertitel zum Buch «Natural Symbols» von Mary Douglas. Der Abstraktionsgrad, auf den sie zustrebt, ver¬ trägt sich schlecht mit subjektiven Erlebnis¬ schilderungen. Ja, es hängt auch mit ihrem Erkenntnisinteresse zusammen, dass die Au¬ torin Mary Douglas in ihren eigenen Wer¬ ken kaum vorkommt. Wenn sie Rituale und Tabus, Tischordnungen und Speisegebote, Menüpläne und Einkaufskörbe, Witze und Mythen, Körpersprache und Ozonloch¬ debatten unter die Lupe nimmt, so will sie nicht nur zeigen, dass die Menschen mit diesen alltäglichen Dingen soziale Struktu¬ ren symbolisch zum Ausdruck bringen; es geht ihr auch um die zugrunde liegenden Klassifikationen, auf denen die gesellschaft¬ liche Konstruktion der Wirklichkeit beruht. Sie interessiert sich für das geistige Ord¬ nungssystem, mit dem sich die Menschen in der Welt orientieren, und sie fragt nach der Beziehung zwischen Ordnungssystem und Gesellschaftsform. Den Schlüssel dazu lie¬ fert ihr eine Theorie der Verantwortlich¬ keiten: «Die grundlegenden Ideen einer Ge¬ sellschaft sind stets gekoppelt mit den For¬ derungen, die die Mitglieder gegenseitig stellen, Weltbild und Wahrnehmung hän¬ gen davon ab, in welchem Mass die Men¬ schen einander Verantwortung und Schuld zuschieben. Anhand der Verantwortlich¬ keiten lassen sich Denken und Wirklichkeit miteinander verbinden. Die Art und Weise, in der sich Menschen untereinander verant¬ wortlich fühlen, bildet den Angelpunkt jeder Organisation, sei es ein einzelner Haushalt oder eine ganze Gesellschaft.» Wiederum klingt nach, was Mary Dou¬ glas bereits in ihrem Buch über die Lele präsentiert hat. Schon lange glaubt sie nicht mehr an einen fundamentalen Unterschied zwischen sogenannt primitiven und indu¬ striellen Gesellschaften. Ituri-Wald-Pygmäen und moderne Londoner Stadtmen¬ schen haben eine ähnlich lockere Einstel¬ lung zu Ritualen, magische Deutungen von Unglücksfällen und Gefahren lassen sich durchaus mit wissenschaftlichen Erklärun¬ gen vergleichen. Traditionelle Gesellschaf¬ ten kennen Tabu und Sünde, um das Verhal¬ ten ihrer Mitglieder zu lenken, die post¬ moderne Gesellschaft verwendet dafür den Begriff des Risikos; und bei der Wahrneh¬ mung und Beurteilung von Umweltrisiken zeigt sich, dass auch wir das Universum mo¬ ralisieren, indem wir unser Gesellschafts¬ ideal unausgesprochen auf die Natur über¬ tragen. Warum, fragt Mary Douglas, reden wir nicht direkt über dieses Gesellschafts¬ ideal, bevor wir uns auf einen unentscheidbaren Streit über Umweltschutzmassnahmen einlassen? halten meine Ansichten für komplett falsch. Das Wort Hierarchie löst heute bei den mei¬ sten Leuten so starke Abwehrreaktionen aus, dass sie kaum mehr nüchtern darüber nach¬ denken können. Aber was bedeutet Hier¬ archie? Nichts anderes als eine Rangfolge. Wenn man die akzeptiert und gewisse Kon¬ trollen einbaut, nähert man sich einem Mo¬ dell, das in traditionellen afrikanischen Kul¬ turen verbreitet war: überschaubare Hier¬ archien, in denen jeweils eine Gegenmacht existierte. Neben dem König gab es zum Bei¬ spiel die Königinmutter mit ihren Räten und Richtern, die die Handlungen des Kö¬ nigs überwachten. Schauen Sie, alle möglichen Systeme sind schlecht, jedes hat seine Fehler. Aber eine Gesellschaft, in der die individuellen Bedürfhisse Priorität haben, scheint mir viel gefährlicher als eine Hierarchie mit ein¬ gebauter Machtkontrolle. Individualismus führt zu einer unerträglichen Zersplitterung in feindliche Interessengruppen. Egalitäre Organisationen ohne Autorität sind in der Regel schwach und zerbrechlich. Ihre ver¬ unsicherten Mitglieder verzehren sich in sektiererischen Kämpfen. Davor habe ich Angst. Wohin das führt, habe ich bei den Lele in Afrika gesehen: Das Fehlen einer Autorität mussten sie mit abschreckenden und kräfteraubenden Mitteln kompensie¬ ren, um die innere Stabilität der Gesellschaft zu erhalten. Die meisten Mängel, die dem hierarchi¬ schen System angelastet werden, haben mit Vorurteilen zu tun. Man hat Angst vor der Macht und verwirft das ganze System, an¬ statt über Möglichkeiten der Machtkon¬ trolle nachzudenken. Der Mensch braucht einen reichen, komplexen und wohlorgani¬ sierten Kosmos, in dem er sich einrichten, eine Organisation, in die er Vertrauen haben kann. Das geht nicht ohne Autorität. Wenn man bereit ist, Autorität anzuerkennen ich halte das für ein Zeichen der Reife -, kann die Autorität auch aufdie unterschied¬ lichen Bedürfnissse einer Gesellschaft rea¬ gieren. Ein hierarchisches System ist viel eher in der Lage, ein Gesetz dem Einzelfall anzupassen oder Minderheiten zu schützen, und das ist doch ein kultureller Gewinn.» «MEIN PERSÖNLICHES IDEAL ist ein ENTSPANNT lehnt sich Mary Douglas in ihren Stuhl zurück. Ein zufriedenes, wohl¬ wollend-verschmitztes Lächeln huscht über ihr Gesicht. Die Anthropologin weiss um die irritierende Wirkung ihrer Worte. Aus¬ gerechnet sie, die weltoffene, scharf analy¬ sierende, differenziert und liberal denkende Wissenschaftlerin, ausgerechnet sie plädiert für eine hierarchische Gesellschaft? Seltsam. Was voreilig als unreflektiertes reaktionäres Geschwätz abgetan werden könnte, klingt bei ihr vernünftig und wohldurchdacht. «Ja, auch den Frauen ginge es in einem gutes hierarchisches System. Ich weiss, da¬ mit liege ich nicht im Trend, viele Freunde guten hierarchischen System besser», ant¬ wortet sie ruhig. Sie verweist auf persönliche 26 Erfahrungen im früheren britischen Univer¬ sitätsbetrieb. Eine funktionierende hierar¬ chische Struktur erlaubte ihr grosse Freihei¬ ten und eine Sonderstellung als Frau, so dass sie neben der wissenschaftlichen Arbeit ihre drei Kinder grossziehen konnte. «Zwischen meiner Feldforschung und dem Buch dar¬ über vergingen ganze fünfzehn Jahre. So etwas wäre zum Beispiel an einer egalitär organisierten amerikanischen Universität undenkbar. Eine Frau, die zehn Jahre nach ihrer Feldforschung noch keine Publikation vorweisen kann, weil sie sich eben der Fami¬ lie widmet, fällt aus dem akademischen System heraus. Auch bei uns haben es die Frauen heute viel schwerer; sie stehen nicht nur unter enormem Druck zu publizieren, es wird ihnen auch viel administrative Ver¬ antwortung aufgebürdet. Im ganzen müssen sie mehr leisten als die Männer, um sich zu behaupten. Ich war in meiner Zeit aus¬ serordentlich privilegiert.» Mechanisch verstandene Gleichheit, schreibt sie, verstümmelt die Vielfalt der menschlichen Bedürfnisse. «Wahrscheinlich geniesse ich ein höhe¬ res Ansehen, als wenn ich ein Mann wäre. Aber das heisst nicht, dass meine Bücher wirklich ernst genommen würden. Um Ein¬ fluss aufdie Entwicklung der Anthropologie zu nehmen, hätte ich eine wichtigere aka¬ demische Position bekleiden müssen. Sol¬ che Verpflichtungen konnte ich aber neben der Familie nicht auch noch übernehmen.» Heute hat sie das Gefühl, ausserhalb ihres Faches zu stehen, weil sie sich mit Fragen beschäftigt, für die sich andere An¬ thropologen kaum mehr interessieren. «Es gibt einen generellen Trend gegen theore¬ tische Ansätze. Ein aussenstehender Autor, der meine Biographie schreibt - eine Ehre, die mir als Mann kaum widerfahren wäre -, hat bei der Durchsicht meines Werkes fest¬ gestellt, dass ich mich meist im Mainstream der klassischen Anthropologie bewegte. Und doch gilt mein Werk unter den heuti¬ gen Vertretern der Disziplin als exzentrisch. Das verbindet mich übrigens mit einigen an¬ deren Anthropologinnen. Man kann meine Ideen leicht übergehen, sie spielen in der aktuellen anthropologischen Diskussion eine untergeordnete Rolle.» Eine Frau, die für hierarchische Struk¬ turen eintritt und mehr Theorie fordert? Unzeitgemäss, gewiss. Aber aus dem Ab¬ seits, das hat Mary Douglas schon früh er¬ fahren, kommen nicht die schlechtesten Einsichten. Und im Wartezimmer gesche¬ hen zuweilen bedeutendere Dinge als auf der Intensivstation. ¦ 1¦ Sprachliche Systeme stellen ein Zusammenwirken von Regeln dar, die ihrerseits das Ergebnis von Geschichte und Gebrauch sind. Dieses Zusammenwirken geschieht in einer aktiven und einer passiven Weise: Informationen werden ausgesendet (Sprechen und Schreiben) und empfangen (Hören und Lesen). Weil die Sprache ein abstraktes System von Zeichen und Symbolen ist und weil der Kontext sich immer ändern kann, ist die Interpretation subjektiv. Aber es herrscht doch breite und wechselseitige Übereinstimmung über die Bedeu¬ tung und Funktion von solch grundlegenden Elementen der (indoeuropäischen) Sprache und Grammatik wie Buchstaben und den Abständen zwischen ihnen. Auf der Mikroebene von Worten und kurzen Sätzen ist die Funktion dieser Grundelemente für die Entstehung von Sinn ent¬ scheidender als in längeren Abschnitten. Hier liegt das Hauptinteresse meiner Arbeit, da wo Abwesenheit, Anwesenheit, Wiedereinfügung oder Veränderung von einer dieser kleinen Ein¬ heiten die sprachliche Folge stören und dabei Muster und Systeme freilegen, die über ihre erwartete Funktion hinausgehen, sie übererfüllen. Lektion 1 erzählt eine knappe und sparsam ausgestattete Geschichte aus nur drei Wörtern, indem sie deren neun Buchstaben dazu bringt, eine Handlung aus einem Verb, einer Konjunktion und einem Substantiv herzustellen. Der Buchstabe A, der von zwei Ds gefolgt wird, ergibt ADD, ein Wort, das die Bedeutung von «vermehren, hinzufügen» hat. In der Tat nehmen die Ds innerhalb des Wortes zu. Zusätzlich wird jetzt das mittlere D durch ein N ersetzt, um AND herzustellen, wobei die Anweisung von ADD befolgt und es durch ein anderes Wort ergänzt wird. Das neue Wort, AND, genügt ausserdem seiner eigenen Definition als VerbindungsWerknüpfungswort durch seine Posi¬ tion in der Mitte. Indem man nun das Position. Eine minimale, fast un¬ bewusste weise, Vorgehens¬ bei Buchstabe der in ein jedem Wort verschoben wur¬ de, erlaubte es, dass das Wort ADD sich auf systematischem Weg in eine kurze Geschichte verwandelte, indem es eine Mitte und ein Ende aus seinem einfachen, unspektakulären sprung Ur¬ erschuf. Die Lektüre muss aktiv und scharfsichtig sein, um Publikationen: «Purity and Danger», London 1966 (dt. «Reinheit und Gefährdung', Suhrkamp). «Natural Symbols», die London 1970 (dt. «Ritual, Tabu und KörperSymbolik», Tischer TB 7365). «Essays in the Sociology of Perception», London 1982. «Risk and Culture», Berkeley 1982. «Risk Acceptability according to the Social Sciences», New York 1985. «How Insti¬ tutions Think», Syracuse 1986. «Risk and Blame, Essays in cultural theory», London 1992. Geschichte in diesem Rudimente für ein E austauscht, um END herzustellen, hat vervollständigt. Die Bedeutung eines jeden Wortes entspricht seiner man die Sequenz zeitlichen A einer sehr gedrängten Text wahrzunehmen. 27