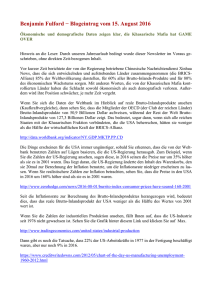Marktbericht 23
Werbung

Marktbericht 23.11.2007 / nicht still sitzen Drei Tage ohne Buch - und deine Sprache verliert an Geist, dein Gesicht an Glanz. (Huang Ting-Tschien) Bücher bringen uns die Welt durch Geschichten näher. Geschichten, die fesseln, in die wir versinken, die uns verzaubern, die uns aber auch den Blick auf eine Welt öffnen, die wir vielleicht so nicht wahrnehmen. Dem kann und darf sich auch ein Börsianer nicht entziehen. Manchmal sitze ich einfach da, schaue in den Himmel, staune und denke: Das ist doch das Schönste auf der Welt, und du machst etwas falsch, wenn du so gnadenlos mit dir umspringst. Aber da ist auch das Andere, das mich treibt: die Neugier. Wir leben in einer Welt, die jeden Tag so viel Neues entwickelt und gleichzeitig das Alte in einer Weise aufbereitet wie nie zuvor. Nie war so viel Wissen verfügbar. Das Leben ist kurz, und wir wissen, dass wir nur sehr wenig erfahren und noch viel weniger weitergeben können. Wie soll man da still sitzen? „Alt geworden, betrachte ich aber auch eine Welt, die anders, aber nicht viel vernünftiger geworden ist (J.R. von Salis).“ Wie soll man da still sitzen, wenn China sich mit der Frage balgt: Wohin mit den vielen Dollars? Sollte das Land sich entscheiden, seine Devisenpolitik umzukrempeln, schadet es sich selbst. Bis vor kurzem noch sahen wir China bloss als Werkstatt der Welt, weil das Land alle nur erdenklichen Billigprodukte herstellte und exportierte. Von China als Weltfinanzmacht war keine Rede. Jetzt aber geht es Schlag auf Schlag. Die Chinesen stellen den Wert der amerikanischen Leitwährung in Frage. Unvorstellbar war auf diesem Hintergrund nicht die Kursentwicklung des "Greenback", sondern die Tatsache, dass die Chinesen erstmals in der Geschichte bei solchen Dingen mitreden und mitmischen.. Bisher legte das Reich Mitte zwei Drittel der aufgehäuften Währungsreserven in amerikanischen Staatsanleihen an, finanzierte damit einen Teil des horrenden US-Hausaltsdefizits und stützte den Dollar. Alle schienen sie zufrieden. Die Chinesen produzierten billig, die Amerikaner konsumierten billig. Aber das Geld, das in Peking die Tresore füllt, wurde immer mehr und jetzt, wo die amerikanische Wirtschaft aufgrund der Kreditkrise wankt und der Dollar böse flattert, wird die Lage immer brisanter. Alle Welt starrt gebannt auf Peking. Jeder will wissen: Was führen die Chinesen im Schilde? Stossen sie die US-Währung ab? Diversifizieren sie ihre Anlagen? Plötzlich droht der Devisenberg in Peking zum Vulkan zu werden. Das Geld, auf dem China sitzt, kann der Weltmarkt wahrscheinlich nur sehr mühsam verdauen. Es ist einfach zu viel. Doch jeder Versuch, weniger in USDollars zu investieren, liefert ein Zeichen und zieht den Dollarkurs weiter in den Keller. Das bringt der chinesischen Zentralbank Milliardenverluste. Noch mehr in den Dollar zu pumpen - mit all den Fragezeichen, die sich über der amerikanischen Wirtschaft ballen - endet aber ebenfalls in herben Verlusten. Die Debatte spaltet die Pekinger Führung. Finanzreformer, wie der ausscheidende Zentralbankchef Zhou Xiaochuan, wollen Chinas verschlossenen Kapitalmarkt öffnen. Für sie ist eine konvertible Währung nur noch eine Frage von wenigen Jahren. Doch auf die liberalen Reformer, die noch ExPremier Zhu Rongji in ihre Ämter hievte, folgen heute nicht selten marktskeptische Kader um Parteichef Hu Jintao. Sie trauen den internationalen Finanzmärkten nicht über den Weg. Für sie sind die Devisenreserven Rücklagen für das alternde China. Mehr als 1'400 Milliarden Dollar für 1.3 Milliarden Chinesen macht nur rund 1'000 Dollar pro Person. Sie rechnen lieber sozial- als währungspolitisch. Bis heute entpuppt sich der US-Dollar als wichtigstes Zahlungsmittel im globalen Handel. Gütergruppen wie Rohöl und Metalle werden in der US-Währung abgerechnet. Zentralbanken und Währungsbehörden greifen zum Dollar, wenn sie Devisenreserven aufbauen. 65 % der weltweiten Reserven lauten, nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds, auf Dollar. Doch nicht nur die Chinesen, auch die Japaner und die Golfstaaten mit ihren gigantischen Erdöleinkommen nutzen den "Greenback", wenn sie ihre Vermögen investieren. Der Euro hat zwar in den vergangenen Jahren mächtig zugelegt, vereinigt aber nur auf 26 % aller Reserven auf sich. Staats- und Unternehmensanleihen werden überwiegend in Dollar begeben, und Länder wie Saudi-Arabien oder China koppeln ihre eigene Währung ganz an die amerikanische. Auch die Araber scheinen nun aber kalte Füsse zu bekommen. Spekulationen über eine Lockerung der engen Dollar-Anbindung liessen die Währungen von 6 Golfstaaten aufwerten. Die neu entfachte Kontroverse über die künftige Währungspolitik der sechs im Golfkooperationsrat zusammengeschlossenen Länder Saudi-Arabien, VAE, Kuwait, Katar, Bahrain und Oman traten die Vereinigten Arabischen Emirate vor einigen Tagen los. Zentralbankgouverneur Sultan Nasser alSuweidi sinnierte dabei über die Einführung eines Währungskorbes nach, aber verdeutlichte, dass er nur zusammen mit Saudi-Arabien und anderen Mitgliedern des Rates handeln werde. Kuwait knüpfte seine Währung bereits im Mai an einen solchen Korb. Reuters zitierte in den letzten Tagen saudische Quellen, wonach das Königreich über eine einmalige Aufwertung nachdenke. Ohne Zweifel heizt der taumelnde US-Dollar die Teuerung in der Golfregion sichtlich an und der Preisdruck könnte sich mit Blick auf möglicherweise weiter fallende Notenbankzinsen in den USA weiter verschärfen. Ein Land, das sich mit kletternden Inflationsraten konfrontiert sieht, sollte seine Währung nicht an ein rezessives Land wie die USA koppeln. Klar ist, dass der Abnabelungsprozess der Länder im Golfkooperationsrat voranschreitet, doch noch nicht so zügig, dass sich daraus in naher Zukunft ein weiterer Zerfall des US-Dollars ablesen liesse. Bewegt sich die Weltwirtschaft auf ein neue Gleichgewicht zu? Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus: Die Zweifel an der ökonomischen Leistungskraft der Vereinigten Staaten wuchern ungehemmt. In den verflossenen Jahren hielten die Amerikaner ihre Ökonomie hauptsächlich durch den Konsum am Laufen und sie liehen sich das Geld dafür im Ausland. Ansonsten herrschte mehr oder wenige Flaute. Amerikanische Unternehmen verlieren weltweit an Marktanteilen, einst stolze Bereiche wie die Automobilindustrie liegen danieder. Und jetzt bremst auch noch die Krise am Immobilienmarkt den privaten Verbrauch, die Existenzgrundlage. Firmen und Verbände sagen das schlechteste Weihnachtsgeschäft seit 2002 voraus und der Wohnungsbau schrumpft stetig. Auch Ben Bernanke, der US-Notenbankchef, sieht dunkle Wolken am Himmel aufziehen: Die Wirtschaft werde sich merklich abkühlen und deutete damit an, dass er die Zinsen noch weiter kappen könnte. Erste Wetten werden abgeschlossen, wann die Chinesen die Führungsrolle am Devisenmarkt an sich reissen. Das stark aufblühende Land wird, nach Berechnungen der Investmentbank Goldman Sachs, schon 2040 die USA als mächtigste Volkswirtschaft dieser Erde abgelöst haben. Doch im amerikanischen Finanzministerium gibt man sich noch gelassen. "Wir beobachten, dass die Wirtschaft sich allmählich auf ein neues Gleichgewicht einstellt", mutmasst Ted Truman, Währungsexperte am Peterson Institute for International Economics in Washington. Dafür sorgten gerade die Immobilienkrise und der schlaffe Dollar. Das Argument läuft ungefähr so: Die Amerikaner sparen mehr, weil sie sich nicht mehr auf einen stetigen Wertzuwachs ihrer Häuser verlassen können. Das knebelt zwar den Konsum, weil aber zugleich die Währung abwertet, werden Exporte lukrativer. Dadurch kann der Nachfrageausfall im Inland abgefedert, wenn nicht gar ausgeglichen werden. Der Kursverlust des "Greenbacks", der Europas Exporteuren das Leben immer schwerer macht, kommt also den US-Behörden überaus gelegen - und es ist unwahrscheinlich, dass sie etwas dagegen unternehmen werden. John Connally, Finanzminister unter Richard Nixon, hat in einer ähnlichen Situation einmal gesagt: "Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem." Eine kurzfristige Abwertung zulassen, um langfristig die Wirtschaft und letztlich die Währung zu stabilisieren, so beschreiben verschiedene Offizielle das angestrebte Kalkül. Das jedoch ist riskant. Ein regelrechter, panikartiger Absturz des Dollars könnte schwerwiegende Verwerfungen in der Weltwirtschaft heraufbeschwören, die auch die Amerikaner am Wickel packen würden. Die Rechnung geht nur dann auf, wenn jene Länder, die bislang davon Nutzen gezogen haben, dass sie ihre Waren in die USA verschiffen und verhökern konnten, jetzt einer Aufwertung ihrer eigenen Währung nicht mehr im Wege stehen und mehr Exporte der Amerikaner absorbieren. Bis heute wehren sich dagegen vor allem die Schwellenländer. China verhindert mit Eingriffen am Devisenmarkt, dass der Dollar gegenüber dem Renminbi an Wert verliert. Indien stemmt sich mit Kapitalverkehrskontrollen gegen den Aufwärtstrend der Landeswährung. Aber auch in Europa regt sich Widerstand. Die französische Zeitung "Le Monde" spielte bereits mit dem Gedanken eines "monetären Weltkrieges". Doch ob sich Europäer und Asiaten dauerhaft gegen den Dollarverfall aufbäumen können, gilt unter Experten als fraglich. Aber auch die folgende Überlegung dürfen wir auf gar keinen Fall unterschätzen: In der Vergangenheit bewiesen die USA immer wieder, dass, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, sie mit schwierigen Situationen umzugehen verstehen. Wie dagegen China reagiert, wenn sich deren Wirtschaft einmal abschwächen sollte, ist noch völlig offen. Das gilt auch für die Euro-Zone: Die Währungsunion erfreut sich einer Zentralbank, die zeigt, dass sie für eine Krise gerüstet scheint. Ob die politischen Institutionen es auch sind, muss sich erst noch weisen. In regelmässigen Abständen wird an den Finanzmärkten sogar die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Währungsunion diskutiert und darüber auch heftig spekuliert. Eine gesalzene Quittung: Die kriegen die amerikanische Notenbank (Fed), die Europäische Zentralbank (EZB) und damit die Finanzwelt jetzt zu spüren. Überall nagt die Inflation im Gebälk. Dummerweise lässt sie sich auch in Europa nicht mehr verstecken. Trotz verhaltener Lohnabschlüsse, eines wohl kaum überbordenden Wirtschaftswachstums und einer starken Aufwertung der Währung pendelte die Teuerung seit 2000 im Jahresmittel immer über 2 % - und die Risiken schwellen weiter an. Von der Zeit der Euro-Einführung abgesehen, fühlte sich die Inflation seit Mitte der 80er-Jahre nie beissender als heute. Denn ob Milch, Butter, Brot, Zucker, Weizen und andere Rohstoffe, Häuser, Aktien oder Kunst, die ungeheuere Geldmengenexplosion der letzten Jahre liess die Preise in die Höhe schnellen. Die Verdoppelung des Goldpreises sogar in Euro seit 1999 sagt eigentlich alles. Wie die Fed hat es auch die EZB diesmal sehr schwer, den Finanzwerten, die irrwitzige 29 % des Stoxx 600 widerspiegeln, rechtzeitig unter die Arme zu greifen. Völlig Überspannt - wer soll das noch verstehen? Im veröffentlichten Abschreiber von 1.2 Milliarden Franken liegt nicht das Problem. Das kann die Swiss Re verkraften. Das Problem steckt in der Tatsache, dass diese Verluste keine zwei Wochen nach einer frohgemuten Quartalsberichterstattung auftauchten. Kein Wunder bricht das Vertrauen weg. Offensichtlich sind die Prognosen für den Finanzsektor kaum das Papier wert, auf dem sie geschrieben wurden. Immer offenbarer wird, dass sich die Kreditkrise nicht auf US-Ramschhypotheken und den unzähligen, davon abgeleiteten Konstruktionen mit mehr oder weniger unaussprechlichen Namen beschränkt. Nachdem die Schulden der Privatpersonen in den USA und im Euro-Raum binnen 10 Jahren um rund 9'000 Milliarden Euro schneller anstiegen als das kombinierte, nominale Bruttoinlandprodukt (BIP), dürften viele andere Kredite und Kreditderivate in die Luft fliegen: europäische Hypotheken ebenso wie Darlehen von Firmen, die von Beteiligungsgesellschaften mit Schulden überfrachtet wurden, und Firmenkredite minderer Bonität ganz allgemein. Und spätestens seit Swiss Re muss jedem klar sein: Der Sprengstoff klebt nicht nur in den Büchern der Banken (die Bilanzsumme des Bankensystems im Euro-Raum ist über die verflossenen 10 Jahre hinweg um sagenhafte 11'829 Milliarden Euro explodiert), sondern in der gesamten Finanzwelt, die Versicherer eingeschlossen. (Financial Times Deutschland) "Lustige oder eher ganz bizarre Bankenwelt": Wall Street Banken beabsichtigen anscheinend $ 38 Milliarden Boni auszuschütten, während ihre Aktionäre $ 74 Milliarden ans Bein streichen müssen. Teilweise lässt sich diese Absurdität damit erklären, dass Boni für die Vergangenheit bezahlt werden, die Börse aber versucht, in die Zukunft zu gucken. Und die Banken haben 2007 - trotz erster nicht zu unterschätzender Abschreibungen - sehr gut verdient. Fühlen sich die verwöhnten Banker dafür nicht gebührend entlohnt, könnten sie schnell abwandern. Kritische Fragen: Will der Citigroup-Analyst mit seiner Hochstufung des US-Bankensektors gut Wetter machen, da er weiss, wie sehr die eigene Bank dieses braucht? Goldman Sachs legt seinen Kunden übrigens nahe, die Citigroup-Aktie zu verkaufen. Viele werden ihm das wohl kaum verzeihen. Doch wie sind unterschiedliche Meinungen aus dem gleichen Hause zu interpretieren? Wenn Goldmans Investment Strategin dem S & P 500-Index dieses Jahr noch über 11 % zutraut, während der Chefvolkswirt argumentiert, dass eine mögliche Kreditverknappung sich wirtschaftlich nicht sehr belebend auswirken wird, kratzen wir uns verständnislos am Kopf. Siehe dazu auch mein Mail vom vergangenen Dienstag. Wenigstens können die Banker durch rege Reise- und Einkaufstätigkeiten dafür sorgen, dass zwei Bereiche, welche die abflauende Konjunktur bereits scharf zu spüren bekommen - Einzelhandel und Transport -, ein wenig entlastet werden. J.R. von Salis trifft den Nagel wahrlich auf den Kopf: Wir betrachten eine Welt, die anders, aber nicht viel vernünftiger geworden ist. Meiner Meinung nach, ist das globale Papiergeld-System noch sehr jung. Sein fortgesetztes Funktionieren beruht auf dem GLAUBEN, dass die Schulden, auf denen es basiert, eines Tages auch zurückbezahlt werden.