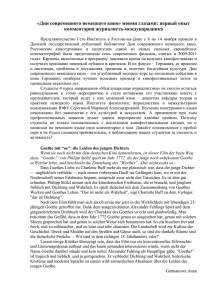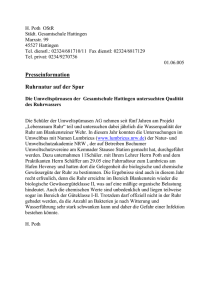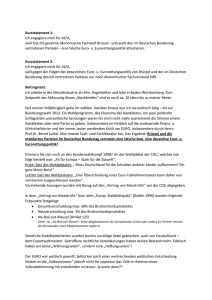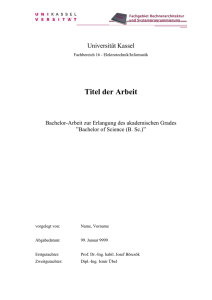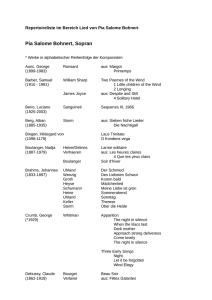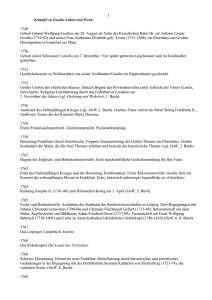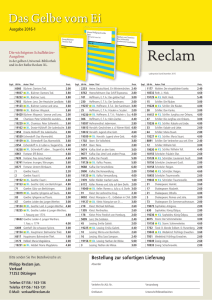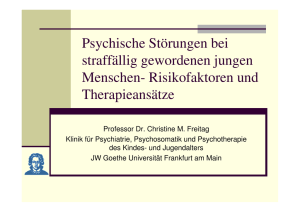- collasius org index
Werbung

1 ____________________________________________________________COLLASIUS S. Winkle Die Ruhr als Kriegsseuche während der Campagne in Frankreich 1792 in den Aufzeichnungen von Goethe und Laukhard ______________________________________________________________________ „Il vaut mieux donner la bataille la plus sanglante que mettre les troupes dans un lieu malsain.“ Correspondance de Napoléon 1, Tome 22, Nr. 18041, p. 411., Paris 186'7. ______________________________________________________________________ Dem Andenken des Belgrader Mikrobiologen Prof. Dr. med. Adam Miljkovic (1902-1987), den ich als junger Arzt im Spätherbst und Winter 1937/38 während einer schweren Ruhr- und Fleckfieber-Epidemie in Skoplje nicht nur als Arzt und scharfsinnigen Epidemiologen, sondern auch als Menschen von außergewöhnlicher Güte, Hilfsbereitschaft und Toleranz kennen und schätzen gelernt habe. ______________________________________________________________________ Die von dem revolutionären Paris ausgehenden Gefahren ließen sogar die verfeindeten Preußen und Österreicher zusammenrücken. Nach der Festnahme Ludwig XVI. überschritt im August 1792 eine preußisch-österreichische Armee die französische Grenze, um „die Pest der Rebellion, ehe sie für die Nachbarstaaten bedrohlich werden konnte, im Keime zu ersticken". Preußen stellte dabei 42.000, Österreich mit den Truppen aus Belgien 72.000 Mann. Hinzu kamen noch etwa 3.000 Emigranten. Der Weimarer Herzog Carl August nahm als Kommandeur eines preußischen Kürassierregiments am Feldzug teil. In seiner Begleitung befand sich auch Goethe. Dem vortrefflich gedrillten, verbündeten Söldnerheer konnte der französische General Dumouriez nur eine schlecht bewaffnete, elend ausgerüstete und kläglich verpflegte Masse von Freiwilligen entgegensetzen. Der Herzog von Braunschweig, der die feindlichen Heere der Verbündeten führte, hatte bereits am 25. Juli ein Manifest erlassen, in dem er drohte, „Paris zu zerstören, wenn die Pariser Kanaille es wagen sollte, die Tuilerien anzugreifen", in denen sich der König, nur von den Schweizer Garden beschützt, aufhielt. Durch dieses Manifest wurde der Verteidigungswille der französischen Massen erst recht entfacht. Der unüberlegten Drohung antworteten die kühnen Klänge der damals entstandenen Marsaillese: „Aux armes, citoyens!" (1) Doch die Verbündeten waren durch Unkenntnis der Verhältnisse voller Verachtung für den Gegner, dem sie keinen ernsthaften Widerstand zutrauten. Sie betrachteten hochmütig den bevorstehenden Feldzug nur als einen „militärischen Spaziergang (2). „Es geht alles so geschwind, daß ich wahrscheinlich bald wieder bei Dir bin [...] Aus Paris bringe ich Dir ein Krämchen mit", schrieb Goethe am 2. September, an Porträt des Schriftstellers Christian Friedrich Laukhard (1758-1822). Zeitgenössischer Kupferstich im 3. Band von „Laukhards Leben und Schicksale, von ihm selbst beschrieben" Leipzig 1796. 1 2 dem Tag als Verdun fiel, an Christiane Vulpius. In seiner später verfaßten autobiographischen Schrift „Campagne in Frankreich 1792" berichtet Goethe, wie er einen Tag vorher (am 1. September) bei der Belagerung von Verdun mit dem Fürsten Reuß hinter Weinbergsmauern auf und ab wandelte und sich mit diesem während eines gewaltigen Bombardements über die Lichtphänomene der Granaten, Brandraketen und Feuersbrände im Sinne seiner Farbenlehre unterhielt. BILD Der französische General Kellermann mit seinem Stab auf dem legendären Feldherrnhügel mit der Windmühle während der Kanonade von Valmy am 20. September 1792. Stich nach einer Zeichnung von H. Vernet. Aus: Galéries Historiques de Versailles. Man war sich des Sieges sicher. Doch das „wohlgedrillte Koalitionsheer" war mit einer „lahmen Heerführung" gesegnet, die es versäumte, nach der Übergabe der Festungen Longwy (am 23. August) und Verdun (am 2. September) die Argonnenpässe, die „Thermopylen Frankreichs", rasch zu besetzen, ehe sich Dumouriez von Sedan und Kellermann von Metz her bei Valmy vereinten (3). Zu den strategischen Fehlentscheidungen kam hinzu, daß das Invasionsheer mit einer „verheimlichten Lagerseuche" behaftet war, der Ruhr. Magister Laukhard, der als gewöhnlicher preußischer Musketier am Feldzug teilnahm, hat in seiner Autobiographie über diese Kriegsseuche ausführlich berichtet (4). Die Verbündeten hätten zwar ihre strategischen Versäumnisse wieder gutmachen können, wenn es ihnen gelungen wäre, am 20. September durch einen Sturm auf die feindlichen Stellungen bei Valmy die beiden Revolutionsgeneräle mit ihren Truppen von der Straße nach Chalons und Paris abzuschneiden. Doch das vom Dauerregen aufgeweichte Terrain war nicht der einzige Grund dafür, daß der Laufschritt der vorgehenden Infanterie gehemmt wurde und der Sturmangriff abgeblasen werden mußte; auch die verheimlichte Seuche hatte die Schlagkraft der Armee geschwächt (5). Als das Ganze mit einer allgemeinen Kanonade endete, kam der von den Verbündeten nicht genutzte Augenblick einer folgenschweren Niederlage gleich. „Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus und Ihr könnt sagen, Ihr seid dabei gewesen." Diese visionär klingenden Worte, die Goethe am Abend nach der Kanonade von Valmy am 20. September am Lagerfeuer zu einer Gruppe von preußischen Offizieren gesagt haben will, hat er wahrscheinlich erst 1820, als er seine alten Aufzeichnungen „aufgefrischt' unter dem Titel „Campagne in Frankreich" in Druck gab, hinzuerfunden (6). Dafür spricht auch Goethes Bekenntnis, das aus seinem zwei Jahre später erfolgten Gespräch mit Eckermann am 4. Januar 1824 hervorgeht: „Es ist wahr, ich konnte kein Freund der Französischen Revolution sein, denn ihre Greuel standen mir zu nahe und empörten mich täglich und stündlich, während ihre wohltätigen Folgen damals noch nicht zu ersehen waren..." Bei Valmy hatte sich das Schicksal der Französischen Revolution entschieden (7). Es war zugleich auf die Zukunft vordeutend, der erste große Interventionskrieg aus weltanschaulichen Gründen. Man stand nicht nur einer Streitkraft, sondern auch einer Idee gegenüber. Nach der Kanonade von Valmy war die Betroffenheit beim Interventionsheer ungeheuer. 2 3 „An den Stellen", schreibt Goethe, „wo die Kanonade hingewirkt, erblickte man großen Jammer: die Menschen lagen unbegraben und die schwer verwundeten Tiere konnten nicht sterben. Ich sah ein Pferd, das sich in seinen eigenen, aus dem verwundeten Leibe herausgefallenen Eingeweiden mit den Vorderfüßen verfangen hatte und so unselig daherhinkte" (Campagne, 22. Sept. 1392). Laukhards entsprechender Bericht spielt auf die friderizianische Verordnung an, wonach „Blessirte erst nach beendeter Bataille" eingesammelt werden dürfen (8). „Die Verwundeten wurden auf ein Vorwerk gebracht, wo sie wegen der elenden Pflege schon meistens in der ersten Nacht unter den heftigsten Qualen hinstarben (9). Gar wenige von allen bey Valmy verwundeten Soldaten sind mit dem Leben, kein einziger ist mit geraden Gliedern davongekommen. Das ist freilich schrecklich, aber daran war auch meistens unsere medizinische Anstalt Schuld, welche bey keiner Armee elender seyn kann, als sie damals bey unserer war" (10). Auch die Ruhr, die man noch nicht beim Namen zu nennen wagt, breitet sich weiter aus. „Die eingerissene Krankheit", notierte Goethe, „machte den drückenden, hülflosen Zustand trauriger und fürchterlicher [...]" (Campagne, Valmy 21. September). Laukhards entsprechende Notiz, die sich allerdings auf den Gesundheitszustand des Heeres noch vor der Kanonade bei Valmy bezieht, ist viel aufschlußreicher: „Ich bin versichert, daß nicht drey Achtel der ganzen Armee von dem fürchterlichen Übel der Ruhr damals frey waren, als wir das Sumpflager beim Dörfchen l'Entrée verließen. Die Leute sahen alle aus wie Leichen und hatten kaum Kräfte, sich fortzuschleppen; und doch klagten nur wenige über Krankheit - aus Furcht vor den Lazarethen, jenen Mördergruben, wohin man die Erkrankten schleppte und worin so viele - viele um ihr trauriges Leben noch trauriger gekommen sind" (11). Die unzulängliche Versorgung der Truppe mit Wasser und Lebensmitteln verschlimmerte die Misere. „Mitten im Regen", klagt Goethe, „ermangelten wir sogar des Wassers. Ich habe es aus den Fußstapfen der Pferde schöpfen sehen, um einen unerträglichen Durst zu stillen" (Campagne, 21. September) (12). Noch bedenklicher war es, daß die gleichen Wagen, mit denen die Ruhrkranken ins Lazarett transportiert wurden, auf dem Rückweg die Anlieferung von Brot für die noch gesunden Truppen besorgten (13). Bald waren zwei Drittel des verbündeten Heeres krank, so daß man es gar nicht mehr wagen durfte, dem Feind entgegenzutreten. Da die Verbündeten durch die Ruhr an Zahl täglich schwächer wurden, während die Franzosen unter General Dumouriez dauernd Verstärkung erhielten, entschloß man sich am 30. September zum Rückzug. Goethe hatte die Gelegenheit eines Krankentransportes benutzt, um wie er es Herder mitteilt, „aus dem Schlamm" herauszukommen und „von einem bösen Traum zu erwachen, der mich zwischen Koth und Noth, Mangel und Sorge, Gefahr und Qual, BILD Adolph Menzel Transport von verwundeten und kranken preußischen Soldaten auf einem Bauernkarren. 3 4 zwischen Trümmern, Leichen, Äsern und Scheißhaufen gefangen hielt" (14). Der Stil dieses Briefes, der unter dem unmittelbaren Eindruck des Debakels zu Papier gebracht wurde, unterscheidet sich kaum von Laukhards vielgeschmähter „Soldatensprache". In seinen später verfaßten Erinnerungen führt uns Goethe mit wenigen Sätzen das ergreifende Schicksal der Ruhrkranken vor Augen, die man infolge des überstürzten Rückzugs nicht mitnehmen konnte und aus Angst vor Ansteckung auch nicht mitzunehmen wagte: „Morgens zogen wir über eine Anhöhe nach Grandpré zu und trafen daselbst die Armee gelagert. Dort gab es neue Sorgen; das Schloß war zum Krankenhaus umgebildet und schon mit mehreren Unglücklichen belegt, denen man nicht helfen, sie nicht erquicken konnte. Man zog mit Scheu vorüber und mußte sie der Menschlichkeit des Feindes überlassen" (Campagne, 3. Oktober). Und am darauffolgenden Tag: „Grandpré, das nun als ein Ort der Pest und des Todes geschildert war, ließen wir gern hinter uns" (Campagne, 4. Oktober). „Unsere traurige Lazarettfahrt", notiert Goethe wenige Tage später, „zog sich nun langsam dahin und gab zu ernsten Betrachtungen Anlaß, da wir in dieselbe Heerstraße fielen, auf der wir mit so viel Hoffnung ins Land eingetreten waren. Wie sah das alles jetzt anders aus! Und wie doppelt unerfreulich erschienen die Folgen eines fruchtlosen Feldzuges durch den trüben Schleier eines anhaltenden Regenwetters!" (Campagne, 9. Oktober) (15). Unter welchen Umständen sich der Rückzug des immer weiter zusammenschmelzenden Heeres in einen wahren Seuchenzug verwandelte, läßt Goethes Eintragung vom 11. Oktober erkennen: „Ohne die Nacht geschlafen zu haben, waren wir früh um 3 Uhr eben im Begriff, unseren gegen das Hoftor gerichteten Wagen zu besteigen, als wir ein unüberwindliches Hindernis gewahr wurden. Es zog eine ununterbrochene Kolonne Krankenwagen durch die zu Sumpf gefahrene Stadt." Nur mit schwerer Mühe gelang es, sich in die „mit Leichenschritten fortbewegenden Kolonnen" einzufädeln (16). In Trier angekommen, notierte er am 24. Oktober: „Ich war von der allgemeinen Krankheit nicht ganz frei geblieben und bedurfte daher einiger Arznei und Schonung" (17) Die Verluste der Koalitionsarmee waren ungeheuerlich. Allein von den 42.000 Mann preußischer Truppen, die im August 1792 die französische Grenze überschritten hatten, kehrten im Oktober kaum 20.000 zurück. Weniger als 1.000 Mann hatte man vor dem Feind verloren, aber mehr als 19.000 an der Ruhr (18). Laukhards Berichte über die permanenten Versorgungskrisen und Strapazen, denen die Soldaten beim chaotischen Rückzug auf regendurchweichten Straßen voller Toter und Ruhrkranker ausgesetzt waren, sind von erschütterndem Realismus. Er benutzt dabei, woran viele Anstoß genommen haben, die grobe Soldatensprache seiner Kameraden, als deren Anwalt er sich berufen fühlt. Während Goethe im eleganten Gedankenflug nur ganz leicht die Oberfläche des menschlichen Elends streift, taucht Laukhard tief in den Sumpf hinein. Hier nur einige Passagen aus drei Kapiteln (16., 13., 18.), die sich auf den „jämmerlichen Abzug aus Frankreich" beziehen: 4 5 „Auf den Wagen, worauf die Kranken transportirt wurden, fehlte es an aller Bequemlichkeit: die armen Leute wurden drauf geworfen, wenn sie sich nicht selbst noch helfen konnten, wie man die Kälber auf die Karre wirft, und damit war es dann gut. Niemand bekümmerte sich, ob so ein Kranker etwas unter dem Leibe oder dem Kopfe hatte, ob er bedeckt war oder nicht: denn die, welche sich um dergleichen hätten kümmern sollen, waren meistens selbst krank und hatten kaum Kräfte genug, sich fortzuschleppen. Starb einer unterwegs, so warf man ihn von dem Wagen auf die Seite und ließ ihn unbegraben liegen. Oft warf man noch Lebende hinunter, die dann aufs jämmerlichste im Schlamm verrecken mußten [...] In allen Dörfern blieben Kranke zurück, die dann meistenteils aus Mangel an Pflege und Nahrung jämmerlich umkamen" (19). "Am 10ten Oktober kamen wir bey Lauremont ins Lager, aber man konnte hier kein Stroh bekommen, uns drauf zu legen: die Dörfer waren schon vorher durch die Kavallerie von allem Stroh beraubt worden. Wir mußten daher auf der bloßen nassen Erde in den Zelten herumliegen; und da es noch obendrein die Nacht stark regnete und das Wasser auch hier wieder in unsere Zelte eindrang, so brachten wir abermals eine ganz scheußliche Nacht hier zu [...]" „Am 13ten Oktober war ein noch schrecklicherer Marsch. Wir konnten kaum in einer Stunde 200 Schritte vorwärts kommen: so ganz abscheulich war der Weg und so sehr hielt uns die Artillerie und Bagage auf. Als wir bis auf den Abend gegangen oder vielmehr gekrochen waren, erreichten wir endlich die Stelle, wo wir lagern sollten. Aber kaum hatten wir abgelegt, als wir sofort Order bekamen, vorwärts zu marschiren. Der kaiserliche General Hohenlohe hatte seinen Abmarsch von Stenay verfrüht und dadurch unsre rechte Flanke entblößt [...] " (20). Nach dem Desaster von Valmy sucht Laukhard die preußischen Lazarette auf, wo „Tausende krepiren mußten". Doch hören wir ihn selbst, was und wie er es sagt: „Die zahllosen Krankheiten, besonders die Ruhren, welche unser unglückliches Militär auf diesem unseligen Feldzuge befielen, machten die Anlegung vieler Lazarethe nöthig. Zu Grandpré, Verdun, Longwy, Chatillon, Luxemburg befanden sich preußische Feldlazarethe, welche alle mit Kranken vollgepfropft waren. Ich habe mehrere dieser Mördergruben selbst besucht und was ich da gesehen habe, will ich dem Leser ehrlich mittheilen, jedoch mit dem Bedinge, daß der zu delikate Leser diese Kapitel (21 und 22) überschlage" (S. 244). Noch in Frankreich hatte Laukhard seinen ersten Krankenhausbesuch unternommen, bei dessen Lektüre es einem kalt über den Rücken läuft: „Ich hörte, daß mein Freund, der Unteroffizier Koggel, zu Longwy im Lazareth krank läge; ich wollte ihn also besuchen und ging hin und hinein, ohne von der Schildwache angehalten oder nur über etwas befragt zu werden. Dieses ließ mich gleich anfangs nicht viel Ordnung im Lazarethe selbst erwarten. Aber wie entsetzte ich mich, als ich gleich beim Eingang alles von Exkrementen blank sah und nicht einmal ein Fleckchen finden konnte, um unbesudelt hineinzutreten. Der gemeine Abtritt reichte für so viele ruhrhafte Kranke unmöglich zu, auch fehlte es den meisten an Kräften, ihn zu erreichen, und Nachtstühle sah ich beinahe gar nicht. Die Unglücklichen schlichen sich also nur bis vor die Stube und machten dann alles hin, wo und wie sie konnten: Es ist abscheulich, daß ich sagen muß, daß ich sogar tote Körper in diesem Unflat liegen sah. Ich schlüpfte schnell durch ins erste beste Zimmer, aber da drängte sich mir auch sogleich ein solch abscheulicher mephytischer Gestank entgegen, daß ich hätte mögen in Ohnmacht sinken [...] An 5 6 Räuchern dachte man gar nicht, auch wurden die Fenster niemals geöffnet, und wo hie und da eine Scheibe fehlte, da stopfte man die Öffnung mit Stroh und Lumpen zu. Das Lager der Kranken war dem vorigen ganz angemessen: die meisten lagen auf bloßem Stroh, wenige auf Strohsäcken und viele gar auf dem harten Boden. An Decken und andere zur Reinlichkeit dienende Dinge war vollends nicht zu denken. Die armen Leute mußten sich mit ihren elenden kurzen Lumpen zudecken, und da diese ganz voll Ungeziefer waren, so wurden sie beinahe lebendig gefressen." BILD Adolph Menzel Inneres eines Feldlazarettes bei der Belagerung von Prag durch Friedrich den Großen 1757 Die Verwundeten und Kranken liegen am Boden auf Stroh. „Ich wollte den Unteroffizier Koggel sehen, aber weder Feldscher noch Krankenwärter konnte mir sagen, in welchem Zimmer ich ihn treffen könnte. So sehr fehlte es an aller besondern Aufsicht!" (21) In Trier angelangt, erfuhr man neue katatstrophale Nachrichten: der französische General Custine, den man unbedenklich im Rücken gelassen hatte, war mit seiner Armeeabteilung ins Rheinland eingefallen. Er hatte Speyer genommen, das Nachschubzentrum der gesamten Invasionsarmee, und bedrohte nun Mainz und Frankfurt. In Koblenz erwarteten ihn bereits weite Kreise mit Begeisterung für die Sache der Revolution. In vier Wochen hatte sich das Klima verändert. Durch die heimkehrenden Truppen wurde die Ruhr durch die Rheinprovinzen nach den verschiedensten Teilen Deutschlands verschleppt, so daß bald in Trier, Koblenz, Wesel, Neuwied, Usingen, Frankfurt a. Main, Höchst, Homburg, Friedberg, Giessen und noch an anderen Orten preußische Feldlazarette entstanden. Laukhard, der zunächst überlegte, ob nicht die grauenhaften Zustände im Feldlazarett zu Longwy vielleicht durch die Not in der Fremde bedingt gewesen sei, beschloß nun, mehrere preußische Feldlazarette in der Haimat zu untersuchen, „um ein richtiges Urtheil darüber fällen zu können". Er tat dies schon in Trier. Was er dort erlebte, sah ganz anders aus, als es später Goethe beschrieb: „Die Lazarethe", so Laukhard, „waren ebenso schmutzig, die Pflege ebenso elend und die Lagerstätten ebenso abscheulich wie in Longwy. Außerdem aber mußten noch vom 30. bis 31. Oktober mehr als 280 Kranke in Trier unter freiem Himmel auf der Gasse liegen bleiben. In den Hospitälern war für sie kein Platz mehr, und niemand wollte sie in die Häuser aufnehmen, weil es allgemein hieß, die Preußen hätten die Pest. Es krepirten - ja es krepirten! - die Nacht mehr als 30 auf der Gasse." „Die andern Lazarethe, die ich weiter sah, waren alle von dieser Art. Woher kömmt aber dieses schreckliche Übel, wodurch der Staat so viel Leute verliert? Denn in diesem Feldzug sind sehr wenig Preußen vor dem Feind geblieben, aber mehrere Tausend in den Hospitälern verreckt, deren meiste man hätte retten können, wenn man ihnen gehörige Pflege hätte können oder wollen angedeihen lassen (22). Nach dieser messerscharfen Feststellung über diese „verlorenen Leute", diese „perdutta gente", erwägt Laukhard scharfsinnig die Gründe der Desorganisation und Korruption, 6 7 durch die die Feldlazarette trotz der friderizianischen Kabinettsorder zum „Inferno" geworden waren" (23). „Der Hauptfehler der preußischen Lazarethe ist, wie mich dünkt, in der Organisation selbst zu suchen. Die Aufseher sind lauter Leute vom Militär, ohne angemessene Erfahrung und Kenntnisse, und meist lauter solche, die sich da bereichern wollen. Ihre Besoldung ist schlecht und doch kommen sie, wenn sie auch nicht lange darin sind und blutarm hineinkamen, allemal mit vollem Beutel heraus. Es muß also an der Subsistenz (Lebensunterhalt) der Kranken defraudirt (unterschlagen) und die ganze Einrichtung so konfus und unordentlich gemacht oder geführt werden, daß man die Defraudation nicht so leicht entdecken kann" (S. 248-249). Es ist die bekannte „Tintenfischtaktik", wobei alles trübe und unklar gemacht wird, um die Spuren zu verwischen. „Bey dergleichen Einrichtungen", kommentiert Laukhard, „pflegt alles zusammenzuhängen und für den gemeinschaftlichen Vorteil gemeinschaftliche Sache zu machen. Selten findet sich ein Mann von Rechtschaffenheit, der seinen Einfluß zur Verbesserung thätig machen mögte; und wenn er sich findet, so wird er bald unterdrückt [...] Ich habe gesehen, daß Feldscherer und Krankenwärter den Wein fortsoffen, der für die Kranken bestimmt war und die guten Essenzen selbst verschluckten. Zwei Menschen in Koblenz, welche den Feldscherern zur Liebschaft dienten, verkauften den Reis aus dem Hospital und die Kranken mußten hungern. In Frankfurt am Mayn kaufte man im Hospital Reis, Graupen, gedörrtes Obst u. dergl. sehr wohlfeil. So war es auch in Giessen. Um nun den Betrug nicht so sehr sichtbar zu machen, geht alles mysteriös und unordentlich in den Lazarethen zu [...]" (S. 249-250). „Die Krankenwärter sind Soldaten, welche bey den Kompagnien nicht mehr fortkönnen, alte steife Krüppel, die sich zum Krankenwärter schicken wie das fünfte Rad am Wagen. Diese, deren theilnehmender Menschensinn durch den militärischen Korporalsinn abgestumpft ist, lassen den armen Kranken eine Pflege angedeihen, daß es eine Schande ist. Daß sie sich mit den Feldscherern und anderen Meistern, die in den Lazarethen etwas anzuordnen haben, allemal einverstehen, versteht sich von selbst: denn auf die geringste Vorstellung des Feldschers oder eines anderen Vorgesetzten, würde der Herr Krankenwärter weggejagt. Ein Oberkrankenwärter, wie ich sie in den französischen Hospitälern zu Dijon und anderwärts gefunden habe, ist gar nicht da" (S. 250) (24). Auch das Ansehen der Chirurgen war im französischen Heer ein ganz anderes als im preußischen. Die despektierliche Bezeichnung „Feldscher" für den Wundarzt hatte ebenso wie die andere Bezeichnung „Bartscherer" einen sonderbaren Ursprung aus der Landsknechtszeit. Mußten doch die Chirurgen, die als rohe Empiriker aus Barbierstuben hervorgegangen waren, noch in der friderizianischen Armee Offiziere und Mannschaften regelmäßig rasieren (25). „Die Feldscherer", schreibt Laukhard, „oder wie man sie seit einigen Jahren nennen soll, die Chirurgen, sind meistens Leute, welche gar wenig von ihrem Handwerk inne haben und daher das Elend in den Spitälern durch ihre Unwissenheit und Unerfahren-heit noch vergrößern. Für die Besetzung der Regimenter durch Oberchirurgen ist ziemlich gut gesorgt, ob es gleich auch da Leute giebt, welche nicht viel mehr i wissen als jeder gemeine Bartkratzer. Die Generalchirurgen sind Männer von Einsicht und Verdienst, aber die gemeinen oder Kompagniechirurgen sind größtentheils elende Stümpfer, die bey ihrem Lehrherrn nicht mehr gelernt haben als rasiren und aderlassen. [...)" (26) 7 8 „Die Oberchirurgi, welche die Aufsicht über die Lazarethe führen, können jeden Kranken nicht selbst untersuchen und behandeln, theils wegen der Menge, theils sind sie dazu zu kommode [...] Sie schauen daher nur dann und wann, und zwar nur so obenhin, in die Krankenstuben, lassen sich vom Feldscheer, sehr oft auch von dem Krankenwärter rasiren, verordnen dann so was hin im Allgemeinen, werfen - um sich respectabel zu machen - mit einigen fehlerhaften lateinischen Wörtern und Phrasen umher, überlassen hierauf alles den Unterchirurgen und gehen - in Offiziergesell-schaften, l'Hombre zu spielen oder sich sonst zu vergnügen. Mir sind ganz schändliche Beyspiele bekannt geworden, wie selbst Oberchirurgi die medizinische Pflege deswegen vernachläßigten, weil sie das Geld, das für Arzney, Essig, Wein u. dgl. bestimmt war, an die Offiziere, die in den Lazarethen als Inspektoren angestellt waren, verspielt hatten und folglich diese Sachen nicht mehr kaufen konnten. Die Offiziere hätten freilich nach ihrer Pflicht darauf inquiriren und den Chirurgus zur Herbeyschaffung der Arzney anhalten sollen, aber eben sie hatten ja das Geld gewonnen, welches sie, im Falle das Ding zur Sprache gekommen wäre, hätten herausgeben müssen. Sie schwiegen also, und die armen Leute waren geprellt" (27). Eine prästabilisierte Harmonie der Korruption. Wie Recht hatte Laukhard mit seiner Behauptung, hier sei „alles Niederträchtige so fest miteinander verzahnt, daß man dagegen nicht ankömmt". Denn nur so konnten die „himmelschreyenden Diebereyen in den Lazarethen" auf die Dauer fortgeführt werden. „Da man in der Verpflegung der Lazarethkranken", so Laukhard, „schon ohnehin sehr ökonomisch zu Werke geht, und da noch obendrein jeder von dieser Subsistenz das Seine ziehen will, so kann man leicht denken, daß die Diät der armen Kranken sehr schlecht seyn muß. An zweckmäßige Einrichtung der Speisen wird gar nicht gedacht, noch weniger an deren zweckmäßige Vertheilung. Etwas elende Brühe - die kaum ein Windspiel fressen möchte - ist die Suppe, worin dann und wann ein bisserl Graupen, Mehl, Grütze oder Brot gethan wird. Die Krankenwärter wissen alles schon so einzurichten, daß nicht ein Auge Fett darauf zu sehen ist und daß die Brühe aussieht und schmeckt wie die elendste Jauche. Das Fleisch in den Lazarethen ist schon das elendste, das man finden kann, und nicht selten stinkt es schon und hat Maden gezogen. Dieses elende Luder wird nun auf die elendste Art zurecht gemacht, ganz unsauber in die Kesel geworfen und oft nur kaum halb gar gekocht." „‚Wer in den Lazarethen nichts zuzusetzen hat, muß rein krepiren' ist ein bekannter Satz bey der preußischen Armee [...] So sehen die Feldlazarethe der Preußen aus, aber die der Österreicher sind um kein Haar besser! Auch da herrscht der nämliche Geist, die nämliche Unordnung, der nämliche Mangel! - Und hieraus läßt sich nun erklären, warum so viele Menschen in den Hospitälern elend umkommen und warum die Armeen durch diese Mördergruben so schrecklich leiden!" (28) Geradezu entschuldigend bezeichnet Laukhard seine ausführliche Schilderung der Lazarettmißstände als ein Mittel zum Zweck: „Meine Leser müssen es zugute halten, daß ich von den preußischen Feldlazarethen etwas mehr anbringe, als man sonst in dieser Biographie erwartet hätte. Ich bin Soldat gewesen und habe das Elend mit angesehen, welches meine Brüder in diesen scheußlichen Mordklüften ertragen mußten. Ich mögte also gerne, so viel als in meinen Kräften steht, zur Verbesserung dieses abscheulichen und schrecklichen Unwesens beytragen. Vielleicht liest etwan ein Mann von Gutsinn und Einfluß meine Schrift und lernt daraus diese Gattung menschlichen Elendes näher kennen und hilft es vielleicht bey einem künftigen Feldzug lindern" (29). 8 9 Leider haben sich Laukhards diesbezügliche Hoffnungen nicht erfüllt: Im Gegensatz zum gut funktionierenden Heeressanitätswesen der Franzosen, das erst infolge der Katastrophe in Rußland versagte, blieb das preußische Sanitätswesen während der napoleonischen Kriege mit der schweren Hypothek aus der Vergangenheit belastet. Es kam dann auch 1806 zu Jena und Auerstedt so schlimm, daß den ganzen Tag über kein einziges preußisches Feldlazarett zu sehen war! 1813 betrug bei den Preußen der ganze Bestand an fliegenden Lazaretten 7 Stück; 1814 erhöhte er sich auf 24, aber den an sie gestellten Anforderungen gegenüber war das viel zu wenig. Denn infolge ihrer außerordentlichen Schwerfälligkeit konnten sie nie rechtzeitig an dem Ort ihrer Bestimmung eintreffen. So kam es, daß in der Schlacht bei Leipzig nur ein einziges, später bei Belle-Alliance aber gar keines zur Stelle war (30). Die in den verschiedenen Ortschaften Hals über Kopf eingerichteten Hospitäler erwiesen sich als wahre Mördergruben. Noch zu Beginn der Freiheitskriege war laut Rust „der Hospitalaufenthalt für die Soldaten fünf bis sechsmal tödlicher als die Bataille (31). Nach der Völkerschlacht bei Leipzig (16. bis 19. Oktober 1813) berichtet der Hallenser Medizinprofessor Johann Christian Reil (1759-1813), der bald danach auch selbst ein Opfer der Seuche wurde, an den Freiherrn von Stein: „Leipzig, Oktober 1813. Ew. Exz. haben mich beauftragt, Ihnen einen Bericht über meinen Befund der Lazarette der verbündeten Armeen am diesseitigen Elbufer einzureichen [...] Die zügelloseste Phantasie ist nicht im Stande, sich ein Bild des Jammers in so grellen Farben auszumalen, als ich es hier in Wirklichkeit vor mir fand [...] Verwundete, die nicht aufstehen können, müssen Koth und Urin unter sich gehen lassen und faulen in ihrem eigenen Unrat an. Für die Gangbaren sind zwei offene Bütten angesetzt, die aber nach allen Seiten überströmen, weil sie nicht ausgetragen werden. In der Petristraße stand eine solche Bütte neben einer anderen ihr gleichen, die eben mit der Mittagssuppe hereingebracht war. Diese Nachbarschaft der Speisen und der Ausleerungen muß notwendig einen Ekel erregen, den nur der grimmigste Hunger zu überwinden imstande ist. Das scheußlichste in dieser Art gab das Gewandhaus. Der Perron war mit einer Reihe solcher überströmenden Bütten besetzt, deren träger Inhalt sich langsam über die Treppen hinabwälzte. Es war mir unmöglich, durch die Dünste dieser Kaskade zu dringen und den Eingang von der Straße her zu erzwingen [...] Ich schließe meinen Bericht mit dem gräßlichsten Schauspiel, das mir kalt durch die Glieder fuhr und meine ganze Fassung lähmte. Nämlich auf dem offenen Hof der Bürgerschule fand ich einen Berg, der aus Kehricht und Leichen meiner Landsleute bestand, die nackend lagen und von Hunden und Ratten angefressen wurden, als wenn sie Missethäter und Mordbrenner gewesen wären. Ich appelire an Ew. Exz. Humanität, an Ihre Liebe zu meinem König und zu seinem Volk: helfen Sie unseren Braven, helfen Sie bald! An jeder versäumten Minute klebt eine Blutschuld!" (32) Zu Recht meinte der liberale ostpreußische Arzt Johann Jacoby (1805-1877), der dieses Memorandum kannte, man müßte „solche Lazarettberichte den verantwortlichen Staatsmännern zur Pflichtlektüre machen, damit sie wissen, welches Grauen sie mit jedem Krieg auf die Menschen heraufbeschwören" (33), 9 10 ANMERKUNGEN ______________________________________________________________________ (1) Das Ende Juli erlassene Manifest des Herzogs von Braunschweig mit seinen unklugen Drohungen war eine der Hauptursachen des zweiten Sturms auf die Tuilerien, der am 10. August erfolgte: die Schweizergarde, die das Schloß verteidigte, wurde niedergemacht, der König suspendiert und als Gefangener in den Tempel gebracht. In den darauffolgenden „Septembermorden" wurden 3.000 internierte „Verdächtige" nach kurzem Verhör der Menge ausgeliefert und guillotiniert. (2) „Meine Herren", rief der Herzog von Braunschweig seinen Offizieren zu, „nicht zuviel Gepäck und Aufwand. Alles ist nur ein militärischer Spaziergang". Als innerlich eiskalt schildern ihn alle, die mit ihm zusammenkamen. Im Jahre 1776 hatte er 4.300 Landeskinder an England für den Kampf mit den amerikanischen Kolonien verschachert. Bis April 1782 waren es 5.723 Mann, von denen 3.015 auf den fernen Schlachtfeldern geblieben sind. Als die Überlebenden in die Heimat zurückkehren sollten, befahl er, die Krüppel und Lahmen drüben zurückzulassen, weil er so auch noch den Invalidensold zu sparen hoffte (F. Mehring, Die Lessing-Legende. 7. Aufl., Stuttgart 1920, S. 360). (3) „Wenn es", lautet ein Bericht nach dem Fall von Verdun an den Nationalkonvent, „Dumouriez nicht gelingt, den Feind in den Engpässen des Argonnenwaldes zum Stehen zu bringen, so kann dessen Vorrücken auf Paris nichts mehr verhindern". Doch es gelang - „infolge der zögernden, rein demonstrativen Kriegsführung des Herzogs von 10 11 Braunschweig, der ein purer Theoretiker und nur so lange ein respekteinflößender Stratege war, bis nicht richtig geschossen und angegriffen wurde" (Von Caemmerer, Taktische und strategische Grundsätze im 18. und 19. Jahrhundert. Breslau 1906, S. 49). (4) Friedrich Christian Laukhards Biographie erschien in fünf Teilen zwischen 1792 und 1802 unter dem Titel „Leben und Schicksale". Der dritte Teil mit dem Untertitel „Begebenheiten, Erfahrungen und Bemerkungen während des Feldzugs gegen Frankreich" erschien 1796 in Leipzig. (5) Magister Laukhard berichtet im 12. Kapitel des 3. Teils seiner Biographie, wie der Vormarsch bei kaltem Wetter unter Dauerregen vor sich ging und wie das Biwakieren auf regendurchfeuchteten Rastplätzen vorhergehender Truppen fieberhafte Erkrankungen zur Folge hatte (S. 110). Er selbst biwakierte nach der Einnahme von Verdun (vor der Kanonade von Valmy) im Dörfchen L'Entrée und erwähnt hier zum ersten Mal die Ruhr und den grauenhaften Zustand der als gefährliche Infektionsquelle in Betracht kommenden Mannschaftslatrinen: „Aber nichts nahm unsere Leute ärger mit als der Durchfall, der allgemeine Durchfall, und dann die darauf folgende fürchterliche Ruhr [...] Die Abtritte, wenn sie täglich gleich frisch gemacht wurden, sahen jeden Morgen so mörderisch aus, daß es jedem übel und elend werden mußte, der nur hineinblickte. Alles war voll Blut und Eiter. Ebenso lagen viele blutige Exkremente im Lager herum, von denen, die aus nahem Drange nicht an den entfernten Abtritt hatten kommen können" (Laukhard, Begebenheiten [wie Anm. 4) S. 148-149). (6) Während viele deutsche Intellektuelle die Französische Revolution anfangs emphatisch begrüßten, lehnte Goethe sie von ihrem Beginn an entschieden ab, was bereits aus den „Venetianischen Epigrammen" von 1790 deutlich zu ersehen ist: „Alle Freiheitsapostel, sie waren mir immer zuwider, Willkür suchte doch nur jeder am Ende für sich...` Goethes ursprüngliche Berichte aus der Campagne, wie z. B. der Brief an Herder, lassen schwerlich Sympathie für die Sache der französischen Republik erkennen. Aus dem Jahre 1793 stammt sein kleines Schauspiel „Der Bürgergeneral", worin die Abneigung gegen die Revolution sogar kleinlich gehässige Formen annimmt und namentlich alle Versuche, die Losungen des französischen Volkes auch in Deutschland aufzugreifen, ins Lächerliche gezogen wurden. Dieselbe negierende Tendenz zeigen das Schauspiel „Die Aufgeregten" und die Anspielungen auf Zeitereignisse im „Reineke Fuchs". (Über Goethes Verhältnis zur Französischen Revolution vgl, Georg Brandes, Goethe. Berlin 1922, S. 312 ff, 324 ff). - Als Goethe 1822 - aus einem Abstand von rund dreißig Jahren - seine Eindrücke und Erlebnisse während der Campagne in Frankreich (1792) in Form von Tagebuchaufzeichnungen zu Papier brachte, benutzte er dazu außer eigenen Notizen und seinerzeit geschriebenen Briefen an Christiane, Herder, Heinrich Meyer, seine Mutter etc. auch fremde Quellen, wie Dumouriez' Lebens- und Laukhards Feldzugserinnerungen, Massenbachs „Memoiren" sowie das unveröffentlichte Tagebuch, das J. K. Wagner, der Begleiter und Kammerdiener des Herzogs Carl August während des Feldzuges äußerst sorgfältig und wahrheitsgetreu geführt hatte. (7) Rivarol hatte mit seiner sarkastisch-despektierlichen Bemerkung nicht ganz Unrecht: „Das bei der Kanonade von Valmy vergossene Blut, dem die französische Revolution ihr eigentliches Überleben verdankt, war überwiegend eine Folge der Ruhr" (Marcel Hervier, Rivarol. Paris 1928, S. 42). 11 12 (8) Es ist klar, daß infolge einer solchen Organisation die Spätkomplikationen bei den Verwundeten meist gefährlicher waren als die Verletzungen an sich. Als der preußische Generalchirurg Johann Ulrich Bilguer (1720-1796) in Anbetracht der ungeheuren Verluste, die diese Verordnung zur Folge hatte, in einer Denkschrift darum bat, die Verwundeten noch während der Bataille einsammeln und das Lazarettwesen reorganisieren zu dürfen, drohte ihm Friedrich II. mit Festungshaft, wenn er noch einmal wagen sollte, ihn damit zu behelligen (W. v. Brunn, Aus chirurgischer Vergangenheit. Berlin 1940, S. 82). (9) Laukhard, Begebenheiten [wie Anm. 4] S. 170. - Bei der Belagerung von Prag (1757) hatte Bilguer beobachten können, wie Hunderte durch leichte Schußwunden verletzter Grenadiere infolge einer viel zu späten Wundversorgung elend zugrunde gingen (v. Brunn [wie Anm. 8] S. 81). (10) Jean Dominique Larrey (1766-1842), Napoleons ständiger Begleiter auf allen seinen Feldzügen, hatte zur gleichen Zeit (1792) als Chirurg bei der französischen Rheinarmee die „Ambulances volantes" (entsprechend den heutigen Hauptverbandplätzen) geschaffen. Die fliegenden Ambulanzen mußten nunmehr stets mit der Avantgarde mitziehen und konnten daher solchen Verwundeten schon auf dem Schlachtfelde ihre Hilfe angedeihen lassen (N. Guleke, Kriegschirurgie und Kriegschirurgen im Wandel der Zeiten. Jena 1945, S. 26-27). (11) Laukhard, Begebenheiten [wie Anm. 4] S. 149. - Im 12. Kapitel mit dem drastischen Untertitel „Das sogenannte Drecklager" schreibt Laukhard von dem berüchtigten Biwak, wo sich die Ruhr so beängstigend ausbreitete: "Wir brachen von Verdun mitten im Regen auf und marschierten den ersten ganzen Tag im Regen fort [...] Endlich erreichten wir ein Dorf, L'Entrée genannt, worin der König sein Hauptquartier nahm und wobey wir unser Lager aufschlagen sollten [...] Wir machten freilich Feuer an und holten dazu aus dem Dorfe L'Entrée heraus, was wir in der finsteren Nacht von Holz finden konnten Stühle, Bänke, Tische und andere Geräthe. Aber diese Feuer, so höllenmäßig sie auch aussahen, waren doch nicht hinlänglich, uns gegen den fürchterlichen Wind und den abscheulichen Regen zu sichern [...] Unsere Munition an Pulver wurde selbige Nacht größtenteils naß und zum Schießen unbrauchbar [...] Endlich war es Tag und die Soldaten krochen aus ihren Zelten, wie die Säue aus ihren Ställen, sahen auch aus wie diese Thiere, wenn sie aus Ställen kommen, welche in sechs Wochen nicht gereinigt sind. Der Koth, worin man sofort patschen mußte, wenn man aus den Zelten heraustrat, lief gleich in die Schuhe [...]" (Laukhard, Begebenheiten [wie Anm. 4]) S. 140-143). (12) Wie in solchen unruhigen Zeiten das Trinkwasser verseucht werden kann, hat Goethe im siebten Gesang von,Hermann und Dorothea' eindrucksvoll geschildert: „Es haben die unvorsichtigen Menschen alles Wasser getrübt im Dorfe, mit Pferden und Ochsen gleich durchwatend den Quell, der Wasser bringt den Bewohnern. Und so haben sie auch mit Waschen und Reinigen alle Tröge des Dorfes beschmutzt und alle Brunnen besudelt, denn ein jeglicher denkt nur, sich selbst und das nächste Bedürfnis zu befried'gen und rasch, und nicht den Folgenden denkt er" (VII. Gesang 30-36). (13) 12 13 Victor Fossel, Kriegsseuchen im 17. und 18. Jahrhundert. Leipzig 1905, S. 81. - „Das Brot", berichtete Goethe, „war angekommen nicht ohne Mühseligkeit und Verlust; auf den schlimmsten Wegen von Grandpré, wo die Bäckerei (und auch das Ruhrlazarett) lag, bis zu uns heran, waren mehrere Wagen stecken geblieben [...] In Angst vor Gift brachte man mir einige Laibe auf Arsenik hindeutend [...] War es aber auch nicht vergiftet, so erregte doch der Anblick Abscheu und Ekel [...]“ (Campagne, 28. September). (14) Brief an Herder vom 16. Oktober 1792. - Um die gleiche Zeit, als „die Retirade des ruhrverseuchten Koalitionsheeres eine blutige Fäkalspur hinterläßt" (Rivarol), entsteht in Frankreich ein anonymes Spottlied: „La grande foire combinée des Prussiens et des Austrichiens." Die ersten beiden Strophen mit dem (insgesamt siebenmal wiederkehrenden) übermütigen Refrain lauten: (1) „Ah! quel malheureux destin! /On ne pourrait le croire; /Les invincibles Prussiens /Ont avec les Austrichiens/La foire, la foire, la foire./ (2) (2) Quand Brunswick dit aux Soldats: / Volons à la victoire; / On répond, culotte en bas:/ Monseigneur, n'avons nous pas/La foire, la foire, la foire?...` (15) Zwei Tage vorher, als man während des Rückzuges bei strömendem Regen an die Maas kam berichtet Goethe, ritt der Herzog von Braunschweig an ihn heran und bemerkte, wie er sich freue, daß ein so berühmter Dichter zugegen sei, „der bezeugen kann, daß wir nicht vom Feinde, sondern von den Elementen überwunden wurden" (Campagne, den 7. Oktober). Doch Goethe schwieg 30 Jahre lang. „Was er schreiben durfte, mag er nicht schreiben und was er schreiben möchte, wird er nicht schreiben", läßt Goethe einen Einsichtigen über die Campagne in Frankreich sagen (Campagne, Trier den 28. Oktober). (16) Das Chaos beim Rückzug nach dem Debakel bei Valmy offenbart sich aus einer Notiz Goethes: „Die Selbsterhaltung in einem so ungeheuren Drange kannte kein Mitleid, keine Rücksicht mehr; nicht weit vor uns fiel ein Pferd vor einen Rüstwagen, man schnitt Stränge entzwei und ließ es liegen. Als nun aber die drei übrigen die Last nicht weiterschleppen konnten, schnitt man auch sie los, warf das schwer bepackte Fuhrwerk in den Graben, und mit dem geringsten Aufhalten fuhren wir weiter und zugleich über das Pferd weg, das sich eben erholen wollte, und ich hörte ganz deutlich, wie dessen Gebeine unter den Rädern knirschten. Daß man unter solchen Umständen in Gräben, auf Wiesen, Feldern und Angern genug tote Pferde erblickte, war die natürliche Folge des Zustands; bald aber fand man sie auch abgedeckt, die fleischigen Teile sogar ausgeschnitten; ein trauriges Zeichen des allgemeinen Mangels!" (Campagne, den 11. Oktober). (17) Goethe, dem seine Farbenlehre stets wichtiger war als die Kriegsereignisse, berichtet am nächsten Tag über den endlich wiedergefundenen, schmerzlich vermißten dritten Teil von Fischers physikalischem Lexikon, den die Küchenmagd seines Herzogs während der Retirade im großen sechsspännigen Küchenwagen bis Trier mitgeschleppt und nun, an Ruhr erkrankt, ins Hospital mitgenommen haben soll. Um das Buch zurückzubekommen, will sich Goethe zu seinem oft angezweifelten, einzigen Hospitalbesuch während der Campagne entschlossen haben: „Auf Erkundigung und Nachforschung fand ich endlich die Küchenmagd im Lazarett, das man mit ziemlicher Sorgfalt in einem Kloster errichtet hatte. Sie litt an der allgemeinen Krankheit, doch waren die 13 14 Räume luftig und reinlich; sie erkannte mich, konnte aber nicht reden, nahm den Band unter dem Haupte hervor und übergab ihn mir so reinlich und wohl erhalten, als ich ihn überliefert hatte." (Campagne, Trier den 25. Oktober). - Allerdings begann Fischers physikalisches Lexikon erst 6 Jahre später (1798) zu erscheinen! Nicht umsonst konnten renommierte Historiker wie Heinrich von Sybel, Leopold von Ranke und andere dem „aufgefrischten" biographischen Alterswerk des großen Dichters nicht viel abgewinnen. (18) Fossel [wie Anm. 13] S. 82. (19) Laukhard, Begebenheiten [wie Anm. 4] 16. Kap. S. 199. - „Den fiten Oktober mußte der Befehl gegeben werden, die Dörfer in der Gegend auszuplündern. Viele unserer Leute glaubten, das sey die Folge eines geringen Angriffs der Franzosen auf die Österreicher und meynten, daß man auf diese Art jenes Unrecht (!) durch Plünderung der armen Bauern rächen wollte. Allein dieser Gedanke war falsch: denn bloß der Mangel an Nahrung für Menschen und Vieh und besonders für das Hauptquartier nöthigte den Herzog von Braunschweig, die Ausplünderung von etwa neun Dörfern zu befehlen, welche auch durch mehrere Bataillons Infanterie und Husaren ausgeführt wurde" (Laukhard, Begebenheiten [wie Anm. 4] Kap. 17, S. 200). (20) Laukhard, Begebenheiten [wie Anm. 4] Kap. 17 S. 204-205. - „Es war schon, ehe wir die Standquartiere verließen, befohlen worden, daß man besonders für gutes Schuhwerk der Soldaten sorgen und hinlänglich dazu mitnehmen sollte, um die abgehenden gleich wieder ersetzen zu können. Aber unsre Herren hatten so für sich auskalkulirt, daß der ganze Krieg wohl nur ein Viertel Jahr dauern könne und waren eben darum auch in Befolgung dieses Befehls sehr nachläßig gewesen. Die Folgen der Fahrläßigkeit in einem so äußerst wichtigen Punkte zeigten sich bald. In der ganzen Armee fingen die Schuhe bey dem scheußlichen Rückzug aus Champagne auf einmal so an zu reißen, daß beynahe kein einziger Soldat gutes Schuhwerk noch hatte [...] Es war schändlich anzusehen, wie die Preußen da ohne Schuhe durch den Koth zerrten und ihre Füße an den spitzigen Steinen blutrünstig aufrissen" (Laukhard, Begebenheiten [wie Anm. 4] S. 212). (21) Laukhard, Begebenheiten [wie Arm. 4] Kap. 21, S. 244-247. (22) Laukhard, Begebenheiten [wie Anm. 4] Kap. 21, S. 247-248. - Wie richtig Laukhard die Bedeutung der Ruhr als Kriegsseuche bei der Campagne in Frankreich eingeschätzt hat, geht auch daraus hervor, daß es vor allem epidemiologische Erwägungen waren, die Bismarck nach der siegreichen Schlacht bei Königgrätz aus Angst vor der Cholera dazu bewogen haben, den von seinem König gewünschten „Vormarsch auf Wien" zu stoppen. Nach dem „Kriegsrat vom 23. Juli 1866" nahm er folgende Eintragung in sein Tagebuch vor: „Im Vorzimmer fand ich zwei Obersten mit Berichten über das Umsichgreifen der Cholera unter ihren Leuten, von denen kaum die Hälfte dienstfähig war. Die erschreckenden Zahlen befestigten meinen Entschluß, aus dem Eingehen auf die österreichischen Bedingungen die Cabinetsfrage zu machen [...] Mir schwebte als warnendes Beispiel unser Feldzug von 1792 in der Champagne vor, wo wir nicht durch die Franzosen, sondern durch die Ruhr zum Rückzug gezwungen wurden" (O. v. 14 15 Bismarck, Gedanken und Erinnerungen. Stuttgart u. Berlin 1919, S. 50). Diese Befürchtung, und nicht etwa „das Gefühl der Rücksicht gegenüber dem österreichischen Brudervolk", war einer der Hauptgründe, weshalb Bismarck der Fortsetzung des Krieges entgegentrat und zum beschleunigten Friedensschluß drängte. In dem kurzen Feldzug 1866 verlor das preußische Heer 4450 Soldaten durch Verwundungen und 6427 durch die Cholera. Die Zivilbevölkerung Preußens (ohne Ostpreußen) hatte im selben Jahr 120.000 Choleraopfer zu beklagen. (23) Nach dem Bayerischen Erbfolgekrieg (1778-1779) hatte zwar Friedrich II., ohne die Organisation der Lazarette zu ändern, eine Kabinettsorder bezüglich der Behandlung von verwundeten und kranken Soldaten erlassen, in der es u. a. heißt: „Ich habe seit dem letzten Kriege solche Befehle gegeben, die es allen den Schelmen, Schurken und Spitzbuben bey der Armee künftig schwer machen werden, ihren König zu betrügen und den armen Soldaten [...] so schändlich und barbarisch zu berauben" (Guleke [wie Anm. 10] S. 32). (24) Laukhard, Begebenheiten [wie Anm. 4] Kap. 21, S. 248-250. - Hier ein Streiflicht über unhygienische Zustände im Lazarett: „Für Reinlichkeit, dieses erste Hauptstück für Krankenpflege, worauf mehr ankommt als selbst auf die medizinische Verpflegung, wird so wenig gesorgt, daß ich Kranke weiß, denen die Hemden auf dem Leib verfault und denen von den Läusen tiefe Löcher in den Leib gefressen waren. Freilich sollen die Krankenwärter entweder selbst waschen oder waschen lassen, aber das geschieht nicht. Ferner sehen die Stuben aus wie die Spelunken; und der mephytische Gestank verpestet die Luft aufs abscheulichste. Wer in eine solche Krankenstube hineintritt, verliehrt den Appetit zum Essen wenigstens auf einen Tag" (Laukhard, Begebenheiten [wie Anm. 4] Kap. 21. S. 250-251). (25) Kennzeichnend für die damalige Geringschätzung des heute so hoch angesehenen chirurgischen Fachzweiges ist die Bemerkung des kgl. preußischen Generalchirurgus Johann Christian Theden (1714-1797) in seinem 1374 erschienenen Büchlein „Unterricht für Unterwundärzte bey Armeen": „Man hat bey der preußischen Armee die Compagnie-Wundärzte der elenden Beschäftigung (den Compagnie-Angehörigen) den Bart zu putzen (d. h. zu rasieren) enthoben." Sogar die großen Generalchirurgen des friderizianischen Heeres haben einst diesen Dornenweg gehen müssen. - Noch im Jahre 1774 wollten die Freiburger Studenten Prof. Mederer von Wuthwehr verprügeln, weil er für die Vereinigung der Chirurgie mit der Medizin eintrat, worin man „eine Herabwürdigung der Medizin" sah (v. Brunn [wie Anm. 8] S. 84. - R. Nissen, Das veränderte Bild der Chirurgie. DMW 1955, S. 1213). (26) Laukhard, Begebenheiten [wie Anm. 4] Kap. 21, 22, S. 251. - Das Aderlassen gehörte im Sinne der Säftelehre zu einer von Zeit zu Zeit vorzunehmenden Präventivmaßnahme, wie z. B. heute die GrippeSchutzimpfung. So ließ sich der Soldatenkönig, wenn seine langen, Kerls zu dieser Prozedur angetreten waren, als erster vom Chirurgen Blut abzapfen (v. Brunn [wie Anm. 8] S. 41). (27) Laukhard, Begebenheiten [wie Arm. 4] Kap. 22, S. 252-253. Friedrichs Mißachtung gegenüber den „Militär-Chirurgen" ging so weit, daß er in Feldlazaretten selbst in 15 16 medizinischen Fragen den Truppenoffizier als Inspektor das letzte Wort sprechen ließ. So heißt es z. B. in einem Reglement von 1781 u. a.: „Die Capitains sollen ernstlich darnach sehen, daß [...] keine Amputation eher vorgenommen wird, bis der Brand da ist" (v. Brunn [wie Anm. 8] S. 83). (28) Laukhard, Begebenheiten [wie Anm. 4] Kap. 22, S. 257-259. (29) Laukhard, Begebenheiten [wie Anm. 4] Kap. 22, S. 254-255. - Alle Laukhard-Zitate stammen aus dem von Engels und Harms unlängst herausgegebenen Faksimiledruck des seit ihrem Erscheinen zwischen 1796 und 1802 nicht mehr neu aufgelegten Werk: Friedrich Christian Laukhard, Leben und Schicksale. Fünf Theile in drei Bänden. Zweitausendeins, Frankfurt a. M. 1987. (30) v. Brunn [wie Anm. 8] S. 90. - „Die Regelung der ersten Hilfe auf dem Schlachtfelde und des Verwundetentransports war unzulänglicher als in der Landsknechtszeit", sagte Johann Rust (1375-1840), der 1815 nach Preußen als Generalchirurg berufen wurde und sogut wie möglich die Verwundetenfürsorge nach der Schlacht von Waterloo zu organisieren versuchte. In Anspielung auf die ihm oft entgegengebrachte Uneinsichtigkeit prägte er das makabre Bonmot: „Holzbeine sind nicht vererblich, aber Holzköpfe sind es." (31) v. Brunn [wie Anm. 8] S.91. - Ähnlich äußerte sich noch um 1860, vor der antiseptischen Ära, auch der schottische Arzt James Young Simpson: „Der Mann, der in einem unserer chirurgischen Krankenhäuser auf dem Operationstisch liegt, läuft mehr Gefahr zu sterben als der englische Soldat auf dem Schlachtfelde zu Waterloo." (32) Pertz, Das Leben des Freiherrn von Stein (zit. n. Sticker). Virchow's Archiv Bd 53, S. 389. - Von der Campagne in Frankreich (1792) bis Waterloo (1815) zählten die europäischen Armeen 4.500.000 Mann, von denen 1.500.000 fielen, aber 2.500.000 meist von Infektionskrankheiten dahingerafft wurden. (33) Th. Bernstein, Johann Jacoby. Königsberg 1903, S. 76. - Der von Bernstein zitierte Satz stammt aus einem Brief Jacobys vom 20. Mai 1866 kurz vor Ausbruch des Preußisch-österreichischen Krieges. Der Königsberger Arzt Johann Jacoby (1805-1877) war auch Mitglied der Deputation, die von König Friedrich Wilhelm IV, von Preußen (1840-1861) im November 1848 die Bildung eines die Sympathien des Volkes genießenden Ministeriums forderte. Als der König sich weigerte die Deputation länger anzuhören, rief ihm Jacoby zu: „Das ist das Unglück der Könige, daß sie die Wahrheit nicht hören wollen." ______________________________________________________________________ Friedrich Christian Laukhard, Leben und Schicksale. Fünf Theile in drei Bänden. Faksimile-Nachdruck. Nachwort und Materialien von H. W. E n g e l s und A. H a r m s. 2908 Seiten. Zweitausendeins, Frankfurt a. M. 1987. Gebunden 75,- DM (Leider seit Jahren vergriffen). 16 17 Vor kurzem erschien in drei Bänden ein Faksimile-Nachdruck der Biographie des Friedrich Christian Laukhard. Als Sohn eines protestantischen Pastors studierte er zunächst Theologie und zog als studentischer Vagant von einer Universität zur anderen. Da er als Magister wegen seiner Freigeisterei die erstrebte akademische Anstellung nicht erreichte, ließ er sich schließlich in die preußische Söldnerarmee anwerben. Als gewöhnlicher Musketier kämpfte er auf seiten Preußens im ersten Koalitionskrieg, geriet auf höchst abenteuerliche Weise in französische Gefangenschaft und erlebte Frankreich während der Jakobinerdiktatur. In der Erkenntnis, ein Augenzeuge bedeutender weltgeschichtlicher Veränderungen zu sein, verfaßte er wie ein rasender Reporter jener turbulenten Zeiten seine mehrbändige „Biographie", die er zwischen 1792 und 1802 veröffentlichte. Dieses Werk ist nicht nur eine Fundgrube für Kulturhistoriker, sondern auch für Medizin- und Seuchenhistoriker. Hier haben wir die Schilderung der zunächst verheimlichten Ruhrepidemie während der Campagne in Frankreich 1792, die bereits vor Valmy die Schlagkraft des Invasionsheeres lähmte, und dann das Grauen in den preußischen Militärlazaretten beim Rückzug. Besonders aufschlußreich für die Geschichte der Geschlechtskrankheiten ist die ungeschminkte Schilderung des verrotteten Studentenlebens samt den Interieurs „der nur zu öffentlichen Häuser". Da Laukhard bei seinen Wanderungen durch Deutschland und Frankreich die unteren Schichten der Bevölkerung besonders gut kennerlernte, fühlte er sich mehr und mehr als ihr Anwalt. Ebenso wie Louis-Sebastian Mercier in seinen „Tableau de Paris" läßt Laukhard in seiner autobiographischen Reportage das Panorama der feudalen „Infrastruktur" an uns vorbeiziehen. Den Faksimiledruck dieser großartigen Biographie verdanken wir dem LaukhardForscher Hans-Werner Engels, einem Schüler der Historiker F. Fischer und W. Grab, der im Laufe von zwei Jahrzehnten mit minuziöser Akribie alles recherchiert hat, was von Laukhard oder über ihn geschrieben wurde. Das von Engels und Harms verfaßte, über 200 Seiten lange Nachwort ist ein wahres Kabinettstück und zugleich eine brillante und verdienstvolle Rehabilitation eines zu Unrecht verpönten, totgeschwiegenen und vergessenen Spätaufklärers, der unerschrocken und weitsichtig gegen die Mißstände seiner Zeit zu Felde zog und in dessen gesellschaftskritischen Schriften - laut Stefan Zweig - „etwas von dem großen Zorn Lessings leuchtet". (Stefan Winkle) Copyright by the author – Alle Rechte beim Autor Dieser Artikel erschien erstmalig im Hamburger Ärzteblatt (42) Seiten 13-20 Jg: .... Kontakt über ePost [email protected] Copyright für diese und die Internetausgabe Collasius 2003 17