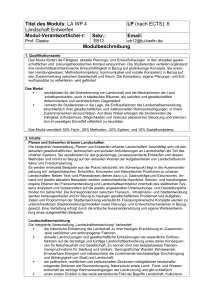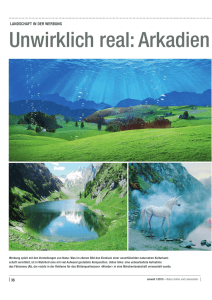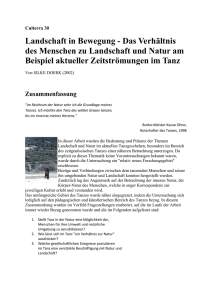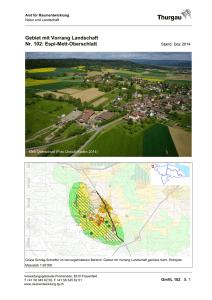Agnes SIODA
Werbung
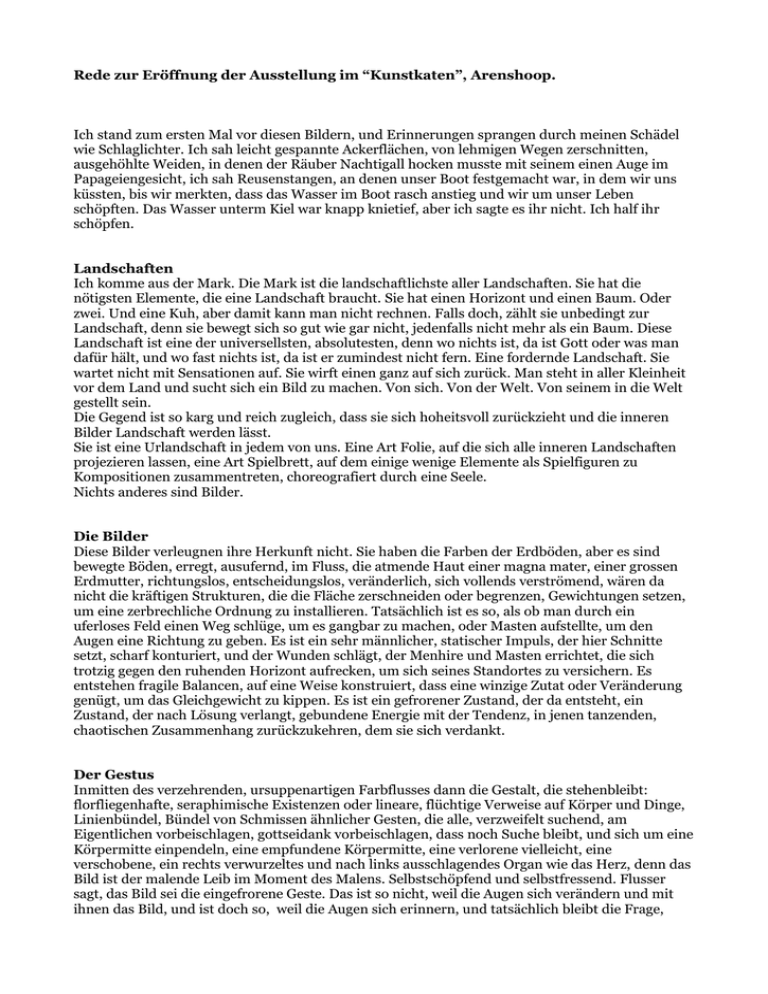
Rede zur Eröffnung der Ausstellung im “Kunstkaten”, Arenshoop. Ich stand zum ersten Mal vor diesen Bildern, und Erinnerungen sprangen durch meinen Schädel wie Schlaglichter. Ich sah leicht gespannte Ackerflächen, von lehmigen Wegen zerschnitten, ausgehöhlte Weiden, in denen der Räuber Nachtigall hocken musste mit seinem einen Auge im Papageiengesicht, ich sah Reusenstangen, an denen unser Boot festgemacht war, in dem wir uns küssten, bis wir merkten, dass das Wasser im Boot rasch anstieg und wir um unser Leben schöpften. Das Wasser unterm Kiel war knapp knietief, aber ich sagte es ihr nicht. Ich half ihr schöpfen. Landschaften Ich komme aus der Mark. Die Mark ist die landschaftlichste aller Landschaften. Sie hat die nötigsten Elemente, die eine Landschaft braucht. Sie hat einen Horizont und einen Baum. Oder zwei. Und eine Kuh, aber damit kann man nicht rechnen. Falls doch, zählt sie unbedingt zur Landschaft, denn sie bewegt sich so gut wie gar nicht, jedenfalls nicht mehr als ein Baum. Diese Landschaft ist eine der universellsten, absolutesten, denn wo nichts ist, da ist Gott oder was man dafür hält, und wo fast nichts ist, da ist er zumindest nicht fern. Eine fordernde Landschaft. Sie wartet nicht mit Sensationen auf. Sie wirft einen ganz auf sich zurück. Man steht in aller Kleinheit vor dem Land und sucht sich ein Bild zu machen. Von sich. Von der Welt. Von seinem in die Welt gestellt sein. Die Gegend ist so karg und reich zugleich, dass sie sich hoheitsvoll zurückzieht und die inneren Bilder Landschaft werden lässt. Sie ist eine Urlandschaft in jedem von uns. Eine Art Folie, auf die sich alle inneren Landschaften projezieren lassen, eine Art Spielbrett, auf dem einige wenige Elemente als Spielfiguren zu Kompositionen zusammentreten, choreografiert durch eine Seele. Nichts anderes sind Bilder. Die Bilder Diese Bilder verleugnen ihre Herkunft nicht. Sie haben die Farben der Erdböden, aber es sind bewegte Böden, erregt, ausufernd, im Fluss, die atmende Haut einer magna mater, einer grossen Erdmutter, richtungslos, entscheidungslos, veränderlich, sich vollends verströmend, wären da nicht die kräftigen Strukturen, die die Fläche zerschneiden oder begrenzen, Gewichtungen setzen, um eine zerbrechliche Ordnung zu installieren. Tatsächlich ist es so, als ob man durch ein uferloses Feld einen Weg schlüge, um es gangbar zu machen, oder Masten aufstellte, um den Augen eine Richtung zu geben. Es ist ein sehr männlicher, statischer Impuls, der hier Schnitte setzt, scharf konturiert, und der Wunden schlägt, der Menhire und Masten errichtet, die sich trotzig gegen den ruhenden Horizont aufrecken, um sich seines Standortes zu versichern. Es entstehen fragile Balancen, auf eine Weise konstruiert, dass eine winzige Zutat oder Veränderung genügt, um das Gleichgewicht zu kippen. Es ist ein gefrorener Zustand, der da entsteht, ein Zustand, der nach Lösung verlangt, gebundene Energie mit der Tendenz, in jenen tanzenden, chaotischen Zusammenhang zurückzukehren, dem sie sich verdankt. Der Gestus Inmitten des verzehrenden, ursuppenartigen Farbflusses dann die Gestalt, die stehenbleibt: florfliegenhafte, seraphimische Existenzen oder lineare, flüchtige Verweise auf Körper und Dinge, Linienbündel, Bündel von Schmissen ähnlicher Gesten, die alle, verzweifelt suchend, am Eigentlichen vorbeischlagen, gottseidank vorbeischlagen, dass noch Suche bleibt, und sich um eine Körpermitte einpendeln, eine empfundene Körpermitte, eine verlorene vielleicht, eine verschobene, ein rechts verwurzeltes und nach links ausschlagendes Organ wie das Herz, denn das Bild ist der malende Leib im Moment des Malens. Selbstschöpfend und selbstfressend. Flusser sagt, das Bild sei die eingefrorene Geste. Das ist so nicht, weil die Augen sich verändern und mit ihnen das Bild, und ist doch so, weil die Augen sich erinnern, und tatsächlich bleibt die Frage, warum das Bild, wenn es denn der selbstmalende lebendige Leib ist, nicht wieder und wieder übermalt werden muss, wie auch der Leib zu keinem Zeigtpunkt derselbe bleibt. Und es ist wohl ein Zugenständnis an das Bedürfnis des Malenden, sich in der Vergangenheit zu beheimaten… das war nämlich der Tag, als der ging oder die den letzten Wein trank und ihr Klavier mitnahm und meine Hand im Gelenk lag wie etwas fremdes… oder eher ein Zugeständnis an die Versuchung, eine Ordnung zu stiften, ein Prinzip, eine Balance der Kräfte, denen er unterworfen ist, eine Ordnung, die auf ihn zurückwirke, ein Neuentwurf der Welt. Mithin ein Zugeständnis an den Tod oder eher an die Angst vor dem Tod. Der Ton Wenn ich durch die Landschaften laufe, von denen ich erzählt habe, ertappe ich mich bei einer Melodie, die mich - über dem Rhythmus der Schritte - durch singt. Es ist eine simple Melodie wie die eines Kinderliedes. Einige wenige Töne, die sich um eine Mitte bewegen. Einige der Bilder hier haben so karge minimalistische Kompositionen. Über einem impressiven, gestischen, hintergründigen Klangteppich bilden einige wenige klar getrennte Töne eine verletzliche Harmonie, eine, die - je nachdem - die Neigung hat, in einen lang ausgehaltenen, einzigen Dauerton zu münden oder in eine Tosende Kakophonie zu stürzen. Ich war gestern am Meer. Das Meer hat diesen einen Ton, und dessen Farbe ist Azur, die Farbe der Transzendenz, des Ewigen, Unendlichen. Aber das Meer ist keine Landschaft, es ist die Aufhebung der Landschaft, das, woraus alles kommt, und wohin es zurückkehrt. Es ist das Urweibliche, in fortwährender Bewegung, periodisch. Und wenn die Mark Gottnähe ist, denn ist das Meer göttlich. Zurückgekehrt in diese Räume, habe ich kein Meer gefunden und diesen Ton nicht und fast kein Blau. Lediglich Annäherungen ; ich habe ein rotes Bild gefunden, das aus sich selbst leuchtet wie ein farbiges Glasfenster, und dessen Formen gezeitenartig an- und abzuschwellen scheinen. Ein Bild nah am Blut und nah am Meer. Kein Meerbild. Gut so, dachte ich dann, denn wenn es so ist, dass man nur ein einziges gutes Bild vom Meer zu malen imstande ist, und wenn dies der Moment ist, in dem man jenen einzigen Ton gefunden hat, der aus der Fläche aufsteigt, dann ist dies auch der Punkt, an dem man dem Meer bereits so nahe ist, dass das Malen ein Ende hat. Und bis dahin sei noch etwas Zeit. Matthias Scheliga, Kunst- und Literaturwissenschaftler Berlin, Januar 1999