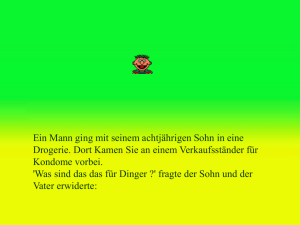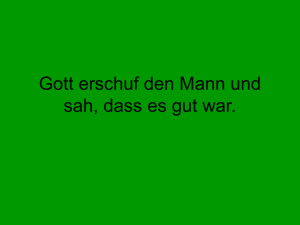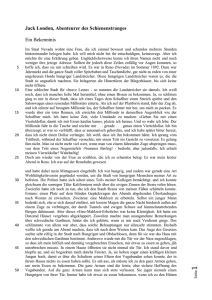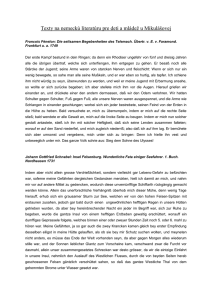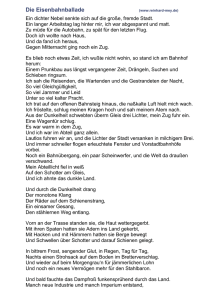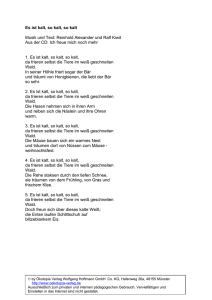Kurzgeschichten
Werbung
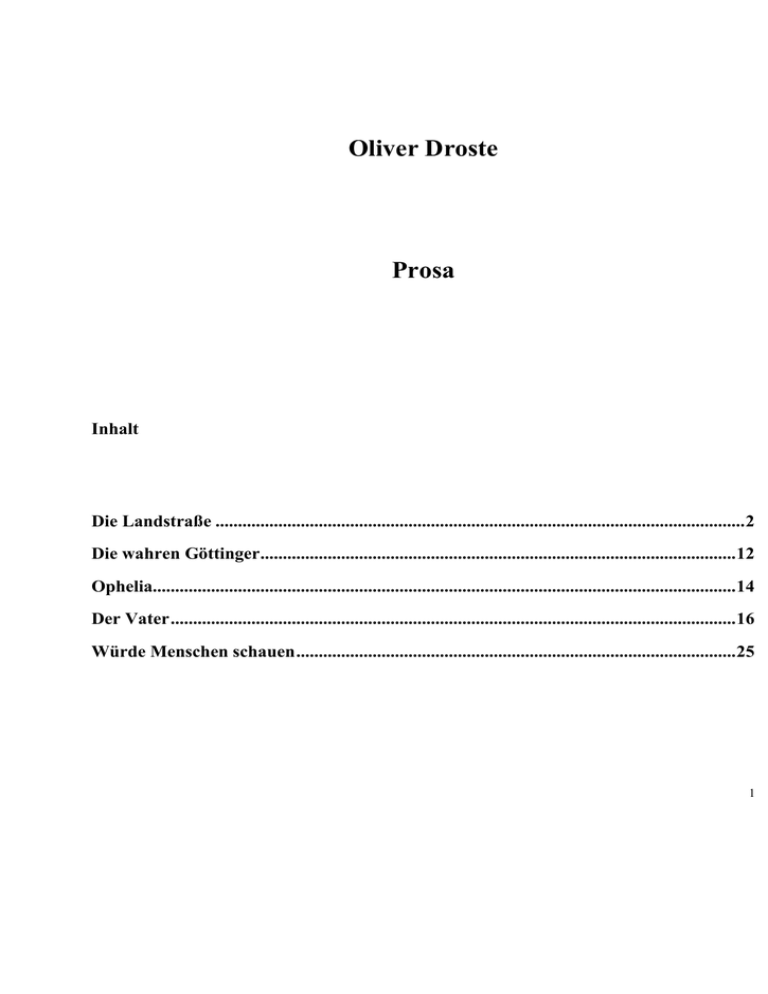
Oliver Droste Prosa Inhalt Die Landstraße ...................................................................................................................... 2 Die wahren Göttinger..........................................................................................................12 Ophelia..................................................................................................................................14 Der Vater ..............................................................................................................................16 Würde Menschen schauen ..................................................................................................25 1 Die Landstraße Als das Mädchen 18 und der Junge 19 wurden, verließen sie das Heim, in dem sie solange, wie sie nur denken konnten, lebten. Es waren aber nur 5 Jahre. Die Zeit davor haben sie vergessen, oder wie ihr Psychologe sagte, verdrängt, da sie so Schreckliches erlebt hatten. Vorher, vor dieser ewig scheinenden Zeit, sollen sie eine Familie gehabt haben, wurde ihnen gesagt. Vieles gab es heute nicht mehr, was es früher einmal gegeben hatte und jeden Tag mußten sie von neuem beginnen, da sie vergessen hatten, was einmal war. Ein Schutzmechanismus der sich aufgebaut hatte, um das Grauen der Vergangenheit im Dunkel der vergessenen Erinnerung zu belassen. Nur trennte dieser Mechanismus nicht die besserere jüngere Vergangenheit von der schlechteren, älteren. So entdeckten sie jeden Tag etwas Neues, Positives wie Negatives. Sie kamen die Landsraße hinunter. Zwischen den hügeligen Bergkuppen blutete der Horizont. „Wir brauchen ein Zimmer und Geld, um es zu bezahlen“, sagte er zu ihr. „Wie sollen wir das finden?“ „Wir müssen nur suchen, weil, wer sucht, der findet“, dachte er laut, den netten Prediger vor Augen, ein Bild der Güte, daß sich in seinem bildhaften Gedächtnis eingegraben hatte, um in Notzeiten, wie ein Heiliger zu erscheinen. „Wer sagt das, dein Therapeut?“ spöttelte sie. „Ne, das hab ich mal als Kind gehört; ich weiß auch nicht wo, irgendwo in Nirgendwo“; er versuchte in seinem Dunkel etwas zu finden, sah nur Bilder, „vielleicht Wheinachten, als es noch von Bedeutung war“. „Wer weiß, wer es dir gesagt hat; hat er dich gemocht?“ „Warum?“ fragte er. „Wenn er dich nicht mochte, wird er es böse mit dir gemeint haben.“ „Ich weiß nicht, wer es gesagt hatte.“ „Hatten sie es danach gut mit dir gemeint?“ beharrte sie. Entweder war ein Mensch gut oder böse, war er schlau oder dumm, hilfsbereit oder gefährlich. Sie meinte es den Menschen sofort ansehen zu können, an ihren Gesichtern, an ihren Augen. „Ich weiß nicht, woran erkennt man das?“ wollte er wissen. „Vielleicht, wenn du dich an deine Vergangenheit erinnerst. Ich kann mich an meine Vergangenheit nicht erinnern. Dr. Schwärzer holt das aus mir heraus, ist aber so schrecklich, daß ich es gleich wieder vergesse, ist keine gute 2 Vergangenheit.“ Ihre grünen Augen sahen in den Himmel, sahen eine Sternschnuppe fallen. Wozu war das noch gut, daß ein Stern vom Himmel fällt, überlegte sie. „Mir ist kalt, was mache ich nur dagegen?“ unterbrach der Junge die eingetretene Stille. „Mir ist nicht kalt, habe Schuhe an.“ „Hab vergessen, sie mir anzuziehen“, bemerkte er, als er zu seinen nackten Füßen hinuntersah. „Wenn du mir einen Schuh gibst, ist mir vielleicht nur halb so kalt und dir nur halb so warm.“ „Du hast aber größere Füße wie ich“, entgegnete das Mädchen. „War ja nur‘ne Idee, tut mir leid.“ „Muß dir nicht leid tun, kann ja nichts dafür, daß ich kleine Füße habe.“ Sie gingen weiter; der aufkommende Vollmond ließ die sie umgebende Landschaft unwirklich aussehen, so unwirklich, wie ihnen ihr Leben schien. Am Waldrand, oberhalb des Feldes bemerkte das Mädchen ein heraustretendes Reh mit Kitz. Sie freute sich über diese Lebewesen, die ihr so elegant und lieblich erschienen. Das Reh beleckte das Kitz, das darauf wild springend und ausschlagend, voll Lebensfreude und Übermut, über die Wiese sprang. So muß das Leben immer sein, dachte sie. Sie kamen an einem Buswartehäuschen vorbei und sahen dort eine lumpige Gestalt liegen. „Laß uns mal den Penner fragen, was er gegen die Kälte tut,“ sagte der Junge frierend. „Hallo, Herr Penner, was können wir gegen die Kälte machen?“ fragte das Mädchen höflich. „Mach dir‘n paar warme Gedanken und laß mich in Ruhe!“ keifte der alte Mann heiser, der für diese Art von Spott nichts übrig hatte und drehte sich auf die andere Seite, um seinen Träumen der guten alten Zeit nachzugehen, ins Nebelland seines Rausches. „Was sind denn nur warme Gedanken?“ fragte das Mädchen vorsichtig. „Verpisst euch! Saubande! Kann man nich mal hier seine Ruhe ham.“ Erschrocken über diesen bösen Ton, beschloß das Mädchen zu gehen. Sie konnte in den Augen nichts erkennen, nur Leere, das machte ihr Angst. „Mir ist so kalt“, jammerte der Junge, diesem Gefühl vollkommen ergeben. „Denk an was Warmes.“ „An was denn nur?“ „An die Sonne“ sagte sie mit leuchtenden Augen, froh über diesen warmen Gedanken. „Ich sehe aber keine Sonne. Ich kann mich nicht mal an die Sonne erinnern“, sagte er. 3 „Sonne ist gelb und rund und macht die Pflanzen wachsen.“ Beim letzten Wort machte sie mit ihren Armen eine ausholende Bewegung, voller Begeisterung. Sie konnte diese warme Welt, eine duftende Blumenwiese sehen. „Dann laß uns das Gelb suchen“, sagte der Junge und beschleunigte seinen Schritt. Durch die veränderte Geschwindigkeit verlor sie den Anschluß an ihre schönen, bunten Bilder und sah sich um. „Wo nur, hier ist alles grau“, erkannte sie traurig. „Der Penner hatte alte, gelbe Zeitungen.“ „Aber Zeitungen sind doch nicht warm“, sagte das Mädchen. „Und gelbe Zähne. Sind meine Zähne gelb? Ähh“, zeigte er ihr seine Zähne. „Geht so“, sagte sie und sah im Mondlicht einen Vogel auf einem Zweig sitzen, was sie wieder in Begeisterung ausbrechen ließ. „Guck mal da, ein Spatz, der friert auch nicht.“ „Woher willst du das wissen?“ „Er zittert doch gar nicht.“ „Sieht auch ganz schön dick aus, ist dann kein Wunder; ich bin dünn“, sagte der Junge. „Der plustert sich auf“, erinnerte sich das Mädchen. „Wie macht er das nur? Hält er die Luft an?“ fragte er. „Weiß nicht, mir wird jetzt aber auch kalt, hier fühl mal meine Hand.“ Sie hielt ihre Hand an seine Wange. „Uhh, kalt“, bemerkte er und zuckte zurück. „In meiner Hosentasche ist noch Wärme.“ „Ich will wieder ein Bett und eine Decke“, sagte sie, sich erinnernd und wunderte sich, nur Gutes aus der nahen Vergangenheit zu wissen. „Aber nich in der Klappse“, erinnerte er das Mädchen und weckte sie aus ihren Träumereien. „Nein, da ist es warm, aber so kalt, dort lebt man nicht mehr“, sagte sie, nun auch frierend. „Aber man hat da keine Probleme“, fügte sie hinzu. „Ne, man schläft nur so vor sich hin, auch wenn man wach ist, alles ist ein Traum.“ „Nein, ich will nicht mehr träumen, will leben. Mir is nur so kalt.“ „Laß uns in ein Haus gehen“, sagte der Junge. „Die sind doch nicht offen.“ „Doch, es muß eins offen sein.“ „Die, die offen sind, sind kalt.“ „Dann müssen wir ein verschlossenes aufbrechen, um Wärme zu finden“, beharrte der Junge. 4 „Das ist aber verboten“, sagte sie mit zitternden Lippen. „Is aber erlaubt, zu erfrieren, oder was?“ „Häuser sind nur für Leute, die Geld haben“, überlegte sie weiter. „Dann müssen wir Geld besorgen.“ „Aber wie?“ fragte sie. Geld war ein abstrakter Begriff für sie. Wo sie herkamen gab es kein Geld, und an die Zeit vor dem Heimaufenthalt konnte sie sich nicht erinnern. „In‘ne Zeitung gucken, wegen Arbeit und Geld verdienen“, sprach der Junge seinen Geistesblitz aus. „Die kostet aber Geld.“ „Vielleicht finden wir‘ne alte Zeitung.“ Sie überlegten, wo sie zuletzt eine Zeitschrift gesehen hatten. Der Blick in die Vergangenheit verdunkelte sich, jedoch nicht der Blick in die nahe Vergangenheit, die vor Augenblicken noch Gegenwart war. „Der Penner hatte alte Zeitungen“, sagte sie. „Die halten ihn warm, der gibt uns bestimmt keine.“ So gingen die beiden die Landstraße entlang, die kein Ende zu nehmen schien und überlegten, wie sie aus dieser Situation ohne fremde Hilfe herauskommen sollten. Bisher sind ihnen alle Entscheidungen abgenommen worden. Das war nicht immer ein angenehmer Zustand. Die Schlafenszeit hätten sie zu gerne selbst bestimmt, auch das Fernsehprogramm, und noch viel mehr hätten sie den Fernsehraum solange in Anspruch genommen, wie es ihnen passte. Ja, ihnen wurde viel vorgeschrieben, aber im Leben soll man auch nicht immer alles bekommen können, was man möchte und das müßten sie auch lernen. Nur konnten sie gerade jetzt dieses Gelernte am wenigsten gebrauchen. Vor ihnen zweigte ein Parkplatz ab, den sie als willkommene Abwechselung betraten. „Da steht ein Altpapierkontainer“, sagte sie und zeigte darauf, sprang ein paar mal in die Luft und klatschte vor Freude in die Hände. „Woher weißt du das?“ fragte der Junge zurückhaltend. „Steht doch drauf“, sagte sie strahlend und zeigte auf den Schriftzug. „Oh“, sagte er errötend und trat etwas verunsichert von einem Fuß auf den anderen, „ich kann nich, äh - lesen“. „Wieso, warst du nicht in der Schule?“ fragte sie herumtänzelnd. „Doch, aber ich hab‘s nich lernen können“, sagte er verärgert, „weiß auch nich wieso, war auf‘ner Sonderschule“, fügte er, sich entschuldigend, hinzu. „Kannst du denn das A, B, C auch nicht?“, fragte das Mädchen und blieb vor ihm stehen. 5 Für so dumm mochte er nun auch nicht gehalten werden, denn das was ihm gesagt wurde, konnte er behalten. Er behielt mehr, als alle anderen, jede Kleinigkeit, jeden Gesichtsausdruck und jede Missetat gegen ihn. Damit konnte er sich tagelang beschäftigen und in sich versunken dasitzen und die Wand seines Zimmers anstarren. „Kannst du denn das A, B, C nicht?“, fragte sie ihn nocheinmal und wunderte sich, warum sie es eigendlich konnte. Wie kam es dazu? „Doch, hab ich mal auswendig gelernt,“ sagte er und demonstrierte ihr, „a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ...“ „Is ja gut, glaub ich ja“, sagte sie etwas laut und sah ihn verwundert an. Denn er hob die Hände schützend, abwehrend vor sein Gesicht und kniff die Augen mit flatternden Lidern zusammen, um sich zu entschuldigen, „kann nur nich die Buchstaben lesen, schlag mich aber bitte nich, kann sie nämlich trotzdem nich lesen.“ „Wieso sollte ich dich denn schlagen?“ wunderte sich das Mädchen. „Wenn ich n-nich l-les-sen kann, n-nützt das Sch-schlagen nämlich a-auch n-nix.“ „Wozu soll auch Schlagen gut sein? Tut nur weh“, sagte sie und nahm seine Hand, um ihn zu beruhigen. „Weiß auch n-n-nicht. W-w-wenn man was f-f-falsches m-macht, wird m-man gesch-sch-schlagen,“ sagte er und fing an, am ganzen Körper zu zittern. Sie nahm ihn in den Arm und drückte ihn sanft an sich, „brauchst keine Angst zu haben, beruhige dich, ich bin doch da“. So standen sie auf dem Parkplatz und wärmten sich in der helfenden Geste. Das Mädchen dachte über seine Worte nach und fragte ihn, als sein Zittern aufhörte, „wer sagt denn, was richtig ist?“. „Weiß auch n-nich, muß m-man a-ber w-wissen. Ich w-weiß aber n-nich, was man m-mir nich sagt.“ Das Mädchen freute sich, daß das Schweigen beendet war; bei so nahem Kontakt fühlte sie sich unwohl, aber wollte ihn wieder aufheitern und hüpfte fröhlich etwas zurück. „Man darf bei Rot nicht über die Ampel gehen“, sagte sie. „Ja, das w-weiß ich“, sagte er und beruhigte sich. „Woher weißt du das?“ fragte sie ihn weiter. „Weiß n-nicht, hat mir wohl jemand gesagt“, sagte er. „Hat er es denn gut mit dir gemeint?“ „Keine Ahnung, weiß ja nicht, woher ich das weiß.“ „Weißt du denn jemand, der es mit dir gut gemeint hat?“ fragte sie ihn und mußte es sich auch selbst fragen. „Muß ich mal überlegen“, sagte der Junge und zog die Augenbrauen hoch. „Vielleicht dein Lehrer?“ „N-ne, der hat m-mich im-mer geschlagen.“ 6 „Warum denn?“ „Weiß n-nicht, weil ich vielleicht n-nich l-lesen konnte,“ sagte er. „Aber gelernt hast du es doch auch nicht durch die Schläge, oder?“ „N-ne, kann im-mer noch nich lesen“, sagte er und grinste, „hat dem n-nämlich überhaupt nichts gen-nützt, hat dann nämlich einen Herzanfall gekriegt“, sagte er und fing an zu lachen. „Hab dann, wie er so am B-boden liegt einen Stt-tuhl genommen und solange auf ihn eingeschlagen, bis er g-ganz tot war.“ „Oh, das war aber ganz böse“, sagte sie und blieb stehen. Die Kälte kroch ihr wieder in die Glieder und sie fing an zu zittern. „Ich will wieder zurück, mir ist so kalt.“ „Ja“, grinst der Junge und starrt vor sich hin, „bis er tot war“. Bei dieser Bemerkung machte er ruckartige Bewegungen mit seinen Armen, um diese Tat nocheinmal zu demonstrieren, sie nocheinmal zu erleben. Was war das für eine Genugtuung für ihn. „Und niemand hat mich seit dem mehr geschlagen. Sie haben mich dann ihn diese Anstalt gebracht.“ „Wo ist nur die Sonne?“ fragte das Mädchen, erschrocken über das Verhalten des Jungen, „ich brauche die Sonne, die Wärme“. Der Junge sah in den Nachthimmel, „da ist aber keine Sonne, es gibt keine Sonne, da ist nur der Mond“ und zeigte mit seinem Finger in die Endlosigkeit. Sein Blick war trübe. „Ja“, sagte das Mädchen und freute sich, nicht ganz verlassen zu sein, „der Mond; er wird von der lieben, warmen Sonne angeschienen; die Sonne macht den Mond leuchten“. „Die Wärme hat der Mond aber für sich behalten“, sagte der Junge und packte das Mädchen grob am Arm, „der Mond ist kalt, es ist immer kalt; es gibt keine Sonne, die wärmt, sie ist nur grell und tut in den Augen weh“. „Aua, laß mich los, du tust mir weh“, rief sie mit aufgerissenen, grünen Augen und versuchte sich loszureißen, doch sein Griff war fest, krampfartig kräftig, vom Bewußtsein nicht gelenkt. Das Mädchen bekam Angst und rüttelte ihren Arm hin und her, „aua, das tut mir doch weh“; sie schlug mit ihrer Faust auf seine Hand. Der Junge blähte seine Brust auf, „du schlägst mich? Du schlägst mich ja. Niemand schlägt mich mehr, niemehr, niemand, du auch nicht“. Er ballte seine andere Faust zu Stein und schlug ihr mit all seiner unterbewußten Kraft ins Gesicht, Blut schoß ihr sofort aus der Nase und grüne Seen wurden ihre Augen. Der Kopf flog zurück; doch der Junge riß sie mit einer kräftigen Bewegung wieder zu sich und schlug erneut zu. 7 „Du schlägst mich nicht!“ brüllte er sie an und traf sie hart an der Schläfe. Darauf sackte sie zu Boden. „Wer mich schlägt, den mache ich kalt.“ So lag das Mädchen am Boden und der Junge hielt ihren Arm fest im Griff, fiel auf seine Knie, griff einen Backstein der am Parkplatzrand lag und zum Ausbessern der Schlaglöcher diente. Nun wurde er einem anderen Zweck zugeführt, mit großer Gewalt. Ein Reh mit einem Kitz verschwanden am Waldrand, aufgeschreckt durch dumpfe Schläge und einem verzerrten Lachen. „Was ist mit dir?“ fragte das Mädchen verängstigt und hielt ihre Hände vor das Gesicht. Der Junge lag am Boden und krampfte zuckend und um sich schlagend. „Was ist denn mit dir? Warum hilft uns denn niemand?“ Sie sah sich um, suchte nach einem Menschen, der helfen könnte, doch da war niemand. Sie waren allein, mit sich selbst allein. Das Zucken ging in ein Zittern über, um dann zu verebben. Sie kniete sich zu ihm und strich ihm mit ihrer Hand das verschwitzte Haar von der Stirn. „Es ist alles gut, alles ist gut, sei ganz beruhigt, ich bin ja da.“ Langsam fanden die Worte durch den Nebel seines Geistes in sein Bewußtsein. Er hielt die Augen verschlossen und genoß die ihm zukommende, mütterliche Zärtlichkeit, die sanften Worte. Sie faßte ihn unter den Achseln und zog ihn auf ihren Schoß, um ihn im Arm zu halten, „alles wird gut, ich bin ja da, ich helfe dir“. Der Junge öffnete seine Augen und blickte verstört um sich, „was ist passiert, wo bin ich?“. „Ich weiß nicht wo wir sind, aber ich bin hier“, antwortete das Mädchen, glücklich über das Erwachen des Jungen. „Was ist denn – passiert? Mein Fuß tut mir weh. Wer hat mir das getan?“ „Niemand hat dir was getan, ich bin doch hier. Du bist plötzlich umgefallen und hast so schrecklich gezuckt und gezittert und mit deinem Fuß an den Straßenpfeiler getreten.“ „Wo bin ich denn?“ „Ich weiß es doch nicht, auf einem Parkplatz, an einer Landstraße“, sagte das Mädchen. So lag der Junge im Arm des Mädchens und wußte nicht, ob er darüber nun glücklich sein sollte oder verängstigt. „Wenn ich dir helfe, kannst du dann aufstehen?“ „Ich will’s versuchen“, sagte der Junge und stand, auf das Mädchen gestützt, mit wackeligen Beinen, auf. „Mir ist so kalt“, zitterte er. „Mir auch“, sagte das Mädchen, „aber es kann nicht immer Nacht bleiben“. 8 „Und wenn doch?“ „Dann bin ich immer noch da.“ „Ich weiß nicht; ich weiß gar nicht mehr, wie die Sonne aussieht.“ „Bald werden wir die Sonne sehen, sieh in den herrlichen Sternenhimmel, keine Wolke, bald sehen wir die Sonne“, lachte das Mädchen, nun wieder glücklich, einen fröhlichen Gedanken gefunden zu haben und diese schreckliche Situation überstanden zu haben. Der Junge freute sich über seine Begleitung, die ihm so viel Hilfe und Wärme zukommen ließ, „ja, laß uns weitergehen.“ „Wohin werden wir wohl gehen?“ fragte das Mädchen. „Ich weiß nicht – irgendwo hin, vielleicht nirgendwo hin – ich weiß nicht.“ „Wo wollten wir eigendlich hin?“ fragte das Mädchen. „Weg wollten wir, woanders hin, wo hin, wo die Sonne scheint, wo die Sonne wärmt. Ob wir den Ort wohl finden?“ „Bald muß die Sonne aufgehen, dann sind wir da.“ „Ja, sie muß bald aufgehen, mir ist so kalt“, sagte der Junge zitternd. So gingen die beiden durch die Nacht, Arm in Arm, sich gegenseitig wärmend, über eine endlos scheinende Landstraße. „Wir müssen doch bald ein Haus finden, ein Dorf“, sagte der Junge. „Ja, ein warmes, gemütliches Haus.“ „Ja, wo es was warmes zu essen gibt.“ „Ein warmes Zimmer, vielleicht mit einem Kamin und warmen, prasseldem Feuer“, träumte das Mädchen den Gedanken weiter. „Einem Sofa mit einer kuscheligen Wolldecke“, lachte der Junge. „Und einer netten alten Frau, die uns was zu essen gibt“, sagte das Mädchen und schluckte etwas Wehmut hinunter. „Und einem Fernseher mit meinem Lieblingsprogramm“, ergänzte der Junge. Sie gingen beide in ihre Träume gehüllt weiter, doch ihnen wurde wieder kalt. „Verdammt, hier ist kein Haus, weit und breit“, sagte der Junge ärgerlich über die Kälte. „Da hinten kommt ein Auto, vielleicht kann es uns mitnehmen zum nächsten Ort“, rief das Mädchen fröhlich und hüpfte auf die Straße, um es zum Anhalten zu winken. Der Wagen kam schnell näher, der Sportauspuff röhrte. 9 „Vorsicht“, rief der Junge, „der sieht dich vielleicht nicht, es ist doch dunkel“. „Der muß mich aber sehen, „hallo“, rief das Mädchen fröhlich, „anhalten!“. „Vorsicht, der ist zu schnell!“ Die Reifen quitschten, der Frontspoiler setzte mehrmals auf, der Wagen schleuderte. Der Junge kniff die Augen zu und drehte sich weg, als wolle er sich schützen. Mit einem Wimmern endete das Quitschen und der Wagen stand, die Scheibe wurde elektrisch heruntergelassen und der donnernde Baß heruntergedreht. „Bist du wahnsinnig, ich hätte dich fast über den Haufen gefahren, du Irre!“, brüllte eine rauhe Stimme. „Eh, frag die Schnitte doch was sie will“, rief eine andere Stimme aus dem Wageninnern. „Was is’n los, was willste?“ fragte der Fahrer. „Wir wollen mit in den nächsten Ort, wo es warm ist“, sagte das Mädchen etwas eingeschüchtert von der Rauhheit des Wortes. „Mitfahren will se, Mann.“ „Soll se doch mitfahren.“ „Komm las die Alte rein“, tönten alkoholisierte Stimmen aus dem Auto. Der Junge stand am Straßenrand und sah sich das Geschehen an. „Aber wir sind zu zweit“, sagte das Mädchen, „uns ist kalt“. „Wir haben nur Platz für einen“, sagte der Fahrer. „Los, Mann“, tuschelte jemand im Hintergrund, so daß es nicht nach außen drang, „las dir was einfallen, die Braut is geil“. „Äh, wir können dich mitnehmen, bis in den nächsten Ort, da lassen wa dich raus und holen deinen Freund, ist doch in Ordnung, oder?“ „Oh, ja“, freute sich das Mädchen und hüpfte zum Wagen. „Ihr seid wirklich nett.“ „Klar sind wir das.“ „Und wie“, rief jemand aus dem Wagen. „Die kommen gleich dich holen, ich fahre zuerst, ja?“ rief das Mädchen zum Jungen. „Ich weiß nicht“, sagte er. Sie stieg in den Wagen auf die Rückbank, zwischen zwei betrunkene Männer und sah in ihren Blicken Gier. Obwohl sie darum gebeten hatte, wieder aussteigen zu dürfen, fuhr der Wagen mit quitschenden Reifen und röhrendem Auspuff, unter besoffenem Gelächter ab. 10 Der Junge wartete lange, bis er es vor Kälte nicht mehr aushielt und ging die Landstraße weiter hinunter, in der Hoffnung, bald die Ortschaft zu finden, wo das Mädchen in dem warmen Haus mit der netten, alten Frau, dem Sofa, dem Kamin und dem Fernseher auf ihn warten würde. Doch die Landstraße war endlos. Ein Vogelkonzert begann und der Himmel errötete. Der Junge war zu müde zum frieren, zu müde zum laufen. Der Duft einer Blumenwiese wehte zu ihm herüber. Die Sonne stieg langsam herauf schreckte die Nacht hoch, daß sie sich langschattig verkroch. „Oh, die Sonne, die Blumenwiese, es wird wärmer.“ Er ging von der Straße auf diese Wiese und atmete die Luft, das Leben, tief ein, ein Leben das dort schlief, für immer. „Da liegt doch jemand“, flüsterte der Junge zu sich selbst, „da ist sie doch“ und lief über die Wiese, dem Waldrand entgegen, wo ein Feldweg, von der Landstraße abzweigend, endete. Er kam näher und wurde langsamer, bis er vor dem Mädchen stehenblieb. „Hallo, da bist du ja, sieh die Sonne, da ist die Sonne endlich und die herrliche Blumenwiese“, sagte der Junge mit trüb glänzenden Augen. Doch das Mädchen rührte sich nicht und starrte mit weit offenen Augen nach Nirgendwo. Er setzte sich zu ihr ins Gras und zupfte ihre zerissenen Kleider zurecht. „Dir wird kalt, wenn du dich nicht wieder richtig anziehst. Sieh, die Sonne, endlich ist die Sonne da, sieh doch.“ Das Mädchen starrte nach Nirgendwo. „Endlich sind wir da, wo wir hinwollten, nicht wahr?“ Er griff ihre Hand, „uh, du bist aber kalt“ und legte sich zu ihr. Er sah glücklich in die Sonne; er sah sehr lange in die Sonne, bis der Morgentau seine Lider benetzte, oder waren es Tränen? Er sah in die Sonne, bis er blind war. Eine Glocke leutete und jemand rief, „essen kommen“. „Komm“, sagte das Mädchen zum Jungen, „wir müssen zum Essen“. „Was?“, fragte der Junge aus seinen Träumen gerissen, „wo bin ich?“ „Warte, ich helfe dir, wir müssen essen.“ Sie sprang fröhlich auf und führte den blinden Jungen zurück in die Psychiatrie. Er war glücklich, daß er diesen Menschen, der so nett zu ihm war, hatte. 11 Die wahren Göttinger Laßt mich diese kleine Göttinger Geschichte einmal erzählen. Etwas sehr schönes habe ich gesehen, ein niedliches Pärchen. Sie umarmten sich auf dem Bürgersteig mitten in der Stadt. Sie freuten sich, daß sie endlich einander gefunden hatten, was sicherlich fast einem Wunder nahe kam und im weiteren zu erläutern wäre. Man sah ihren Gesichtern an, wieviel Elend sie durchgemacht hatten, wieviel Elend sie jetzt zur Zeit noch ertragen. Man sah aber auch ihre Freude in ihren Augen, das alles nun vergessen zu können, zu wollen, zu müssen. An ihrer Kleidung sah man aber auch, daß es nicht geschehen wird. Nicht, daß sie sich bald nicht mehr lieben werden, nein, das will ich nicht sagen. Man könnte denken, da haben sich wirklich zwei gefunden; sie passen ja wirklich perfekt zusammen. Würden sie heiraten, meinen Segen hätten sie. Beide sahen sich sehr ähnlich, hatten beide die gleiche Hautfarbe, ja sogar die gleiche Haut, ziemlich rot, ziemlich vertrocknet. Sarkastisch könnte man quasi sagen, so alt wie sie aussehen, können sie nicht mehr werden. Mag vielleicht sogar so sein. Sie hatten beide die gleiche stumpfe Leerheit in ihren verliebt blickenden Augen. Daß solche zerlebten Augen, noch dieses lebende Feuer von Liebe auszustrahlen vermochten. Das würde ich gerne in all diesen Leuten scheinen sehen. Natürlich wird es das nicht geschehen, jedenfalls nicht in diesem Leben, in dieser Welt. Ja, ja, da läuft einer verdreckt, langhaarig und barfuß in dieser Stadt herum. Sarkasmus nennt ihn Jesus. Dieser läuft sogar teilweise barfuß im Winter, wenn man schon beschuht kalte Füße bekommt. Ja, dieser wird sicher nicht mehr das Licht in seinen Augen zu strahlen bekommen. Obwohl, so manche Frau seines Standes wäre noch zu erwähnen. Eine theoretische Möglichkeit bestünde da noch, die wohl stark zu bezweifeln wäre, aber eine Erwähnung in diesem Zusammenhang wert ist. Das erste Mal, als ich eine dieser Frauen durch die Stadt gehen sah, war ich doch erschrocken, wohl darüber, mit diesem Auftritt nicht gerechnet zu haben, aber auch darüber, aus meinem Leben gerüttelt 12 worden zu sein, eine Waagschale meiner Probleme auf der einen Seite und auf der anderen die ihrigen, vor meinem geistigen Auge, woraus sich mein Weltbild wieder gerade rückte, so wie es des öfteren geschehen muß. Diese Frau kleidete sich durchaus weiblich, so daß es jedenfalls zu erkennen war, was nicht unbedingt in dieser Volksgruppe häufig war. Bei manchen Frauen auch in meiner Volksgruppe muß man doch manches mal genau hinsehen, um das Geschlecht zu erkennen, da es in unseren Konversationen zur besseren und einfacheren Verständigung beiträgt, oder, wo ich über Liebe spreche, gerade auf diesem Sektor zu einigen peinlichen Situationen kommen kann und zu einigem Erschrecken vor sich selbst, sich mit seiner entdeckten Zweigeschlechtlichkeit auseinandersetzen zu müssen, um es am Ende auf einen Informationsfehler zu schieben und sich für wieder ordentlich in Ordnung zu halten, schaut man nicht genau hin. Ea wäre aber auch noch die andere Frau zu erwähnen, die einen Literaturtip für eine kleine Spende verteilen wollte, ein Buchtip für ein belangloses Werk über Körnerfresser. Ich wollte ihr schon mal was gutes zu lesen gebe, aber ich fand sie nicht wieder. Schade. Vielleicht ist sie nun längst versunken in ihrer Welt, dort ertrunken, aber Bücher können schwimmen, eine Zeit lang, dann gehen sie wohl auch unter. Hätte sie nicht diese Hautfarbe und diese Haut, wäre sie sicher eine attraktive Frau. In ihren Kleidern findet man ebenfalls Tücher, die aber bunter sind, als erstgenannt sie trägt. Damit scheint sie etwas Farbe in ihr Leben zu tragen, um ihre Farblosigkeit besser ertragen zu können. Auch wenn die Sonne scheint, erscheint ihr Leben farblos, ihre Welt kalt und schmerzvoll, ihr Leben mit Sehnsucht beschwert, einer Sehnsucht, so einfach und doch so viel komplexer, als die unserer Welt. Und da stand dieses Pärchen auf dem Bürgersteig, küßte sich und brachte es auf den Punkt. Es sind die wahren Göttinger, denn als Obdachlose wohnen und leben sie in der ganzen Stadt, wer weiß wo? (Felsenkeller, 15./16.5.99) 13 Ophelia Ich krieche zurück unter meine Decke, in eine Märchenwelt, und Du gehst in das verlassene Dorf. Ein Weg durch den Wald alter Bäume, mit Erinnerungen in den Ästen. Ich sehe Dich aus dem Wolkenhimmel. Da steht das zerfallene Haus. Ophelia wohnt dort. Sie hat es sich hergerichtet, mit bunten Tüchern ausgekleidet. Ophelia hat flammendes Haar und eingeflochtene Federn, Augen, wie meine, durch die schau ich deine, wie du durch die die Tür eintrittst. Du weißt, sie ist verückt. Sie hat sich dort versteckt. Mit Freude über deinen Besuch, strahlt sie dich an und streichelt deine Seele. Soviele Jahre kennst du sie schon, und immer hat sie dir was geschenkt. Unnütze Dinge scheinbar, wie heute einen Stein. "Sieh doch, ist er nicht schön, er gefällt mir wirklich gut, der ist für Dich." Du freust dich über ihre Freude, dir eine gemacht zu haben. Wie einfach es ist, sie glücklich zu machen. Sie scheint eigendlich immer, glücklich zu sein. Es ist vielleicht der Grund, warum du schon so oft dort warst. Du erinnerst dich, warum du heute kamst: "Ophelia, Du mußt Dich woanders verstecken!" "Warum denn", stahlt sie, "hier habe ich doch alles, was ich brauche." "Ich weiß", sagst du und mußst ein Stück Traurigkeit schlucken, "sie wissen im Dorf, daß Du hier lebst". "Oh, dann kommen sie vielleicht mich besuchen. Ich kann ihnen viele schöne Dinge geben." "Nein, Ophelia, sie sin nicht wie ich." "Das macht doch nichts; ich mag auch Menschen, die anders sind." "Ja, Du schon, aber sie mögen keine Menschen, die anders sind." "Warum wollen sie mich dann besuchen kommen?" "Sie wollen Dich nicht besuchen kommen. Sie sagen, es ist nicht gut, daß Du hier lebst; es ist gegen ihr Gesetzt. Sie sagen, es ist nicht Dein Haus." "Oh, ich kannte die Oma, die hier lebte, und ich hielt ihre Hand, als sie starb. Sie lächelte mich an und ich lächelte zurück, weil ich wußte, ich soll auf ihr Haus aufpassen." "Das wissen die Menschen im Dorf nicht. Sie sagen, Du kannst Dir hier nicht helfen und es ist gegen ihr Gesetzt." "Ich brauche mir nicht helfen, ich bin nicht in Not. Hier habe ich alles. Willst Du auch etwas Brenesseltee?" "Ophelia, sie sind auf dem Weg zu Dir. Lauf lieber weg, sonst werden sie Dich einsperren." "Warum denn? Ich habe niemandem etwas getan." "Ich weiß, Du bist zu 14 jedem nett und gastfreundlich." "Reicht ihnen das nicht?" "Sie haben angst vor Leuten, die anders sind." "Wo wollen sie mich denn hinbringen?" "Ein großes Haus ist es, in der Stadt. Dort sind Ärzte, die Dir helfen sollen." "Aber ich brauche doch keine Hilfe." "Ophelia, Du mußt hier weg, sie sind schon auf dem Weg hierher." "Ach, ich sag es ihnen am besten selbst." "Ich habe schon mit ihnen gesprochen. Sie lassen nicht mehr mit sich reden." "Ich schenke ihnen etwas", strahlt sie, "dann reden sie bestimmt mit mir." "Ophelia, Du hast mir schon so oft geholfen, aber heute muß ich Dir helfen. Du mußt Deine Sachen packen und mitkommen, wir laufen durch den Wald weg." "Ich kann meine Sachen nicht packen, es ist zu viel. Ich kann es nicht alles tragen. Sieh doch." Sie zeigt durch das Zimmer. Überall liegt steht und hängt etwas. Es sind eingendlich alles unnütze Dinge, wie Zapfen, Steine, Holzrinde, getrocknete Pflanzen, alte Puppen, Bilder und so viele Dinge, die andere weggeworfen haben. "Nein, ich möchte hierbleiben." Sie strahlt dich an, als sie ihren Reichtum überschaute. Du weißt, du kannst sie nicht überzeugen. So sitzt ihr auf dem Boden, trinkt euren Tee und schweigt. Du hörst den Krankenwagen vorfahren, die Türen klappen, siehst Ophelia traurig an. Schritte kommen und es klopft. "Oh, Besuch." Sie geht und öffnet, mit einem selbstgemachten Gesteck aus Moos, Tannenzweigen, Holz und einem Stein in der Mitte, in der Hand. Drei Männer und zwei Polizeibeamte stehen vor der Tür. Der Arzt: "Vanessa Kreuzfeldt?" "Oh, ja, so wurde ich früher gerufen. Woher kennen sie mich?" "Ich kenne sie nicht. Sie müssen mit uns mitkommen." "Wenn sie mich nicht kennen, und ich kenne sie auch nicht, dann komme ich nicht mit. Aber kommen sie doch rein. Bitte." Sie macht die Tür mit einer einladenden Bewegung auf. Der Arzt dreht sich zu den beiden Sanitätern und Polizisten: "Lassen sie mich mit ihr alleine reden." Er tritt ein und weißt dich hinaus. Du gehst und siehst Ophelia traurig an. "Du kannst ruhig bleiben", sagt Ophelia, "Du stöhrst mich nicht." "Ich möchte aber gerne mit ihnen alleine sprechen", sagt der Arzt. "Na gut", sagt sie. Ich sehe das Haus von oben, aus meiner Wolkenperspektive, die Autos davor, wie ein sterbender entfernt. Ich schreie hinunter: "Lauf weg, Ophelia!" Aber sie hört mich nicht. Dann sehe ich, wie die Sanitäter und die Polizisten sie rauszerren, sie schreit zu mir hoch. Ich bin zu schwerelos und komme nicht runter. Sie starrt hoch und alles erstarrt. Ich sehe zu ihr runter und sehe ihr Gesicht deutlich vor mir, immer tiefer in ihre traurigen grünen Augen und sie werden meine, durch die ich schau in Deine. 15 (Felsenkeller, 6.12.98) Der Vater Bovenden, 18.2.98 Er lehnte sich zurück auf der Pritsche und starrte vor sich hin. Was war das schön, als ich morgens um halbfünf mit meinen Kollegen durchs Werkstor ging, mich in den Waschkauen umzog und dann am Band meine Arbeit verrichtete, jeden Morgen um viertel vor fünf den letzten Schluck Kaffee zu mir nahm, bevor ich an die Arbeit ging mit meinen Kollegen. Das Wort Kollege hatte bei uns noch Bedeutung. Wenn mal einer Mist gebaut hatte, waren wir anderen immer da. Ja, gut, der Gerhard hatte es wirklich übertrieben. Wir haben ihm das immer wieder gesagt, er solle doch mit dem Alkohol aufpassen und nicht so viel während der Arbeit trinken. Wir wußten wohl, daß er Probleme hatte, aber als er neben das Band gekotzt hatte und nicht mehr alleine stehen konnte, hatte ihn der Betriebssicherheitsbeamte auch schon geschnappt und vom Werkschutz nach Hause fahren lassen. Und da er schon wegen so etwas ähnlichem eine Abmahnung hatte, mußte Gerhard Zuhause bleiben. Doch da war niemand. Und ich dachte noch, armer Kerl; jetzt geht er stempeln. Wenn er nüchtern war, konnte man gut mit ihm; er war ein herzensguter Mensch. Jetzt wird er wohl noch tiefer sinken. Seine Frau war ihm ja auch schon mit den Kindern weggelaufen. Ich glaube, deshalb fing er mit dem Trinken an. Aber das soll keine Entschuldigung sein; man muß doch wissen, wo seine Grenzen sind. Daß wir ihn nicht ewig so mit durchziehen konnten war wohl klar. Wir haben es ihm ja auch oft genug gesagt. Na und da kam dann dieser Tag, als mich das Schicksal traf. Ich dachte immer, mir könnte das nicht passieren. Da rief mich der Chef in sein Büro und erklärte mir, daß sie in der Produktion nun umsteigen auf rationellere Arbeitsverfahren mit computergesteuerten Präzisionsmaschinen und daß der Absatz im letzten Jahr weniger Gewinn gebracht hatte und die Zeiten schlecht aussehen und so rationalisiert werden mußte und genug um den heißen Brei geredet, nach 13 Jahren guter Arbeit sagte er "Tschüß, das war's dann wohl". Und da gab es keine Diskussion. 16 Ich dachte immer, mein Job wäre sicher, und so lange habe ich hier gearbeitet. Aber unserem Betrieb ging es eben schlechter - weniger Gewinn. Na, dachte ich, besser, als Verlust zu machen. Dann mußte ich an diesem schweren Tag zum Arbeitsamt. Ich dachte mir, das sollte man sofort erledigen. Aber mit sofort kommt man beim Arbeitsamt nicht voran. Den ganzen Vormittag, bis in den Nachmittag saß ich da, und ich war früh da. Zuerst mußte ich eine Nummer ziehen und da dachte ich schon, jetzt bist de bloß 'ne Nummer. Und in dem Augenblick fiel etwas von mir. Ich weiß nicht, was es war. Plötzlich war ich ganz leer; ich glaube, meine Würde war es, die von mir fiel. In diesem Augenblick fühlte ich mich unendlich elend, besser kann ich es nicht beschreiben. Als ich Zuhause war, gegen Feierabend, konnte ich es meiner Frau und den Kindern nicht sagen. Darauf waren wir doch nicht eingerichtet. Wie sollten wir das Haus abbezahlen; den Zweitwagen konnten wir uns auch nicht mehr leisten. Dann kam noch die Zahnarztrechnung, meine Frau bekam eine neue Brücke und bei unserem Sohn wurde eine schwerere orthopädische Zahnbehandlung nötig. Ich fragte mich, wieso ich eigentlich in die Krankenkasse eingezahlt hatte und nun 7 000 DM bezahlen solle. An dem Tag war das Leben zu ende. Ich wußte, ich konnte meiner Frau nichts vormachen, aber ich sagte, ich wollte mich noch mit zwei Kollegen zum Skat treffen und anschließend das Fußballspiel sehen. Es war ja auch Freitag und ich wäre ja auch das ganze Wochenende zu Hause. Ich hatte schlecht gelogen und bin schnell gegangen. Claudia wußte sofort, daß was nicht in Ordnung war. Aber wir sind im Leben schon durch manche Schwierigkeiten zusammen gegangen. Nur dachte ich, wir hätten es so langsam geschafft. Es blieb zwar nie viel zum Leben, aber es hatte gereicht. Im Sommer sind wir auch schon mal in den Schwarzwald gefahren, um dort zwei Wochen Urlaub zu machen. Den Abend wußte ich nichts besseres, als in die Kneipe in den Nachbarort zu fahren. Dort traf ich auch noch Gerhard, der wie immer betrunken war und zu dem noch schlecht aussah. Er wäre jetzt auf Sozialhilfe und lachte, daß ich das dann ja auch bestimmt bald sei, früher oder später. Ich fand es nicht zu lachen, mir war in dem Augenblick zum heulen. 17 Ich machte mir noch Hoffnung, woanders unterzukommen, aber als Bandarbeiter war ich zu spezialisiert. 13 Jahre immer das selbe getan. Das erfuhr ich in den folgenden Tagen der Arbeitsuche. Die dachten wohl, am Band, da verblödet man total. Ich habe doch meinen Beruf gelernt. Und in der Einarbeitungszeit kann man doch wieder reinkommen. Aber es gibt ja auch genug junge Arbeitslose. Dann kam der Tag, als ich nicht mehr drum herum kam und Claudia die Wahrheit sagen mußte. Sie sagte, sie habe es geahnt und schloß sich im Schlafzimmer ein. Was sollte ich tun, Zuhause habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich bin eine Zeit mit dem Auto herumgefahren, mußte tanken und dachte, das kannst du dir bald auch nicht mehr leisten. Da bin ich im Nachbardorf angehalten, wo ich Gerhard traf. Meine Kollegen waren im Werk, auf Schicht. Die Bank meldete sich dann auch ziemlich früh. Die sind ja doch vorsichtig, wenn sie merken, da kommt nichts mehr rein und das sie keine gute Chance auf das Miese ausgleichen haben. Na jedenfalls schrumpfte der Dispo bald und die Überzugszinsen wuchsen mit dem Minus. Die Zinsen waren im Monat bald schwer zu tilgen. Wir haben den Zweitwagen dann verkauft. Es reichte nicht, da das Haus noch abzuzahlen war. Claudia fand kurzzeitig Arbeit bei einer Gebäudereinigungsfirma als Putzfrau, aber auch nur für ein Jahr. Dann muten wir das Haus verkaufen und davon die Bank bezahlen; es blieb uns nicht viel übrig. Diesen Abend traf ich dann wieder Gerhard in der Kneipe. Er sah nicht gut aus und hatte Ärger mit dem Wirt, da er einiges anschreiben ließ. Ich dachte nur, daß der Wirt wohl genug an seiner Sucht verdient haben wird, wenn ich mir den Einkaufspreis und den Verkaufspreis überlegte. Aber das zählt nicht mehr. Gerhard brachte kein Geld mehr rein, war nicht mehr geschäftsfähig und wurde den Abend rausgeworfen. Ich ging dann auch nach Hause. Das Jahr Weihnachten war das schlimmste Weihnachten für meine Frau und mich. Wir mußten in eine kleine Wohnung in einen Plattenbau ziehen, wo unsere beiden Kinder in einem Zimmer wohnen mußten. Wir hatten ein Schlafzimmer, das Wohnzimmer und Küche und Bad. Was sollten wir machen. Ich mochte noch nie diese anonymen Hochbauten. Unsere Kinder verliefen sich die erste Zeit auf dem Weg von der Schule nach Hause, da diese Hochhäuser in der Siedlung alle gleich aussahen. Der Architekt muß ein Sadist gewesen sein. 18 Zu Weihnachten konnten wir dann unseren Kindern auch nicht mehr so viel schenken, wie sonst, da das zusätzliche Weihnachtsgeld fehlte. Es waren dann auch nur billige Sachen. Die Klamotten sind dann auch nicht gut angekommen. Die Kinder müssen ja nur Markenwaren in der Schule tragen. Unser Ältester hatte dann auch öfters Schlägereien. Er sagte, das seien nur so ein paar arrogante Säcke gewesen. Ich wußte aber, was los war und konnte es nicht ändern. Immer wenn im Fernsehen in der Werbung diese ganzen Markenwaren kamen, habe ich umgeschaltet oder den Ton abgestellt. Aber es war nur ein Augen schließen vor der Realität. Die Kinder werden doch jeden Tag in der Schule mit der Realität konfrontiert. Da dachte ich das erste Mal positiv über die Schuluniformen in England. Als mein Ältester mal mit einem blauen Auge nach Hause kam, fragte ich erst gar nicht, was passiert war; ich wußte es. Den Abend traf ich Gerhard und er sah krank aus Seine Zähne waren gelb und seine Augen waren glasig rot. Und er war sehr ernst, nicht so locker, wie sonst. Wir haben uns diesen Abend ernsthaft unterhalten. Über die alten Zeiten, als wir uns noch darüber geärgert hatten, wie wenig vom Bruttolohn übrigblieb und was für die anderen Steuern noch alles draufging, wie Mehrwert-, Mineralöl-, Alkohol- oder Tabaksteuer. Als wir uns noch Gedanken machten, was wir mit dem Geld anfangen könnten, wenn wir den Bruttolohn ausbezahlt bekämen. Wir hätten ausgesorgt. Aber dann kam die Wende, der Solidaritätszuschlag, die Politiker finanzierten alles aus der Rentenkasse und wir dachten das erste Mal, unsere Zukunft wird wohl doch nicht so sicher sein. Dann kam das Gerede von der Einheitsrente und wir schlossen Privatversicherungen ab. Die mußte ich außerdem als Arbeitsloser ohne Geld weiter bezahlen. Meine Kinder habe ich energisch davor gewarnt, im Leben jemals eine Versicherung abzuschließen. Die wollen nur an unser sauer verdientes Geld; und wenn wir mal ihre Leistung in Anspruch nehmen wollen, dann wird das ganz schwierig. Das sind alles Verbrecher, diese Versicherungsvertreter. 19 Aber meine Kinder haben mich zu dem Zeitpunkt nicht mehr für richtig voll genommen. In ihren Augen war ich wohl nichts mehr Wert, ein Nichtsnutz, der den ganzen Tag Zuhause war. Sie sind dann auch äußerst respektlos zu mir gewesen. Leider bin ich dann auch mal ein wenig ausgerastet, habe dem Großen eine gelangt. Na, eben mal den Hintern versohlt, oder so. Ich glaube, ich bin da ein wenig ausgerastet. Das hatte Claudia jedenfalls so gemeint. Die Kinder reden mit der Mutter eh ganz anders und schildern alles ganz anders. Wir hatten einen riesen Krach deswegen und sie hat dann wohl ihrer Seele so richtig Luft machen müssen und wohl auch mal so Sachen gesagt, die sie auch nicht so gemeint hatte. Das hab ich den Abend nun aber auch in den falschen Hals gekriegt und bin abgehauen. Den Abend habe ich mich doch ziemlich besoffen. Da habe ich auch noch Ärger in der Kneipe gehabt. Es muß wohl einiges zu Bruch gegangen sein. Die Nacht habe ich dann in der Ausnüchterungszelle bei der Polizei verbracht. Hätte ich auch nie gedacht, daß mir das passieren könnte. Leider mußte ich wegen der Untersuchungshaft etwas länger bleiben, da ich wohl den Wirt auch noch verhauen hätte. Na, da hing aber der Haussegen schief. Ich versprach Claudia, daß ich nicht mehr trinken würde. Wir vertrugen uns eine Zeit ganz gut, der Wirt hatte meine Entschuldigung auch angenommen. Er wäre ja kein Unmensch und ich könnte ruhig wiederkommen, die Sache wäre gegessen, das könnte mal passieren und war ja nur ein Mißverständnis und ich war ja immer ein guter Kunde. Dort traf ich dann auch noch zufällig Gerhard wieder und er fragte mich, ob ich ihn nicht einladen könnte auf ein Bier und einen Kurzen. Ich war sowieso in reumütiger Stimmung und wollte mal mit einem ehemaligen Arbeitskollegen reden. Den Abend bekam der Wirt auch noch ein Trinkgeld und unsere alte "Freundschaft" war wieder hergestellt. Ich machte mir nun langsam Sorgen, des Alkohols wegen und daß ich nicht abhängig werden wollte. Gerhard sagte nur, ich spräche ja schon davon, als wäre ich heroinsüchtig, oder so. Und das wäre 'ne Abhängigkeit, 'ne Sucht. Wenn man mal abends bei 'nem Bier und Schnaps zusammensitzt, wäre das wohl nicht so schlimm. 20 Ich hatte aber trotzdem ein schlechtes Gewissen, besonders, da ich den Abend wieder betrunken nach Hause kam. Claudia hatte da verständlicherweise gar nichts für übrig. Aber ich konnte dem Wirt ja auch nicht alles abschlagen, wenn er fragte, noch zwei Neue und zwei Kurze. Leider verstand das Claudia überhaupt nicht und ich hatte keine Lust mich weiter zu rechtfertigen. Aber sie hörte auch nicht auf, mir Vorwürfe zu machen. Ich konnte doch auch nichts dafür, meinen Job zu verlieren. Aber sie meinte, darum ginge es doch gar nicht. Ich würde nur meine Probleme sehen, aber daß es unseren Kindern nicht gut gehe sehe ich wohl nicht. Sie hätten in der Schulleistung nachgelassen. Ich hatte mich schon gewundert, warum die Zeugnisse so spät dieses Jahr kämen. Da sagte sie, die Kinder trauten sich nicht sie mir zu zeigen. Ich sagte nur, das komme wohl von ihrer Erziehung und sie glaubte wohl, wenn sie als Putze arbeite, etwas besseres zu sein. Da sagte sie, ich solle nicht so abfällig darüber reden, das sei wenigstens Arbeit und irgendwas hätte ich wohl gekriegt, wenn ich gewollt hätte. Als wenn ich nicht Arbeiten wollte. Als Frau scheint man wohl einfacher Arbeit zu kriegen. Sie meinte, daß Männer sich wohl zu schade dafür seien. Dann wurde unser Streit wohl ziemlich unsachlich und persönlich, zum Teil auch intim. Am Ende habe ich ihr gesagt, sie solle mich endlich in Ruhe lassen. Aber sie hackte immer weiter auf mich ein. Ich sagte, ich kann nicht mehr, ich habe das alles doch auch nicht gewollt. Dann hätte ich wohl nicht die Nacht bei der Polizei verbracht und die Leute hätten nichts zu reden. Und dann hielt sie mir noch all die anderen Dinge vor, wozu sie in all den Jahren nichts gesagt habe. Und ich sagte ihr energisch, sie solle mich jetzt verdammt noch mal in Ruhe lassen, da könnten wir morgen drüber reden, wenn ich wieder nüchtern wäre. Und da hatte ich was gesagt, da ging es erst richtig wieder los und ich wäre ein Säufer und Alkoholiker und so. Und ich sagte ihr, sie solle aufhören. Als sich das dann noch 'ne halbe Stunde hochschaukelte, da ohrfeigte sie mich, weil ich wohl ausfallend wurde. Und ich warnte sie, daß wenn sie jetzt nicht aufhörte, etwas passieren würde. Jedenfalls haben wir uns den Abend ordentlich gehauen. Ich habe sie zuerst verhauen und sie mich anschließend, als ich stinkbesoffen von Gerhard wiederkam und im Hausflur zum Erliegen kam. Da muß sich Claudia wohl ordentlich revanchiert haben. Jedenfalls hatte ich am nächsten Morgen einige blaue Flecke und ein Veilchen. Gerhard hatte mir jedenfalls beteuert, daß wir uns im Guten getrennt hätten. Der 21 Morgen war jedenfalls bitter. Claudia und die Kinder waren bei ihrer Mutter. Claudia reichte zwei Wochen später die Scheidung ein. Den Abend konnte ich nicht allein in dem leeren Haus bleiben und wußte nicht, zu wem ich sonst hätte gehen können. Leider traf ich dann wieder Gerhard, der verwahrlost aussah. Er war unrasiert, ungepflegt, hatte einen strengen Geruch an sich und sah zerlumpt aus, als hätte er die letzte Nacht unter einer Brücke zugebracht. Und so ähnlich ist es auch gewesen. Den Abend haben wir aber noch zwei andere ehemalige Arbeitskollegen getroffen, die dasselbe Los zogen, wie wir. Wir diskutierten über Politik, wie die da oben unser Land so runterwirtschaften konnten und sich dann auch noch die Diäten erhöhen können, da läuft es wie im Selbstbedienungsladen. Dann holen sie immer mehr Ausländer rein und für uns, die eigenen Leute, gibt es dann keine Arbeit mehr. Aber irgendwann gibt es den großen Knall. Da muß dann erst mal ein kleiner Adolf her. Da gab es keine Arbeitslosigkeit und die Frauen konnten sich auch noch allein im Dunkeln raustrauen. Ja, da waren wir uns einig. Als ich dann beim Scheidungsanwalt meine Frau wiedertraf, sagte sie mir, daß ich krank aussähe, so ungepflegt und gelb um die Augen sei. Ich solle doch mal zum Arzt gehen. Aber was kümmere sie sich um mich, sagte ich ihr, wo sie sich doch scheiden lassen will. Das ist heute ja wohl so Mode. Gibt es ein klein wenig Ärger und Probleme und kein Geld mehr, kann man sich ja schnell scheiden lassen, der dumme Mann bezahlt ja alles in unserer emanzipierten Welt. Da wollen die Frauen plötzlich nichts mehr von Emanzipation wissen. Das es beim Anwalt wieder zum Streit kam, brauche ich nicht zu sagen. Ich mußte dann zu Gerhards Beerdigung. Er hatte einen Schlaganfall und starb drei Tage später. Da hat ihn der Alkohol auch nicht früher getötet, der machte ja das Blut flüssiger, normalerweise. Da starb er einfach mit 51 an einem Schlaganfall. Wir trafen uns zum Stammtisch, da wir immer mehr wurden, die Entlassenen unserer Firma. Und dann saßen da mal den Abend ein paar Deutschrussen und lachten ganz unverhohlen. Und Sigi erzählte, daß die mit ihrer ganzen Sippe hierhergekommen waren. Die bringen Oma und Opa extra mit, weil sie dann die Rente rückwirkend ausbezahlt kriegten, die hätten schon gut zu lachen. Das wollten wir erst gar nicht 22 glauben, bis dann Hartmut, der Bankangestellte sagte, daß das wahr sei und daß die sich so hier gleich ein neues Haus bauen könnten. Alles von unseren Geldern, als wir noch welches verdienten. Den Abend haben wir denen aber gezeigt, daß die nichts in unserer Kneipe zu suchen hatten. Es war wieder eine Nacht in der Ausnüchterungszelle. Eine Zeit später kam einer von den Republikanern und der erzählte uns am Stammtisch mal die Wahrheit, was der Staat mit unserem Geld alles macht, als wir noch Steuern zahlten. Die würden wir doch immer noch auf alles mögliche bezahlen, sogar jetzt in der Kneipe für jedes Bier und jede Zigarette. Wo der Mann recht hatte, hatte er recht. Und was die Asylanten alles in den Hintern geblasen kriegen, fahren dicke Autos, haben 'ne neue Anlage, 'nen neuen Fernseher, bekommen 'ne Schüssel, tragen immer die neusten Markenklamotten und verkaufen unseren Kindern noch Drogen. Die bekämen eben den Hals nicht voll, und er erzählte noch ganz andere Geschichten. Wir sollten ihn mal in Rostock besuchen kommen, da wäre sein Parteichef, der richtig Ahnung habe und uns alles besser erzählen könnte. Wir könnten in einer Datscha unterkommen. Drei Monate später war es dann soweit. Wir hatten ja eh nichts besseres vor und so mieteten wir für das Wochenende einen Kleinbus und fuhren nach Rostock. Dort trafen wir uns in einer Kneipe und gingen später in einen Saal. Da waren über 700 Leute , die meisten waren arbeitslos, wie wir. Und der Redner traf den Nagel auf den Kopf. Wir ließen uns vom Staat ausbeuten und der schiebt es den Asylanten in den Hintern. Er gebrauchte hier ein anderes Wort dafür. Aber wo er recht hatte, hatte er Recht! Den Abend schaukelte sich die Stimmung jedenfalls ziemlich hoch und auf den Straßen saßen viele Jugendliche rum und betranken sich, hörten aus tiefergelegten Autos laute Musik. Und da rief irgend jemand "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus". Und dann riefen es immer mehr und dann riefen wir auch mit. Wir müssen uns ja erstmal um unsere eigenen Leute kümmern. Die sollen sich doch in ihrem eigenen Land um sich selbst kümmern. Und dann gingen wir die Straße runter und es wurden immer mehr. Viele Leute saßen in den kleinen Schrebergärten und grillten oder saßen bei einem Bier zusammen, da es schön mild war. Und viele waren Arbeitslose und machten ihrer Wut mal Raum. 23 Dann standen wir vor diesen Asylantensilos und riefen "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus". Und aus den Häusern applaudierten sie und es flogen Molotowcocktails und aus den Häusern applaudierten sie. Und ich wachte in der Ausnüchterungszelle bei der Polizei auf und war in U-Haft. Ich sollte einen Afrikaner erschlagen haben. Das kann nicht sein, ich kann mich nicht erinnern, ich war doch betrunken. 24 Würden Menschen schauen Der Mensch endgöttlichte sich in Eden, als er sich göttlichen wollte, worauf er dunkelte und verklang, ganz dumpf, unwetterwolkenhaft. Er löste sich vom Baum des Lebens, schnitt die Nabelliane ab, begann zu vergreisen, zu Baumnahrung kompostiertes Herz, zu zerfallen. Jedes Jahr sät er auf sein sterbegedüngtes Land, der Auferstehung des Lebens harrend, den Samen der Hoffnung auf Rückkehr des Lebens, aus. Lichtlächeln des Vaters läßt es aufsprießen, die Köpfchen ihm zugewandt lächeln die Blumenwiesen zurück und der Mensch, bekommt er eine geschenkt, pflanzt das Lächeln fort, einem Schmetterling gleich, nach Eden hinübergleitend, fröhlich, den Edenfarben gleich, immer lächelnd und beschwingt, lufthüpfend, mit den Flügeln die göttliche Schrift „Halleluja“ schreibend, könnten sie schreiben. Auch Bäume, stehen sie frei, entfalten ihre grünen, gekrönten Seelen Gottvater Lächeln, einladend entgegen. Darin jubeln dann die gefiederten Phönixe Lichtlachlieder; nur der Dompfaff ist manisch depressiv; ob er zu lange im Schatten seiner Namensverwandtschaft brütete und zu viele nichtlächelnde ungefiederte, gottsuchende, niefindende in ihren sonntäglichen Trauermarsch dahinströmen sah? Und ist die Zeit des Abschieds gekommen, entblüten sich die Blumengeschwister, multiplizieren sich im Sterben samenhaft und wissen, wohin sie gehen, wo sie im Frühjahr wieder Lichtvater geschwängert zurückstrahlen werden. Ihr Sterben ist Wiedergeburt, so wie der Wiedergeburt der Tod vorangehen muß; so liegt das göttliche Gesetz schon in den Blumenwiesen, so trägt es der Schmetterling adonaiwiederlächelnd von Blüte zu Blüte und erzählt die Gute Botschaft jedem Kelch, aus dem er trinkt, dankbar weiter. Die Tauben klatschen dazu in die Fittiche und die Drosseln singen, ihr unscheinbares Gewand ablegend, ihr schönstes Lied vom Thron eines Baumes aus, und die Lerchen steigen himmelwärts Gottvater ihr Liebeslied zu bringen. Die Goldammern sind jedoch so nett, uns den Gesang zu verdolmetschen, wenn sie ihr „wie, wie, wie, hab ich dich lieb“ rufen. Nur hört der Mensch dieser Welt so schlecht, wie Gottgehorsam schon immer sein Problem gewesen ist. Ich laß die dummen Menschen durch die Natur walken, mountainbiken und laut palavernd daherschreiten, taub und blind, wie ein steinverherztes Kind 25 und freue mich an der Wirklichkeit meines lächelnden, leuchtenden, duftenden, ewig Seienden, an dem Gesang und der Freude der erkennbaren, schaubaren Natur. Im Vorbeischweben grüße ich die Arbeiter der Ameisenpyramiden, die ihre Bauten zur Sonne hin ausrichten und freue mich über ihren Eifer. Der Grünspecht lacht über mich und meine Naturbetrachtungen; denn er weiß sehr wohl den Fleiß der Ameisen zu wertschätzen, jedoch noch mehr ihren Nährwert. Ja, ja, denke ich, fressen und gefressen werden; alle wollen leben, alle sehnen sich nach Eden zurück; dann wird der Löwe Gras fressen und der Wolf wird der Sonne seine Arien singen, vom Kind unschuldig gestreichelt und geherzt. Oh, wenn wir nur wieder in Eden wären, wenn wir eines Tages in der neuen Welt leben werden, wir alle mit entzündeten, leuchtenden Seelen, die Herzen voll der Gottesliebe, auf dem Schoße Adonais uns in seinem Lächeln einwühlen, ob schwarz, ob weiß, ob gelb oder rot, wir spielen miteinander ohne Haß oder Tod. Tief verpflanzt ist seine Liebe in unseren Herzensgrund, wovon uns die Natur schon jetzt freudig Kunde gibt. Wenn doch nur die Menschen die Tore ihrer Seelen weit öffnen würden, sie würden geadelt mit des Höchsten Engelsflügeln und flögen schon lebend in das Himmelsland, oh, wenn sie doch nur würden, würde das Würde eine Möglichkeitsform werden und sich realisieren. Ich komme erst gerade wieder zurück vom letzten Flug, lieber Leser (= Neutrum!), vom großen Himmlischenfest, wo mir mein geliebter Prinz begegnete, in den vielen Wolkenpalästen, mich in den Arm nahm und mit dem Kuß der Urchristenliebe begrüßte. Wir verbrachten einige wunderbare Tage, spielten David und Jonathan miteinander, bräunten uns orientalisch braun unter Gottes ewigen Sonnenvaterlächeln, sprangen ihm auf den Schoß und kitzelten ihm im weißen Rauschebart, bis er donnernd loslachte, daß ihm die Tränen kamen. Eine spülte mich hinfort, zurück an meinen seelenkunterbunten Ort, hierher, irgendwo nach Nirgendwo, in meine ewige Wanderschaft, heimatlos? Nein, meine Heimat ist in den Himmeln! Oh, jetzt habe ich wieder viel zu viel verraten, ich muß fort! 26