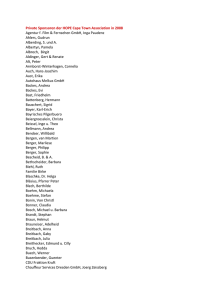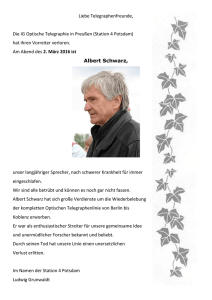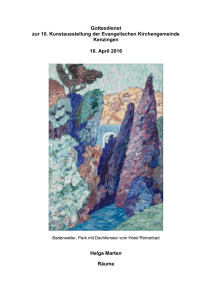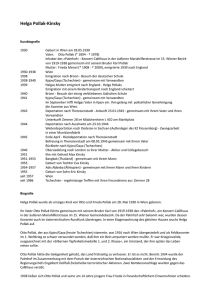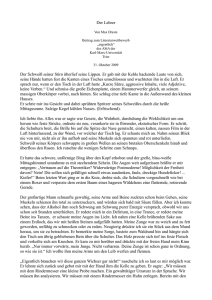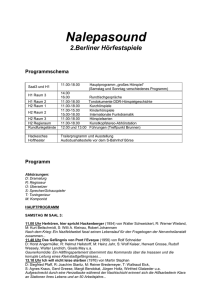Einer flog über das Spatzennest
Werbung
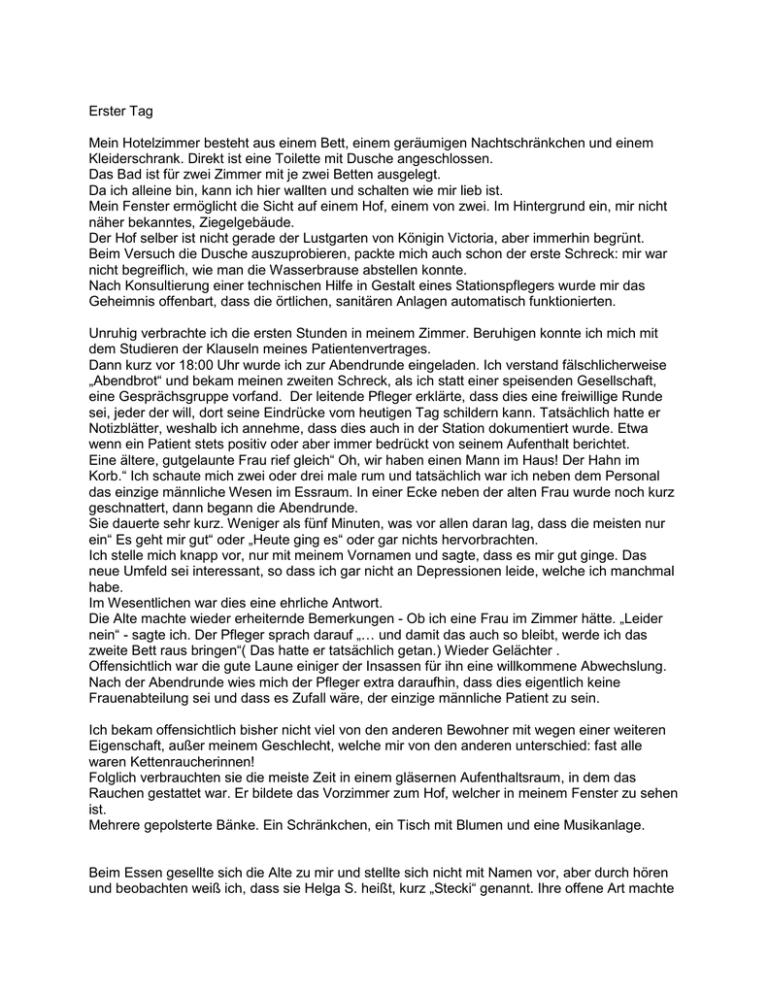
Erster Tag Mein Hotelzimmer besteht aus einem Bett, einem geräumigen Nachtschränkchen und einem Kleiderschrank. Direkt ist eine Toilette mit Dusche angeschlossen. Das Bad ist für zwei Zimmer mit je zwei Betten ausgelegt. Da ich alleine bin, kann ich hier wallten und schalten wie mir lieb ist. Mein Fenster ermöglicht die Sicht auf einem Hof, einem von zwei. Im Hintergrund ein, mir nicht näher bekanntes, Ziegelgebäude. Der Hof selber ist nicht gerade der Lustgarten von Königin Victoria, aber immerhin begrünt. Beim Versuch die Dusche auszuprobieren, packte mich auch schon der erste Schreck: mir war nicht begreiflich, wie man die Wasserbrause abstellen konnte. Nach Konsultierung einer technischen Hilfe in Gestalt eines Stationspflegers wurde mir das Geheimnis offenbart, dass die örtlichen, sanitären Anlagen automatisch funktionierten. Unruhig verbrachte ich die ersten Stunden in meinem Zimmer. Beruhigen konnte ich mich mit dem Studieren der Klauseln meines Patientenvertrages. Dann kurz vor 18:00 Uhr wurde ich zur Abendrunde eingeladen. Ich verstand fälschlicherweise „Abendbrot“ und bekam meinen zweiten Schreck, als ich statt einer speisenden Gesellschaft, eine Gesprächsgruppe vorfand. Der leitende Pfleger erklärte, dass dies eine freiwillige Runde sei, jeder der will, dort seine Eindrücke vom heutigen Tag schildern kann. Tatsächlich hatte er Notizblätter, weshalb ich annehme, dass dies auch in der Station dokumentiert wurde. Etwa wenn ein Patient stets positiv oder aber immer bedrückt von seinem Aufenthalt berichtet. Eine ältere, gutgelaunte Frau rief gleich“ Oh, wir haben einen Mann im Haus! Der Hahn im Korb.“ Ich schaute mich zwei oder drei male rum und tatsächlich war ich neben dem Personal das einzige männliche Wesen im Essraum. In einer Ecke neben der alten Frau wurde noch kurz geschnattert, dann begann die Abendrunde. Sie dauerte sehr kurz. Weniger als fünf Minuten, was vor allen daran lag, dass die meisten nur ein“ Es geht mir gut“ oder „Heute ging es“ oder gar nichts hervorbrachten. Ich stelle mich knapp vor, nur mit meinem Vornamen und sagte, dass es mir gut ginge. Das neue Umfeld sei interessant, so dass ich gar nicht an Depressionen leide, welche ich manchmal habe. Im Wesentlichen war dies eine ehrliche Antwort. Die Alte machte wieder erheiternde Bemerkungen - Ob ich eine Frau im Zimmer hätte. „Leider nein“ - sagte ich. Der Pfleger sprach darauf „… und damit das auch so bleibt, werde ich das zweite Bett raus bringen“( Das hatte er tatsächlich getan.) Wieder Gelächter . Offensichtlich war die gute Laune einiger der Insassen für ihn eine willkommene Abwechslung. Nach der Abendrunde wies mich der Pfleger extra daraufhin, dass dies eigentlich keine Frauenabteilung sei und dass es Zufall wäre, der einzige männliche Patient zu sein. Ich bekam offensichtlich bisher nicht viel von den anderen Bewohner mit wegen einer weiteren Eigenschaft, außer meinem Geschlecht, welche mir von den anderen unterschied: fast alle waren Kettenraucherinnen! Folglich verbrauchten sie die meiste Zeit in einem gläsernen Aufenthaltsraum, in dem das Rauchen gestattet war. Er bildete das Vorzimmer zum Hof, welcher in meinem Fenster zu sehen ist. Mehrere gepolsterte Bänke. Ein Schränkchen, ein Tisch mit Blumen und eine Musikanlage. Beim Essen gesellte sich die Alte zu mir und stellte sich nicht mit Namen vor, aber durch hören und beobachten weiß ich, dass sie Helga S. heißt, kurz „Stecki“ genannt. Ihre offene Art machte mir Mut und nahm mir die Unsicherheit, die allerdings, wie ich verwundert feststellte, nicht sehr groß war. Ich vertraute ihr sogar meine Geschichte an. Sie wiederum erzählte mir, dass sie eigentlich manisch-depressiv ist. In ihrer manischen Phase verschleuderte sie ihr Geld. Ob sie dann gerne nach Las Vegas verreise? - fragte ich. Sie lachte. „Ach, soviel Rente kriege ich auch nicht“. Sie nahm ein Medikament, welches zeitweise verboten war. Ich fragte nicht nach Details, aber so wie ich das verstand, führte es bei ihr zu einer Art Kollaps, am Tag des verlorenen Halbfinales, welcher sehr heiß war. Ihr Pfleger konnte sie rechtzeitig zur Notaufnahme bringen, wo sie sechs ganze Tage verbrachte. Da sie nicht ansprechbar war, wurde sie per Entschluss für zwei Monate hierher verlegt. Eine andere, weinerliche, ältere Patientin hatte wohl mitgehört; sie kam schüchtern zum Tisch. „Entschuldigen Sie bitte, ich soll diese Mittel auch bekommen...“ Stecki wurde auf einmal nervös und ihre Stimmer verbitterten sich. „Nein, ich habe es hinter mir. Ich sage nichts dazu..., dass darf ich auch nicht.“ Die traurige Frau war den Tränen nähe, langsam trottelte sie daran. „Na gut... Entschuldigung“ - schlutzte sie. Es begann eine Lästerrunde über Medikamente „ Von den Zeug werde ich fett, toller Schuh“. Wie sich herausstellte hatte ich in dieser Gemeinschaft noch eine dritte Besonderheit an mir. „ ICH WAR ALS EINZIGER CLEAN“, nahm keine Medikamente. Man hielt mir zwar Tavor und ein Schlafmittel bereit, aber ich nahm es nicht. Zu etwas zwingen, wollten mich die Ärzte noch nicht, zum Glück. Die Medikamente sind wohl auch Ursachen für manche merkwürdige Eigenschaften der einigen Patienten. Bei anderen wiederum lässt sich dank ihnen nicht sagen, an was der betroffene überhaupt leidet. Eine Mutter, traurig oder depressiv, gibt hier einen netten Gesprächspartner ab. Am selben Abend setzte sie sich im Hof zu uns. Sie leidet an das, was man unter Multiple Persönlichkeitsstörung verstand. Stecki hat an diesem Wochenende ihre Zeit abgesessen. Immer wieder betont sie „wie sie ihren Paragraphen abgesessen hat“ und „in die goldene Freiheit mit ihrem Taxi fährt“. Auch wenn sie grinsend erzählt, dass sie die gute Unterhaltung hier vermissen würde. Jeden Tag passierte hier etwas Neues. Ich fragte, ob hier öfters neue Patienten kommen. „Ja, aber die meistens waren schon hier. Verdammter Drehtüreneffekt!.“ Ich war nicht die einzige Neuerscheinung an diesem Tag. Eine Patientin, die ebenfalls Helga hieß und der Mundart noch irgendwo aus dem südlichen Rheinland kam, hatte eine bipolare Störung samt Psychose. Während sie nachmittags, den Kopf zum Himmel gestreckt, die Augen verschlossen, draußen im Hof die Zeit verbrachte. Mal vollführte sie Drehungen, dann wieder machte sie seitwärts Schritte. Nachdem sie wohl abends gegessen hatte, stolzierte sie den Flur entlang. Abermals die Augen verschlossen; die Hände an den Schläfen gekrallt. Erst verfiel sie wieder in einen englischsprachigen Singsang, - wie zuvor schon im Hof, dann stöhnte sie, so dass ich besorgt von meinem Zimmer aus meinen Kopf in den Flur hineinlugte. Als ich den Eindruck bekam, sie würde sich doch nicht wie eine Furie schreiend gegen die verschlossene Eingangstür zum Treppenhaus stürmen, beschloss ich, in den Aufenthaltsraum zu gehen. Obwohl die Tür zu war, stank es bereits aus 2 m Entfernung nach würzigem, beißendem Tabakgeruch. Drinnen saß Stecki, welche sich einen Apfel klein schnitt. Neben ihr die gramgebeugte Mutter. Ich setzte mich gegenüber am Tisch. Am Kopfende des Tisches thronte auf einem Holzstuhl eine dicke Frau. Ihre Augen von einer Sonnenbrille verdeckt und die Mundwinkel zu einer bitter-skeptischen Miene verzogen. Sie hat mich zuvor im Hof angesprochen, als ich mit Stecki und der Mutter eine Konversation geführt hatte. Sie sprach mich mit Jesus an! Fragte mich, wo denn die Maria Magdalena sei. Selbst an diesem Ort war ich von Jesus-Sprüchen nicht gefeilt. Auch jetzt sprach sie mich mit den Namen des Gottessohnes an; wo sei denn die Maria Magdalena jetzt, fragte sie im selben sarkastischen Tonfall. Weiter fragte sie mich nach der Farbe meiner Unterwäsche. Sie sei schon auf Weiß umgestiegen; weiß wie die Unschuld. Sie sei nämlich Jungfrau. Männer würden keine Unschuld mögen, aber die Frauen. Die Mutter sagte, ich solle mir daraus nichts machen, immer wäre sie so. „ Ich muss Angst haben, dass ich HIV habe, soviel wie ich mit Schwarzen arbeiten musste. Ich muss noch die Negerbabys abtreiben lassen“. Solche Sprüche waren, wie sich herausstellte, heute das Abendprogramm bei ihr. Sie hatte wohl beschlossen, abwechselnd bissige oder sinnlose Kommentare abzugeben. Wie ich zwei Tage später hörte, hieß die Frau mit der Sonnenbrille Margrit. Helga näherte sich in ihren beige-rosa Anzug, von ihren besinnlichen Rundgang im Flur sichtlich erheitert. In der Hand hatte sie ausgedruckte Blätter. „Die kommt in die Gummizelle“ räumte Stecki. Tatsächlich sah ihr Zustand schlimmer, als den der anderen Patienten aus, was nicht zuletzt an ihrem Anzug lag, denn sie als einzige Patientin auf der Station trug. Auf ihn darauf waren ein Wappen der UKE und eine römische 3. Sie öffnete die gläserne Eingangstür. Die ausgedruckten Zettel waren ein Kino- oder Kulturprogramm, das sie laut vorlas. Zeitgleich kommentierte sie jeden Programmpunkt. So viel Übung wie sie dabei zu haben scheint, machte sie wohl so was öfters. Als sie damit geendet hatte, fing sie an, wirkürlich Anekdoten zu erzählen. Die tat sie mit etwas, das man schon Euphorie nennen könnte. Nicht nur einmal verfiel sie dabei in ihren Singsang. Mit fast religiöser Insbrust sprach sie schließlich immer wieder das Wort „Freedom“. „Ja, darauf freue ich mich. Ich habe meinen Paragraphen abgesessen. Noch Samstag noch übernachten, dann mach ich meine drei Kreuze“ - erzähle Stecki vergnügt. Die Mutter, die ihre dritte oder vierte Zigarette anzündete, war schließlich genervt und verließ den Raum. Dafür wollte sie im Flur jemand anders herein. : Eine gebrechliche Frau mit Gehhilfe und Sonnenbrille; vom Alter her auf Mitte 50 zu schätzen. Ich öffnete ihr die Tür, nachdem sie durch Klopfen sich zu erkennen gab, man solle das für sie tun. Langsam wollte sie zum anderen Zimmerende und nahm vorsichtig Platz auf einer Bank rechts hinter Margret. Dort saß sie schweigend und die Szenerie mal interessiert, mal ausdruckslos beobachtend. Helga erzählte jetzt unterdessen von einem Lebensgefährten oder Ehemann, der ihr immer vorgeworfen hätte, morgens eine Fahne zu haben, wenn sie am Abend zuvor ein Glas Wein getrunken hätte. Margret stieg in die Thematik ein. Sie wäre auch mal verheiratet gewesen. Mit einem Spanier, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Ob sie mit ihm tatsächlich verheiratet gewesen sei, wüsste sie nicht mehr. Es stünde aber in der Dokumenten, in der Heiratsurkunde. Helga wechselte das Thema, in dem sie erzählte, sie hätte die größte Party in Hamburg des Jahres 1988 mit veranstaltet. Margret schwenkte mit um, in dem sie vom Woodstock erzählte. Dort hatten sie alle „gefickt“. „Das heißt geschlafen“ – rief Stecki empört. Plötzlich läutete das Telefon. Freudig hüpfte Helga zum Telefon. „Hallo, wer ist da?“; „Angelika C.? Kenne ich nicht“( Das ist eine Verwandte, die Frau C. sprechen möchte – flüsterte Stecki mir zu.) „ Ach, sie sind Frau C. Und sie wollen Angelika sprechen (lachen!)? Wie ? Das verstehe ich nicht, das müssen sie mir noch mal erklären!“ Sie hörte einen momentlang lachend zu, und sie legte schließlich auf. Dabei grinste sie, als hätte sie sich einen Telefonstreich erlaubt. Wir waren offensichtlich Zeuge davon, wie ein Familienangehöriger veräppelt wurde. Lachend turnte Helga auf der Bank und erzählte weiter. Nicht selten verfiel sie in ihren Singsang. Margret beteiligte sich weiterhin, bildete dabei mit ihrer träger Art, dem monotonen Ton und dem trockenen Humor das genaue Gegenstück zu Helgas manischen Gelächtern. Mittlerweile drehte sich das Gespräch um gewaltige Zahnarztrechnungen und privaten Krankenkassen, die nichts zahlen würden. Von Leuten, deren nach 30 Jahren alle Kronen abfielen und danach zahnlos waren. Zum zweiten Male klingelte das Telefon. Wiederum hüpfte Helga auf. Stecki war aber diesmal schneller: „Lass mich, sonst vermasselst du es wieder“. „Stecki ! Die Frau C. ? Ja, ich hol sie mal!“. Besagte Frau C. War die Mutter von vorhin. Besorgt nahm sie den Hörer. „Hallo , mein Liebes... Geht es dir wirklich gut? Sind die Hundert Euro schon angekommen? Wie? Ist der Riss leicht? Versucht es mit Tesafilm. Das reicht nicht? Dann geh zur Bank. Hörst du.... (...) . Ja aber bleibt nicht solange auf, und mach nicht soviel Unfug. Und ich bitte dich, trink nicht soviel Bier, hörst du? (..) Du hast was? Ach, er hat die Perücke geklaut. 750 Euro!? Ja, lasst diesen Mist. (...) Ja, fruchtbar.“ (Margaret, die ca. 60 cm neben ihr saß, gab wieder ihre „Statements“ ab. Helga sprang sofort mit ein. Stecki wies beide Unruhenquellen an, Still zu sein.) „Hör zu, der Doktor hat mir eine Hautprobe entnommen. Ich hatte diesen Hautausschlag, den du auch hast. Dann wissen wir beide, was wir haben...“, „Hatte Jesus nicht alle Menschen als Brüder? Pscht…“- herrschte Stecki Margret an.); „Ja, es stimmt, morgen ist ja frei; mach aber trotzdem nichts Dummes mit deiner Freundin...“ („Wird man von diesem Leponex nicht auch so fett? „Seid mal endlich still, hier will jemand telefonieren“ - schimpfte Stecki laut. Helga schaute darauf betrübt nach unten, während Margret ihren Mund verzog. Was dieser zu bedeuten hatte, konnte man nicht sagen, da ihre Augen von den dunklen Gläsern verdeckt waren.) „Ja, tut mir Leid Liebes, wir haben heute eine Neueinweisung bekommen, die ist nicht auszuhalten.“ Ganz offensichtlich meinte Frau C. Helga. Kurz danach beendete sie das Telefonat und zündete sich wieder ihre Glimmstängel an. Hier Hände zitterten. Allmählich entspannte sich die Atmosphäre. Die Frau mit dem Anzug „römisch drei“ (Helga) forderte zum Singen auf und ging gleich mit gutem Beispiel voran. Genervt äffte Frau C. Sie nach. „Bist ganz schön anstrengend, weißt du das?“ Helgas Blick und Stimme wurde etwas ernster. „Ja, ich weiß“. Später, plötzlich stand Margret auf und sagte: Ich gehe mich jetzt beschweren!“, „Worüber denn?“ - fragte Stecki. „Weil man hier als Frau nicht mehr ungestört werden kann!“. Sie verließ tatsächlich den Raum und ging zur Kanzel. „Offensichtlich will sie sich über mich beschweren“ Steckis Gesichtausdruck nach, soll ich mir keine Gedanken machen. Ich sah durch das Glasfenster wie sie mit dem Pfleger sprach. Der schüttelte nur den Kopf. Margaret stapfte wieder zurück. „Frechheit, dies ist eine Frauenklinik. Hier waren seit Wochen keine Männer.“ „Aber ich mache doch gar nichts“ - sagte ich. „Ich fühle mich aber trotzdem bedroht. Wegen was bist du denn hier?“ - fragte Margret. „Ich stehe hier nur unter Beobachtung wegen Selbstmordversuch. Ich hatte noch keinen vergewaltigt“ - antwortete ich. „Na gut“ - sie hat sich sichtlich beruhigt. Nach einer Minute gingen die Gespräche weiter. Wie: „Von Leponex habe ich geblutet wie ein Schwein, als ich noch meine Regel hatte…! Ich ging aber schlafen, plötzlich fühlte ich mich unter den Damen nicht mehr so wohl. Zweiter Tag: Hatte man am Freitag das Gefühl, es gehe auf dieser Station den Umständen entsprechend fröhlich und lebendig zu, so lies sich die Stimmung am diesem Samstag und Sonntag mit der eines Kleintierfriedhofs vergleichen. Dabei konnte man meinen, der Tag würde recht angenehm beginnen. Der Weckdienst lässt einen am Wochenende tatsächlich bis kurz nach sieben schlafen. Auf diese Art und Weise ist es tatsächlich möglich, sich von der nächtlichen Anwesenheitskontrolle zu erhöhen, bei der die Zimmertür geöffnet wird und das hereinfallende Flurlicht, welches Tag und Nacht brennt, den Schlafenden blendet wie ein Flakscheinwerfer. Doch schon das Frühstück entpuppte sich als Enttäuschung. Die acht bis neun Anwesenden im Speiseraum vermittelten den Eindruck, als kämen sie von der Station für Komapatienten. Die zumeist greisen und versehrten Patientinnen nahmen mit zittrigen, faltigen Händen schweigend ihre Nahrung zu sich. Mühsam wurden Joghurtbecher aufgerissen, hustend Kaffeetassen gekippt. Nun wenn jemand ein Brötchen übrig hatte oder noch Butter brauchte, hörte man eine menschliche Stimme. Wo war der Rest der Belegschaft geblieben? Als ich mit dem Essen fertig war, - brachte ich mein Tablett zum Rollwagen, in dem 3 x täglich das Essen serviert wurde. Anhand der Namensschildchen lies sich entnehmen, dass sich auf der Station 17 bis 18 Patientinnen befinden. Die meisten müssten sich aber in ihren Zimmern aufhalten. Mein persönlicher Höhepunkt an diesem Vormittag war die Gewichtskontrolle und die Blutdruckmessung. Mehr Aufmerksamkeit kriegte man vom Personal nicht geschenkt. Mit zittrigen Fingern wurden die Tabakbeutel und Papierblättchen hervor gezücht. Die Wohlhabenden, konnten sich Zigaretten leisten. Schweigsam wurde die Nikotinsucht in den Höfen und im nikotingelben Raucherzimmer befriedigt. Die meisten rauschten eine Zigaretten nach der anderen, denn eine einzelne genügte ihnen nicht. Einige machten auch ein Gebrauch von ihrem Recht auf einen einhalb- und einstündigen Freigang. Es folgte das Mittagessen, das nicht anders ablief als das Frühstück. Danach war das Stockwerk noch ruhiger als morgens. Überall nachmittägliche Stille. In der Kanzel lösten die Pfleger Kreuzworträtsel. Frau C. geisterte mit verzweifeltem Geist durch die Korridore, Helga hüpfte konzentriert auf dem Hof und bestaunte die dortige Botanik. Später kam Margrit, die mit Nachnahmen Frau B. Hieß, dazu und unterhielt sich mit Helga. Anscheinend hatten sich zwei gefunden. Mir neu war die Frau W., eine Rollstuhlfahrerin mit eingefallenem Gesicht, knochigen Armen und Beinen und furcht erregenden Augen. Sie erinnerten an eine blinde, alte Siamkatze. Ihr Mund was meist halbgeöffnet und entblößte ein schiefes Gebiss. Sie hatte einen grauen, stoppeligen Frauenbart. Mit trägen Blick starrte sie nach draußen und wirkte sehr einsam. Was wohl die Ärmste in der Psychiatrie machte? Die Langeweile dieses Samstags war nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass Stecki wie so manche andere, auch Zuhause Übernachtungsurlaub machten. So trottelte ich im Gefängnishofgang durch den Garten und Flurgebäude und wartete darauf, dass sich etwas ereignen wollte. Tatsächlich was das einzig auffällige, der sich zunehmend verschlechternder Zustand von Frau C., die abends darum bat, den Blutdruck zu messen und sich untersuchen zu lassen. Beim Abendessen lernte ich noch die beiden Rentnerinnen, Frau H. und Fr. Fritz kennen. Schließlich ging ich zeitig zu meinem Nachtlager und wollte schlafen, was aber hinausgezögert wurde, weil die Nachschicht mir ein Schlafmittel andrehen wollte. Dritter Tag Auch am Sonntag war die Stimmung vergleichbar trübe wie am Sonnabend. Es gab ebenso keine Arztvisiten, Untersuchungen oder Therapieangebote. Auch jetzt hatten so manche Patientinnen Heimurlaub von der Psychiatrie. Da ich dessen mir von Anfang an bewusst war, nutzte ich die Zeit über die Erkenntnisse, welche ich über die Insassen gewonnen habe, zu reflektieren. Es ist ohne Aktenansicht, unmöglich zu sagen, wie viele Personen aktuell eingeschrieben sind. Manche befinden sich nur gelegentlich auf der Station und fast täglich sieht man im Schnitt ein neues Gesicht. Alle paar Tage wird auch glücklicherweise jemand entlassen. Auch hier im Schnitt nur eine Person. Trotzdem kann man recht sicher von mindestens einem dutzend Personen ausgehen, die zumindest dieser Tage sich zeitweise in der Klinik aufhielten. Zwei von ihnen war eine Kathrin Sch., angeblich nach eigener Aussage hier, weil sie während eines Krankenhausaufenthaltes auf das Dach kletterte und sich in der folgenden Tagen selbst Blut zu „medizinischen Zwecken“ abnehmen wollte. Eine Bilderbuchgeschichte, um in die Psychiatrie zu kommen. Die meiste Zeit verbringt sie auswärts. Entweder vormittags in der Schule und abends in einer Wohngruppe, wo sie schon mal übernachten durfte. Sie ist gegenüber den Pflegern sehr gesprächig und sehr zappelig. Wie ein kleines Kind lässt sie überschüssige Energie ab, indem sie auf einem Stuhl turnte. Eine zweite wird Dornrösschen genannt. Ein mageres Geschöpf. Ihr Haar meist unter einem Kopftuch versteckt und fast immer verträumt. Sie hat mehrfach bewiesen, dass sie manchmal sprechen kann. Meist starrt sie aber einfach nun an, wenn man sie anspricht. Aber von sich aus redet sie nicht. Dafür fängt sie oft urplötzlich an zu lachen. Wenn sie mit ihrem Disc-Man Musik hört, so wird sie noch verträumter und gerät schon fast in eine Art Trance. Nicht selten singt sie mit. Mal wirken ihre Gesichtzüge dabei entweder völlig entspannt, oder aber sehr angestrengt. Zu ihrem eigenen Unglück raucht sie sehr viel. Petra ist die Zimmergenossin von Margret B. Sie muss wohl wegen enorm starker Depressionen eingeliefert worden sein. Denn in den Abendrunden erzählt sie davon , wie sehr für sie einfache Tätigkeiten wie Wäsche aufhängen oder das Zimmer aufräumen, eine Anstrengung, welche den ganzen Nachmittag ausfüllt-, darstellt. Freudig erzählt sie, wie viel sie geschafft hätte, wenn sie nicht mit ihrer Mutter ein paar Kartons sortiert hätte, und wie der Tag dabei schnell zu Ende ging. Nach solchen „arbeitsamen“ Tagen pflegt sie, abends fernzusehen. Sie versucht des Weiteren, in der Bibel Hoffnung zu finden. Frau V. Ist eine etwas zottelige Erscheinung, was daran liegt, dass sie ihr vorderes Haar, welches ihr Gesicht verdecken würde, provisorisch mit einer Haarklammer nach hinter befestigt. Dank dieser Frisur wirkt sie mitunter dämlich. Wegen ihrer Medikamente hat sie Schwierigkeiten mit ihren Körperbewegungen. Deshalb geht sie langsam und stocksteif, ähnlich wie Frau C. und Frau B. (Margret). Sie soll paranoid sein. Melitta ist eine etwas schlankere Frau Ende 40, was man an grauen Haaransatz erkennen kann. Nicht desto trotz läuft sie mit Latzhose, rot geschminkten Wangen und Pippi-LangstrumpfZöpfen herum. In ihrem Zimmer hält sie Stofftiere. Diese auffälligen Äußerlichkeiten stellen auch alle erkennbaren Anomalien dar. Ich habe noch nie eine kranke Verhaltensweise bei ihr beobachten können. In den Abendrunden erzählt sie grundsätzlich nichts. Frau Fritz ist eine charmante Rentnerin mit ausgeprägter norddeutscher Mundart. Sie spielt auf der Station gerne Tischtennis und isst jeden Abend ihren Salatteller. Ihr Problem scheint eher ein neurologisches zu sein, dass sich durch mitunter heftigen Körperzittern äußert. Auch sie ist während der Abendrunden nicht gerade gesprächig. Frau H. Ist zwar 56, aber ihren Aussehen nach schon Ende 70. Dies liegt nicht zuletzt an ihren fast zahnlosen Mund. Damit man sie verstehen kann, muss sie entsprechend laut reden. Warum sie hier ist, kann ich nicht sagen. Sie wird aber Anfang Oktober entlassen. Wie sehr sie sich darauf freut, betont sie während der Abendrunde. Weitere erwähnenswerte Psychiatriebewohnerinnen sind die greise Frau W., Anna , die gehbehinderte Frau, die beiden Helgas, Frau C. und Margret B., die Frau , die von sich selbst sagt, sie hätte kein Herz mehr. Gegen Sonntagnachmittag kam Stecki für eine letzte Übernachtung noch einmal zur Station zurück. Schlagartig änderte sich die Atmosphäre im Erdgeschoß. Patienten und Personal werden im Umgang lockerer. Sie bemerkte den roten Blumenstrauß, den ich von meiner Mutter bekam. „Uuuii, dass ist aber ein schöner Strauß, nehme ich mit für zu Hause. Oh, was ist denn das für eine Vase?“ Ich vergaß, dass Glas auf diesem Geschoß verboten war. Wohl damit niemand im Wahn mit einer zerbrochenen Flaschenhälfte Jack the Ripper oder Macki-Messer nachahmte. Ich machte mich daran, die Vase zu verstecken, um sie bei nächsten Mal meiner Mutter wieder mitzugeben. Als ich den Schrank öffnete, bemerkte sie, dass ich mittlerweile einen enormen Süßigkeitenberg angesammelt habe. „Was hast du denn da Tolles?“ Ich erklärte ihr, wie meine Eltern und Großmutter mir bisher jeden Tag mehr Schokolade mitbrachten, als ich binnen einer Woche überhaupt essen könnte. Ich hatte diverse Milka-Sorten, After-Eight, VivilBonbons, Sesamstangen und Rittersport-Taffeln auf Vorrat. Als Krönung noch eine Packung Celebration-Schokoriegelbonbons. „Die nehme ich!“ - Stecki lies es sich nicht zweimal sagen, als ich ihr etwas anbot. Um auch im Raucherraum die Stimmung zu verbessern, beschloss ich gut die Hälfte meiner Süßigkeiten mitzunehmen und dort auf den Tisch zu verteilen. Mein Angebot wurde angenommen. Insbesondere Helga stützte sich begeistert auf die weiß Milkaschokolade. Stecki dagegen vergriff sich an die Vieviel-Bonbons und die Rittersporttafeln. Auch andere naschten, insbesondere Frau C., welche den Eindruck machte, dass sie von ihrer Tochter, welche sie heute besucht hatte, auch gerne mal Süßigkeiten bekommen hätte. Helga verhielt sich deutlich ruhiger als am Freitag. An diesem Vormittag wirkte es so als hätte sie eine depressive Phase, die Manie abgelöst hatte. Die Brille, die sie jetzt trug, lies sie sogar sehr intelligent wirken. Frau B. hielt sich allerdings diesmal nicht im Raucherraum auf. Anna saß wieder in der Ecke. Stecki hatte zittrige Hände, deshalb spielte ich ihren Assistenten und öffnete für sie Verpackungen und drehte eine Kippe nach der anderen. Die Stimmung war angenehm. Ich machte mir jedoch seit Längeren um Frau C. sorgen. Sie hat sich halb getäubt meist in ihrem Zimmer aufhielt, welches aus Sicherheitsgründen eine Kamera hatte. Ich sollte früh genug erfahren, warum. An diesem Abend schien sich ihr Zustand allmählich zu verschlechtern. Ihre Augen waren erschöpft, ihr Mund war halb offen, aber ihre Bewegungen nicht mehr hölzern. Sie sprach auch ein wenig. Ich nahm nicht bewusst wahr, dass sie den Raum verließ und zum Hof hinausging. Wohl dachte ich zu diesem Zeitpunkt, sie wollte frische Luft schnappen. Zwar stand die Tür zum Hof weiterhin offen, aber die Luft war dermaßen Teen- und Nikotin geschwängert, dass man regelmäßig den Raum kurz verließ. So auch ich. Ich bemerkte eine Gestalt in der Dunkelheit. Sie stand auf der Tischtennisplatte. Ich konnte nicht erkennen, um wen es sich handelte. Nur dass, die Frau von der Platte fiel und darauf auf ihren 4-Buchstaben saß. Um mich zu vergewissern, dass ihr nichts passiert war, lief ich hin. Es war Frau C. Auf die Frage hin, ob mit ihr alles in Ordnung sei, konnte ich ihre Antwort nicht verstehen. Verunsichert ging ich wieder. Als ich beim Eingang zum Hof stand, sah ich, dass sie wieder auf der Tischtennisplatte stand und auf der Tischkante balancierte. Sie beugte sich vor, als ob sie einen Kopfsprung auf den Pflastersteinen wagen wollte. Ich eilte zur Kanzel und gab Bescheid. Sie nahmen mich erfreulicherweise ernst und liefen zum Hof raus. Wenig später führten sie zwei Pfleger rein. Ihr war offensichtlich nichts passiert. Betrübt setzte sie sich in den Speiseraum. Minuten später hörte ich ein Klopfen oder Hämmern. Das Personal wurde wieder alarmiert. Wieder zerrten sie an Frau C.! Sie hatte ihren Kopf mehrfach auf die Tischplatte gedonnert. Ihre Stirn war gerötet und geschwollen. „Frau C., gestern noch haben Sie Angst gehabt, dass sie sterben und heute tun Sie sich das an. Das können wir nicht nachvollziehen“ Die Pfleger schnallten sie ans Bett und spritzten ihr Beruhigungsmittel ein. Fixieren nannte man diesen Vorgang. Vierter Tag Das Wochenende war vorbei. Wieder hieß es, um kurz nach sieben aufzustehen. Mühsam richtete ich mich auf und bewegte mich Richtung Bad. Ich beschloss, heute Morgen zu duschen. So manchen ist der Umstand bekannt, dass in billigen Hotels oder öffentlichen Gebäuden das Wasser nicht richtig warm ist. Dieses Problem hatte ich nicht. Das Shampoo ausspülen erwies sich als Tortur, musste ich damit rechnen, Verbrennungen ersten Grades auf meiner Kopfhaut zu erleiden. Ich hielt mich deshalb die meiste Zeit außerhalb des Wasserstrahls auf, und wenn ich mich doch darunter stellen musste, ging ich dabei in die Hocke, da das Wasser unten kühler war, als direkt an der Brause. Schließlich verließ ich die dampfende Kabine. Merkwürdigerweise hatte ich dieses Problem nicht gehabt, als ich mich am Freitagabend duschte. Ich hatte einige Erwartungen an diesen Tagen gehabt. Da es nun wieder Arztvisiten gab, was ich gespannt auf klärende Untersuchungen und Gespräche. Es fing auch hoffnungsvoll an, denn gleich am frühen Tag, kam einer vom Pflegepersonal und servierte mir einen leeren Pappbecher mit meinem Namen darauf. Spätestens bei seiner Musterung, weiß ein junger Man, wozu dieser Becher gut ist. Nach dem Frühstück bildete sich wie jeden Morgen eine Schlange vor der Kanzel. Eine nach der anderen formte ihre Hände zu einer Schale, um eine Handvoll runder oder länglicher, weißen oder rosanen, kleiner Pillen zu empfangen. Als nächstes reichte man ihnen kleine orange oder gelber Einwegbecher, gefüllt mit lauwarmem Wasser, der nach Benutzen in einem Abfallkorb landete. Ich war glücklich, nicht zu diesen Leuten gehören zu müssen. Ich schüttelte mit dem Kopf, als ich die Verschwendung mit den kleinen Bechern sah. Die Urinprobe war Teil einer Routinenuntersuchung. Der nächste Schritt waren drei Blutproben. Eine junge Ärztin wies mich an, meinen Arm frei zu machen und die Faust zu ballen. Sie tastete den Arm ab und wurde sich auf einmal unsicher. Sie hatte offenbar Schwierigkeiten eine ergiebige Ader zu finden. Auf Höhe des Ellenbogens wurde sie doch findig. Begierig stach sie zu, doch statt Blut, kam nur Vakuum heraus. „Sie haben eine zu dicke Haut. Dann müssen wir es wohl mit dem anderen Arm probieren“ Sie schnürte mir den Arm mit einem blauen Band ab, bat mich wieder die Faust zu ballen und stach zu. Sie zog die Spritze an, doch die Schlauchkanüle, durch das mein Blut in den Behälter fließen sollte, blieb sauber und leer. „Dann müssen wir mit der Hand versuchen. Sind Sie Rechthändler?“ Ich verstand zwar nicht, warum sie nicht die große, pulsierende Ader auf der Innenseite meines Unterarms anstachen wollte, aber ich dachte mir schon, sie wüsste, was zu tun sei. Sie versucht e es also mir meiner linken Hand. Als das aber auch missglückte und auch ein weiterer Versuch im rechten Ellenbogenbereich fehlschlug, stach sie schließlich in eine Aderverzweigung meiner rechten Hand. Langsam füllte der rote Lebenssaft alle drei Probengefäße. Mit dem Gefühl zerstochen zu sein wie ein Heroinsüchtiger verließ ich das Behandlungszimmer. Bei der Arztvisite sprach ich das Problem mir meiner Leiste an. Mein Leistenbruch ist nun seit zwei Jahren ein Problem gewesen, und ich hatte gehofft, man würde sich diesem Leiden annehmen. Ich erreichte immerhin, dass ich bei der Chirurgie angemeldet wurde. Beim Einweisungsgespräch mit dem Oberarzt, schenkte man mir wenig Beachtung. Im Flur sah ich Frau C. Ihre Augen waren entsetzlich anzusehen. Mit einer Mischung aus Apathie und Entsetzen starrten ihre Augen durch die Gänge. Ihr Mund war halb offen. Stocksteif bewegte sie sich vorwärts. Auf ihrer Stirn thronte eine rot angeschwollene Beute. Sie musste unglaubliche Kopfschmerzen haben oder durch die Medikamente bis oben hin bedröhnt sein. Plötzlich kam Stecki um die Ecke „Na, bist du auch auf der Idiotenrennbahn (Der Korridor der Station) unterwegs? Haben deine Eltern wieder was mitgebracht? Mach deinen Schrank auf!“ Wir gingen in mein Zimmer. Ich öffnete die Schranktür und sofort griff sie sich eine Schachtel Süßigkeiten. „Biete den anderen aber auch mal was an!“ - sagte ich und sie lachte nur höhnisch. „Ich bin Egoist! Komm hier, du kannst mir die Zigaretten drehen“. Im Raucherraum rauchten natürlich auch die anderen Patientinnen. Darunter auch Dornröschen. Steck sprach sie an, ob sie ihr Tabak geben könnte. Offenbar muss sich zwischen den beiden eine Beziehung entwickelt haben. „ Und, krieg ich jetzt das hübsche Bild für meine Küche?“ Sie atmete einen tiefen Zug ein, schob Stecki den Tabakbeutel zu, atmete aus und fragte „Welches?“, „Das mit der Elfe“. Dornröschen lächelte ein wenig verträumt, stand auf und brachte eine Postermalerei mit einer Fee auf einer Seerose darauf. „Schön, was Bekloppte für tolle Sachen machen können“ -sagte Stecki. Später am Abend läutete das Telefon. Ich ging ans Telefon: „Klapsmühle UK-Eppendorf! Frau B.? Einen Moment“ Frau B. war auf ihrem Zimmer, und da sie nicht gut zu Fuß war, musste der Anrufer lange warten. Ächzend setzte sie sich hin und ergriff den Hörer. „Hallo? Ja Hallo Christiane. Schön, dass du anrufst (..) Ich bin heute recht müde, war heute Schuhe kaufen und habe einen langen Spaziergang gemacht. Die hatten aber nicht das richtige Paar gehabt (...) Ja, ich weiß auch nicht warum. Eigentlich wollte ich nur meine Schwiegermutter besuchen, Als ich mich über diese Zustände aufgeregt habe, haben sie mich hier behalten (...)“ Stecki unterdrückte erfolglos ein lautes Lachen. „Übrigens, der Typ, mit dem ich verheiratet war oder verlobt, oder wie man das nennen kann, bei dem ist die Heiratsurkunde gefälscht. (...). Ich weiß nicht. Ich habe bei einer Anwältin angefragt; sagte mir sie hätte keine Zeit und werde sich um die Sache später angucken. Und nicht nur das ! Meine drei Renten sind falsch berechnet. Diese Summen sind zu hoch angesetzt. Auch meine Betriebsrente ist gefälscht...“ - erzählte sie weiter. „ Und deine Geburtsurkunde auch ist gefälscht“ - bemerkte Frau C. bissig. Offensichtlich hörte sie so was nicht das erste Mal. „Ja, wenn soll ich anklagen? Das Amt. Ja, du weißt gar nicht wie schrecklich das ist. Ja (...). Und in der Wohnung hatte ich auch schon ein schlechtes Gefühl gehabt. In dieser wurde ich nämlich abgehört. Du lass uns lieber morgen treffen. Dann erkläre ich dir das genauer. Jetzt nicht am Telefon (...). Ja, ich habe Ausgang, ich bin ja schließlich freiwillig hier!“ Zwischendurch fragte mich Stecki erstaunt: Lukas, was machst du hier überhaupt? Hier unter diesen ganzen Psychopathen?“ Ich zuckte mit den Schulten und lächelte: „Keine Ahnung, wohl aus rechtlichen Gründen.“ „ Ha, pass auf. Die geben dir auch noch Psychopharmatika. Zyprexa und all so was, Davon wirst du bekloppt“ Fünfter Tag Ich legte mich am späten Vormittag hin, da mein Gedärm gegen meine Leiste drückte. Plötzlich kam die Ärztin rein, die mir gestern das Blut abgenommen hatte, mit einer jungen Auszubildenden herein. Sie führte EKG-Messgerät auf einem Rollwagen mit. Sie erklärte mir, dies wäre Bestandteil einer Routineuntersuchung. In der Hand hatte sie eine Liste von Körperteilen und Merkmalen, die sie von Kopf bis Fuß untersuchen sollte. Sie beklebte mich mit Noppen, an denen die Kabel eingesteckt wurden. Sie drückte die Starttaste, während sie sich mit dem Azubi unterhielt. Das Gerät spuckte darauf nur einen zerflederten Streifen raus. „ Da muss eine neues Papier rein“ Beide grübelten und versuchten herauszufinden, wie die neue Papierrolle einzuführen sei. Nach mehreren Versuchen war das Gerät wieder einsatzbereit. Als die Ärztin den Knopf drücken wollte, kam jedoch eine Schwester herein. Die Ärztin hatte einen Anruf. Hastig eilte sie nach draußen, während die Schwester die Arbeit übernahm. Die restlichen Untersuchungen werden bis auf Weiteres verschoben. In der Mittagszeit schritt Stecki in ihre“ goldene Freiheit“. Sie wurde entlassen. „ Dir geben sie auch noch Psychopharmatika“ Diese Worte hallten noch immer im meinem Kopf, als sie ging. Noch an der Sonntag-Abendrunde sprach ich noch ausdrücklich davon, wie ich froh darüber war, keine M. nehmen zu müssen. Ich hoffte, dass Stecki düstere Prophezeiung sich nicht bewahrheitete. Doch nach der Arztbesprechung kam meine verantwortliche Ärztin in mein Zimmer. Ich solle das Neuroleptikum; Zyprexa und eine Antidepressivum nehmen. Soviel zu meinem Glück. Ich versuchte wenigstens mehr Informationen über dieses Mittel zu bekommen. Sie aber hätte schon längst Feierabend und müsse gehen. Leicht verärgert ging ich ins Raucherzimmer und erzählte es Helga. Die sagte, ich müsste nichts annehmen solange ich nicht den Beipackzettel erhalten habe. Ich fasste Mut. Als ich eben um diesen bei der Kanzel fragte, sagte man mir, dass das nicht üblich sei. Man habe schlechte Erfahrungen damit, da bei der Auflistung möglichen Nebenwirkungen der Patient Panik bekommt und sich weigert, das Mittel zu nehmen. Überdies hätten sie keinen auf der Station. Das war nichts mehr zu machen. Denn das Mittel war fest und nicht auf Bereitschaft von der Ärztin vorgeschrieben worden. Verärgert saß ich im Raucherzimmerund hörte den Oldie-Sender. Der einige Sender, der von allen Patientinnen akzeptiert wurde. Helga tänzelte zur Musik und hob die Hände, Bärbel, eine Suizidkandidatin, die von etwa 48 Stunden, eingeliefert wurde, und zu der ich bis jetzt keinen Kontakt hatte, war von ihr fasziniert, ohne sie jedoch auszulachen. Nach einigen Stücken machte Helga eine Pause, statt Musik wurden Nachrichten gesendet. Helga setzte sich neben mir und bemerkte sofort, dass ich immer noch schlechter gelaunt war als sonst. Sie ergriff meine Hand und hielt sie „ Ich halte deine Hand bis es dir besser geht“ Als wieder Musik gesendet wurde, begann sie meine Hand rhythmisch zu bewegen, wie bei einem Tanz. Die Musik wechselte und ich begann den Tanz zu führen. Unsere Hände kreisten und sie verschloss ihre Augen, „Schön „ - sagte sie. Sechster Tag Frau H. trug nun seit einer Woche denselben Pullover. Er war königsblau und mit Perlen verziert. Sie saß am Rauchertisch, was ungewöhnlich war, da sie zu den wenigen Nichtraucherinnen gehörte. Sie war sehr aufgeregt. „Ich werde heute abgeholt“ – erzählte sie immer wieder mit lauter aber aufgrund ihres unvollständigen Gebisses, undeutlicher Stimme. „Ich werde am 03. Oktober entlassen. Aber mein Mann holt mich schon heute ab zum Übernachten. Halb elf, hat er gesagt“. Helga beruhigte sie: „Ja, es sind noch 10 Minuten, er wird bestimmt gleich kommen“ „Er ist aber immer sehr pünktlich gewesen; er kommt, nu?“ „Ja, der wird ganz bestimmt kommen“ Bärbel, eine Patientin, die wegen eines Suizidversuchs am Sonntagabend oder Montag eingeliefert wurde, beobachtete die Szene. Die zehn Minuten verstrichen sehr unruhig, weil Frau H. ständig besorgt war, dass ihr Mann nicht erscheinen wird. „Kommt er mit dem Taxi oder mit der Bahn?“ „Der kommt mit dem Bus und mit der Bahn“. „Ja siehst du, dann kann er sich verspäten“ – erklärte ihr die Helga. „Aber mein Mann ist immer pünktlich. Der war sogar immer früher da“ „Aber der Bus könnte im Stau stehen“ – meinte Helga. „Ja, das kann angehen“ „ Es reicht ja schon, wenn er den Anschlussbus verpasst, oder die U-Bahn Schwierigkeiten hat, dann kommt man schon auf 10 bis 15 Minuten Verspätung“ – pflichte ich bei. „Ja, dass kann angehen. Kann angehen…“ Nach einigen Minuten kam ihr Mann immer noch nicht. Frau H. begann, sich wirklich Sorgen zu machen und war durch unsere Beschwichtigung, nur noch bedingt zu beruhigen. Wir schlugen ihr vor, ihn anzurufen. „Wenn er nicht rangeht, wird er schon unterwegs sein“ – sagte ich ihr. Und Helga ergänzte:“ Und 10 Minuten verspäten kann sich jeder“ „Ja das kann angehen“ Ans Telefon ging keiner ran. Er musste wohl also doch unterwegs sein. Und auch in den folgenden Minuten wollte ihr Gatte einfach nicht kommen. Somit blieb ihr einfach nicht übrig, als sie weiter zu vertrösten. Ständig klingelte es. Aber es war nie Herr H., der die Station betrat. Ich setzte Frau H. schon auf einen Stuhl im Eingangsflur, um den hoffentlich, bald aufkreuzenden Herr H. zu empfangen. Nach einer Stunde rief die Station noch mal an. Wieder ging keiner ran. Glücklicherweise konnten wir die traurige Frau H. überreden, sich schlafen zu legen. Sie habe sich vermutlich verhört und ihr Mann wollte erst am Nachmittag kommen. So redeten wir auf sie ein. Tatsächlich erschien ihr Mann auch, als sie schlief. Der bis auf die Krücke gesund aussehende alte Herr (womit er deutlich besser aussah als seine Frau), brachte ein Strauß Blumen vorbei. Sein Bein ginge es schlecht. Daher muss er sie morgen abholen. Nachmittags war Frau H. wieder unruhig. „Mein Mann wird mich morgen abholen. Wird er doch, oder?“ „Ganz bestimmt“ – ermutigte sie Helga. „Aber die Zeit, die ich verloren habe… Ich könnte so viel machen können zuhause“ „Ja, ich weiß, aber Hauptsache es kommt morgen. Nicht wahr?“ „Ja, Ja. Morgen kommt er“ Frau H. war jetzt sichtlich den Tränen nahe. Helga nahm den Strauß mit Blumen unter die Nase. „Guck mall, das hat er mitgebracht. Sonnengeld sind sie“ „Ja, ich weiß. Aber er ist sonst immer pünktlich. Ich hatte schon einkaufen gehen können“ Sie erzählte eine Weile so weiter, während Helga ihr die Blumen immer vor der Nase hielt, wie einem Baby den Schnuller. „Schau mal, wie dich die Blumen anlächeln.“ – strahlte sie. Frau H. vergoss schließlich einige Tränen und legte ihr Gesicht in den Strauß. Dann fasste sich sie sich wieder. „Ich bin ja eigentlich nicht so weinerlich“ – und lächelte sie wieder. Getröstet verließ sie den Raum. Bärbel sprach: „Wie lange läuft sie eigentlich in diesem Pulli rum? Sie riecht schon unangenehm“ Frau H. wurde tatsächlich abgeholt und verließ am 3. Oktober mit ihrem Mann die Station. Siebter Tag Als ich aufwachte, war der Morgen dunkel und neblig. Ich war müde und meine Augen gingen ungewöhnlich schwer auf. Mit wackligen Beinen stieg ich aus dem Bett. Als ich zum Tablettwagen schritt, um mein Frühstück zu holen, blendete mich das Korridorlicht und mein Gang war mehr ein Schlürfen als ein Gehen. Meine vor Müdigkeit zufallenden Augen spähten noch einen Sitzplatz, den ohne Sondererlaubnis war Frühstücken im Zimmer verboten. Mit Anstrengung verspeiste ich mein Essen. Helga schien, dagegen it zu sein. Dies ist insoweit erstaunlich, da sie die halbe Nacht mit Yaw im Aufenthaltsraum verbracht haben soll. Yaw ist einer Schwarzafrikaner, sprach kaum Deutsch, sondern einen englischen Dialekt und wurde gestern Nachmittag hierher gebracht. Gestern Abend verbrauchte er die Zeit unruhig im Hof und rauchte. Es war offensichtlich, dass es hier raus wollte. Helga war erfreut über sein Erscheinen, sie sprach von einem „Engelsgeschöpf“ und begann sogleich ihr Englisch, das eingerostet war, zu polieren. Mir war das Geschehen recht egal, ich wollte nur noch schlafen. Sogleich verkroch ich mich auf mein Zimmer und döste für mehrere Stunden ein. Am späten Vormittag war ich immer noch nicht richtig wach, aber es reichte, um das geschäftige Treiben auf der Station, zu beobachten. Helga machte dem Personal die Hölle heiß. Den genaueren Hergang konnte ich zwar nicht mehr rekonstruieren, es scheint jedoch, dass ihr richterlicher Entschluss sie hier festzuhalten zeitlich abgelaufen war. Ob sie rausgeschmissen wurde, oder selber hinaus wollte blieb unklar. Tatsache war aber, dass sie ihre Originalunterlagen haben wollte, die ihr verweigert wurden. Wütend flüchtete sie vor dem Personal, das ihr hinterher schritt. Schließlich gelang es einem Arzt, sie mit Kopien zu beschwichtigen. „Sehr anständig von Ihnen“ – kommentierte sie. Circa eine Stunden später verlies sie und; auch Kathrin durfte nach dreizehn Monaten endgültig raus. Helga verabschiedete sich herzlich von mir. „Schade, jetzt wird es hier langweilig werden“ – bedauerte Bärbel. Tatsächlich traf das nur auf die nächsten Stunden zu. Bereits am Abend war was wieder los im Erdgeschoß vom Haus S15. Zunächst einmal erbarmte, sich einer von der Chirurgie mich endlich zu besuchen. Er schaute sich meinen Leistenbruch an und betätigte, dass es wohl operiert werden müsste, aber sagte auch, dass man dies Übernächste Woche machen würde. Das enttäuschte mich ein wenig. Heißt es doch, so was müsste zeitnah gemacht werden. Als er wieder ging, schaute ich aus dem Fenster: Yaw spazierte im Hof und unterhielt sich mit sich selbst. Plötzlich kamen Gestalten in weißen Kitteln hinzu. Ein bärtiger Mann ging mit Ihnen. Er war wohl Übersetzer. „I don´t need you“ – sagte Yaw immer und immer wieder. Offenbar wollten sie ihm Medikamente verabreichen. „You cannot force me. I`ll do not take any medication. I don´t need you” Mehrere Minuten ging es so hin und her. Dabei wurde seine Stimme immer lauter. Das Personal wurde unruhig. Ein Zivildienstleistender schickte die Patienten in die Zimmer. Das war für die meisten nicht weiter schlimm, denn im Zimmerfenster hatte man schon den besten Ausblick. Kurz darauf klingelte die Eingangstür. Ein Polizeibeamter und eine Polizistin kamen in voller Montur herein. Die Lage war sichtlich angespannt. Sie hielten einen gebührenden Abstand zwischen sich und Yaw. Sie sprachen ihn an. Yaw verwies immer wieder darauf, dass er sie nicht brauchen würden. „Ich spreche kein Englisch“ – sagte der Polizist. „Fuck you“ – schrie Yaw quengelnd. „Du mich auch“ „Get away, you working for CIA and Mossad. I don´t need you!” Zwei weiteren Polizisten kamen als Verstärkung. Yaw, der sich sichtlich bedroht gefühlt hatte, wich zurück“ Ein bulliger Polizist kam auf ihn zu und ergriff seinem Arm. Yaw versuchte sich loszureißen, doch die anderen Beamten kamen hinzu. Sie drückten ihn zu Boden, Er brachte unsanft auf. Ein Kittelträger bereitete eine Spritze von und stach zu. Dann trug man den Schwarzen in den „Bau“. Ein Zimmer mit doppelter Tür und Kamera. Man fixierte ihn. Achter bis zehnter Tag Und wieder näherte sich das Wochenende. Am Freitag kam noch Helga zu besuch, brachte Tabak und Süßigkeiten. Mit schuldete sie noch Geld, das sie einmal für Zigaretten ausgeliehen hatte. Sie zahlte es von sich aus zurück. Ich war aber zu erschöpft, so dass ich der Runden nicht lange Gesellschaft leisten konnte, Erst gegen Abend wurde ich wacher, dafür versuchte sich mein Darm zwischen Bauchdecke und Leiste zu drücken. Schwester Elke holte tatsächlich einen Krankenpfleger, der mich zur Notaufnahme brachte. Nach eineinhalb Stunden schaute sich der Chirurg mich an und bestätigte, dass ich zeitnah operiert werden müsste. Montag sollte ich zur Vorbesprechung. Spätnachts kam ich auf mein Zimmer und hielt mein Gedärm im Schach. Am Sonntagmorgen war ich wieder so schlapp, dass ich auf das Frühstück voll verzichtete. Ich war nicht der einzige. Ein dunkelhaariger Bursche lag neben mir im Nachbarsbett. Er muss spätnachts hierher gebracht worden sein. Wir beide brauchten einfach unsere Ruhe. Bis Mittag lagen wir auf der Matratze, nur geweckt, um Medizin zu nehmen. Zum Mittag wachte ich auf, als auf einmal Laserkanonen das Feuer auf mich eröffneten. Nein, es war nur bloß ein skurriler Handyklingelton. Der Busche bekam ein Anruf. Er hatte erst einen normalen Tonfall: „Hallo Mama, mir geht es gut. Ich bin hier im Krankenhaus Eppendorf. Wann holst du mich ab?“ Von da wurde der Ton weinerlicher. „Nein, du musst kommen. Der Arzt hat gesagt, ich kann abgeholt werden. Du musst kommen, hörst du? Ich muss auch nicht zu Hause bleiben, ich gehe mit Kumpels weg“ Nach einigen Augenblicken wurde er merklich wütend. „Doch, du musst mich abholen, sonst ist das Wochenende versaut. Doch. Hält´s Maul. Hol mich jetzt ab“ Nach ein bis zwei Minuten wurde sein Tonfall wieder weinerlich. Aber er hat angefangen. Er hat mich sauer gemacht. Bitte, hol mich jetzt ab“ Er flehte noch minutenlang, doch es war zwecklos. Die Mutter des unsympathischen Kerls wollte ihn hier drin behalten. Er aber wäre lieber mit Freunden auf die Piste gegangen. Sein pickliges, derbes Gesicht offenbarte, dass er noch ganz Teenie war, und was ich von den Gesprächsfetzen mitkriegte, ein aggressiver dazu. Mit war nicht danach, mit ihm zu sprechen. Und das galt ebenfallsumgekehrt mir gegenüber. Er ging mit einer Schachtel Zigaretten raus und knallte die Tür zu. Als er später wieder rein kam, legte er sich wieder hin. Ich verließ meine Stube. „Schläft er bei dir?“ – fragte mich Anna. „Na du hast vielleicht einen tollen Nachbar. Guckt nur mürrisch und macht auf Gangster“ „Erinnert mich an meinen Kleinen“ – meinte Bärbel. Bärbel war die Mutter zweier Söhne und mit einem Türken verheiratet. Der jüngere Sohn spielte sich, wie sie erzählte, als Ghettoschläger auf. Ich verstand mich prima mit Bärbel. Sie erzählte gerne du freute sich, wenn ich Leckereien auf den Tisch stellte, die ich bei meinen Besuchen geschenkt bekam. Sie war hier, weil ihr Mann und ihre Söhne seit Jahren zerstritten waren. Sie geriet zwischen die Fronten und ertrug es nicht mehr. Ich fragte nicht nach weiteren Details. „Aber im Inneren ist er ein Milchbubi“ – ergänzte Bärbel ihre Einschätzung meines neuen Zimmergefährten. Ich war von allen erstaunt wie lange er schlafen konnte. Am späten Nachmittag schlief er immer noch. Können das alleine Schlafmittel sein? Ich hörte schließlich auf, mich zu wundern, da ich schließlich selber so erschöpf war. Es war das Zyprexa. Ja, ich habe das auch bekommen. Ich bekam morgens so einen trockenen Mund davor und Augenringe, die mir schmerzten. Na toll, welche Freude. Durch die Glastür sah ich den Pfleger mit einem weißen, durchsichtigen Kanister mit einer gelben Flüssigkeit aus dem „Bau“ spazieren. Yaw war wohl immer noch aus Bett gefesselt. „Ich wundere mich, dass du Zyprexa auch bekommen hast“ – meinte Frau C. zu mir. „Das nimmt man normalerweise bei Psychosen“. Das Wochenende verlief insgesamt langweilig. Der unangenehme Bursche wurde verlegt. Yaw blieb aber bis Sonntag im Sicherheitszimmer eingesperrt, ohne sich aggressiv verhalten zu haben Elfter Tag Der Drehtüreneffekt. So nannte es Stecki. Wenn Patienten immer wieder auf die Station zurückgebracht werden mussten. Und ich wurde Zeuge so einer Begebenheit. Er war früher Vormittag. Ich war gerade erst wieder auf den Beiden, denn nach dem Frühstück war ich wieder mal so müde, dass ich mich wieder hinlegen musste. Da schleusten auf einmal Polizisten jemanden durch die Eingangstür. Ich staunte nicht schlecht, als ich die Person wieder erkannte. Es war Helga. Die Helga, die gerne im Hof tänzelte und so sehr weiße Schokolade liebte. Doch sie war nicht so wie sonst. Etwas stimmte nicht mit ihr. Ws war nicht die Helga, die einen die Zeit schnell vergessen lies. Durch ihre Brille, die sie anhatte wirkte sie ernster. Sie war ruhiger und gefasster. Ja, sie wirkte sogar melancholisiert. „Hallo Lukas“ – sagte sie leise und zurückhaltend. „Was ist vorgefallen?“ – fragte ich verwundert. „Nichts, die Polizisten waren so nett zu mir und brachten mich hierher“. Sie senkte ihren Kopf und schaute nach unten. Ich konnte es nicht länger ertragen. Ich griff nach ihrem Arm. Meine Finger umfasste der ihre. So wie sie vor einigen Tagen bei mir tat. Sie schaute wieder hoch. Ich beobachtete ihr Gesicht. Nach einer Weile änderte sich ihre Miene und ihre Lippen formten sich zu einem schüchternen Lächeln. Aus dem Lächeln erwuchs ein Lachen. Uns aus dem Lachen wurde schließlich ein Laut, der eine Mischung aus Gackern und Piepen war. Sie kugelte sich fast vor Freude. Kurz darauf tänzelte sie wieder zur Radiomusik. Das war die Helga, wie wir sie kannten! Am selben Tag stand mein chirurgisches Vorgespräch auf dem Terminkalender. Der Umstand, dass meine Eltern mich begleiten, freute die Stationsleitung. So mussten sie keine Aufsicht entbehren. Der Termin war auf 14:00 Uhr angesetzt. Wir meldeten uns ordnungsgemäß an, setzten uns aber in den falschen Warteraum, was wir erst nach über einer Stunde merkten. Ich wies die zuständige Schwester daraufhin; in Sorge, dass wir bereits aufgerufen wurden und den Termin verpasst haben. „Keine Sorge“ – beruhigte uns die Schwester „Hier hat sich nichts getan“. Im Warteraum befanden sich außer uns, vier Personen. Ein Gipfbeiniger, ein Rollstuhlfahrer und zwei junge Buschen. Im Flur war ein wehleidiges Wimmern zu hören. Kein Gespenst, sondern eine alte Frau, am Bett gefesselt, war alleine in einem Zimmer, dessen Tür offen war. Mehr als eineinhalb Stunden begleitete uns ihr Klagen. Etwa um dieser Zeit wurde der Rollstuhlfahrer aufgerufen. Die jungen Burschen waren sichtlich gelangweilt. Sie verstrichen sich die Zeit mit Scherzen und Unfug. Nach zwei Stunden verging ihnen das lachen aber auch und sie verließen den Warteraum, ohne aufgerufen worden zu sein. Nach drei Stunden verlor auch der Mann mit dem Gipsbein die geduld und ging. Nach dreieinhalb Stunden erst wurde unser Warten belohnt. Der Termin wurde auf den Montag gelegt. Ich sollte endlich operiert werden. Zwölfter Tag Ich hatte mir erhofft, Helgas Anwesenheit würde mir die Lebensgeister wecken. Aber meine Erschöpfung hielt an. Nur am späten Nachmittag war ich einigermaßen wach und konzentriert. Wir scherzten über MedikamenteBärbel und ich hatten die Idee gehabt, alle „Smarties“ In einem Wasserbottich zu schmeißen, aufzulösen und davon zu kosten. Wir erhofften uns eine halluzigene Wirkung, was eine recht optimistische Erwartung war. Man musste viel eher mit Herzrasen und Schwindelgefühl rechnen. Im unspektakularischen Fall mit Übelkeit. Ich jedenfalls habe mich die ganze Zeit geärgert, dass ich von Zyprexa augenblicklich gähnen musste und schläfrig wurde. Aber ich war mir sicher, der Ärztin schlechtes zu wünschen, nachdem ich hörte, dass mein OP-Termin auf ein Mal um eine Woche verschoben wurde. Es bestand die Möglichkeit, so erklärte man mir, dass ich einen Schlauch bekommen musste, damit das Blut aus der Wunde abfließen könnte. Dies wurde Patienten verunsichern, so dass sie mir den Schlauch versuchen würden fortzureißen. Meine Frage, warum Frau W. einen Infusionsschlauch mit sich führte, wurde abgewimmelt. Die Chirurgie aber hätte nicht die Möglichkeit gehabt, mich nach der Operation „psychologisch zu versorgen…!“ Dreizehnter Tag Es war vormittags und ich schrieb gerade an meinen Aufzeichnungen. Da klopfte es an meiner Tür. Die Türklinge wurde runtergedrückt. Es traten zwei Personen herein. Die erste war eine Pflegerin, die zweite war ein mürrisch und streng dreinblickender Mann mit Brille und kariertem Anzug. Es schaute mich skeptisch an. Ich hatte das Gefühl, es wäre aus einem beruflichen und offiziellen Anlass hier. War er ein Richter? Ein Beamter? Ein Gutachter? Oder vielleicht ein Psychologe? „Herr U., dies ist Herr V.“ – sprach die Schwester endlich. „Er wird für eine Nacht Ihr Zimmergenosse sein“ Ich grüsste ihn und wir beide gaben uns die Hand. Die Schwester zog sich zurück. „Um eines klar zu stellen“ – sprach der Herr V. im energischen, ja gerade befahls…. Ton „Ich bin hier, um zu schlafen. Ich will Sie nicht stören. Sie aber dürfen mich stören“ „Ist gut, ich werde Sie nicht daran hindern“ – erwiderte ich. „Versichern Sie mir, dass ich Sie nicht Ihrer Freiheit beraube?“ Ich wunderte mich über die Frage und verneinte. Immerhin wusste der Kerl, dass er manchen Personen auf den Wecker gehen konnte, wenn seine wahrscheinlich exzentrischen Verhaltenmuster zu Tage legte und andere damit konfrontierte. Er begann sich zu entkleiden und fragte welcher Schrank frei sei. „Der rechte. Sie können bei der Kanzel einen Schlüssel ausleihen“ Er schaute mich finster an, musterte mich von Kopf bis Fuß. „Sie werden auf die Sachen aufpassen. Ich vertraue Ihnen“ – sagte er knapp. Er zog sein Jackett aus, knöpfte dann sein Hemd auf. Unter seiner Kleidung entblößte sich ein kurzarmiges Feinripphemd. „Ich wollte Sie nur warnen. Ich dusche nur freitags. Mein Körper stinkt.“ Ich antwortete ihm, dass es mir egal sei, ich werde auch nicht täglich duschen. „Ich tue dies aber aus religiöser Überzeugung“ – sagte er „Ich sage mir immer: Im Schweiße meiner Arbeit“ – ergänzte er. „Auch das stört mich nicht“ Er zog die Hosen aus und hing die Socken offensichtlich im Schrank auf. Dann legte es sich ins Bett hinein. Dort lag er für mehrere Minuten reglos. Als dann einen andere Schwester ins Zimmer trat, hob er flink seinen Kopf und sagte „Für Sie gibt es keine Krankenkassennummer. Ich rechne mit Ihnen privat ab“. Nach kurzem Hin und Her gab sich die Schwester zufrieden und ging wieder. Daraufhin fragte Herr V. „Wie viel der Aufenthalt in diesem Krankenhaus kosten würde“ „Ich habe mir sagen lassen bis zu mehreren hundert Euro“ „Tausend werden wohl reichen“ – sagte er ernst. Ich hörte Klimpern und einen Wagen rollen. Das Mittagessen wird angeliefert. Ich sagte dies auch den Herrn V. „Ich bin hier zum Schlafen, nicht zum Essen. Das Essen ist hier eh ein Fraß“ – sagte er erwütend. „Zugegeben, der Joghurt ist mit Aroma und Farbstoff bearbeitet, aber der Rest geht doch“ „Ja, wenn man von Joghurt spricht. sein ganzer Produktionszyklus ist widernatürlich“ Das hielt mich natürlich nicht von Essen ab. Ich ging, wie die anderen auch, während er im Zimmer liegen blieb. Er rollte sich seitwärts zur Wand hin. Sein Hinter …. Unter der Decke hervor. Nach dem Essen schlich ich mich wieder ins Zimmer herein. Ich kritzelte an meinen Unterlagen. Ich hörte gerade wie ein anderer Mann auf die Station gebracht wurde. Ihm wurde erklärt, wie das Badezimmer funktionierte. Die Tür zum Bad stand offen, so konnte ich jedes Wort aus dem benachbarten Raum hören. Das Weckte den Herr V., wenn er denn überhaupt eingeschlafen war. „Glauben Sie, dass ich hier einschlafen kann?“ „Sie können sich ja ein Schlafmittel verabreichen lassen. Heute ist die Oberarztvisite“ Er sprang aus dem Bett, kleidete sich wieder an und marschierte Schnurstracks zur Kanzel. Dort wurde sein Begehren abgelehnt. Es sei ja schließlich heiligster Tag. Der sei nicht zum Schlafen. Auch die Betonung, dass es Privatpatient wäre, überzeugte das Personal nicht. Nun gut, darauf wollte er einen Kaffee. Aber nicht das widerliche Zeig, sondern seinen eigenen, denn er in seiner Tasche mit sich führte. Ob dem stattgegeben wurde, vermag ich nicht sagen, aber er kehrte noch einen in mein Zimmer zurück, wo er eine Erörterung über das Universum begann: „Zunächst aber holte es seine Geldbörse raus. Es wühlte darin herum und legte mir ein 5-Euroschein auf den Tisch. „Leg die in die Spendenschale in der Petri-Kirche in der Mönckebergstr. Sie werden mir dort den Schein wiedergeben“ „Ich darf aber nicht heraus“ – sagte ich. „Morgen darfst du raus um 11:30 Uhr auf den Rathhausmarkt. Weißt du wann ich raus darf?“ Ich zuckte mit den Schultern So wie der sich benahm, wohl noch eine ganze Weile nicht. „ Es hat was mit den Urknall zu tun. Alles hat damit zu tun. Das Universum dehnt sich aus, aber verschieden schnell. Was hat das zu Folge?“ Ich überlegte eine Weile. Würden nach seiner Theorie die Sternsysteme sich gleich schnell bewegen, würden alle Ereignisse in der Geschichte zeitgleich ablaufen. Die Kausalität würde in vielen Fällen wegfallen, oder die Zahl der Ereignisse würde sich drastisch veringern. „Sehen wir es mal so, ich bin schneller draußen ais du“ stellte er fest. Das Duzen kam recht plötzlich, irritierte mich aber nicht. „Auch die Gedanken bewegen sich zeitversetzt. Deswegen bin ich heute dazu gekommen und du warst schon hier, Was heißt das?“ Er schaute zu mir hoch, als er sah, dass ich nichts verstand, worauf er hinauswollte, erzählte er weiter. „Das bedeutet alles Gedanken sind ...endlich“ Nun dem würde so nach einer zustimmen, aber die Verknüpfung mit der Materie und Energie im All blieb mir unergründlich. Würden sich Gedanken durch den Urknall fortbewegen wie Masse im Kopf, dann würde sie unendlich und stetig in der Leere in Bewegung sein, wenn sie nicht in einer Athmophäre haften bleiben“ Er erzählte noch eine Weile weiter, ich konnte dem Gesprächlauf nicht weiter folgen.. Kurz darauf redete er nämlich von unendlichem Gedanke, Ich fragte, welcher das sei „Der Gedanke der ewigen Liebe“ Er wollte darauf gehen, faselte was von Religion und das ich was darüber schreiben sollte. Ich fragte was. „In Tansania haben sie die ältesten Götterbilder. Wenn die Menschen ein Ritual feiern, wäre das ein weltweiter Glaubenerkenntnis für die Menschheit.“ Der Herr verlangte wenig später gehen zu dürfen. Und tatsächlich ging er ca. eine Stunden später. Vierzehnter Tag „Frau B, sie haben sich schon wieder verspätet. Sie haben uns doch versprochen in einer Stunde wieder hier zu sein“ „Ich war in einem Gespräch vertieft. Da habe ich die Zeit vergessen, Dann waren diese unfreundlichen Schwestern auf einmal da. Welche mit kurzen Haaren und kräftig gebaut. Das hat mich alles an die Nazizeit erinnert…“ Frau B. war stets mindestens zweimal draußen. Fast immer verspätete sie sich, was ihr immer wieder Tadel einbrachte. Aber sie durfte in diesen Tagen die Station verlassen. Auch die schweigsame Anna sollte gehen. So dass diese Station recht leer wurde. Am Wochenende schien hier wieder langweilig zu werden. Aber heute würde mir nicht langweilig werden. Ich sollte heute ein Gespräch mit dem Oberarzt haben. Das besondere: Im Beisein von über 20 Studenten, die – wenn ich er erlaubte- fragen stellen durften. Es war zunächst ungewohnt, mich vor soviel Leuten seelisch zu entblößen, aber irgendwie war meine Zunge lockerer als sonst. Die Fragen der Studenten waren sogar recht tiefgründig. Der Doktor stellte dagegen nur Standardfragen: „Haben Sie manchmal das Gefühl, sie verschwinden mit Ihrer Umwelt?“ „Ich nehme kein LSD… Fünfzehnter Tag Am Freitag herrschte enormer Betrieb. Nachdem es am Donnerstag, so leer war, dass die Abendrunde nur an einem Tisch Platz fand. Bärbel und ich waren noch erstklassige Gesprächspartner mit einigen Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel einen Ähnlichen Geschmack, was Essen anging. Doch das reichte nicht, um seinen Bedarf an menschlichen Kontakten zu befriedigen. Helga sorgte ab und an für Unterhaltungen, doch sonst war der Alltag trist. Yaw schaute, nachdem er e Tagelang fixiert wurde, von morgens bis abends CNN. Petra und Frau F. waren meist auswärts. Frau C. und Dornröschen dagegen ganz mit sich selbst beschäftigt und kamen nur zum Rauchen aus ihrem Zimmern. Frau W. war bettlägerig und hing an einer Infusion, denn sie wurde zwangsernährt. Melitta war nur abends zu sehen und Frau F. schließlich war wegen ihrer Medikamente zum Teil schwer ansprechbar. Am Freitag aber wurden 6 Patienten neu aufgenommen. Das Personal war den ganzen Tag auf den Beinen. An meiner Tür klopfte es zur Mittagszeit. Es war ein kleiner Mann, dunkelhaarig und dunkelhäutig. Seine Beine mussten wohl vor längerer Zeit zu schaden gekommen sein, denn er bewegte sich fort wie ein Pinguin. Mit kleinen Schritten watschelte er ins Zimmer. „ Hallo, ich heiße Ali, wie geht’s dir?“ – sagte mit starkem Akzent. Ich reichte ihm die Hand und sagte, dass es mir sehr gut ginge. „Sehr gut. Dankeschön“ – plapperte er erfreut und verbeugte sich. Der etwas ältere Iraner, der ständig grüßte und sich ständig für etwas bedankte, verbrachte die ersten Stunden fernzusehen. Yaw saß im Fernsehzimmer. Er war schlecht gelaunt, weil er schon so lange ohne Ausgang eingesperrt wurde. Elizar, so hieß Ali in Wirklichkeit, lies sich nicht daran stören und schaute die CNN-Nachrichten. Schon bald fand er Anschluss zu den anderen. War er doch politisch gebildet und reflektierte aktuelle politische Ereignisse. „Israel geht kaputt durch Erdbeben“ – erzählte es erfreut in der Abendrunde. „Ich mache weg, Ich bin Jesus“ „Meinen Sie nicht eher ein Erdbeben in Ihrem Kopf?“ – fragte der Pfleger frech. Von dann an begnügte er sich damit andere nach ihrem Wohlbefinden zu fragen. Jedem wünschte er in der Früh einen guten Morgen, Bei jeder Mahlzeit wünschte er allen einen guten Appetit. Und den hatte er!!!! Das Essen, das er bekam war tatsächlich knapp bemessen. So naschte er gerne bei anderen mit. Ob ein übrig gebliebener Brot, eine Tütensuppe oder Schokolade. Wenn man ihm etwas anbot, griff er gierig zu und verschlang es. So, dass er schließlich die Rationen vergrößert bekam. „Dankeschön! Vielen Dank!“ Und ein Lächeln waren seine Reaktion. Trotzdem hortete es alles, was er nicht sofort verspeiste im Zimmer. Bärbel, die in der letzten Zeit kaum Appetit hatte, gab einmal Elizar ihr ganzes Abendbrot zu essen. Er war somit ein freundlicher, wenn auch etwas anstrengendes Zeitgenosse. Dafür hilfsbereit. Manchmal war er aber auch in sich gekehrt. Dann sprach er zu sich selbst auf iranisch und sang. Einmal erzürnte er, oder aber freute er sich ganz besonders. Da zerschlug er draußen im Hof eine Tasse. Helga, die inoffizielle Seelsorgerin der Station, eilte sofort zu ihm und beruhigte ihn erfolgreich. Sie verstanden sich gut. Am Sonntag fand Elizar noch eine Deutschlandkarte. Er fand derart großen Gefallen daran, dass es sie die ganze Zeit an behielt. Nur zum Schlafen setzte er sie ab. Genauso handhabte er mit seiner Lederjacke, die er zum Schlafen zwar auszog, aber sie trotzdem ins Bett nahm als Unterlage. Nachdem das Wochenende vorbei war, kamen seine Pflegerinnen ihn besuchen. Sie sagten, sie wollten ihn bald abholen. Elizar war aber bei uns vollauf zufrieden und wollte gerne noch etwas bleiben