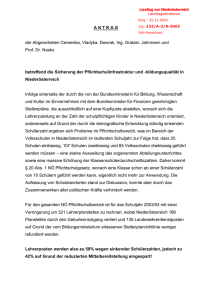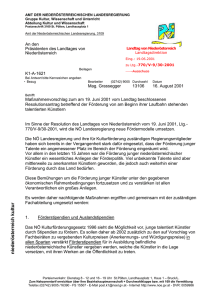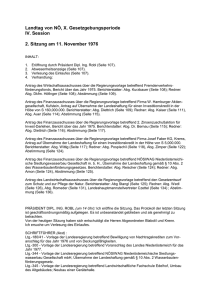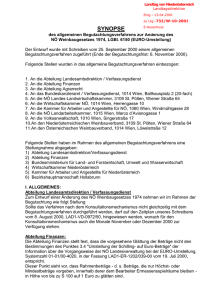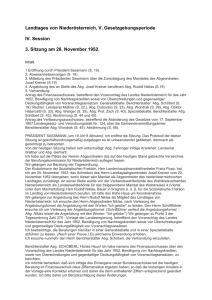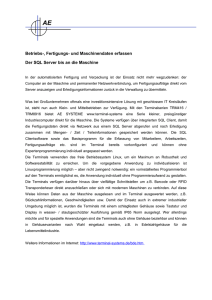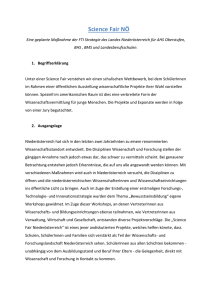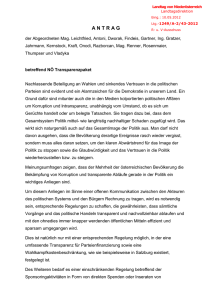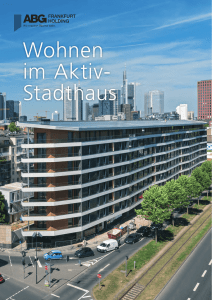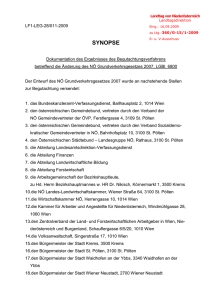Herunterladen des Sitzungsberichtes
Werbung
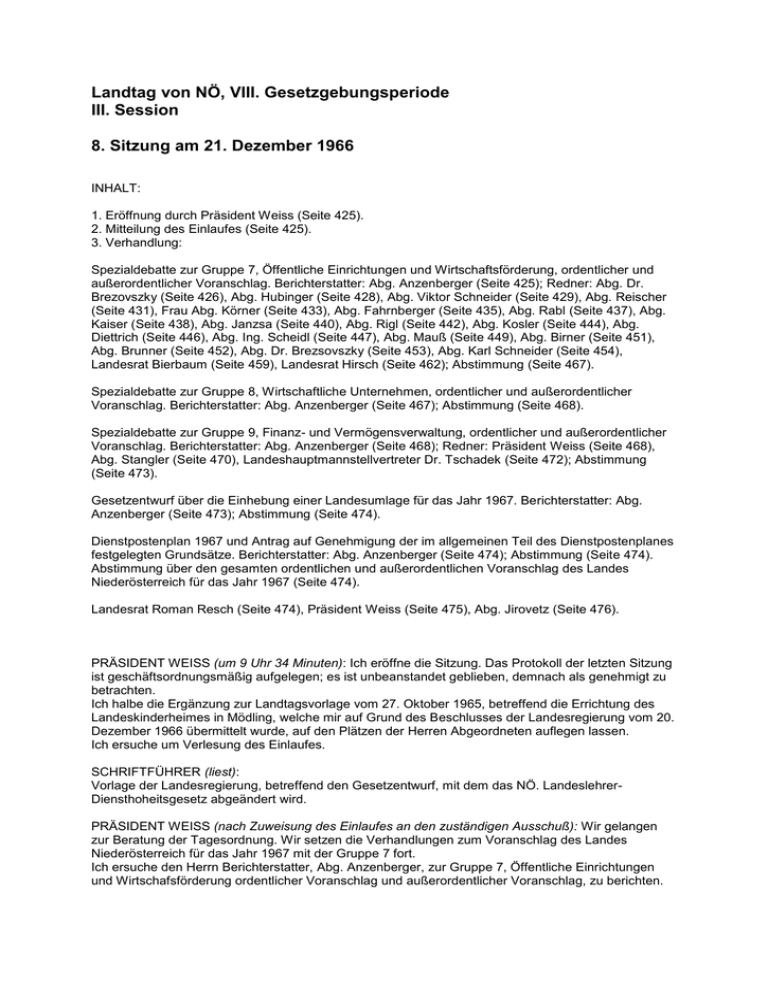
Landtag von NÖ, VIII. Gesetzgebungsperiode III. Session 8. Sitzung am 21. Dezember 1966 INHALT: 1. Eröffnung durch Präsident Weiss (Seite 425). 2. Mitteilung des Einlaufes (Seite 425). 3. Verhandlung: Spezialdebatte zur Gruppe 7, Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung, ordentlicher und außerordentlicher Voranschlag. Berichterstatter: Abg. Anzenberger (Seite 425); Redner: Abg. Dr. Brezovszky (Seite 426), Abg. Hubinger (Seite 428), Abg. Viktor Schneider (Seite 429), Abg. Reischer (Seite 431), Frau Abg. Körner (Seite 433), Abg. Fahrnberger (Seite 435), Abg. Rabl (Seite 437), Abg. Kaiser (Seite 438), Abg. Janzsa (Seite 440), Abg. Rigl (Seite 442), Abg. Kosler (Seite 444), Abg. Diettrich (Seite 446), Abg. Ing. Scheidl (Seite 447), Abg. Mauß (Seite 449), Abg. Birner (Seite 451), Abg. Brunner (Seite 452), Abg. Dr. Brezsovszky (Seite 453), Abg. Karl Schneider (Seite 454), Landesrat Bierbaum (Seite 459), Landesrat Hirsch (Seite 462); Abstimmung (Seite 467). Spezialdebatte zur Gruppe 8, Wirtschaftliche Unternehmen, ordentlicher und außerordentlicher Voranschlag. Berichterstatter: Abg. Anzenberger (Seite 467); Abstimmung (Seite 468). Spezialdebatte zur Gruppe 9, Finanz- und Vermögensverwaltung, ordentlicher und außerordentlicher Voranschlag. Berichterstatter: Abg. Anzenberger (Seite 468); Redner: Präsident Weiss (Seite 468), Abg. Stangler (Seite 470), Landeshauptmannstellvertreter Dr. Tschadek (Seite 472); Abstimmung (Seite 473). Gesetzentwurf über die Einhebung einer Landesumlage für das Jahr 1967. Berichterstatter: Abg. Anzenberger (Seite 473); Abstimmung (Seite 474). Dienstpostenplan 1967 und Antrag auf Genehmigung der im allgemeinen Teil des Dienstpostenplanes festgelegten Grundsätze. Berichterstatter: Abg. Anzenberger (Seite 474); Abstimmung (Seite 474). Abstimmung über den gesamten ordentlichen und außerordentlichen Voranschlag des Landes Niederösterreich für das Jahr 1967 (Seite 474). Landesrat Roman Resch (Seite 474), Präsident Weiss (Seite 475), Abg. Jirovetz (Seite 476). PRÄSIDENT WEISS (um 9 Uhr 34 Minuten): Ich eröffne die Sitzung. Das Protokoll der letzten Sitzung ist geschäftsordnungsmäßig aufgelegen; es ist unbeanstandet geblieben, demnach als genehmigt zu betrachten. Ich halbe die Ergänzung zur Landtagsvorlage vom 27. Oktober 1965, betreffend die Errichtung des Landeskinderheimes in Mödling, welche mir auf Grund des Beschlusses der Landesregierung vom 20. Dezember 1966 übermittelt wurde, auf den Plätzen der Herren Abgeordneten auflegen lassen. Ich ersuche um Verlesung des Einlaufes. SCHRIFTFÜHRER (liest): Vorlage der Landesregierung, betreffend den Gesetzentwurf, mit dem das NÖ. LandeslehrerDiensthoheitsgesetz abgeändert wird. PRÄSIDENT WEISS (nach Zuweisung des Einlaufes an den zuständigen Ausschuß): Wir gelangen zur Beratung der Tagesordnung. Wir setzen die Verhandlungen zum Voranschlag des Landes Niederösterreich für das Jahr 1967 mit der Gruppe 7 fort. Ich ersuche den Herrn Berichterstatter, Abg. Anzenberger, zur Gruppe 7, Öffentliche Einrichtungen und Wirtschafsförderung ordentlicher Voranschlag und außerordentlicher Voranschlag, zu berichten. Berichterstatter Abg. ANZENBERGER: Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich berichte zur Gruppe 7: In der G r u p p e 7, Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung, betragen die Ausgaben S 249,581.000 und die entsprechenden Einnahmen S 64,589.000, so daß das Nettoerfordernis S 184,992.000 beträgt. In dieser Gruppe kommen die Gebarungsvorgänge, welche der allgemeinen Verwaltung dieser Belange, den öffentlichen Einrichtungen, der Förderung der Land- und Forstwirtschaft, den Einrichtungen zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft, der Förderung der gewerblichen Wirtschaft, der Fremdenverkehrsförderung und sonstigen Aufwendungen dieser Art dienen, zur Verrechnung. Die Ausgaben umfassen 9,7 Prozent des Gesamtaufwandes, während die des Vorjahres 10,8 Prozent darstellten. Die Ausgaben dieser Gruppe zeigen eine Steigerung um rund 10,3 Millionen S. Hievon betreffen rund 7,2 Millionen S den Personalaufwand und rund 3,1 Millionen S den Sachaufwand. Neu in den Voranschlag aufgenommen wurde der Voranschlagsansatz 7319-611, Zuschüsse zu den Kosten für agrarische Operationen, sowie die Voranschlagsansätze 75-62, Landesbeitrag an den Wirtschaftsförderungsfonds, und 770-62, Landesbeitrag an den Fremdenverkehrsförderungsfonds, wobei in allen Fällen keine Erhöhung des Ausgabenkreditrahmens eintrat. Die Erhöhung des Sachaufwandes betreffen vor allem die Voranschlagsansätze 7319-68, zur Verfügung der niederösterreichischen Landes-Landwirtschaftskammer, mit 3 Millionen S, 7410-61, Sachaufwand der landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen, mit 1 Million S, die Voranschlagsansätze 7410-750, 7410-751, 7420-750 und 7420-751, 50prozentiger Ersatz des Landes an den Bund zu den Aktivitätsbezügen der Lehrer an landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen, mit zusammen rund 1,2 Millionen S, 75-66, Zuschüsse zur Errichtung und Erhaltung von Lehrlingsheimen und für Lehrlingsausbildung, mit 0,5 Millionen S, 770-64, Landesbeitrag zum Zinsendienst für die Fremdenverkehrskreditaktion, mit 0,3 Millionen S, und 79-62, Aufwendungen für das Feuerlöschwesen, mit 1,3 Millionen S. Eine Erhöhung um rund 0,8 Millionen S ergibt auch der Sachaufwand der Landesbauhöfe. Verminderungen erfuhren die Voranschlagsansätze betreffend die Bekämpfung der Rinder- und Ziegentuberkulose um rund 0,7 Millionen S, Bangseuchenbekämpfung, Sachaufwand, um rund 0,2 Millionen S, und betreffend Iden Zuschuß an den niederösterreichischen landwirtschaftlichen Wohnbauförderungsfonds aus zweckgebundenen Einnahmen um 2 Millionen 5. Weggefallen sind die Ansätze ,,Bodenschutzmaßnahmen, Kraftfahrwesen", „Bauhof in Waidhofen an der Ybbs" und ,,Ausbau der land- und forstwirtschaftlichen Fortbildungsschulen, Zuschüsse zur Errichtung von Internaten". Die Einnahmen erhöhen sich um rund 3,5 Millionen S. Diese Erhöhungen bringen vor allem die Bauhöfe mit rund 1,5 Millionen Schilling, die bäuerlichen Fachschulen mit rund 0,3 Millionen S, der Fremdenverkehrsförderungsfonds mit rund 1,1 Millionen S und die Landesfeuerwehrschule in Tulln mit rund 0,4 Millionen S. Neu in den Voranschlag aufgenommen wurden die Voranschlagsansätze 731436, Bodenschutzmaßnahmen, Miete und Pacht, und 7452, Landesbauhof in Laa an der Thaya. Die Beiträge zu den Kosten der Be- und Entwässerung stellen die Landesbeiträge dar, neben denen Bundes- und Interessentenbeiträge für die einzelnen Bauvorhaben geleistet werden. Das ergibt, daß mit den 10 Millionen S Landesbeiträgen Bauvorhaben in der Höhe von 46 Millionen S durchgeführt werden können. In der Gruppe 7 wird aus gebarungstechnischen Gründen die Notwendigkeit gegeben sein, verschiedene Voranschlagsansätze als gegenseitig deckungsfähig zu erklären. Des weiteren sind Zweckbindungen von Einnahmebetragen zu verfügen. In der Gruppe 7 sind die außerordentlichen Ausgaben mit 19,500.000 S veranschlagt. Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Verhandlungen zur Gruppe 7 einzuleiten. PRÄSIDENT WEISS: Als erster Redner kommt Herr Abg. Dr. B r e z o v s k y zum Wort. Abg. Dr. BREZOVSKY: Herr Präsident! Hohes Haus! Sehr geschätzte Damen und Herren! In der Gruppe 7, Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung, finden wir unter mehreren Voranschlagsansätzen Ausgaben für das Feuerlöschwesen und die Ausrüstung der Feuerwehren. Die Landesfeuerwehrschule in Tulln hat gleich hohe Einnahmen wie Ausgaben, so daß hiezu nicht viel zu sagen sein wird, um so mehr, als ja die Landesfeuerwehrschule Tulln durch die Tätigkeit des Finanzkontrollausschusses in Zukunft die Abgeordneten dieses Hohen Hauses noch beschäftigen wird. Im Voranschlagsansatz 79-62 sieht man ständig steigende Aufwendungen für das Feuerlöschwesen, was ja auch durch die Modernisierung der Feuerwehren gerechtfertigt erscheint. Nun können wir heuer feststellen, daß 14 Millionen Schilling im Gegensatz zum Vorjahr, wo nur 12,704.000 S vorgesehen waren, enthalten sind. Auch diese Posten finden erfreulicherweise die Zustimmung beider Parteien, so wie überhaupt festzustellen ist, daß das Feuerwehrwesen politisch außer jedem Streit steht. Wir alle wissen, daß das niederösterreichische Feuerwehrwesen im Lande, aber auch international voll anerkannt wird; und gerade das abgelaufene Jahr 1964 zeigte, wie umfangreich die Tätigkeit des Feuerwehrwesens war. Ich darf in diesem Zusammenhang nur auf die Amtlichen Nachrichten der Niederösterreichischen Landesregierung vom 15. Dezember 1966, Seite 2, hinweisen, die eine sehr stolze Leistungsbilanz der Feuerwehren aufzeigen. Besonders freut es uns Niederösterreicher, daß in Jugoslawien in Karlovac die Feuerwehren aus Mistelbach und Obergrafendorf Weltmeistertitel erreichen konnten, und wir danken von dieser Stelle aus allen Feuerwehrleuten in Niederösterreich für ihren Einsatz im Dienste unserer niederösterreichischen Bevölkerung. Bedauerlicherweise sind bei diesem Einsatz 67 Feuerwehrleute zu Teil schwer verletzt worden, und ein Feuerwehrmann fand sogar den Tod. Wir danken also dafür und anerkennen diese hervorragende Leistung im Dienste der Nächstenhilfe und wir gratulieren vor dem auch den jungen Feuerwehrleuten zu ihrem hervorragenden Abschneiden bei den Leistungswettkämpfen in Jugoslawien. (Beifall im ganzen Hause.) Ich darf aber nicht verhehlen, 'aß bei den Feuerwehren im Lande seit einiger Zeit eine gewisse Unruhe eingetreten ist, und zwar wunde diese Unruhe durch einen Entwurf eines niederösterreichischen Feuerwehr- und Katastrophenhilfsgesetzes der zuständigen Abteilung des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung hervorgerufen. Es wurde bereits in Vorjahr darauf hingewiesen, daß das Feuerlöschwesen neu geregelt werden soll, und heuer wurde dieser Entwurf ausgesendet. Es wurden in dieser Aussendung einige Festsbellungen getroffen, die einen flammenden Protest des Landesfeuerwehrkommandos hervorgerufen heben, vor allem die Feststellung, daß dieser Entwurf in seiner Grundkonzeption vom Landesfeuerwehrkommando erstellt worden sei. Dagegen verwahrte sich eben das Landesfeuerwehrkommando, denn es erklärte ausdrücklich, daß es in dieser Form keinen Gesetzentwurf ausgearbeitet habe. So heißt es dezidiert in dieser Erklärung; der Entwurf des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung weiche grundsätzlich von dem Grundkonzept der niederösterreichischen Freiwilligen Feuerwehren ab. Es seien die Feuerpolizeiordnung und das Gesetz über den Landesfeuerwehrbeirat vor Aussendung des Entwurfes nicht beachtet worden, der Entwurf hätte mit der Feuerwehr nur mehr indirekt zu tun. Und dann eine sehr harte Kritik: Eine Aufsplitterung der Materie auf einige Gesetze ist widersinnig. Durch den neuen Entwurf eines Feuerwehrgesetzes wird auch die Autonomie der Feuerwehren irgendwie beseitigt, außerdem enthält dieser Entwurf 11 Verordnungsdelegationen, welche letztlich 3000 Einzelverordnungen erforderlich machen würden. Bei einer derartige Einschränkung der Autonomie und der Willensbildung der Feuerwehren und des Landesfeuerwehrverbandes werden sich kaum mehr verantwortungsbewußte Funktionäre als ausführende Organe finden. Auch werde eine steigende Überwachung der Feuerwehren durch Fachbeamte erwogen, dabei hätte sich schon in der Vergangenheit herausgestellt, daß es nicht einmal möglich war, für die Landesfeuerwehrschule in Tulln Iden geeigneten Fachbeamten der Gruppe A zu finden, und nur mit Mühe und Not sei ein BBeamter für diese Funktion gefunden worden. Wenn man diese Stellungnahme des Landesfeuerwehrkommandos liest, so klingt dies wie ein Sirenengeheul bei höchster Gefahr für die Freiwilligen Feuerwehren. Aber auch die sozialistischen Gemeindevertreter, vertreten durch den sozialistischen Gemeindevertreterverband, sind nicht minder besorgt bezüglich dieses Entwurfes, und zwar deshalb, weil durch diesen Entwurf eine zusätzliche Belastung für die Gemeinden hervorgerufen werden würde. Da hier außerdem Dinge enthalten sind, die den Gemeinden, vor allem den Bürgermeistern, so meint der sozialistische Gemeindevertreterverband, eine Verantwortung übertragen, die aus rein praktischen und sachlichen Erwägungen nicht voll zu tragen wäre. Er glaubt, daß jemand das auf freiwilliger Basis ausgebaute Feuerwehrwesen durch eine übermäßige bürokratische Bevormundung in Zukunft belasten würde. Ich glaube, wir hätten dann in den Dörfern und Städten nicht mehr die Sicherheit, daß diese Feuerwehren so klaglos funktionieren, wie es bisher der Fall war. Es kann niemand gegen eine gewisse Koordinierung des Feuerwehrwes- sein, da ja die Anschaffung der modernen Feuerwehrgeräte immense Kosten erfordert. Ich weiß das aus meiner Heimatgemeinde Untersiebenbrunn. Wir haben in den letzten Jahren nahezu 1 Million Schilling aufgewendet für die Ausstattung der Feuerwehr mit einem modernen Gerätehaus, mit einem Tanklöschwagen, mit Funkgeräten und verschiedenen anderen Dingen. Ich weiß, wie groß der Einsatz der Gemeinden bisher schon für die Feuerwehren war. Sicherlich ist es gerechtfertigt, in der modernen Zeit eine Organisation zur Verfügung zu haben, die den Erfordernissen Rechnung trägt und außerdem Kosten erspart. Aber man soll die Feuerwehr und auch die Gemeinden nicht überfordern, sonst untergräbt man die Basis des bisher guten Funktionierens der Feuerwehren beim Katastropheneinsatz und bei sonstigen Gelegenheiten. Freiwilligkeit verträgt keine übermäßige Verbürokratisierung, denn jeder weiß, daß Verbürokratisierung Zwang bedeutet. Und Freiwilligkeit und Zwang stehen sich gegenüber wie Feuer und Wasser. Man schüre daher nicht das Feuer des Zwangs, sonst könnte das Wasser der Freiwilligkeit ausbleiben, zum Schaden unserer bisher so gut geschützten Bevölkerung. Ich möchte nun abschließend noch zu einem anderen Problem kurz Stellung nehmen, nämlich zum Landarbeitsgesetz und zum land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz, und zwar hinsichtlich der fehlenden Ausführungsgesetze. Wir alle wissen, daß bereits am 14. Juli vom Nationalrat Novellen verabschiedet wurden. Darin wurden die Landtage beauftragt, innerhalb von sechs Monaten Landesausführungsgesetze zu beschließen. Obwohl seit diesem Zeitpunkt nahezu 1 1/2 Jahre verstrichen sind, also nahezu 12 Monate mehr als der Gesetzgeber . dem Landtag aufgetragen hat, ist noch immer ein solches Ausführungsgesetz nicht erlassen worden. Ich erlaube mir daher, einen Resolutionsantrag zur Gruppe 7 des ordentlichen Voranschlages des Landes Niederösterreich für das Jahr 1967 zu stellen, welcher lautet (liest): „Der Bundesgesetzgeber hat mit zwei Bundesgesetzen vom 14. Juli 1965, BGBL Nr. 238 und 239, die von ihm aufgestellten Grundsätze lauf dem Gebiete des Arbeitsrechtes in der Land und Forstwirtschaft sowie hinsichtlich der Berufsausbildung der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft abgeändert. Da die den Landesgesetzgebern zur Erlassung der Ausführungsgesetze aufgetragene Frist von jeweils 6 Monaten längst überschritten ist, wird die Landesregierung aufgefordert, dem Landtag ehestens Gesetzesvorlagen über die in Frage kommende Materie zur Beratung und Beschlußfassung vorzulegen." Ich bitte das Hohe Haus, diesem Resolutionsantrag die Zustimmung zu geben. (Beifall bei der SPÖ.) PRÄSIDENT WIEISS: Zum Worte kommt Herr Abgeordneter H u b i n g e r. Abg. HUBINGER: Herr Präsident, Hohes Haus, meine Damen und Herren! Mein Vorredner, Dr. Brezovsky, hat auf die internationalen Wettkämpfe hingewiesen, bei welchen sich unsere Feuerwehren heuer ausgezeichnet haben. Bei .den dritten internationalen Wettkämpfen in Karlovac in Jugoslawien sind 13 Nationen angetreten, um im edlen Wettstreit das Beste zu leisten und zu zeigen, wie sich die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren auswirkt. Mit Stolz können wir Niederösterreicher - und ich aus dem Bezirk Mistelbach besonders - darauf hinweisen, daß von 10 Gruppen, die aus Österreich angetreten sind, die Mistelbacher und Grafenbacher Wehren die ersten Plätze bei diesen Wettkämpfen erreichten und somit Österreich auch auf diesem Gebiete führend war. Wir können unseren braven Männern der Wehr herzlich gratulieren, aber nicht nur jenen, die dort zu den Wettkämpfen angetreten sind, sondern darüber hinaus allen, bis zum letzten Mann, die hier so Vorbildliches leisten. Denken wir doch daran, daß 60.000 Männer freiwillig ihren Dienst versehen und als „Armee der freiwilligen Helfer der Nächstenliebe in unserem Lande" - ohne Rücksicht auf Partei und Stand - ihrem Wahlspruch ,,Gott zur Ehr', dem Nächsten zur Wehr" gemäß ihre Pflicht erfüllen. Um aber diese Pflicht erfüllen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Das Industriezeitalter, die moderne Technik erfordern auch moderne Ausrüstungen. Wenn wir unsere heutige Feuerwehr mit der vor 10 oder 20 Jahren vergleichen, müssen wir hier eine Änderung feststellen, welche sich nur zugunsten der Bedrängten auswirkt. Stehen doch Über 1300 Kraftfahrzeuge zur Verfügung, und das modernste Löschfahrzeug, der Tanklöschwagen, wird gerade bei Bränden, die in der chemischen Industrie auftreten oder in anderen Betrieben, die besonders entzündliche Artikel herstellen, von ausschlaggebender Bedeutung sein. Durch diese Tanklöschwagen konnten bereits große Schäden verhindert werden. Aber auch der Katastrophendienst sei hier besonders erwähnt. Es wurde schon über die Feuerwehrschule in Tulln gesprochen, die in unserem Lande als Zentrum für die Ausbildung des Katastrophendienstes und die Schulung der Feuerwehrmänner dienen soll. Auch hier ist eine Umschichtung feststellbar. Die funkgesteuerten Geräte, die oft unabhängig von einem Anschluß funktionieren, müssen bei Katastrophen rascher als das Telefon Hilfe herbeiholen. Es wurde daher am Sitz jeder Bezirkhauptmannschaft eine Funkfixstation errichtet, die raschest die Feuerwehren verständigen kann; der Stützpunkt ist das Landeseinsatzkommando Tulln. Wie bereits Doktor Brezovsky erwähnte, könnten wir uns mit der Schule in Tulln separat befassen. So zweckmäßig sie ist, so groß ist auch der Mehrbedarf an technischen Ausrüstungen, sie leidet an Platzmangel usw. Aber all das ist ein anderes Kapitel. Auch der Strahlenschutzdienst ist im heutigen Atomzeitalter eine Hauptaufgabe unserer Feuerwehren. Leider mußten wir auch feststellen, daß 97 Mann verunglückt sind, davon einer tödlich,. Wenn wir uns das Gedicht aus unserer Schulzeit in Erinnerung rufen ,,Hoch klingst du, Lied vom braven Mann, wie Orgelton und Glockenklang", so paßt es wohl nirgends besser als auf unsere braven Männer der Feuerwehr, die in selbstlosem Einsatz zur Hilfe des Nächsten jederzeit bereit sind. (Zweiter Präsident Sigmund übernimmt den Vorsitz.) Im letzten Jahr konnten wir über 5500 Einsätze verzeichnen. Es waren zahlreiche Brände, davon 60 Großbrände und viele Mittel- und Kleinbrände, zu bekämpfen. Weiters wurden zahlreiche technische Einsätze, die früher nicht zum Kapitel Feuerwesen zählten, getätigt. Von unseren freiwilligen Helfern wurden nahezu 166.000 Arbeitsstunden im Dienste des Nächsten geleistet. Bedingt durch die Erfolge bei den internationalen Wettkämpfen, geht der Ruf unserer Feuerwehren über die Grenzen unseres Landes hinaus. Als die Katastrophe über italienische Städte hereinbrach, wurden unsere Katastrophenzüge und Alarmeinheiten gerufen. 48 Männer unserer niederösterreichischen Wehren standen dort mit ihrer Spezialausrüstung helfend zur Verfügung und pumpten 20 Millionen Liter Schmutzwasser aus den Wohnungen dieser italienischen Städte. Für die Ausrüstung wurde von den Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer ein Betrag von mehr als 38 Millionen Schilling aufgebracht. Nun einige kurze Bemerkungen zum Feuerschutzgesetz. Diesbezüglich besteht zweifellos einige Beunruhigung. Wir werden uns mit dieser Materie noch sehr eingehend befassen müssen, soll doch ein modernes, der derzeitigen Situation angepaßtes Feuerwehrwesen garantiert werden und die Eigenständigkeit und Freiwilligkeit sowie die Selbsterhaltung der Feuerwehren bewahrt bleiben, damit diese ihre Aufgaben erfüllen können. Es ist alarmierend, daß ein Großteil der Brände durch Kinder verursacht wurde. Vielleicht können wir dadurch mithelfen, daß die Kinder in den Schulen, insbesondere in den höheren Lehrgängen, über Brandgefahren und Brandverhütung aufgeklärt werden; den 35 von Erwachsenen gelegten Bränden stehen 48 Brandlegungen durch Kinder gegenüber. Wir mußten 71 Brände unbekannter Ursache verzeichnen. Die Brandschäden in der Landwirtschaft machen über 20,733.000 Schilling, in der Industrie über 26 Millionen und im Gewerbe mehr als 3 Millionen Schilling aus. Wollen wir auch hier in diesem Hause gemeinsam mitwirken, damit die Schlagkraft unserer Wehren erhalten bleibt und der freiwillige Einsatz unserer Männer nicht nur anerkannt, sondern auch von dieser Stelle aus belohnt wird. Ich danke allen Männern der Feuerwehren Niederösterreichs, die nicht nur heuer im Einsatz standen, sondern auch weiterhin gewillt sind, ihre Pflicht im Dienste der Nächsten getreu zu erfüllen. (Beifall im ganzen Hause.) ZWEITER PRÄSIDENT SIGMUND: Zum Wort gelangt Herr Abg. Viktor S c h n ei d e r. Abg. Viktor SCHNEIDER: Hohes Haus! Ich möchte mich hier zur Gruppe 7 mit den Einrichtungen zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft befassen. Bei genauem Studium der Gruppe 7, die die Förderung und Einrichtung der Land- und Forstwirtschaft betrifft, kann man feststellen, daß sich die Ausgaben für die Förderung um 459.000 Schilling erhöht haben. Aus den Voranschlagsposten bezüglich der Einrichtungen kann man eine Steigerung von 6,933.000 Schilling, also rund 7 Millionen Schilling, entnehmen. Weiters ist festzustellen, daß der Prozentsatz der Gruppe 7 zum Gesamtbudget trotz der veranschlagten Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr von 10,8 Prozent auf 9,7 Prozent, also um rund 1 Prozent, gesunken ist. Blättert man jedoch den außerordentlichen Voranschlag zur Gruppe 7 durch, so kann man feststellen, daß für die Landwirtschaft eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rund 8 Millionen Schilling vorgenommen wunde. Diese drückt sich auch im Prozentsatz aus, aber nur bezüglich der Einrichtungen der Land- und Forstwirtschaft. Es wirft sich somit die Frage auf, ob man die nominale Erhöhung der Förderung mit den starken Erhöhungen der Einrichtungen nicht in Einklang bringen kann. Damit ist aber nicht gesagt, daß wir keine landwirtschaftlichen Schulen brauchen, denn um solche handelt es sich ja bei den Einrichtungen; im Gegenteil, wir brauchen sie sogar sehr dringend. Hätten wir keine landwirtschaftlichen Einrichtungen, vor allem landwirtschaftliche Schulen, dann wäre es um unsere Landwirtschaft, wie auch um die gesamte Volkswirtschaft schlecht bestehlt, denn gerade in der Schule wind den jungen Landwirten von morgen jenes Wissen vermittelt, das sie auf dem Gebiete des wirtschaftlichen und technischen Fortschrittes in der heutigen Zeit zur Führung ihres Betriebes unbedingt brauchen. Wir sehen es sehr deutlich an den modernen Produktionsmethoden in der Land- und Forstwirtschaft und vor allem in der Landwirtschaft selbst. Ohne eine landwirtschaftliche Schule wäre es heute nicht möglich, die lebenswichtigen Erfordernisse der Bevölkerung aufzubringen oder, wie der Bauer sagt, den Tisch des Volkes zu decken. Wie man aus der Statistik entnehmen kann, wurden im Jahre 1963/64 82 Prozent des Nahrungsmittelverbrauches des österreichischen Volkes durch die heimische Produktion gedeckt. Im Jahre 1964/65 fiel die heimische Produktion lauf 77 Prozent zurück, was allerdings mit den Katastrophen in Verbindung steht. Hohes Haus! Wir wissen, daß die Förderung der Land- und Forstwirtschaft im Vorjahr auch eine starke Erhöhung aufzuweisen hatte. Wenn ich das Problem der Einrichtungen trotzdem erwähne, so nur deshalb, weil ich der Meinung bin, daß, wenn die Erhöhung der Mittel für die Einrichtungen in der Land- und Forstwirtschaft weiter so anwächst, was wir von Jahr zu Jahr feststellen können, in Zukunft für die Förderung der Land- und Forstwirtschaft zuwenig Geld vorhanden sein wird. Sehr geehrte Damen und Herren! Ich will damit sagen, daß man sich bezüglich der Einrichtungen zur Förderung &der Land- und Forstwirtschaft Gedanken machen soll, ob nicht durch eine Reorganisation des gesamten Fragenkomplexes ähnlich wie bei den Pflichtschulen das stete Anwachsen der Ausgaben vermieden werden kann und man trotzdem den Erkenntnissen und Erfordernissen der modernen Landwirtschaft gerecht wind. Ich nehme an, daß durch den Bau von Internaten, die im außerordentlichen Voranschlag vorgesehen sind, ein kleiner Anfang gemacht worden ist. Man darf nicht glauben, daß die Landwirtschaft keiner Förderung mehr bedarf. Daher glaube ich, daß diese einer Förderung Wahl würdig sind. Dieser kleine Ausschnitt aus der Statistik zeigt, daß es sich in der Mehrzahl nur um kleine und mittlere Betriebe handelt, die aber wesentlich mithelfen, die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen. In Niederösterreich kommt dieses ungleiche Verhältnis zu Großbetrieben noch stärker zum Ausdruck. Wenn wir also in irgendeiner Form in einen großen europäischen Markt eingegliedert werden und dessen Auswirkungen nicht kennen, werden gerade die kleinen und mittleren Betriebe in ihrer Existenz am meisten gefährdet werden. Ich will damit ausdrücken, daß diese Betriebe deshalb in der technischen Entwicklung zurückgeblieben sind, weil sie bei der Förderung nicht immer Berücksichtigung gefunden haben und in bezug auf die betriebliche Größe die finanziellen Grundlagen nicht vorhanden waren. Wenn man die Struktur und die Entwicklung der Landwirtschaft von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, ist eine Förderung der Betriebe unbedingt notwendig, ja für diese sogar lebenswichtig. Es gibt Politiker, die einen raschen Anschluß an die EWG vehement bejahen und den Zusammenschluß als Rettung der Landwirtschaft hinstellen, dabei aber nicht bedenken, welche Auswirkungen daraus für die kleinen und mittleren Betriebe entstehen. Hohes Baus! Es wird sehr viel über die Erhaltung der Familienbetriebe in der Landwirtschaft gesprochen. Gerade der Familienbetrieb muß aber immer wieder Schulden auf sich nehmen; der mittlere Bauernbetrieb muß für Maschineneinkäufe, die zur Erhaltung des Hofes unbedingt notwendig sind, sogar größere Verschuldungen in Kauf nehmen. Die Landwirtschaft hat heute bei einem geschätzten Aktivkapital von 150,9 Milliarden Schilling - das sind 7 Prozent des gesamtösterreichischen Aktivkapitals - insgesamt eine Verschuldung von 10,6 Milliarden Schilling aufzuweisen. Ich glaube daher, daß es vorteilhaft gewesen wäre, wenn der Vorschlag der Sozialisten und des Arbeitsbauernbundes zur Schaffung von Maschinenhöfen Gehör gefunden hätte. Wir Sozialisten vertreten noch immer die Meinung, daß Maschinenhöfe, wie sie im Bundesland Kärnten bestehen, sich sehr segensreich für die Klein- und Mittelbetriebe auswirken; sie werden, wenn eine Annäherung an den europäischen Markt erreicht wird, in Zukunft zur Existenzfrage werden. Hohes Haus! Es wird sehr viel von der Landflucht gesprochen. Hervorragende Experten auf dem Agrarsektor, Wirtschaftswissenschaftler und vor allem die Raumplaner haben jahrelang Untersuchungen darüber angestellt, wie man die Landflucht stoppen kann. Es wunden auf diesem Gebiete brauchbare Vorschläge ausgearbeitet, unter anderem ist auch die Schaffung von Landarbeiterwohnungen zur Debatte gestanden. Ich habe bei weiterer Durchsicht der Gruppe 7 beim Voranschlagsansatz 7412-61 festgestellt, daß zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung von Landarbeitenwohnungen wieder nur ein Betrag von 1,700.000 Schilling eingesetzt ist. Mein Parteifreund und Berufskollege Niklas hat im vergangenen Jahr bei den Budgetberatungen auf das gleiche Problem hingewiesen, daß nämlich von seiten des Landes zuwenig Mittel zur Schaffung von Landarbeiterwohnungen zur Verfügung gestellt werden; auf Bundesebene hingegen werden durch die ERP-Fachkommission für die Land- und Forstwirtschaft Millionenkredite zu einem Zinsfuß wie bei der Wohnbauförderung für die Erbauung von Forstarbeiterwohnungen vergeben. Meiner Meinung nach wurde des weiteren bei den Beträgen zur Bekämpfung der Rindertuberkulose und der Bangseuche sehr gespart; wir sind in Niederösterreich noch lange nicht mit der Bekämpfung dieser beiden Seuchen zu Ende. Je rascher wir diese Seuchen bekämpfen, um so besser wird sich dies auf die Gesunderhaltung unseres Viehs auswirken. Auch bei der Wohnbauförderung können wir eine kleine Reduzierung feststellen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum in der Erläuterung zum Voranschlag auf Seite 14 am Schluß des 2. Absatzes der Hinweis gegeben wird, daß zu dem Zuschuß .an den niederösterreichischen landwirtschaftlichen Wohnbauförderungsfonds aus zweckgebundenen Einnahmen nur deshalb 2 Millionen Schilling weniger eingesetzt sind, weil die Darlehensrückflüsse eine sinkende Tendenz aufweisen. Wir wissen doch, daß jedes Jahr viele Millionen für die landwirtschaftliche Wohnbauförderung ausgegeben wenden; das beweist auch der Rechnungsabschluß. Ich bin auch hier der Meinung, daß die landwirtschaftliche Wohnbauförderung zur Besitzfestigung wie auch zur Erhaltung der Familienbetriebe ihren Beitrag leistet. Auch bei den landwirtschaftlichen Wegebauten erscheint mir der Ansatz zu niedrig. Die Erschließung abgelegener Bauernhöfe durch Zufahrtswege dient nicht nur der Besitzfestigung, sie ist auch für den Fremdenverkehr von großer Bedeutung. Der Städter, der heute durch die fortschreitende Motorisierung manche mondäne Urlaubsorte aufsuchte und dort nicht die gewünschte Erholung gefunden hat, sehnt sich dann nach Ruhe, die er nur in einem einfachen Bauernhof finden kann. Für den Bergbauern in unserer schönen Gebirgsgegend bedeutet das eine Einnahmequelle, die für seine weitere Existenz oft von ausschlaggebender Bedeutung sein kann. Bei den Ansätzen für Be- und Entwässerung konnte ich feststellen, daß hier der gleiche Betrag wie im Vorjahr eingesetzt ist, nämlich 10 Millionen Schilling. Meine Damen und Herren! Ich habe in meinen Betrachtungen über die Gruppe 7 einige Probleme berührt, die im Interesse der Land- und Forstwirtschaft gelegen sind. Ein erfreulicher Lichtblick zeigt, daß man der Landwirtschaft großes Verständnis entgegenbringt. Es konnte trotz großer Meinungsverschiedenheiten der beiden großen Parteien bei Iden Marktordnungsgesetzen auf Bundesebene eine Einigung erzielt werden. Ich glaube, daß gerade die Marktordnungsgesetze für die Landwirtschaft eine Lebensnotwendigkeit darstellen. Das beweist uns, daß die Sozialisten die Arbeit der Bauern anerkennen und mithelfen, ihre finanzielle Basis zu sichern. Die Sozialisten haben als erste den sozialen Fortschritt der Bauern vertreten. Ich verweise nur auf die Schaffung des Zuschussrentenversicherungsgesetzes und der Bauernkrankenkasse. Wir vertreten weiter die Ansicht, daß jeder, ob Arbeiter, Rauer oder Gewerbetreibender, für dieses unser Österreich arbeiten soll. Wir haben für dieses herrliche Land gekämpft, wir wollen es uns erhalten und weiter ausbauen. (Beifall bei der SPÖ.) ZWEITER PRÄSIDENT SIGMUND: Zum Wort gelangt Herr Abg. R e i s c h e r. Abg. REISCHER: Herr Präsident! Hohes Haus! Herr Abg. Dr. Brezovsky hat gestern erklärt, daß er es unter seiner Würde findet, auf meine Ausführungen einzugehen, obwohl ich nur die Ausführungen seines Klubkollegen Grünzweig kommentiert habe. Nun, Herr Abg. Brezwdy, ich weiß sehr genau, wann Sie würdevoll und vornehm werden, nämlich darin, wenn Sie Ihre mehr oder weniger gepfefferten Aussprache im Hohen Hause an den Mann gebracht haben. Ich mache mir das einfacher und halte es mit den Aussprüchen unserer Waldbauern und Forstarbeiter, die sagen - ich sage es doch anders: Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es heraus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Bedeutung der Forstwirtschaft, von der man im allgemeinen nicht viel spricht, wird meist im Zusammenhang mit Hochwasserkatastrophen offenkundig. Ich muß sagen, daß dann die Fragen der Forstwirtschaft nicht immer sehr objektiv behandelt werden. Ich möchte also dem Hohen Hause heuer die Bedeutung der Forstwirtschaft für das Land Niederösterreich an Hand einiger Zahlen demonstrieren. 36 Prozent der Fläche Niederösterreichs sind mit Wald bedeckt, und der Einschlag beläuft sich auf 2 Millionen Festmeter Holz, wovon wieder 1,4 Millionen Festmeter Nutzholz und 600.000 Festmeter Brennholz anfallen. Die Forstwirtschaft beschäftigt derzeit 3F00 ständige und 3000 nichtständige Forstarbeiter, dazu kommen 1118 Forstingenieure, Forster und Forstwarte. Die wirtschaftliche Bedeutung mag heute nicht mehr so augenscheinlich sein wie im Jahre 1945, als Holz der einzige Devisenbringer unseres gesamten Landes war. Ich sage augenscheinlich, denn noch heute ist Holz ein sehr bedeutender Grund- und Rohstoff für das Gewerbe und für eine beachtliche holzverarbeitende Industrie. Im Landesbudget ist meiner Meinung nach für die Förderung der Forstwirtschaft nicht im ausreichenden Maße Rechnung getragen. Wenn ich nun die Frage erhebe, warum überhaupt Förderung der Forstwirtschaft, dann muß ich sagen, deshalb, weil diese Förderung im Interesse der gesamten Gemeinschaft liegt und die Forstwirtschaft im Interesse der Gemeinschaft sehr bedeutende Lasten zu tragen bat. Ich verweise hier nur auf die Bewirtschaftung des Waldes, die großen gesetzlichen Beschränkungen unterworfen ist. Ich darf sagen, daß es Schutz- und Bannwälder gibt, wo die Nutzung selbst von Einzelstämmen an die Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde gebunden ist, und nicht zuletzt auch deshalb, weil die Forstwirtschaft im Interesse der Wasserwirtschaft bedeutende Lasten zu tragen hat. Betrachten wir nun die Bedeutung des Waldes in bezug auf den Fremdenverkehr und in bezug auf Erholungsräume, die wiederholt von Forstplanern angezogen wunden, so müssen wir feststellen, daß er für die Allgemeinheit von unschätzbarem Wert ist. Ich möchte nun kurz die Nonnenkalamität des vergangenen Sommers streifen und darf sagen, daß ohne öffentliche Mittel eine wirksame Bekämpfung dieses Schädlings nicht möglich gewesen wäre. Dieser Forstschädling - der Nonnenfalter und seine Raupe - tritt erfahrungsgemäß alle 17 bis 18 Jahre in Massen auf. So sind beispielsweise in den Jahren 1917 bis 1927 in Böhmen und in großen Teilen des Waldviertels an die 10 Millionen Festmeter Schadholz angefallen. Erst durch die Bekämpfung mit chemischen Mitteln vom Flugzeug aus ist es möglich, auf den behandelten Flächen einen hundertprozentigen Erfolg zu zeitigen. Es wurden also im vergangenen Jahr an die 16.500 Liter Bekämpfungsmittel vom Flugzeug aus versprüht, wofür ein Kostenaufwand von 600.000 Schilling notwendig war. Ich darf noch einmal feststellen, daß dank des Fortschrittes in der Chemie und Technik dieser Erfolg gezeitigt werden konnte, daß es aber gegen Windwurfkatastrophen, wie sie heuer über unsere Wälder hereingebrochen sind, auch in Zukunft - sicher zu allen Zeiten – keine wirksamen Mittel geben wird. Durch einen orkanartigen Südsturm wurden in Niederösterreich allein an die 450.000 Festmeter Holz aller Altersklassen geworfen, und ich darf sagen, daß besonders stark die hiebreifen Altersklassen betroffen wurden. Das bedeutet aber, daß so mancher Waldblauer in seiner Existenz bedroht ist. Das mag nicht sofort in Erscheinung treten, denn er wird aus dem Erlös dieses Schadholzes momentan eine größere Summe Geldes auf den Tisch gelegt bekommen, wovon, das muß ich feststellen, wieder das Finanzamt einen Großteil abschöpfen wird. Aber durch diese Windwürfe wird eine Vornutzung auf zwei Generationen getätigt. Es fallen also in Hinkunft die regelmäßigen Einnahmen aus dem Forst, welche für unsere Wald- und Bergbauern notwendig sind, aus, und es bleiben die Belastungen in Form von Steuern, von Kosten für die Aufforstung und von Pflegekosten. Die Aufforstung des Schadholzes wird zum Teil erst im kommenden Frühjahr möglich sein, weil in diesen Gebieten heute schon tiefer Winter ist. Dadurch wird aber die Schädlingsgefahr für das kommende Jahr wieder besonders akut. Es muß also die Bekämpfung der Forstschädlinge heute schon wieder eingeplant werden, nur ist es im Bergland nicht so einfach, weil man dort mit Normalflugzeugen nicht operieren kann. Man wird wahrscheinlich Hubschrauber zum Einsatz bringen müssen. Vor allen Dingen wird es aber notwendig sein, etwa 20 km Forststraßen zu bauen, um dieses Schadholz einer Verwertung zuzuführen und um diese Flächen wieder aufzuforsten. Ich darf darauf hinweisen, daß besonders die Aufforstung von solchen Großflächen bedeutende Mehrkosten erbringen wird. Neben diesen außerordentlichen Vorhaben sollen aber auch die laufenden Aktionen der Landesforstinspektion und der Bezirksforstinspektionen durchgeführt werden, so zum Beispiel die . Wiederaufforstung alter Kahlflächen und im besonderen die Aufforstung von Grenzertragsböden. Das sind ertragsarme landwirtschaftliche Boden, die durch diese Aufforstung wieder einer Nutzung zugeführt werden, wodurch auch eine Verwilderung unseres Landschaftsbildes hintangehalten wird. Ein besonderes Anliegen ist aber die Förderung des Forstwegebaues. Die Aufschließung der Wälder Niederösterreichs ist gänzlich unzureichend. Wie wenig vom Land bisher zu diesem Zweck zugeschossen wurde, möchte ich an Hand einiger Zahlen untermauern. Für den Forstwegebau wurden im Jahre 1965 Geldmittel von 7,631.000 Schilling erbracht, und zwar wurden 3,549.000 Schilling an Eigenleistungen zugeschossen, an zweiter Stelle kommen die Bundesmittel in Höhe von 2,787.000 Schilling, dann die Kammermittel von 670.000 Schilling und an letzter Stelle rangieren die Landesmittel in Höhe von 625.000 Schilling. Ich darf feststellen, daß im Jahre 1965 mit diesen Mitteln 60 km Forstwege gebaut wurden und daß eis im Jahre 1966 65 bis 70 km Forstwege sein werden. Ich muß aber in einem Atemzug hinzufügen, daß im Jahre 1965 alle Projekte durchgeführt werden konnten, während im Jahre 1966 erstmalig 35 Projekte mit einer Länge von 48 km nicht zur Durchführung gelangen konnten, weil die erforderlichen Mittel nicht vorhanden waren. Ich muß auch sagen, daß auf dem Sektor des Forstwegebaues noch nicht alle Möglichkeiten in bezug auf die Ausnützung der Bundeszuschüsse ausschöpft sind. Das Land Tirol zum Beispiel stellt jährlich 1,5bis 2 Millionen Schilling zur Verfügung, während Niederösterreich im Budget 1967 wieder nur 550.000 Schilling vorgesehen hat. Diese Mittel machen natürlich nur ein geringes Ausmaß an Bundesmitteln frei. Es besteht also hier noch die Möglichkeit, im Interesse der Forstwirtschaft und nicht zuletzt im Interesse der gesamten niederösterreichischen Wirtschaft zusätzliche Mittel flüssigzumachen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich halbe eingangs auf die Bedeutung der Forstwirtschaft hingewiesen, sowohl auf die wirtschaftliche Bedeutung des Waldes als auch auf seine Wohlfahrtsfunktion, die er zu erfüllen bat. Die Erhaltung des Waldes liegt im öffentlichen Interesse, und wir Forstwirte dürfen erwarten, daß eine stärkere Förderung - vielleicht schon im Nachtragsbudget - für die Belange der Forstwirtschaft in Erscheinung tritt. (Beifall bei der ÖVP.) ZWEITER PRÄSIDENT SIGMUND: Zum Wort gelangt Frau Abg. K ö r n e r. Abg. KÖRNER: Hohes Haus! Ich bin zwar kein Waldbauer, ich wohne nur im Waldviertel, aber trotzdem unterstreiche ich die Richtigkeit der Worte: Wie man in den Wald hineinruft, so hallt es zurück. Ich glaube aber, daß dieser Spruch nicht nur für meinen Fraktionskollegen gilt, sondern auch für die Herren aus dem ÖVP-Klub. Meine Herren, wir haben gestern einen gemeinsamen Antrag, betreffend das Projekt Göpfritz, beschlossen. Wir alle hoffen, daß es verwirklicht werden wind, aber trotzdem, glaube ich, können wir uns nicht darauf verlassen, daß damit alle Fragen, die das Waldviertel oder im weiteren Sinne die niederösterreichische Wirtschaft betreffen, gelöst wären. Wir müssen uns so wie bisher bemühen, für unsere Gebiete mehr zu erreichen. Ich habe gestern schon auf die Konferenz in Krems verwiesen und auf die Ausführungen des Herrn Prof. Jäger. Ich möchte heute im Zusammenhang mit der Gruppe 7 wieder auf seine Ausführungen verweisen, denn er hat sich in Krems - auch in verschiedenen Schriften, die aufliegen und die man nachlesen kann - insbesondere mit dem Fremdenverkehr im Waldviertel beschäftigt und eine Möglichkeit gewiesen, wie man den dort lebenden Menschen zusätzliche Einkommensmöglichkeiten schaffen kann. Wir wissen, daß das Waldviertel schon immer ein Stiefkind Niederösterreichs gewesen ist, nicht erst seit der Zweiten Republik, denn seinerzeit war das nördliche Waldviertel sozusagen das Sibirien unseres Landes. Hatte ein Lehrer etwas angestellt und wurde er strafversetzt, dann ist er in das nördliche Waldviertel gekommen. Heute ist das, Gott sei Dank, nicht mehr so. Ich wollte das nur aufzeigen, um zu beweisen, daß das Waldviertel unter den Vierteln Niederösterreichs immer schon benachteiligt war und daß der Nachholbedarf, den wir auf vielen Gebieten haben, eben aus dieser Zeit stammt. Es ist daher notwendig, daß insbesondere für dieses Viertel etwas geschieht. Es ist auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs in den letzten Jahren wirklich viel getan worden, aber trotz allem wissen wir, daß es noch zuwenig ist. Herr Prof. Jäger hat bei der niederösterreichischen Raumplanungskonferenz darauf verwiesen, daß in Tirol auf 100 Bauernhöfe 84 Fremdenzimmer fallen. Das ist schon ein Hinweis, den wir nicht geben könnten, weil es da bei uns sehr schlecht bestellt ist. Wir wissen, daß in der letzten Zeit die Fremdenverkehrswirtschaft auch oberm Manhartsberg große Anstrengungen gemacht hat. Es ist ja auch die Landschaft des Waldviertels für Erholungssuchende der Großstadt einmalig geeignet. Ich möchte nur auf die schönen Waldviertler Wälder und Teiche verweisen, auf die Blockheide bei Gmünd, auf das Kamptal, auf die Stauseen; das alles sind Anziehungspunkte nicht nur für die Wiener, sondern auch für die Fremden. Wir alle aber wissen, daß es mit den Unterkünften noch immer im argen liegt, und hier Abhilfe zu schaffen, ist unbedingt notwendig. Außerdem, so sagt der Vertreter des Raumplanungsinstitutes, ist jeder Ausbau des Fremdenverkehrs in diesem Viertel eine der wenigen Möglichkeiten, nicht nur für die Fremdenverkehrsbetriebe, sondern auch für die bäuerliche Bevölkerung. In diesem Zusammenhang wurde eben auf die westlichen Bundesländer verwiesen. Ich war im heurigen Sommer in einem kleinen Kärntner Gebirgsdorf auf Urlaub. Ein Dorf, das absolut nicht größer und schöner ist als viele Dörfer, die wir haben. Trotzdem aber gibt es dort das ganze Jahr hindurch - ich meine in diesem Dorf in Kärnten - viele Urlauber, und die dortige Bevölkerung lebt vom Fremdenverkehr, auch die bäuerliche Bevölkerung. Man hat dort bei jedem Bauernhof zwei, drei, manchmal nur ein ausländisches Auto gesehen. Man hat in den Gehöften Fremdenzimmer eingerichtet und schafft so zusätzliche Einnahmequellen. So, glaube ich, wäre der Ausbau des Fremdenverkehrs auch bei uns ein Mittel, um die Abwanderung etwas hintanzuhalten, um die Menschen im Lande zu halten. Wenn wir Überlegen, daß der Fremdenverkehr in den westlichen Bundesländern Iden Menschen wirklich zum Wohltand verholfen hat, und den Vergleich zu uns ziehen, dann müssen wir feststellen, daß hier bei uns noch vieles fehlt. Anstrengungen werden auf allen Linien gemacht, und ich glaube, es ist nicht so, daß man zum Beispiel für das Waldviertel nur sagen müßte, den Fremdenverkehr fördern, sondern auch koordinieren, nämlich Fremdenverkehr und auch die Ansiedlung von Betrieben fördern. Ich möchte als Beispiel die Neugründung eines Betriebes in Weitra anführen. Die Firma Zierhut hat dort einen Betrieb errichtet, der absolut das Landschaftsbild nicht zerstört, der sich in die Landschaft einfügt und der auch die Luft nicht verpestet. Es ist ein sauberes Gebäude, in dem Frauen aus der Umgebung von Weitra Beschäftigung finden. Wenn man das also abstimmt, dann kann man Arbeitsmöglichkeiten schaffen, ohne dabei die Entwicklung des Fremdenverkehrs au beeinträchtigen. Ich glaube daher, daß man die Bestrebungen, die die Gemeinden oder der regionlale Entwicklungsausschuß für das Waldviertel machen, wirklich unterstützen soll. Es geschieht ja, aber man sollte es in noch stärkerem Ausmaße tun, damit wir die Menschen in unserem Gebiet halten, und damit wir noch mehr Fremde in unser Gebiet bringen. Ich möchte im Zusammenbang mit den Bestrebungen mir Hebung .des Fremdenverkehrs und der Unterstützung der verschiedenen Vereinigungen nun auf ein Problem verweisen, das alle unsere Arbeit und Bestrebungen zunichte machen würde und die ganzen Arbeiten, die bisher auf dem Gebiete geschehen sind, wieder beeinträchtigen würde. Es ist dies die Frage der Einstellung der Nebenbahnen. Wir alle wissen, daß unser Straßennetz ein schweres Hemmnis für die Entwicklung des Fremdenverkehrs ist. Ich habe gestern früh darüber gesprochen, und wir alle wissen, daß ein gutes Verkehrsnetz unbedingt notwendig ist, wenn man den Fremdenverkehr fördern und weiter ausbauen will. Wenn man nun in letzter Zeit gehört hat, daß man an die Einstellung der Nebenbahnen denkt, dann möchte ich dazu sagen, daß dies kein neues Problem ist. Wir haben uns ja schon seinerzeit hier im Landtag auch mit dieser Frage beschäftigt und auch damals einen gemeinsamen Antrag beschlossen. Ich weiß das und kann das selbst bestätigen, weil ich mit unzähligen Delegationen seinerzeit beim zuständigen Minister vorgesprochen habe. Alle betroffenen Gemeinden, ohne Unterschied der Partei, haben sich zur Wehr gesetzt, und ich weiß, daß es die Gemeinden auch jetzt tun und tun müssen, weil es ja in ihrem ureigensten Interesse liegt. Ich möchte in diesem Zusammenhang mit den Gerüchten - aber es sind eigentlich keine, denn es wunde auch vom Betriebsdirektor bestätigt, und man konnte es ja in den Zeitungen, auch amtliche Verlautbarungen, lesen - hoffen, daß ein Team von Fachleuten die Wirtschaftlichkeit der Nebenbahnen prüft. Sicher müssen auch die Bundesbahnen nach wirtschaftlichen Grundsätzen arbeiten, ich glaube aber, auch hier muß man sagen, man kann nicht alles über einen Leisten ziehen. Es wird Nebenbahnen geben in Gebieten, wo das Verkehrsnetz wesentlich besser ausgebaut ist als bei uns. Ich weiß, daß es Gebiete gibt, in denen man rechnen kann, daß, wenn schon nicht jede halbe Stunde, so doch zumindest jede Stunde ein Autobus fährt. Wenn ich da an unser Gebiet denke, so muß ich sagen, daß von GroßGerungs nach Gmünd überhaupt kleine Verbindung außer der Bahnverbindung besteht. Ich könnte das an vielen Beispielen fortsetzen. Das gilt nicht nur für die Nabenbahn Gmünd - Groß-Gerungs, sondern auch für andere Strecken. Daß es eine wirtschaftliche Schädigung aller Gemeinden und vieler Industrie- und Gewerbebetriebe wäre, möchte ich Ihnen an einem Beispiel vor Augen führen. Man hat auch gehört, daß man daran denkt, die Nebenbahn Gmünd – Litschau bzw. Alt-Nagelberg - Heidenreichstein stillzulegen. In Alt-Nagelberg steht, wie bekannt, die Glasfabrik \der Stölzle AG. Die Stölzle AG. hat in der letzten Zeit große Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt, sie hat zum Beispiel unter anderem auch das Gleis zum Betrieb verlegt, im Einverständnis und nach Absprache mit der Bundesbahn, und man denkt bei der Stölzle AG. daran - auch das wurde schon seinerzeit mit der Bundesbahn abbesprochen - vom Propangas, vom Flaschengas, auf eine Flüssiggasanlage umzustellen, wobei die Anlieferung des Gases natürlich mit Kesselwagen der Bundesbahnen in den Betrieb hinein erfolgen müßte. Deshalb hat man auch diese neue Gleisanlage gemacht. Wenn nun die Nebenbahn eingestellt würde, dann wäre das eine schwere wirtschaftliche Schädigung des Betriebes der Glasfabrik. Wir alle wissen, wie groß die Schwierigkeiten gerade auf diesem Sektor jetzt sind. Die Stölzle AG. hat im Jahre 1965 zum Beispiel 289 Waggon verschiedener Chemikalien, Sand, Kohle usw. auf der Nebenbahn in den Betrieb geführt, und 27 Waggon und 201 Behälter sind im Jahre 1965 von der Glasfabrik herausgerollt, auf die Nebenbahn und sodann auf die Hauptbahn. Man kann daraus entnehmen, daß die Nebenbahnen nicht nur für den Fremdenverkehr, für die Arbeiter und Schüler notwendig sind, sondern auch für die Wirtschaft, und daß es wirklich für die Wirtschaft eine Schädigung bedeuten würde, wenn man diese Nebenbahnen einstellt. Was ich für die Glasfabrik Nagelberg gesagt habe, gilt natürlich auch für viele andere Betriebe, ich denke an die Firma Patria in Heidenreichstein, an die Agrarindustrie in Gmünd und an verschiedene andere Gmünder Betriebe, an die Holztransporte aus der oberen Gegend und auch an die landwirtschaftlichen Genossenschaften, die zur Beförderung ihrer Waren auch die Nebenbahnen brauchen. Ich glaube daher, daß es notwendig ist, daß wir uns gegen eine solche Auflösung der Nebenbahnen, die ja eine Beeinträchtigung der Wirtschaft darstellen, eine Beeinträchtigung der Förderung des Fremdenverkehrs und von vielen anderen, wirklich zur Wehr setzen müssen, im Interesse der betroffenen Gebiete. Es ist selbstverständlich, daß Einsparungen vorgenommen wenden, wenn dadurch niemand geschädigt wird. Das wird auch jeder einsehen. Aber man kann nicht auf der einen Seite in Gebiete Förderungsmittel geben und auf der anderen Seite diese ganzen Hilfen wieder zunichte machen durch Einstellung von Nebenbahnen, die auch dem Fremdenverkehr, dem Handel, dem Gewerbe und der Industrie dienen. Gestatten Sie mir daher folgenden Resolutionsantrag zu stellen (liest): „Die Landesregierung wird aufgefordert, beim Bundesministerium für Verkehr und Verstaatlichte Unternehmungen vorstellig zu wenden und dahin zu wirken, daß die Einstellung bzw. Einschränkung des Zugverkehrs auf den sogenannten Nebenbahnen überhaupt unterbleibt oder, sofern dies nicht möglich ist, diese Maßnahmen nur unter Bedachtnahme auf die Interessen der Wirtschaft und der Bevölkerung der betroffenen Gebiete vorgenommen werden; insbesondere sollte in diesem Falle getrachtet werden, daß anstelle des mit Dampf betriebenen Personenzugsverkehrs Schienenautobusse oder Triebwagen eingesetzt werden.'' Dazu möchte ich noch ergänzend bemerken - weil Sie hier die Forderung nach Schienenautobussen finden -, daß man vielleicht manches bei Iden Nebenbahnen einsparen könnte, wenn man nicht mit alten Dampfloks fahren würde, die eine lange Anlaufzeit haben, sondern hier moderne Triebwagen einsetzt. Ich bitte um Annahme dieses Antrages im Interesse aller betroffenen Gemeinden. (Beifall bei der SPÖ.) ZWEITER PRÄSIDENT SIGMUND: Zum Worte gelangt Herr Abg. Fla h r n b e r g e r. Abg. FAHRNBERGER: Herr Präsident, Hohes Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir einige kurze Anführungen zum Voranschlagsansatz 733-61, Landesbeiträge zu den Kasten landwirtschaftlicher Wegbauten. Bevor ich mich damit beschäftige, möchte ich aber ganz kurz zu einem anderen Problem Stellung nehmen. Wir wissen, daß im heurigen Jahr über Niederösterreich und darüber hinaus über unser ganzes Bundesgebiet schwere Katastrophen hereingebrochen sind. So wie in Kärnten, Tirol und Vorarlberg ist auch im Spätherbst in Niederösterreich durch die Unwetter schwerer Schieden entstanden. Wie mein Freund Reischer bereits erwähnte, ist im südlichen Niederösterreich durch Föhneinwirkung ein Südsturm hereingebrochen, der an Hunderttausenden Festmetern Holz schweren Schaden angerichtet hat. Ich komme deshalb nochmals darauf zurück - obwohl Kollege Reischer schon darüber gesprochen hat -, weil mein eigenes Gebiet davon betroffen wurde. Herr Landeshauptmann Maurer, er war damals der zuständige Landesrat, hat nach den Katastrophen die ganzen Gebiete bereist und mit uns besprochen, wie hier ratschest Abhilfe geschaffen wenden könnte. Wir wissen, daß im ganzen Bundesgebiet ca. 1,250.000 Festmeter Holz am Boden liegen. Des trifft den Absatzmarkt sehr schwer. Wir haben einen normalen Einschlag von ca. 9 Millionen Festmeter, zusätzlich wenden nun noch über 1 Million Festmeter Holz lauf den Markt kommen. Wir haben große Sorgen, ab es möglich sein wird, all das Holz auch absetzen zu können. Durch die schweren Windbrüche ist aber auch viel Schadholz entstanden. Man kann rechnen, daß für dieses Holz um 30 bis 40 Prozent weniger Erlös zu verzeichnen sein wird, ist doch des Holz vielfach abgesprengt und kann nur mehr als Brenn- oder Schleifholz abgesetzt werden. Die größte Gefahr aber bilden die Aufräumungsarbeiten, die hier – bedingt durch den frühen Wintereinbruch – ins Stocken geraten sind. Dadurch ist die Gefahr des Auftauchens von Schädlingen – zum Beispiel des Borkenkäfers - natürlich besonders groß, und es muß entsprechend vorgesorgt werden, um zu verhindern, daß unsere Forste davon befallen werden. Nunmehr einige kurze Bemerkungen über die Aufforstungskosten. Wir wissen, daß die Aufforstung jener Grundstücke, bei denen das Holz mit Wurzelstöcken im Buden liegt, schwieriger ist und man längere Zeit mit der Aufforstung zuwarten muß, bis die Wurzelstöcke zusammengebrochen sind. Die Aufforstungskosten werden daher um 50 oder 100 Prozent höher sein, als es normalerweise der Fall wäre. Unsere Bitte an die öffentliche Hand geht nun dahin, sich einzuschalten, damit Iden betroffenen Betrieben geholfen wird. Ich kann hier ein besonders krasses Beispiel anführen: Ein Bauer, der einen Waldbesitz von ca. 60 ha aufzuweisen hat, hat 3000 Festmeter Holz am Boden liegen. Der Betrieb ist für die weitere Zukunft schwer gefährdet, er hat momentan wohl große Einnahmen, aber die Nachkommen wenden aus der Forstwirtschaft einmal keinen Nutzen ziehen können. Es tritt aber noch ein weiteres Problem auf. Diese Bauern sind steuerlich viel höher belastet, als wenn die Holzschlägerung normal durchgeführt wird. Man muß daher alles tun, um ihnen steuerlich zu helfen. Nun kommen wir zu dem Problem Güterwegebau. Schon im Rahmen der Budgetdebatte wurde versucht aufzuzeigen, welche Wege beschritten wenden müssen, um der in den ländlichen Gebieten lebenden Bevölkerung eine bessere Aufwärtsentwicklung zu ermöglichen. Wenn ich auf das Problem der Güterwege eingehen darf, glaube ich feststellen zu können, daß wir dem Land sehr dankbar sein müssen, daß in den letzten Jahren bezüglich der Erschließung unserer Streusiedlungen im Bergbauerngebiet und auch im Waldviertel schon sehr viel getan worden ist. Ich habe von der Agrarbezirksbehörde einen kleinen Informationsbericht bekommen, der sehr erfreulich ist. In den letzten zehn Jahren, von 1955 bis 1965, auf die sich der Informationsbericht begrenzt - natürlich wurde mit dem Wegebau schon früher begonnen -, wurde mit einem Kapitalaufwand von 267 Millionen Schilling 758 Kilometer Güterwege und die Aufschließung von 2370 Höfen geschaffen. Der aufgewendete Betrag setzt sich aus Mitteln des Bundes, des Landes und der Interessenten zusammen. Im letzten Jahr 1965/66 - die Erfolgsmeldung ist noch nicht zur Gänze abgeschlossen, weil das Jahr 1966 noch nicht zu Ende ist - wurden rund 80 Kilometer Güterwege fertiggestellt, während 130 Kilometer noch im Bau sind bzw. übernächstes Jahr fertig werden. Trotz dieses Erfolges haben wir noch sehr viele bäuerliche Gebiete, die noch keine Zufahrt zu ihren Höfen haben. Es handelt sich um ca. 2400 Höfe. 200 dieser Höfe werden durch die heuer begonnenen Güterwege eine Zufahrt erhalten, so daß letzten Endes 2200 Betriebe noch keine Zufahrt besitzen. Die zur Aufschließung dieser Höfe notwendige Weglänge beträgt 1300 Kilometer. Ich habe mir die Fleißaufgabe gemacht und berechnet, welche Mittel hiefür notwendig sind. Der Anteil des Landes wäre, eine zehnjährige Bauzeit vorausgesetzt, pro Jahr mindestens 10 Millionen Schiling, also insgesamt ein Betrag von 100 Millionen Schilling. Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei der Besprechung des Bergbauernproblems muß ich aber auch noch auf die vorangegangene Budgetdebatte zurückkommen, in der viel von der Raumplanung gesprochen wurde. Es wurden Überlegungen angestellt, wie man in Zukunft der in den einzelnen Landesteilen lebenden Bevölkerung eine bessere Aufwärtsentwicklung gewährleisten könnte. Im Hinblick auf die Ausstrahlung der Städte und Industrie auf die anschließenden Räume liegen das Waldviertel und das Voralpengebiet weit ungünstiger. Ich bin der Meinung, daß die verkehrsmäßige Aufschließung dieser Gebiete das Problem Nummer 1 sein muß. Ich habe die Wichtigkeit in einigen Punkten zusammengefaßt und möchte diese aufzählen: 1. wird durch die Erschließung der Gebiete für die Bevölkerung eine bedeutende Erleichterung in vielen Belangen erzielt werden können; 2. leidet die soziale Betreuung der Bevölkerung, wie schon gestern aufgezeigt wurde, am Mangel an Landärzten. Dazu kommt, daß, wenn in Zukunft vielleicht verschiedene Planposten nicht mehr besetzt werden können, die Wege für die Ärzte immer länger werden. Meine Damen und Herren! Wenn die Erschließung dieser Höfe nicht vorangetrieben wird, wird es in manchen dringenden Krankheitsfällen kaum möglich sein, rasch einen Arzt zur Stelle zu haben. Im Verlauf der Debatte ist auch von der Umwandlung der Industriegesellschaft in eine Bildungsgesellschaft gesprochen worden. Hier spielt auch die Schulorganisation eine große Rolle. Wenn man nunmehr darangeht, bessere Schuleinrichtungen zu schaffen und Schulen zusammenzulegen, ergeben sich für die Schüler weitere Schulwege. Die Aufschließung der Höfe ist daher auch aus diesem Grunde unbedingt notwendig, damit den Kindern die Möglichkeit gegeben wird, ihre Schulen leichter zu erreichen. Es ist uns Bauern bewußt, daß die Billdung unserer Jugend eines der wichtigsten Probleme darstellt, denn nur eine gebildete Jugend wird in Zukunft bestehen können. Zum Abschluß möchte ich noch bemerken, daß die von mir aufgezeigten Belange für uns Bergbauern besorgniserregend sind. Wir wollen aber darauf hinweisen, daß wir in landwirtschaftlich schönen Gebieten leben, die Erholungsgebiete darstellen, in die die Menschen aus den Städten hinausströmen werden, um Ruhe und Erholung zu finden. Das wird in Zukunft zur Existenzsicherung unserer Bauernwirtschaften im Gebirge beitragen. Wenn heute in der Gruppe 7 auch zum Fremdenverkehr gesprochen wird, so freuen wir uns darüber, denn wir wissen, daß es für die im Bergbauerngebiet lebenden Menschen um so besser ist, je mehr Fremdenverkehrseinrichtungen gebaut werden und je mehr Erholungssuchende in diese Gebiete kommen. (Beifall bei der ÖVP.) DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Wort kommt Herr Abg. R a b l. Abg. RABL: Herr Präsident! Hoher Landtag! Die Voranschlagsansätze 7319-600 und 7319-601 enthalten den Zuschuß zur landwirtschaftlichen Wohnbauförderung des Landes Niederösterreich. Sicherlich sind sehr viele Voranschlagsansatze in unserem Budget für das Jahr 1967 nicht ausreichend dotiert und auch sehr viele berechtigte Wünsche zu diesen Ansatzposten vorhanden; gestatten Sie mir jedoch, daß ich mit einigen wenigen Worten die Bedeutung gerade dieser beiden Voranschlagsansätze unterstreiche. Ich glaube, daß die landwirtschaftliche Wohnbauförderung im besonderen zur Gesunderhaltung und wirtschaftlichen Existenz unseres Volkes in Österreich beiträgt. Denken wir an das Ende des zweiten Weltkrieges zurück, als neue wirtschaftliche Formen gefunden werden mußten, weil man einer neuen Zeit gegenüberstand und die österreichische Wirtschaft durch die Kriegs- und Nachkriegszeit schwerstens darniederlag. Vor allem die bäuerliche Bevölkerung beziehungsweise die bäuerlichen Familien standen zum Unterschied ihrer Vorfahren der Tatsache gegenüber, daß sie in den letzten zwanzig Jahren weitaus mehr investieren mußten. Das war einerseits durch den Mangel an Arbeitskräften bedingt und andererseits aber auch dadurch, daß sie sich in den neuen Wirtschaftsprozeß, der uns und die übrige Welt erfasst hatte, einreihen mußten. Es mußten maschinelle Investitionen und vor allem auch bauliche Maßnahmen getätigt wenden. Leider haben wir gerade bei diesen Investitionen bemerkt, daß sie nicht nur dazu führen, daß die österreichische Landwirtschaft heute mit über 7 Prozent Fremdkapital am Eigenkapital beteiligt ist, sondern daß vor allem sehr viele dieser Investitionen, seien es Maschinen oder bauliche Maßnahmen, im Laufe der Zeit überholt worden sind, Maschinen, die in den ersten zehn Jahren nach dem zweiten Weltkrieg noch modern waren, Bauten, die noch als zweckentsprechend angesehen werden konnten, sind heute auf Grund des Arbeitsvorganges und neuesten industriellen Erzeugnissen längst wieder überholt. Dadurch bedingt war es der bäuerlichen Familie, dem bäuerlichen Berufsstand nicht möglich, vor allem die Hauswirtschaft und den bäuerlichen Wohnbau so zu gestalten, daß die bäuerliche Familie mit der übrigen Bevölkerung Österreichs wohnungsstandardmäßig mitgekommen wäre. Es ist nicht so, daß die bäuerliche Bevölkerung nicht interessiert wäre an einer entsprechenden Wohnkultur, aber es war ihr aus den angeführten Erwägungen nicht möglich, mit der übrigen Bevölkerung Österreichs diesbezüglich Schritt zu halten. Es braucht nicht besonders betont werden, daß es gerade die bäuerliche Bevölkerung verdient hätte, hier entsprechend miteingereiht zu werden. Gestatten Sie mir noch einige Bemerkungen über das landwirtschaftliche Bauwesen. Wenn wir auch bedenken, daß wir in nächster Zeit in einen großen gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum gehen, der sicherlich auch der bäuerlichen Bevölkerung gewisse Pflichten auferlegen wind, und daß wir im Konkurrenzkampf Berufskollegen finden werden, die bildungs- und beratungsmäßig vielleicht unter günstigeren Voraussetzungen arbeiten als der bäuerliche Berufsstand in Österreich, so bin ich doch der Meinung, daß wir uns tauch in diesem gemeinsamen europäischen Markt behaupten werden können. Eines scheint mir wichtig, nämlich daß gerade auf Initiative und über Antrag des Herrn Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Dipl.-Ing. Schleinzer, der Herr Unterrichtsminister Dr. Piffl-Percevic an der Technischen Hochschule eine Lehrkanzel für landwirtschaftliches Bauwesen eingerichtet hat. Ich glaube, daß gerade dies in der Zukunft für die bäuerliche Bevölkerung und den bäuerlichen Berufsstand nutzbringend sein wird. Ich möchte nicht verabsäumen, den Beamten des Referates in der Teinfaltstraße für ihre Arbeit zu danken. Wenn auch die Mittel gering sind, so wurden doch die Ansuchen um Wohnbauförderung, die von der bäuerlichen Bevölkerung über ihre Interessenvertretungen an das Amt gelangten, rasch und nach Maßgabe der Mittel erledigt. Es muß offen ausgesprochen werden, daß der Dank besonders den Außenbeamten und den Fachschullehrkräften gebührt, die draußen tätig sind und die bäuerlichen Familien beraten. Wir bemerken ihre Tätigkeit vor allem in der Verschönerung der Bauernhäuser. Es sind hier nicht nur Beamte am Werk, die ihre Pflicht erfüllen, sie sind auch mit dem Herzen bei der Arbeit. Ich glaube, das ist von großem Vorteil und dafür gebührt ihnen unser herzlicher Dank. Meine Bitte an unseren neuen politischen Referenten, Herrn Landesrat Ökonomierat Bierbaum, geht dahin, dem Kapitel ,,Zuschuß zur niederösterreichischen Wohnbauförderung" ein besonderes Augenmerk zuzuwenden. Sicherlich wird dazu die Unterstützung und das Verständnis des Herrn Finanzreferenten notwendig sein, ich darf aber übereinstimmend mit allen sagen, die bäuerliche Bevölkerung wird es zu danken wissen, sie wird weiterhin der Gesundbrunnen des österreichischen Volkes bleiben. (Beifall im ganzen Hause.) DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Worte gelangt Herr Abg. K a i s er. Abg. KAISER: Sehr geehrter Herr Präsident, Hoher Landtag! Wir alle, die wir aus den Betrieben kommen, kennen die Schwierigkeiten und die Anliegen, die es derzeit in unserer Wirtschaft gibt. Die sprunghafte Entwicklung in der Wirtschaft beginnt allmählich nachzulassen, und die Konjunkturtendenz hat im vergangenen Jahr bereits die erste Dämpfung erfahren. So haben wir im Jahre 1964 eine Steigerung der Produktion um 8 Prozent feststellen können, im Jahre 1965 betrug die Zunahme nur mehr 4 bis 5 Prozent. Die Entwicklung ist branchenweise sehr unterschiedlich. Es zeigt sich, daß sich die Wirtschaft in einer Umstrukturierung befindet; dafür gibt es verschiedene Ursachen. Eine sehr wesentliche Ursache liegt darin, daß sich zu einem nicht unbeträchtlichen Teil der Konsumbedarf geändert hat. Ich komme aus einem Betrieb, der Gummi verarbeitet. Wir können dort feststellen, daß eine sehr deutliche Umschichtung eingetreten ist. Produkte, die vor Jahren noch abgesetzt werden konnten, finden heute kaum mehr Eingang in die Konsumentenschaft. Man sieht sehr deutlich, wie hier ein Trend zur Kunststoffverarbeitung eintritt. Eis gibt ein weiteres Faktum, und das ist die immer größer und schwieriger werdende Konkurrenz. Auch hier können wir feststellen, daß der Kampf um die Absatzmärkte immer heftiger wird. Nicht zuletzt wird es durch die Verarbeitung von Werkstoffen notwendig, neue Maschinen anzuschaffen. Auch die neuesten Erkenntnisse verschiedener rationeller Arbeitsmethoden, die angewandt werden müssen, um entsprechend preisgünstig erzeugen zu können, sind von Bedeutung. All diese Faktoren stellen die Betriebe vor immer neue Aufgaben und verlangen vor allem einen kräftigen Kapitaleinsatz. Von Seiten des Landes hat man zeitgerecht diese Entwicklung erkannt und durch die Förderungsmaßnahmen, die der Wirtschaft zugute kommen, hier entsprechend vorgesorgt. Sicherlich hätte die eigene Initiative nicht ausgereicht, um all diesen Problemen wirksam entgegenzutreten. Deshalb wurde bereits im Jahre 1947 der Wirtschaftsförderungsfonds gegründet. Es kann mit Genugtuung festgestellt werden, daß aus diesem Fonds bereits 74,4 Millionen Schilling an 3135 Darlehenswerber abgegeben wurden. Seit 1955 gibt es auch eine anerkennenswerte Kreditaktion im sogenannten Dreibund, dem sind das Handelsministerium, das Land Niederösterreich und die Handelskammer beigetreten. Auch aus dieser Aktion sind kräftige Impulse gekommen, und zwar mit einem Betrag von 39,6 Millionen Schilling. Sie wurden an 1890 Darlehenswerber vergeben, so daß die Gesamtsumme aus diesem Fonds derzeit 114 Millionen Schilling beträgt. Darüber hinaus wurde auch im Jahre 1962 vom Landtag der Betriebsinvestitionsfonds beschlossen, um für größere Betriebe die Erweiterung dieser Stützungsmaßnahmen durch zinsenbegünstigte Darlehen zu erreichen. Seit seinem Bestehen wurden insgesamt 112 Darlehen berücksichtigt, hiefür wurde ein Betrag von rund 62 Millionen Schilling ausgegeben. Wie begehrt diese Einrichtung ist, geht schon daraus hervor, daß bei weitem nicht jene Mittel zur Verfügung gestellt werden können, die notwendig wären, um den Erfordernissen gerecht zu werden. Dieser Betriebsinvestitionsfonds hätte vornehmlich die Aufgabe, industriearmen Gebieten zu helfen. Wenn wir die Bilanz ziehen, so können wir wohl feststellen, daß seit dem Jahre 1962 bis Ende 1965 insgesamt 103 Betriebsneugründungen zustande gekommen sind. Es gab aber nicht nur Betriebsneugründungen, sondern auch Betriebsstillegungen; so gab es zum Beispiel im Jahre 1964 42 Betriebsneugründungen, aber 55 Betriebsstillegungen, im Jahre 1965 42 Betriebsneugründungen und ebenfalls 55 Betriebsstillegungen. Man sieht daraus, wie lebendig es heute im Wirtschaftsablauf zugeht. Es genügt aber nicht, daß das Land diese Mittel unter relativ günstigen Bedingungen gewährt; es soll auch dafür gesorgt werden, daß es zu einem zweckmäßigen Einsatz dieser Gelder kommt und daraus ein optimaler gesamtwirtschaftlicher Erfolg resultiert. Eis wäre zum Beispiel total verfehlt und würde einer Vergeudung des Kapitals gleichkommen, würde ein Unternehmer eine Maschine kaufen, die weit über seiner üblichen Kapazität liegt und keine Chance hätte, optimal ausgenützt zu werden. Leider muß man feststellen, daß hier des öfteren Sünden begangen werden. Vielleicht deshalb, weil man die wirtschaftlichen Möglichkeiten abschätzt und vom persönlichen Ehrgeiz gepackt ist. Dadurch kann man das Mögliche vom Unmöglichen nicht richtig trennen. Die Technik treibt uns heute, sie macht riesenhafte Sprünge. Wir können feststellen, daß eine Maschine, die gestern noch als die neueste Erkenntnis der Technik gegolten hat, heute nicht mehr ganz den Erfordernissen der Zeit entspricht. Die laufende Anpassung an diese neue Technik ist vom Produktionsstandpunkt sicherlich begrüßenswert, weil damit eine günstigere Kostenerstellung der Produktion erreicht werden kann, aber trotzdem ist es letzten Endes eine Frage der Investition, und es genügt nicht immer, sich jede neue Maschine zu kaufen, die es auf dem Markt gibt. Ich glaube, hier muß erst richtig abgestimmt werden, damit auch optimal richtige Produktionskosten herauskommen. Es nützt nichts, wenn die Erzeugung rationell ist, wenn aber die Investitionsmittel wieder auf die Produktion umgelegt werden und dadurch die Konkurrenzfähigkeit in Frage gestellt wird. Ein wesentliches Faktum erscheint mir in der modernen Wirtschaft auch die Marktforschung. Sie gibt heute die Grundlagen für eine vorausschauende und planvolle Abstimmung zwischen den Bedürfnissen der Konsumenten und der möglichen Produktion. Gewiß gibt es auch bei dieser Methode gewisse Unsicherheitsfaktoren, aber ich glaube, daß wir in dieser hektischen Zeit nicht mehr ganz mit Erfahrungswerten aus der Vergangenheit auskommen und daß es auch nicht immer genügt, gefühlsbetonte Überlegungen anzustellen, wenn wir unsere Betriebe auf eine neue Form der Produktion umstellen. Es ist auch unbedingt notwendig, daß man sich ein Konzept zurechtlegt - wir leiden ja noch immer an einer gewissen Konzeptlosigkeit in der Wirtschaft - und sich auch systematisch daran hält. So können die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden, um unser Wirtschaftswachstum auch ständig steigen zu lassen. Es genügt heute nicht mehr der Standpunkt, daß sich in der Wirtschaft alles nach freier Wahl einpendeln muß. Wenn wir diesen Standpunkt weiterhin vertreten, ist das, glaube ich, förmlich der Garantieschein dafür, daß wir in der österreichischen Wirtschaft allmählich ins Hintertreffen kommen. Ich .möchte auch ein Kapitel anschneiden, das wert ist, näher in die Betrachtung gezogen zu werden. Man beschäftigt sich gegenwärtig in der verstaatlichten Industrie mit einer Koordinierung im Produktionsprogramm. Ich kann durchaus verstehen, daß diese Überlegung in der Privatwirtschaft gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt, aber vom wirtschaftlichen Standpunkt aus wäre es ebenso zweckmäßig, wenn man auch dort eine gewisse Koordinierung in der Produktion erreichen könnte; denn mit Kreditoperationen allein kann man diesem Problem nicht wirksam an den Leib rücken. Ich glaube auch, daß wir in Österreich besonders unter einem Umstand au leiden haben, auf den ich etwas näher eingehen möchte: das ist das Problem unserer Handelsspannen. Es besteht immer dieser Gegensatz zwischen Industrie, dem Gewerbe und dem Handel, und es wird ein ewiger Streit bleiben, wer ohne besonderen materiellen Einsatz am meisten verdient. Ich komme selbst aus der Industrie. Wir werden von der Belegschaftsseite her immer angehalten, rationellst zu produzieren, damit wir auch auf den Märkten konkurrenzfähig bleiben. Ich möchte an Hand eines praktischen Beispieles beweisen, wie sich die Dinge immer wieder abzeichnen und genau das Gegenteil von dem bringen, was man sich zum Ziele gesetzt hat. Wir erzeugen in der Vielfalt unserer Produktion auch die Wärmeflaschen. Es hat eine Zeit gegeben sie liegt allerdings einige Jahre zurück -, wo wir von der Konkurrenz herausgefordert wurden, unsere Wärmeflaschen billiger zu erzeugen. Man ist an die Beschäftigten herangetreten, zur Sicherung ihrer Arbeitsplätze doch die Produktivität z u steigern. Die Produktivitätssteigerung ist dadurch zum Ausdruck gekommen, daß die Produktion der Wärmeflaschen pro Kopf von 106 Stück auf 240 Stück in der gleichen Zeit und bei gleichem Lahn angestiegen ist. Ich darf Ihnen, meine Damen und Herren, sagen, daß zum selben Zeitpunkt die Wärmeflasche, die in der Produktion billiger geworden ist, im Detailhandel um 2 Schilling teurer wurde. Ich glaube daher, daß die arbeitenden Menschen, die sich letzten Endes auch bemühten, produktiver zu erzeugen, unter solchen Voraussetzungen sehr schwer überzeugt werden können, daß sie produktiver erzeugen müssen, damit die Konsumenten auch billiger zu unseren Produkten kommen. Hier gibt es noch mehr als genug Gegensätze, und wir verspüren auch immer noch Iden Trend, daß der Handel versucht ist, seine ihm zugedachte Funktion allmählich oder in noch stärkerem Maße auf die Industrie abzuwälzen. Es ist keine Seltenheit, daß man Aufträge mit dem Vermerk erhält: ,,Bitte, seien Sie so freundlich und schicken Sie dem und dem Detaillisten die und die Menge, aber die Faktura an meine Adresse." Wenn man die Sache verfolgt stellt sich heraus, daß der Großhändler lediglich die Funktion des Telefonierens übernommen hat und nicht mehr die Funktion des Risikos, des Verteilens, aber trotzdem einen entsprechenden Gewinn einnimmt. Ich glaube, meine Damen und Herren, wenn es uns um die Geschicke der österreichischen Wirtschaft ernst ist, dann muß mit diesem Unfug Schluß gemacht werden. Wir sind nicht so borniert, daß wir eine echte Funktion nicht verstehen; sie ist notwendig, aber man soll nicht versucht sein, mit weniger Arbeitsaufwand unberechtigt mehr zu verdienen. Das können die arbeitenden Menschen in der Gesellschaft nicht verstehen und das, glaube ich, steht auch dem Handel nicht zu. Es ist nur bedauerlich, daß die Industrie in diesem Kräftespiel an die Wand gedrückt wird und fast keine Möglichkeit findet, sich dagegen wirksam zur Wehr zu setzen. Ich habe im Vorjahr auch einen Antrag gestellt, der sich damit beschäftigte, daß neben den bereits bestehenden Wirtschaftsförderungsmaßnahmen das Land einen Haftungs- und Garantiefonds ins Leben ruft, damit man auch eine Möglichkeit hat, einer beachtlichen Anzahl von kleineren und mittleren Betrieben, die es ja in Niederösterreich in besonderem Maße gibt, einen Kredit zu ermöglichen. Sie sind es, die besonders unter Kapitalknappheit zu leiden haben. Ich habe den Antrag gestellt und Herr Abg. Schneider hat dazu eine Stellung bezogen. Er hat uns versichert, daß man zu einem späteren Zeitpunkt diese Frage noch einmal erörtern kann. Wir haben daraufhin unseren Antrag in der Überlegung zurückgezogen, daß man doch einen Weg suchen soll, um diese Frage, die letzten Endes in der Endkonsequenz alle Menschen berührt, egal ob sie in der Wirtschaft tätig sind oder ob sie zu dem Kreis der arbeitenden Menschen gehören, ob Unternehmer, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, einer Lösung zuzuführen. Ich habe heute bereits mit Herrn Abg. Schneider gesprochen, er hat schon einen Antrag formuliert und wird ihn sicherlich auch einbringen. Ich muß sagen, unsere Fraktion wird diesem Antrag die Zustimmung geben, obwohl wir als Einschränkung sagen müssen, daß er nicht ganz unseren Vorstellungen entspricht. Unsere Vorstellung wäre gewesen, daß das Land Niederösterreich aus eigener Initiative heraus einen Fonds schafft, der diese Möglichkeit der Kreditgewährung an Klein- und Mittelbetriebe gewährleistet. Das ist hier nicht geschehen. Es heißt in diesem Antrag, daß die Kammer der gewerblichen Wirtschaft initiativ wird und daß das Land diesem Bemühen nur mit einem bestimmten Betrag beitreten wird. Wir glauben, daß das in der gegenwärtigen Situation ein bescheidener Beginn sein kann, aber wir können trotzdem nicht darauf verzichten, daß das Land selbst einen eigenen Fonds schafft, der gewisse Erleichterungen für diese Industriebetriebe, die so an Kapitalknappheit leiden, schafft. Die verantwortliche Landesregierung sollte doch Möglichkeiten überlegen, wie man – wenn schon nicht im kommenden Jahr, so doch in der Folge hier Geldmittel zur Verfügung stellt, denn die Erfordernisse in der Wirtschaft werden sicherlich nicht geringer, sondern eher mehr werden. Wenn wir zeitgerecht der Wirtschaft die notwendigen Impulse geben, dann, glaube ich, wird es auch möglich sein, eine Plattform zu bauen, auf der wir unseren Lebensstandard in Zukunft auch weiterhin aufbauen können. (Beifall bei der SPÖ.) DRITTER PRÄSIDENT REITER: Das Wort hat Herr Abg. J a n z s a. Abg. JANZSA: Herr Präsident! Hohes Haus! In der Gruppe 7 ist auch der Fremdenverkehr zu behandeln. über den Fremdenverkehr im allgemeinen und den Fremdenverkehr in Niederösterreich im besonderen kann nicht oft und nicht eindringlich genug gesprochen werden, ist doch der Fremdenverkehr jener Bestandteil der Wirtschaft, den viele Gebiets- und Verwaltungsgemeinschaften und Körperschaften als einen ihrer ertragsreichsten Einnahmenteile bezeichnen können. In vielfältiger Form fließen die Einnahmen aus dem Fremdenverkehr in die Kassen der öffentlichen und privaten Organisationen. Schon der geringe Mitgliedsbeitrag zum Verkehrs- und Verschönerungsverein eines Ortes ist ein Beitrag im Dienste des Fremdenverkehrs, der außerdem in Abkehr jeder materiellen Einstellung nur aus ideellen und kulturellen Gründen geleistet wird. Diese Vereine, die sich dem Dienste des Fremdenverkehrs verschrieben haben, also die Fremdenverkehrsvereine, entfalten und entwickeln je nach der Möglichkeit, die ein Ort auf Grund seiner Lage bietet, eine Regsamkeit, die einem kräftigen Impuls für die Fremdenverkehrswirtschaft gleichkommt. Sie ist gleichsam der erste Herzschlag auf dem Sektor Fremdenverkehr. Die Werbung, Propaganda oder Einladung zu einem Sommerfest, einem Blumenkorso, einem Heimatabend, einem Strandfest, Skiabfahrtslauf, einer Wettveranstaltung usw., wo zumeist die Fremdenverkehrsvereine als Veranstalter fungieren, gibt einem Ort schon die Möglichkeit, den Fremden auf die Besonderheiten dieses Ortes und seiner Umgebung aufmerksam zu machen und so durch mündliche, persönliche Aufklärung oder durch Überreichung von Prospekten oder andere Kontaktnahme diesen Fremden zu einem späteren Besuch und Aufenthalt anzuregen. Auch die Ausschmückung und Verschönerung eines Ortes ist meist Sache dieser Vereine, die selbstverständlich mit Unterstützung der Ortsgemeinden, soferne sie Fremdenverkehrsgemeinden sind, diese Tätigkeit in vorbilldlicher Weise erfüllen. So beginnt bereits im Orte selbst von unten angefangen die Werbung um den Fremden, die in der weiteren Folge durch Fremdenverkehrsverbände von Teilgebieten der Fremdenverkehrssektion der Handelskammer Niederösterreich und letztlich durch den Niederösterreichischen Landesverband für den Fremdenverkehr in einer groß angelegten, breiten Streuung, die nicht nur das österreichische Bundesgebiet, sondern auch das Ausland umfaßt, fortgesetzt wird. Ich möchte daher, Hoher Landtag, von dieser Stalle aus allen jenen Vereinen und Verbänden und allen uneigennützigen Mitarbeitern, die sich in den Dienst des Fremdenverkehrs gestellt haben, den allerherzlichsten Dank und die Anerkennung für ihre Arbeit aussprechen. (Beifall bei der ÖVP.) Bis einschließlich September 1966 wurden in Niederösterreich 4,662.278 Gesamtnächtigungen gezählt, davon 699.399 Ausländerübernachtungen. Dies bedeutet gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 1965 eine Steigerung um 68.121 Gesamtnächtigungen. Auch die Ausländernächtigungen erfuhren im gleichen Zeitraum eine Steigerung um 53.477, die zu weiteren Hoffnungen Anlaß gibt, daß immer mehr Ausländer Niederösterreich als Urlaubs- und Erholungsland entdecken. Noch immer hat Niederösterreich als einziges Bundesland nicht die Nächtigungsziffer des Jahres 1937, nämlich 5,727.000, erreicht. Während Niederösterreich sich allmählich der Wendemarke des Jahres 1937 nähert, steigen bedrohliche Wolken im Horizont des Fremdenverkehrs auf. Die Konkurrenz anderer Fremdenverkehrsländer wird immer stärker fühlbar. Im Jahre 1960 haben die Österreicher 1,6 Milliarden Schilling für ihre Auslandsreisen und Auslandsurlaube ausgegeben. Im Jahre 1962 waren es 1,9 Milliarden Schilling und im Jahre 1965 bereits 3,6 Milliarden Schilling. Damit geben die Österreicher schon mehr im Ausland aus, als sie im Inländerfremdenverkehr in Österreich selbst ausgeben. Das ist zweifellos ein Zeichen für unseren Wohlstrand, aber auch bedenklich vor allem für den niederösterreichischen Fremdenverkehr, dessen wichtigster Gast immer schon der Inländer, vor allem der Wiener, gewesen war, denn der Ausländerfremdenverkehr ist in Niederösterreich trotz seiner verkehrsextremen Lage gegenüber dem Westen von Jahr zu Jahr gestiegen. Im Jahre 1937, dem letzten Normaljahr vor dem Kriege, wurden in Niederösterreich 484.700 Nächtigungen ausländischer Gaste gezählt und im Jahre 1965 725.000. Es ist also der Wiener, der unser Bundesland im Stich gelassen hat, Iden es in die Ferne zieht und der die Schönheiten seiner eigenen engeren Heimat nicht mehr hoch genug für seinen Urlaub einschätzt. Vor allem sind es die osteuropäischen Staaten, wie Bulgarien und Rumänien, die sich um den Österreicher bemühen. Zur Zeit kann man in Wien Plakate sehen, auf denen ein Wochenaufenthalt in der Slowakei samt Hin- und Rückfahrt um 797 Schilling angeboten wird. Obwohl Österreich ein klassisches Wintersportland ist, bemühen sich die Tschechen mit einer kostspieligen Werbung um den Österreicher. Ich hatte heuer persönlich Gelegenheit, bei einem Kurzaufenthalt in Prag und Pressburg die Anstrengungen der Tschechen um die Gunst des Ausländergastes zu beobachten, die in weiterer Folge fortgesetzt auch unseren Ausländerfremdenverkehr, wenn wir in unseren Bemühungen nachlassen, in eine rückläufige Bewegung versetzen werden. Ich darf Ihnen, meine seh geehrten Damen und Herren, damit Sie sehen, daß auch von höherer Warte diese bedenklichen Zeichen festgestellt werden, jene Feststellungen der hauptamtlichen Zweigstellenleitung der Fremdenverkehrswerbung anläßlich ihrer Jahrestagung bekanntgeben, die feststellen, daß die Konkurrenz anderer Feriengebiete, namentlich des Südens, gegenüber Österreich erdrückend zugenommen hat, daß wichtige Herkunftsstaaten jener Gäste, die Österreich gerne besuchen, auch gewisse Tendenzen wirtschaftlicher Rezession zeigen, daß die für die Fremdenverkehrswerbung zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen und schiießlich, daß sich die Erhöhung des Handelsdefizits nur durch Einnahmen aus dem Fremdenverkehr abdecken läßt, wenn diese Einnahmen steigen. Voraussetzung dafür ist selbstverständlich eine verstärkte Werbung. Noch mehr als bisher bemühen wir uns um den Inländerfremdenverkehr. Dazu benötigen wir aber vor allem ein Werbekonzept und entsprechende finanzielle Mittel, um dieses Konzept auch tatsächlich verwirklichen zu können. Wenn die Konkurrenz eine solche Werbekampagne startet, nur um unseren harten Schilling ins Land zu bekommen, so müssen auch wir uns anstrengen und dürfen nichts unversucht lassen, um unser Bundesland wieder ins rechte Licht zu rücken. Die niederösterreichische Fremdenverkehrswirtschaft hat es nicht an Initiative fehlen lassen. Es wurden weiterhin die zinsenbegünstigten Fremdenverkehrsförderungskredite des Landes und der Handelskammer Niederösterreichs beansprucht, um die Gastgewerbebetriebe auszubauen und zu modernisieren. Es wunden im Jahre 1966 bisher Fremdenverkehrsförderungskredite einschließlich der Zinsenzuschüsse für unterentwickelte Gebiete in einer Kapitalsumme von 56 Millionen Schilling vergeben. Für die Errichtung von Bädern, Liften und für sonstige Fremdenverkehrseinrichtungen eine Summe von 12,200.000 Schilling. Auch das Land hat mit seinen Beiträgen im Jahre 1966 einschließlich der unterentwickelten Gebiete für Lifte, Bäder, Tennisplätze und für die Staubfreimachung von Straßen Iden Betrag von 1,085.000 Schilling gegeben. Der Erfolg dieser Förderungsmaßnahmen ist aber auch nicht ausgeblieben. Im Zeitraum vorn 1. Jänner 1965 bis 30. September 1966 wurden 240 Fremdenverkehrsbetriebe neu gegründet. Durch Aufstockung, Ausbau und Anbau wurden 1002 Fremdenzimmer errichtet mit einer Bettenanzahl von 2097. Aber auch die Aussichten in der weiteren Ausgestaltung, Modernisierung und Neugründung von Fremdenverkehrsbetrieben sind erfolgversprechend, vorausgesetzt, daß der Bedarf den heutigen Preisverhältnissen gerecht wird. Die Tatsache, daß bereits für das Jahr 1967 127 Ansuchen mit einer Kapitalsumme von 52,100.000 Schilling für Fremdenverkehrsbetriebe, 11 Ansuchen mit einer Summe von 5,300.000 Schilling für Bäder und ein Ansuchen in Höhe von 200.000 Schilling für die Errichtung eines Liftes vorliegen, gilt als Beweis dafür, daß die niederösterreichische Fremdenverkehrswirtschaft bereit ist, eine weitere nicht unbeträchtliche Schuldenlast auf sich zu nehmen, um dem Staate die ausgleichende Einnahmequelle zu sichern. Auch von dieser Stelle aus darf ich den Dank an die Beamtenschaft und die Mitarbeiter für das klaglose Funktionieren der Kreditvergaben aussprechen. Es muß die Bitte an das Finanzressort gerichtet werden, bei der künftigen Vergabe auf dem Sektor des Fremdenverkehrs daran zu denken, daß in den letzten Zeiten auch die Preise gestiegen sind und daß die Förderungsmittel entsprechend angeglichen werden müssen. Für die Werbung sind im Jahre 1966 für Prospekte, Gaststättenverzeichnisse, Plakate rund so weiter 2,900.000 Schilling ausgegeben worden. Der Bedarf für die verstärkte Werbung, die notwendig wäre, um dem Fremdenverkehr einen entsprechenden Impuls zu geben, wurde bereits mit 5,430.000 Schilling geschätzt. Daher ist es notwendig, daß das Kapitel Fremdenverkehr eine entsprechende Förderung erfährt, damit jene Werbung einsetzen kann, um die Einnahmen auch aus diesem Sektor einer Steigerung zuzuführen. (Beifall bei der ÖVP.) DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Wort gelangt Herr Abg. R i g l. Abg. RIGL: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kollege Janzsa hat sich mit den Problemen des Fremdenverkehrs befaßt. Ich will mich nun einigen unangenehmen Dingen zuwenden, die das Bemühen des Fremdenverkehrs sehr erschweren. Ich habe hier die Fotokopie eines Dekretes aus dem Jahre 1835 vor mir, das heute noch an den Nerven und den Brieftaschen unserer Fremdenverkehrsbetriebe nagt. Diese Verordnung seiner k. k. Majestät vom 5. Dezember 1835 verlangt eine sogenannte Produktionslizenz, weil es zur höchsten Kenntnis gekommen ist, „daß die Zahl der herumziehenden Schauspielertruppen, Seiltänzer, gymnastischen Künstler, herumziehenden Musikbanden oder Eigentümer sonstiger Schaugegenstände aller Art, welche die österreichischen Provinzen in allen Richtungen durchstreifen, seit einiger Zeit bedeutend zunehmen. Weil das Herumziehen derlei Leute besonders mit Schaugeschäften von nicht wesentlichem Belange oder Produktionen gemeiner Art selbst der Müßiggang förderlich seien, da viele solcher Vaganten bei der Unzulänglichkeit der erwähnten Nahrungswege teils den Gemeinden und Ortsobrigkeiten zur Last fallen, teils das zur Fristung ihrer Subsistenz Fehlende auf unerlaubte Weise zu ergänzen suchen, müsse zur besonderen Pflicht gemacht werden, dahin zu wirken, daß die Bewilligung zu solchen Produktionen streng erwogen wird". Meine Damen und Herren! Diese Verordnung, die jetzt im Dezember ihren 130. Geburtstag feiert, gilt nach wie vor, und es ist zweifelhaft, ob in diesem Hofkanzleipräsidialdekret an das Radio und Fernsahen gedacht wurde. Wenn ein Fremdenverkehrsbetrieb in seinem Extrazimmer einen Radioapparat oder ein Fernsehgerät aufstellen will, um seinen Urlaubsgästen bei schlechtem Wetter die Zeit etwas zu verkürzen, muß er beim Polizeireferat der Landesregierung um diese sogenannte Produktionslizenz ansuchen. Diese kostet 100 Schilling und wird nur für drei Jahre erteilt. Die Prozedur, die alle drei Jahre notwendig ist, um die Verlängerung zu erhalten, will ich nicht aufzeigen; das allein wäre eine Begründung für eine Verwaltungsreform. Wenn das Fernsehen der ,,Moralität" nachteilig sein sollte, warum muß dann der Gastwirt dafür bezahlen? Die Anwendung dieses 130 Jahre alten Hofkanzleipräsidialdekretes für die Aufstellung von Rundfunk- und Fernsehgeräten sowie Musikautomaten in gewerblichen Betrieben ist gesetzwidrig und gehört sofort abgeschafft. Außerdem würde der Wegfall dieser Produktionslizenz eine Vereinfachung der Verwaltung mit sich bringen. Aus den eingangs erwähnten Gründen der verschärften Konkurrenzierung unseres Fremdenverkehrs werden wir auch die steuerliche Belastung unseres Hotel- und Gastgewerbes an die der anderen Fremdenverkehrsländer angleichen müssen. Unserer Fremdenverkehrswirtschaft ist eine Reihe von Sondersteuern auferlegt, die es in anderen Ländern nicht gibt - zum Beispiel die Getränkeabgabe, die Hitler nach Österreich gebracht hat. In der Bundesrepublik Deutschland ist diese Sondersteuer - auch das wurde schon erwähnt - bereits weitgehend abgeschafft. Von insgesamt 24.502 deutschen Gemeinden heben nur mehr 803 Gemeinden, das sind 3 Prozent aller deutschen Gemeinden, die Getränkeabgabe ein. Der Einwand, daß die Aufhebung der Getränkeabgabe die Gemeinden in finanzielle Schwierigkeiten bringen würde, ist nicht stichhältig. Im Jahre 1964 betrugen die Einnahmen aller österreichischen Gemeinden einschließlich der Bundeshauptstadt Wien 19,8 Milliarden Schilling. Das Aufkommen an Getränke- und Speiseabgaben aller österreichischen Gemeinden betrug im gleichen Jahr rund 606 Millionen Schilling, das sind 3,1 Prozent der gesamten Steuereingänge der Gemeinden. Der Verlust dieser 3,1 Prozent kann die Gemeinden finanziell nicht ruinieren. Für das Gastgewerbe wäre es jedoch schon eine Erleichterung, wenn die selbstverfertigten Limonaden, wie Soda mit Himbeer, Kaffee und Tee von der Albgabe befreit werden könnten. Das würde eine Veränderung des Aufkommens an Getränkesteuer um höchstens ein Sechstel mit sich bringen und die Gesamteinnahmen er österreichischen Gemeinden um ein halbes Prozent schmälern. Da das österreichische Gesamtaufkommen an Getränkeabgabe von 606 Millionen Schilling im Jahre 1965 auf 700 Millionen Schilling gestiegen ist, was eine Steigerung um genau ein Sechstel bedeutet, wäre das nichts anderes, als daß die Einnahmen aus der Getränkeabgabe einmal ein Jahr lang auf ihren Stand stehenbleiben würden. Mit der Herausnahme gewisser alkoholfreier Getränke aus der Getränkeabgabe würden so manche Differenzen zwischen den Gemeinden und den Gastwirten aus der Welt geschafft werden. Es brauchte dann nicht mehr darüber gestritten werden, ob eine Zitrone für ein Schnitzel oder eine Limonade verwendet wurde oder ob der Himbeersaft zur Zubereitung des sogenannten kalten Reises oder als Getränk ,,Soda mit Himbeer" verwendet worden ist. Auch das Niederösterreichische Lustbarkeitsabgabegesetz ist nicht weniger grotesk als das Hofkanzleipräsidialdekret aus dem Jahre 1835. So ist für das Billardspiel in den Kaffeehäusern keine Lustbarkeitsabgabe zu entrichten, wohl aber, wenn das gleiche Billard in einem Gasthaus oder Hotel steht. Sogar Schachwettkämpfe werden besteuert, wenn dabei Speisen und Getränke verabreicht werden. Der Lustbarkeitsabgabe unterliegen auch alle pratermäßigen Volksbelustiglungen, wie das Ringelspiel, Kasperltheater, das Musizieren, die Schießbudm, die Kegelbahnen, das Radrennen, das Preisschießen, das Schinakelfahren, das Tennis- und Tischtennisspielen. Es gibt kaum ein Vergnügen, das nicht von der Lustbarkeitsabgabe angezapft wird, mit der Folge, daß in Österreich, dem Lande der Musik, in unseren gastgewerblichen Betrieben am Abend nicht einmal ein Zitherspieler anzutreffen ist. Das Niederösterreichische Lustbarkeitsabgabegesetz wäre daher insoferne zu reformieren, daß Darbietungen lebender Musiker, mit Ausnahme von Tanzveranstaltungen, wo zum Beispiel Entree verlangt wind, nicht mehr der Lustbarkeitsabgabe unterliegen. Ebenso sollten Theaberaufführungen von Dilletanten, also Liebhaberbühnen, künstlerisch und kulturell wertvolle Ausstellungen oder Vorträge und die öffentlichen Fernsehdarbietungen in den Gastwirtschaften, Volksheimen, Erholungsheimen usw. von der Lustbarkeitsabgabe befreit werden. Um das weitere Kinosterben in Niederösterreich hintanzuhalten, müßten auch alle künstlerisch wertvollen Filme sowie alle für sehenswert erklärten Filme abgabefrei erklärt werden. Es ist leider so, daß den Gemeinden lediglich die Steuerhoheit bei Abgaben, die äußerst unpopulär sind, zuerkannt ist, wie die Getränkeabgabe, die Ankündigungsabgabe, die Abgabe für die Luftsteuer und die Abgabe für den Hund. Die Gemeinde muß außerdem jede Musikveranstaltung und auch das Ringelspiel besteuern. Ich glaube, daß diese Aufzählung allein schon für sich spricht. Auf lange Sicht gesehen müßte daher getrachtet werden, den Gemeinden aus Bundessteuern und Landesabgaben im Finanzausgleichgesetz höhere Mittel zur Verfügung zu stellen, um diese sogenannten Bagatelleabgaben abschaffen zu können, deren Einbringung oft mit mehr Kosten verbunden ist, als die Sache wert ist. Eine solche Finanzpolitik muß aber auch im Interesse der Rationalisierung und Personaleinsparung gefordert wenden, zumal auch die Finanzämter Elektronenrechner und andere arbeitssparende Maschinen werden einführen müssen, was aber bei der großen Zahl von Abgaben und Steuern nicht möglich sein wird. In Österreich gilbt es nämlich neben den Zöllen rund 80 verschiedene Zwangsbeiträge, die in Form von Gebühren oder Verwaltungsabgaben eingehoben werden. Diese Zahl spricht ebenfalls für sich. Mit den meisten Sondersteuern ist aber die Fremdenverkehrswirtschaft belastet. Um sie zu fördern gilt es, in erster Linie steuerliche und bürokratische Erschwernisse zu beseitigen. Meine Damen und Herren! Gestern wurde auch über den Zustand der Landesstraßen gesprochen. Es kommt häufig vor, daß bei der Einmündung einer Hauptstraße in eine Landesnebenstraße ein Schild mit der Aufschrift ,, Wintersperre" steht. Die Gemeinden bemühen sich, Einrichtungen, wie kleinere Schipisten und andere Annehmlichkeiten zu schaffen, um aus dem Dornröschenschlaf erweckt zu werden. Wenn nun der Fremde kommt und das Wort Wintersperre liest, veranlaßt ihn die Bezeichnung ,,Sperre' abzudrehen, und das Bemühen der Gemeinde ist hinfällig. Es könnte doch, wenn sich das Land schon der Verpflichtung der Straßenräumung entledigen will, bestimmt eine andere Bezeichnung gewählt werden. Das Wort ,,Sperre" halte ich auf jeden Fall für eine unzweckmäßige Härte, die das Bemühen der Gemeinden, die auch die Straßenreinigung übernehmen, zunichte macht. (Beifall rechts.) DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Wort gelangt Herr Abg. K o s l e r. Abg. KOSLER: Hoher Landtag! Meine Damen und Herren! Zunächst eine kurze Replik auf die Ausführungen meines Herrn Vorredners. Herr Kollege Rigl, ich glaube nicht, daß Sie zu Ihren Ausführungen, die Sie soeben über die Getränkesteuer gemacht haben, die Zustimmung der Kommunalpolitiker erhalten werden, auch nicht jener Ihrer eigenen Partei. Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Schon einer meiner Vorredner hat, über den Fremdenverkehr sprechend, sehr deutlich hervorgehoben, wieviel für die Fremdenverkehrsförderung, Ortsverschönerung und Fremdenverkehrswerbung durch die Verschönerungs- bzw. Fremdenverkehrsvereine in den einzelnen Orten geleistet wird. Ich darf mich dem Dank, der In diesem Zusammenhang den unzähligen Funktionären und Mitarbeitern dieser Organisationen ausgesprochen wurde, auch namens meiner Fraktion mit Begeisterung anschließen. Ich darf ferner hervorheben, daß auch eine Reihe von anderen Einrichtungen, wie der Landesfremdenverkehrsverband, die Handelskammer und selbstverständlich vor allem das Fremdenverkehrsreferat der Niederösterreichischen Landesregierung, sehr intensiv bemüht sind, den Fremdenverkehr in unserem Bundesland zu fördern. Insbesondere das Fremdenverkehrsreferat der Niederösterreichischen Landesregierung hat eine sehr umfangreiche Arbeit zu meistern. Der Aufgabenbereich dieses Referates ist sehr weit gesteckt. Ich erinnere daran, daß in diesem Referat auf Grund des Niederösterreichischen Fremdenverkehrsgesetzes nicht nur die Angelegenheiten behördlicher Art zu erledigen sind, sondern auch die Fremdenverkehrsbelange des Landes Niederösterreich nach außenhin vertreten werden müssen, daß viel Arbeit die Erstellung der niederösterreichischen Fremdenverkehrsstatistik bereitet und daß diese Werbung für den Fremdenverkehr des gesamten Landes und einiger besonderer Fremdenverkehrsgebiete gleichfalls große Leistungen verursacht. Dazu kommen auch noch die Förderungsmaßnehmen, die eine besondere Aufgabe darstellen, sowohl für die Herausgabe von Prospekten als auch für die Errichtung von Fremdenverkehrseinrichtungen, die Durchführung von Veranstaltungen und den weiteren wirtschaftlichen Ausbau der Fremdenverkehrsbetriebe. All diese Leistungen, die hier von der Gemeinde und dem zuständigen Referat der Landesregierung vollbracht werden, verdienen höchste Würdigung. Und gerade deshalb ist man immer wieder sehr erstaunt und betroffen, wenn man die ungünstige Entwicklung im niederösterreichischen Fremdenverkehr aus der Fremdenverkehrsstatistik entnehmen kann. Auch das Jahr 1966, und zwar die ersten neun Monate, haben uns keinen besonderen Aufstieg gebracht. Wir haben zwar mit 4,662.000 Gesamtnächtigungen - dabei sind 699.000 Ausländernächtigungen zu verzeichnen - gegenüber dem Jahr 1965 ein kleines Plus von 68.000 Nächtigungen festzustellen, gegenüber dem Jahre 1964 ist das aber noch immer ein sehr deutliches Minus von fast 100.000. Dagegen weist die gesamtösterreichische Statistik für die (ersten neun Monate immerhin noch eine Erhöhung um 0,5 Prozent auf - obwohl wir hier auch eine Verflachung des Aufstiegs erkennen müssen. Außerdem ist dieser Statistik die beachtliche Feststellung zu entnehmen, daß wir eben im Jahre 1965 höher standen als im Jahre 1964, was in Niederösterreich nicht der Fall war. Der Umfang des Fremdenverkehrs wächst also in Gesamtösterreich auch immer, in Niederösterreich nur mehr in einem so geringen Ausmaß gegenüber dem Jahre 1964 überhaupt nicht -, daß man von einer rückläufigen Tendenz sprechen muß. Ich war in der Budgetdebatte des vergangenen Jahres der einzige Sprecher, der im Zusammenhang mit der Rückentwicklung des Fremdenverkehrs ausdrücklich betont hat, daß man es sich zu einfach macht, wenn man schlechtes Wetter und Naturkatastrophen als die alleinigen Ursachen hinstellt. Ich bin heute in der glücklichen Lage, fast wortgetreu meine Aussage im Tätigkeitsbericht der Handelskammer Niederösterreich wiederzufinden. Wir müssen eines bedenken: Schlechtwetter und Überschwemmungsgefahren gibt es nicht nur in unserem Bundesland, man trifft sie auch in anderen Bundesländern, sie sind im Vorjahr und auch heuer in anderen Bundesländern unter Umständen viel ärger aufgetreten. Es würde vielleicht auch der Vergleich zwischen einzelnen Jahren noch nicht so sehr die Feststellung untermauern, daß wir bezüglich des Fremdenverkehrs einige Sorgen haben müßten, wenn wir nicht auf etwas weitere Sicht eine Tendenz feststellen könnten, die nicht erfreulich ist. Aus der Statistik ist zu entnehmen, daß wir seit dem Jahre 1961 in bezug auf die Übernachtungszahlen in Gesamtösterreich eine Zunahme von ca. 30 Prozent, im Bundesland Niederösterreich aber nur eine solche um ca. 10 Prozent verzeichnen können. Mit anderen Worten heißt das, das Anwachsen in den letzten fünf Jahren ist in Niederösterreich nur bis zu einem Drittel festzustellen. Diese harten Tatsachen können noch dadurch ergänzt wenden, daß wir im bereits erwähnten Normaljahr 1937 - ich möchte dieses Jahr jedoch nicht als ,,Normaljahr" Bezeichnen, da Österreich ja damals in einer schweren wirtschaftlichen Krise stand - in bezug auf die Zahl des Fremdenverkehrs immerhin mit 16,8 Prozent beteiligt waren; im Jahre 1965 betrug diese Beteiligung 6,7 Prozent. Die Statistik sagt bei kleinen Differenzierungen nicht so klar aus, ich glaube aber, so große Verschiebungen wie zum Beispiel von 16,8 Prozent auf 6,7 Prozent sind doch unbestreitbare Tatsachen, sie sind sehr aufschlußreich und müßten uns immer wieder ermahnen. Ich betone nochmals, es wind auf diesem Gebiete politisch und Verwaltungsmäßig viel geleistet. Darf ich aber in diesem Zusammenhang vorschlagen, daß es vielleicht einmal sehr zweckmäßig wäre, andere nachdenken zu lassen; man sollte ein Team von Experten zusammenrufen, die möglichst keine Niederösterreicher sind - am geeignetsten wären Wiener, denn wir erwarten uns ja aus der Großstadt Wien die Masse der Besucher -, und ihre Meinung hören, warum sich in Niederösterreich der Fremdenverkehr nicht besser entwickeln kann. Hohes Haus! Zum Abschluß noch ein Wort über das niederösterreichische Landesreisebüro. Der Umsatz des niederösterreichischen Landesreisebüros bat sich im Jahre 1966 um 5 Prozent gegenüber dem Jahre 1965 verschlechtert. Man mag sagen, das hängt mit dem Rückgang der Wirtschaft oder mit der Witterung zusammen. Ich glaube, da13 dieser Rückgang des Umsatzes kein erfreuliches Zeichen für uns ist. Mir scheint auch die Zahl von 17.650 Personen, die das Landesreisebüro im Laufe des Jahres nach Niederösterreich vermittelt hat, äußerst gering. Ich glaube, ein privates Reisebüro in einer unserer niederösterreichischen Städte - so zum Beispiel das Reisebüro Gärtner in St. Pölten dürfte vermutlich mehr Reisende aufzuweisen haben, die durch Vermittlung dieses Reisebüros weggefahren sind, natürlich nicht nur allein nach Niederösterreich. Die Gründe, glaube ich, liegen deutlich auf der Hand. Der Standort des Landesreisebüros hier in Wien, fernab von den Hauptgeschäftsstraßen, dürfte noch immer nicht der richtige sein. Die Tatsache, daß wir nirgends echte Filialen dieses Landesreisebüros finden, Außenstellen auf den Bahnhöfen oder hier am Ring in den Unterführungen - dort, wo zwar das Burgenland verbeten ist, nicht aber Niederösterreich -, dürfte ein weiterer Schaden für das Landesreisebüro sein. Ich glaube sogar, der Name ist nicht der günstigste. Vor gar nicht langer Zeit hat mich ein bekannter Wiener, der wegen eines Aufenthaltes in unserem Bezirk an mich herangetreten ist, dem ich aber nicht die gewünschte Auskunft geben konnte und ihn daher an das Landesreisebüro verwies, gefragt, ja dort wird so etwas gemacht, ich habe es schon gesehen, habe aber geglaubt, es handle sich um eine Dienststelle der Niederösterreichischen Landesregierung. Man sollte darüber nachdenken, ob der Name allein schon genügt, werbewirksam zu sein; so wie ich überhaupt glaube, daß die Werbewirkung des Niederösterreichischen Landesreisebüros äußerst gering ist. Meine Damen und Herren! Wir bekommen als Abgeordnete doch im Laufe des Jahres unzählige Zuschriften, denen meistens - auch das sei erwähnt - ein Erlagschein beiliegt. Wir bekommen aber - zumindest ich nicht - nichts, aber schon gar nichts vom Niederösterreichischen Landesreisebüro, keinen Prospekt, kein Blatt, auf dem steht, dort und dort hätten wir dieses oder jenes Arrangement. Nichts! Ich will damit nicht sagen, daß wir Abgeordnete in erster Linie solche Werbungen bekommen sollten, wenn aber gegenüber den Abgeordneten des eigenen Landes so vorgegangen wind, kann ich mir vorstellen, daß auch sonst zuwenig geschieht, um die Tätigkeit dieses Landesreisebüros zu intensivieren und für Niederösterreich dienstbar zu machen. Darf ich abschließend noch feststellen, wenn der Fremdenverkehrswirtschaftszweig Erfolge in noch umfangreicherem Ausmaße erreichen will, müssen wir gerade auf diesem Gebiete eng zusammenarbeiten, damit ein großer Personenkreis an den Problemen des Fremdenverkehrs Interesse erhält; nicht nur der Gastwirt, nicht nur die Beherbergungsbetriebe, jeder einzelne in einem Fremdenverkehrsort, mag er Arbeiter oder Angestellter sein, soll lebhaft an den Fremdenverkehrsbelangen seines eigenen Ortes, seines Gebietes und darüber hinaus des Landes Niederösterreich interessiert sein. Wir müssen alles tun, um herauszubekommen, was der eigentliche Grund ist, daß wir in Niederösterreich im Fremdenverkehr nicht so richtig vorwärts kommen. Im Laufe der Debatte der vergangenen Woche hat ein prominenter Abgeordneter der ÖVP-Fraktion bezüglich des Fremdenverkehrs gemeint, es wäre Verschiedenes geschaffen worden, was bei uns in Niederösterreich ,,daneben vorbeigeht". Vielleicht ist das einer der Gründe, die uns soviel Schaden verursachen. Der Ausdruck „daneben vorbeigeht" scheint mir zu weitläufig, man müßte versuchen herauszubekommen, warum, wie, wann, seit wann und in welcher Richtung geht der Strom der Fremden an Niederösterreich ,,vorbei". Dann wird man auch feststellen 'können, was zu tun ist, damit hier ein Wandel eintritt, zum Wohle unseres Landes Niederösterreich und seiner Bevölkerung. (Beifall bei der SPÖ.) PRÄSIDIENT WEISS: Zum Wort gelangt Herr Abg. D i e t t r i c h . Abg. DIETTRICH: Herr Präsident, Hoher Landtag, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe die Ehre, über die Wirtschaftsförderung global und auf das Land Niederösterreich abgestimmt zu sprechen. Die Voraussagen, daß sich unsere Wachstumsentwicklung nicht mehr so erfolgreich vollziehen dürfte wie bisher, hat mein geschätzter Vorredner schon dargelegt. Er hat eine Feststellung der Niederösterreichischen Handelskammer zitiert, die sich schon vor langer Zeit mit diesen Problemen sehr eingehend beschäftigt hat. Leider ist nun diese Verflachung eingetreten, und wir müssen uns mit dieser Tatsache auch vertraut machen. Aus einer Aussendung des Wirtschaftsforschungsinstitutes ist zu entnehmen, daß im Jahre 1967 wahrscheinlich nicht einmal jene 4 Prozent Wachstumsrate erreicht werden kann, die bisher als Minimalbasis bezeichnet wurde. Es liegt auf der Hand, daß diese Entwicklung zu einer gewissen Besorgnis führt und daß nur umfassende wirtschaftspolitische Maßnahmen geeignet wären, diese Schwäche zu überwinden. Ich glaube, der größte Fehler wäre es, in Skeptizismus und Resignation zu verfallen. Auch hier gilt wie auf verschiedenen anderen Gebieten das Motto „Die Gegenwart braucht nur Tapfere und Tüchtige, es ist weder Selbstgefälligkeit noch Konformismus gefragt, und auch an Zaghaften und Fanatikern ist kein Bedarf". Ich habe einmal in einem Seminar Professor Heinrich von der Hochschule für Welthandel in Wien gefragt, ob eine Wiederholung der schweren Krisenzeit der dreißiger Jahre seiner Meinung nach denkbar wäre. Professor Heinrich hat mir zur Antwort gegeben: ,,Sollte !die Menschheit nicht wieder in einen Weltkrieg schlittern, wären die Wirtschaftswissenschaften heute in der Lage, Erscheinungen ähnlicher Art zu verhindern." Es würde über mein heutiges Thema hinausreichen, im einzelnen über die Methode und die Maßnahmen zu sprechen, die in einem solchen Falle notwendig wären. Ein Vergleich jedoch, meine hochgeschätzten Damen und Herren, ist angebracht. Ähnlich wie in der Medizin in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte auf dem Gebiete der Heilung und Entwicklung neuer Medikamente erzielt werden konnten - ich möchte hier nur beispielsweise die Menschheitsgeißel der Kinderlähmung anführen, die man medizinisch und klinisch einschränken konnte -, so sind auch auf dem Gebiete der Wirtschaft neue fundamentale Erkenntnisse gewonnen und Methoden entwickelt worden. Um nun wieder zu meinem Ausgangspunkt zu kommen, wäre auch über die gezielten Maßnahmen des Landes zu sprechen. Erste Aufgabe der Wirtschaftsförderung des Landes wäre es, die Rationalisierungs- und Modernisierungsbestrebungen unserer Klein- und Mittelbetriebe durch Gewährung von zinsenbegünstigten Darlehen bis zu einer Höhe von 50.000 Schilling mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einer Verzinsung von 3,75 Prozent per anno zu unterstützen. Es ist damit eine große Möglichkeit geschaffen, unseren Gewerbe- und Handeltreibenden ihre Werkstätten und Geschäfte den Erfordernissen der Jetztzeit anzupassen, denn gerade diese Klein- und Mittelbetriebe sind es, welche als Säulen der österreichischen Wirtschaft angesehen werden können; sind es doch diese Betriebe, welche im wahrsten Sinne des Wortes das Rückgrat der Finanzkraft einer Gemeinde bilden und auch als Steuerträger sehr bedeutungsvoll und willkommen sind. Die Bedeutung dieses Wirtschaftsförderungsfonds, aus dem diese Kredite gewährt werden, kann aus der Tatsache ermessen werden, daß seit dessen Bestehen 3300 Darlehen in einer Gesamthöhe von 80 Millionen Schilling ausgegeben wurden. Mein Freund Kaiser hat 74 Millionen Schilling genannt. Diese westlichen 6 Millionen Schilling stammen, glaube ich, aus dem Nachtragsbudget. Dem gleichen Zweck dient die gemeinsame Kreditaktion, an der sich Bund, Land und Handelskammer beteiligen. Im Rahmen dieser Aktion sind bisher rund 2000 Darlehen von insgesamt 43 Millionen Schilling gewahrt worden. Ein weiteres Bestreben unserer Wirtschaftsförderung ist es, Betriebe in wirtschaftlich ungünstig gelegene Gebiete Niederösterreichs zu bringen. In diesem Zusammenhang ist ja von dieser Stelle aus schon sehr viel gesprochen worden. Es liegt im Interesse einer gewissen Strukturverbesserung des Landes, daß auch in jenen Gebieten Niederösterreichs neue Unternehmungen eingerichtet werden sollen und müssen, wo eben diese Schwächen offenkundig sind. Um diese Maßnahmen auch durchführen zu können, hat der Landtag im Jahre 1962 den sogenannten Betriebsinvestitionsfonds geschaffen. Es wurden bis heute für den vorerwähnten Zweck 55 Millionen Schilling genehmigt. Mit diesem Betrag konnten 112 zinsenbegünstigte Darlehen gewährt wenden, deren Höchstgrenze 1 Million Schilling beträgt und deren Laufzeit mit 10 Jahren begrenzt ist. Ich kann sagen, daß sich die Gründung des Betriebsinvestitionsfonds sehr segensreich für Niederösterreich ausgewirkt hat. Es wurden mit dessen Hilfe in den letzten 5 Jahren 40 Neugründungen und damit ungefähr 2600 Arbeitsplätze geschaffen. Die Förderung der gewerblichen Wirtschaft erstreckt sich aber nicht allein auf die Hilfeleistung für Klein- und Mittelbetriebe. Es sind auch zahlreiche andere Aufgaben, die erfüllt wurden und auch weiterhin erfüllt werden müssen. So werden beispielsweise die Rationalisierungsuntersuchungen in einzelnen Gewerbezweigen unterstützt und insbesondere größere Beiträge für die einzelnen Ausstellungen und Messen, welche im wahrsten Sinne des Wortes Schaufenster der Wirtschaft unseres Landes darstellen, geleistet. In diesen Rahmen fällt auch die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an Besucher gewerblicher und kaufmännischer Lehranstalten. Im Jahre 1966 hat hier der finanzielle Einsatz 825.000 Schilling ausgemacht. Das ist auch ein immerhin bedeutender Beitrag. Schließlich wäre noch auf die Förderung der unterentwickelten Gebiete in Niederösterreich einzugehen, die besonders auf dem gewerblichen Sektor liegen. Mit Hilfe des Bundes wurden auch hier Beträge in einer Größenordnung von 1,2 Millionen Schilling bereitgestellt. Auch diese Aktion dient dazu, dem wirklich großen Nachholbedarf Niederösterreichs ein wenig gerecht zu werden. Ich glaube, es sind alle Anstrengungen zu unternehmen, um die erreichten Lebensbedingungen auch in den kommenden Jahren zu erhalten, denn leider Gottes ist eine Wohlstandssteigerung derzeit, sollten nicht alle Vorzeichen trügen, kaum zu erwarten. Es hat sich nun herausgestellt, daß die Meinung, die Wirtschaft müsse ständig und ohne jede Unterbrechung eine reale Einkommenserhöhung bringen, zumindest für eine gewisse Zeit revidiert wenden muß. Meine Damen und Herren, die großen Anpassungsschwierigkeiten, die bevorstehen, werden zweifelsohne für Arbeitnehmer und Arbeitgeber Selbstdisziplin notwendig machen. Disziplin bei den Gewinnspannen, aber auch Disziplin bei den Lohnwünschen. Es steht fest, daß es am Bemühen der Sozialpartner gelegen sein wird, neue Fortschritte im Interesse der Wirtschaft zu erzielen, um durch Anpassung Restriktionsschwierigkeiten zu überwinden. (Beifall bei der ÖVP.) PRÄSIDENT WEISS: Zum Wort kommt Herr Abg. S c h e i d l. Abg. SCHEIDL: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte mir erlauben, die Ausführungen einiger meiner Vorredner über den Fremdenverkehr durch die kurze Behandlung eines Spezialthemas zu ergänzen, von dem ich sehr gut weiß, daß es intensiv auf den Fremdenverkehr Bezug nimmt. Der Zusammenhang zwischen der Entwicklung des gesamtösterreichischen Fremdenverkehrs und dem Personenseilbahnwesen in Österreich ist erkennbar, wenn man das Anwachsen der Anzahl solcher Seilbahnanlagen seit dem Jahre 1945 in Betracht zieht. Mit Mitte des Jahres 1966 gab es in Österreich an sogenannten Hauptseilbahnen, wozu nach der Fachterminologie auch Doppelsessellifte zählen, 126 Stück, an Kleinseilbahnen – das sind Sessellifte - einschließlich vier sogenannter Kombilifte - das sind kombinierte Sessel- und Schlepplifte - 173 Stück und an Schleppliften 1121 Stück, zusammen also 1420 Anlagen in ganz Österreich. Österreich steht damit ex aequo mit der Schweiz ungefähr gleich hinter dem großen Italien an der zweiten Stelle in Europa. Zum gleichen Zeitpunkt gab es in Niederösterreich drei Hauptseilbahnen, 11 Sessellifte und 77 Schlepplifte. Aus einem Bericht der Abteilung I/7 vom 24. November 1966 an die Landesamtsdirektion entnahm ich in einem Satz die lapidare Feststellung, daß auf dem Gebiete +des Seilbahnwesens im Berichtszeitraum keine Veränderungen aufgetreten sind. Die jährlich zweimal durchgeführten Überprüfungen der Sessellifte haben einen guten Erhaltungszustand der Anlage gezeigt. Baureife Projekte Für die Errichtung neuer Sesselliftanlagen in Niederösterreich liegen derzeit nicht vor. Es sind jedoch Untersuchungen im Gange für die Errichtung eines Doppelsesselliftes von der Cholera-Kapelle im Helenental auf das Eiserne Tor und eines Einzelsesselliftes in Reichenau-Rax. Bis zum 15. Dezember 1966 hat sich die Anzahl der Schlepplifte auf 81 erhöht. Dazu ist zu sagen, daß diese Schlepplifte nur für Winterbetrieb geeignet sind, weil man ja dazu Schnee braucht. Niederösterreich besitzt demnach zahlenmäßig etwa 6 Prozent der Gesamtanlagen von Österreich, und das ist, wenn man von Wien and dem Burgenland, die für Seilbahnen nur in einem sehr geringen Umfang in Frage kommen, absieht, der weitaus geringste Prozentsatz von allen Bundesländern. Es gilt auch für manche Gebiete Niederösterreichs die Erkenntnis, daß eine Intensivierung, eine effektvolle Intensivierung, des Fremdenverkehrs nur dann möglich ist, wenn in die Planung auch ein Seilbahnprojekt miteinbezogen wird. Selbstverständlich muß an der Spitze der Betrachtungen, Überlegungen der zuständigen Landesinstitutionen zum Beispiel stehen, ob ein Projekt auch förderungswürdig ist, ob zum Beispiel in ausreichender Zahl Sommerquartiere in einem Ort, in dem ein solcher Sessellift oder eine solche Seilbahn errichtet werden soll, vorhanden sind. In den meisten Fällen muß man auch sehen, ob zumindest ausbaufähige Winterquartiere vorhanden sind. Für eine richtige Beurteilung der zu erwartenden Frequenz muß auch das Einzugsgebiet berücksichtigt werden, wobei Niederösterreich Iden Vorteil hat, Wien - das wurde schon einmal erwähnt - als ergiebiges Hinterland betrachten zu können. Das Österreichische Institut für Raumplanung stellt in einem kürzlich herausgegebenen Buch mit dem Titel ,,Die Seilbahnen in Österreich und ihre Auswirkung auf die Wirtschaft" fest, daß - ich zitiere wörtlich - ,,mitunter das Fehlen genügend naher Möglichkeiten zu sehr langen Anfahrtswegen führt". (Dritter Präsident Reiter übernimmt den Vorsitz.) In diesem Zusammenhang ist angeführt, man habe festgestellt, daß in Tauplitz die Ausflügler zu 50 Prozent aus Wien stammen. Es heißt dort weiter: „Vor allem für die Großstädte Wien, München und Stuttgart ist der Bedarf an Seilbahnen im Ausflugsbereich nicht gedeckt." Sogar der Gedanke der Mitwirkung dieser Städte bei einer Finanzierung weniger rentabler Bahnen, wie zum Beispiel in München offiziöse Kreise Interesse für die Errichtung von Seilbahnen in Tirol zeigten, wind dort ausgesprochen. Eine Parallele in der Relation Wien - Niederösterreich wäre in diesem Zusammenhang zumindest überlegenswert. Es ist nicht meine Absicht, die niederösterreichischen Hoffnungsgebiete für den Personenseilbahnbau zu nennen, weil dies vermutlich nur unvollständig geschehen könnte, und ich mich hüten werde, mich dadurch mit Vertretern gewisser Gebiete in Widerspruch zu setzen, da ich das eine oder andere Gebiet nicht nennen kann. Es ist aber bekannt, daß die unter Leitung eines Fachmannes stehende, im Haus befindliche Dienststelle für Fördertechnik sich seit langem mit einer solchen Konzeption befaßt, selbstverständlich, wie ich weiß, auch Herr Landeshauptmannstellvertreter Hirsch selbst. Es wird darüber hinaus Sache der Gemeinden und Mandatare sein, wirklich nur ernst zu nehmende Projekte regional zu vertreten. Das Land wird auch darüber zu wachen haben, daß nicht durch Neuerrichtungen eine Konkurrenzierung bestehender Anlagen entsteht. Wesentlich ist selbstverständlich auch die Frage des zu wählenden Seilbahnsystems, das ein Optimum hinsichtlich der Gestehungskosten, der Betriebskosten, der Förderleistung und sonstiger örtlicher Erfordernisse gewährleisten soll. Das schwierigste Problem jedoch wird dabei in den meisten Fällen, von denen in diesen 3 Tagen die Rede war, die Frage der Finanzierung sein, notabene in näherer Zukunft, wenn ich richtig unterrichtet bin, ERP-Kredite für diese Zwecke kaum mehr zur Verfügung stehen wenden, sondern – Herr Landeshauptmannstellvertreter Hirsch nickt hier zustimmend - höchstens Zinsenzuschüsse aus dem ERP-Fonds. Wenn man annimmt, daß etwa 30 Prozent Eigenkapital für die Errichtung einer Seilbahnanlage aufgebracht werden können bzw. müssen und der Rest zu erträglichen Bedingungen beschafft wird, dann kann man damit rechnen, daß auch Privatinteresse für die Beteiligung am Bau einer solchen Anlage geweckt werden kann. Dazu wäre es aber notwendig, oder ist es notwendig, daß die am Bau interessierte Gemeinde in die Lage versetzt wind, eine Haftung für einen Bankkredit zu übernehmen, oder daß eventuell vom Land aus dem Fremdenverkehrsfonds, wie das zum Beispiel - es ist mir das konkret bekannt - seit einiger Zeit praktiziert wird, Mittel gegeben werden. Es wunden zum Beispiel einige Seilbahnen in Heiligenblut auf diese Weise mitfinanziert. Ich führe Kärnten an, weil ich das von Kärnten weiß. Es könnte auch sein, daß andere Bundesländer das tun. Ich weiß es im Augenblick nicht. Es könnten zum Beispiel widmungsgebundene Zinsenzuschüsse gewährt werden, wie eis Kärnten macht, die das Land nicht zu sehr belasten würden. Vielleicht könnte aber auch in Gemeinschaft mit anderen Bundesländern ein Vorstoß in die Regierung unternommen werden, daß die Verkehrssteuer für Seilbahnen zur Landessteuer wird, damit eventuell von hier aus Mittel frei werden könnten; oder aber vielleicht wäre es möglich, einen Ersatz für den entfallenden ERP-Fonds zu schaffen, wofür die Gewährung langfristiger Kredite, ca. 15 bis 16 Jahre ist üblich, bei 2 Stillhaltejahren ermöglicht würde, wobei die Rückflüsse weitere Befruchtung bringen würden, wie das bei den ERP-Krediten auch möglich war. Die Begründung ,des Fonds könnte ich mir vorstellen aus einer Anleihe mit Landeshaftung, ähnlich der Energieanleihen. Es ist nämlich zu bedenken, daß Personenseilbahnen für sich ja in den seltensten Fällen, insbesondere nicht in den ersten Jahren, lukrativ sind, daß sie aber der Umgebung, den Gemeinden und damit dem Lande, der Wirtschaft Nutzen bringen, soferne vor einer Errichtung die Zweckmäßigkeit der Anlage überlegt wurde. Auch den bestehenden Anlagen und damit den Sitzgemeinden könnte geholfen werden, wenn das Landesfremdenverkehrsamt im Fernsehen für die weniger in Frage kommenden Orte im Winter kurze, möglichst mit Abfahrtsbildern oder sonst irgendwelchen attraktiven Beigaben versehen, Schneeberichte zur Information der Wiener und Bewohner größerer Industrieorte durchgeben würde, wenn man in Prospekten - es ist heute schon erwähnt worden, daß es zuwenig Prospekte g2bt - auch auf die günstige Möglichkeit der verkehrsschwachen Wochentage für die Schuljugend, Gendarmerie, Bundesheer, Schichtarbeiter, Geschäftsleute mit Wochensperrtagen - über die Innungen könnte ich mir das vorstellen - hinweist. Es werden vermutlich für Niederösterreich nicht mehr sehr viele Personenseilbahnen in Frage kommen; dort aber, wo sie der Allgemeinheit Erholung und Nutzen bringen können, sollte man ihre Errichtung und ihre spätere Betreuung, selbstverständlich unter dem Postulat, die Natur zu erschließen und nicht zu stören und nach ökonomischen Grundsätzen, fördern. Meine Damen und Herren! Die österreichischen Personenseilbahnen genießen in ihrer technischen Wertung und hinsichtlich der installierten Sicherheitseinrichtungen europäisch gesehen einen guten Ruf. Wir sind in Niederösterreich damit mehr als gleichwertig der Schweiz, Frankreich, Italien, der deutschen Bundesrepublik und mehr als gleichwertig auch den Vereinigten Staaten von Amerika. Österreich dient in diesen Belangen auch als Vorbild für die Oststaaten, die sich unsere Seilbahnbedingnisse und auch unsere Sicherheitsvorschriften zu eigen gemacht halben. In den zuständigen Aufsichtsbehörden, das sind für größere Seilbahnen das Bundesministerium für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen, für Schlepplifte das Bundesministerium für Bauten und Technik sowie die Delegierten der Landesbehörden, sitzen qualifizierte fachkundige Beamte, insbesondere auch in Niederösterreich, die für die Überwachung und die Betreuung von Seilbahnanlagen Sorge tragen. Diese Seilahnanlagen gewährleisten den Fahrgästen weitgehende Sicherheiten. Es könnte durch eine Förderung von Seilbahnanlagen, die wertvolle, moderne Verkehrseinrichtungen sind, auch der Fremdenverkehr intensiviert werden. Ich denke 'dabei nicht an eine wahl- und maßlose Förderung, dort aber, wo wohlüberlegt gehandelt wird, sind die Personenseilbahnen sicher in der Lage, dem Fremdenverkehr, der auch in Niederösterreich einen Aufschwung nehmen soll, besonders zu dienen. (Beifall bei der SPÖ.) DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Worte gelangt Herr Abg. M a u ß . Abg. MAUSZ: Herr Präsident, Hoher Landtag! Meine Ausführungen zur Gruppe 7 passen wohl nicht zum Thema Fremdenverkehr, ich spreche nämlich über den Weinbau, aber ich glaube, auch der Fremdenverkehr braucht den Weinbau, weil der österreichische und speziell der niederösterreichische Weinbau unserem Gebiet und unserer Bevölkerung einen besonderen Stempel aufdrückt. In der Gruppe 7 sind für die Landes-Landwirtschaftskammer Förderungsbeiträge vorhanden. Die LandesLandwirtschaftskammer unterstützt die Sonderkulturen, in erster Linie den Weinbau. Ich möchte dem Hohen Landtag namens der Weinhauer danken, daß er am 20. Jänner 1966 das Weinbauregelungsgesetz einstimmig beschlossen hat. Dieses Gesetz wunde am 20. Jänner beschlossen, und trotzdem bemühen sich schon viele, es wieder aufzulockern. Eis ist mir unverständlich, wieso ein Landeskammerrat der sozialistischen Fraktion bei Iden Stadtgesprächen in Tulln an den Herrn Bundesminister die Frage stellen kann: „Herr Minister, wäre es nicht doch möglich, 15.000 bis 20.000 ha Weingärten setzen zu können." Derselbe Landeskammerrat hat in der LandesLandwirtschaftskammer mitgestimmt, daß das Weinbauregelungsgesetz beschlossen wurde. Hohes Haus! Der niederösterreichische Weinbau hat sich in den letzten 30 Jahren um 7 Prozent vermehrt, im Bundesland Burgenland um 360 Prozent, in der Steiermark ist er zurückgegangen, weil sich der Weinbau ober der Frostgrenze abspielt. (Zwischenrufe bei der SPÖ.) Jetzt frage ich Sie, wenn Sie schon die Weinbauvertreter sind, wer kann in Zukunft Weingärten setzen, wer hat die Möglichkeit dazu, wer betreibt die Pflege und wo wird er gesetzt? Der Großteil im Burgenland und nicht in Niederösterreich, die Großgrundbesitzer und die Kapitalkräftigen, aber doch niemals der kleine Mann. Daher meine berechtigte Frage, wieso kommt dieser Landeskammerrat dazu, den Herrn Bundesminister zu ersuchen, !dieses Gesetz lückenhaft zu machen? Wenn wir im Jänner ein Gesetz beschließen und dann im Dezember wieder aufzulockern versuchen, wenden wir in unserer Berufssparte wahrscheinlich nicht ernst genommen werden. Hohes Haus! Der niederösterreichische Weinbau macht 3/5 des gesamtösterreichischen Weinbaues aus; er umfaßt 30.000 ha Fläche mit 18.000 Betrieben und 37.000 Beschäftigten. Der Rohertrag aus dem Weinbau beträgt 1,1 Milliarden Schilling, das sind über 20 Prozent des Rohertrages des gesamten Pflanzenbaues. Die Produktion dm niederösterreichischen Weinbaues liegt im Durchschnitt zwischen 900.000 bis 950.000 hl. Der gesamtösterreichische Weinbau hat eine Fläche von 50.000 ha, der durchschnittliche Hektarertrag liegt zwischen 40 und 50 hl, das ergibt eine Weinmenge von ca. 2,5 Millionen hl, der jährliche Verbrauch beträgt 1,500.000 Hektoliter. Nur durch die Steigerung der Qualität und die Senkung der Produktionskosten wird es möglich sein, der österreichischen Bevölkerung einen guten Wein zu einem erschwinglichen Preis bieten zu können. Mit dem Weinbauregelungsgesetz wurden auch die Rebsorten beschlossen und genehmigt. Das ist deshalb besonders wichtig, weil wir nun die bestehenden Qualitätssorten weiterentwickeln und weiterveredeln können. Der in der Gruppe 7 unter Voranschlagsansatz 7319-72 aufscheinende Betrag von 5 Millionen Schilling ist der Hagelversicherung gewidmet. Sie ist besonders für den Weinbauer dringend notwendig, denn es werden dadurch die Risken unseres Berufszweiges herabgesetzt. Wir haben in Niederösterreich drei Bezirke, die sich mit einer Hagelabwehr befassen; leider wurden dafür keine Budgetmittel bereitgestellt. Darf ich hier eines feststellen: Die Hagelversicherung bezahlt ,den Weinbauern den direkten Schaden, der indirekte Schaden ist aber bei jungen Kulturen wesentlich größer; außerdem bezahlt die Hagelversicherung nur demjenigen, der versichert ist. Bei der Hagelabwehr und bei der Weinbauförderung werden alle Nutznießer dieser Institution, und zwar deshalb, weil der indirekte Schaden zum Teil verhindert wird und weil auch der Kleingärtner und der Private in diesen Genuß kommt, wenn kein Hagel Schaden anrichtet. Hohes Haus! Es wind in nächster Zeit sicher über die Frage der Schaffung eines Weinwirtschaftsgesetzes gesprochen werden. Wir müssen darüber ernstlich nachdenken, denn die beängstigenden Schwankungen auf dem Preissektor und auf dem Weinmarkt werden uns in naher Zukunft schwer zu schaffen machen. Wir wenden zur Kenntnis nehmen müssen, daß wir - auch wenn wir eine Rekordernte haben - jährlich 97.000 Hektoliter Wein einführen müssen. Da wir schon in den nächsten Jahren mit einer Eigenproduktion von ungefähr 2,5 bis 3 Millionen Hektoliter rechnen müssen, also um 500.000 Hektoliter mehr, wind das Weinwirtschaftsgesetz für uns Weinhauer bestimmt zwingend notwendig sein. Was wir in der nächsten Zeit brauchen, ist nicht Parteipolitik, sondern wir brauchen für die Agrarwirtschaft und insbesondere für den Weinbau eine bessere Billdungspolitik, eine gerechte Sozialpolitik, eine gesunde Strukturpolitik, eine vernünftige Investitionspolitik und eine gute Markt- und Preispolitik. Warum streben wir das an? Wir wollen unsere bäuerliche Bevölkerung und speziell die kleinen Produzenten, die mit 80 Prozent das Gros des Weinhauerberufsstandes ausmachen, wirtschaftlich besserstellen und ihnen die Möglichkeit geben, auch in Zukunft ihren Grund und Boden bewirtschaften zu können, um einem zu dienen, nämlich unserem höchsten Herrn, dem Konsumenten. (Beifall rechts.) DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Wort gelangt Herr Abg. B i r n er. Abg. BIRNER: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wenn wir von der Förderung des Fremdenverkehrs sprechen, dann denken wir meistens an jene Gemeinden, die in den exponierten Fremdenverkehrsgegenden liegen, wie etwa Lilienfeld, die BuckIige WeIt oder überhaupt das gesamte Voralpengebiet. Ich glaube aber, wir dürfen deswegen nicht jene Gemeinden vergessen, die in weniger frequentierten Fremdenverkehrsgegenden liegen, sich aber trotzdem stark um die Hebung des Fremdenverkehrs bemühen. Ich denke vor allem an das Triestingtal und an dessen Mittelpunkt, die Stadtgemeinde Berndorf. Diese Gemeinde hat im Jahre 1960 mit dem Bau eines großen Erholungszentrums begonnen, und zwar mit der Anlage eines Zentralbades, wie es auch in Stockerau errichtet worden ist. Der Voranschlag belief sich damals auf 5 Millionen Schilling. Die Gemeinde hat dazu 1 1/2 Millionen Schilling aus Eigenmitteln aufgebracht und wollte den Rest durch Darlehen decken. Die Bauherstellung wurde durch verschiedene Schwierigkeiten in die Länge gezogen, wodurch mit diesen 5 Millionen Schilling das Auslangen nicht gefunden werden konnte. Die Stadtgemeinde Berndorf hat sich daher an das Land. Niederösterreich um einen Zinsenzuschuß gewandt, mußte aber die Erfahrung machen, daß ihr bis heute für dieses große Bauvorhaben noch kein Groschen zugeteilt worden ist. Diese Anlage ist vor 1 ½ Jahren eröffnet worden und hat einen Baukostenaufwand von insgesamt 13 Millionen Schilling erfordert. Daß der Bau nicht nur für den Fremdenverkehr, sondern auch für die Bevölkerung von Berndorf und die umliegenden Gemeinden notwendig werden würde, war von vorneherein klar. Da die Stadtgemeinde Berndorf allein ca. 10.000 Einwohner zählt, war es einfach nicht mehr tragbar, daß dort der Jugend keine Bademöglichkeit zur Verfügung steht. Die Gemeinde hat versucht, für dieses Projekt einen Zuschuß zu erhalten. Durch den Umstand, daß in Berndorf kein Fremdenverkehrsverein bestand, ergab sich die groteske Situation, daß zuerst ein solcher gegründet werden mußte, um über diesen Verein ein Darlehen aufnehmen zu können. Sonderbarerweise mußte die Gemeinde als Erbauer für diesen Verein als Bürge und Zahler auftreten. Außerdem mußte sie eine Bestätigung über die widmungsgemäße Verwendung der Mittel beibringen. Der ganze Vorgang kommt mir etwas sonderbar vor. Da die Stadtgemeinde Berndorf für dieses Großprojekt noch immer zahlen muß, bitte ich den Herrn Landeshauptmannstellvertreter Hirsch, ihr dadurch zu helfen, daß ihr endlich ein Zinsenzuschuß zu dem bei der Hypothekenbank aufgenommenen Darlehen gewährt wird. Ich möchte noch eine zweite lokale Angelegenheit erwähnen. Im Jahre 1960, zu jener Zeit, als die Gemeinde das eben besprochene Projekt zu bauen begonnen hat, erhielt sie von der Vereinigten Metallwerke AG. Berndorf ein Geschenk, das sehr zweifelhaft war. Sie bekam nämlich das Theater im Schenkungswege übertragen. Dieses wurde im Jahre 1899 von Krupp erbaut und zählt zu den schönsten Theatern unseres Landes. Nichtsdestoweniger wurde dieses Theater im Laufe der Jahre derart vernachlässigt, daß es sich in einem katastrophalen Zustand befand. Als die Gemeinde dieses Geschenk übernahm, gab es sehr verschiedene Meinungen. Die einen waren dafür, das Theater weiterhin verfallen zu lassen, und die anderen wollten es unbedingt der Nachwelt erhalten. So hat man sich schweren Herzens entschlossen, bedeutende Mittel aufzuwenden, um es in einen unserer Kultur würdigen Zustand zu bringen. Das Theater hat für das gesamte Triestingtal eine besondere Bedeutung, denn es ist praktisch der kulturelle Mittelpunkt dieses Gebietes. Es wird seit einigen Jahren nicht nur von Laiengruppen bespielt, sondern auch vom Stadttheater Baden, der Ländenbühne, dem Burgtheater und verschiedenen anderen Ensembles gerne benützt, da es einen ausgesprochen lieben und intimen Charakter hat: Als es zu den ersten Restaurierungsarbeiten gekommen ist, hat die Stadtgemeinde auch die Vertreter des Landes und des Bundes eingeladen. Es fanden Gespräche mit dem ehemaligen Landeshauptmannstellvertreter Popp, dem ehemaligen Landesrat Stika und in weiterer Folge mit Herrn Landeshauptmannstellvertreter Dr. Tschadek, Landesrat Kuntner, Landeshauptmannstellvertreter Hirsch und auch einem Vertreter des Unterrichtsministeriums statt. Im Gespräch des Bürgermeisters mit diesen verantwortlichen Herren ist zum Ausdruck gekommen, daß man sich die Kosten für die notwendige Restaurierung des Theaters brüderlich teilen wolle. Auf Grund dieser Gespräche wären auf jedem Partner ca. 500.000 Schilling entfallen. Die Stadtgemeinde Berndorf hat ihnen Anteil sofort bereitgestellt, genauso Herr Landeshauptmannstellvertreter Popp und das Referat des ehemaligen Landesrates Stika. Das Unterrichtsministerium und Herr Landeshauptmannstellvertreter Hirsch sind vorerst zu diesen Gesprächen nicht gestanden. Im Vorjahr hat sich Herr Landeshauptmannstellvertreter Hirsch von diesem Theater und der Notwendigkeit, es zu erhalten, so beeindrucken lassen, daß er vorerst 300.000 Schilling als Zuschuß zur Verfügung stellen ließ, was wir gerne entgegengenommen haben und wofür wir ihm heute noch besonders danken. Im Anschluß daran sind dann noch einmal 100.000 Schilling vom zuständigen Referat gegeben worden, so daß insgesamt vom Fremdenverkehrsreferat 400.000 Schilling aufgebracht wurden. Das Kulturreferat hat in Anbetracht der besonderen Situation dieses Theaters eine ,,Fleißaufgabe" geleistet und nicht nur die Zusage eingehalten, sondern darüber hinaus noch um 100.000 Schilling mehr gegeben, als ursprünglich vereinbart war, Herr Landeshauptmannstellvertreter Dr. Tschadek hat ebenfalls kräftig mitgeholfen, denn auch ihm ist dieses Theater eine Herzenssache. Er hat das Unterrichtsministerium immer wieder mit Briefen „bombardiert" und gebeten, man möge doch auch von seiten des Unterrichtsministeriums einen Zuschuß leisten. EIS wurden dann im Budget 1965 von seiten des Bundes 400.000 Schilling bereitgestellt; auch das wurde dankbar vermerkt. Diese Milde wurde allerdings dadurch etwas geschmälert, daß in der Zwischenzeit für das Darlehen entsprechende Zinsen aufgelaufen sind; ein beachtlicher Teil der hier vom Land und Bund gewährten Zuschüsse mußte an Zinsen gezahlt werden. Nachdem die Gemeinde noch immer an diesem Projekt zu zahlen hat und außerdem 100.000 Schilling von Herrn Landeshauptmannstellvertreter Hirsch ausständig sind, möchte ich Sie herzlichst bitten, zu Ihrer Zusage zu stehen und der Stadtgemeinde Berndorf demnächst diesen Betrag zuzuweisen. Ich bin überzeugt, daß Sie damit nicht nur Berndorf, sondern dem gesamten Triestingtal helfen, und wir werden es stets dankbar vermerken. (Beifall im ganzen Hause). DRITTER PRÄSIDENT REITER: Der Schulausschuß wind nach Unterbrechung dieser Sitzung seine Nominierungssitzung im Herrensaal abhalten. Ich unterbreche die Sitzung bis 14 Uhr 30 Minuten. (Unterbrechung der Sitzung um 13 Uhr 13 Minuten). PRÄSIDENT WEISS (um 14 Uhr 32 Minuten): Ich nehme die Sitzung wieder auf. Wir setzen die Verhandlungen zum Voranschlag dies Landes Niederösterreich für das Jahr 1967, Gruppe 7, fort. Zum Wort kommt Herr Abg. B r u n n e r. Abg. BRUNNER: Herr Präsident! Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! So wie im Vorjahr möchte ich mich auch heuer mit der Berufsausbildung der bäuerlichen Jugend befassen. Durch die Einführung des 9. Pflichtschuljahres, das erstmals in diesem Schuljahr zum Tragen kam, war es notwendig, auf dem Gebiete des landwirtschaftlichen Berufsschulwesens eine Neuorganisation durchzuführen. Die ansonsten in zwei Winterhalbjahren zu absolvierende Berufsschule wird ab diesem Jahr in einem Schuljahr zurückgelegt. Dabei wurde gleichzeitig das bisherige Unterrichtsausmaß von 480 Stunden auf 540 Stunden erhöht. Unterrichtet wird nach dem für ganz Österreich geltenden Lehrplan, der mit Erlaß des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft vom 11. März 1966 empfohlen wurde. Dieser Lehrplan baut sich nach entsprechender Abänderung durch das Zusammenwirken der Bundesländer auf. Ab diesem Schuljahr stehen für die Berufsschulen in Niederösterreich 13 Internate zur Verfügung. Diese sind in der Lage, rund 20 Prozent der Schulpflichtigen aufzunehmen; 80 Prozent aber müssen die zur Zeit bestehenden 140 externen Schulen besuchen. Die bisher gewonnenen Erfahrungen haben gezeigt, daß der eingeschlagene Weg, alle Berufsschüler internatsmäßig zu erfassen, der richtige wäre. Leider stehen dieser pädagogischen Erkenntnis die finanziellen Möglichkeiten entgegen. Es wind daher auch Aufgabe des Hohen Hauses sein, bei der Beratung des landwirtschaftlichen Schulerhaltungsgesetzes Möglichkeiten m erwägen, wie diese finanziellen Lasten bewältigt werden können. Betrüblich ist, daß sich zur Zeit kein weiteres Internat im Bau befindet und auch im vorliegenden Budget keine Ansätze vorgesehen sind. Umso mehr möchte ich von dieser Stelle aus der Niederösterreichischen LandesLandwirtschaftskammer Dank sagen, die von sich aus in den Häusern der Landwirtschaft Internate mitgebaut hat, die unserer bäuerlichen Jugend zur Berufsausbildung dienen. Die Bauern selbst haben mit der Einführung einer bezirkseigenen Kammerumlage zur Finanzierung auch der Internate einen wesentlichen Beitrag für feine Aufgabe des Landes geleistet. Auf dem Gebiete des Fachschulwesens ist die Lage weiterhin sehr angespannt. Auch in diesem Jahr konnten nicht alle Bewerber aufgenommen werden. Wie die bestehenden Räume ausgenützt werden, zeigt am meisten das Beispiel der Schule in Krems. Gebaut wurde diese Schule für 40 Burschen, untergebracht sind aber derzeit 95. Daß unter solchen Voraassetzungen die Schüler überaus beengt sind, ist begreiflich. Um dem Schülerandrang aber halbwegs gerecht zu werden, hat man auch hier neue Wege versucht. Sowohl in Krems als auch \in Mistelbach laufen ab diesem Schuljahr einjährige Fachschulen, die am 3. September dieses Jahres begonnen haben und Ende Juni des kommenden Jahres enden werden. Die bisherigen Erfahrungen mit diesen Schulen sind sehr gut. Es wäre zu hoffen und zu wünschen, daß sich im kommenden Jahr mehrere Schulen dieser Art zuwenden können. Aber auch für diese Schulsparte sind beträchtliche Mittel erforderlich, um die bestehenden Schulen in jenen Zustand zu versetzen, der den heutigen Anforderungen entspricht. Ich denke da besonders an die Fachschule für Mädchen in Göpfritz/Wild, die in einem derartigen Zustand ist, daß jetzt die Planungen zur Errichtung einer neuen Fachschule im Gange sind. Ich möchte ganz eindringlich bitten, daß im kommenden Voranschlag jene Mittel bereitgestellt werden, die notwendig sind, um den Mädchen des Waldviertels jene Möglichkeit zu geben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Bäuerinnen des Waldviertels auch brauchen. Wenn das ein Nichtwaldviertler Abgeordneter vor diesem Hause sagt, der sich selbst im heurigen Jahr von idem Zustand überzeugen konnte, dann glaube ich, wird die gesamtniederösterreichische Bedeutung dadurch nur noch unterstrichen. Durch die Neuordnung des landwirtschaftlichen Berufsausbildungswesens wird sich auch auf diesem Gebiete das Hohe Haus mit zwei Gesetzentwürfen im Frühjahr 1967 zu beschäftigen haben. Der Zudrang zu den bäuerlichen Fachschulen wurde derzeit verstärkt. Wir dürfen da her gerade in dieser, für die gesamte Landwirtschaft so wichtigen Frage unser Augenmerk besonders verschärfen. die in den, den Schulen angeschlossenen Versuchswirtschaften erzielten Ergebnisse können uns mit Stolz und Befriedigung erfüllen. Vielfach sind die Impulse, die die landwirtschaftliche Bevölkerung von diesen Wirtschaften erhält. Wenn es aber beispielsweise in der Schule Edelhof möglich war, in den letzten Jahren eine Roggenneuzüchtung herauszubringen, die auf dem Gebiete des Roggensaatgutes an erster Stellte steht, so danken wir diese Leistung in erster Linie den Direktoren, den Lehrkräften und den an den Fach- und Berufsschulen tätigen Arbeitern. Ich möchte daher von dieser Stelle aus diesen Menschen meinen aufrichtigsten Dank und meine Anerkennung aussprechen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Berufsausbildung der bäuerlichen Jugend ist nicht nur eine Notwendigkeit für einen Berufsstand, sondern für die ganze Volkswirtschaft. Nur ein Staat, der über ausreichende Fachkräfte verfügt, ist in der Lage, die Produktivität seiner Wirtschaft zu steigern und damit den Lebensstandard seines Volkes zu heben. Der österreichische Bauer ist nicht nur ein Erzeuger von land- und forstwirtschaftlichen Produkten, sondern vor allem auch ein wesentlicher Verbraucher von gewerblichen und industriellen Gütern. Schaffen wir daher unserer bäuerlichen Jugend jene Stätten, die sie befähigen, die modernen Erkenntnisse der Wissenschaft in sich aufzunehmen, jene Stätten, die sie erfüllen mit der Liebe zur Heimat, mit der Treue zum bäuerlichen Stand und der Verantwortung für Volk und Staat. (Beifall bei der ÖVP und SPÖ.) PRÄSIDENT WEISS: Zum Wort gelangt Herr Abg. Dr. B r e z o v s k y . Abg. Dr. BREZOVSKY: Herr Präsident! Hohes Haus! Sehr geschätzte Damen und Herren! Ich wollte mich nicht mehr zum Wort melden, aber Herr Landesrat Bierbaum ist an mich herangetreten wegen des von mir eingebrachten Resolutionsantrages. Bevor ich darauf eingehe, bitte ich zwei Feststellungen machen zu dürfen. Erstens bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, daß ich mir bezüglich der Weltmeister bei den Feuerwehrwettkämpfen einen Versprecher geleistet habe. Ich wollte sagen Grafenbach und Mistelbach. Ich bitte also auch die Gemeinde Grafenbach um Entschuldigung, denn ich habe Grafendorf gesagt. Zweitens möchte ich Kollegen Reischer sagen, daß ich in keiner Weise in kränkender Absicht gestern erklärt habe, auf seine ersten paar Sätze nicht einzugehen. Er hat mir dann vorgehalten, daß ich öfters gepfefferte Aussprüche mache. Das bestreite ich nicht, weil ich gepfefferte Aussprüche für die Würze einer parlamentarischen Debatte halte, so wie ich ja auch beim Essen sehr gerne etwas Pfeffer habe. Wogegen ich mich aber wehre ist, wenn verpfeffert oder versalzen wird. Ich glaube aber, wenn beleidigende Äußerungen gegen meine Fraktion gefallen sind, dann betrachte ich das als verpfeffert und versalzen und darauf einzugehen habe ich abgelehnt. Nun zum Resolutionsantrag. Herr Landesrat Bierbaum hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß das Ausführungsgesetz zu den Grundsatzgesetzen bereits fertig sei, und er hat ausdrücklich erklärt, daß er im Jänner diese Ausführungsgesetze in der Landesregierung einbringen wird. Ich stehe nicht an, ebenso wie es der Kollege Czipin gestern oder vorgestern bei seinem Resolutionsantrag bezüglich des Behindertengesetzes loyalerweise getan hat, meinen Antrag zurückzuziehen, in der Hoffnung, daß im Jänner 1967 diese Ausführungsgesetze die Landesregierung passieren werden. (Beifall bei der SPÖ.) PRÄSIDENT WEISS: Zum Worte gelangt Herr Abg. S c h n e i d e r . Abg. Karl SCHNEIDER: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie bereits vom Herrn Kollegen Kaiser angekündigt, habe ich die Absicht, hier einen Resolutionsantrag zu stellen, der, wie Sie mir gesagt halben, Herr Kollege Kaiser, auch Ihre Zustimmung findet. Ich weiß nur nicht, ob Sie meinen, daß wir ihn gemeinsam stellen oder ob er nur Ihre Zustimmung hat. Das ist eine ganz kleine Reinheit in der Nuancierung. Ich kann verstehen, daß Sie nicht das Bestreben halben, ihn mitzuunterfertigen. Sie können sich das aber noch überlegen. (Abg. Kaiser: Wir stimmen zu!) Des habe ich schon herausgehört, wobei ich mir zuerst erlaubt habe zu sagen, daß ein kleiner Unterschied darin besteht, ob Sie ihn mitunterschreiben oder nur Ihre Zustimmung geben. Es handelt sich um die Kreditbürgschaftseinrichtung, die wir im Vorjahr schon besprochen haben. Es ist vollkommen richtig, was mein sehr geehrter Herr Vorredner gesagt hat. Auch ist richtig, daß ich mich im Vorjahr dazu zum Wort gemeldet und gemeint habe, daß es zweckmäßiger sei, hier gewisse Vorarbeiten zu leisten, ehe man ohne Basis mit einem solchen Antrag den Hohen Landtag beschäftigen dürfte. Sie, Herr Kollege, haben dann erklärt, Sie würden mich zu gegebener Zeit beim Wort nehmen und es bleibe abzuwarten, ob dieses Wort eingehalten wird. Ich darf dazu meinerseits folgendes sagen: Ich werde mich bemühen, das kurz zu machen, obwohl es inzwischen eine recht komplizierte Angelegenheit geworden ist. Unmittelbar, nachdem wir im Vorjahr darüber gesprochen haben, habe ich mit Landeshauptmannstellvertreter Hirsch eine lange Aussprache darüber gehabt, wie man zu einem solchen Kreditbürgschaftsfonds oder zu einer GmbH oder zu irgendeiner Einrichtung kommen könne, wie man etwas derartiges konstruieren müsse. Wir haben Pestgestellt, daß es zwar einige Krediteinrichtungen gibt, die sich zweckmäßig ausgewirkt haben, daß wir aber gerade für Klein- und Mittelbetriebe innerhalb der gewerblichen Wirtschaft, die die erforderlichen Sicherungen für die in Anspruch zu nehmenden Kredite nicht geben können, einen solchen Bürgschaftsfonds schaffen müssen. Sie können sich zweifellos an die Diskussion erinnern, wo wir festgestellt haben, daß nicht jeder in der Lage ist, einen Kredit zu sichern, weil er entweder noch nicht irgen dwelche Substanzen nachweisen kann, weil er in Miete ist und das Haus nicht ihm gehört, in dem er seinen Betrieb ausübt, oder weil es sich vielfach um junge Menschen handelt, die erst kurz berufstätig sind und noch keine Möglichkeit haben, die Sicherheiten für einten solchen Kredit zu geben. Und da halben wir gemeint, daß auch diese Kreise, junge expansive Kreise, mit einer solchen Kreditmöglichkeit ausgestattet werden müßten und daß es sehr gut wäre, wenn neben den bestehenden Einrichtungen auch noch eine solche Kreditbürgschaftseinrichtung geschaffen werden könnte. Da ich zunächst aus finanziellen Gründen hier im Hause keine Möglichkeit gesehen habe, diese Konstruktion auf Landesebene aufzubauen, und Herr Landeshauptmannstellvertreter Hirsch sich intensiv mit dieser Problematik beschäftigt hat, ist es schließlich dazu gekommen - ich sage das in aller Offenheit -, daß ich auf dem Boden, der mir in dieser Frage zugänglich erschien, das ist die Handelskammer Niederösterreich, bei den Sektionen des Handels, des Gewerbes, der Industrie, des Verkehrs, des Fremdenverkehrs, schließlich aber auch bei der Sektion Geld- und Kreditwesen, weil ja mein Plan darin bestand. die Kammer für eine Dotierung anzusprechen, sondiert habe. Der langen Rede kurzer Sinn ist der, daß es nach nicht unkomplizierten Verhandlungen dazu kam, daß innerhalb der Kammer dann insofern eine positive Auffassung zustande kam, als die Handelskammer Niederösterreich bereits 2 Millionen Schilling aus ihrem Budget für diesen Zweck gebunden hat, und wir meinten, daß zunächst, um einen ersten Schritt zu tun, das Land Niederösterreich auch um etwa 2 Millionen Schilling anzusprechen Ware und wir darüber hinaus mit den Kreditinstituten eine Vereinbarung zu treffen hätten, um diese dazu zu bringen, etwa 4 Millionen Schilling diesem Fonds zuzuführen. Die diesbezüglichen Verhandlungen sind positiv. Wir haben Zusagen von den verschiedenen Bankensektoren, die natürlich auch verschiedenster Auffassung sind und hier bis ins Programmatische gehen, so daß wir sagen können, daß auch die 4 Millionen der Banken bereits verbindlich abgesprochen sind. Schließlich haben wir uns auch noch an Iden ERPFonds gewendet und ersucht, mit 8 Millionen beizuspringen, damit auf diese Art, zumindest theoretisch, 16 Millionen beisammen sind. Der ERP-Fonds ist nicht nur überlastet, sondern verfügt scheinbar für 1966/67 nicht mehr über die erforderlichen Mittel. Man hat uns dort erklärt, daß zunächst eine positive Erledigung nicht möglich sei, daß man aber darauf zurück kommen könne, was wir sicherlich tun werden. Wir haben uns vorgestellt, daß nach den Erfahrungen solcher Bürgschaftseinrichtungen, die es ja in der Schweiz, in Westdeutschland und auch in Belgien, Holland und Luxemburg gibt, mit einer einfachen Bürgschaftshaftung ungefähr das Zehnfache in Anspruch genommen werden kann. Das würde bei dieser Konstruktion bedeuten, wenn wir 16 Millionen aus den diversen Stellen in diesen Fonds geben, hätten wir dann 160 Millionen; mit dieser Summe könnten wir den bedürftigen Betrieben wesentlich helfen. Es ist nicht alles, man könnte den Gedanken weiterspinnen, daß man dann, wenn eine Rückbürgschaft durch eine Gebietskörperschaft, beispielsweise durch (das Land erfolgt, mit einer zwanzigfachen Inanspruchnahme rechnen kann. Ich weiß, daß man in manchen deutschen Gebieten auf dieser Basis sehr erfolgreich tätig war und die zwanzigfache Substanz für derartige Bürgschaften dort Anwendung findet. Das war der Grund, diese Arbeit weiterzuführen und dann zu einem Antrag zu kommen, der auch Ihre Unterstützung, Herr Kollege, findet. Ich weiß, daß es Ihnen lieber gewesen wäre, das haben Sie auch ausgeführt, daß auf reiner Landesebene etwas geschieht, aber ich bin schon sehr froh und £ast ein bisschen stolz, daß wir von seiten der Handelskammer einmal hier vorgestoßen sind. Ich erlaube mir daher, folgenden Resolutionsantrag - den Sie immer noch unterschreiben können, ich würde mich darüber sogar freuen - einzubringen (liest): „Die Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Niederösterreich 'beabsichtigt die Errichtung einer Kreditbürgschafts GmbH, um den kleinen und mittleren Betrieben der gewerblichen Wirtschaft für wirtschaftlich gerechtfertigte Investitionskredite die erforderlichen Sicherungen zu bieten. Die Landesregierung wird aufgefordert, diese Bestrebungen der Kammer wirkungsvoll zu unterstützen und eine Beteiligung des Landes an der Kreditbürgschafts GmbH in Erwägung zu ziehen." Sollte es uns gelingen, eines Tages daraus eine sehr mächtige Einrichtung zu schaffen - es würde mich persönlich sehr glücklich machen -, dann könnten jene Bereiche miteinbezogen wenden, die Sie heute Vormittag angedeutet haben, wobei man natürlich gewisse Abgrenzungen wind finden müssen, um eine zweckmäßige und zielführende Verwendung zu gewährleisten. Ich darf auch noch einen zweiten Resolutionsantrag einbringen, der sich auf die Fernverkehrsbeförderungssteuer bezieht – dieses Wort hat Landeshauptmann Hartmann fast widerwillig ausgesprochen -, die auch uns sehr unangenehm ist. Wir sind seit Jahren erfolglos in dieser Angelegenheit tätig und wir wissen, daß alle unsere Bestrebungen vergeblich sind, daß wir den Betrieben in den Notstandsgebieten und den grenznahen Räumen sehr schwer helfen können, wenn dieses Bleigewicht der Fernverkehrsbeförderungssteuer weiterhin aufrecht bleibt. Es ist leicht zu verstehen, daß ein Unternehmer, dem man zumutet, in diesem steuergefährdeten Raum einen Betrieb aufzubauen, dies schon aus dem Grunde ablehnt, weil es eben diese Steuer gibt. Eis liegt hierin eine starke Belastung, und ein Unternehmer könnte in der Konkurrenz nicht bestehen. Wir haben immer wieder ausgeführt, daß wir nicht verstehen, warum man diese Steuer nicht korrekter, gerechter und zweckmäßiger festlegt oder sie völlig verändert. Wir haben erfolglos versucht, durch Resolutionsanträge hier im Hohen Hause, durch Resolutionsanträge der Kammern und verschiedener Einrichtungen vorwärts zu kommen; es ist uns versagt geblieben. Die angestrebte Reform dieser Fernverkehrsbeförderungssteuer wurde zwar im Ministerrat behandelt, es wurde auch eine Novelle angenommen, die uns sehr geholfen hatte, aber sie wurde dann neuerlich zurückgestellt. Ich glaube, daß diese kleine Reform, die hier im Ministerrat besprochen wurde und an der uns Niederösterreichern sehr viel liegt, den Grenzbezirken sehr helfen würde, wenn es auch zunächst nur die kleine Reform ist. Die große Reform der Beförderungssteuer steht hingegen sicher noch in weiter Ferne, weil sie in unmittelbarem Zusammenhang mit den sogenannten Marchentarifen ist. Das werden aber die Herren, die sich mit dieser Materie befassen, wissen, die Marchentarife im Straßengüterverkehr haben zwei Partner, die hier scheinbar noch immer nicht zu einer gemeinsamen Auffassung kommen konnten. Über diese Tarife wurde bekanntlich durch mehrere Jahre hindurch zwischen dem Verkehrsgewerbe und der verladenden Wirtschaft sehr intensiv verhandelt, aber der im August einvernehmlich zustande gekommene Entwurf in dieser Frage ist wieder am Einspruch des Herrn Verkehrsministers und seines Ministeriums gescheitert; die Details darüber hier anzuführen, halte ich für völlig überflüssig. Ich erlaube mir daher, folgenden Resolutionsantrag vorzutragen (liest): „Die Bundesregierung hat dem Nationalrat einen Gesetzentwurf Über die Abänderung des Beförderungssteuergesetzes 1953 vorgelegt. Die im Entwurf vorgesehene Übergangslösung, derzufolge die am meisten von der Güterfernverkehrssteuer wirtschaftlich betroffenen Gebiete ausgenommen werden sollen, wird begrüßt. Dessen ungeachtet muß aber das Endziel der Reform der Beförderungssteuer in einer völligen Abkehr des der Güterfernverkehrssteuer innewohnenden Systems erblickt wenden. Die Landesregierung wird daher aufgefordert, bei der Bundesregierung und insbesondere beim Bundesministerium für Finanzen dahin zu wirken, daß, unbeschadet des dem Nationalrat vorliegenden Entwurfes einer Beförderungssteuergesetz-Novelle 1967, ehestens eine Reform des Beförderungssteuerrechtes insoferne erreicht wird, als bei der Fernbeförderungssteuer nicht vom Standort, sondern vom Ausmaß der tatsächlich gefahrenen Beförderungsstrecke auszugehen ist." Ich glaube kaum, noch etwas hinzufügen zu müssen, weil Sie, meine Damen und Herren, das Problem zur Genüge kennen. Ich darf zum Abschluß meiner Betrachtungen noch ganz kurz auf einige Bemerkungen eingehen, die Kollege Kaiser gestern gemacht hat. In Ihrem Vortrag über die landesplanerischen Notwendigkeiten und über die Zusammenhänge der Wirtschaft in dieser Konzeption haben Sie ausgeführt, daß die Unternehmer in Niederösterreich aus der Wirtschaft wohl einigen Nutzen zogen, ohne etwas zur Verbesserung der Lebensbedingungen der arbeitenden Menschen beigetragen zu haben. So oder ähnlich klangen Ihre Worte. In Ihren anschließenden raumplanerischen Betrachtungen haben Sie sich, Herr Abgeordneter, zu der Äußerung veranlaßt gesehen, die Unternehmer als in schwieriger Lage befindlich zu deklarieren und haben das Risiko angedeutet, das der Unternehmer zu tragen hat. Ich bin nicht ganz klug daraus geworden, ob Sie damit mahnen wollten oder einen anderen Zweck verfolgten. Ich darf dazu feststellen, daß es für die Unternehmerschaft gerade in der gegenwärtigen schwierigen Konkurrenzierung nicht sehr leicht ist, ihre Aufgaben zu erfüllen, da sich insbesondere in der Problematik der Integration neue Gesichtspunkte ergeben. Ich weiß, daß man in der Einstellung zur Integration verschiedener Meinung sein kann. Wie man sich auch die praktischen Erfolgsaussichten unserer Wirtschaft vorstellen mag, steht unsere Wirtschaft der bedauerlichen Tatsache ihrer wachsenden Diskriminierung unseres Exports im EWGRaum gegenüber. In den letzten Monaten ist genau das eingetreten, was wir von Seiten der Wirtschaft seit Jahren vorausgesagt haben - ich hatte hier bereits im Vorjahr, vor zwei und drei Jahren Gelegenheit gehabt, das auszusprechen -, nämlich ein Rückgang des Exports auf diesen für uns so überaus wichtigen und angestammten Märkten. Auch die zukünftigen zollfreien Exporte in die EFTALänder werden meiner Meinung nach keinen Ersatz bieten können, wie überhaupt .immer wieder darauf hingewiesen werden muß, daß es keine Alternative gibt, sondern daß wir einen Wirtschaftsvertrag mit der EWG brauchen, um nicht zu sehr in die von mir geschilderten Schwierigkeiten hineinzukommen und das Problem zu meistern. Die Ziffern über die zunehmende Auseinanderklaffung zwischen den von uns getätigten Exporten und den immer stärker zunehmenden Importen sind Ihnen ja bekannt. Die letzten diesbezüglichen Zahlen sprechen von einem mindestens 18,5 Milliarden großen Handelsbilanzpassivum, das heißt, daß wir im vergangenen Berichtszeitraum um 18,5 Milliarden mehr Ware aus dem Ausland nach Österreich eingeführt haben, als wir imstande waren zu exportieren, wobei natürlich nicht nur eine Rolle spielt, daß wir die Zollmauer zu überklettern haben, sondern noch verschiedene andere Dinge maßgebend sind. Diesen bedrückenden Tatsachen steht, wie der Herr Kollege Janzsa schon ausgeführt hat, der hochaktive Fremdenverkehr, der ja auch eine meine Exportwirtschaft darstellt, gegenüber. An und für sich ist es wohl gleichgültig, ob wir nach London oder sonst wohin in die Welt Ware schicken und dafür Devisen bekommen oder ob die Fremden zu uns kommen und durch Quartier, Verpflegung und diverse Urlaubsannehmlichkeiten ihr Geld hier lassen. Es handelt sich um eine reine Exportwirtschaft, die aber nicht mehr stark genug ist, um die auseinanderklaffende Handelsbilanzseite auszugleichen. So stehen wir dann eben vor einer passiven Handelsbilanz, was vielleicht ein oder zwei Jahre keine Rolle spielen mag, wenn die Beträge nicht übermäßig groß sind, was aber bedrückend wird, wenn man annehmen muß, daß der Fremdenverkehr heuer vielleicht nur 15 bis 15,5 Milliarden Schilling erbringt und anderenseits eine starke Passivität des Exports festgestellt werden muß, die in letzter Konsequenz zu einer passiven Zahlungsbilanz führt. Das ist der Grund, weshalb der Geldumlauf nicht nur kleiner, sondern auch gehemmter ist und es so schwierig ist, lauf dem Kapitalmarkt anzukommen. Die Banken haben derzeit fast keine Mittel zur Verfügung, weshalb die Restriktionsbestimmungen auf dem Sektor Geld- und Kreditwesen so angespannt werden mußten. Das alles ist die Ursache, daß wir mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Ich möchte mich da nicht zusätzlich ausbreiten, glaube aber, daß diese Überlegungen über die wirtschaftlichen Belange dazugehören. Der Osthandel spielt sicherlich tauch eine Rolle, wird aber nicht von so großer Bedeutung sein, daß ihm ein entscheidendes Gewicht innerhalb der gesamten Wirtschaftskonzeption zukommt. Auf dem Gebiete der Wirtschaftspolitik möchte ich ein Problem erwähnen, auf das auch vom Herrn Abg. Kaiser hingewiesen worden ist und das für Niederösterreich große Bedeutung hat, nämlich die Einordnung der verstaatlichten Industrie. Herr Abg. Kaiser, Sie haben dieses Problem nicht direkt behandelt, sondern nur gestreift. Ich darf Ihnen versichern, daß sich die gewerbliche Wirtschaft darüber klar ist, daß die Errichtung dieses neuen Wirtschaftskörpers, die Österreichische Industrieverwaltungsgesellschaft, zwar eine sehr wichtige Voraussetzung für eine Neuordnung ist, daß aber die Zukunft dieses wichtigen Faktors unserer Wirtschaft – ich bezeichne das als einen sehr wichtigen Wirtschaftsfaktor - davon abhängt, daß die von Ihnen erwähnten Probleme der Produktionsumstellung, die ich ebenfalls bejahe, der Koordinierung, der Teilkonzernierung und letzten Endes auch die Programmbereinigung dabei eine große Rolle spielten. Wenn Sie Ihrer Meinung Ausdruck geben, daß dies auch für die Privatwirtschaft Gültigkeit habe, stimme ich Ihnen zu, glaube aber, daß die Flexibilität der Privatwirtschaft doch etwas größer ist, als allgemein angenommen wird. Zweifellos wird heute in den privatwirtschaftlichen Bereichen um diese zeitbedingten Notwendigkeiten geradezu gerungen, um sie gemeinsam zu bewältigen. Was den längst umstrittenen Investitionsfonds betrifft - es ist Ihnen ja bekannt, daß darüber ernst zu nehmende Abhandlungen, Polemiken, Demagogien und alles mögliche gemacht wurden -, erlaube ich mir als Vertreter der Wirtschaft, als der ich hier sprechen darf, zu sagen, daß es zu keinem wachstumshemmenden Gewinnumverteilungsprozeß kommen darf, wenn man von aktiven zu passiven Betrieben hinübergleitet. Dieses mehrfach besprochene Problem haben wir fauch im Zusammenhang mit der NEWAG – NIOGAS erläutert und gewisse Betrachtungen in dieser Richtung angestellt. Wenn diese entscheidenden Notwendigkeiten, die sich innerbetrieblich der Gesamtwirtschaft darlegen, nicht beachtet oder falsch beurteilt werden, dann nützt uns auch die Raumplanung nichts. Es kann uns nichts von dem helfen, was uns von der Planifikation angefangen bis zur planwirtschaftlichen Auffassung angedeutet wunde, wenn wir nur in Teilbereichen nach Auswegen suchen. Noch ein paar Worte zu Ihren Ausführungen über die Handelsspannen. Ich räume ein, daß es überall schwarze Schafe gibt. Es gibt sicherlich Bereiche, in denen die Handelsspannen nicht unbestritten hingenommen werden können. Andererseits wird aber leider bei uns in Österreich vielfach der Begriff ,,Handelsspanne" mit „Gewinn'' verwechselt, und das wirtschaftsfremde Denken ist bei uns eine häufige Erscheinung. Es gibt oft hochintelligente akademische Geister, die, wenn man von der Handelsspanne spricht, sofort der Meinung sind, daß es sich um den Gewinn des Unternehmens handle, mit dem man machen könne, was man will, womöglich eine Reise an die Riviera und dergleichen. Wenn Sie in Amerika mit den Arbeitern eines Betriebes sprechen, dann werden Sie feststellen, daß diese über solche Dinge weit besser Bescheid wissen. Sie haben mein viel wirtschaftsnäheres Denken, als man es bei uns gewohnt ist. Sie kennen das Aktienrecht, weil sie selbst im Besitze von Aktien sind, können Bilanzen lesen, sie sind kurzum in ihrer Denkungsweise viel wirtschaftlicher ausgerichtet. Was ist der Grund, daß man bei uns so schwer zu dieser wirtschaftlichen Denkungsart findet? Ich kann es nicht sagen. Tatsache ist, daß eine gewisse Vergiftung der öffentlichen Meinung zu erkennen ist, wenn von solchen Dingen gesprochen wind. Die Handelsspanne ist nicht gleich dem Reingewinn, sie ist gleich dem Rohgewinn, und man vergißt zu sagen, was aus dieser Handelsspanne zu decken ist. Darf ich dazu ausführen, daß der Handel heute ca. 10 Prozent seines Umsatzes an Steuerleistung zu erbringen hat; das ist ein Teil des Rohgewinnes. Ich spreche auch von Löhnen, Gehältern und anderen Kosten, wie Beförderung, Beheizung und Beleuchtung, ich spreche aber noch nicht von Rücklagen, um ein bisschen Kapital aufzustocken, das man wieder nicht braucht, um Schmerbäuche zu bekommen, sondern um die Betriebe zu modernisieren. Das alles ist darin enthalten, man sagt es aber leider nicht dazu. Es ist sehr einfach, bei einer Preiserhöhung immer nur die Handelsspanne zu kritisieren. Sie haben als Beispiel die Erzeugung der Wärmeflaschen erwähnt und ausgeführt, daß man die Produktivität von 196 lauf 240 Stück erhöht hat, ohne daß die Bediensteten, die diese Steigerung durchführten, ihren Anteil verlangt halben. Dennoch haben im Handel dann diese Wärmeflaschen um 2 Schilling mehr gekostet. Darf ich Ihnen auch ein Beispiel, und zwar aus der Kunststoffindustrie sagen. Dort wird die Ware X hergestellt; es werden erst nur 100 Stück eines Artikels erzeugt, durch Modernisierungsmaßnahmen kann aber mit demselben Aufwand eine Erhöhung auf 150 Stück erreicht werden. Nun müßte man glauben, daß ein riesiger Preisrückgang möglich ist, weil die Produktion so gigantisch gesteigert wurde. Solche Fälle gibt es sogar in der Praxis. Die Absenkung der Preise wäre der Weg, für den wir eintreten. Der zweite Weg ist der, daß die Belegschaft mit Recht kommt und sagt, du, lieber Unternehmer, hast jetzt feinen höheren Gewinn, den werden wir entsprechend aufteilen. Das macht die Gewerkschaft, und es ist ihr gutes Recht, daß man dann entsprechende Anteile verlangt. Es kommt also leider meistens nicht zum Preisrückgang, sondern zu sozialrechtlichen Umschichtungen, die völlig begründet sind, das habe ich ja bereits erwähnt. Es gibt aber nicht nur diesen einen Betrieb in der gleichen Branche. Die anderen hatten aber vielleicht noch nicht die Möglichkeit, sich zu modernisieren, sie erzeugen noch nicht 150 Stück dieses Artikels, sondern nur 100 Stück, um beim gleichen Beispiel zu bleiben. Diese Betriebe müssen aber lohnmäßig mit dem Betrieb A Schritt halten, weil sie sonst ihre Arbeitskräfte verlieren würden. Der Betrieb A würde sie sofort übernehmen, er leidet ja an Personalmangel. Nun müssen die anderen die Kosten erhöhen, in der weiteren Folge werden sie auch in die Preise ausweichen. Durch diese Entwicklung tritt dann aber nicht der so begehrenswerte Preisrückgang ein, es ist sogar eine Kostenerhöhung festzustellen, weil hier eine Progression wirksam wird, die dann zum Schluß diesen Druck verursacht. Es gibt auch in der Handelswirtschaft asoziale Elemente, das sind die Preisschrecks und wie sie alle heißen mögen, das sind die Unternehmungen, 'die im Windschatten viel zu milder Konkurs- und Ausgleichsbestimmungen - die es in diesem Lande leider gibt - andere zugrunde wirtschaften, dann selbst zugrunde gehen, zur gegebenen Zeit sich absetzen und einen Trümmerhaufen hinterlassen. Das sind die Leute, die man zuerst lobt, weil sie fast ohne Spanne ihre volkswirtschaftliche Verteilungsaufgabe erfüllt haben, die aber dann, wenn es einmal düster wird, sehr bald um die Ecke verschwinden und eine Sintflut hinterlassen. Bedauerlicherweise werden dann aber jauch rechtschaffene Unternehmungen, die gerade noch von den Handelsspannen gelebt haben, zugrunde gerichtet. Der Zusammenhang, so gesehen, sieht etwas anders aus, als wenn man den Scheinwerfer zu einseitig einstellt. Sie kennen die Schwierigkeiten, in denen wir stehen; Sie kennen die Schwierigkeiten, die darin liegen, daß unsere Wirtschaft wohl mit einem gewissen Glanz ausgestattet ist, dahinter befindet sich aber oft keine feste Substanz, bedingt durch mangelnde Kapitalstrukturen in diesen Betrieben. Das beweist der Umstand des Begehrens von Fremdmitteln und Leihgeldern, das beweist unsere Suche nach Auswegen gerade in dieser Richtung auf vielfältigster Ebene, angefangen vom Betriebsinvestitionsfonds über die Landeshaftung, den Gewerbe- und Fremdkredit bis zu der Stelle, wo wir nunmehr in unseren Überlegungen gelandet sind, nämlich die Haftung für solche Betriebe zu Übernehmen, die nicht selbst die Bürgschaft erbringen können. Wenn wir jetzt schon - wo international gesehen erst ein leiser Wind weht – zu solchen Feststellungen kommen, muß man sich die Frage stellen, was wird dann sein, wenn ein kalter Wind aufkommt - ich spreche nicht von einem Sturm -, wie wird man dann über all diese Dinge hinwegkommen? Das könnte nicht sein, wenn durch so starke Spannen und eine so günstige Steuerpolitik dieser unternehmerischen Wirtschaft Geschenke oder Begünstigungen eingeräumt worden wären, das kann nur sein, weil das Gegenteil der Fall ist und das leider oft falsch gesehen wird. Ich verstehe Ihren Standpunkt, ich bin auch kein Feind der Gewerkschaft, ich respektiere sie als eine Repräsentation der Arbeitnehmerseite. Ich bin auch der Meinung, daß es sehr gesund ist, in einer Demokratie all diese Einrichtungen zu haben. Ich glaube nur, daß man bei echten Überlegungen die Schwierigkeiten leichter überwinden kann, als wenn man sich auseinanderlebt und dem Lande damit nichts Gutes tut. Ich habe schon erwähnt, daß für die Wirtschaft der Zustand der Zusammenarbeit nicht eine Sekunde unterbrochen war, obwohl die monokolore Regierungsform vor uns steht. In der Wirtschaft hat es keine Sekunde der Unterbrechung gegeben, wir stehen dazu, weiterhin die Sozialpartnerschaft zu pflegen, sie auszubauen, zu vertiefen und zu festigen, um mit all den nur in einer Skizze hier entworfenen Problemen fertig zu werden. Es ist nicht alles, aber doch beträchtlich viel, was wir, von der Seite 'der landespolitischen Tätigkeit her gesehen, dazu beitragen können. Ich glaube, wir tun es gern, weil es um unsere Heimat und um die Wirtschaft unserer Heimat geht und weil wir die Verpflichtung einer solchen Tätigkeit übernommen haben. (Beifall im ganzen Hause.) PRÄSIDENT WEIS: Zum Wort gelangt Herr Landesrat B i e r b a u m. möchte zu all den Anliegen des Kapitels 7, die in mein Ressort fallen, der Reihenfolge nach antworten. Darf ich vorerst über das Feuerwehrwesen sprechen und mich gleich einer angenehmen Pflicht entledigen. All den tausenden Männern, die bei der Freiwilligen Feuerwehr jahrein, jahraus, immer dann, wenn sie gerufen werden, ihren Mann stellen, gebührt unser herzlichster Dank. Herr Dr. Brezovsky hat zu der ausgesendeten Diskussionsgrundlage zum Feuerwehrgesetz Stellung genommen und ausgeführt, daß man nicht daran denken dürfe, statt der Freiwilligkeit den Zwang zu setzen. Ich darf feststellen, niemand hat die Absicht, statt der Freiwilligkeit den Zwang zu setzen. Es könnte niemand die Folgerungen, die daraus entstehen, verantworten und ebensowenig die hiefür erforderlichen finanziellen Mittel aufbringen. (Zwischenruf bei der SPÖ: Das ist aber in der Gesetzesvorlage drinnen!) Wir wollen auf der Freiwilligkeit beharren. Darf ich hier gleich auf eine zweite Frage zurückkommen. Wenn es bei Erlassung der Ausführungsgesetze zur Landarbeitsordnung etwas länger dauert, als man annehmen könnte, so glaube ich, ist es wesentlich besser, wenn man sich mit einer so schwierigen Materie länger befaßt. Ich darf erklären, daß die Diskussionsgrundlage zum Feuerwehrgesetz vielleicht etwas zu schnell hinausgegangen ist. Wir leben in einer Demokratie, es gibt das Begutachtungsverfahren, alle Stellen haben die Möglichkeit, hier noch ihre Meinung zu äußern. Ich kann Ihnen versichern, daß wir einen Entwurf vorlegen werden, der keinen Zwang beinhaltet, sonder auf Freiwilligkeit beruht. Auf die Ausführungsgesetze bezüglich der Landarbeiterordnung zurückkommend, darf ich sagen, daß erst zwei Bundesländer, nämlich Tirol und Salzburg, die Gesetze beschlossen haben; allendings sind sie dort auch noch nicht in Kraft, weil sie noch nicht verlautbart wurden. Alle übrigen Bundesländer sind - so wie Niederösterreich - in Verzug. Ich möchte betonen, daß das natürlich keine Entschuldigung ist, ich habe aber versprochen, daß ich im Jänner dafür Sorge tragen werde, daß der Entwurf der Regierung vorgelegt wird. Der Herr Abgeordnete Schneider hat bei den Schulen angeführt, daß hier die Dotation etwas besser ist. Das ist ein Trugschluß. Im Jahre 1962 waren im außerordentlichen Budget 9,5 Millionen Schilling angesetzt; in den Folgejahren ist dann der Betrag rückläufig gewesen, weil andere Mittel zur Verfügung gestanden sind. Im Jahre 1967 sind wir wieder bei 9,5 Millionen Schilling angelangt. Wir alle wissen, daß überall mehr Mittel gefordert werden-. Wenn es aber wirklich so wäre, daß zugunsten der Schulen die übrigen Förderungen etwas geringer angesetzt sind, so ist das, meiner Meinung nach, auch keine Sünde, denn es gibt keine bessere Investition als das Lernen. Wir können auf dem Sektor ohnehin nur das Notwendigste tun. Wenn die Mittel wirklich etwas steigend wären - ich glaube, das ist allerdings nur eine optische Täuschung -, dann wäre das nur eine unbedingte Pflicht. Der Herr Abgeordnete Brunner hat bereits erwähnt, daß neben dem Land Niederösterreich auch die Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer erhebliche Mittel für das Pflichtschulwesen in Landwirtschaft zur Verfügung gestellt hat. Ich kann diesen Betrag nicht genau nennen, schätzungsweise wurden von der Niederösterreichischen Landes-Landwirtschaftskammer in den letzten Jahren ca. 50 Millionen Schilling für Schulzwecke bereitgestellt, um die bäuerliche Jugend heranzubilden. Sie hat vor allem Schulräume rund in den letzten Jahren auch Internate gebaut, weil das Land nicht in der Lage war, die erforderlichen Mittel hiefür aufzubringen. Ich frage Sie nun, welche Berufsgruppe gibt noch ihr eigenes Geld in dem Maße her, damit ihre Jugend geschult werden kann? Sie wissen selbst, daß es überall gesetzliche Vorkehrungen gibt, daß alle, auch die Gemeinden, dazu beitragen müssen, wenn irgendwo eine Pflichtschule, eine gewerbliche Schule usw. entsteht. Oft ächzen die Bürgermeister unter der Last, die sie zu tragen haben, aber sie müssen sie tragen, weil die Billdung Vorrang hat. Gerade beim landwirtschaftlichen Schulwesen kann niemand verhalten wenden, und es leistet eben die Kammer - neben dem Land, bei dem die Mittel meiner Ansicht nach keineswegs zu hoch sind, im Gegenteil, wir würden mehr brauchen - einen ganz gewaltigen Beitrag. Es wurde des weiteren ausgeführt, daß der Familienbetrieb im Vordergrund steht. Die ganze Agrarpolitik ist ja auf Iden Familienbetrieb abgestimmt. Wenn nun gesagt wurde, daß man dafür sorgen müßte, daß gerade der Familienbetrieb Förderungsmittel erhält, darf ich feststellen, daß es eine Bestimmung gibt, die Betriebe, die nicht Familienbetriebe sind, von der Förderung ausschließt; sie können nur in Ausnahmefällen miteingeschlossen werden, da die Grenze mit 500.000 Schilling Einheitswert festgelegt ist. Die Auffassung über den Begriff ,,Großbetrieb" und „Bäuerlicher Familienbetrieb" ist. in Österreich sehr verschieden. Der eine sagt bei 20 ha liegt die Grenze, der andere meint bei 40 ha und wieder einer bei 100 ha. Ich glaube, daß diese ungünstige Relation auch damit zusammenhängt, daß Österreich ein sehr waldreiches Land ist und daß im Waldgebiet eine größere Fläche notwendig ist, um einen Betrieb zu führen. Außerdem verfügen Kirche, Klöster, ja der Staat Österreich und sehr viele Private über große Besitzungen. Wenn man bedenkt, daß für die landwirtschaftliche Fläche ca. 60 Prozent zur Verfügung stehen, ist die Relation nicht so ungünstig. Es wurde auch die Verschuldung der österreichischen Landwirtschaft angeschnitten; Abgeordneter Schneider hat sie mit 7 Prozent beziffert. Wenn man hier die anderen Berufsparten vergleicht, müßte man eigentlich feststellen, daß die Verschuldung hier nicht so arg ist. Ich möchte weder aufjauchzen noch lamentieren, aber 7 Prozent sind bei der niedrigen Verzinsung des Kapitals für die Landwirtschaft schon ziemlich viel. Ich bitte, hier keine Vergleiche mit dem Gewerbe oder mit der Industrie anzustellen, denn dort wird das Geld ja viel schneller umgewälzt, es amortisieren sich die Schulden viel schneller. Bei der Landwirtschaft geht das verhältnismäßig langsamer. Darf ich hier einen Vergleich ziehen zu Staaten in Europa, zum Beispiel Deutschland, dort ist die Verschuldung bei c. 20 Prozent, in der Schweiz bei nahem 50 Prozent, bei den nordischen Staaten, hier insbesondere in Dänemark, liegt sie bei 90 Prozent, in Österreich steht sie derzeit bei 7 Prozent. Das könnte uns aufjauchzen lassen. Ich habe aber schon gesagt, es ist weder ein Grund zur übermäßigen Freude noch einer zum Schwarzmalen. Alle diese Zahlen lassen sich nur sehr selten miteinander vergleichen. Darf ich Ihnen hier einen extremen Fall von Dänemark anführen. In Dänemark spricht man von 90 Prozent, aber es herrschen dort ganz andere Übergabebedingungen. Es muß der junge Bauer von seinem Vater den Besitz regelrecht kaufen. Der Staat greift in das Rechtsgeschäft zwischen Vater und Sohn in der Form ein, daß der Sohn vom Vater den Hof kaufen muß, es kann der Vater dem Sohn den Hof nicht schenken; wenn er dies tut, kommt der Staat mit der Schenkungssteuer und nimmt ihm eine gewaltige Summe weg. Es gibt dort drei Arten von Hypotheken. Der junge Bauer geht nun in die Staatsbank und nimmt sich das Geld auf, um den Hof vom Vater zu kaufen; dadurch liegt schon eine Riesenhypothek auf dem Hof. Er gibt dem Vater das Geld, der legt es in die Kasse und fristet damit sein Leben. Es lassen sich daher die Staaten untereinander nur schwer vergleichen. Ich würde Ihnen aber raten, hier nicht andere Berufsgruppen heranzuziehen. Es wurde auch von Maschinenhöfen gesprochen und darauf hingewiesen, daß sie unter Umständen beigetragen hätten, hier weniger Kapital aufwenden zu müssen, da man !gemeinsame Maschinenanschaffungen durchführen könnte. Ich glaube, auch dort, wo versucht wurde, mit Maschinenhöfen durchzukommen, zeigt sich wieder eine rückläufige Tendenz. Ich möchte hier niemandem einen politischen Vorwurf machen, aber die Zeit bahnt sich eben ihren Weg selbst. Wir haben in Österreich, Gott sei Dank, das Nachbarschaftshilfegesetz. Ich bin der Meinung, daß gerade diese Nachbarschaftshilfe den Weg zu geringeren Investitionen weist, und zwar nicht in der Form, daß man gemeinsame Maschinen auf genossenschaftlicher Basis besitzt - manchmal wind das gut gehen, in den meisten Fallen nicht -, sondern daß sich der eine Bauer diese und der andere Bauer jene Maschine kauft. Ich könnte hier einige Fälle in meiner Gemeinde aufzeigen, wo sich diese Nachbarschaftshilfe sehr bewährt hat. Jeder ist für seine Maschine verantwortlich, er betreut sie und hat daher auch weniger Schaden, sie helfen sich gegenseitig aus, und ich glaube, daß hier wirklich ein brauchbares Gesetz geschaffen wurde. Was die Beiträge zum Landarbeiterwohnbau betrifft, darf ich feststellen, daß hier nicht nur Landesmittel, sondern im wesentlichen auch Bundesmittel verwendet werden. Das Land gibt die Landesmittel an die beiden Kammern, sie werden mit Bundesmitteln ergänzt und kommen dann zur Vergebung. Leider müssen wir aber bemerken, daß die Zahl der Landarbeiter gewaltig rückläufig ist, so daß - würde man eine Relation anstellen - die Mittel ausreichen, ich stehe aber nicht an zu sagen, daß wir auch selbstverständlich hier noch mehr Geld brauchen würden. Wenn Sie erwähnen, daß bei der Tbc-Bereinigung zuwenig Mittel angesetzt scheinen, darf ich feststellten, daß die Materie abgeschlossen ist. Wir haben im Jahre 1967 nur mehr für die dauernde Kontrolle der Bestände - ausgenommen einige Ausläufer - zu sorgen. Die Erstausmerzung hat große Mittel verschlungen, wir haben aber, Gott sei Dank, in Österreich im Jahre 1967 nur mehr für die Ausläufer aufzukommen und können uns dann der dauernden Überprüfung widmen, denn die Bestände sind rein, sie bleiben es aber nicht unbedingt. Zur Wohnbauförderung: Es ist eine Umschichtung des Bedarfes. Wenn man die ersten Nachkriegsjahre nimmt, so war damals ein großer Andrang auf Kredite, damit sich der Bauer Maschinen kaufen konnte. Die Landflucht hat ihm die Leute weggenommen, er hat selbstverständlich Maschinen und dazu viel Geld gebraucht. Es hat sich dann umgewälzt auf die Wirtschaftsgebäude, auf Stallgebäude, und der neue Trend geht jetzt lauf die Wohnbauten aber. Es ist schwer zu sagen, wieviel Prozent der bäuerlichen Wohnungen in Osterreich sich in einem guten, mittleren und schlechten Zustand befinden. Wir wissen nur, daß große Geldmittel für diese Umschichtung von der Maschine über die Wirtschaftsgebäude und jetzt zu den Wohngebäuden nötig sind. Hoffentlich gelingt es uns noch, bevor wir in die EWG hineinkommen, nach dem Rechten zu sehen, damit unsere bäuerliche Bevölkerung die Möglichkeit hat, in menschengechten Wohnungen zu leben. Eine optisch unschöne Sache ist auch im Budget. Es scheinen statt 16 Millionen Schilling nur 14 Millionen Schilling an Mitteln auf. Minus 2 Millionen Schilling wurden hier angezogen. Hoffentlich gelingt es uns in den nächsten Jahren - ich werde mich bemühen -, wenigstens die 14 Millionen Schilling zu halten, denn es ist ja so, daß die bäuerliche Wohnbauhilfe auf einen Fonds umgelenkt wurde. Die Rückflüsse kommen jetzt nicht mehr zum Land und daher nicht mehr in der gleichen Summe in das Ressort, sondern auf direktem Weg zu dem Fonds, und daher ist es theoretisch so: Wenn wir es gleich belassen würden, würe es jährlich um 2 Millionen Schilling fallen. Ich bin aber Ihrer Ansicht. Hoffentlich gelingt es uns allen zusammen, jetzt einmal stillzuhalten, damit ein regelrechter Aufbau der Mittel, die wir durch die Umschichtung beim Wohnbalu selbstverständlich brauchen, erfolgt. Forstaufschließungswege: Es ist gesagt worden, daß wir in Österreich tim Schnitt 15 Laufmeter auf dem Hektar haben und daß wir anstreben, auf 25, vielleicht auf 30 zu kommen. Ich darf Ihnen sagen, daß wir dieses Maß in den Zentren, wo ein Hochaufschließung dabei ist, fast erreicht haben, weil eben die beiIden Förderungsinstitute, die bei den Bauinstitute, die Fages und die Stelle beim Land immer ein bissel konzentrisch vorgehen. Nicht ausgebaut sind die entlegenen Forste, die wir aber auch aufschließen müssen. Wir müssen daher die 70 km, die im Jahr gebaut wenden - sie wunden auch erwähnt -, mit zwei multiplizierten, weil es bei der Kammer noch die Fages gibt, die auch ungefähr 70 km im Jahr ausbaut. Nicht nur der Wegebau bringt uns große Sorgen, sondern auch die Wegeerhaltung. Die Wege sind einmal da und sie werden nicht mehr nur vom Traktor oder von mit Tieren gezogenem Fuhrwerk befahren, sondern oft von großen Personenwagen, deren Besitzer dem Bauer in sehr vielen Fällen einen Nebenverdienst bringen, weil die Fremden bei ihm einkehren und wohnen wollen. Sie wissen, daß diese Wagen schneller als die Bauernfahrzeuge fahren und dadurch die Wege gewaltig mitgenommen werden. Es wird uns daher die Wegeerhaltung in Zukunft große Sorgen bereiten. Schon beim Ausbau des Weges werden die Bauern, aber auch wir, die öffentliche Hand, gewaltige Mittel hinlegen müssen. Damit sind wir aber noch nicht fertig; wir brauchen noch mehr Mittel, denn es folgt schon wieder die Erhaltung dieser Wege. Da, glaube ich, müsste man einen Weg finden, daß nicht nur der Rauer zu dieser Wegerhaltung beitragen muß, denn auch die anderen fahren jetzt auf diesen Wegen. Das ist eine große Sorge, die uns noch trifft. Ich komme zum Schluß und darf noch ein Wort zu den Marktordnungsgesetzen sagen, die auch genannt wurden. Ich hoffe, es sollte damit nicht gesagt werden, jetzt haben wir dem Bauer etwas Gutes getan, jetzt hat auch die Sozialistische Partei im Parlament zu den Marktordnungsgesetzen die Zustimmung gegeben. Wenn es so wäre, daß diese Gesetze nur idem Bauer dienen würden, dann weiß ich nicht, ob noch zur richtigen Stunde auch die Zustimmung gekommen wäre. Es sind aber sicher alle der Meinung, daß die Marktordnungsgesetze nicht nur dem Bauer, nicht nur der Landwirtschaft, sondern auch dem Konsumenten dienen. Einer hat gesagt, daß wir im Jahre 1965/66 nicht einmal 80 Prozent (der Lebensmittel produzieren konnten, die der Mensch zum Leben braucht. Das hört sich sehr hoch an, fast so, als gäbe es jetzt schon Schwierigkeiten, wie wir unsere Lebensmittel unterbringen. Ich darf Sie nur bitten, daran zu denken, daß zur Stillung des Hungers nicht 80Pruzent, sondern 100Prozent gehören. Wenn Sie Ihren Kindern nur 80 Prozent der Lebensmittel geben, die sie täglich brauchen, würden Sie bald hören, wie sie nach Brot rufen. 80 Prozent produzieren wir im Schnitt, das heißt, wir müssen uns bemühen, noch mehr zu bauen. Wir können daher nicht einige Sparten dadurch umbringen, daß wir sie preisgeben und sagen, wenn so viel da ist, dann hört auf zu produzieren. Wir brauchen keine Marktordnungsgesetze! Ich sage nicht, daß Sie es gesagt haben, ich will nur demonstrieren, daß man Zweige der Landwirtschaft vor die Hunde gehen lassen kann, wenn man sagt, momentan haben wir zuviel. Unser Butterüberschuß - das wurde heute auch schon gesagt - macht nicht einmal einen Wochenbedarf aus, und wenn wir gar eine Fettbilanz in Österreich machen würden, würden wir in einigen Tagen nach den Kartenstellen fragen, damit wir Karten bekommen, um unseren Fettbedarf decken zu können. Das zeigt uns, daß wir nur 80 Prozent haben. Es war daher notwendig, Gesetze zu bekommen, die um die Ernährung in Zukunft insoferne sichern, daß wir in der Lage sind - wenn es auch einmal da und dort ein wenig zuviel ist - weiter zu produzieren. Wenn alle die Zustimmung zur Verlängerung der Marktordnungsgesetze wieder gegeben haben - leider Gottes nur auf zwei Jahre -, dann war es nichts anderes als die Sicherung der Ernährung auf wenigstens 80 Prozent. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, freut es mich, daß Sie alle zum Kapitel Landwirtschaft keine wesentlichen negativen Dinge vorgebracht haben. Ich hoffe, Sie haben damit dokumentiert, daß wir alle auf einem Ast sitzen, auf dem Ast der Ernährung, der bei den Bauern Österreichs liegt. (Beifall bei der ÖVP.) DRITTER PRÄSIDENT REITER: Als letzter Redner zur Gruppe 7 hat Herr Landeshauptmannstellvertreter H i r s c h das Wort. Landeshauptmannstellvertreter HIRSCH: Herr Präsident! Hoher Landtag! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe den Ruf ,,Uijeh" vernommen, Sie brauchen keine Sorge zu haben, daß ich das Paket, das ich vor mir habe, Verliesen werde. Es dient mir nur als Unterlage zu den Zahlen, die ich für meine Ausführungen brauche. Ich darf vorerst, Hohes Haus, meiner ehrlichen Freude darüber Ausdruck geben, daß seit Beginn der Budgetdebatte in diesem Hause über die Wirtschaft so viel diskutiert wurde. Wenn ich mich an die Jahre vorher zurückerinnere, so glaube ich, wurde dem Kapitel 7 nicht so viel Raum wie in diesem Jahr gegeben. Dafür darf ich Ihnen meine Anerkennung und Hochachtung zum Ausdruck bringen. Fast in allen Reden wurde die Bedeutung der Wirtschaft in irgendeiner Form herausgestrichen, ja, es sind sogar sehr anerkennende Worte übler die Wirtschaft gefallen, auch mancher Hinweis, wie man es besser machen könnte, und manche Art der Kritik. Das alles zusammen läßt mich nicht nur in die Dankesworte jenes Redners einstimmen, der hier im Zusammenhang mit dem Fremdenverkehrsreferat den beamteten Referenten und Mitarbeitern außerordentlichen Dank für die große Bewältigung ihrer Aufgaben gezollt hat, sondern auch persönlichen Dank zu sagen allen Referaten, angefangen vom Straßenreferat bis zum KulturPeferat, für das gute Zusammenwirken, soweit es sich um die Bereiche der Wirtschaft und im besonderen um die Fremdenverkehrswirtschaft gehandelt hat. Ich könnte jetzt noch lange Ausführungen machen, weil sehr viele Mängel aufgezeigt wurden, und ich könnte, genauso wie der Herr Abgeordnete, der vor nicht allzu vielen Stunden vorher hier gestanden ist, sagen, Niederösterreich ist im Bundesstaat jenes Land, das am meisten benachteiligt wurde, und für das Waldviertel gilt in Niederösterreich wider das gleiche. Ich könnte jetzt sagen, daß, wenn wir uns das Kapitel 7, Abschnitt 75, ansehen, das im Verhältnis zum Budget auch für diesen Abschnitt gelten könnte. Es wurde von einem der Herren Abgeordneten auch gesagt, daß hier keine Vermehrung ist. Ich darf Ihnen aber sagen, weil ich das nicht nur allein aus Gesprächen weiß, daß Straßen, Brücken und Einrichtungen jeglicher Art für die Wirtschaft notwendig sind. Deshalb hat es uns auch leid getan, daß, wie durch das Finanzreferat festgestellt wurde, es bei diesem Abschnitt zu keiner Ausweitung gekommen ist. Ich möchte aber sagen, daß ich hoffe, daß es möglich sein wird, im Laufe des kommenden Jahres bei einem allfälligen Nachtragsbudget gewisse Dinge auszugleichen, die jetzt von vornherein nicht gegeben sind. Ich stimme Ihnen also zu, daß die Wirtschaft auch bestimmte Förderungen notwendig hat. Wenn wir außerhalb des Budgets seit Jahren immer wieder in vielfältigster Weise versucht haben, den Mangel an Mitteln durch Kreditaktionen auszugleichen, wobei das Land die Haftung übernimmt, dann möchte ich dem Hohen Landtag aufrichtigen Dank sagen dafür, weil nur dadurch der Ausbau des Fremdenverkehrs in dem Maße möglich war, wie es bis heute geschehen ist, aber doch noch zu gering ist. Ich will dann noch auf die Kritiken zurückkommen, warum Niederösterreich im Gegensatz oder im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht in der gleichen Weise vorangekommen ist. Da gibt es aber auch, wie bei allem in der Wirtschaft, weil die Vielseitigkeit, die Vielschichtigkeit und die Vielproblematik gerade in der Wirtschtaft das bedingt, noch manche Dinge, die übersehen werden können. Ich möchte aber jetzt feststellen – das ist aber von mir nicht als Vorwurf gedacht, sondern nur gesagt, um verschiedene Dinge in das rechte Licht zu rücken -, daß Straßen, Brücken und Wege Adern und Nerven der Wirtschaft sind. So wurde es hier gesagt. Ich gehe sogar noch weiter und sage, sie sind notwensdig zur Begegnung, nicht nur allein auf wirtschaftlichem Raum, sondern zur Begegnung von Mensch zu Mensch, nicht nur in unserem Lande selbst, sondern weit über die Grenzen unseres Landes hinaus, und ich darf mich daher ein wenig den Bemerkungen, die zu diesem Abschnitt in diesem Kapitel gemacht wurden, zuwenden. Ich verspreche, mich wirklich sehr kurz zu fassen. Ich freue mich, daß beim Kapitel Landwirtschaft eine so rege Beteiligung an Rednern war, die alle übereinstimmend die Notwendigkeiten der Förderungsmaßnahmen auf allen Gebieten festgestellt haben. Ich möchte sagen, in gleicher Weise trifft da fast alles auch für die gewerbliche Wirtschaft zu. Wenn zu bedeutenden wirtschaftlichen Projekten von hier aus auch Stellung genommen und damit die Bedeutung gerade für das Waldviertel herausgestrichen wunde, so muß ich diesen Ausführungen vollkommen folgen. Frau Abg. Körner hat das Projekt Göpfritz angezogen und darauf hingewiesen, daß in einer Konferenz in Krems Prof. Jäger darauf hingewiesen habe, wie bedeutsam diese Dinge seien. Auch für die Fremdenverkehrswirtschaft im Waldviertel hat sie sehr stark das Wort genommen. Dabei wurde auch - ich weiß nicht von wem - gesagt, daß dabei selbstverständlich erst viele Voraussetzungen geschaffen wenden müssen. Nicht allein die Energieversorgung, nicht allein die Wasserversorgung, sondern darüber hinaus die Versorgung der Menschen, die dann in diesem Werk, wenn es gelingt, tätig sein werden, die Schulen, die von uns verlangt werden, wo Fremdsprachen unterrichtet werden, und anderes mehr. Was das für eine Aufgabe ist, kann man erst ermessen, wenn man weiß, wie die Verhandler, die in Klosterneuburg mit uns gesprochen haben, die Problematik der Einrichtungen eines solchen Werkes sehen. Ich hatte die Gelegenheit, dabei zu sein. Es werden dabei wahrhaftig sehr viele Aufgaben gestellt, und die Bewältigung dieser Aufgaben wird wehr viele Mittel erfordern. Das Land Niederösterreich wird diese Mittel nicht allein aufbringen können. Wir werden darauf angewiesen sein, daß uns der Bund gewaltig zur Seite steht, denn nur dann wird es überhaupt möglich sein, die Dinge zu bewältigen. Es freut mich auch, daß über die Fremdenverkehrswirtschaft so viel ausgesagt wurde. Sie ist ein bedeutsamer Zweig und praktisch immer wieder der Lückenbüßer für die gesamte Wirtschaft. Wenn wir vom Ausland zuviel an Importen hereinbekommen, dann muß eben die stille Ausfuhr, also der Fremdenverkehr, Mr einen gewissen Ausgleich sorgen. Selbstverständlich hat die Fremdenverkehrswirtschaft im ganzen Lande große Anstrengungen gemacht, auch ober dem Manhartsberg, und ich freue mich, diese Feststellung machen zu können, weil das Land allein das nicht tun könnte, weil viele, viele notwendig sind, damit wir zum Ausbau gerade auf diesem wirtschaftlichem Gebiet kommen. Die Gemeinden, die Vereinigungen, die Privaten, sie alle müssen zusammenwirken Das Land kann nur insoferne fördernd eingreifen, als wir billigen Kredit zur Verfügung stellen, Zinsenzuschüsse geben, als wir unter Umständen auch da und dort Subventionen geben, natürlich nur, wenn es sich um Gemeinden und Vereinigungen handelt, denn bei Privaten können wir das nicht tun. Nur auf diese Art und Weise können wir tatsächlich den Erfordernissen Rechnung tragen. Zu der Feststellung, daß in Kärnten in einem kleinen Ort ganz andere fremdenverkehrsmäßige Voraussetzungen vorzufinden sind, möchte ich mir erlauben gerade auf die Problematik dieser Dinge hinzuweisen, und ich glaube, auch meine Freunde im Fremdenverkehrsverband, in den Fremdenverkehrsunterverbänden, die wir in Niederösterreich, Gott sei Dank, haben, und in den Fremdenverkehrsgemeinden sind mit mir einer Meinung, daß wir, wenn wir im Fremdenverkehr vorwärts kommen wollen, vor allen Dingen an einer gewissen Fremdenverkehrsgesinnung aller interessiert sein müßten, denn der Fremdenverkehr verkauft sich nicht so wie eine Semmel oder sonst eine Ware. Denn hier im Verkauf des Fremdenverkehrs wind man, wenn wir noch so viel produzieren würden, nichts an den Mann bringen, wenn die Menschen sich nicht wie zu Hause fühlen, wenn sie nicht wüßten, daß sie hier Freunde haben, wenn sie nicht das, was eigentlich unsere Aufgabe ist, eine Verbindung zwischen den Menschen vieler Länder herbeizuführen, durch die Mentalität der Bevölkerung, durch die Freundlichkeit des Gehabens und durch ein nettes Benehmen vom Kinde bis zur Frau und zum Manne hätten. Freilich, alles andere ist dabei sicherlich notwendig. Der Fremdenverkehr allein würde auch in 'diesen Gebieten, im Waldviertel, nicht ausreichen, um die Voraussetzungen für bestimmte Lebensbedingungen zu schaffen. Wir haben aber nicht die Möglichkeit, daß wir jemand veranlassen, unbedingt dorthin zu gehen; wir können nur Begünstigungen beistellen. Es ist dem Landtag nicht hoch genug anzurechnen, daß er hier in einer großzügigen Gesinnung gehandelt hat. Die Kritik an der Einstellung der Nebenbahnen ist vollkommen berechtigt. Darf ich Ihnen sagen, was in dieser Hinsicht schon geschehen ist. Ich kann Ihnen noch aus der Zeit, in der wir alle sehr bedrückt waren, einen Briefwechsel vorlesen, aus dem hervorgeht, daß die Niederösterreichische Landesregierung sich an die Generaldirektion der Bundesbahnen gewendet hat und über die Dinge Aufklärung verlangte, die im Zusammenhang mit der Entsendung einer Kommission, die die Wirtschaftlichkeit dieser Nebenbahnen zu überprüfen hatte, beabsichtigt sind. Ich war damals sehr beruhigt, als am 31. August das Antwortschreiben einlangte, in dem mitgeteilt wurde, daß diesbezüglich keine Entscheidungen getroffen werden, ohne nicht vorher das Einvernehmen mit dem Landeshauptmann von Niederösterreich hergestellt zu haben. Ich habe dieses Schreiben damals Herrn Landeshauptmann Hartmann vorgelegt, und er war damit ein wenig zufrieden. Später habe ich dann Herrn Landeshauptmann Maurer diese Mitteilung zukommen lassen, und es ist zu hoffen, daß unsere gemeinsamen Bemühungen für dieses schwergeprüfte Gebiet von Erfolg gekrönt sein werden und man nicht den Willen, dort alles zu unternehmen, um die Existenzsicherung zu gewährleisten, durch andere Maßnahmen wieder tötet. Wenn daher heute der Resolutionsantrag gestellt wurde, so kann man dem ohne weiteres zustimmen; ich würde ihn aber nicht \so absolut formulieren, wie dies im ersten Absatz geschehen ist, sondern hinweisen, daß den Notwendigkeiten Rechnung getragen werden soll; wenn diese Formulierung aber so bleibt, ist dagegen auch nichts einzuwenden. Selbstverständlich müssen wir uns alle, wenn es um eine Schädigung der wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung geht, entsprechend zur Wehr setzen, ich stimme Ihnen hier voll und ganz zu. Ich pflichte auch den Ausführungen des Herrn Abgeordneten Fahrnberger bei, als er eindeutig und klar zum Ausdruck brachte, daß der Fremdenverkehr und der Ausbau desselben zur Existenzsicherung der bäuerlichen Bevölkerung beitragen kann. Es gibt dafür eine Reihe von Beispielen. Ich war am Sonntag anläßlich der Eröffnung reines Umlaufliftes in Lackenhof am Ötscher. Wir konnten dort feststellen, daß viele Einwohner ihre Hauser ausbauen, um Unterkünfte für Urlauber zu schaffen, weil die vorhandenen Quartiere nicht mehr ausreichen. Ich halbe mich auch sehr gefreut, daß einige Abgeordnete, darunter der Herr Abgeordnete Kaiser, sich so sehr mit der Wirtschaft beschäftigt haben, und ich kann nur betonen, daß manches auch volle Richtigkeit hat. Es wunde des weiteren über die Konjunkturabschwächung gesprochen. Sie wird oft bestritten, aber ich muß sagen, sie ist zu spüren, und die Ursachen müssen gefunden wenden. Es wunde auch erwähnt, daß für die Betriebe, die neue Aufgaben haben, ein Mehrbedarf an Kapital entsteht; das ist ebenfalls hundertprozentig zu unterstreichen. Es können aber die Maßnahmen, die wir über die einzelnen Förderungsfonds usw. treffen, nicht ausreichen, allem gerecht zu werden. Es ist richtig und ich begrüße es, wenn daran gedacht wird, eine eigene Förderung durch eine gemeinsame Aktion wieder ins Leben zu rufen. Der Wirtschaftsförderungsfonds hat sicher sehr segensreich gewirkt und viel dazu beigetragen, daß in kleineren und mittleren Betrieben Investitionen durchgeführt werden konnten; ebenso die Wirtschaftshilfeaktion, die wir in unserem Lande haben, und die Zinsenzuschußaktionen, wie auch der Betriebsinvestitionsfonds. Ich glaube, daß wir damit wenigstens zum Teil zufrieden sein können. Wenn daneben auch die Fremdenverkehrskreditaktionen seit Jahren laufen und immer neue Aufstockungsaktionen - wir sind jetzt bei der elften, und es wird vielleicht, wenn das Geld aufzubringen ist, möglich sein, daß ich schon im kommenden Jahr wieder eine solche Vorlage dem Landtag unterbreite - durchgeführt werden, so ersehen Sie daraus, daß noch sehr viel Bedarf an Kapital für die Fremdenverkehrswirtschaft vorliegt. Wir hätten keine glücklichere Formulierung finden können als die, welche seinerzeit als erste Vorlage dem Landtag unterbreitet wurde, daß das Land die Globalhaftung übernimmt, aber durch Bankrückhaftungen zur Gänze abgesichert ist, so daß kein Groschen dabei verloren gehen kann, ganz gleich, was auch immer kommen möge, oder das Land einmal mit dieser Landeshaftung, wie man des da oder dort sagen könnte, zum Zuge kommt. Es ist richtig, daß eine Marktforschung notwendig ist; aber eines steht fest, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Wirtschaft gibt es nur immer wieder diese Wechselbeziehung, die nicht wegzudenken ist, die Produktion und die Konsumation bzw. die Produktion und der Verkauf. Wenn Produkte - und wenn sie noch so gut sind - nicht verkauft werden können, ist früher oder später eine Katastrophe unvermeidlich. Es ist sehr erfreulich, daß wir nicht nur im Inland einen so großartigen Vertriebsapparat durch unseren Handel haben, das möchte ich ausdrücklich feststellen, sondern daß wir auch im Ausland durch die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft über Außenhandelsstellen verfügen, die dafür sorgen, daß auch die Industrieprodukte ins Ausland kommen. Wenn hier zum Ausdruck gekommen ist, man sollte die von Herrn Abgeordneten Schneider vorgelegte Kreditgarantiegemeinschaft nicht so sehr begrüßen, so will ich doch festhalten, daß wir eine Reihe solcher Aktionen haben. Ich erwähne nur den Wirtschaftsförderungsfonds, die gemeinsame Kreditaktion Bund - Land - Kammer, dann die Zinsenzuschußaktion, die Fremdenverkehrskreditaktion, den Betriebsinvestitionsfonds und schließlich die Landeshaftung. Wenn also dazu noch eine Einrichtung kommt, die die Versorgung mit Krediten ermöglicht, bei der auch das Land mitwirkt, ist das meiner Meinung nach nur zu begrüßen. Im Zusammenhang mit der Budgetdebatte ist immer wieder aufgeklungen, daß die Fremdenverkehrswirtschaft für alle Bereiche mitverantwortlich sein könnte, und ich muß das bejahen. Wenn also jetzt eine Einrichtung ins Leben gerufen wird, die die Kreditbeschaffung übernimmt, und wenn das Land mit dabei ist, so glaube ich, daß dies nur zu begrüßen ist und wir alle dem beipflichten körnen. Wenn aus der Debatte immer wieder hervorging, daß die Fremdenverkehrswirtschaft eigentlich in alle Bereiche hineinspielt, kann ich das nur bestätigen, denn wie Sie hier gehört haben, wurden vom Fremdenverkehrsreferat trotz der bescheidenen Mittel sogar für Staubfreimachungen Beiträge geleistet. Diese wurden nicht etwa für Landes- oder Bundesstraßen gegeben, nein, es wurden die Straßen in den Gemeinden staubfrei gemacht, Parkplätze geschaffen und Plätze, wo vielleicht größere Menschenansammlungen stattfinden, hergerichtet, damit nicht im Staub herumgegangen werden muß. In unserem Referat liegt, ein Ansuchen der Gemeinde Laxenburg zur Sanierung des großen Platzes mitten im Ort. Diesen im Regen zu überqueren, ist fürwahr kein Vergnügen. Wir werden daher versuchen, für dieses Vorhaben so viel wie möglich zu geben. Wir können ruhig sagen, daß jede Einrichtung dem Fremdenverkehr dient. Wenn eine Gemeinde Fremdenverkehrsgemeinde werden will, verlangen wir den Nachweis verschiedenster Einrichtungen, wird zum Beispiel Wasserleitung, Kanalisation, entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten usw. Auch Straßen und Brücken gehören ebenso dazu wie die Möglichkeit der Verpflegung und Unterbringung. Ich bin daher der Ansicht, daß wir diesem Zweig unserer Wirtschaft unser ganz besonderes Augenmerk zuwenden müssen. Ich stimme auch mit Herrn Abgeordneten Kosler überein und kann seine Einstellung verstehen, wenn er feststellt, daß ihn die Entwicklung auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs nicht vollauf befriedige. Man soll sich nicht immer auf Katastrophen und Unwetter ausreden, obwohl dies begründet wäre, sondern auch ganz andere Dinge in Betracht ziehen. Wenn man zwischen den Übernachtungsziffern der Jahre 1937, 1955 und 1965 Vergleiche zieht, muß man die näheren Umstände berücksichtigen. Niederösterreich verfügte im Jahre 1937 über 84.000 Fremdenbetten in Hotels, Sanatorien, Schutzhütten und Privatquartieren, wahrend es nach dem Kriege nur mehr 44.000, also ungefähr die Hälfte, waren. Nicht allein, daß wir zehn Jahre die Besatzung in unserem Lande gehabt haben, ist auch der Umstand in Betracht zu ziehen, daß Niederösterreich das klassische Fremdenverkehrsland für die östlichen Länder war, die uns heute vollkommen verwehrt sind. Heute wurde hier festgestellt - ich glaube, es war Herr Abgeordneter Janzsa, der von Milliardenbeträgen sprach -, wieviel Geld die Bevölkerung Niederösterreichs bzw. Österreichs ins Ausland bringt. Wer hätte denn schon bei den sozialen Verhältnissen des Jahres 1937, wie Urlaubsbedingungen usw., daran denken können, an die Adria zu reisen? Das alles spielt eine Rolle und muß bei Vergleichen bedacht wenden. Außerdem fällt auch ins Gewicht, ldaß wir von den verschiedenen Fremdenverkehrsgebieten abgeschnitten sind, während wir - und hier ergibt sich die Wechselbeziehung - eine Steigerung von einer Milliarde auf mehr als 'drei Milliarden Schilling zu verzeichnen haben. Wie hier auch festgestellt wurde, werben die Länder Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Jugoslawien um den Österreicher. Die Nähe der Grenzen und die Möglichkeit, entsprechende Geldbeträge mitnehmen zu können, bilden einen Anreiz, sich in diesen Ländern umzusehen. Betrachten wir einmal die Gegenseite. Wer kann denn schon aus Ungarn nach Österreich auf Urlaub fahren und wieviel finanzielle Mittel darf der Urlauber ins Ausland mitnehmen? Oft wird der Nachweis verlangt, daß er bei Verwandten wohnen kann. Das sind die Schwierigkeiten, die wir als östlichstes Bundesland haben. Sie dürfen jetzt nicht sagen, daß das in Kärnten nicht anders wäre. Wir sind im Norden und Osten von dieser toten Grenze eingeschlossen, was sich nicht nur als wirtschaftlicher Nachteil in bezug auf den Fremdenverkehr, sondern auch auf alle übrigen Gebiete auswirkt. Wenn wir nicht ohnedies genau Bescheid wüssten, könnten die dort liegenden Orte ein beredtes Zeugnis ablegen. Um die Verhältnisse richtig darzustellen, muß ich darauf hinweisen, daß alle diese Momente bei unserem langsameren Vorwärtskommen auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs eine bedeutsame Rolle spielen. Sie sind der Grund, weshalb wir im prozentuellen Anteil am Fremdenverkehr nicht so günstig liegen wie die westlichen Gebiete oder jene, die ihre Zugänge aus dem Westen haben. Ich möchte feststellen, daß wir aus diesen Gebieten langsam steigende Zugänge verzeichnen können. In bezug auf das Jahr 1937 möchte ich noch bemerken, daß wir einen sehr wichtigen Umstand, weshalb nicht mehr Fremde in unserem Land waren, nicht vergessen dürfen. Es hat damals die sogenannte 1000-Mark-Sperre gegeben, wodurch es für die Deutschen nicht leicht war, längere Zeit in Österreich zu verbringen, was sich auf unsere Fremdenverkehrswirtschaft sehr nachteilig auswirkte. Zur Ehre der Wirtschaft, der Fremdenverkehrsgemeinden, der Fremdenverkehrsverbände, der Länder und aller jener, die im Fremdenverkehr tätig sind, sei bemerkt, ,daß bisher die größten Anstrengungen gemacht wurden und auch weiterhin gemacht werden, um den Inländerfremdenverkehr mehr zu erfassen und die Saison zu verlängern. Es müssen daher Einrichtungen geschaffen werden, um den Fremdenverkehr auch in anderen Jahreszeiten zu intensivieren. Ein Vergleich zwischen den Jahren 1937 und 1965 kann daher nur unter diesen Perspektiven richtig ausfallen. Ich darf daran erinnern, daß Sie früher am Semmering nur sehr wenige Gäste aus Deutschland oder England gesehen haben werden. Die Besucher kamen alle aus den östlichen Gebieten. Zu der heute geübten Kritik, daß zuwenig Werbung betrieben wird, möchte ich feststellen, daß auch ich der Meinung bin, daß hiefür nicht genug getan werden kam. Mit den gleichen Mitteln bei erhöhten Preisen und Kosten mehr zu werben, ist jedoch ein Kunststück, das auch von Unis keiner zusammenbringen würde. Wir bemühen uns allerdings sehr, die Werbung zeitgemäß zu gestalten, sind jedoch an den uns gegebenen finanziellen Rahmen gebunden. Zum Abschluß kommend, möchte ich auch auf die Einrichtungen, die im Zusammenhang mit dem Fremdenverkehr in wenigen Jahren in unserem Land geschaffen wurden, hinweisen. Es wurde sehr viel über unsere Seilbahnen gesprochen. Wir haben diesbezüglich gegenüber den früheren Jahren einen beachtlichen Stand erreicht. In den letzten Jahren wurde eine Reihe von Seihbahnen und Sesselliften eröffnet, und wir sind glücklich, daß wir es auf die jetzige Zahl gebracht haben. Es ist klar, daß nur eine genaue Untersuchung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Anlagen die Grundlage für deren Errichtung sein kann, denn sonst würde der Fall eintreten, daß von Jahr zu Jahr für mehr solcher Einrichtungen ständige Subventionen gegeben werden müßten. Wir haben aber noch kein Wort bis auf eine einzige Ausnahme über die in großer Anzahl vorhandenen sommerfremdenverkehrsfördernden Maßnahmen gehört. Das sind zum Beispiel die Sommerbäder, die im ganzen Land verstreut eine solche Vielfalt ergeben, daß wir uns nur alle darüber freuen können. Sicherlich haben die Gemeinden der Vereinigungen, die solche Bäder führen, bei einer schlechten Saison ihre Schwierigkeiten. Wir werden ihnen daher zur Überbrückung solcher Schwierigkeiten zur Seite stehen müssen, dienen sie doch dazu, um den Strom der Wiener und der Fremden in unser Land zu führen und die Menschen zum Verweilen anzuhalten. Ich möchte noch betonen, daß ich selbstverständlich für Hinweise, wie man eine wirksame Werbung betreiben kann, sehr dankbar bin, und wenn vom Fernsehen gesprochen wird, darf ich folgendes sagen: Wir haben im Zusammenhang mit den Schneeberichten über den Rundfunk schon sehr viel getan, wir könnten auch sicherlich das noch verkraften, obwohl ich weiß, daß diese Durchsagen nicht billig sind; aber wir werden auch diesen Weg noch beschreiten. Wenn zum Schluß über den gesetzten Rahmen hinaus noch spezielle Fragen einer einzigen Gemeinde angeführt wurden, so bin ich gerne bereit, darauf zu antworten. Es widerspricht allerdings den Gepflogenheiten einer Budgetverhandlung, hier nur für eine Gemeinde zu sprechen. Ich möchte aber des Interesses halber feststellen, daß wir für das Theater natürlich auch einen Beitrag gegeben haben, obwohl ein Theater ja keine reine Fremdenverkehrseinrichtung ist. Wir sind aber von dem Gesichtspunkt ausgegangen, daß dieses Gebiet und dieses Theater wert sind, daß hier das Gemeinde-, Kultur- und Fremdenverkehrsreferat gemeinsam beitragen, damit die Gemeinde nicht unnötige Belastungen auf sich nehmen muß. Was das Centrelax anbelangt, darf ich anführen, daß die Gemeinde Berndorf seinerzeit um einen Fremdenverkehrskredit in der Höhe von 60.000 Schilling angesucht und ihn auch bis auf den letzten Groschen erhalten hat. Die Gemeinde Berndorf hat aber in der Folge direkt vom Handelsministerium einen Zinsenzuschuß für einen Kredit der Hypothekenanstalt erhalten, sie hat dann auch um einen Fremdenverkehrskredit gebeten, der mit einem solchen Zinsenzuschuß des Bundes ausgestattet ist. Zweimal aber kann von einer Bundesstelle ein Beitrag nicht geleistet werden. Es war deshalb die Gewährung des Fremdenverkehrskredites nicht möglich. Man muß all diese Dinge kennen, um hier ein Urteil abgeben zu können. Abschließend darf ich sagen: Natürlich sind noch sehr viele Probleme der Wirtschaft zu bewältigen, natürlich gibt es auf allen Gebieten noch ungeheuer viel zu tun und es wird von allen viel Mut und Energie notwendig sein, um da und dort richtig vorzugehen. Wir selbst wissen, daß wir in den regionalen Entwicklungsvereinen sehr wertvolle Helfer zur Seite haben, die uns immer wieder Hinweise geben. Wir wissen aber auch, daß in allen unseren Referaten ausnahmslos auf diese Dinge Rücksicht genommen wird. Es ist zu hoffen, daß es uns durch gemeinsame Anstrengungen und durch gemeinsame Arbeit gelingt, auch im kommenden Jahr wieder Iden Aufgaben gerecht zu werden, die uns gestellt sind, um zu weiteren Erfolgen für unser Land und für die brave Bevölkerung Niederösterreichs zu kommen. (Beifall im ganzen Hause). DRITTER PRÄSIDENT REITER: Die Rednerliste ist erschöpft, der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort. Berichterstatter Abg. ANZENBERGER: Ich verzichte auf das Schlußwort. DRTTTER PRÄSIDENT REITER: Zur Abstimmung liegt vor die Gruppe 7, Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung, hiezu die Resolutionsanträge der Abg. Körner, Schneider Karl, Schneider Karl und Körner. Ich lasse zunächst über die Gruppe selbst und die zu dieser Gruppe vorliegenden Resolutionsanträge abstimmen. Ich bitte den Herrn Berichterstatter, nunmehr seinen Antrag zu Gruppe 7, Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung, ordentlicher und außerordentlicher Voranschlag, zu stellen. Berichterstatter Abg. ANZENBERGER: Hohes Haus! Ich stelle den Antrag, die Gruppe 7, Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung, mit Einnahmen im ordentlichen Voranschlag von 64,589.000 Schilling und Ausgaben im ordentlichen Voranschlag von 249,581.000 Schilling sowie Ausgaben im außerordentlichen Voranschlag von 19,500.000 Schilling zu genehmigen. Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Abstimmung vorzunehmen. DRITTER PRÄSIDENT REITER (nach Abstimmung über die Gruppe 7, Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung, ordentlicher und außerordentlicher Voranschlag, in Erfordernis und Bedeckung): Angenommen Ich bitte nunmehr den Herrn Berichterstatter um die Verlesung der Resolutionsanträge. (Nach Abstimmung über den Resolutionsantrag der Frau Abg. Körner, betreffend Maßnahmen gegen Einstellung bzw. Einschränkung des Zugsverkehrs auf den sogenannten Nebenbahnen): Angenommen. (Nach Abstimmung über den Resolutionsantrag des Abg. Karl Schneider, betreffend Beteiligung des Landes an der Kreditbürgschafts-GmbH): A n g e n o m m e n. (Nach Abstimmung über den Resolutionsantrag der Abg. Schneider Karl und Körner, betreffend Fernbeförderungssteuer): A n g e n o m m e n . Ich ersuche den Herrn Berichterstatter Abg. A n z e n b e r g e r, zur Gruppe 8, Wirtschaftliche Unternehmen, ordentlicher und außerordentlicher Voranschlag, zu berichten. Berichterstatter Abg. ANZENBERGER: Hohes Haus! Ich berichte zur Gruppe 8. Die G r u p.p e 8, Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen, weist Ausgaben im Betrage von S 696.000 und Einnahmen von S 80.000 aus. Das Nettoerfordernis beträgt daher S 616.000. In dieser Gruppe kommen die Gebarungsvorgänge für Werke, Unternehmen der Verkehrsförderung, land- und forstwirtschaftliche Unternehmen und sonstige Unternehmen zur Verrechnung. Die Aufwendungen dieser Gruppe betragen 0,1 Prozent der Gesamtausgaben des ordentlichen Voranschlages gegenüber 0,3 Prozent des Vorjahres. Diese Gruppe zeigt auf der Ausgabenseite eine Verminderung um rund 6,1 Millionen Schilling, da für die Aufstockung des Gesellschaftsanteiles an der Wiental-Sammelkanalgesellschaft bzw. der NÖSIWAG im Jahre 1967 im außerordentlichen Voranschlag Mittel bereitgestellt werden. Die Einnahmen dieser Gruppe haben keine Änderung erfahren. An außerordentlichen Ausgaben sind in der Gruppe 8 9,004.000 Schilling vorgesehen. Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Verhandlung zu dieser Gruppe einzuleiten. DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Wort ist niemand gemeldet; ich bitte den Herrn Berichterstatter, seinen Antrag zur Gruppe 8, Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen, ordentlicher und außerordentlicher Voranschlag, zu stellen. Berichterstatter Abg. ANZENBERGER: Hohes Haus! In der Gruppe 8, Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen, sind im ordentlichen Voranschlag Einnahmen in der Höhe von 80.000 Schilling und Ausgaben von 696.000 Schilling und außerordentlichen Voranschlag Ausgaben von 9,004.000 Schilling vorgesehen. Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Abstimmung einzuleiten. DRITTER PRÄSIDENT REITER (nach Abstimmung über Gruppe 8, Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen, ordentlicher und außerordentlicher Voranschlag, in Erfordernis und Bedeckung): Angenommen. DRITTER PRÄSIDENT REITER: Ich ersuche den Herrn Berichterstatter, Abg. Anz e n b e r g e r , zur Gruppe 9, Finanz- und Vermögensverwaltung, ordentlicher und außerordentlicher Voranschlag, zu berichten. Berichterstatter Abg. ANZENBERGER: Hohes Haus! Ich berichte zur Gruppe 9: Die Ausgaben und Einnaihmen der G r u p p e 9, Finanz- und Vermögensverwaltung, beziehen sich auf die Finanzverwaltung, das allgemeine Kapitalvermögen, auf das Liegenschaftsvermögen, auf das Sondervermögen, auf die Steuern und steuerähnlichen Ein nahmen und Ausgaben, auf die Zuführungen zum außerordentlichen Haushalt, auf die Beihilfen ohne besondere Zweckbestimmung, auf die Verstärkungsmittel, auf die Abwicklung der Vorjahre und auf sonstige in diesen Rahmen fallende Gebarungsvorgänge. Die Ausgaben dieser Gruppe betragen S 389,388.000,-, ihnen stehen Einnahmen von S 1.909,648.000,-- gegenüber, so daß sich ein Nettoertrag von S 1.520,296.000,-- ergibt. Innerhalb des ordentlichen Voranschlages beanspruchen die Ausgaben dieser Gruppe 15,2 Prozent, während sie im Vorjahr 18,1 Prozent betrugen. In dieser Gruppe werden die Eingänge an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben sowie die eigenen Steuern des Landes als hauptsächlichste Einnahmenpost des Landes veranschlagt. Damit stellt sich diese Gruppe als wichtigste der Landesgebarung dar. Die Ausgabenseite dieser Gruppe zeigt ein Sinken um rund 12 Millionen Schilling. Dies ist darauf zurückzuführen, daß für den Schuldendienst um 19 Millionen Schilling weniger notwendig sein werden und daß die Ansätze ,,Förderungsbeitrag für die Kammer für Arbeiter und Angestellte" und ,,Beiträge für Gemeindevertreterverbände" in die Gruppe 0 überstellt wurden. Im Jahre 1966 waren hiefür 2,6 Millionen Schilling veranschlagt. Hingegen zeigen die Bedarfsauweisungen an Gemeindeverbände und Gemeinden ein Ansteigen um 8,3 Millionen Schilling. Der Kredit für Verstärkungsmittel wurde um 1 Million Schilling erhöht. Neu in den Voranschlag aufgenommen wurde der Voranschlagsansatz 922-60, Grundbesitz, Sonstige Kosten, mit einem Kreditbetrag von 15.000 Schilling. Die Einnahmenseite weist Mehreinnahmen von 233,5 Millionen Schilling tauf. Sie ergeben sich bei den Zinsen von Wertpapieren und Guthaben mit einer Million Schilling, bei den Haftungsbeiträgen und dem Kriegsgräberspendenfonds mit 0,3 Millionen Schilling, bei den eigenen Steuern mit rund 3,8 Millionen Schilling, bei den Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit rund 196,1 Millionen Schilling, bei der Landesumlage mit rund 14,3 Millionen Schilling und bei den Bedarfszuweisungen des Bundes für Gemeindeverbände und Gemeinden mit rund 8,3 Millionen Schilling, während die Zinsen und Rückflüsse aus gegebenen Darlehen eine Verminderung um rund 0,7 Millionen Schilling erfuhren. Neu in den Voranschlag aufgenommen wurden der Voranschlagsansatz 963-75, Zweckzuschuß des Bundes zum Bauaufwand der öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen, mit einem Einnahmenbetrage von rund 10,3 Millionen Schilling. Eine Reihe von Einnahmenansätzen dieser Gruppe wäre einer Zweckbindung zu unterwerfen. Im außerordentlichen Teil weist die Gruppe 9 Einnahmen in der Höhe von 3,172.000 Schilling aus. Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Verhandlungen über diese Gruppe einzuleiten. DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Wort gelangt Herr Präsident W e i s s. PRÄSIDENT WEISS: Herr Präsident, Hohes Haus, werte Damen und Herren! Nicht weil ich unbedingt auch ans Rednerpult wollte, habe ich mich zu Worte gemeldet, sondern weil ich von der Notwendigkeit überzeugt bin, zu einer Frage der Gruppe 9 das Wort zu ergreifen, die zwar keine politische ist, sondern eine, die uns alle gemeinsam berührt. Leider ist es aber dann doch so, daß für die Betroffenen indirekt ein Politikum daraus wenden konnte, weil bei der Verteilung der Mittel, die die Betroffenen so notwendig brauchen, die erforderliche Objektivität entweder nicht vorhanden ist oder nicht angewendet wird. Sie werden jetzt schon wissen, worauf ich zurückkomme, nämlich auf die Katastrophen, von denen in den letzten beiden Jahren unser ganzes Bundesgebiet betroffen wurde. Im Jahre 1965 haben Bund, Land und Gemeinden, aber auch tausende freiwillige, hilfsbereite Menschen versucht, mit diesem Unglück fertig zu werden. Es ist auch bis zu einem gewissen Grad gelungen, durch diese Anstrengungen den entstandenen Schaden, der in Niederösterreich in einer Größenordnung von 235,209.000 Schilling aufgetreten ist, durch gezielte Aktionen wenigstens zu lindern. Der eingetretene Schaden, den 1440 Personen an Gebäuden und Einrichtungen verzeichnet hatten, beträgt allein 39,345.000 Schilling. An Flurschäden ist für 8061 Betroffene eine Schadenssumme von 183,142.000 Schilling festzustellen. An 63 Objekten entstand ein Wegeschaden von 12,722.000 Schilling. Zur Behebung dieses Schadens im Jahre 1965 wurde für Gebäude und Einrichtungen an die Betroffenen eine direkte Beihilfe von 9,634.000 Schilling zur Auszahlung gebracht und dazu noch ein Darlehen von 2,580.000 Schilling gewährt. Für Flurschaden wurde eine Vergütung von 34,920.000 Schilling gegeben und damit der Versuch unternommen, diesen entstandenen Ernteschaden wenigstens zum Teil dadurch auszugleichen, daß nicht eine direkte Existenzgefährdung für die Betroffenen eintritt. Es wurde dann noch ein Zinsenzuschuß für größere Betriebe, die auch von diesem Unglück betroffen wurden, von 6,700.000 Schilling gewährt. Eine gezielte Saatgutaktion, die 4,700.000 Schilling umfaßte, wurde ebenfalls zur Linderung der Not eingeleitet und für die Betroffenen wirksam. Eine Heuspendenaktion mit einem Wert von 187.000 Schilling und eine Aktion zur Beseitigung der Wegschäden zu den Betriebsgebäuden mit einem Betrag von 7,458.000 Schilling seien noch erwähnt. Zusammengerechnet ergibt das die Summe von 59,149.000 Schilling, dazu kommt noch der Betrag des Darlehens in der Höhe von 2,580.000 Schilling; es wurden also 61 Millionen Schilling aufgewendet aus den Beträgen von Bund, Land, Gemeinden und den privaten Spendern, die hier zur Linderung der Not mitgeholfen haben. Als sich aber dieses Unglück im Jahre 1966 in weiten Teilen unseres Landes und leider auch in Niederösterreich wiederholte, hat die hohe Bundesregierung nunmehr den Anstoß zur Beschlußfassung eines Gesetzes geben müssen, mit dem sie in die Lage versetzt wurde, ein nationales Notopfer einheben zu können. Die Bevölkerung war spontan dazu bereit, weil sie erkannt hatte, dlaß es sich hier tatsächlich um ein nationales Unglück handelt. In Niederösterreich ist auch im Jahre 1966 wieder in weiten Teilen großer Schaden an privatem und öffentlichem Gut entstanden, und zwar am 338 Gebäuden und Einrichtungen mit einer Summe von über 8,500.000 Schilling. Die Flurschäden, von denen 1695 Geschädigte (betroffen wurden, betrugen im Jahre 1966 rund 30 Millionen Schilling. Wegschäden sind in der Höhe von 9,440.000 Schilling zu verzeichnen. Dazu kommt, daß das Unglück, das durch den Windbruch entstanden Ist, eine Schadenssumme verursacht hat, die die Grenze von 20 Millionen Schilling überstiegen hat, so daß im Jahre 1966 wieder ein Schaden von rund 70 Millionen Schilling entstanden ist. Und jetzt komme ich eigentlich zum Grundsätzlichen meiner Absicht, mit der ich aufzeigen wollte, was mir bei dieser leidlichen Sache nicht gefällt. Wir wissen schon sehr genau zu beurteilen und einzuschätzen, daß in den betroffenen Bundesländern, wo Schäden an Gebäuden entstanden sind, wo Menschenleben zugrunde gegangen sind, wo Menschen chacenlos geworden sind, die Belastung der Menschen sicherlich größer geworden ist als dort, wo nur materieller Schaden entstanden ist. Daher haben wir Verständnis dafür, daß Vorrang für die Beseitigung dieses Unglücks naturgemäß dort einsetzen muß, wo dieses menschliche Leid in vollem Umfang wirksam geworden ist. Daß man aber daneben für das Land Niederösterreich, das in diesen beiden Jahren genauso schwer, nur in einer anderen Art, nämlich mit mehr materiellem Schaden, belastet war, eine ungerechte Verteilung der Mittel walten läßt, will ich nicht ganz verstehen, denn auch bei Menschen, die durch Iden eingetretenen Flurschaden zwei Ernten verloren haben und dadurch in ihrer Existenz sehr gefährdet sind, ist eine Belastung eingetreten, die in der Wertordnung dem Leid und Unglück anderer Menschen gleichzusetzen ist. Wir waren schon darüber nicht sehr glücklich, daß es für Niederösterreich im ersten Jahr bei der Verteilung der Bundesmittel so gewesen ist, daß Niederösterreich für 1 1/2 Bundesschilling einen Landesschilling aufwenden mußte und das auch im Jahre 1966 wieder tun muß, während die anderen Bundesländer zwei Bundesschilling Grund des eingetretenen Schadens auch in Niederösterreich für einen notwendigen Hochwasserschutzbau Vorsorge getroffen werden muß, haben die Herren Abgeordneten während der ganzen Budgetdebatte des öfteren hier vom Rednerpult aus gesagt. Daher, glaube ich, muß auch in Niederösterreich für einen entsprechenden Hochwasserschutzbau vorgesorgt werden, der verhindern soll, sodaß wieder ganze Ernten verlorengehen und dieses niederösterreichische Volk in Not und Leid gestürzt wird. Ich erlaube mir daher, einen Resolutionsantrag zu stellen - er wurde von mehreren Kollegen unterzeichnet -, und bitte Sie jetzt schon, diesem Ihre Zustimmung zu geben. Er soll die Bundesregierung auffordern, dem Land Niederösterreich doch in gleicher Weise beizustehen, wie das, verständlicherweise, auch für die anderen Bundesländer vorgesehen ist (liest): „Resolutionsantrag der Abgeordneten Weiss, Sigmund, Stangler, Schneider K., Brunner, Wüger, Keibllinger, Kienberger, Reischer und Anzenberger zu G r u p p e 9 des Voranschlages des Landes Niederösterreich für das Jahr 1967, Ltg. 200. Nach § 15 des Wasserbautenförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 34/1948 in der derzeit geltenden Fassung, können nur die geschädigten örtlichen Interessenten durch Verordnung der Bundesregierung von der Beitragsleistung befreit werden. Das Hochwasserhilfegesetz 1966, BGBI. Nr. 208, sieht die Gewährung von Zweckzuschüssen des Bundes an die Länder und Gemeinden für auf deren Hoheitsgebiet eingetretene Hochwasserschäden unter der Voraussetzung vor, daß von den betroffenen Ländern bestimmte Beitragsleistungen erbracht werden. Ähnlich liegen die Verhältnisse nach dem Katastrophenfondsgesetz, BGBl. Nr. 207/1966. Allfällige Zweckzuschüsse des Bundes sind an die Beitragsleistung der Länder und Gemeinden nach dem Wasserbautenförderungsgesetz geknüpft. Die Mittel hiefür bringt der Bund im Wege einer Zwecksteuer auf. Es ergibt sich somit, daß die ohnedies durch die Katastrophen schwerst betroffenen Bundesländer und Gemeinden im Gegensatz zum Bund fast ausschließlich aus Budgetmitteln noch enorme Beiträge erbringen müssen, die ihre finanzielle Leistungsfähigkeit übersteigen. Darüber hinaus müssen die Länder noch für Konkurrenzbauten bedeutende Mittel bereitstellen. Es muß auch darauf hingewiesen werden, daß die Verteilung jener Bundesmittel, die der Errichtung von Hochwasserschutzbauten dienen sollen, hinsichtlich des dem Land Niederösterreich zukommenden Anteiles nicht so erfolgt, wie es Iden gegebenen Tatsachen entspricht. Die Landesregierung wird aufgefordert, 1. bei der Bundesregierung unter Einsatz aller ihr zur Verfügung stehlenden Mittel zu verlangen, daß ehestens im Wege gesetzgeberischer Maßnahmen a) die Beitragsbefreiung der geschädigten örtlichen Interessenten gemäß § 15 Wasserbautenförderungsgesetz auch auf die Länder und Gemeinden ausgedehnt wird und Vorkehrungen getroffen wenden, daß aus der Beitragsbefreiung der geschädigten örtlichen Interessenten den Ländern und Gemeinden keine Mehrbelastungen entstehen können sowie b) die Länder und Gemeinden von der Beitragsleistung nach dem Wasserbautenförderungsgesetz sowie von der Grundleistung nach § 18 des Finanzausgleichsgesetzes 1967 im Sinne des geschilderten Sachverhaltes befreit werden, 2. bei der Bundesregierung zu fordern, daß bei Verteilung jener Bundesmittel, die der Errichtung von Hochwasserschutzbauten dienen, das Land Niederösterreich entsprechend den gegebenen Verhältnissen berücksichtigt wird." Ich darf Sie bitten, diesem Antrag Ihre Zustimmung zu geben. (Beifall im ganzen Hause.) DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Wort gelangt Herr Abg. S t a n g l er. Abg. STANGLDR: Hoher Landtag! Ich habe beim Kapitel 3 im Rahmen einer entstehenden allgemeinen Diskussion angekündigt, daß ich mich der Ordnung halber mit dieser Frage erst im Kapitel 9 melden werde. Ich werde mich bemühen, das so kurz als möglich zu machen. Ich habe zwei Punkte vorzubringen. Erstens, glaube ich, kann man feststellen ich darf das namens meiner Fraktion tun -, daß wir in dieser Debatte zu den Problemen des Voranschlages in umfassender Weise Stellung genommen haben. Ich würde mir einen Vorschlag an die sozialistische Seite erlauben. Wir haben schon einmal darüber Einvernehmen gehabt, daß wir in der Budgetdebatte keine bezirkseigenen oder gemeindeeigenen Probleme beihandeln sollen, nur jene Fragen, die für das ganze Land oder die gesamte Bevölkerung Gültigkeit haben. Wir würden sonst leicht in den Fehler verfallen, nur persönliche Gemeinde- oder Bezirkswünsche hier zu vertreten. Es dient, glaube ich, dazu, daß die Debatte sachlich ist und auf einem höheren Niveau steht, wenn wir uns bemühen, allgemein zu diesen Fragen Stellung zu nehmen. Zum zweiten Punkt. Im Kapitel 0 hat sich Herr Landeshauptmannsbellvertreter Doktor Tschadek veranlaßt gesehen, wohl nicht zur Gemeindeangelegenheit zu sprechen, sondern er replizierte auf meine Ausführungen in der Generaldebatte über einige Feststellungen meinerseits zur Frage der vergangenen großen Koalition, deren große Verdienste ich gewürdigt habe. Ich stellte auch klar, daß es vor allem in späteren Jahren leider vielfach ein Unvermögen zur Lösung wichtiger Fragen gegeben hat. Der Dritte Präsident dies Landtages, Kollege Reiter, nahm dann im Kapitel 0 Gelegenheit, sich grundsätzlich mit der Haltung oder der Darstellung der SPÖ zu beschäftigen, und hier kam ein Ausdruck vor, der dann lebhafte Zwischenrufe auslöste und eine allgemeine Unruhe im Hause entstehen ließ. Ich erlaube mir dazu auch etwas Grundsätzliches zu sagen. Ich meine, daß es auch zur Demokratie gehört, auch in grundsätzlichen Fragen härtere Formulierungen zu gebrauchen. Das beweist auch die Debatte im Hohen Parlament drüben am Ring in den letzten Wochen, und ich glaube, selbst dann, wenn man die heutige Gesellschaft als eine pluralistische Gesellschaft voll und ganz anerkennt und sich auch zu der notwendigen Toleranz bekehrt, zur Toleranz gegenüber den politisch Andersdenkenden, so schließt das nicht aus, Argumente zu gebrauchen und eigene Meinungen zu vertreten, bei denen es auch zu harten Formulierungen kommen kann. Ich darf darauf hinweisen, daß der Präsident des Hohen Hauses drüben am Ring, der Herr Präsident des Nationalrates Maleta, festgestellt hat, schließlich sind Politik und parlamentarische Körperschaften keine Gartenlaube oder, wenn ich mich richtig erinnere, kein Jungmädcheninternat. Es geht eben in der Politik fallweise auch um härtere Gangarten. Nur um eines sollten wir uns dabei bemühen, nämlich daß vermieden wird, persönliche Beleidigungen auszusprechen, und gerade in diesem konkreten Falle, bei dieser grundsätzlichen Debatte, die Herr Präsident Reiter hier eingeleitet hat, kam es anschießend durch meinen sehr verehrten Kollegen, Abg. Grünzweig zu einer Antwort (Zwischenruf: Haßliebe ist das!), die eine sehr persönliche Beleidigung beinhaltete, und die weisen wir zurück. Das werden Sie verstehen. Da wir nun am Ende der Budgetdebatten sind, möchte ich - ich sage es ausdrücklich - durch meine Ausführungen absolut keine neuen Klüfte aufreißen. Das liegt mir vollkommen fern, nur eines darf ich dazu sagen: Herr Kollege Reiter hat wahrlich viel und genügend Material zur Verfügung gehabt, um die Gründe für seine Auffassungen oder die Gründe für seine Ausführungen zu erhärten. Ich möchte, um die Debatte nicht sehr zu verlängern, darauf verweisen, daß uns Zeitschriften wie die ,,Zukunft" oder das ,,Neue Forum" oder auch fallweise die „ArbeiterZeitung" - ich verweise auf die Hausartikelserie – genügend Material liefern. Ich verweise daher, wenn Sie meinen, daß Herr Abg. Reiter so Unrecht gehabt hat, auf die Lektüre des Forumheftes Nr. 141 mit einem Artikel von Dr. Günther Nenning, die Doppelnummer 148/1949 mit einem Beitrag von Dr. Rupert Gmoser ,,Geist statt Tingel-Tangel" oder die letzte Nummer des Forums vom November/Dezember 1966. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf Zitate des Herrn Nationalratspräsidenten Waldbrunner, von Frau Rosa Jochmann, von Dr. Nenning, von Dr. Gmoser, von Norbert Leser, vom steirischen Abg. Pay , vom Herrn Altbürgermeister von Linz, Bundesrat a. D. Dr. Koref, und anderen mehr. Das sind die Grundlagen gewesen, die den Herrn Abg. Reiter zu seinen grundsätzlichen Feststellungen bewogen haben, ohne ein Mitglied der Sozialistischen Fraktion oder die Sozialistische Partei damit persönlich zu beleidigen. Ich will nicht weiter ins Detail gehen, die letzte Stunde - nehme ich an - der Budgetdebatte 1966 für den Voranschlag 1967 würde es nicht rechtfertigen, um ins Detail zu gehen und eine neue Grundsatzdebatte auszulösen. Das wollte ich nicht. Ich glaube aber doch feststellen zu dürfen, daß es absolut im Geiste der Demokratie liegt, im Geiste einer pluralistischen Gesellschaftsauffassung, wenn man grundsätzlich divergente Auffassungen in klare, ich möchte sagen in kristallklare, auch harte Worte kleidet. Harte Grundsatzgedanken gehören zur Debatte mit dazu, ebenso wie eine echte Gesinnung, die wir beim anderen akzeptieren und in der wir uns gegenseitig achten sollten. So glaube ich, daß wir uns - und das wäre mein Wunsch als Sprecher der Volkspartei - für das kommende Jahr eines wünschen sollten, einen sehr fortgeschrittenen Wettbewerb an Ideen, an gegenseitigen Argumenten, um in diesem Wettbewerb die besten Mittel und die besten Wege zu finden, um unserem Land Niederösterreich auch den besten Dienst für die Zukunft zu erweisen. (Beifall bei der ÖVP.) PRÄSIDENT WEISS: Zum Wort gelangt noch Herr Landeshauptmannstellvertreter Dr. T s c h a d e k . Landeshauptmannstellvertreter Doktor TSCHADEK: Hohes Haus! Herr Abg. Stangler hat noch einmal eine Grundsatzdebatte, wenn auch sehr kurz, heraufbeschworen, und ich bitte nicht wieder nervös zu werden, wenn ich dazu auch meine Meinung sage. Herr Abg. Stangler hat erklärt, in der Demokratie gehört auch eine härtere Debatte zur politischen Notwendigkeit. Es können auch härtere Grundsatzdebatten geführt werden, ohne daß wir uns deshalb gegenseitig beleidigen, ohne daß wir deshalb gegenseitig in eine menschliche Differenz gelangen. Ich möchte (doch auf einige Äußerungen ganz kurz antworten. Ich bin der Meinung des Herrn Abg. Stangler, daß es immer gut ist, mit Argumenten Standpunkte zu vertreten und Standpunkte zu verfechten. Es sollen aber Argumente und keine Diffamierungen sein. Und wenn man, verstehen Sie das, einer so traditionsreichen Bewegung vorwirft, daß sie nur mit hohlen Phrasen, mit einem hohlen Programm, mit einer hohlen Ideologie vor die Wähler tritt, dann ist das unserer Meinung nach kein Argument, sondern eher der Versuch einer politischen Diffamierung, Herr Abg. Stangler, ich leugne nicht, daß es bei uns Diskussionen gibt über Form und Taktik der politischen Bewegung. Der demokratische Sozialismus ist kein Ewigkeitsdogma, sondern er muß sich genauso mit den Gegebenheiten der Welt auseinandersetzen, wie jede andere geistige Bewegung sich mit den Gegebenheiten der Welt auseinandersetzen muß. Wenn die römischkatholische Kirche, die auf eine 2000jährige Tradition zurückreicht, es für notwendig hält, ein Konzil abzuhalten, sich zu fragen, ob ihre Einstellung zur Arbeiterbewegung nicht revidiert wenden muß, ob nicht die soziale Einstellung einer Überprüfung unterzogen werden muß, wenn nicht sehr ernste sittliche Fragen angesichts der Entwicklung der Welt einer neuen Überlegung bedürfen, dann ist es bestimmt auch kein Schaden und kein Nachteil, wenn eine politische Bewegung den Mu hat, in aller Offenheit., frei und ehrlich auch darum zu ringen, den besten und richtigsten Standpunkt zur Entwicklung der Gesellschaft zu erzielen. Und deshalb deuten Sie die Diskussionen, meine sehr geehrten Herren, nicht als Schwächezeichen. Wir sind überzeugt, daß aus diesen Diskussionen einmal sehr lebendiger Geist entstehen wird, den Sie, meine Herren, vielleicht noch sehr deutlich und wahrscheinlich schon bei den nächsten Wahlen zu spüren bekommen werden. (Beifall bei der SPÖ.) Sehen Sie, Sie verargen es mir, daß ich so oft über die Notwendigkeiten demokratischer Arbeit, demokratischer Taktik und demokratischer Gesinnung rede. Der Herr Abg. Präsident Reiter hat gemeint, man würde es sich nicht mehr bieten lassen, daß ich hier den Lehrer der Demokratie spiele. Es liegt mir vollkommen fern, einen Lehrer spielen zu wollen, ich bin auch keiner, Herr Präsident Reiter, das Unterrichten muß ich also Ihnen überlassen, aber ich glaube, daß, wenn man in die Entwicklung der Welt hineinblickt und auch die Entwicklung in Österreich sieht, die nicht ganz ungefährlich erscheint, in der antidemokratische Tendenzen nicht immer ganz ungefährlich da sind, sondern sehr unterschwellig auf gewisse Bevölkerungskreise wirken, ich glaube, daß man dann die Pflicht hat, zu sagen.: Wahrt und behütet die Demokratie als Garant der Freiheit, als Garant österreichischer Unabhängigkeit, als Garant menschlicher Würde. Wenn ich das also immer wieder sage, dann, weil ich manchmal den Eindruck habe, daß das Wort aus Goethes Faust noch immer lebendig ist „Den Teufel merkt das Völklein nie, selbst wenn er es beim Kragen hätte". Einmal haben wir den Teufel nicht rechtzeitig gemerkt und wir haben bitter dafür bezahlt. Und deshalb will ich als einer der älteren Politiker, der mehr als 40 Jahre im öffentlichen Leben steht, das meine dazutun, daß der Teufel nicht noch einmal groß wird in Österreich. Das, meine Herren, sind die Beweggründe, die wir an Iden Tag legen und die mich manchmal dazu bringen, sehr offen über diese Fragen zu reden. Lassen Sie mich noch eines grundsätzlich sagen: Ich habe gesagt, es muß nicht eine bloße Koexistenz zwischen demokratischem Sozialismus und christlichem Humanismus geben. Ich kann mir viel nähere Berührungspunkte vorstellen. Wissen Sie warum? Weil ich zutiefst überzeugt bin, daß das Gesellschaftsbild von heute, daß die Welt von heute, in der wir leben, nicht entstanden wäre ohne diese beiden geistigen Strömungen, daß wir aber für uns buchen können, daß die große soziale Tat des Aufstiegs der Arbeiterklasse, daß die entscheidende Emanzipation der Menschen aus wirtschaftlicher Knechtschaft, daß das Herausheben de3 Menschen aus der Masse und !die Entwicklung des Massemenschen zur freien sittlichen Persönlichkeit in erster Linie ein Werk der alten sozialdemokratischen Bewegung ist. (Beifall bei der SPÖ.) Und wir sind stolz darauf. Wir anerkennen auch den Anteil er anderen Seite, denn wir haben keine einseitige Gesellschaftsordnung. Unser Weltbild ist nun einmal im Zusammenwirken entstanden. Und als kein Zusammenwirken, sondern ein Gegeneinanderwirken da war, ist Österreich und seine Freiheit zugrunde gegangen. Das sind meine Überlegungen, und ich glaube, wenn wir uns alle mit dieser Problematik ernsthaft auseinandersetzen, wird die Debatte über diese Fragen nicht vergeblich gewesen sein. Wir leben in der Weihnachtszeit. Demokratie ist eine Form des Zusammenlebens, des Zusammenarbeitens, eine Form friedlicher Politik. Aber der Friede wird nach der Weihnachtsbotschaft nur denen geschenkt, die guten Willens sind. Sind wir alle, meine sehr geehrten Herren, in diesem Hohen Hause guten Willens, dann wenden wir in friedlicher Arbeit unserem niederösterreichischen Heimatlande den besten Dienst erweisen. (Lebhafter Beifall bei der SPÖ.) PRÄSIDENT WEISS: Die Rednerliste ist erschöpft, der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort. Berichterstatter Abg. ANZENBERGER: Ich verzichte. PRÄSIDENT WEISS: Zur Abstimmung liegt vor die Gruppe 9, Finanz- und Vermögensverwaltung, und hiezu der Resolutionsantrag der Abgeordneten Weiss, Sigmund, Stangler, Schneider Karl, Brunner, Wüger, Keiblinger, Kienberger, Reischer und Anzenberger. Ich lasse zunächst über die Gruppe selbst und zum Schluß über den Resolutionsantrag abstimmen. Ich bitte den Herrn Berichterstatter, nunmehr seinen Antrag zu Gruppe 9, Finanz- und Vermögensverwaltung, ordentlicher und außerordentlicher Voranschlag, zu stellen. Berichterstatter Abg. ANZENBERGER: Hohes Haus! Ich stellte den Antrag, die Gruppe 9, Finanz- und Vermögensverwaltung, welche im ordentlichen Voranschlag Einnahmen von 1.909,684.000 Schilling und Ausgaben von 389,388.000 Schilling und im außerordentlichen Voranschlag Einnahmen von 3,172.000 Schilling aufweist, zu genehmigen. Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Abstimmung einzuleiten. PRÄISIDEINT WEISS (nach Abstimmung über Gruppe 9, Finanz- und Vermögensverwaltung, ordentlicher und außerordentlicher Voranschlag, in Erfordernis und Bedeckung): A n g e n o m m e n . (Nach Abstimmung über den Resolutionsantrag der Abgeordneten Weiss, Sigmund und Genossen, betreffend Befreiung von der Beitragsleistung nach dem Wasserbautenförderungsgesetz bzw. Berücksichtigung bei Verteilung der Bundesmittel für Errichtung von Hochwasserschutzbauten): Angenommen. Ich ersuche den Herrn Abg. A n z e n b e r g e r, die Verhandlungen zum Gesetzentwurf über die Einhebung einer Landesumlage für das Jahr 1967 einzuleiten. Berichterstatter Abg. ANZENBERGER: Hohes Haus! Gesetz über die Einhebung einer Landesumlage. Der Landtag von Niederösterreich möge beschließen: § 1. Von den Gemeinden (einschließlich der Städte mit eigenem Statut) im Lande Niederösterreich ist eine Landesumlage in der Höhe von 15 v. H. der ungekürzten Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben zu entrichten. § 2. (1) Der Berechnung der Landesumlage sind die ungekürzten monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben bzw. allfällige Nachzahlungen auf die Ertragsanteile zu Grunde zu legen. (2) Die endgültige Abrechnung der Landesumlage erfolgt anläßlich der endgültigen Abrechnung der Ertragsanteile der Gemeinden auf Grund des Rechnungsabschlusses des Bundes. § 3. Auf die einzelnen Gemeinden (einschließlich der Städte mit eigenem Statut) ist die von ihnen aufzubringende Umlage im Verhältnis ihrer Finanzkraft aufzuteilen. Diese wird erfaßt durch die Heranziehung 1. von 50 v. H. des jeder Gemeinde nach den finanzausgleichsgesetzlichen Bestimmlungen zukommenden Anteiles an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben, 2. der Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben unter Zugrundelegung der Meßbeträge des Vorjahres und eines Hebesatzes von 300 v. H., 3. der Grundsteuer von den Grundstücken unter Zugrundelegung der Messbeträge des Vorjahres und eines Hebesatzes von 300 v. H. und 4. der tatsächlichen Erträge der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital in den Monaten Jänner bis September des Vorjahres und Oktober bis Dezember des zweitvorgegangenen Jahres, jedoch unter der Annahme eines Hebesatzes von 125 v. H. § 4. Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 1967 in Kraft und verliert mit Ablauf des 31. Dezember 1967 seine Wirksamkeit. Ich bitte den Herrn Präsidenten, über das Gesetz zur Einhebung einer Landesumlage die Verhandlungen einzuleiten. PRÄSIDENT WEISS: Zum Wort ist niemand gemeldet, wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag des Finanzausschusses, Punkt 15): A n g e n o m m e n . Ich ersuche den Herrn Berichterstatter Abg. A n z e n b e r g e r, zum Dienstpostenplan 1967 zu berichten. Berichterstatter Abg. ANZENBERGER: Meine sehr geehrten Damen und Herren des Hohen Hauses! Da sich der nachgereichte Dienstpostenplan seit einiger Zeit in Ihren Händen befindet. werde ich mir die Verlesung des Dienstpostenplanes ersparen, vorausgesetzt, daß Sie hiezu die Zustimmung erteilen. (Keine Einwendung.) PRÄSIDENT WEISS: Wir schreiten zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den Dienstpostenplan 1967, Punkt 17, sowie die im allgemeinen Teil des Dienstpostenplanes festgelegten Grundsätze): Angenommen. Ich lasse zunächst über den Antrag des Finanzausschusses, und zwar über die Punkte 1 bis 14 und über die Punkte 16, 17 und 18 unter einem und über den Punkt 15 getrennt abstimmen. Der Antrag des Finanzausschusses liegt im vollen Wortlaut den Mitgliedern des Hauses vor. Ich glaube daher, dem Herrn Berichterstatter die Verlesung dies Antrages ersparen zu können. (Keine Einwendung.) Ich bitte den Herrn Berichterstatter um seinen Antrag. Berichterstatter Abg. ANZENBEBGER: Ich beantrage, den Antrag des Finanzausschusses Punkte 1 bis 14 und die Punkte 16, 17 und 18 sowie getrennt Punkt 15 im Sinne des Antrages des Finanzausschusses anzunehmen. PRÄSIDENT WEISS: Nach Verabschiedung des ordentlichen Voranschlages, des außerordentlichen Voranschlages, des Gesetzentwurfes über die Einhebung einer Landesumlage für das Jahr 1967 und des Dienstpostenplanes 1967 sowie nach Genehmigung der im allgemeinen Teil des Dienstpostenplanes festgelegten Grundsätze gelangen wir nunmehr zur Abstimmung des Voranschlages des Landes Niederösterreich für das Jahr 1967 als Ganzes hinsichtlich Erfordernis und Bedeckung und des Antrages des Finanzausschusses zum Voranschlag, Punkt 1 bis Punkt 14, Punkt 16, 17 und 18 sowie Punkt 15 im Wortlaut des Gesetzes. Ich ersuche die Mitglieder des Hohen Hauses, die Gesamtabstimmung vorzunehmen. (Nach Abstimmung über den Antrag des Finanzausschusses zum Voranschlag 1967, Punkt 1 bis 14, Punkt 16, 17 und Punkt 18): Angenommen. (Nach Abstimmung über den Antrag des Finanzausschusses zum Voranschlag 1967, Punkt 15, im Wortlaut des Gesetzes): Angenommen. Der Voranschlag ist somit verabschiedet. Zum Wort ist noch Herr Landesrat Roman R e s c h gemeldet. Landesrat Roman RESCH: Sehr verehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Mit dem Voranschlag hat der Landtag sicherlich die umfangreichste Vorlage dieses Jahres verabschiedet. Nahezu 80 Redner haben dazu Stellung genommen und die Probleme des Landes in dankenswerter Weise von vielen Seiten beleuchtet. Mehr als 30 Anträge wurden gestellt und darüber hinaus eine Reihe von Anregungen und Wünschen vorgetragen, die sicherlich wert sind, bezüglich der Vollziehung geprüft und insbesondere, da alles Geld kostet, von der Finanzverwaltung auch auf ihre Bedeckungsmöglichkeit untersucht zu werden. In der Debatte haben sich alle Probleme gespiegelt, mit denen sich der Finanzreferent an und für sich nicht nur bei Finanzausgleichsverhandlungen, sondern das ganze Jahr hindurch konfrontiert sieht. Ich darf Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, und allen Mitgliedern des Hohen Hauses dafür danken, daß dieser Voranschlag so sachlich beraten worden ist, und obwohl ich es schon eingangs getan habe, sage ich noch einmal allen Mitarbeitern in der Finanzabteilung, insbesondere dem Herrn vortragenden Hofrat Sawerthal und Herrn Buchhaltungsdirektor Hochstrasser, die ja immer zur Zeit der Budgeterstellung eine Fülle von Arbeit zu vollbringen haben, die weit über die normalen täglichen Arbeitsstunden hinausgeht, meinen aufrichtigen Dank. Ich gebe dem Wunsch Ausdruck, daß das Jahr 1967 ein gutes Jahr sein möge, ein Jahr, in dem eine gute wirtschaftliche Entwicklung zu verzeichnen ist, weil damit letzten Endes eine günstige Entwicklung 'der Landesfinanzen verbunden ist. Möge uns Gott beistehen, daß wir von Hochwasser und sonstigen Naturkatastrophen verschont bleiben, denn wir haben in den letzten Jahren wahrlich genug davon gehabt. Möge es ein Jahr werden, das uns alle in edlem Wettstreit um Mehrleistungen in Niederösterreich findet. (Beifall im ganzen Hause.) PRÄSIDENT WEISS: Hohes Haus! Sehr geschätzte Damen und Herren! Obwohl, wie auch der Herr Landesfinanzreferent wieder ausgeführt hat, das Budgetrecht des Landtages in der Landesverfassung unter dem Titel ,,Mitwirkung an der Vollziehung des Landes" genannt ist, zählt es zu den wesentlichsten Rechten der gesetzgebenden Körperschaft des Landes. Die Problematik dieses Rechtes für ein Land im Rahmen eines Bundesstaates, wurde im Zuge der Verhandlungen über den neuen Finanzausgleich wieder besonders deutlich, da zwar den Ländern theoretisch das Steuerfindungsrecht zusteht, dieses jedoch praktisch kaum zur Anwendung kommen kann, weil der Bund fast lalle Möglichkeiten auf diesem Gebiet ausgeschöpft hat. Eine der wenigen wahrgenommenen Möglichkeiten stellt das niederösterreichische Landesgesetz über den Fernsehschilling dar. Es darf aber doch festgestellt werden, daß der nunmehr zustande gekommene Finanzausgleich gewisse Erleichterungen für die Länder gebracht hat und vor allem wieder eine Planung auf längere Sicht ermöglicht. Ich habe schon im Vorjahr der Meinung Ausdruck verliehen, daß das Budgetrecht des Landtages zweifellos gewährt erscheint, wenn die Regierung die in den Beratungen geäußerten Anregungen und Wünsche des Landtages entsprechend verwertet. Ich glaube, daß die Exekutive sehr viel von diesen Anregungen berücksichtigt hat, wobei ich insbesondere auf die Maßnahmen zur freiwilligen Zusammenlegung von Klein- und Kleinstgemeinden, auf die Reorganisation des Schulwesens, die Vorsorgen für das 9. Schuljahr und den weiteren Ausbau der Landesstraßen hinweisen möchte. Bedauerlicherweise bleibt es mir nach dem neuerlichen Hochwasserkatastrophen dieses Jahres nicht erspart, wieder auf die Bedeutung des Hochwasserschutzes, gerade auch in unserem Heimatlande, hinzuweisen, obwohl auf diesem Gebiete nunmehr auch weitere Vorkehrungen finanzieller Art auf Bundesebene getroffen wurden. Ich habe mir daher erlaubt, in meiner Rede zur Gruppe 9 ausführlich auf dieses Problem einzugehen und die ungerechte Verteilung der Mittel des Bundes auf die einzelnen Länder aufzuzeigen. Gerade den vorbeugenden Maßnahmen muß auf diesem Gebiete entsprechende Bedeutung beigemessen werden, denn diese sichern wertvolles öffentliches und privates Gut und erfordern letzten Endes nur einen Teil jener Mittel, die später für die Behebung von Katastrophenschäden aufgebracht werden müssen. Ich möchte aber nicht versäumen, allen jenen Organisationen und freiwilligen Helfern auch von dieser Stelle im Namen des Landtages aufrichtigen Dank für ihren selbstlosen Einsatz zu sagen, der vor allem den Einheiten des Bundesheeres gelten soll. Ich darf mit Befriedigung feststellen, daß die Beratungen und Verhandlungen über den Voranschlag 1967 im allgemeinen in sehr sachlicher Weise geführt wurden, und ich möchte nur wünschen, daß dieser Arbeitsstil, der auf unseren verewigten Landeshauptmann Hartmann zurückgeht, auch in Zukunft weitgehend beibehalten werden möge. Einige erregtere Auseinandersetzungen über rein politische Fragen sollten uns, trotz naturgemäß bestehender grundsätzlicher Differenzen, nicht dazu bringen, die Gesprächsbasis zwischen den beiden Fraktionen zu verlieren. Die Gliederung des Voranschlages, insbesondere die Übernahme weiterer Positionen aus dem Außerordentlichen in den Ordentlichen Voranschlag, hat weiter dazu beigetragen, die Klarheit und Übersichtlichkeit wesentlich zu verbessern. Die finanzielle Lage des Landes ist geordnet und es besteht die begründete Aussicht, daß der ausgewiesene Abgang in engen Grenzen gehalten werden kann und der Schuldenstand des Landes keine Erhöhung erfährt. Trotz dieser an sich erfreulichen Tatsache wird naturgemäß die Benachteiligung Niederösterreichs auch im kommenden Jahr nicht beseitigt werden können. Sie wird weiterhin die besondere Sorge aller Verantwortlichen unseres Landes bilden. Für die zeitgerechte Einbringung des Voranschlages möchte ich dem Herrn Landesfinanzreferenten und dem Herrn Referatsleiter, mit allen seinen Mitarbeitern, den besten Dank sagen. Meinen Absichten entsprach es nicht, daß die Beratungen über den Voranschlag erst in der Woche unmittelbar vor dem Weihnachtsfest stattfinden und nicht, wie im vergangenen Jahr, schon eine Woche früher. Es ist dies auf die zeitliche Entwicklung im Herbst dieses Jahres und die notwendige gründliche Beratung über den Rechnungshofbericht, betreffend die Landesgesellschaften, zurückzuführen. Es sollte dies aber leine einmalige Ausnahme bleiben, um den Mitgliedern des Landtages und der Beamtenschaft eine solche außergewöhnliche Belastung kurz vor Iden Festtagen zu ersparen. Während der ca. 28 Stunden dauernden Beratungen haben 105 Redner das Wort ergriffen und die schwierigen Probleme des Landes eingehend erörtert. In dieser langen Zeit haben mich der Zweite und Dritte Präsident im Vorsitz wesentlich unterstützt, wofür ich ihnen herzlich danken will; ebenso gebührt dem Herrn Berichterstatter für seine große Mühe besondere Anerkennung. Dafür, daß der Finanzausschuß seine Vorberatungen über den Voranschlag trotz der vorangegangenen außergewöhnlichen Belastungen sachlich und zeitgerecht durchgeführt hat, danke ich dem Ausschuß und seinem Obmann, dem Herrn Abgeordneten Schneider, ganz besonders. (Beifall.) Für die erheblichen Vorbereitungsarbeiten und die schnelle Auswertung des Ergebnisses der Beratungen, die weit über die Sitzungszeit hinaus die Tätigkeit der Beamtenschaft forderten, möchte ich dem Vorstand und allen Mitarbeitern der Landtagskanzlei, des Stenographenbüros und des Presseamtes meinen aufrichtigen Dank sagen. (Beifall im ganzen Hause.) Zum Schluß bleibt mir nur noch übrig, der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Heimatlande die Erfüllung des Voranschlages und der darin enthaltenen Vorhaben ermöglichen möge, zum Wohle unserer braven Bevölkerung. Hohes Haus! Die Beratungen des Landtages von Niederösterreich im Jahre 1966 sind nunmehr beendet. Ein Rückblick auf dieses Jahr muß uns zunächst mit Trauer erfüllen, denn unser Land hat ebenso wie im Vorjahr den Verlust seines Landeshauptmannes zu beklagen. Mit dem plötzlichen und unerwarteten Tod unseres verehrten Landeshauptmannes Dr. h.c. Dipl.-Ing. Hartmann hat Niederösterreich einen seiner schwersten Schicksalsschläge erlitten. Was dieser große Niederösterreicher in den sechzehn Monaten seiner Amtszeit geleistet hat, wird in die Geschichte unseres Landes eingehen, und ich wage zu behaupten, daß er sofort nach seinem Amtsantritt und bis zu seinem Ableben kraft seiner Persönlichkeit in das Geschehen unseres Landes maßgeblich eingegriffen hat und daß es am Beginn seiner Tätigkeit keiner Anlaufzeit bedurfte. Sein Werk wird nunmehr vom neugewählten Landeshauptmann Maurer fortgeführt werden, dem ich im Namen des Landtages dafür danken möchte, daß er sich eindeutig zu den Grundsätzen der Politik Hartmanns, nämlich der Politik der Sachlichkeit, der Anständigkeit sowie der Sauberkeit und Ordnung im öffentlichem Leben, bekannt hat. (Beifall im ganzen Hause.) Dies beinhaltet die kompromißlose und endgültige Bereinigung aller Affären, die diesen Grundsätzen widersprechen. Wir wollen aber unseren BIick vor allem in die Zukunft richten und uns für das Jahr 1967 auf die grundlegenden Probleme Niederösterreichs konzentrieren. Ich freue mich daher, daß die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und Forschung, besonders hinsichtlich der Raum- und Regionalplanung, in den vorangegangenen Debatten wiederholt gefordert wurde und darf darauf hinweisen, daß ich auf die Bedeutung einer gesetzlichen Regelung der Raumplanung bereits in meiner Rede anläßlich der Eröffnung der 11. Session dieser Gesetzgebungsperiode am 30. September 1965 eingegangen bin. Die Katastrophen, welche auch in diesem Jahr wieder viel Leid über unser Land gebracht und erhebliche Schäden angerichtet haben, haben aber auch eindeutig bewiesen, daß gerade in Notzeiten die Hilfsbereitschaft und das gegenseitige Verständnis unter den Menschen am größten ist. Diese menschlichen Kontakte über alle Verschiedenheit der Anschauungen hinweg zu pflegen, auch wenn uns nicht die äußere Not dazu zwingt, ist mein Wunsch in dieser Zeit friedlicher Besinnung. So darf ich Ihnen allen, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, der Landesregierung, mit Herrn Landeshauptmann Maurer an der Spitze, sowie allen Bediensteten des Landes und ihren Angehörigen laufrichtigen Herzens ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 1967 wünschen. Mein Weihnachtsgruß gilt darüber hinaus der gesamten Bevölkerung unseres Heimatlandes Niederösterreich. (Beifall im ganzen Haus.) Abg. JIROVETZ: Sehr geehrter Herr Präsident! Als Senior des Hauses mache ich mich zum Sprecher meiner Kollegin und meiner Kollegen und möchte Ihnen für Ihre lieben Weihnachtswünsche herzlich danken. Ich erwidere sie und kann dazu nur sagen: Wir werden, um des Friedens teilhaftig zu werden, unter der Devise „Nur ruhig weiterstreiten“ friedlich und guten Willens sein. Ich möchte aber nicht verabsäumen, einigen Kollegen eine kleine Warnung mitzugeben. Wir sollten nicht vergessen, während der Weihnachtsfeiertage auf unsere Linie zu achten, damit wir im nächsten Jahr wieder gesund und froh unserer Tätigkeit nachgehen können. (Beifall im ganzen Hause.) Zum Schluß allen Mitgliedern des Hohen Hauses und Ihnen, Herr Präsident, einen guten Rutsch ins Jahr 1967. (Beifall im ganzen Hause.) PRÄSIDENT WEISS: Herzlichen Dank für die Glückwünsche und für den guten Rat. Die Sitzung ist geschlossen. (Schluß der Sitzung um 17 Uhr 22 Minuten.)