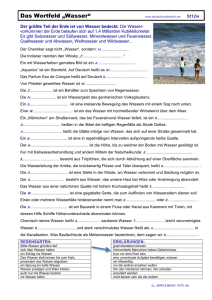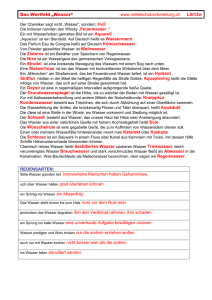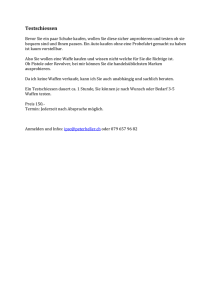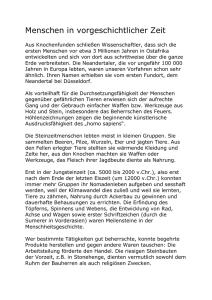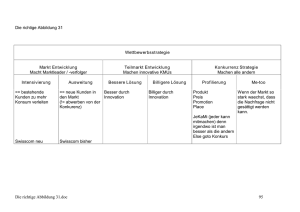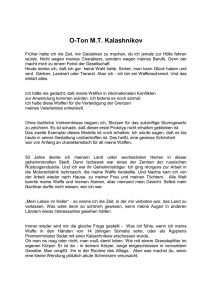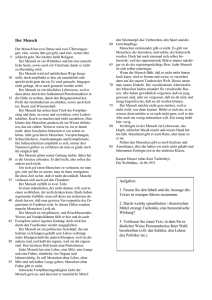Auf dem Weg zu einer Weltgewaltordnung - Lise-Meitner
Werbung
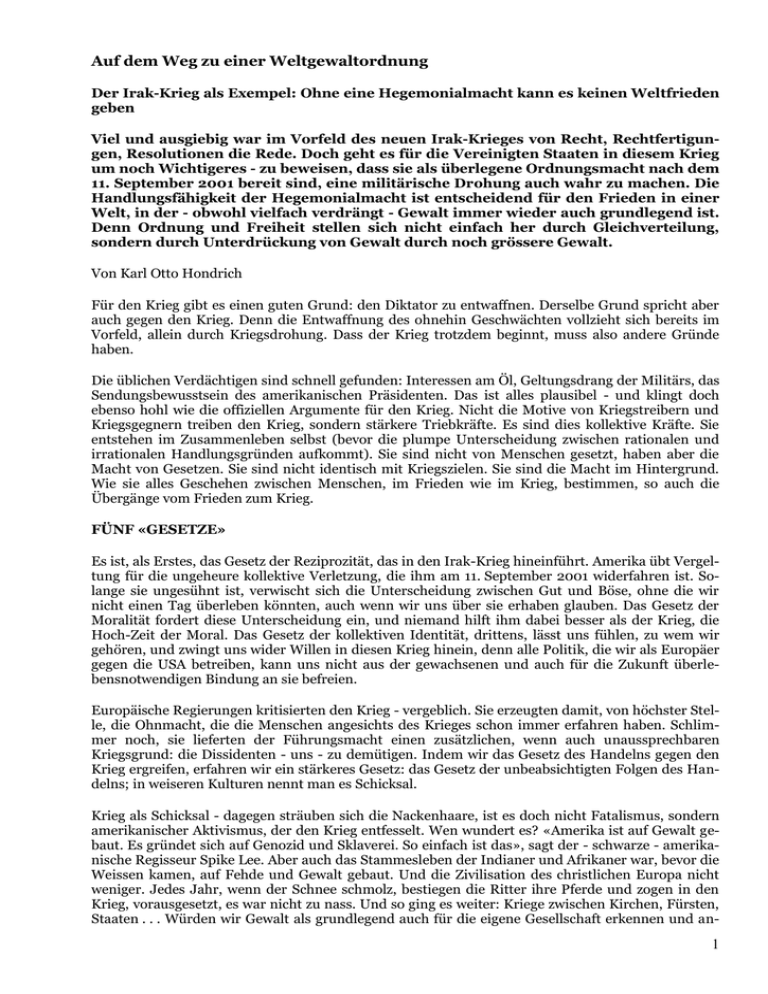
Auf dem Weg zu einer Weltgewaltordnung Der Irak-Krieg als Exempel: Ohne eine Hegemonialmacht kann es keinen Weltfrieden geben Viel und ausgiebig war im Vorfeld des neuen Irak-Krieges von Recht, Rechtfertigungen, Resolutionen die Rede. Doch geht es für die Vereinigten Staaten in diesem Krieg um noch Wichtigeres - zu beweisen, dass sie als überlegene Ordnungsmacht nach dem 11. September 2001 bereit sind, eine militärische Drohung auch wahr zu machen. Die Handlungsfähigkeit der Hegemonialmacht ist entscheidend für den Frieden in einer Welt, in der - obwohl vielfach verdrängt - Gewalt immer wieder auch grundlegend ist. Denn Ordnung und Freiheit stellen sich nicht einfach her durch Gleichverteilung, sondern durch Unterdrückung von Gewalt durch noch grössere Gewalt. Von Karl Otto Hondrich Für den Krieg gibt es einen guten Grund: den Diktator zu entwaffnen. Derselbe Grund spricht aber auch gegen den Krieg. Denn die Entwaffnung des ohnehin Geschwächten vollzieht sich bereits im Vorfeld, allein durch Kriegsdrohung. Dass der Krieg trotzdem beginnt, muss also andere Gründe haben. Die üblichen Verdächtigen sind schnell gefunden: Interessen am Öl, Geltungsdrang der Militärs, das Sendungsbewusstsein des amerikanischen Präsidenten. Das ist alles plausibel - und klingt doch ebenso hohl wie die offiziellen Argumente für den Krieg. Nicht die Motive von Kriegstreibern und Kriegsgegnern treiben den Krieg, sondern stärkere Triebkräfte. Es sind dies kollektive Kräfte. Sie entstehen im Zusammenleben selbst (bevor die plumpe Unterscheidung zwischen rationalen und irrationalen Handlungsgründen aufkommt). Sie sind nicht von Menschen gesetzt, haben aber die Macht von Gesetzen. Sie sind nicht identisch mit Kriegszielen. Sie sind die Macht im Hintergrund. Wie sie alles Geschehen zwischen Menschen, im Frieden wie im Krieg, bestimmen, so auch die Übergänge vom Frieden zum Krieg. FÜNF «GESETZE» Es ist, als Erstes, das Gesetz der Reziprozität, das in den Irak-Krieg hineinführt. Amerika übt Vergeltung für die ungeheure kollektive Verletzung, die ihm am 11. September 2001 widerfahren ist. Solange sie ungesühnt ist, verwischt sich die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, ohne die wir nicht einen Tag überleben könnten, auch wenn wir uns über sie erhaben glauben. Das Gesetz der Moralität fordert diese Unterscheidung ein, und niemand hilft ihm dabei besser als der Krieg, die Hoch-Zeit der Moral. Das Gesetz der kollektiven Identität, drittens, lässt uns fühlen, zu wem wir gehören, und zwingt uns wider Willen in diesen Krieg hinein, denn alle Politik, die wir als Europäer gegen die USA betreiben, kann uns nicht aus der gewachsenen und auch für die Zukunft überlebensnotwendigen Bindung an sie befreien. Europäische Regierungen kritisierten den Krieg - vergeblich. Sie erzeugten damit, von höchster Stelle, die Ohnmacht, die die Menschen angesichts des Krieges schon immer erfahren haben. Schlimmer noch, sie lieferten der Führungsmacht einen zusätzlichen, wenn auch unaussprechbaren Kriegsgrund: die Dissidenten - uns - zu demütigen. Indem wir das Gesetz des Handelns gegen den Krieg ergreifen, erfahren wir ein stärkeres Gesetz: das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen des Handelns; in weiseren Kulturen nennt man es Schicksal. Krieg als Schicksal - dagegen sträuben sich die Nackenhaare, ist es doch nicht Fatalismus, sondern amerikanischer Aktivismus, der den Krieg entfesselt. Wen wundert es? «Amerika ist auf Gewalt gebaut. Es gründet sich auf Genozid und Sklaverei. So einfach ist das», sagt der - schwarze - amerikanische Regisseur Spike Lee. Aber auch das Stammesleben der Indianer und Afrikaner war, bevor die Weissen kamen, auf Fehde und Gewalt gebaut. Und die Zivilisation des christlichen Europa nicht weniger. Jedes Jahr, wenn der Schnee schmolz, bestiegen die Ritter ihre Pferde und zogen in den Krieg, vorausgesetzt, es war nicht zu nass. Und so ging es weiter: Kriege zwischen Kirchen, Fürsten, Staaten . . . Würden wir Gewalt als grundlegend auch für die eigene Gesellschaft erkennen und an- 1 erkennen, könnten wir sie nicht mehr nur bekämpfen und müssten an uns selbst irre werden. Deshalb wird die eigene Gewalt tabuisiert. Das Tabu oder Gesetz des Nicht-wissen-Dürfens ist der fünfte Grund zum Kriege. Die Erklärung von Krieg und Gewalt durch Gesetze, die selbst nicht von Menschen gemacht sind also Reziprozität, Moralität, Identität, Fatalität, Tabu -, widerstrebt uns als modernen Menschen zutiefst. Wir führen Gewalt auf individuelle Schuld und Schurken zurück. Einzelne Führer oder die von ihnen Verführten für böse oder dumm, für zu stark oder zu schwach zu halten - das ist auch heute noch die geläufigste Kriegserklärung. Sie übersieht dabei allerdings etwas Entscheidendes: Gewalt ist keine Eigenschaft von Einzelnen, sondern entsteht als Wechselwirkung zwischen Menschen. Sie wird nicht nur durch niedrige Neigungen, sondern auch durch hohe Werte hervorgerufen. Als Versuch, eigene Werte (und Interessen) auch um den Preis durchzusetzen, andere und sich selbst zu verletzen, gibt es Gewalt, solange Menschen verletzlich sind und solange Werte im Widerstreit sich behaupten wollen. Gesellschaft ohne Gewalt ist demnach möglich - unter drei Bedingungen, von denen nur eine erfüllt sein muss: Menschen müssen unverletzlich sein; oder ihre Lebensform muss ihnen nicht durchsetzungswert, also im Vergleich zu andern nichts wert sein; oder sie braucht sich nicht durchzusetzen, weil Harmonie der Werte herrscht. So einfach ist das. Aber: Die drei Bedingungen gewaltfreier Gesellschaft - sie rücken ferner, je mehr die Entwicklung sich dem nähert, was als «höhere» Kultur bezeichnet wird. Fieberhaft arbeiten wir, mit allen Mitteln der Medizin, Chemie, Biologie an dem Drachenblut, das uns, wie Siegfried in der Sage, unverletzlich, wenn nicht unsterblich machen soll. Die USA nähren sogar den Traum, mit Hilfe der Raumfahrtwissenschaft ihren ganzen Kontinent gegen fremde Waffen unversehrbar zu machen. Aber während dieses gigantische Unternehmen anläuft, wird die Weltmacht zum ersten Mal durch die Erfahrung erschüttert, auf eigenem Boden kollektiv verletzbar zu sein. Und während der Irak-Krieg (auch) geführt wird, um die Weiterverbreitung von Vernichtungswaffen zu stoppen, rasseln kleinere Mächte wie Nordkorea mit eben diesen Waffen. Nicht nur die unerhört gesteigerte Vernichtungskraft und Reichweite der Waffen steigert die Verletzbarkeit des modernen Menschen, sondern paradoxerweise auch die gesteigerte Moral, mit der er sich schützen will. Ausfluss dieser Moral ist etwa das Gebot der Gewaltlosigkeit. Solange dieses aber nicht überall gleichermaßen gilt, macht es diejenigen verwundbarer, die ihm folgen. Und je stärker es verinnerlicht wird und unter dem Schutzschild staatlicher Gewaltmonopole auch äußerlich herrscht, desto mehr steigern sich die Ansprüche an Gewaltlosigkeit; gemessen daran erscheinen schon kleine Verletzungen, gestern noch «normal», heute als Gewalt. Gewalt wird immer empörender - und damit unterschwellig immer wertvoller. Verletzlichkeit ohne Ende. Geht wenigstens das Eifern zu Ende, mit dem Lebensformen sich durchsetzen wollen? Die westlichen Gesellschaften sehen sich ja auf dem Wege in die Toleranz. Aber prüfen wir selbst: Wenn Gleichberechtigung der Geschlechter, Freiheit der Religion und der Rede, demokratische Kontrolle der Macht ernstlich angegriffen würden - würden wir uns nicht mit aller Gewalt zur Wehr setzen? Nur weil wir uns der eigenen Lebensform so sicher sind (und damit rechnen, dass sie sich wie von selbst durchsetzt, also in Beziehung zu andern dominant ist), können wir vergessen, dass sie auf gewaltsamer Durchsetzung beruht und des Gewaltschutzes bedarf, kurz, eine Gewaltordnung ist. Weit entfernt davon, darauf verzichten zu können, macht die westliche Kultur Durchsetzung zu einem Wert eigener Art: Selbstbestimmung, Selbstbehauptung, Selbstentfaltung diese modernen Wertformeln enthalten mehr Keime der Gewalt als das lakonische «Allahs Wille geschehe». Bleibt die letzte Hoffnung: dass Gewalt sich erübrige, weil der Widerstreit der Werte sich in einer universalen Weltmoral aufhebe. Dass diese den Ehrenkodex der Paschtunen, die kollektiven Tauschverpflichtungen der Trobriander und die im Koran festgelegten Verpflichtungen für den frommen Muslim uns auferlegen könnte, halten wir natürlich für ausgeschlossen. Vielmehr sollen die andern in die uns vertraute christlich-aufklärerische Moral eingeschlossen werden. Sechs Milliarden Menschen über den gleichen moralischen Leisten zu schlagen - das wird die Konflikte der Kulturen und Interessen nicht abmildern, sondern anheizen. 2 Die Einsicht ist bitter. Aber es führt kein Weg an ihr vorbei: Je höher und schneller sich Gesellschaft entwickelt und je weiter sie sich als Weltgesellschaft dehnt, desto verletzlicher werden die Menschen und ihre Kulturen, desto durchsetzungseifriger, desto konfliktreicher, kurz: desto gewaltträchtiger. Die Gewalt wächst in der Latenz, geborgen und verborgen. Ausbrechen kann sie überall und jederzeit. Wie ist sie in Schach zu halten? Durch Verträge zwischen Gleichen und Gleichberechtigten, lautet die prompte Antwort. In ihr drückt sich eine tiefe und weithin geteilte moralische Intuition aus: Die Ordnung sei am besten, die sich durch Freiheit und Gleichheit, als Gleichgewicht und Gleichverteilung einstelle. Die Vorstellung trügt. «Als alle Menschen gleich und frei waren, war niemand vor dem anderen sicher», schreibt Wolfgang Sofsky in einem «Traktat über die Gewalt» . . . Das «Gleichgewicht der Kräfte» zwischen Stämmen, Fürsten und Staaten: Immer brach es zusammen - zuletzt im Kalten Krieg - oder lud zu gewaltsamen Machtproben ein. Daraus erst ging die Bändigung von Gewalt hervor. Nicht durch Recht, sondern durch Gewalt selbst, nicht durch Gleichverteilung, sondern im Gegenteil durch äußerste Ungleichverteilung und Konzentration der Gewalt beim Staat entstand die Gewaltfreiheit, die wir heute als zivile Gesellschaft genießen. Gewalt verletzt und stört nicht nur, sie schützt und ordnet auch - allerdings nur als überlegene, als hegemoniale Gewalt . . . Mit der Bildung nationaler Gewaltmonopole ist der Prozess nicht zu Ende. In größerem Rahmen geht er weiter. In der Weltgesellschaft treffen viele und ungleiche Staatsgewalten aufeinander, dazu frei herumvagabundierende und marodierende Gewalten. Immer mehr Staaten, Banden, Terrorgruppen verschaffen sich die modernsten Waffen, um bei der Ordnung der Gewalt mitzumischen - und vergrößern die Unordnung der Gewalt. Dies schreit nach einer Weltgewaltordnung. DIE DROHUNG WAHR MACHEN Wie soll sie aussehen? Lauter gleichberechtigte Staaten, wie es das Credo der Uno will? Die Staaten fordern auch das gleiche Recht auf Waffen. Zur Sicherheit trägt das nicht bei. Ordnung heißt, machen wir uns nichts vor, nicht Gleichverteilung, sondern Unterdrückung von Gewalt durch noch größere Gewalt. Die größere Unterdrückung gewährt mehr Sicherheit als die kleinere. Kann eine solche Ordnung ohne Hegemon auskommen, der die Einzelgewalten entmachtet und im gleichen Zuge sich selbst als Übergewalt herausbildet? Und ist diese Umverteilung von Gewalt ohne gewaltsame Vormachtkämpfe, allein durch freie Vereinbarung, denkbar? Diese Fragen werfen ein ungewohntes Licht auf den Krieg. Ginge es in ihm nur um den Irak, genügte die Kriegsdrohung. Aber nur der Krieg selbst zeigt, was die Drohung allein nicht zeigen kann: dass die USA sie wahr machen. Den Anspruch, Ordnungsmacht zu sein, können viele erheben - aber nur der Krieg macht die Probe aufs Exempel. Er ist ein Beispiel, eine Stichprobe und ein Glied in einer Kette. Keine Ordnungsgewalt ist gewaltig genug, um alle Gewalt gleicher- und gerechtermaßen zu unterdrücken. Jede Ordnung kann nur Exempel statuieren und enthält, in deren Auswahl, ein Element des Eigeninteresses und der Willkür. Jede Ordnung beruht auf Stichproben. Aber auf diese ist sie angewiesen. Wir wüssten sonst nicht, dass es sie gibt - eine Ungewissheit, die einer Aufforderung zu weiterer Gewalt gleichkäme. Jeder Krieg ist mehr als nur dieser Krieg. Auch der Irak-Krieg ist nicht nur Irak-Krieg, vielleicht nicht einmal in erster Linie dies. Er hat andere Kriege neben sich und in sich, hinter sich und vor sich. Er kann weitere Kriege hervorrufen, aber er kann ihnen auch zuvorkommen. Ob es ein Krieg war, der andernorts Kriegen vorbeugt, wird sich auch später nie genau sagen lassen, denn er wird nicht der letzte in der Kette gewesen sein. Ob er der Weltgewaltordnung dient, lässt sich nur erahnen. Aber ohne sie ist er nicht zu verstehen. Die mögliche Bedeutung des Krieges für eine Weltgewaltordnung - wird sie in Deutschland verstanden? Hier verweist man empört auf die Dinge, um die es in diesem Krieg, genauso wie in den meisten andern, gar nicht geht: auf Recht, Rechtfertigungen, Resolutionen. Und auf unvorhersehbare Folgen. Sie sind unvermeidlich. Aber auch die Kriegsvermeidung hat unvermeidlich Folgen, die nicht vorhergesehen und nicht beabsichtigt sind. Dass sie schleichend daherkommen, macht sie nicht besser. 3 «Krieg ist sinnlos. Der Krieg löst keine Probleme.» Die USA und die Länder, die den Krieg gegen die Hitler-Diktatur geführt haben, sehen das anders. Und nicht nur sie. «Ich erinnere mich noch brennend an Leid und Elend des Krieges. Ich erinnere mich aber auch an meine Verzweiflung und meine Wut, weil die Welt über die Tragödie hinwegsah, die mein Volk zu vernichten drohte. Wir flehten eine fremde Macht an, uns von der Unterdrückung zu befreien - wenn nötig mit Gewalt», schreibt José Ramos-Horta, Außenminister von Osttimor. 1996 im Exil erhielt er den Friedensnobelpreis. So verwerflich, unrechtmäßig, unnötig der Krieg aus europäischer Sicht sein mag - mit einem Schlag widerlegt er eine Reihe von Theorien, die zur Gewaltunsicherheit und Gewaltunordnung in der Welt beitragen: dass der «dekadente» Westen seine Interessen und Werte nicht verteidige (wie die Apostel der Überlegenheit «östlicher» Werte behaupten); dass Demokratien nicht bereit seien zu kämpfen (die Theorie aller Diktatoren); dass niemand die Herde der Gewalt in der Welt austrete und sich, in Kooperation und Konflikt mit einer schwachen Uno, für eine Weltgewaltordnung stark mache. ORDNUNGSMACHT AMERIKA Doch, da ist jemand. Die Vereinigten Staaten sind, nach dem Untergang des Sowjetimperiums und vor dem Aufgang Chinas und Indiens, die einzige Gewaltmacht auf der Welt, die sich dieser Aufgabe wirklich stellt. Niemand macht sie ihr streitig. Aber jedermann glaubt sie schelten und schmähen zu können: Die USA maßten sich die Macht an - aber niemand sonst hat ein ähnliches Maß an Macht; sie riefen Gegenmacht hervor - ja, das tut jede Macht; sie hätten zu viel Macht - ja, mehr als jeder andere Staat hat, aber zu wenig, um in der Welt wirklich Ordnung zu halten; sie hätten zu wenig Macht - ja, gerade deshalb brauchen sie Verbündete. Ein Weltgewaltmonopol haben sie nicht, wohl aber führen sie, in Gestalt der Nato, ein Weltgewaltkartell an. Viele drängen in es hinein. Woher rührt seine Strahl- und Anziehungskraft? Man kann dahinter eine merkwürdige Mischung vermuten: den Eros übermächtiger Gewalt, die Attraktivität westlicher Lebensformen für den Rest der Welt, den Schutz vor offenen oder verdeckten Formen der Fremdherrschaft, den das Weltgewaltkartell verheißt, in erster Linie aber die Ordnungs- und Befreiungsaufgaben, die es tatsächlich erledigt. Sie werden immer ambivalent aufgenommen. Denn als Garant von Ordnung und Unabhängigkeit schafft die Weltordnungsmacht unweigerlich neue Abhängigkeit von sich selbst. Vielerorts ist dies Abhängigkeit von kulturell Fremden - das unterscheidet das Weltgewaltkartell von den Nationalstaaten, die auf einem kulturellen Konsens der Staatsbürger aufruhen. Im Vergleich dazu ist jede Weltordnungsmacht chronisch unterlegitimiert. Indem etwa die Bundesrepublik Deutschland dem Krieg, an dem sie ohnehin nicht hätte teilzunehmen brauchen, ihre Zustimmung versagt, verstärkt sie die Legitimationsprobleme einer Weltgewaltordnung. Darin lag die eigentliche Sünde deutscher Politik. Sie paarte sich mit Schwäche, denn aufhalten konnte sie den Krieg nicht. Er lädt sich auf - zu einer Machtprobe auch zwischen Hegemon und abtrünnigen Vasallen. Diese geraten in eine untergründige Nähe zu Saddam und allen, die sich hegemonial gedemütigt fühlen. Daraus bezieht die Politik der Schwäche eine gewisse Schläue: Durch den Krieg gestraft, wird sie später in der Weltgewaltordnung wieder gebraucht, in einer wenn auch schillernden Mittel- und Mittlerlage als Teilhaber und zugleich Unterworfener des hegemonialen Systems. Nur innerhalb dieses Systems liegen Spielräume deutscher und europäischer Politik. Ändern kann sie es nicht, aus ihm austreten auch nicht. Die Welt ist US-hegemonial verfasst, weil es eine Ordnung ohne Gewalt nicht gibt; weil es eine Gewaltordnung ohne Hegemonie nicht gibt und weil es keinen andern Hegemon gibt, der die Vielfalt, die Widersprüche und die Träume der Welt so sehr in sich vereint wie die Vereinigten Staaten. Wer von ihrer Hegemonie nichts wissen will, der kann die Hoffnung auf Weltfrieden begraben. Prof. Dr. Karl Otto Hondrich lehrt Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Zuletzt erschienen 2002 bei Suhrkamp die Bände «Wieder Krieg» sowie «Enthüllung und Entrüstung. Eine Phänomenologie des politischen Skandals». 22. März 2003, 03:17, Neue Zürcher Zeitung 4