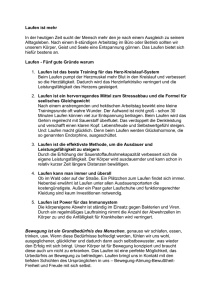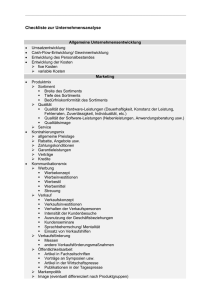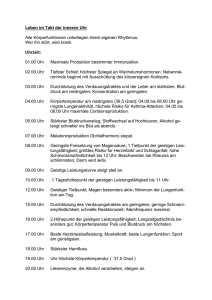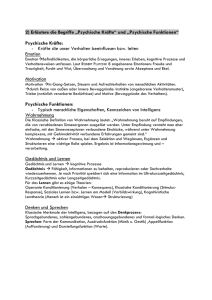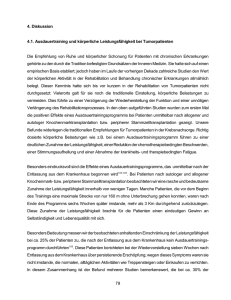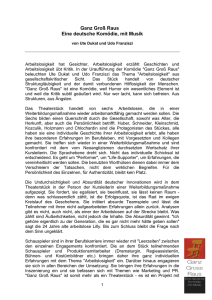2 Arbeitslosigkeit und Gesundheit bei älteren Menschen
Werbung
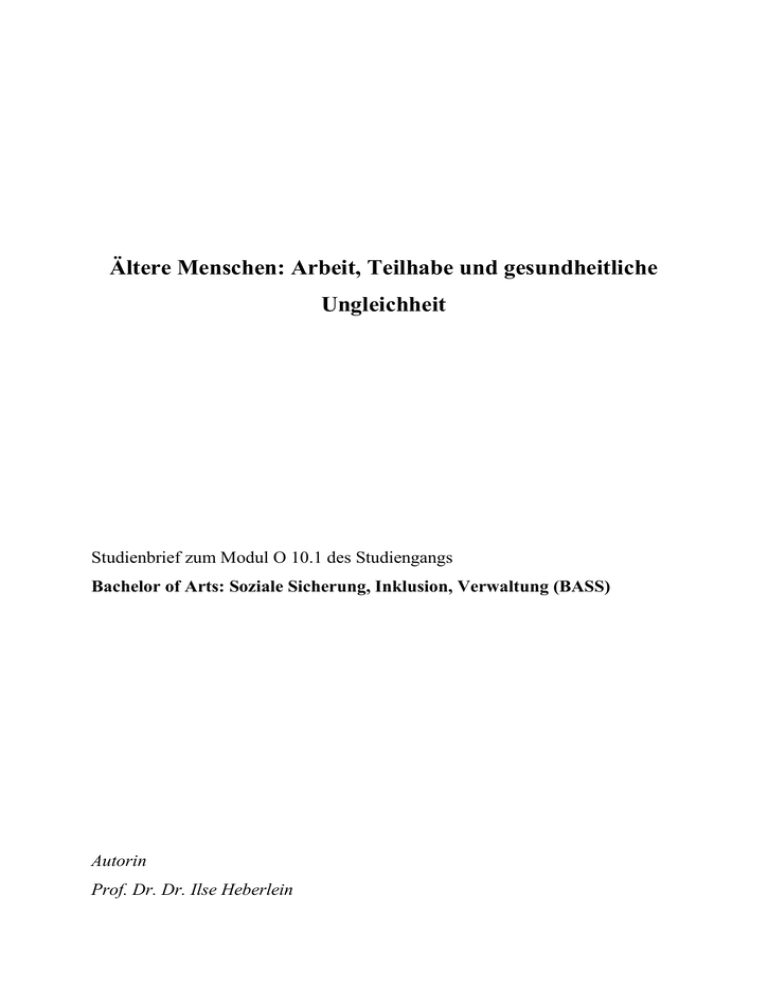
Ältere Menschen: Arbeit, Teilhabe und gesundheitliche Ungleichheit Studienbrief zum Modul O 10.1 des Studiengangs Bachelor of Arts: Soziale Sicherung, Inklusion, Verwaltung (BASS) Autorin Prof. Dr. Dr. Ilse Heberlein Inhaltverzeichnis Inhaltverzeichnis ............................................................................................ 1 1 Arbeit und Gesundheit bei älteren Menschen ........................................ 4 1.1 Teilhabe und soziale Anerkennung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ........................................................................... 4 1.2 Empowermentprozesse im Kontext von Arbeit und Gesundheit ... 6 1.3 Modelle zur Erklärung des Zusammenhangs von Arbeit und Gesundheit................................................................................................ 10 1.3.1 Anforderungs-Kontroll-Modell ............................................ 10 1.3.2 Modell der beruflichen Gratifikationskrisen ........................ 11 1.3.3 Belastungs-Beanspruchungs-Modell .................................... 12 1.4 Arbeitsbelastungen und subjektive Wahrnehmung der Gesundheitsgefährdung ............................................................................ 14 1.5 Körperliche und Umgebungs-Belastungen .................................. 17 1.5.1 Arbeitsunfälle, arbeitsbedingte Erkrankungen und Berufskrankheiten ................................................................................ 19 1.5.2 1.6 Gesundheitsprobleme bei Nacht- und Schichtarbeit ............ 22 Psychosoziale Belastungen .......................................................... 24 1.6.1 Mobbing .............................................................................. 27 1.6.2 Berufsbedingte räumliche Mobilität ..................................... 31 1.7 Gesundheitsprobleme durch psychosoziale Belastungen und Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit ................................................... 33 1.7.1 Burnout ................................................................................. 34 1.7.2 Psychische Störungen und Arbeitsunfähigkeit ..................... 38 1.8 2 Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand .......................... 42 1.8.1 Erwerbstätigkeit 50+ ............................................................ 43 1.8.2 Frühberentung ...................................................................... 46 Arbeitslosigkeit und Gesundheit bei älteren Menschen ....................... 49 2.1 Subjektiver Gesundheitszustand Arbeitsloser .............................. 50 2.2 Gesundheitsverhalten und Risikofaktoren.................................... 51 2.3 Erkrankungen und Mortalität bei Arbeitslosen ............................ 53 2.3.1 Depressive Störungen ........................................................... 56 2.3.2 Posttraumatische Verbitterungsstörung(Posttraumatic Embitterment Disorder, PTED)............................................................ 57 2.3.3 Alkoholmissbrauch, Alkoholabhängigkeit ........................... 58 2.3.4 Mortalität .............................................................................. 62 2.4 Dauer der Arbeitslosigkeit und Gesundheit ................................. 62 2.5 Modelle des Zusammenhangs von Arbeitslosigkeit und Krankheit . ...................................................................................................... 64 2.5.1 Kausalitätshypothese ............................................................ 64 2.5.2 Selektionshypothese, Drifthypothese ................................... 64 2.5.3 Circulus vitiosus von Krankheit und/oder Behinderung und Arbeitslosigkeit .................................................................................... 65 3 Medizinische Klassifikationssysteme................................................... 66 3.2 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) ............................................................................... 67 3.2.1 Konzept der funktionalen Gesundheit .................................. 68 3.2.2 Konzept der Körperfunktionen und -strukturen ................... 68 3.2.3 Konzept der Aktivitäten ....................................................... 69 3.2.4 Konzept der Teilhabe ........................................................... 69 3.2.5 Konzept der Kontextfaktoren ............................................... 69 3.2.6 Das bio-psycho-soziale Modell von Gesundheit und Krankheit .............................................................................................. 70 3.2.7 3.3 Anwendung der ICF ............................................................. 71 Internationale Klassifikation der Prozeduren in der Medizin (ICPM; OPS-301)..................................................................................... 71 4 Sozialmedizinische Begutachtung........................................................ 72 4.1 Grundlagen ärztlicher Begutachtung ............................................ 72 4.2 Beteiligte und Begutachtung ........................................................ 73 4.3 Finale versus kausale Betrachtung bei medizinischen Gutachten 76 2 4.4 Begutachtungsrelevante rechtliche Begriffe ................................ 79 4.4.1 Grad der Schädigung (GdS) und Grad der Behinderung (GdB) .............................................................................................. 79 4.4.2 Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) und Erwerbsminderung (EM)...................................................................... 80 4.5 Sozialmedizinische Begutachtung bei der Bundesagentur für Arbeit ...................................................................................................... 81 5 Sozialmedizinische Leistungsdiagnostik und Beurteilung der Leistungsfähigkeit ........................................................................................ 83 5.1 Leistung im sozialmedizinischen Sinn ......................................... 83 5.2 Grundlagen der sozialmedizinischen Beurteilung der Leistungsfähigkeit .................................................................................... 85 5.3 Diagnostik der erwerbsbezogenen Leistungsfähigkeit ....................... 86 5.3.1 Spezielle Leistungsdiagnostik: arbeitsbezogene Assessments . .............................................................................................. 88 5.3.2 Work Ability Index (WAI) ................................................... 89 5.3.3 Erfassung von arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmustern ................................................................................... 90 5.4 Abschließende Beurteilung des erwerbsbezogenen Leistungsvermögens in der sozialmedizinischen Begutachtung .............. 91 5.4.1 Qualitatives Leistungsvermögen .......................................... 92 5.4.2 Quantitatives Leistungsvermögen ........................................ 92 5.5 6. Leistungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer ...................................... 94 Literaturverzeichnis .............................................................................. 95 Anhang ....................................................................................................... 107 3 1 Arbeit und Gesundheit bei älteren Menschen Erwerbstätigkeit ist ein grundlegendes soziales Bedürfnis. Arbeit „prägt entscheidend die Beziehungen der Menschen untereinander wie auch die Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen. Über ihre gesellschaftliche Anerkennung bilden sich individuelle Identität und Selbstwertgefühl. Arbeit bedeutet ökonomische Sicherheit und die Möglichkeit der Bedürfnisbefriedigung durch finanzielle Mittel, damit auch Teilhabe an kulturellen Aktivitäten und Freizeitaktivitäten. Arbeit bedeutet Strukturierung des Tages und der Woche, Möglichkeiten zu sozialen Kontakten und zur Außenwelt“ (Blättner 2011, S. 97). In Abhängigkeit verschiedener Faktoren wie Zeitumfang, Leistungsanforderungen, Handlungsspielräume, Kontrollmöglichkeiten, Betriebsklima, Arbeitsplatzgestaltung etc. können Arbeitsbedingungen einen positiven oder negativen Einfluss auf die Gesundheit von Beschäftigten haben. In Anbetracht der demografischen Entwicklung und der Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre ist es von hoher Relevanz, gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Potenziale älterer erwerbstätiger Menschen zu erhalten und auszubauen. Vor diesem Hintergrund erhielt die Sachverständigenkommission für den 5. Altenbericht von der Bundesregierung den Auftrag, Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft aufzuzeigen und politikrelevante Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten (BMFSFJ 2006). Auf individueller Ebene geht es darum, auch älteren Menschen die Verwirklichung persönlicher Ziel- und Wertvorstellungen im Zusammenhang mit Erwerbstätigkeit zu ermöglichen und Altersdiskriminierung zu vermeiden. Auf gesellschaftlicher Ebene stellt sich die Frage, inwieweit ältere Menschen in der Lage sind, einen Beitrag zum Wohl der Solidargemeinschaft zu leisten. 1.1 Teilhabe und soziale Anerkennung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels Die Berufsrolle stellt im frühen und mittleren Erwachsenenalter eine zentrale soziale Rolle dar. Für viele Menschen dieser Altersgruppe ist Erwerbsarbeit die wichtigste Quelle zur Sicherung des eigenen Lebensunterhalts. Gleichzeitig ist sie eine wichtige Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Durch ihre Arbeit sind Erwerbstätige in von Familie und Freunden unabhängige soziale Beziehungsnetzwerke eingebunden. Unter guten Bedingungen 4 wird Erwerbstätigkeit als sinnstiftend erlebt und geht mit sozialem Ansehen einher. Die Chance, einen angestrebten beruflichen Status zu erreichen, diesen solange wie gewünscht zu erhalten und gegen Konkurrenz zu verteidigen, wird als Statuskontrolle bezeichnet. Eine hohe Statuskontrolle ist mit einer gesundheitsfördernden Wirkung verbunden, während sich eine bedrohte oder niedrige Statuskontrolle negativ auf die Gesundheit auswirkt (Siegrist 2005). In Anbetracht des demografischen Wandels gewinnt die Nutzung des Erwerbspersonenpotentials Älterer an Bedeutung und gleichzeitig wird es mit zunehmendem Lebensalter häufig schwieriger in einer verlängerten Er- werbsphase eine hohe Statuskontrolle aufrecht zu erhalten. Gute Voraussetzungen für eine hohe Statuskontrolle sind z. B. Bildung, Qualifikation, Selbstwirksamkeit sowie ein positives Selbstwertgefühl. Demografischer Wandel: Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2050: kontinuierliche Alterung der Bevölkerung Zunahme der Zahl älterer Menschen mit überproportionaler Zunahme der Hochaltrigen (80 Jahre und älter) Abnahme der Gesamtbevölkerung mit prozentual stärkerer Abnahme der Bevölkerung im Erwerbsalter (BMFSFJ 2006) Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung haben sich die EU-Staaten im Rahmen der sog. Lissabon-Strategie im Jahr 2000 darauf geeinigt, die Erwerbsquoten älterer Arbeitnehmer zu erhöhen. Mit der letzten Rentenreform wurde in Deutschland außerdem das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre angehoben. Die Umstellung erfolgt ab 2012 in Stufen und soll 2029 abgeschlossen sein. Obwohl die Erwerbstätigenquote älterer Menschen in den vergangenen Jahren angestiegen ist, liegt die Rate der 55 bis 64-Jährigen, die nicht mehr an einer Erwerbsarbeit teilhaben mit über 40% immer noch hoch. 5 Abb. Entwicklung der Erwerbstätigenquoten (Quelle: statistisches Bundesamt 2011) Frauen im Alter von 55 bis 64 Jahren sind mit 49% immer noch seltener erwerbstätig als Männer mit 64% (Statistisches Bundesamt 2011). Diese Zahlen machen deutlich, dass weitere Anstrengungen notwendig sind, um die Ressourcen älterer, insbesondere weiblicher Arbeitnehmer zu stärken und ihnen einen längeren Verbleib in Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Im Folgenden sollen zunächst die allgemeinen Zusammenhänge von Arbeit und Empowerment sowie von Arbeit und Gesundheit näher betrachtet werden. A1 1.2 Empowermentprozesse im Kontext von Arbeit und Ge- sundheit Das Konzept des Empowerment stammt aus der amerikanischen Gemeindepsychologie. Es bezeichnet Strategien und Maßnahmen, die es Individuen oder Gruppen ermöglichen, „ihre soziale Lebenswelt sowie ihr Leben selbst zu gestalten und sich nicht gestalten zu lassen“ (Gutzwiller und Paccaud 2007). Empowerment bedeutet Stärkung der Eigenverantwortlichkeit, Entwicklung oder Verbesserung eigener Fähigkeiten sowie Gestaltung und Kontrolle der eigenen sozialen Lebenswelt, also auch der Erwerbstätigkeit. 6 Nach Siegrist (2005) ermöglicht das soziale Handeln im Medium zentraler Rollen wie der des Erwerbstätigen neben einer sozialen Nutzenproduktion immer auch eine personale Nutzenproduktion. Die personale Nutzenproduktion beinhaltet die Befriedigung basaler Bedürfnisse des physischen und psychischen Wohlbefindens und der sozialen Wertschätzung und ist bei gutem Gelingen mit positiven Selbsterfahrungen verbunden. Abb. Positive Selbsterfahrungen im Kontext von Erwerbstätigkeit Positive Selbsterfahrungen Selbstwirksamkeitsgefühl: Erfahrung von Autonomie und Erfolg eigenen Handelns Selbstwertgefühl: Erfahrung von Anerkennung der eigenen Person und Leistung Zugehörigkeitsgefühl: Erfahrung des Eingebundenseins in eine Gemeinschaft Eine Erwerbsarbeit, die positive Selbsterfahrungen ermöglicht, kann somit zur Förderung der physischen und psychischen Gesundheit beitragen. Zu den Merkmalen einer Erwerbstätigkeit, die mit positiver Selbsterfahrung, Empowerment und Ressourcenstärkung verbunden sind, gehören z. B.: angemessene Bezahlung Sicherheit des Arbeitsverhältnisses angemessene Arbeitsanforderungen (weder Über- noch Unterforderung) Anerkennung der Arbeitsleistung ausreichende Beteiligung an der Gestaltung von Arbeitsprozessen gutes Betriebsklima gute Weiterbildungsmöglichkeiten Im Jahr 2004 wurden Beschäftigte im Auftrag der Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) nach ihren Vorstellungen von „guter Arbeit“ befragt. Für die meisten war ein gesichertes Arbeitsverhältnis mit einem festen, verlässlichen Einkommen das wichtigste Merkmal. Außerdem sollte die Arbeit 7 Spaß machen und die Beschäftigten wollten von ihren Vorgesetzten „als Mensch“ behandelt werden (Fuchs 2006). Tab. Anforderungen an „Gute Arbeit“ aus der Sicht von Arbeitnehmer_innen: die 10 wichtigsten Punkte (Fuchs 2006) 1 Festes, verlässliches Einkommen 92% 2 Sicherheit des Arbeitsplatzes 88% 3 Arbeit soll Spaß machen 85% 4 Behandlung „als Mensch“ durch Vorgesetzten 84% 5 Unbefristetes Arbeitsverhältnis 83% 6 Förderung der Kollegialität 76% 7 Gesundheitsschutz bei Arbeitsplatzgestaltung 74% 8 Arbeit soll als sinnvoll empfunden werden 73% 9 Auf Arbeit stolz sein können 73% 10 Vielseitige/abwechslungsreiche Arbeit 72% Erwartungsgemäß sind Empowermentprozesse und positive Selbsterfahrungen in Berufen mit einer hohen Qualifikation häufiger. Eine 2006 gemeinsam vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) durchgeführte Erwerbstätigenbefragung zeigt, dass höher Qualifizierte über mehr Planungskompetenz bezüglich der eigenen Arbeit verfügen und eher von Vorgesetzten unterstützt werden. Außerdem haben Erwerbstätige mit einer höheren Qualifikation eher das Gefühl, dass ihre Arbeit wichtig ist und dass die Zusammenarbeit mit Kollegen gut ist. 8 Abb. Psychische Arbeitsbedingungen in Abhängigkeit der beruflichen Qualifikation – prozentuale Anteile (Quelle: BiBB-BAuA- Erwerbstätigenbefragung 2006) Eine Erwerbstätigkeit, die sowohl innerbetrieblich als auch gesellschaftlich mit Anerkennung verbunden ist, wird als sinnstiftend erlebt und wirkt sich positiv auf das subjektive Wohlbefinden aus. Dies wird durch Statistiken zu Arbeitsunfähigkeitsdaten bestätigt. Die niedrigsten Fehlzeiten fanden sich im Jahr 2010 bei pflichtversicherten Frauen aus freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, insbesondere bei Naturwissenschaftlerinnen, Apothekerinnen, Ärztinnen, Wirtschaftsprüferinnen und Steuerberaterinnen sowie Publizistinnen. Bei Männern waren die Fehlzeiten am geringsten bei Hochschullehrern und Dozenten an höheren Fachschulen und Akademien sowie bei Juristen und Naturwissenschaftlern (BKK 2011). Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Erkrankungs- und vorzeitiges Sterberisiko umso niedriger sind, je höher die berufliche Stellung in der Hierarchie einer Organisation ist. So zeigte sich in der Whitehall-Studie, einer Untersuchung britischer Regierungsangestellter, dass das relative Risi9 ko für eine koronare Herzkrankheit innerhalb von zehn Jahren bei hohen Verwaltungsangestellten und leitenden Angestellten deutlich niedriger lag als bei Boten und Reinigungspersonal, selbst dann, wenn bekannte Risikofaktoren wie Alter, Rauchen, Blutdruck etc. kontrolliert wurden (Marmot et al. 1984). Ein entsprechender Zusammenhang zwischen hohem beruflichen Status und koronarem Risiko konnte sowohl für Männer als auch für Frauen nachgewiesen werden (Marmot et al.1997, Wamala et al. 2000). Die beschriebenen Studienergebnisse machen deutlich, dass eine effektive Prävention am Arbeitsplatz nicht nur auf die Vermeidung von Schäden ausgerichtet sein darf, sondern Hand in Hand mit einer gesundheitsförderlichen Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen gehen muss. 1.3 Modelle zur Erklärung des Zusammenhangs von Arbeit und Gesundheit Zur Erklärung, wie Arbeit die Gesundheit beeinflusst, können verschiedene medizinsoziologische Modelle herangezogen werden, insbesondere das Anforderungs-Kontroll-Modell, das Modell der Gratifikationskrisen und das Belastungs-Beanspruchungs-Modell. 1.3.1 Anforderungs-Kontroll-Modell Nach dem Anforderungs-Kontroll-Modell von Karasek und Theorell (1990) führt ein hohes Ausmaß quantitativer Arbeitsbelastungen zu umso höherem Distress (negativem Stress) und damit zu einem erhöhten Krankheitsrisiko, je geringer der Entscheidungsspielraum über die Arbeitsaufgabe und damit die Kontrollmöglichkeiten einer Person sind. Ein geringer Grad der Selbstbestimmung in der Erledigung von Aufgaben und wenig Möglichkeiten, persönliche Kompetenzen zu entwickeln und anzuwenden, lösen unangenehme Gefühle aus und führen zu anhaltenden psychophysischen Spannungszuständen. Ein klassisches Beispiel für solche gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen ist die Fließbandarbeit. Aber auch in statusniedrigen Dienstleistungstätigkeiten (z. B. Reinigungskräfte) ist meist eine Kombination aus hohen Anforderungen und niedriger Kontrollierbarkeit von Arbeitsinhalt und Arbeitsablauf gegeben. Durch eine geringe psychosoziale Unterstützung werden die negativen Auswirkungen solcher Arbeitsbedingungen noch verstärkt. 10 Umgekehrt sind geringere bzw. angemessene quantitative Anforderungen bei hohem Entscheidungsspielraum und guter sozialer Unterstützung mit niedriger Belastung verbunden. Arbeit wird dann zu einer gesundheitlichen Ressource. Kritik wurde vor allem deshalb an diesem Modell geübt, weil weder individuelle Bewältigungsstrategien belastender Arbeitsbedingungen noch andere Rahmenbedingungen der Arbeit wie z. B. Sicherheit des Arbeitsplatzes, Betriebsklima, unangemessene Bezahlung etc. berücksichtigt werden. 1.3.2 Modell der beruflichen Gratifikationskrisen Nach demModell der beruflichen Gratifikationskrisen von Siegrist (1996) wird ein Arbeitsvertrag als gesellschaftliches Tauschverhältnis von Leistung und Belohnung (Gratifikationen) betrachtet. Es werden drei Arten von Gratifikationen unterschieden: 1. finanzielle Belohnungen (Lohn, Gehalt), 2. Wertschätzung und Anerkennung und 3. Belohnung durch Aufstieg und/oder Arbeitsplatzsicherheit. Ein ausgeglichenes Verhältnis von Leistung und Belohnung (Reziprozität) wirkt sich gesundheitsförderlich aus. Ein Ungleichgewicht von hohem Arbeitseinsatz und niedriger Belohnung (Gratifikationskrise) führt zu negativen Gefühlen und körperlicher Anspannung, d. h. zu Stressreaktionen. Siegrist (2005) unterscheidet drei Bedingungen, unter denen zu erwarten ist, dass sich Erwerbstätige einem ungünstigen Verhältnis von Verausgabung und Belohnung aussetzen: Soziale Zwänge, die einen Wechsel in eine günstigere Tätigkeit nicht zulassen wie geringe Mobilität, geringe Qualifizierung („lieber eine schlechte Arbeit als gar keine“) Berufsbiografisch-strategische Erwägungen, z. B. Erwartung einer späteren Honorierung von Vorleistungen (Beförderung) Psychische Disposition: übersteigerte berufliche Verausgabungsneigung Bei anhaltendem Stress durch ein Missverhältnis von Verausgabung und Belohnung können sich daraus sowohl körperliche (z. B. Bluthochdruck, 11 Adipositas) als auch seelische Gesundheitsprobleme (z. B. Burnout, depressive Störungen) entwickeln. 1.3.3 Belastungs-Beanspruchungs-Modell Da die Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen sind, werden zunehmend psychische und psychosomatische Prozesse in die Gefährdungsbeurteilung und den Gesundheitsschutz miteinbezogen. Das Belastungs-Beanspruchungsmodell dient in der Arbeitsmedizin als Grundlage für Messinstrumente psychosozialer Belastungen und deren Bewertung durch die Betroffenen. In Abhängigkeit von den persönlichen und sozialen Dispositionen und Rahmenbedingungen bewirkt eine Belastung eine individuelle Beanspruchung. Diese äußert sich in Reaktionen auf verschiedenen Ebenen: im Denken (positive - negative Assoziationen, Wertungen, Kognitionen), Fühlen (positive - negative Emotionen), vegetativen Nervensystem (Aktivierung - Dämpfung), in der Muskulatur (Anspannung - Entspannung) und/oder im Verhalten einer Person (Nagel et al. 2011). Nach DIN EN 10075-1 „Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung” werden psychische Belastungen definiert als: „die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken” (DGUV 2010). Diese Definition ist etwas irritierend, da der Begriff „Belastung“ im allgemeinen Sprachgebrauch per se negativ konnotiert ist (z. B. „Ich fühle mich durch etwas belastet.“ „Das ist eine Belastung für mich.“) Auch in Studien wird der Begriff häufig nicht als neutrale äußere Einwirkung definiert. Nach dem Belastungs-Beanspruchungsmodell geht jede Erwerbstätigkeit mit psychischen Belastungen einher. Diese können sowohl mit positiven Folgen (Anregungs-, Lern- und Trainingseffekte) als mit negativen Folgen (verringerte Leistungsfähigkeit, psychische Sättigung, Ärger, Ermüdung, Suchtmittelmissbrauch) verbunden sein. Messung der Belastung: Bestimmung von Belastungshöhe und Belastungsdauer 12 Belastungen führen zu individuell unterschiedlichen Beanspruchungen. Beanspruchung = Reaktion des Menschen auf arbeitsbedingte Belastungen Messung der Beanspruchung: Messung von Aktivitätsparametern (z. B. Pulsfrequenz, Atemfrequenz) Erfassung von Veränderungen der Leistung (z. B. Menge, Qualität) Messung des subjektiven Befindens (z. B. Ermüdung) Verschiedene Personen sind bei gleicher Belastung in der Regel nicht gleich beansprucht. Belastungen sind immer zusammengesetzt aus physischen, psychomentalen und psychosozialen Komponenten sowie dem Umweltbereich (Groner 2012). Zwischen Belastung und Beanspruchung besteht kein linearer Zusammenhang, sondern eine U-förmige Beziehung, d. h. sowohl eine Unterforderung als auch eine Überforderung können zu einer Überbeanspruchung mit negativen körperlichen und/oder seelischen Folgen führen. Im Leitfaden für Betriebsärzte zu psychischen Belastungen und den Folgen in der Arbeitswelt wurde das Belastungs-Beanspruchungsmodell erweitert, indem nicht nur die lineare Reaktionskette Belastungen – Beanspruchungen – Folgen betrachtet wird, sondern zusätzlich Rückkopplungsprozesse einbezogen werden: sowohl infolge der Fehlbeanspruchung entstandene als auch parallel vorhandene psychische und somatische Erkrankungen beeinflussen arbeitsbezogene Belastungen und zwar sowohl positiv als auch negativ (DGUV 2010). 13 Abb. Das erweiterte Belastungs- und Beanspruchungsmodell (modifiziert nach DGUV 2010) Rückkopplungsprozesse Arbeitsbedingte Belastungen Externe Ressourcen Arbeitsumgebung Soziales Klima Arbeitsaufgabe Arbeitsorganisation unmittelbare Reaktion Persönliche Ressourcen Private Belastungen 1.4 Beanspruchung individuell unterschiedlich postiv positiv Kurzfristige Folgen Langfristige Folgen negativ negativ Rückkopplungsprozesse Arbeitsbelastungen und subjektive Wahrnehmung der Gesundheitsgefährdung „Es gibt das Menschenrecht auf Arbeit und angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen, sogar das Menschenrecht auf gleichen Lohn bei gleicher Arbeit – festgelegt in Artikel 23 der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen von 1948. Für viele Menschen scheint dieses Recht aber nicht zu gelten – auch nicht in Deutschland. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den beruflichen Stress zu „einer der größten Gefahren des 21. Jahrhunderts“ erklärt. Die daraus resultierenden gesundheitlichen und gesellschaftlichen Probleme sind auch in Deutschland zu gravierend, um sie als vermeintlich unabänderliche Kollateralschäden des Wirtschafts- und Finanzsystems zu tolerieren.“ (Hölzinger 2011) Hohe Belastungen am Arbeitsplatz, die die individuelle Leistungsfähigkeit der Erwerbstätigen übersteigen, können zu Beanspruchungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Berufskrankheiten führen mit erhöhten Fehlzeiten, einem erhöhten Risiko für Fehlhandlungen oder Arbeitsunfälle, einer Minderung der Erwerbsfähigkeit oder einem vorzeitigen Renteneintritt. 14 Belastungen durch Erwerbstätigkeit können aus körperlichen oder geistigen Tätigkeiten, aus der Arbeitsorganisation, der Arbeitsumgebung oder den sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz entstehen. Erwerbstätigkeit in Deutschland ist auf der einen Seite gekennzeichnet durch eine hohe Zahl hochqualifizierter und sozial abgesicherter Arbeitsplätze sowie durch starke Interessenvertretungen der Arbeitnehmer. Andererseits gibt es eine steigende Anzahl von Arbeitsplätzen in gering regulierten Bereichen des Arbeitsmarktes mit unzureichender Bezahlung (z. B. 1-Euro-Jobs, Praktika). Wird das eigentliche Ziel dieser Beschäftigungsverhältnisse, der (Wieder)einstieg in den ersten Arbeitsmarkt, nicht erreicht können daraus erhebliche psychosoziale und finanzielle Belastungen resultieren. Arbeitsbelastungen können unterteilt werden in Umgebungsbelastungen (z. B. Lärm, extreme Temperaturen), körperliche Belastungen (z. B. schweres Heben und Tragen) sowie psychische und soziale Belastungen (z. B. Zeitdruck, Konflikte am Arbeitsplatz) (Statistisches Bundesamt 1998). In den Jahren 2009/2010 führte das Robert Koch-Institut einen Interviewsurvey zu Arbeitsbelastungen und gesundheitlichen Folgen durch. Im Rahmen der Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA 2010)“ wurden 20.050 erwerbstätige Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren befragt (Kroll et al. 2011). Ein Siebtel der befragten erwerbstätigen Frauen und ein Fünftel der Männer sah die eigene Gesundheit als stark oder sehr stark durch ihre Arbeit gefährdet. Die Mehrheit der erwerbstätigen Frauen und Männer gab an, dass ihre Gesundheit durch die eigene Arbeit „gar nicht“ oder nur „mäßig“ gefährdet sei. Im Vergleich der Altersgruppen „Berufseinstieg“, „Hauptphase der Erwerbstätigkeit“ und „späte Phase des Berufslebens“ zeigten sich aber – vor allem bei erwerbstätigen Männern – deutliche Unterschiede in der subjektiv wahrgenommenen Gesundheitsgefährdung durch die eigene Arbeit (Kroll et al. 2011). 15 Tab. Subjektiv wahrgenommene Gesundheitsgefährdung durch die eigene Arbeit (Datenbasis GEDA 2010, Kroll et al. 2011) Gesundheitsgefährdung durch die eigene Arbeit gar nicht mäßig stark sehr stark 18-29 Jahre 44,2% 42,1% 11,8% 1,8% 30-44 Jahre 44,1% 41,0% 12,2% 2,7% 45-64 Jahre 44,9% 41,8% 11,0% 2,3% 44,5% 41,6% 11,6% 2,3% 18-29 Jahre 39,5% 44,6% 12,4% 3,4% 30-44 Jahre 26,3% 50,2% 18,6% 4,9% 45-64 Jahre 34,4% 46,4% 15,7% 3,5% 32,4% 47,5% 16,1% 4,0% Frauen Frauen gesamt Männer Männer gesamt Die häufigsten Arbeitsbelastungen waren „Arbeit unter Zeit- /Leistungsdruck“ mit 40,4%, „Überstunden, lange Arbeitszeiten und Arbeitswege“ mit 34,6%) und „Lärm, Kälte, Hitze usw.“ mit 34,2% (Kroll et al. 2011). Analysen des Zusammenhangs zwischen Arbeitsbelastungen und wahrgenommener Gesundheitsgefährdung zeigten, dass Frauen „Beeinträchtigungen im Arbeitsklima“ und „Arbeit unter Zeit-/Leistungsdruck“ als wichtigste Risikofaktoren für eine Gesundheitsgefährdung einschätzten. Männer maßen den Belastungsfaktoren „Beeinträchtigungen im Arbeitsklima“ und „Lärm, Kälte, Hitze usw.“ die größte Bedeutung für eine Gesundheitsgefährdung zu (Kroll et al. 2011). Die subjektiv empfundene gesundheitliche Belastung (Beanspruchung) durch die eigene Arbeit hängt nicht nur von der Art der Belastung ab. Weitere Einflussfaktoren sind insbesondere der Umfang der Erwerbstätigkeit und der mit der Tätigkeit verbundene soziale Status. Vollzeiterwerbstätige schätzen ihre gesundheitliche Belastung durch die eigene Arbeit deutlich höher 16 ein als Teilzeiterwerbstätige oder geringfügig Beschäftigte. 17% der vollzeitbeschäftigten Frauen und Männer sahen eine starke Belastung ihrer Gesundheit durch die eigene Arbeit, 21% eine sehr starke. Im Vergleich dazu nahmen nur 5% der geringfügig Beschäftigten eine starke und 12% eine sehr starke Belastung wahr (Kroll et al. 2011). Im Branchenvergleich findet sich eine starke oder sehr starke subjektive gesundheitliche Belastung vor allem bei Frauen, die in der Gesundheitsbranche beschäftigt sind und bei männlichen Beschäftigten im Baugewerbe sowie im Güter- und Personenverkehr (Kroll et al. 2011). Frauen und Männer, die als Arbeiter_innen beschäftigt sind, sehen deutlich häufiger eine Gesundheitsgefährdung durch ihre Arbeit als Angestellte oder Freiberufler_innen und Selbständige. Diese Unterschiede zeigen sich auch nach statistischer Kontrolle des Alters, des Umfangs der Erwerbstätigkeit und der Dauer der Betriebszugehörigkeit (Kroll et al. 2011). A2 1.5 Körperliche und Umgebungs-Belastungen Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen körperlichen Belastungen (z. B. langes Stehen, schweres Heben), Umgebungsbelastungen (z. B. Hitze, Kälte, Lärm) und psychischen Belastungen (z. B. fehlende Anerkennung, mangelnde Kommunikation), wobei von Wechselwirkungen auszugehen ist. Psychische Belastungen durch Zeitdruck und Arbeitsintensität haben in den vergangenen Jahren in allen Branchen zugenommen. Körperliche Belastungen sind bei einem Drittel der Beschäftigten geringer geworden, bei einem Drittel angestiegen (Ahlers u. Brussig 2004 zit. in Groner 2012). Auch die Daten der GEDA-Studie machen deutlich, dass trotz der zunehmenden Entwicklung einer Dienstleistungsgesellschaft noch ein erheblicher Anteil der Beschäftigten in Deutschland eine gesundheitliche Gefährdung durch körperliche und umgebungsbezogene Arbeitsbelastungen empfindet (Kroll et al. 2011). 17 Nach der BiBB-BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006 übt etwa ein Viertel der Befragten (7,6 Millionen) eine mit Heben und Tragen schwerer Lasten verbundene Tätigkeit aus. 52% fühlen sich dadurch belastet. Abb. Arbeitsbedingungen schweres Heben, Vibration, Schmutz; Mehrfachnennungen möglich (Quelle: BiBB-BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006) 8 Millionen Erwerbstätige führen Arbeiten unter Lärm aus. Mehr als die Hälfte fühlt sich dadurch belastet (BAuA 2006). Abb. Arbeitsbedingungen: Umgebungsfaktoren (Quelle: BiBB-BAuAErwerbstätigenbefragung 2006) 18 1.5.1 Arbeitsunfälle, arbeitsbedingte Erkrankungen und Berufskrankheiten Durch den Aufbau eines umfassenden Arbeitsschutzsystems auf der Basis des Staatlichen Arbeitsschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland und der 16 Länder sowie des Autonomen Arbeitsschutzrechts der gesetzlichen Unfallversicherungsträger und einen Trend zur Dienstleistungsgesellschaft sind die Zahlen der gemeldeten Arbeitsunfälle ebenso wie die Berufskrankheiten in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Von 1992 bis 2003 haben sich die Arbeitsunfälle in Deutschland um ca. 45% verringert (BAuA 2011, Seidel et al. 2007). Die Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit sind im gleichen Zeitraum von 260.000 auf 65.000 zurückgegangen (Seidel et al. 2007). Berufskrankheiten gehören zu den arbeitsbedingten Erkrankungen. Arbeitsbedingte Erkrankungen sind Erkrankungen, die durch Arbeitsbedingungen ganz oder teilweise beeinflusst werden oder deren Verlauf durch die Arbeitsbedingungen ungünstig beeinflusst wird. Arbeitsbedingte Erkrankungen sind sehr viel häufiger als Berufskrankheiten, da hierzu auch Erkrankungen zählen, die durch die Arbeit mitbedingt sind, für deren Entstehung aber die strengen Kausalvoraussetzungen der Berufskrankheiten nicht gegeben sind. Die WHO empfiehlt, für diese Untergruppe arbeitsbedingter Erkrankungen den Begriff „arbeitsbezogene Erkrankungen“ (work related diseases) zu verwenden. Nach dem BKK-Gesundheitsreport 2010 sind aus Sicht der Beschäftigten vor allem Beschwerden des Muskel- und Skelettsystems und psychische Probleme arbeitsbedingt. Als (mit)verursachende Faktoren spielen dabei häufig sowohl körperliche und Umgebungs- als auch psychosoziale Belastungen eine Rolle. Dafür sprechen auch die Daten des BKK- Gesundheitsreports, die zeigen, dass sechs von zehn Personen mit Muskelund Skelett-Beschwerden gleichzeitig auch psychische Probleme haben. 19 Regelungen zur Prävention von arbeitsbedingten Erkrankungen finden sich sowohl im SGB VII als auch im Arbeitsschutzgesetz (§ 2: Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren). Definition Berufskrankheit nach §9 Abs. 1 SGB VII: Berufskrankheiten = Krankheiten, die die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates in die sog. Liste der Berufskrankheiten aufgenommen hat. Für die gelisteten Berufskrankheiten ist ein kausaler Zusammenhang zwischen schädigender Einwirkung einer Berufstätigkeit und Krankheitsentstehung nachgewiesen. In Einzelfällen können gemäß §9 Abs. 2 SGB VII Krankheiten, die nicht in der BK-Liste aufgeführt sind, anerkannt werden, wenn neue, gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse den Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit belegen. Für die Anerkennung einer Berufskrankheit müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 1. Zwischen der versicherten Tätigkeit und der schädigenden Einwirkung muss ein rechtlich wesentlicher ursächlicher Zusammenhang bestehen. 2. Zwischen der Einwirkung und der Erkrankung muss ein rechtlich wesentlicher ursächlicher Zusammenhang gegeben sein. Abb. Anerkennung einer Berufskrankheit Versicher- Schädigen- te de Tätigkeit Einwirrechtlich wesentlicher ursächlicher Zusammenhang kung Erkrankung Anerkannte Berufskrankheit Nachweis von Beschäftigungszeiten unter schädigender Einwirkung Anerkennung im individuellen Fall 20 Die Anerkennung einer Berufskrankheit im individuellen Fall setzt voraus, dass Beschäftigungszeiten in einem Beruf mit schädigenden Einflüssen (Exposition) nachgewiesen werden. Die Anzeige einer Berufskrankheit kann durch Ärzte (Anzeigepflicht nach §202 SGB VII), Unternehmer (Meldepflicht nach §4 BKV), Versicherte, Krankenkassen und andere Stellen erfolgen. Sowohl bei Arbeitsunfällen als auch bei Berufskrankheiten ist es die Aufgabe der gesetzlichen Unfallversicherungen, Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Versicherten wieder herzustellen und die Betroffenen bzw. im Todesfall ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu entschädigen (§1 SGB VII). Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Zahl der angezeigten und anerkannten Berufskrankheiten in den vergangenen Jahren. Abb. Berufskrankheitenzahlen 1960 bis 2010 (Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2010) Im Jahr 2003 betrafen die häufigsten Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit Hauterkrankungen (26%), Lärmschwerhörigkeit (17%) und bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule (12%). Die häufigste anerkannte Berufskrankheit war die Lärmschwerhörigkeit (40%), gefolgt von Asbest-bedingten Berufskrankheiten (21%) (Seidel et al. 2007). Ähnli21 che Daten zeigen sich in der Dokumentation der Gesetzlichen Unfallversicherung für das Jahr 2010. Abb. Am häufigsten angezeigte Berufskrankheiten und Anerkennung (Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2010) 1.5.2 Gesundheitsprobleme bei Nacht- und Schichtarbeit Nach der Leitlinie „Nacht- und Schichtarbeit“ der Deutschen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin (DGAUM 2006) ist Schichtarbeit „eine Form der Tätigkeit mit Arbeit zu wechselnden Zeiten (Wechselschicht) oder konstant ungewöhnlicher Zeit (z. B. Dauerspätschicht, Dauernachtschicht).“ Da alle Körperfunktionen mehr oder weniger ausgeprägt einem tagesperiodischen Wechsel unterliegen, kann eine biologische Desynchronisation durch Schichtarbeit zu gesundheitlichen Störungen führen. Schichtarbeiter leiden häufig unter Schlafstörungen, die sich längerfristig psychosomatisch auswirken können. Das sogenannte Schichtarbeiter-Syndrom ist eine von etwa 80 in der Internationalen Klassifikation der Schlafstörungen (International Classification of Sleep Disorders, ICSD-2) aufgeführten Schlafstörungen. Es gehört zur Gruppe der Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen. Nachtarbeiter, die tagsüber schlafen müssen, sind vielfältigen Störfaktoren ausgesetzt wie Helligkeit, höheren Temperaturen, vor allem aber einem hö22 heren Geräuschpegel. Die Prävalenz schichtarbeitsassoziierter Schlafstörungen nimmt mit steigendem Lebensalter zu. Ein Schlafdefizit ist häufig mit Befindlichkeitsstörungen verbunden, d. h. mit eher unspezifischen „funktionellen“ gesundheitlichen Beschwerden (z. B. Appetitlosigkeit, Magenbeschwerden, innere Unruhe, Nervosität). Neben der Verschiebung des biologischen Rhythmus besteht bei Schichtarbeit in der Regel auch eine soziale Desynchronisation. Schichtarbeit erfordert eine zeitliche Veränderung der Lebensweise, die die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt. Unternehmungen mit Partner_innen und Familie, die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung, die Ausübung von Hobbys oder der Kontakt zu Freunden sind erheblich erschwert. Die daraus resultierenden psychosozialen Belastungen können ebenfalls zu gesundheitlichen Folgestörungen führen. Inwieweit die mit der Schichtarbeit verbundenen Veränderungen des Lebensrhythmus zu gesundheitlichen Problemen führen, hängt auch von der persönlichen Situation des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin ab, insbesondere von der eigenen Akzeptanz der Schichtarbeit und der Einstellung von Partner_innen und Familie zu dieser. Schicht arbeitende Frauen müssen meist zusätzlich die Hausarbeit erledigen und deutlich mehr Zeit für die Kinderbetreuung aufbringen als Männer. Diese Kumulierung sozialer Rollen und die daraus resultierenden schlechteren Ausgleichsmöglichkeiten stellen einen erheblichen gesundheitlichen Risikofaktor bei Schicht und Nacht arbeitenden Frauen dar. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Schichtarbeit werden zusätzlich durch den sozialen Status von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen beeinflusst. Schichtarbeit wird umso eher akzeptiert, je stärker individuelle Bedürfnisse bei der Gestaltung von Arbeitsplänen Berücksichtigung finden (DGAUM 2009). Studien, die Arbeitstätigkeiten zu verschiedenen Tageszeiten untersucht haben, ergaben ein Leistungstief zwischen 0.00 und 6.00 Uhr. Das relative Unfallrisiko nimmt dementsprechend von der Früh- über die Spät- bis zur Nachtschicht zu. Auch eine über acht Stunden andauernde Arbeitszeit geht mit einem erhöhten Unfallrisiko einher. Untersuchungen zu täglichen Arbeitszeiten von neun, zehn oder zwölf Stunden haben gezeigt, dass mittelund langfristig überdurchschnittliche Ermüdung, Schläfrigkeit, schlechtere 23 Leistungen und ein erhöhtes Unfallrisiko bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen auftreten (DGAUM 2009). In Anbetracht der demografischen Entwicklung wird die Besetzung von Arbeitsstellen mit Schichtarbeit immer mehr zu einem Problem, da mit zunehmendem Alter die Schichtverträglichkeit abnimmt (Reik 2011). In Deutschland sind über zwei Millionen Nacht- und Schichtarbeiter_innen bereits über 50 Jahre alt (Statistisches Bundesamt 2011). Da auf Nacht- und Schichtarbeit in Bereichen wie z. B. Pflege, Rettungsdienst, Polizei nicht verzichtet werden kann, ist es notwendig präventive und kompensatorische Maßnahmen zur Minderung der erhöhten Beanspruchung anzubieten. Nachtarbeitern ab dem 50. Lebensjahr steht jährlich eine arbeitsmedizinische Untersuchung zu. Prävention von Gesundheitsstörungen durch Schichtarbeit sollte aber bereits früher beginnen und wegen der komplexen Wechselwirkungen von physischen, psychischen und sozialen Belastungen multimodal ansetzen. Zur Wirksamkeit von multimodalen Interventionen zur Verbesserung der Gesundheit bei Schichtarbeier_innen liegen bisher zwar nur wenige Studien vor, eine Kohortenstudie von Ott et al. (2009) konnte aber z. B. zeigen, dass durch ein Gesundheitsschutzprogramm die Rate der Arbeitsunfälle bei Schichtarbeitern signifikant reduziert werden konnte (Ott et al. 2009). A3 1.6 Psychosoziale Belastungen Bedingt durch technische Fortschritte und einen verbesserten Arbeitsschutz auf der einen Seite und erhöhte Arbeitsanforderungen und Zeitdruck auf der anderen Seite hat sich der Schwerpunkt der Arbeitsbelastungen in den modernen Industrienationen aus dem physikalischen und chemischen Bereich in den psychosozialen Bereich verschoben. Ob Arbeitsanforderungen oder soziale Interaktionen am Arbeitsplatz von einer Person als negativ (Stress, Distress) empfunden werden hängt nicht nur von den Arbeitsbedingungen ab. Persönlichkeitsfaktoren, Stressbewälti24 gungsstrategien (Coping), psychosoziale Unterstützung, Belastungsquellen im privaten Bereich (Familie, Freunde, Freizeit etc.) sind in diesem Zusammenhang ebenfalls von Bedeutung. Psychosoziale Arbeitsbelastungen können in mentale und emotionale Belastungen unterteilt werden (Siegrist 2005). Mentale Belastungen Emotionale Belastungen Arbeitsanforderungen, die durch soziale Interaktionen am ArHäufigkeit, Dauer, Intensität oder beitsplatz, die durch die beSchwierigkeit das kognitive Leis- schäftigte Person negativ betungsvermögen* der beschäftig- wertet werden (mangelnde Anten Person überfordern oder be- erkennung, Gruppendruck, einträchtigen (Zeitdruck, Über- Mobbing etc.) forderung, Unterforderung etc.) *kognitive Leistungen = Wahrnehmung, Erkennen, Vorstellen, Wissen, Denken, Kommunikation, Handlungsplanung (Birbaumer & Schmidt 2006) 10 bis 30% aller abhängig Beschäftigten in Vollzeitarbeitsverhältnissen sind von krankheitswertigen psychosozialen (mentalen und/oder emotionalen) Belastungen betroffen (Siegrist 2005). Durch chronische Stressreaktionen können sich aus psychosozialen Arbeitsbelastungen psychosomatische Störungen und körperliche Erkrankungen entwickeln. Stress ist ein unspezifisches Reaktionsmuster auf erhöhte Beanspruchungen (Stressoren). Es wird unterschieden zwischen positivem Stress (Eustress), z. B. angemessene Herausforderungen oder interessante Aufgaben und negativem Stress (Distress), z. B. anhaltende Überforderung oder Unterforderung. 25 Stressoren (= Stressreize) können körperlicher Art (z. B. schwere Erkrankung, schwere körperliche Arbeit), psychischer Art (z. B. Prüfungsängste) oder sozialer Art (z. B. Isolation) sein. Nach der Dauer ihres Vorkommens können Stressoren unterteilt werden in: akute Stressoren: traumatische Erlebnisse (z. B. Überfall) subakute Stressoren: kritische Lebensereignisse, die über Wochen oder Monate andauern (z. B. schwere Erkrankung, psychosoziale Belastungen am Arbeitsplatz) chronische Stressoren: über Jahre andauernde psychosoziale Belastungen (z. B. Arbeitsbelastungen) (Siegrist 2005) Die Wirkung von aversiven Stressreizen hängt von verschiedenen Faktoren ab, die miteinander interagieren: objektive, physikalische Intensität subjektiv-psychologische Intensität (Bewertung) Vermeidungs- und Bewältigungsmöglichkeit (Coping) Vorerfahrungen mit Stress (Lerngeschichte) Dauer und Häufigkeit von Stressreizen konstitutionelle Faktoren (Stressempfindlichkeit, Vulnerabilität, Persönlichkeit) soziale Unterstützung motorische „Abfuhrmöglichkeiten“ (Sport) (Birbaumer & Schmidt 2006) Beim Versuch der Anpassung (Adaptation) des Organismus an physische, psychische und/oder soziale Stressoren kommt es zu einer Aktivierung des sympathischen Nervensystems sowie zur Ausschüttung von Stresshormonen (Katecholamine, Cortisol) durch die Nebenniere. Langzeitstress ohne erfolgreiche Bewältigung führt zu einem Zusammenbruch der homöostatischen Gegenregulation. Es kommt zu krankheitswertigen Fehlreaktionen und strukturellen Schädigungen von Organsystemen. Am besten belegt ist der Zusammenhang von chronischem Stress und Krankheitsentstehung für affektive Störungen und Herz- Kreislauferkrankungen (Marmot et al. 1997). Auch wenn durch psychosoziale Belastungen am Arbeitsplatz nur ein Teil der Varianz dieser Krankheitsbilder zu erklären ist, sind die empirisch beleg26 ten Zusammenhänge von großer Bedeutung für die Arbeitsmedizin und die betriebliche Gesundheitsförderung. Im Folgenden sollen einige häufig vorkommende psychosoziale Arbeitsbelastungen näher betrachtet werden. 1.6.1 Mobbing Mobbing am Arbeitsplatz stellt eine erhebliche psychosoziale Belastung dar und ist immer mit Ausgrenzung verbunden. Definition Der Begriff leitet sich von dem englischen Wort „to mob = über jemanden herfallen“ ab. Eine einheitliche, international anerkannte Definition gibt es bisher nicht. Die Gesellschaft gegen psychosozialen Stress und Mobbing (GPSM) gibt folgende Definition: „Mobbing ist eine konfliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz unter Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, bei der die angegriffene Person unterlegen ist und von einer oder einigen Personen systematisch, oft und während langer Zeit mit dem Ziel und/oder dem Effekt des Ausstoßes aus dem Arbeitsverhältnis direkt oder indirekt angegriffen wird und dies als Diskriminierung empfindet“ (Schwickerath et al. 2004). Auch in der Rechtsprechung wurde der Begriff „Mobbing“ verschiedentlich definiert, z. B. in einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Thüringen vom 10.4.2001 – 5SA403/00: „Im arbeitsrechtlichen Verständnis erfasst der Begriff Mobbing fortgesetzte, aufeinander aufbauende oder ineinander übergreifende, der Anfeindung, Schikane oder Diskriminierung dienende Verhaltensweisen, die nach Art und Ablauf im Regelfall einer übergeordneten, von der Rechtsordnung nicht gedeckten Zielsetzung förderlich sind und jedenfalls in ihrer Gesamtheit das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder andere ebenso geschützte Rechte, wie die Ehre oder die Gesundheit des Betroffenen verletzen. Ein vorgefasster Plan ist nicht erforderlich. Eine Fortsetzung des Verhaltens unter schlichter Ausnutzung der Gelegenheiten ist ausreichend“ (zit. in: Weber et al. 2007a). Epidemiologie 27 2002 lieferte der Mobbing-Report der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) erstmals repräsentative Daten zur Häufigkeit in Deutschland. Danach war im Jahr 2000 von insgesamt etwa 38 Millionen Erwerbstätigen 1 Million von Mobbing betroffen. Die 12-Monatsprävalenz lag bei 5,5%. Neue Mitarbeiter_innen scheinen ein höheres Mobbing-Risiko zu haben als langjährige Mitarbeiter_innen, ebenso Frauen im Vergleich zu Männern. Nach dem deutschen Mobbing-Report ist das Risiko für Frauen um 75% höher als das für Männer. Die am stärksten betroffenen Altersgruppen sind mit 3,7% die unter 25-Jährigen und Auszubildende sowie mit 2,9% die über 55-Jährigen. Kollegen-Mobbing (gleiche Hierarchieebene) ist mit einer Prävalenzrate von 50% am häufigsten, gefolgt von Mobbing durch Vorgesetzte („Bossing“) mit etwa 40% (Weber et al. 2007a). Häufig betroffene Berufsgruppen fanden sich im Gesundheits- und Erziehungsbereich, in der öffentlichen Verwaltung sowie bei Banken. Im Gesundheits- und Sozialwesen wurden Mobbing-Raten von bis zu 30% angegeben (Weber et al. 2007a). Ätiopathogenese Mobbing ist ein multifaktoriell verursachter Prozess und wird sowohl durch die Verhältnisse und Bedingungen im Arbeitsumfeld als auch durch Verhalten und Einstellungen sowie Persönlichkeitsmerkmale von Opfern und Tätern beeinflusst. Die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz differenziert zwischen zwei Mobbing-Varianten: Mobbing als „Folge eines eskalierenden Konfliktes“ „Mobbing-Fälle, in denen Täter ihre Aggressionen ausleben (Suche nach einem Sündenbock) und die Opfer primär nicht in einen Konflikt verwickelt waren“ (zit. nach Weber et al. 2007a). Mobbing-begünstigende Faktoren der Arbeitswelt sind nach Weber et al. (2007a) z. B.: Arbeitsverdichtung – Überforderung – chronischer Stress verschärfter Wettbewerb Unterforderung, Langeweile Perspektivlosigkeit 28 unklare Arbeitsorganisation Arbeitsplatzunsicherheit schlechtes Betriebsklima innerbetriebliche Veränderungen defizitäre Führungskompetenz fehlende gemeinsame Werte Mobbing-Handlungen Mobbing –Handlungen sind sehr vielfältig. Sie können das soziale Ansehen, die Qualität der Arbeit sowie die Entfaltungs- und Mitteilungsmöglichkeiten betreffen oder direkt auf die Schädigung der Gesundheit ausgerichtet sein. Typische Mobbing-Handlungen sind z. B. • Jemanden wie Luft behandeln • Jemanden lächerlich machen • Gerüchte verbreiten • Jemanden ständig unterbrechen • Verteilung sinnloser Arbeitsaufgaben • Zwang zu gesundheitsschädlichem Arbeiten Gesundheitsprobleme durch Mobbing Mobbing-Opfer sind einem gesundheitsschädigenden Stress ausgesetzt und klagen infolgedessen über vielfältige unspezifische Symptome wie Selbstzweifel, Ohnmachtsgefühle, Gereiztheit, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Schwindel, Bluthochdruck, Magen- Darmbeschwerden, Rückenschmerzen bis hin zu schweren seelischen Beeinträchtigungen (depressive Störungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Suchterkrankungen) (Jaggi 2008, Weber et al. 2007a). Nach dem MobbingReport der Bundesanstalt für Arbeitsschutz litten 44% der betroffenen Personen unter stärkeren gesundheitlichen Einschränkungen bzw. manifesten Erkrankungen. Bei jedem sechsten war deswegen eine stationäre Behandlung notwendig (Schwickerath et al. 2004). Eine Kohortenstudie aus Finnland, die 5000 Beschäftigte des Gesundheitswesens untersuchte, konnte einen Zusammenhang zwischen Mobbing am 29 Arbeitsplatz und dem Auftreten depressiver Störungen und kardiovaskulärer Erkrankungen belegen (Kivimäki et al. 2003). Mobbing-Folgen und Verlauf Mobbing hat nicht nur individuelle gesundheitsschädigende Folgen, sondern auch betriebliche und gesellschaftliche Auswirkungen. Durch reduzierte Arbeitsleistungen und vermehrte Fehlzeiten von Mobbing-Opfern können erhebliche betriebswirtschaftliche Kosten entstehen. Mit zunehmender Mobbing-Dauer wird eine für alle Beteiligten erfolgreiche Beendigung immer unwahrscheinlicher. 50% der im Mobbing-Report berichteten Fälle endeten mit einer Kündigung des Arbeitsvertrags (Schwickerath et al. 2004). Gerade bei älteren Erwerbstätigen ist nach längerer Krankschreibung wegen psychischer Störungen damit ein generelles Ausscheiden aus dem Erwerbsleben verbunden, da ein beruflicher Wiedereinstieg nicht mehr gelingt (Weber et al. 2007a). Abb. Mobbing-Verlauf (modifiziert nach Leymann 2000) Ungelöster Konflikt Schuldzuweisungen, persönliche Angriffe Psychoterror – Etablierung von Mobbing Ausgrenzung/Isolation, abnehmendes Selbstwertgefühl Eskalation – Verschlechterung der Arbeitsleistung Psychische Erkrankung, vermehrte Fehlzeiten, Abmahnung, Versetzung, Kündigung, Ausschluss – Verlust des Arbeitsplatzes Psychische Erkrankung, Arbeitsunfähigkeit, Frühverrentung, Arbeitslosigkeit, sozialer Abstieg, Suizid – vorzeitiger Tod 30 Prävention von Mobbing Die Notwendigkeit von Präventionsmaßnahmen bzw. Interventionen gegen Mobbing wird zunehmend erkannt. Der erste Schritt ist eine Sensibilisierung und Aufklärung über die Problematik. Dabei sollten sowohl Führungskräfte und Personalrat als auch Mitarbeiter eines Betriebs einbezogen werden. Die Thematik sollte in das betriebliche Gesundheitsmanagement eingebaut werden. Der Umgang mit Mobbing im Betrieb sollte einheitlich geregelt werden, z. B. über Dienstvereinbarungen, Einrichtung klarer Beschwerdewege etc. (Meschkutat et al. 2002). 1.6.2 Berufsbedingte räumliche Mobilität Berufsbedingte Mobilität ist kein neues Phänomen der heutigen Arbeitswelt, aber die Mobilitätsanforderungen haben in den letzten Jahrzehnten zugenommen (Ruppenthal u. Lück 2009). Mobilität ist häufig nicht nur für Wirtschaft und Unternehmen von Nutzen (z. B. Austausch von Wissen und Erfahrung), sondern auch für den einzelnen Beschäftigten von Vorteil (z. B. höheres Einkommen, beruflicher Erfolg). Für die Beschäftigten kann eine erwerbsbedingte räumliche Mobilität aber auch mit negativen Konsequenzen verbunden sein, z. B. mit Vereinsamung, Entwurzelung, Zerbrechen sozialer Beziehungen Es können zwei Formen der berufsbedingten räumlichen Mobilität unterschieden werden: residenzielle Mobilität: Umzugsmobilität innerhalb eines Landes oder über Landesgrenzen hinweg zirkuläre Mobilität: Pendeln Bezüglich des Pendelns ist noch einmal zu unterscheiden zwischen Fernpendlern und Wochenendpendlern (sog. Übernachtern). Nach dem Forschungsprojekt „Job Mobilities and Family Lives in Europe“ sind die Mobilitätsformen wie folgt definiert: 31 residenzielle Mobilität: Umzug in einen mindestens 50 km entfernten Ort Fernpendler: für den Weg zur Arbeit und zurück werden mindestens zwei Stunden benötigt; Pendeln an mindestens drei Tagen pro Woche Wochenendpendler, Übernachter: Übernachtung außer Haus mindestens 60 Mal in den letzten 12 Monaten (Ruppenthal u. Rüger 2011) Jeder zweite Erwerbstätige in Deutschland zwischen 25 und 54 Jahren hat bereits einmal Erfahrungen mit berufsbedingter räumlicher Mobilität gemacht. Etwa drei Viertel sind zirkulär mobil, ein Viertel residenziell. Besonders mobil sind jüngere Erwerbstätige zu Beginn ihrer Berufstätigkeit und Erwerbstätige mit Hochschulabschluss (Ruppenthal u. Rüger 2011). Auswirkungen einer berufsbedingten räumlichen Mobilität auf Wohlbefinden und Gesundheit Nach Adjustierung für Alter, Geschlecht, Schulbildung, Erwerbsumfang und Familienform klagten Fernpendler gegenüber nicht mobilen Erwerbstätigen über einen schlechteren Gesundheitszustand und gaben vermehrt eine starke generelle Stressbelastung und eine depressive Verstimmung an (Ruppenthal u. Rüger 2011). Abb. Belastungsprofile mobiler und nicht-mobiler Erwerbstätiger in Deutschland, adjustierte Odds Ratios (Quelle: Ruppenthal u. Rüger 2011, Daten für Deutschland aus dem Projekt „Job Mobility and Family lives“, modifiziert nach Schneider et al. 2009) *p </= .10; ** p</= .05 32 Ursachen für die stärkere Stressbelastung von Fernpendlern dürften vor allem Zeitmangel und Zeitdruck sein sowie Belastungen durch hohes Verkehrsaufkommen und Kontrollverlust bei Verspätungen. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Fernpendler vermehrt über psychosomatische Beschwerden klagen, häufigere Fehlzeiten aufweisen und ein höheres Unfallrisiko haben (Häfner et al. 2001, Nitsche et al. 2009). Übernachter zeigen tendenziell einen schlechteren Gesundheitszustand und ein geringeres psychisches Wohlbefinden. Umzugsmobile Erwerbstätige weisen vor allem in den ersten anderthalb Jahren nach dem Umzug vermehrt psychosoziale Belastungen auf (Ruppenthal u. Rüger 2011). Der Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK 2012) berichtet, dass mit einem Wohnkreiswechsel assoziierte Risiken für psychische Störungen vor allem ältere Versicherte betreffen. Personen im Alter von 25 bis 29 Jahren hatten im Vergleich zu Personen mit konstantem Wohnkreis allenfalls geringfügig erhöhte AU-Raten unter der Diagnose psychischer Störungen. In einem höheren Erwerbsalter waren ein oder mehrere Wohnortwechsel dagegen, gemessen an AU-Tagen wegen entsprechender Diagnosen, deutlich mit psychischen Belastungen assoziiert (TK 2012). 1.7 Gesundheitsprobleme durch psychosoziale Belastungen und Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit In einer Befragung der DAK von 3.000 Berufstätigen im Alter von 25 bis 65 Jahren berichtete knapp jeder Zehnte von beruflichen Gratifikationskrisen. Männer und Frauen waren gleichermaßen betroffen. Besonders häufig waren Gratifikationskrisen bei Facharbeitern und in der Altersgruppe der 45- bis 59-Jährigen. 11,2% der Facharbeiter und 10,8% der Arbeiter klagten über Gratifikationskrisen, während Selbständige und Freiberufler nur in 3,9% und Beamte in 6,7% der Fälle betroffen waren. Erwerbstätige mit einer Gratifikationskrise beurteilen ihren Gesundheitszustand im Vergleich zu Personen ohne Gratifikationskrise häufiger als schlecht (50% versus 17%). Beschäftigte mit Gratifikationskrisen haben häufiger auch objektivierbare Gesundheitsprobleme, insbesondere Ängste oder Gefühle der Hilflosigkeit (73,8% versus 23,9%). Auch Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit treten bei Personen mit Gratifikationskrisen häufiger auf (DAK-Gesundheit 2012). 33 Kopfschmerzen und Schlafstörungen sowie andere psychosomatische Beschwerden können Ausdruck eines Burnout Syndroms sein. Da Krankschreibungen wegen eines Burnout in den vergangenen Jahren zugenommen haben, soll im Folgenden auf dieses Syndrom näher eingegangen werden. 1.7.1 Burnout Burnout ist nach ICD-10 kein eigenständiges Krankheitsbild mit eindeutig zuzuordnenden diagnostischen Kriterien. Burnout wird dort unter den „verwandten Gesundheitsproblemen“ im Abschnitt Z73 „Probleme und Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“ mit dem Diagnoseschlüssel Z73.0 als „Ausgebranntsein“ und „Zustand der totalen Erschöpfung“ erfasst. Im Jahr 1974 schrieb der amerikanische Psychoanalytiker H. Freudenberger: „Was wir aufbauen, sind unsere Talente und Fähigkeiten, was wir einbringen, sind Überstunden für ein Minimum an finanziellem Ausgleich. Wir arbeiten zu viel, zu lange und zu intensiv. Wir fühlen einen inneren Druck, zu arbeiten und zu helfen, und wir fühlen einen Druck von außen zu geben… Aber genau wegen dieses Engagements tappen wir in die Burnout-Falle“ (Freudenberger 1992). 1982 gab es bereits über 50 verschiedene Definitionen von Burnout mit über 100 unterschiedlichen psychischen und physischen Symptomen. Bis heute gibt es keine einheitliche Definition. Nach Jaggi (2008) ist Burnout „eine körperliche, emotionale und geistig Erschöpfung aufgrund beruflicher Überlastung. Dabei handelt es sich nicht um eine Arbeitsmüdigkeit, sondern um einen fortschreitenden Prozess, der mit wechselhaften Gefühlen der Erschöpfung und Anspannung einhergeht.“ In der Anfangsphase findet sich häufig ein Überengagement. Bei anhaltendem Stress, der nicht mehr bewältigt werden kann, kommt es zunehmend zu einem Gefühl des Ausgebranntseins bis hin zur Entwicklung einer Depression mit Hoffnungslosigkeit und Suizidgedanken. Der Schriftsteller Eugen Roth hat den Verlauf eines Burnout Syndroms treffend in einem Gedicht formuliert: „Ein Mensch sagt, und ist stolz darauf, er gehe ganz in seiner Arbeit auf. bald aber, nicht mehr ganz so munter, 34 geht er in seiner Arbeit unter.“ Eugen Roth Typische Symptome bei zunehmendem Burnout sind: • in der Anfangsphase: Überengagement • zunehmende psychische Erschöpfung • Abnahme der Arbeitslust, „innere Kündigung“ • Gefühle des Versagens • aggressive Verhaltensweisen • Vorwurfshaltung • destruktives Kritikverhalten • negativistische Einschätzungen • psychosomatische Symptome: Verspannungsgefühl der Muskulatur, Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden (Übelkeit, Krämpfe), Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, Schlafprobleme • erhöhte Anfälligkeit gegenüber Infekten • Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Gefühl der Sinnlosigkeit, Suizidgedanken In einer Untersuchung von Rösing (2003) fanden sich die höchsten Prävalenzraten für Burnout bei Pflegekräften: Häufigkeit von Burnout (Rösing 2003) Deutsche Lehrer 30-35% Deutsche Pflegende 40-60% Deutsche Ärzte 15-30% Auslöser eines Burnout-Syndroms sind häufig äußere Stressoren (z. B. Lärm) oder innere Stressoren (z. B. Gefühl der Überforderung). Psychologischer Stress bezieht sich auf eine Beziehung mit der Umwelt, die vom Individuum im Hinblick auf sein Wohlergehen als bedeutsam bewertet wird, aber zugleich Anforderungen an das Individuum stellt, die dessen Bewältigungsmöglichkeiten beanspruchen oder überfordern (Lazarus 1991). Faktoren in der Arbeitswelt, die mit negativem Stress verbunden sind und somit ein erhöhtes Risiko für Burnout darstellen, sind nach Jaggi (2008): 35 • Langzeitarbeitslosigkeit • übermäßiger Leistungsdruck • geringe soziale Unterstützung im beruflichen und privaten Umfeld • hohe Wochenarbeitszeiten • extrem unregelmäßige Arbeitszeiten • destruktive Konflikte mit Vorgesetzten und Kollegen (Mobbing) • Druck durch fordernde Kunden • Unsicherheit betr. Arbeitsplatz Stressempfinden und körperliche Beschwerden nehmen in Abhängigkeit des geforderten Arbeitstempos zu. Nach der 3. Europäischen Befragung zu Arbeitsbedingungen in 27 Ländern berichteten 56% der Erwerbstätigen, dass ihre Tätigkeit mit einem sehr hohen Arbeitstempo verbunden sei und 28% empfanden eine hohe Stressbelastung (Paoli u. Merllié 2001). Ähnliche Daten erbrachte die 4. Europäische Befragung zu Arbeitsbedingungen (ParentThirion et al. 2007) Tab. Rücken- und Muskelschmerzen in Abhängigkeit von berichtetem Stress (Parent-Thirion et al. 2007 in: Fourth European Working Conditions Survey) Angaben Stress Kein Stress zu Rückenschmerzen 11,2% Muskelschmerzen Stress 71,1% 68,4% Gesamt 25,6% 23,8% 9,1% Mit der Zunahme von Arbeitstempo und Zeitdruck hat in den vergangenen Jahren in Deutschland auch die Prävalenz von Burnout zugenommen (BPtK 2012). 36 Abb. Burnout (Z73): AU-Fälle pro 100 Versichertenjahre (BPtK 2012) Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK 2012) hat die Daten der großen gesetzlichen Krankenkassen zur Arbeitsunfähigkeit (AU) wegen psychischer Erkrankungen analysiert. Danach haben sich die AU-Fälle wegen Burnout von 2004 bis 2011 verachtfacht. Allerdings ist die Zahl der Krankschreibungen wegen Burnout im Vergleich zur Rate der AU-Fälle wegen anderer psychischer Störungen vergleichsweise niedrig (siehe Kapitel 1.7.2). Obwohl Burnout nach ICD-10 kein eigenständiges Krankheitsbild ist, wird die Diagnose von den Ärzten in den letzten Jahren häufiger gestellt. Das dürfte Ausdruck einer gestiegenen Sensitivität der Ärzte für berufliche Belastungen und Beanspruchungen und deren psychische Folgen sein (BPtK 2012). 37 1.7.2 Psychische Störungen und Arbeitsunfähigkeit Die Analyse der Daten der gesetzlichen Krankenkassen durch die Bundespsychotherapeutenkammer zeigt, dass sich die Zahl der Krankschreibungen wegen psychischer Störungen von 2000 bis 2010 verdoppelt hat. Sowohl die AU-Fälle als auch die Fehltage wegen psychischer Erkrankungen haben insgesamt deutlich zugenommen (BPtK 2011). Auch 2011 hat sich dieser Trend fortgesetzt (BPtK 2012). Abb. Psychische Erkrankungen und Arbeitsunfähigkeit: Fehltage pro 100 Versicherte in den angegebenen Jahren (Quelle: BPtK 2011) Da sich die Dauer der Krankschreibung über die Jahre hinweg nur wenig geändert hat, geht die Zunahme der Fehltage auf eine Zunahme der AU-Fälle zurück. 38 Abb. Durchschnittliche Dauer einer Krankschreibung aufgrund psychischer Erkrankungen in Tagen (Quelle: BPtK 2012) Durchschnittlich beträgt die Krankschreibung bei psychischen Erkrankungen drei bis sechs Wochen und liegt damit deutlich höher als bei den meisten körperlichen Erkrankungen. Beispielsweise fällt ein Arbeitnehmer wegen einer Atemwegserkrankung im Schnitt nur etwa eine Woche aus. Während sich die Zahl der AU-Fälle mit psychischen Erkrankungen in verschiedenen Altersgruppen nur geringfügig unterscheidet, nimmt die Anzahl der Fehltage mit zunehmendem Alter deutlich zu (BPtK 2011). 39 Abb. AU-Tage/100VJ durch psychische Erkrankungen nach Altersgruppe für das Jahr 2009 (Quelle: BPtK 2011) Die häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit wegen psychischer Erkrankungen sind bei allen Krankenkassen Depressionen und Anpassungsstörungen. Im Vergleich dazu ist die Zahl der Krankschreibungsfälle wegen Burnout relativ niedrig: auf 2,1 AU-Fälle wegen Depression kommen 0,4 Fälle wegen Burnout (BPtK 2012). Die mittlere Dauer der Krankschreibungen wegen Burnout entspricht aber der AU-Dauer bei psychischen Erkrankungen insgesamt. Sie beträgt 26 Tage, bei Depressionen 39 Tage und bei Anpassungsstörungen 22 Tage (BPtK 2012). Anpassungsstörung: gestörter Anpassungsprozess nach einer einschneidenden Lebensveränderung (schwere Krankheit, Flucht, chronische Überforderung im Beruf) oder nach einem belastenden Lebensereignis (Scheidung, Tod eines nahen Angehörigen); affektive Symptome wie Ängste, depressive Verstimmung, Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit; Dauer meist nicht länger als sechs Monate. 40 Abb. Durchschnittliche Dauer einer Krankschreibung in Tagen bei Burnout, Depressionen und Anpassungsstörungen: AU-Tage/100 Versichertenjahre (Quelle: BPtK 2012) Eine Krankschreibung ausschließlich wegen Burnout erfolgt selten. Bei etwa der Hälfte aller AU-Fälle aufgrund von Burnout lag zusätzlich eine psychische Erkrankung vor, am häufigsten eine Depression oder eine Belastungsreaktion/Anpassungsstörung. Bei weiteren 36% der Krankschreibungsfälle aufgrund von Burnout wurde zusätzlich eine andere Diagnose gestellt, die nicht (eindeutig) dem Bereich psychischer Erkrankungen zuzuordnen war. Meist handelte es sich um unspezifische Beschwerden wie Unwohlsein und Ermüdung, Rückenschmerzen, Schlafstörungen u. a. (BPtK 2012). Grund der Krankschreibungen ausschließlich wegen Burnout könnte die Vorbeugung schwerwiegender psychischer Erkrankungen sein. Nach der Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses haben Ärzte nicht nur bei einer behandlungsbedürftigen Erkrankung die Möglichkeit einer Krankschreibung, sondern auch dann, wenn „aufgrund eines Krankheitszustandes“ (hier Burnout) abzusehen ist, dass durch eine Fortführung der Berufstätigkeit Arbeitsunfähigkeit eintreten würde (Gemeinsamer Bundesausschuss 2006). 41 Auf der anderen Seite wäre es auch möglich, dass bei den AU-Fällen mit ausschließlicher Burnout-Diagnose keine zusätzliche psychische Erkrankung diagnostiziert wurde, um eine Stigmatisierung zu vermeiden. Zusammenfassend macht die Zunahme der Fehlzeiten und der AU-Fälle aufgrund psychischer Erkrankungen deutlich, dass ein Ausbau präventiver Maßnahmen vor allem im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung unabdingbar ist, zumal psychische Erkrankungen auch immer häufiger Grund für eine vorzeitige Berentung sind. In einigen Betrieben wird inzwischen neben der Beurteilung der Gefährdung durch körperliche und Umweltfaktoren auch eine Beurteilung psychischer Belastungen und Fehlbeanspruchungen vorgenommen. Der Leitfaden der DGUV für Betriebsärzte (2010) nennt folgende Indikatoren für psychische Belastungen und Fehlbeanspruchungen: „1. Hohe Unfallzahlen/hohe Arbeitsunfähigkeit/hohe Fluktuation 2. Geringe Qualität der Produkte oder Dienstleistungen/zunehmende Kundenbeschwerden 3. Häufige Störungen des betrieblichen Ab- laufs/Terminschwierigkeiten/häufige Überstunden 4. Reizbare Stimmung im Betrieb / Unzufriedenheit/ Nervosität /Sich „ausgebrannt“ fühlen / Burnout-Syndrom 5. Disziplinarprobleme/Kompetenzgerangel/ aggressives Verhalten / Mobbing /Gewalt“ (DGUV 2010). A4 1.8 Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand Eine Analyse der Beschäftigungssituation von Menschen im Alter zwischen 50 und 64 Jahren in verschiedenen europäischen Ländern hat gezeigt, dass die Rate der berenteten Personen dieser Altersgruppe erheblich variiert: von 8,4% in den Niederlanden bis 47,8% in Österreich (Alavinia u. Burdorf 2008). 42 1.8.1 Erwerbstätigkeit 50+ In Deutschland waren 2009 noch 64% der Männer und 49% der Frauen im Alter von 55 bis 64 Jahren erwerbstätig. Für 95% der erwerbstätigen Männer dieser Altersgruppe und für 85% der Frauen ist Arbeit die Haupteinnahmequelle für den eigenen Lebensunterhalt (Statistisches Bundesamt 2011). Die Mehrheit der älteren Erwerbstätigen war 2009 in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt. Die Rate der Teilzeitbeschäftigten lag mit 28% nur geringfügig über der Teilzeitquote aller Erwerbstätigen (26%). Der Anteil geringfügig oder kurzfristig Beschäftigter unter den älteren Erwerbstätigen entsprach mit 9% dem Durchschnitt. Allerdings zeigten sich sowohl hinsichtlich Teilzeitarbeit als auch hinsichtlich geringfügiger Beschäftigung deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Frauen arbeiteten mit 50% häufiger als Männer (10%) in Teilzeit. Mit 15% waren sie auch deutlich häufiger geringfügig oder kurzfristig beschäftigt als Männer (4%) (Statistisches Bundesamt 2011). Von den 65- bis 74-Jährigen waren 2009 in Deutschland noch 6% erwerbstätig. Für etwa 40% dieser Menschen war die ausgeübte Erwerbstätigkeit die Hauptquelle ihres Lebensunterhalts, für die Übrigen ein Zuverdienst. Jeder zweite Erwerbstätige dieser Altersgruppe war selbstständig oder mithelfender Familienangehöriger. 69% der Erwerbstätigen im Rentenalter übten ihre Tätigkeit in Teilzeit aus (Statistisches Bundesamt 2011). In Anbetracht der demografischen Entwicklung ist davon auszugehen, dass im Jahr 2015 über 30% der Erwerbspersonen 50 Jahre oder älter sein werden (Buck et al. 2002). Tab. Demografische Entwicklung der Erwerbspersonen in 10erKohorten bis 2020 (nach Buck et al. 2002) bis 29-Jährige 30- bis 39-Jährige 40- bis 49-Jährige 50-Jährige und älter 1979 32% 23% 24% 21% 1984 33% 21% 23% 22% 1989 32% 24% 22% 22% 1996 25% 29% 24% 22% 2005 21% 25% 30% 23% 2010 21% 21% 31% 27% 2015 21% 21% 27% 31% Nach dem DAK-Gesundheitsreport 2012 ist die Erkrankungshäufigkeit bei älteren Erwerbstätigen kaum höher als bei jüngeren, aber die Krankheitsdauer ist deutlich länger. In der Altersgruppe der über 60-Jährigen nimmt die 43 2020 20% 23% 23% 34% Erkrankungshäufigkeit ab. Wahrscheinlich ist dies durch den sog. „healthyworker-effect“ zu erklären: gesundheitlich stark beeinträchtigte ältere Arbeitnehmer scheiden über Frühverrentung häufig vorzeitig aus der Erwerbstätigkeit aus, während gesündere länger im Beruf verbleiben (DAKGesundheit 2012). Hauptursachen für Arbeitsunfähigkeit waren 2011 Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems sowie Atemwegserkrankungen. Aber auch Krankschreibungen wegen psychischer Störungen haben zugenommen (BPtK 2011, 2012, DAK-Gesundheit 2012). Bei älteren Erwerbstätigen sind vor allem Erkrankungen des Muskel-Skelettsystems von Bedeutung. Hier ist ein kontinuierlicher Anstieg von 9% bei den 15- bis 19-Jährigen auf 29% bei den über 60-Jährigen zu beobachten (DAK-Gesundheit 2012). Diese Daten machen deutlich, dass es unabdingbar ist, effiziente Präventionsstrategien zu entwickeln, welche die Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer_innen nachhaltig fördern und erhalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die im Alter verfügbaren Ressourcen sowohl durch die frühere Erwerbs- und Bildungsbiografie als auch durch die soziale Herkunft und Rollenvorstellungen geprägt sind. Die Lebenssituationen älterer Menschen in Deutschland sind durch große soziale Ungleichheiten geprägt, da sowohl Vorteile als auch Nachteile im Laufe des Lebens kumulieren. Gegenwärtig finden sich bei geschiedenen und verwitweten Frauen die höchsten Armutsquoten, vor allem dann, wenn geringe Bildungschancen und eine lückenhafte Erwerbsbiografie zusammenkommen. Unabhängig vom Geschlecht sind sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern der EU ältere Menschen mit einem hohen Bildungsabschluss häufiger erwerbstätig als Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss (Brussig 2010, Statistisches Bundesamt 2011). Ältere Hochqualifizierte sind öfter auch vollzeitbeschäftigt als Ältere mit mittlerer oder niedriger beruflicher Qualifikation (Brussig 2010). 44 Abb. Erwerbstätigenquote der 55- bis64-Jährigen 1991 bis 2007 nach Qualifikation (Quelle: Brussig 2010, Berechnung für verschiedenen Jahre nach Mikrozensus) Studien haben auch gezeigt, dass bei Fortsetzung des Bildungsniveaus und der Bildungsaktivitäten bis ins hohe Alter die geistigen Fähigkeiten erhalten werden können. Beschäftigte mit vielen Anregungen zum Lernen und häufiger Konfrontation mit Problemlösungen behalten ihre geistige Flexibilität bis ins Rentenalter (Gatzke 2007). Entsprechende betriebliche Weiterbildungsangebote können somit zum Erhalt einer längeren Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer_innen beitragen. Allerdings stellt das Konzept des „Lebenslangen Lernens“ nur einen Baustein zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit dar. Eine Analyse von Praxisbeispielen mit dem Ziel der Beschäftigungsförderung älterer Arbeitnehmer_innen in verschiedenen europäischen Ländern hat gezeigt, dass folgende Faktoren bei der Umsetzung einer alternsgerechter Personalpolitik von Bedeutung sind: Altersstrukturanalysen im Betrieb, um die eigene Situation besser einschätzen und entsprechende Maßnahmen ableiten zu können 45 Sensibilisierung aller relevanten Akteure für das Thema Altern (Management, Führungskräfte, Betriebsrat, Beschäftigte) Aktive Eibindung der Beschäftigten zur Erhöhung der Veränderungsbereitschaft Gestaltung alternsgerechter Arbeitsbedingungen auf der Basis etablierter Instrumente + Entwicklung neuer, auch ungewöhnlicher Lösungen Nachhaltige Gestaltung von Veränderungen z. B. durch Betriebsvereinbarungen (Nägele u. Sporket 2007) 1.8.2 Frühberentung Psychische Erkrankungen sind inzwischen der häufigste Grund für krankheitsbedingte Frühberentungen. Seit den 80er Jahren hat sich die Gewichtung verschiedener Krankheitsgruppen für das Frühberentungsgeschehen verschoben. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist der Anteil an Frühberentungen wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2003 wurden Männer wie Frauen am häufigsten wegen psychischer Krankheiten früh berentet. Bei Männern ist der Anteil der Frühberentungen wegen psychischer Erkrankungen von etwa 8% im Jahr 1983 auf rund 24% im Jahr 2003 angestiegen, bei Frauen von knapp 10% auf über 35%. Zweithäufigster Grund für Frühberentungen sind sowohl bei Männern als auch bei Frauen Erkrankungen des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (Rehfeld 2006). In den vergangenen Jahren ist der Anteil an Erwerbsminderungsrenten wegen psychischer Erkrankungen weiter gestiegen. 46 Abb. Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bei Männern und Frauen nach ausgewählten Diagnosegruppen (Quelle Hoffmann & Hofmann 2008) Im Jahr 2007 stellten psychische Erkrankungen mit einem Anteil von 28,7% bei Männern und 38,7% bei Frauen die häufigste Diagnosegruppe für die Frühberentung dar. Die steigenden Anteilswerte ergeben sich, bei relativ geringen Schwankungen in den absoluten Zahlen der Frühberentung wegen psychischer Störungen, aus einer rückläufigen Entwicklung der absoluten Fallzahlen für die Erwerbsminderungsrenten insgesamt (Hoffmann & Hofmann 2008). Affektive Störungen sind bei Männern mit 7,7% und bei Frauen mit 16,6% die wichtigste Untergruppe innerhalb der psychischen Erkrankungen, die zur Frühberentung führen. Am zweithäufigsten waren bei Männern die Suchterkrankungen mit 5,8%. 47 Hauptursache für die zunehmende Bedeutung psychischer Erkrankungen für die Frühberentung dürfte die Zunahme psychosozialer Belastungen in der Arbeitswelt sein. Daneben könnte auch die zunehmende Enttabuisierung affektiver Störungen eine Rolle spielen, insofern, dass bei vorliegender Erwerbsminderung als Hauptdiagnose heutzutage eher eine „Depression“ angegeben wird (Hoffmann & Hofmann 2008, Rehfeld 2006) Nach aktuellen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung wurden im Jahr 2010 bundesweit fast 71.000 Männer und Frauen wegen psychischer Erkrankungen vor Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren berentet. 39,3% der insgesamt 181.000 Fälle verminderter Erwerbsfähigkeit waren durch seelische Störungen verursacht. Frühberentungen aufgrund psychischer Erkrankungen erfolgen zunehmend in einem jüngeren Alter. Während 1980 das Durchschnittsalter aller erwerbsund berufsunfähigen Neurentner 56 Jahre betrug, lag es 2010 bei 50 Jahren und bei denjenigen, die wegen einer psychischen Erkrankung vorzeitig berentet wurden, bei 48,3 Jahren (Deutsche Rentenversicherung 2012). Entsprechend dem Grundsatz „Reha vor Rente“ hat auch bei ambulanten und stationären Rehabilitationsmaßnahmen der Anteil psychisch Kranker in den vergangenen Jahren zugenommen. 2010 erhielten fast eine Million Menschen von der Rentenversicherung Reha-Maßnahmen. Bei etwa 177.000 Männern und Frauen war der Grund für diese Maßnahme eine psychische Erkrankung. Gegenüber dem Vorjahr waren es 11.000 Personen mehr. Bei Frauen sind psychische Erkrankungen mit 20% die dritthäufigste Ursache für eine stationäre medizinische Rehabilitation. Bei Männern ist der Anteil mit 11% geringer, aber stationäre Entwöhnungsbehandlungen wegen einer Suchterkrankung sind mit 9% gut viermal so häufig wie bei Frauen (Deutsche Rentenversicherung 2012). 84% der psychisch Erkrankten schaffen es durch Rehabilitationsmaßnahmen, ihre Leistungsfähigkeit wieder zu verbessern und ins Berufsleben zurückzukehren (Deutsche Rentenversicherung 2012). A5 48 2 Arbeitslosigkeit und Gesundheit bei älteren Menschen Nach § 16 SGB III sind Arbeitslose Personen, die „vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen (Beschäftigungslosigkeit) eine versicherungspflichtige Beschäftigung suchen und dabei den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit zur Verfügung stehen (Verfügbarkeit) und sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet haben“ (Weber et al. 2007b) Langzeitarbeitslose sind nach § 18 SGB III Personen, die mindestens ein Jahr arbeitslos sind. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Arbeitslosen nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit um etwa ein Fünftel gesunken. Der Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit war im gleichen Zeitraum mit zwei Fünfteln noch deutlicher (Bundesagentur für Arbeit 2012). Im Jahr 2012 sank die durchschnittliche Zahl der Erwerbslosen auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren, allerdings ging die Zahl der offenen Stellen Ende des Jahres zurück (Bundesagentur für Arbeit 2013). Das Risiko für Langzeitarbeitslosigkeit wird vor allem durch ein Alter über 50 Jahre und eine fehlende Berufsausbildung erhöht. 2011 waren nur acht Prozent der arbeitslosen Jugendlichen, aber 45 Prozent der arbeitslosen Älteren langzeitarbeitslos (Bundesagentur für Arbeit 2012) Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde ein Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und vermehrten Gesundheitsproblemen beschrieben. 1933 veröffentlichte die Soziologin Marie Jahoda-Lazarsfeld die Daten ihrer Untersuchung zum Gesundheitszustand bei Langzeitarbeitslosen in Marienthal. Ihre Untersuchungsergebnisse machen deutlich, dass Arbeitslosigkeit nicht nur zu finanziellen Einbußen führt, sondern erhebliche negative Auswirkungen auf Gesundheit und soziale Beziehungen hat (Jahoda-Lazarsfeld et al. 1975). Mit dem Verlust der Arbeit gehen Verluste fester Zeitstrukturen 49 und außerfamiliäre Kontakte zu Kollegen und Kolleginnen verloren. Das an den Beruf gebundene soziale Prestige verringert sich, vor allem dann, wenn über eine längere Zeit keine Wiedereingliederung gelingt. Diese psychosozialen Belastungen können zu gesundheitsriskantem Verhalten und zu Gesundheitsproblemen führen. Die Arbeitslosenquote lag zwar 2011 in Deutschland mit 7,1% niedrig, aber auch Personen mit einer prekären Beschäftigung leiden unter erhöhten psychosozialen Belastungen und Gesundheitsrisiken. Prekäre Beschäftigung = Arbeitsverhältnisse mit niedrigen Löhnen, die meist nicht auf Dauer und Kontinuität angelegt sind, keine Absicherung durch die Sozialversicherung aufweisen und nur geringe arbeitsrechtliche Schutzrechte beinhalten. 2.1 Subjektiver Gesundheitszustand Arbeitsloser Arbeitslose Männer und Frauen schätzen ihren allgemeinen Gesundheitszustand häufiger als „weniger gut“ oder „schlecht“ ein (23%) als Berufstätige (11%) (Grobe u. Schwartz 2003). Das psychische Wohlbefinden von prekär beschäftigten und arbeitslosen Frauen und Männern liegt deutlich unter den altersspezifischen Referenzwerten einer psychisch gesunden Bevölkerung von 50 Punkten (Kroll 2011). Abb. Vitalität und psychisches Wohlbefinden (SF-36) nach Erwerbssituation und Geschlecht (Kroll 2011: Datenbasis GEDA 2010) 50 Arbeitslose und prekär Beschäftigte leiden auch häufiger als Gesunde unter körperlichen und seelischen Beschwerden und sind dadurch bei Alltagsaktivitäten beeinträchtigt. Bei arbeitslosen Frauen, die weniger als ein Jahr arbeitslos sind, ist die Anzahl der Tage mit körperlichen Beschwerden im Vergleich zu sicher beschäftigten Frauen um 63% erhöht, bei arbeitslosen Männern um 83% (Kroll 2011: Datenbasis GEDA 2010). 2.2 Gesundheitsverhalten und Risikofaktoren Das Robert Koch Institut führte 1998 eine Bevölkerungsbefragung zum Gesundheitszustand durch, in die Frauen und Männer im Alter von 20 bis 59 Jahren einbezogen waren, die zum Zeitpunkt der Befragung mindestens 15 Stunden wöchentlich berufstätig oder arbeitslos gemeldet waren. Arbeitslose berichteten deutlich schlechtere Lebensbedingungen als Berufstätige (Grobe u. Schwartz 2003). Tab. Lebensbedingungen bei Arbeitslosen und Berufstätigen (Grobe u. Schwartz 2003) Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2000 DM vormals als ungelernte oder angelernte Arbeiter tätig Hauptverdiener: Männer Frauen dezentrale Kohle- oder Holzbehei- Arbeitslose Berufstätige 40% 7% 25% 12% 53% 27% 82% 35% 51 zung Lärmbelastung in Wohnung oder Haus Wohnen an stark befahrener Straße 8,7% 4,5% 45% 34% 37% 22% Bei Arbeitslosen findet sich häufiger ein ungesunder Lebensstil als bei Beschäftigten. Insbesondere länger andauernde Arbeitslosigkeit ist häufig verbunden mit körperlicher Inaktivität, ungesundem Ess- und Schlafverhalten, einem verstärkten Alkohol- und Nikotinkonsum sowie einem sozialem Rückzug (Turtle und Ridley 1984). Sowohl arbeitslose Männer als auch arbeitslose Frauen rauchen häufiger und stärker als Vollzeitbeschäftigte. Nach dem Bundesgesundheitssurvey 1998 rauchten arbeitslose Männer mit 49% deutlich öfter täglich als berufstätige Männer (34%). Bei den Frauen zeigten sich dagegen nur geringe Unterschiede: 31% der arbeitslosen und 28% der berufstätigen Frauen gaben an, täglich zu rauchen (Grobe u. Schwartz 2003). Auch nach den aktuellen Daten zur Gesundheit in Deutschland (GEDA 2010) rauchen Arbeitslose häufiger und häufiger stark als Erwerbstätige, während das Rauchverhalten von prekär Beschäftigten mit dem der Erwerbstätigen vergleichbar ist (Kroll 2011). Abb. Rauchquote nach Erwerbsstatus und Geschlecht (Kroll 2011: Datenbasis GEDA 2010) 52 Der Anteil von Personen, die Alkohol in potentiell schädigenden Mengen tranken, war dagegen bei Arbeitslosen und Berufstätigen vergleichbar. Die Angaben zu Ernährungsgewohnheiten deuten auf eine preisbewusste Ernährung bei Arbeitslosen hin, ohne dass sich daraus konkrete Hinweise auf erhöhte gesundheitliche Risiken ableiten lassen. Arbeitslose gaben im Vergleich zu Berufstätigen einen höheren Konsum von kohlehydratreichen Grundnahrungsmittel an (gekochte Kartoffeln, Graubrot, Weißbrot) sowie von fettreduzierten Brotaufstrichen und Margarine. Keine Unterschiede fanden sich bezüglich des Konsums von Milchprodukten, Fleisch, rohem Gemüse und Obst (Grobe u. Schwartz 2003). Sowohl arbeitslose Frauen als auch arbeitslose Männer gaben seltener an, mindestens eine Stunde pro Woche Sport zu treiben als Berufstätige (30% versus 40%). Bezüglich des Körpergewichts zeigten sich dagegen deutliche Geschlechtsdifferenzen: Arbeitslose Männer sind mit 4,9% häufiger untergewichtig als berufstätige (1,1%). Arbeitslose Frauen sind dagegen häufiger stark übergewichtig bzw. adipös als berufstätige (23% versus 15%). 2.3 Erkrankungen und Mortalität bei Arbeitslosen In den vergangenen Jahrzehnten haben viele Studien belegt, dass Arbeitslose im Vergleich zu Erwerbstätigen einen schlechteren Gesundheitszustand haben (Berth et al. 2009, Brenner 1979, Elkeles u. Seifert 1993, Grobe u. Schwartz 2003, Hollederer u. Brand 2006, Lampert 2011, Paul et al. 2006, Rose u. Jacobi 2006, Weber u. Lehnert 1997). Nach dem Bundesgesundheitssurvey 1998 waren arbeitslose Männer häufiger erkrankt als berufstätige. Statistisch signifikante Unterschiede ergaben sich bei ambulanten Behandlungen für folgende Erkrankungen: - Durchblutungsstörungen des Gehirns mit Lähmungen oder Gefühlsstörungen - Durchblutungsstörungen der Beine - chronische Bronchitis - Leberzirrhose - Epilepsie - Psychische Erkrankungen - Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen 53 Abgesehen von der chronischen Bronchitis lagen die Häufigkeitsraten jedoch auch bei den stärker von Krankheit betroffenen Arbeitslosen jeweils unter 10%. Arbeitslose Frauen in ambulanter ärztlicher Behandlung waren lediglich von „Durchblutungsstörungen der Beine“ häufiger betroffen als berufstätige (Grobe u. Schwartz 2003). Die Auswertung von Routinedaten der Gmünder Ersatzkasse (GEK) ergab, dass Arbeitslosigkeit mit einer deutlich erhöhten Inanspruchnahme stationärer Krankenhausleistungen, insbesondere wegen psychischer Störungen, einhergeht. Arbeitslose Männern verbringen etwa siebenmal mehr Tage zur Behandlung einer psychischen Störung im Krankenhaus als berufstätige. Von besonderer Bedeutung sind dabei Behandlungen im Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch: 14,3% aller Krankenhaustage arbeitsloser Männer entfallen auf die Diagnose „Verhaltensstörungen durch Alkohol“. Des Weiteren finden sich auch Schizophrenien, Belastungsreaktionen sowie Depressionen bei arbeitslosen Männern häufiger als bei berufstätigen (Grobe u. Schwartz 2003). Auch arbeitslose Frauen zeigen im Vergleich zu Berufstätigen eine höhere Inanspruchnahme von Krankenhausleistungen. Für Krankenhaustage bedingt durch psychische Störungen beträgt das Verhältnis von arbeitslosen zu berufstätigen Frauen etwa 3:1. Diagnosen im Zusammenhang mit Substanzmissbrauch sind für etwa 12% der Differenz zu den Berufstätigen verantwortlich. Von Bedeutung sind außerdem Ess- und Persönlichkeitsstörungen. Im Vergleich zu Berufstätigen finden sich bei arbeitslosen Frauen außerdem doppelt so viele schwangerschaftsbedingte Krankenhaustage (Grobe u. Schwartz 2003). Auch die Daten des BKK-Gesundheitsreports zeigen, dass arbeitslose Männer und Frauen deutlich häufiger an psychischen Erkrankungen leiden als beschäftigte (BKK 2009). Abb. Krankenhausfälle nach ICD-Hauptgruppen (Quelle BKK Gesundheitsreport 2009) 54 Mit 20% haben Arbeitslose eine deutlich höhere Depressionsprävalenz als Vollzeitbeschäftigte mit 9,1% (Jacobi et al. 2004). Arbeitslose Frauen erhalten die meisten Antidepressiva (BKK Gesundheitsreport 2009, Techniker Krankenkasse 2010). Da die Prävalenz von depressiven Störungen und Alkoholproblemen bei Arbeitslosen hoch ist, soll im Folgenden auf diese Erkrankungen näher eingegangen werden. 55 A6 2.3.1 Depressive Störungen Depressionen gehören zu den affektiven Störungen. Das ist eine Gruppe psychischer Erkrankungen, die durch Störungen von Stimmung und Gefühlen (Emotionalität) sowie abnorme Affekte charakterisiert sind. Stimmung: Gesamtlage des Gefühlszustandes über einen längeren Zeitraum Affekte: kurzdauernde, umschriebene Gefühle (Gefühlswallungen) wie Ärger, Wut, Begeisterung Gefühle (Emotionen): einzelne länger anhaltende Gefühle wie Trauer, Zuneigung, Wohlbehagen, Erschöpfung Hauptsymptome depressiver Störungen sind eine über einen längeren Zeitraum anhaltende gedrückte Stimmung mit Interessenlosigkeit und Antriebsminderung. Das Denken ist verlangsamt und häufig kreisen die Gedanken immer wieder um belastende Themen (Grübelneigung). Aufmerksamkeit und Konzentration sind vermindert. Depressive Menschen leiden meist auch unter starken Selbstzweifeln sowie ausgeprägten, unangemessenen Schuldgefühlen. Es können wiederkehrende Gedanken an den Tod oder Suizid auftreten bis hin zu suizidalem Handeln. Zusätzlich zu psychischen Symptomen treten häufig verschiedene körperliche Beschwerden auf wie Schlafstörungen, Appetitverlust oder gesteigerter Appetit mit entsprechender Gewichtsveränderung (DGPPN 2012). Nach ICD-10 (siehe Kapitel 3.1 ) wird eine leichte depressive Episode von einer mittelgradigen und einer schweren depressiven Episode abgegrenzt. Menschen mit einer mittelgradigen oder schweren depressiven Episode gelingt es kaum oder gar nicht, ihre alltäglichen Aufgaben zu bewältigen. Therapie Zur Behandlung depressiver Störungen werden vor allem psychotherapeutische Verfahren und medikamentöse Therapien mit Antidepressiva eingesetzt. 56 Epidemiologie Nach einer Studie der WHO zählen depressive Störungen zu den wichtigsten Volkskrankheiten und werden in den nächsten Jahren noch deutlich an Bedeutung zunehmen (Lopez et al. 2006). Etwa 15 bis 20% der Gesamtbevölkerung erkranken im Laufe ihres Lebens an einer Depression (Lebenszeitprävalenz), wobei Frauen häufiger als Männer betroffen sind. Ätiologie und Pathogenese Zwillingsstudien sprechen dafür, dass genetische Faktoren für die Entstehung depressiver Störungen eine mitverursachende Rolle spielen. Neuere Untersuchungen weisen darauf hin, dass Gene, die die Ausschüttung von Botenstoffen (Neurotransmitter) im Gehirn, insbesondere den Serotoninstoffwechsel, steuern, zu einer Prädisposition für die Entstehung depressiver Störungen führen. Nach dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell tritt die Erkrankung aber erst im Zusammenspiel mit Auslösefaktoren wie körperlichen Erkrankungen oder psychosozialen Faktoren (z. B. Verlust naher Angehöriger, Trennungen, berufliche Enttäuschungen, Überforderungen, interpersonelle Konflikte, mangelnde soziale Unterstützung usw.) auf (DGPPN 2012). Verlauf und Prognose Depressive Störungen verlaufen häufig in Phasen, können aber auch chronifizieren. Prognostisch ungünstig sind psychiatrische oder somatische Begleitkrankheiten (Komorbidität), junges Alter bei Ersterkrankung, weibliches Geschlecht sowie ein Mangel an sozialer Integration oder Unterstützung (DGPPN 2012). 2.3.2 Posttraumatische Verbitterungsstörung(Posttraumatic Embit- terment Disorder, PTED) Die Posttraumatische Verbitterungsstörung zählt zu den Anpassungsstörungen, die nach einschneidenden, belastenden Lebensereignissen auftreten können. Sie wurde erstmals von M. Linden, einem Psychiater an der Berliner Charité, als eigenständiges Krankheitsbild beschrieben. Charakteristisch für die Störung ist eine bleibende Verbitterung nach einem kränkenden Erlebnis, das wesentliche Sinn stiftende Grundanschauungen einer Person grob verletzt. Verbitterung entsteht dabei meist aus Gefühlen und Gedanken der Ungerechtigkeit, Herabwürdigung, Enttäuschung und Benachteiligung zusammen mit dem Impuls sich zu rächen. Die Symptomatik ähnelt der einer De57 pression, aber im Gegensatz zu dieser ist bei der PTED die affektive Schwingungsfähigkeit nicht gestört. Die häufigsten Auslöser für eine PTED sind Arbeitsplatzverlust (38%) und Konflikte am Arbeitsplatz (25%) (Linden 2004). Kernkriterien für eine PTED sind nach Linden (2004) die folgenden Merkmale: „1. Es ist ein einmaliges schwerwiegendes negatives Lebensereignis zu identifizieren, in dessen Folge sich die psychische Störung entwickelt hat. 2. Dem Patienten ist dieses Lebensereignis bewusst, und er sieht seinen Zustand als direkte und anhaltende Konsequenz aus dem Ereignis. 3. Der Patient erlebt das kritische Lebensereignis als “ungerecht”. 4. Wenn das kritische Ereignis angesprochen wird, reagiert der Patient mit Verbitterung und emotionaler Erregung. 5. Der Patient berichtet wiederholte intrusive Erinnerungen an das Ereignis. Teilweise ist es ihm sogar wichtig, nicht zu vergessen. 6. Die emotionale Schwingungsfähigkeit ist nicht beeinträchtigt. Der Patient zeigt normalen Affekt, wenn er abgelenkt wird oder kann beim Gedanken an Rache lächeln. 7. Es trat keine manifeste psychische Störung im Jahr vor dem kritischen Lebensereignis auf. Der gegenwärtige Zustand ist kein Rezidiv einer vorbestehenden psychischen Erkrankung.“ Viele Patienten und Patientinnen mit einer posttraumatischen Verbitterungsstörung zeigen ein Vermeidungsverhalten (81%), d. h. sie meiden Ort und/oder Situationen, an denen das kränkende Lebensereignis aufgetreten ist. Falls sie noch erwerbstätig sind, zeigt sich meist eine Beeinträchtigung der Arbeit, außerdem finden sich Beeinträchtigungen im Freizeitverhalten (65%) und in ihren familiären Beziehungen (57%) (Linden 2004). 2.3.3 Alkoholmissbrauch, Alkoholabhängigkeit Alkohol ist die am häufigsten missbrauchte Substanz, da er zu den legalen Drogen gehört und leicht zu beschaffen ist. Gesundheitsprobleme durch übermäßigen Alkoholkonsum können akut auftreten (Rausch, Intoxikation) oder sich chronisch entwickeln (Alkoholabhängigkeit mit Folgeerkrankungen). 58 Nach dem Drogenbericht der Drogenbeauftragten der Bundesregierung (2012) trinken ca. 9,5 Millionen Menschen in Deutschland Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. „Etwa 1,3 Millionen gelten als alkoholabhängig und jedes Jahr sterben über 73.000 Menschen an den Folgen ihres Alkoholmissbrauchs“ (Drogenbeauftragte der Bundesregierung 2012). Etwa ein Drittel der Alkoholabhängigen sind Frauen, zwei Drittel Männer (Drogenbeauftragte der Bundesregierung 2011). In Konflikt- oder Belastungssituationen wird Alkohol nicht selten zur Spannungsreduktion eingesetzt. Insbesondere Männern dient der Alkoholgebrauch als Stimulations- und Kompensationsmittel gegenüber Leistungsanspruch sowie Kampf- und Konkurrenzbereitschaft. Nach Stöver (2006) dient Alkoholgebrauch als „Coping-Strategie traditioneller Männlichkeit: Verdrängen, Abspalten und Abschotten“. Coping = adaptives Verhalten, abgeleitet von dem englischen Begriff „to cope with“ = „bewältigen, überwinden“ Coping-Strategien = Bewältigungsstrategien Ob sich aus einem Alkoholgebrauch als Bewältigungsverhalten eine Abhängigkeit entwickelt hängt von multiplen Faktoren ab: genetischen Prädispositionen, dem materiellen und sozialen Umfeld, einem geringen Selbstwertgefühl und einer verminderten Frustrationstoleranz. In einer Studie von Möller-Leimkühler et al (2002) wurden ausgeprägte Depressivität, geringes Selbstwertgefühl, geringe Anpassungsfähigkeit und geringe Lebenszufriedenheit als spezifische Risikofaktoren für Alkoholabhängigkeit identifiziert. Eine wichtige Rolle spielt auch das Eingebundensein in Subkulturen oder bestimmte Peergroups, die ihren Mitgliedern substanzfreundliche Normen vermitteln sowie Gruppenkohäsion und eine stützende Identität. Nach ICD-10 liegt ein Abhängigkeitssyndrom vor, wenn drei oder mehr der folgenden Kriterien mindestens seit einem Monat bestehen: starkes Verlangen oder eine Art Zwang, die Substanz zu konsumieren verminderte Kontrolle über den Substanzgebrauch 59 körperliche Entzugssymptome, wenn die Substanz reduziert oder abgesetzt wird Toleranzentwicklung, Steigerung des täglichen Konsums Einengung der Interessen auf den Substanzgebrauch, Vernachlässigung sozialer Kontakte anhaltender Substanzgebrauch trotz schädlicher Folgen Jellinek (1952) beschreibt die Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit in vier Phasen: Präalkoholische Phase: Spannungsreduktion durch Alkohol, häufiges Trinken, leichte Toleranzerhöhung ohne Abhängigkeit Prodromalphase: regelmäßiges Erleichterungstrinken, Räusche mit Erinnerungslücken, heimliches Trinken, dauerndes Denken an Alkohol, Toleranzsteigerung, noch kein Kontrollverlust Kritische Phase: vergebliche Versuche der Abstinenz, Toleranzabnahme, Kontrollverlust, soziale Folgen (Verlust von Freunden, Verlust des Arbeitsplatzes), Interessenverlust, Stimmungsschwankungen, Selbstvorwürfe, Verminderung des Sexualtriebs; zunächst psychische Abhängigkeit, später auch physische Abhängigkeit Chronische Phase: tagelange Räusche, Denkbeeinträchtigungen, psychomotorische Störungen, Trinken auch mit Personen eines niedrigen Sozialstatus Behandlung Ziel der Behandlung von Alkoholabhängigen ist die Abstinenz. Kontrolliertes Trinken ist in der Regel wegen des Kontrollverlusts nicht dauerhaft zu erreichen. Die Therapie beginnt mit der Entzugsbehandlung (meist stationär), an die sich eine Entwöhnungsbehandlung anschließt, die meist mehrere Wochen oder Monate dauert. In der Nachsorgephase erfolgt häufig eine Unterstützung der Betroffenen durch Selbsthilfegruppen (Anonyme Alkoholiker, Blaues Kreuz, Guttempler) oder Suchtberatungsstellen. Alkoholkonsum und Erwerbstätigkeit In bestimmten Tätigkeitsfeldern bzw. Berufen kommt der Konsum von Suchtstoffen, insbesondere von Alkohol besonders häufig vor. Dies sind 60 nach Feuerlein (1995) „Berufe mit spezifischer Belastung in verschiedener Hinsicht: instrumentell (z. B. Arbeitsanfall, Arbeitstempo, Schichtarbeit) sozioemotional (Kontrolle, Konkurrenz, Eintönigkeit) frustrierend (geringer Verdienst, schlechte Aufstiegschancen) fehlende „Dispositionsspielräume“ bei der Arbeit Umfang und Art sozialer Kontakte bei der Arbeit.“ Die besondere Gefährdung bestimmter Berufe kann auch nach dem Konzept der Berufe mit „hohem Opportunitätsbudget“ erklärt werden (Gundel 1980). Danach besteht ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit in Tätigkeiten oder Berufen, die durch folgende Merkmale charakterisiert sind: relativ niedriges Qualifikationsniveau traditioneller Alkoholkonsum während der Arbeit hohes Maß an Verhaltensautonomie Rollenunterlastung Inkompetenz von Kontrollinstanzen Zusammenfassend können negative Bedingungen und Lebensereignisse im Arbeitsumfeld wie Mobbing, Überforderung, Unterforderung, oder (drohende) Entlassung einen verstärkten Alkoholkonsum begünstigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass häufig zirkuläre Probleme bestehen. Durch eine bereits bestehende Alkoholabhängigkeit wird die berufliche Situation in vielerlei Hinsicht ungünstig beeinflusst. Mit zunehmender Dauer der Alkoholsucht kommt es zu Hirnschädigung und Wesensänderung, die zu einer Verlangsamung der Psychomotorik, zu einer Beeinträchtigung des Denkvermögens und zu Konzentrationsstörungen führen. Dadurch kommt es sowohl zu qualitativen als auch zu quantitativen Leistungseinbußen. Gleichzeitig entwickelt sich ein erhöhtes Unfallrisiko und die Betroffenen bleiben vermehrt unentschuldigt der Arbeit fern. Daraus ergeben sich häufig zwischenmenschliche Spannungen und Konflikte. Über einen meist kaskadenförmig fortschreitenden Desintegrationsprozess kommt es zum beruflichen und sozialen Abstieg (Feuerlein 1995). 61 A7 2.3.4 Mortalität Auch unter gleichzeitiger Kontrolle für Alter und Geschlecht lassen sich signifikante Einflüsse der Arbeitslosigkeit auf die Mortalität nachweisen. Bereits bei Kurzzeitarbeitslosigkeit von weniger als sechs Monaten innerhalb von drei Jahren fand sich in den Folgejahren eine 1,4-fach erhöhte Mortalität (OR = 1,39; 95%-Konfidenzintervall: 1,14-1,69). Bei Arbeitslosigkeit von einem bis unter zwei Jahren war das Mortalitätsrisiko zweifach und bei Arbeitslosigkeit von zwei oder mehr Jahren 3,8-fach erhöht (OR = 3,8; 95%Konfidenzintervall: 3,26-4,50) im Vergleich zu Beschäftigten (Grobe 2006). 2.4 Dauer der Arbeitslosigkeit und Gesundheit Untersuchungen haben gezeigt, dass die Zeiten mit Beeinträchtigung der körperlichen Gesundheit, des seelischen Befindens und der Ausübung der Alltagsaktivitäten mit der Dauer der Arbeitslosigkeit zunehmen (Kroll u. Lampert 2012). Langzeitarbeitslosigkeit führt nicht nur zu finanziellen Einbußen, sondern auch zu sozialer Ausgrenzung, d. h. zu Deklassierung und Isolation. Anhaltende Arbeitslosigkeit geht mit einer zunehmenden Verschlechterung von Teilhabechancen einher. Neben einer starken materiellen Benachteiligung kommt es dadurch zu Identitätsverlust und mangelnder Wertschätzung mit erhöhtem Krankheitsrisiko. Abb. Psychisches Leid und soziale Erfahrungen (nach Mirowsky & Ross 1989) Soziale Position Einkommen Auskommen Beschäftigung Geschlecht Rasse Ethnizität Ehestand Entfremdung Autoritarismus Machtlosigkeit Isolation Selbst-Entfremdung Sinnlosigkeit Inflexibilität Misstrauen Ungerechtigkeit 62 Viktimisierung Ausbeutung Leid Depression Angst Metaanalysen zu Querschnittserhebungen bei Langzeitarbeitslosen zeigen, dass diese eine stärker eingeschränkte psychische Gesundheit haben als Kurzzeitarbeitslose (Paul et al. 2006). Eine Längsschnittuntersuchung ergab, dass eine Kurzzeitarbeitslosigkeit nur für Männer einen signifikanten negativen Einfluss auf die Gesundheitszufriedenheit hatte. Eine Dauer der Arbeitslosigkeit von zwei Jahren oder länger wirkte sich dagegen sowohl für Frauen als auch für Männer negativ auf die Gesundheitszufriedenheit aus. Ein höheres Alter verstärkt den negativen Effekt der Arbeitslosigkeit auf die Gesundheitszufriedenheit: Personen über 50 Jahre beurteilen die Folgen von Arbeitslosigkeit als schwerwiegender. Das dürfte mit den schlechteren Perspektiven älterer Arbeitsloser zusammenhängen (Gordo 2006). Menschen im Alter von 55 bis 64 Jahren sind nicht wesentlich häufiger erwerbslos als Angehörige anderer Altersgruppen. Dieser Personengruppe fällt es jedoch schwer, eine neue Beschäftigung zu finden. In einer Befragung gaben 62% der älteren Erwerbslose an, dass sie bereits mehr als 12 Monate auf Arbeitssuche seien. Insgesamt waren von allen befragten Erwerbslosen nur 46% schon so lange arbeitssuchend (Statistisches Bundesamt 2011). 63 2.5 Modelle des Zusammenhangs von Arbeitslosigkeit und Krankheit Zum Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Gesundheit gibt es zwei Hypothesen: die Kausalitätshypothese, die Arbeitslosigkeit als Ursache für Krankheit betrachtet, die Selektionshypothese oder soziologische Drift-Hypothese, die Krankheit als Ursache für Arbeitslosigkeit sieht. 2.5.1 Kausalitätshypothese Die Kausalitätshypothese geht davon aus, dass Arbeitslosigkeit eine (Mit)Ursache von Krankheit darstellt. Die Gültigkeit dieser Hypothese lässt sich nur schwer überprüfen. Man müsste eine Gruppe von Arbeitslosen mit einer Gruppe von Beschäftigten über einen längeren Zeitraum bezüglich der Inzidenzraten von Erkrankungen vergleichen. Aussagekräftige Ergebnisse würde man nur erhalten, wenn der Gesundheitszustand beider Gruppen vor Eintritt der Arbeitslosigkeit keine signifikanten Unterschiede zeigte. Zusätzlich müssten beide Gruppen bezüglich anderer Faktoren wie Alter, Bildung, Lebensstil etc., die neben der Arbeitslosigkeit einen Einfluss auf die Krankheitsentstehung oder den Verlauf bereits bestehender Erkrankungen haben könnten, vergleichbar sein. Ein weiteres Problem betrifft die zeitliche Verzögerung möglicher Auswirkungen von Arbeitslosigkeit. Soziale Auswirkungen, psychische Reaktionen, Verhaltensänderungen und Befindlichkeitsstörungen treten meist relativ kurzfristig nach Beginn der Arbeitslosigkeit auf. Bei somatischen Erkrankungen wie z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist dagegen von einer Entwicklungsdauer über Jahre auszugehen. 2.5.2 Selektionshypothese, Drifthypothese Die Selektionshypothese nimmt an, dass kränkere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen unter den Wettbewerbsbedingungen einer freien Marktwirtschaft eher entlassen und seltener wieder eingestellt werden. Hinweise auf derartige Selektionseffekte ergeben sich aus mehreren Längsschnittstudien (z. B. Elkeles 2001, Müller u. Heinzel-Gutenbrunner 2001). 64 2.5.3 Circulus vitiosus von Krankheit und/oder Behinderung und Ar- beitslosigkeit Insgesamt betrachtet ist von einem zirkulären Zusammenhang auszugehen, d. h. es besteht ein Teufelskreis zwischen Krankheit und/oder Behinderung und Arbeitslosigkeit. Arbeitsplätze mit hohen physischen und/oder psychomentalen Belastungen erhöhen die subjektiv empfundenen Beanspruchungen und stellen somit langfristig ein Risiko für Gesundheitsschäden dar. Gesundheitliche Einschränkungen oder Behinderungen sind wiederum mit einem erhöhten Risiko verbunden, den Arbeitsplatz zu verlieren. Arbeitslose, die bereits Gesundheitsprobleme haben, weisen eine höhere Vulnerabilität gegenüber den Stressoren der Arbeitslosigkeit auf. Als Folgen ergeben sich eine Verschlimmerung der Gesundheitsprobleme und eine Verzögerung des Wiedereinstiegs in eine Erwerbstätigkeit. Mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit verschlechtern sich wiederum die Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz Im Jahr 2009 betrug der Anteil von schwerbehinderten Personen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Deutschland 5,8%. Der Anteil schwerbehinderter Menschen an Arbeitslosen lag 2011 bei 6,1%. Die Wahrscheinlichkeit einer Schwerbehinderung nimmt mit dem Alter zu. Entsprechend betrug der Anteil schwerbehinderter Menschen an Arbeitslosen der Altersgruppe 55-59 Jahre 12,0%. Bei 60 bis 65-jährigen Arbeitslosen lag der Anteil Schwerbehinderter bei 13,1 % (Bundesagentur für Arbeit 2012). Abb. Schwerbehindertenquote: Anteil der schwerbehinderten Menschen an der jeweiligen Altersgruppe, 31. 12. 2009 in % (Quelle: Statistisches Bundesamt 2011) 65 Behinderung: „Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist“ (SGB IX § 2). Schwerbehinderung: „Menschen sind … schwerbehindert, wenn bei Ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt…“ (SGB IX § 2). Auch wenn die Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung durch gesetzliche Regelungen erleichtert ist, sind die Arbeitslosenzahlen unter den älteren Schwerbehinderten in den letzten Jahren um etwa 7% angestiegen. Das dürfte vor allem mit dem Auslaufen vorruhestandsähnlicher Regelungen seit Januar 2008 (insbesondere nach § 428 SGB III) zusammenhängen (Bundesagentur für Arbeit 2012). A8 3 Medizinische Klassifikationssysteme Um medizinisches Wissen systematisch zu ordnen und eine Vergleichbarkeit von Angaben zu Diagnosen oder therapeutischen Maßnahmen zu erreichen, wurden unter verantwortlicher Federführung der World Health Organisation (WHO) internationale medizinische Klassifikationssysteme eingeführt. In der Bundesrepublik Deutschland werden die gültigen amtlichen Klassifikationen durch das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), eine nachgeordnete Behörde des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), übersetzt und herausgegeben. 3.1 Internationale Klassifikation der Krankheiten und verwand- ter Gesundheitsprobleme (ICD-10) Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (International Statistical Classification of Diseases 66 and related health problems, ICD) ist die bedeutendste international standardisierte Diagnosen-Klassifikation der Medizin. Sie wurde ursprünglich 1893 für eine weltweit standardisierte Todesursachenstatistik entwickelt und wird seit 1948 für die Dokumentation von Krankheitsdiagnosen und gesundheitsbezogenen Problemen genutzt. Etwa alle zehn Jahre erfolgt eine Überarbeitung. Aktuell liegt die ICD in der 10. Revision vor. Bei der ICD handelt es sich um eine einachsige Klassifikation, die sich in 22 Krankheitskapitel gliedert. Die Notation ist alphanumerisch, d. h. an erster Stelle steht ein Buchstabe für die jeweiligen Krankheitskapitel (z. B: F Psychische und Verhaltensstörungen) gefolgt von zwei bis maximal vier Ziffern für Krankheitsgruppen und Krankheitsklassen. Beispiel: F30-F39 Affektive Störungen F33.1 rezidivierende depressive Störung aktuell leichte depressive Episode Die ICD-10 wird sowohl für die Dokumentation und Kommunikation in der ambulanten und stationären individuellen medizinischen Versorgung als auch für die Evaluation im Gesundheitswesen (quantitative Auswertungen, Statistiken, Vergleiche, Analysen) eingesetzt. 3.2 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Be- hinderung und Gesundheit (ICF) Da die ICD lediglich Krankheitsdiagnosen verschlüsselt und keine Aussagen über Auswirkungen der Erkrankungen auf Funktionsfähigkeit, Leistungsbeeinträchtigung und Teilhabe am sozialen Leben zulässt, wurde von der WHO zusätzlich eine Klassifikation für Behinderungen entwickelt. Nach dem deutschen Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX-Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) können Leistungen zur Teilhabe für Personen nur dann erbracht werden, wenn deren Teilhabe am Erwerbsleben oder am sozialen Leben erheblich gefährdet oder bereits gemindert ist. Dieser Leistungsanspruch ist mit dem Teilhabekonzept der ICF und dem dahinter stehenden bio-psycho-sozialen Krankheitsmodell eng verbunden. 67 Die ICF ermöglicht eine umfassende Klassifikation der Auswirkungen einer Krankheit bzw. Behinderung auf die Lebenssituation der Betroffenen. Sie sieht die Beschreibung von Beeinträchtigungen körperlicher und mentaler Funktionen vor, die Erfassung von Aktivitäten und Teilhabe (Partizipation) in verschiedenen Lebensbereichen unter Berücksichtigung von Kontextfaktoren, d. h. von Umweltfaktoren und personenbezogenen Faktoren. Neben krankheitsbedingten Defiziten werden auch die noch vorhandenen Ressourcen von Personen erfasst. 3.2.1 Konzept der funktionalen Gesundheit Im Fokus der ICF steht das Konzept der funktionalen Gesundheit. Danach gilt eine Person als funktional gesund, wenn: „ ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des geistigen und seelischen Bereichs) und ihre Körperstrukturen allgemein anerkannten (statistischen) Normen entsprechen (Konzept der Körperfunktionen und -strukturen), sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem (ICD) erwartet wird (Konzept der Aktivitäten), und sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Teilhabe/Partizipation an Lebensbereichen)“ (BAR Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006 ). 3.2.2 Konzept der Körperfunktionen und -strukturen Das Konzept der Körperfunktionen und -strukturen bezieht sich auf den menschlichen Organismus und zwar sowohl auf den körperlichen als auch auf den mentalen Bereich. Körperfunktionen = physiologische Funktionen von Körpersystemen (z. B. Sinnesfunktionen, Funktionen des Verdauungssystems, psychologische Funktionen) Körperstrukturen = anatomische Teile des Körpers (z. B. Auge, Ohr, Magen, Nervensystem) 68 Schädigungen = Beeinträchtigungen einer Körperfunktion oder -struktur (z. B. wesentliche Abweichung oder Verlust. 3.2.3 Konzept der Aktivitäten Das Konzept der Aktivitäten bezieht sich auf die Handlungen von Menschen. Aktivität = die Durchführung einer Handlung oder Aufgabe Beeinträchtigungen einer Aktivität = Probleme, die eine Person bei der Durchführung einer Handlung oder Aufgabe hat Das Aktivitätskonzept umfasst zwei Sachverhalte, nämlich Leistungsfähigkeit und Leistung. Leistungsfähigkeit = das maximale Leistungsniveau einer Person bezüglich einer Aufgabe oder Handlung unter Test-, Standard- oder hypothetischen Bedingungen ( „maximal“ abhängig von der Fragestellung, z. B. Dauerleistungsfähigkeit, Spitzenleistungsfähigkeit) Leistung = tatsächliche Durchführung einer Aufgabe oder Handlung einer Person unter den Gegebenheiten ihres Kontextes (z. B. Gehen bei unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit 3.2.4 Konzept der Teilhabe Das Teilhabekonzept befasst sich mit dem Menschen als Subjekt in Gesellschaft und Umwelt (Zugang zu Lebensbereichen, gleichberechtigte Teilhabe, erlebte gesundheitsbezogene Lebensqualität, erlebte Anerkennung und Wertschätzung in den Lebensbereichen). Teilhabe = Einbezogensein einer Person in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich Beeinträchtigungen der Teilhabe = Probleme, die eine Person beim Einbezogensein in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich hat 3.2.5 Konzept der Kontextfaktoren Das Konzept der Kontextfaktoren umfasst die Gegebenheiten des gesamten Lebenshintergrundes einer Person. Dazu gehören Umweltfaktoren und personbezogene Faktoren. 69 Umweltfaktoren = die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben (Wohnung, Straße, Hilfsmittel, Medikamente, Familie, Arbeitgeber, Einstellungen anderer Personen, Gesundheits- und Sozialsystem) personbezogene Faktoren = individueller Hintergrund des Lebens und der Lebensführung einer Person, ihre Eigenschaften und Attribute (z. B. Alter, Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale, Lebensstil, Beruf, Coping) Umweltfaktoren sind in der ICF bereits klassifiziert. Dabei ist immer anzugeben, ob die beschriebenen Umweltfaktoren Ressourcen darstellen oder Barrieren bilden. Die Klassifikation für personenbezogene Faktoren ist noch in der Entwicklung (BAR 2006, Schuntermann o. Jahr). Ziel ist es, mit den personenbezogenen Faktoren auch die personale Ebene zu erfassen und die subjektive Sicht der Betroffenen mit einzubeziehen. Die Erfassung individuell erlebter gesundheitlich bedingter Beeinträchtigung der Alltags- und beruflichen Aktivitäten chronisch kranker und behinderter Menschen ist vor allem wichtig für eine gemeinsame Entwicklung von Rehabilitationszielen. Nur durch einen gemeinsam von Betroffenen und Therapeuten erstellten Rehaplan können eine hohe Eigenverantwortung und eine motivierte Mitarbeit erreicht werden. Dadurch können Compliance und Rehaergebnisse sowie deren Nachhaltigkeit verbessert werden (Deck et al. 2012). 3.2.6 Das bio-psycho-soziale Modell von Gesundheit und Krankheit Grundlage der ICF ist das bio-psycho-soziale Modell von Gesundheit und Krankheit, das von folgenden Annahmen ausgeht: • Gesundheitliche Probleme lassen sich physiologischen, psychischen und sozialen Systemebenen zuordnen, die miteinander kommunizieren und untrennbar biopsychosozial verwoben sind. • Physiologische Vorgänge können psychosoziale Auswirkungen haben. • Psychosoziale Vorgänge können physiologische Wirkungen haben. 70 Abb. Das bio-psycho-soziale Modell der ICF (BAR 2006) Eine Beeinträchtigung der funktionalen Gesundheit einer Person ist nach diesem Modell das Ergebnis der negativen Wechselwirkungen zwischen dem Gesundheitsproblem (klassifiziert nach ICD) einer Person und ihren Kontextfaktoren. Beispielsweise kann eine Person mit mangelnder psychosozialer Unterstützung Probleme am Arbeitsplatz mit erhöhtem Alkoholkonsum bewältigen und dadurch eine Beeinträchtigung der Teilhabe am Erwerbsleben erleiden. 3.2.7 Anwendung der ICF Die ICF findet in Deutschland vor allem im Bereich der medizinischen Rehabilitation (Erstellung von Reha-Plänen, Begutachtung für das SGB IX, Rehabilitationsrichtlinien nach SGB V) Anwendung. Da die ICF sehr komplex und umfangreich ist, werden derzeit von der ICF Research Branch sog. ICF-Core-Sets entwickelt und in verschiedenen Projekten erprobt. Dabei handelt es sich um ICF-Kodelisten, die sich nur auf umschriebene und abgegrenzte Gesundheitszustände oder Versorgungszusammenhänge beziehen (DIMDI 2012). 3.3 Internationale Klassifikation der Prozeduren in der Medi- zin (ICPM; OPS-301) Hierbei handelt es sich um eine uniaxiale Klassifikation mit bis zu 6 Ebenen. Auf der obersten Ebene liegen 5 Kapitel: diagnostische Maßnahmen bildgebende Diagnostik 71 Operationen nicht operative therapeutische Maßnahmen ergänzende Maßnahmen Diese Klassifikation findet vor allem bei der Dokumentation und Abrechnung stationärer Leistungen in Krankenhäusern Anwendung. A9 4 Sozialmedizinische Begutachtung Ärztliche Begutachtung ist nicht nur im Strafrecht, sondern auch im Sozialrecht von hoher Bedeutung. Sozialrechtliche Gutachtenfragestellungen umfassen vor allem Fragen der Behandlungsbedürftigkeit gesundheitlicher Einschränkungen sowie der medizinischen und beruflichen Rehabilitationsbedürftigkeit. Für die Begutachtung im Rahmen der Rentenversicherung sowie der Kranken- und Arbeitslosenversicherung ist die Beurteilung der Leistungsfähigkeit von zentraler Bedeutung. Im Wesentlichen bezieht sich sozialmedizinische Begutachtung auf folgende Bereiche: Beurteilung der Einsatzfähigkeit im Erwerbsleben (Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) Bewertung von gesundheitlichen Einschränkungen in der Folge eines schädigenden Ereignisses; Beurteilung der Ursächlichkeit (soziales Entschädigungsrecht, Unfallversicherung) Feststellung und Bewertung des Status der gesundheitlichen Einschränkung als Grundlage für die Gewährung von Hilfen (Schwerbehindertenrecht, Pflegeversicherung). 4.1 Grundlagen ärztlicher Begutachtung Gutachten werden angefordert, wenn Gerichte, Institution oder Personen zu einem Sachverhalt eine Entscheidung treffen müssen, aber nicht über die erforderliche Sachkunde verfügen. Deshalb werden Gutachtenaufträge an Experten erteilt, die über das notwendige Wissen verfügen. Das Gutachten dient dem Auftraggeber als wichtige Entscheidungshilfe. 72 In Deutschland werden jährlich – vor allem im Auftrag von Sozialleistungsträgern und Sozialgerichten – mehrere Millionen medizinische Gutachten erstellt. Ziel jeder Begutachtung ist es, mit Hilfe des Sachverstands eines Experten (Sachverständigen) einen Sachverhalt zu klären. 4.2 Beteiligte und Begutachtung Immer gibt es drei Hauptbeteiligte: den Probanden oder die Probandin, den Auftraggeber oder die Auftraggeberin des Gutachtens und den Gutachter oder die Gutachterin. In (sozial)medizinischen Gutachten wird in der Regel nicht der Begriff „Patient“ sondern der Begriff „Proband“ angewandt, da sich die betroffene Person in der Begutachtung einer Prüfung unterzieht (lat. probare = prüfen) und keiner ärztlichen Behandlung. Es kommt auch vor, dass es sich bei zu Begutachtenden nicht um Patienten handelt oder dass dieser Sachverhalt im Begutachtungsverfahren erst zu klären ist. In der Rechtssprache werden auch Begriffe wie „der Versicherte“, „die versicherte Person“, „der Antragsteller“ oder „der Kläger“ verwendet. In der folgenden Abbildung ist der Prozess einer Begutachtung dargestellt. Abb. Das Dreieck der Kommunikation und Kooperation im Begutachtungsprozess (modifiziert nach Gebauer 2012a) Proband Antrag Bescheid Mitwirkung Einladung Gutachten Untersuchung Vorbereitung Entscheidung Auswertung Erstellung Auftraggeber Gutachter Gutachtenauftrag und Gutachten 73 In der Sozialmedizinischen Begutachtung sind Probanden häufig Langzeiterkrankte, die im Laufe einer mehrjährigen Krankengeschichte zahlreiche Erfahrungen mit gesundheitlichen Einschränkungen und sozialen Veränderungen gemacht haben. Neben der Untersuchung umfasst die Begutachtung eine eingehende Sozialanamnese, die den individuellen Lebenslauf sowie die Krankheitsentwicklung und Teilhabestörungen vor dem Hintergrund spezieller soziokultureller Aspekte wie Herkunft und Sprache erfasst. Der Auftraggeber eines Gutachtens ist in der Regel auch Entscheider des Verfahrens. Er stellt die Indikation für eine medizinische Sachaufklärung und legt durch Aktenvorbereitung, Formulierung der Fragestellung und Auswahl des medizinischen Sachverständigen den Grundstein für ein qualifiziertes Gutachten. Ärztliche Gutachter und Gutachterinnen haben eine Doppelrolle inne. Auf der einen Seite müssen sie sich wie ärztliche Behandler eingehend mit dem Probanden bzw. dem medizinischen Sachverhalt des Gutachtenauftrags befassen. Auf der anderen Seite müssen sie sich auch mit Denkweise und Begrifflichkeiten des Entscheiders auseinandersetzen, damit im Begutachtungsprozess eine gute Kommunikation und Kooperation gelingt. Gleichzeitig sind die medizinischen Gutachter konträren Erwartungen von Personen und Institutionen (Probanden und dessen Rechtsvertreter, Auftraggeber, Solidargemeinschaft der Versicherten, Sozialstaat) ausgesetzt: es ist Aufgabe des medizinischen Sachverständigen, die Bedürfnisse des einzelnen Mitglieds der Solidargemeinschaft der Versicherten abzuwägen, aber vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller Ressourcen der sozialen Versicherungssysteme soll das sozialmedizinische Gutachten auch dazu dienen, eine Verteilungsgerechtigkeit herzustellen. Grundsätzlich gilt, dass die medizinische Befundermittlung und Beurteilung auf der Basis größtmöglicher Objektivität und sachlicher Neutralität zu erfolgen hat. Subjektivität ist auch in einer Begutachtungssituation immer vorhanden, da persönliche Erfahrungen, Gefühle, Wahrnehmungen und Wertungen nicht einfach abgeschaltet oder ausgeblendet werden können. Wichtig ist, dass diese Subjektivität erkannt, reflektiert und ggf. offen thematisiert wird. Nach Gebauer (2012a) hat ein medizinischer Gutachter folgende Grundsätze der Begutachtung und Ethik zu beachten: 74 - „Qualifizierte Arbeit leisten, Fortbildung betreiben, berufsrechtlich gebotene Sorgfalt - Nach „bestem Wissen und Gewissen“ begutachten - Wahrhaftigkeit und Charakterstärke, keine Beeinflussbarkeit in der Urteilsbildung durch Dritte 15 Proband erhält Bescheid - Jedem Probanden mit menschlicher Wertschätzung zu begegnen; ihn als ein Du und nicht als ein Es behandeln - Nihil nocere (keinem Probanden Schaden zufügen) - Kollegialität gegenüber anderen Gutachtern und Behandlern - Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - Schutz des Eigentums der Solidargemeinschaft vor unberechtigtem Begehren.“ Wenn ein Gutachter befangen ist (z. B. Verwandtschaft mit dem Probanden) oder wenn die Fragestellung einen Sachverhalt umfasst, für dessen Beurteilung keine ausreichenden Kompetenzen erworben wurden, ist der Gutachtenauftrag mit entsprechender Begründung an den Auftraggeber zurückzugeben. In der folgenden Abbildung sind die Teilschritte des Begutachtungsprozesses von der Antragstellung bis zum Bescheid zusammengestellt. Abb. Die Treppe der Begutachtung (modifiziert nach Gebauer 2012a) 75 14 Verwaltung entscheidet 13 Verwaltung wertet Gutachten aus 12 Gutachtenstelle versendet Gutachten 11 Gutachter liest, unterschreibt Gutachten 10 Gutachter plant, formuliert, diktiert Gutachten 9 Gutachter reflektiert, ergänzt, bewertet 8 Gutachter befragt, untersucht Probanden 7 Gutachtenstelle lädt Probanden ein 6 Gutachter sichtet Unterlagen, plant Begutachtung 3 Gutachtenauftrag geht in Gutachtenstelle ein 4 Verwaltung bereitet Gutachtenauftrag vor 3 Verwaltung prüft Bedarf für medizinische Begutachtung 2 Verwaltung prüft versicherungsrechtliche Voraussetzungen 1 Proband beantragt Sozialleistung Aus richterlicher Sicht ist ein gutes Gutachten durch folgende Merkmale gekennzeichnet: - Erstellung in angemessener Zeit - Erstattung durch den Sachverständigen persönlich - Vollständige, schlüssige, überzeugende und richtige (vom Gericht für richtig befundene) Beantwortung der gestellten Beweisfragen - für die Beteiligten verständliche Formulierung - angemessene Auseinandersetzung mit dem Vorbringen der Beteiligten und dem Inhalt vorhandener Vorgutachten (Schmidt 2005). 4.3 Finale versus kausale Betrachtung bei medizinischen Gut- achten Bei der gutachterlichen Beurteilung von Gesundheitsstörungen ist eine finale Betrachtung von einer kausalen zu unterscheiden. Bei der finalen Betrachtung geht der Gutachter von der Frage nach den Auswirkungen einer Krankheit für den Probanden aus (finalis = endgültig). Da die Bewertung eines Krankheitszustands und seiner Folgen für Leistungsfähigkeit, berufliche und soziale Teilhabe im Vordergrund der Untersuchung stehen, wird auch von Zustandsgutachten gesprochen. 76 Eine kausale Betrachtung geht der Frage nach ob eine vorliegende Krankheit ursächlich (kausal; causa = Ursache) auf ein schädigendes Ereignis (z. B. Arbeitsunfall) oder eine schädigende Einwirkung (z. B. berufliche Exposition gegenüber Lärm) zurückzuführen ist. Diese Gutachten werden Kausalitätsgutachten oder Zusammenhangsgutachten genannt. Bei medizinischen Begutachtungen zu Fragen der sozialen Sicherung geht es in erster Linie um eine finale Betrachtung Dem Gutachter stellt sich hier die Frage: „Wie wirkt sich die Krankheit für den Probanden oder die Probandin aus?“ Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über finale und kausale Betrachtungsweisen in Begutachtungsverfahren für verschiedene Träger der sozialen Sicherung. Tab. Finale und kausale Betrachtungsweisen in Begutachtungsverfahren für verschiedene Träger der sozialen Sicherung Gutachtenarten: Recht/Träger Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) Arbeitsförderung Gesetzliche Unfallversicherung (GUV) Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) Pflegeversicherung (PV) Thema/Frage AU: Liegt (weiterhin) Arbeitsunfähigkeit vor? Einsatzfähigkeit/Verfügbarkeit Kausalität, Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) Liegt eine teilweise oder vollständige Erwerbsminderung (EM) vor? Pflegestufe Betrachtung Final Kausal + + (+) + + + Rehabilitationsrecht (alle Liegt Rehabilitationsbedürftigkeit vor? Träger) Schwerbehindertenrecht Grad der Behinderung (GdB) (SchwbR) Soziales Entschädigungs- Kausalität, Grad der Schädigung (GdS) recht (SER) + + (+) Für die gutachterliche Bewertung der Auswirkungen einer Krankheit (finale Betrachtung) ist die Benennung der vorliegenden Krankheit (ICD-Diagnose) nicht ausreichend, da sie keine Aussagen zu Schweregrad und Funktionsbeeinträchtigungen beinhaltet. Zwei Personen, die an der gleichen Krankheit leiden, können in Abhängigkeit vom Verlauf und Schweregrad unterschiedliche Funktionsstörungen aufweisen und entsprechend unterschiedlich in ihrer Teilhabe am sozialen Leben beeinträchtigt sein. Für das Ausmaß der Teilhabeeinschränkungen sind zusätzlich personen- und umweltbezogene 77 + Kontextfaktoren von Bedeutung. In der sozialmedizinischen Begutachtung sind diese vor allem auch im Hinblick auf die Prognose und Wiedereingliederung in die Berufstätigkeit zu betrachten. Eine Orientierung der Befunderhebung an der ICF mit Feststellung der Funktionsbeeinträchtigungen ebenso wie der noch vorhandenen Ressourcen und der Kontextfaktoren ist deshalb unumgänglich (vergl. Kapitel 3.2). Häufig erfordern Gutachtenaufträge sowohl eine finale als auch eine kausale Betrachtungsweise. Beispielsweise kann in Zustandsgutachten für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) oder die Rentenversicherung (RV) die Frage eine Rolle spielen, ob für die Leistungspflicht u. U. eine Krankheit ursächlich ist, deren Folgen von einer anderen Institution (z. B. Unfallversicherung) abgedeckt werden. Bei entsprechenden Hinweisen kann gemäß § 102 SGB X ein Erstattungsantrag gestellt werden. Beispiel: Die Krankenkasse bezahlt für Frau Müller einen Krankenhausaufenthalt in einer HNO-Klinik und Krankengeld. Aus der Anamnese ergibt sich der Verdacht auf eine berufsbedingte Lärmschwerhörigkeit. Daraufhin wird bei der zuständigen Berufsgenossenschaft (BG) ein Antrag auf Anerkennung einer Berufskrankheit gestellt. Nachdem die Lärmschwerhörigkeit als Berufskrankheit anerkannt worden ist, macht die Krankenkasse bei der BG einen Erstattungsanspruch für die aufgewendeten Leistungen geltend. Ergibt sich in Kausalitätsgutachten ein kausaler Zusammenhang zwischen Krankheit und schädigendem Ereignis, wird der Gutachter zusätzlich beauftragt, den Schweregrad der gesundheitlichen Beeinträchtigung einzuschätzen. Handelt es sich um ein Gutachten für die Gesetzliche Unfallversicherung (GUV), erfolgt die Festlegung der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) bedingt durch die Unfallfolgen. Im Zusammenhang mit einer Begutachtung im Rahmen des Sozialen Entschädigungsrechts wird der Grad der Schädigung (GdS) abgeschätzt. 78 4.4 Begutachtungsrelevante rechtliche Begriffe Das Ausmaß von Funktionsbeeinträchtigungen oder Behinderungen sowie die Erwerbsfähigkeit müssen im Rahmen sozialmedizinischer Gutachten immer im Kontext des jeweiligen Rechtsgebietes beurteilt werden. Da je nach Rechtsgebiet unterschiedliche Begriffe verwendet werden, sollen die wichtigsten im Folgenden kurz besprochen werden. 4.4.1 Grad der Schädigung (GdS) und Grad der Behinderung (GdB) Der Grad der Schädigung (GdS) ist ein Begriff des sozialen Entschädigungsrechts (SER §30 Abs. 1 BVG). Mit dem GdS wird das Ausmaß der Auswirkungen einer – kausal im leistungsrechtlichen Rahmen des SER entstandenen – Gesundheitsstörung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft angegeben. Im Schwerbehindertenrecht (SGB IX, Teil 2) wird das Ausmaß der Beeinträchtigung durch den Grad der Behinderung (GdB) bemessen. Der Begriff der Behinderung ist vor allem für den Bereich der Rehabilitation von Bedeutung. Nach SGB IX §1 erhalten Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen Rehabilitationsleistungen, „um ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.“ Dies gilt insbesondere auch für die Teilhabe am Arbeitsleben. Definition Behinderung nach SGB IX § 2 „(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.“ Begrifflich zu unterscheiden sind: Schwerbeschädigte Schwerbehinderte Grad der Schädigung (GdS) = 50 Grad der Behinderung (GdB) = 50 oder höher oder höher Zur Sicherstellung, dass Beeinträchtigungen bundesweit einheitlich bewertet werden, wurden Begutachtungs-Richtlinien erstellt. Diese Richtlinien heißen „Versorgungsmedizinische Grundsätze" nach der VersorgungsmedizinVerordnung vom 10. Dezember 2008. Danach werden GdS und GdB nach den gleichen Grundsätzen bemessen. 79 „Beide Begriffe unterscheiden sich lediglich dadurch, dass der GdS nur auf die Schädigungsfolgen (also kausal) bezogen ist, der GdB auf alle Gesundheitsstörungen unabhängig von ihrer Ursache (also final) bezogen ist. Beide Begriffe haben die Auswirkungen von Funktionsbeeinträchtigungen in allen Lebensbereichen und nicht nur die Einschränkungen im allgemeinen Erwerbsleben zum Inhalt. GdS und GdB sind ein Maß für die körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Auswirkungen einer Funktionsbeeinträchtigung aufgrund eines Gesundheitsschadens“ (Versorgungsmedizinische Grundsätze 2008). 4.4.2 Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) und Erwerbsminde- rung (EM) Bei der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) handelt es sich um einen Begriff der GUV (§56 Abs. 2 SGB VII): für die Feststellung der Höhe der MdE ist das Ausmaß zu beurteilen, um das die bisherige Einsatzfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (= 100%) durch die Schädigung (Unfallfolgen, Berufskrankheit) eine Minderung erfahren hat. Der Begriff der MdE ist zu unterscheiden von der Erwerbsminderung (EM). Dieser Begriff ist der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) zuzuordnen und wird im §43 SGB VI des Rentenrechts in der ab 1.1.2001 geltenden Fassung zweistufig definiert: 1. teilweise erwerbsgemindert, 2. voll erwerbsgemindert. Begrifflich zu unterscheiden sind: Minderung der Erwerbsfä- Erwerbsminderung (EM) higkeit (MdE) nach dem Recht der GRV (SGB VI) nach dem Recht der GUV (SGB VII) Ausmaß, um das die bisheri- Teilweise EM Volle EM ge Einsatzfähigkeit auf dem irgendeine Erwerbs- irgendeine Erwerbsallgemeinen Arbeitsmarkt tätigkeit auf dem tätigkeit auf dem durch Unfallfolgen oder Be- allgemeinen Ar- allgemeinen Arrufskrankheit gemindert ist beitsmarkt kann auf beitsmarkt kann auf nicht absehbare Zeit nicht absehbare Zeit nicht mindestens 6 nicht mindestens 3 Stunden täglich aus- Stunden täglich geübt werden ausgeübt werden 80 4.5 Sozialmedizinische Begutachtung bei der Bundesagentur für Arbeit Im ärztlichen Dienst der Bundesagentur für Arbeit (BA) sind in den verschiedenen Agenturen derzeit über 400 Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen beschäftigt. Im Jahr2011 wurden bundesweit ca. 550.000 Aufträge an den Ärztlichen Dienst der BA vergeben. Kern der Tätigkeit des ärztlichen Dienstes ist die „Eignungsfeststellung“ gemäß § 32 SGB III. Soweit dies für die Feststellung der Berufseignung oder Vermittlungsfähigkeit erforderlich ist, wird der ärztliche Dienst danach mit der Begutachtung von Kundinnen und Kunden der BA beauftragt. Zusätzlich erstellt der Ärztliche Dienst bei Beauftragung auch sozialmedizinische Gutachten im Rahmen des SGB II für Jobcenter (Bundesagentur für Arbeit 2012). Die wesentliche Aufgabe der Sozialmedizin im Rahmen des SGB II ist nach Toumi (2006) die Mitwirkung bei: der Feststellung der Erwerbsfähigkeit (Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt) der Umsetzung des Grundsatzes des Forderns bei gegebener Erwerbsfähigkeit (§2 SGB II) (Eingliederung, Mitwirkungsbereitschaft) der Umsetzung des Grundsatzes des Förderns (§§ 14 und 16 SGB II) (Beratung, Integration, Qualifizierung, Rehabilitation, Fallmanagement) Die Begutachtung durch den Ärztlichen Dienstes der BA erfolgt nach einem Stufenkonzept, d. h. in der Regel wird auf der Basis der vom Kunden vorgelegten ärztlichen Unterlagen nach Aktenlage ein Gutachten erstellt. Ein umfassendes sozialmedizinisches Gutachten mit Untersuchung des Kunden wird nur bei komplexen Fragestellungen notwendig. Ziel der sozialmedizinischen Begutachtung durch den Ärztlichen Dienst der BA sind möglichst objektive Aussagen zur individuellen Leistungsfähigkeit. Das Gutachten dient als Entscheidungsgrundlage für Vermittlungsbemühungen, Gewährung von Förderleistungen oder Geldleistungen. Die Begutachtung der Leistungsfähigkeit und Erwerbsfähigkeit bezieht sich, je nach Fragestellung des Auftraggebers, entweder auf die Beurteilung der Leistungsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, also die Erwerbsfä81 higkeit allgemein oder auf die Leistungsfähigkeit in einem bestimmten Tätigkeitsfeld oder einem speziellen Beruf. Ist das Leistungsvermögen so erheblich eingeschränkt, dass eine Erwerbstätigkeit auf Dauer weniger als drei Stunden täglich ausgeübt werden kann, steht der Kunde dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Ggf. sind die Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente abzuklären. Die abschließende Entscheidung, ob Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente besteht, wird vom zuständigen gesetzlichen Rentenversicherungsträger getroffen. Bei gesundheitlich eingeschränktem Leistungsvermögen einer Kundin oder eines Kunden nimmt der Ärztliche Dienst in seiner Begutachtung Stellung zu der Frage, ob durch medizinische und/oder berufliche Rehabilitationsmaßnahmen die Teilhabe am Arbeitsleben wieder hergestellt bzw. verbessert werden kann. Entsprechend der ICF geht es dabei nicht nur um die Feststellung von Leistungseinschränkungen sondern auch um die Erfassung noch vorhandener Ressourcen des Kunden. Folgende Fragen sind in diesem Zusammenhang zu klären: „Sind Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe erforderlich? (Rehabilitationsbedürftigkeit)“ „Welche Maßnahmen sind erforderlich? (Rehabilitationsbedarf)“ (Arbeitsagentur 2012) Wird eine Rehabilitation mit hoher Wahrscheinlichkeit die Leistungsfähigkeit verbessern? (positive Rehaprognose) Welche Ressourcen sind noch vorhanden, an die in der Rehabilitation angeknüpft werden kann? A10 82 5 Sozialmedizinische Leistungsdiagnostik und Beurtei- lung der Leistungsfähigkeit In der Sozialversicherung werden zwei Bereiche von Leistungen unterschieden: - Eine Leistung im leistungsrechtlichen Sinn wird einem Versicherten von einem Sozialleistungsträger als Sach-, Dienst- oder Geldleistung bewilligt/erbracht (z. B. Krankengeld, Rentenleistung, RehaLeistung). - Eine Leistung im sozialmedizinischen Sinn ist eine Arbeitsleistung mit bestimmten Anforderungen, die von einer gesundheitlich beeinträchtigten Person vor dem Hintergrund der personen- und umweltbezogenen Kontextfaktoren erbracht/bewältigt werden kann. Im Zusammenhang mit Erwerbstätigkeit ist die zweite Definition von Bedeutung, die im Folgenden näher betrachtet wird. 5.1 Leistung im sozialmedizinischen Sinn Leistungen in der Arbeitswelt sollen bestimmte Anforderungen erfüllen und zu Ergebnissen führen, die für Arbeitgeber, Kunden und/oder Gesellschaft nützlich sind. Das heißt, dass Arbeitsleistungen in einer adäquaten Zeit erbracht und die Ergebnisse bestimmten Quantitäts- und Qualitätsvorgaben entsprechen sollten. Voraussetzung für die Beurteilung menschlicher Leistungen bzw. der Fähigkeit, eine definierte Leistung zu erbringen, ist deshalb die Orientierung an bestimmten Maßstäben. Die Beurteilung der erwerbsbezogenen Leistungsfähigkeit ist in vielen Bereichen ärztlicher Tätigkeit von Bedeutung. Von kurativ tätigen Ärztinnen und Ärzten wird beispielsweise erwartet, dass sie Patienten mit chronischen Erkrankungen beraten, welche Belastungen vermieden werden sollten. In der sozialmedizinischen Begutachtung ist die Beurteilung der individuellen Leistungsfähigkeit gesundheitlich beeinträchtigter Menschen notwendig, um Entscheidungen zu Arbeits-, Berufs- und Dienstunfähigkeit sowie Erwerbsminderung treffen zu können. Eine wichtige Rolle spielt die Leistungsdiagnostik und -beurteilung auch für die Arbeitsvermittlung, die Ermittlung von Rehabilitationsbedarf sowie die berufliche (Wieder-) Eingliederung ein83 schließlich der Anpassung eines Arbeitsplatzes an behindertengerechte Kriterien. Tab. Beurteilung der Leistungsfähigkeit als ärztliche Aufgabe Modifiziert nach Gebauer (2012c) Anlässe für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit im Arbeits- und Erwerbsleben Gutachter Alle kurativ tätigen Arbeitsmediziner, Amtsärzte Ärzte Begutachtungsanlässe im Sozialrecht: Beratung der Pati- Ärztliche Untersuchungen im Ar- Arbeitsunfähigkeit (SGB V) ent_innen zu Belast- beitsverhältnis: - Erwerbsminderung (SGB VI) barkeit - Personalärztliche Untersuchun- Leistungsfähigkeit/Einsatzfähigkeit (SGB gen auf Verlangen des ArbeitgeII und III) bers - Erwerbsminderung im Alter (SGB XII) - Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen - Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz Begutachtungsanlässe im Beamtenrecht: Vertragsärzte Reha-Mediziner - Eignung/Dienstunfähigkeit Begutachtungsanlässe im Privatversiche- Feststellung von AU Beurteilung der Leistungsfähigkeit rungsrecht: in Einrichtungen der medizinischen - Berufsunfähigkeit (private BUund beruflichen Rehabilitation Versicherung) - AU (PKV) Die Begriffe Leistungsvermögen und Leistungsfähigkeit werden in der neueren Literatur zur sozialmedizinischen Begutachtung synonym verwendet (DRV 2009). Unter Leistungsfähigkeit wird in der Begutachtungsmedizin die Fähigkeit einer Person verstanden, eine bestimmte Leistung zu erbringen, also eine definierte Aufgabe zu bewältigen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der Leistungsfähigkeit unter Realbedingungen und der Leistungsfähigkeit unter Test- oder Idealbedingungen. Unter Realbedingungen soll Leistung nicht nur einmalig, sondern über einen längeren Zeitraum stabil erbracht werden können. Im Gegensatz dazu wird bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit unter Ideal- oder Testbedingungen die maximale Leistungsfähigkeit einer Person unter standardisierten Bedingungen eingeschätzt (vgl. Kap. 3.2). Leistungsfähigkeit unter Realbedingungen (performance) Fähigkeit, eine Leistung langfristig und stabil zu erbringen Leistungsfähigkeit unter Idealbedingungen (capacity) Maximale Leistungsfähigkeit unter Testbedingungen 84 Jede Arbeitsleistung ist abhängig von sachlichen Vorbedingungen und menschlichen Voraussetzungen. Zu den sachlichen Vorbedingungen gehören zum einen organisatorische Faktoren wie Arbeitszeit, Arbeitssicherheit oder Entlohnung und zum anderen technische Faktoren wie Aufgabenschwierigkeit, Arbeitsmittel oder Umgebungsbedingungen (Groner 2012). Bei den menschlichen Voraussetzungen ist zu differenzieren zwischen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft. Tab. Menschliche Voraussetzungen für Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft (modifiziert nach Groner (2012)) Einflussfaktoren für Leistungsfä- Einflussfaktoren für Leistungsbereithigkeit (Beispiele) schaft (Beispiele) - Konstitution - Interesse - Geschlecht - Selbstverständnis - Alter - Stimmungslage - Bildung - Arbeitsbedingungen - Kognitive Fähigkeiten - Betriebsklima - Sensorische Fähigkeiten - Finanzielle Anreize 5.2 Grundlagen der sozialmedizinischen Beurteilung der Leis- tungsfähigkeit Bei der sozialmedizinischen Beurteilung der Leistungsfähigkeit hat der Gutachter die Aufgabe, die gesundheitlich bedingte bzw. die durch Krankheit und/oder Behinderung beeinträchtigte Leistungsfähigkeit mit seinem Expertenwissen und dem Einsatz validierter Messinstrumente zu beurteilen. Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit für Aktivitäten der Arbeitswelt und des täglichen Lebens erfolgt auf der Grundlage der ICF unter Berücksichtigung bio-psycho-sozialer Wechselwirkungen sowie positiver und negativer Kontextfaktoren (vgl. Kap. 3.2). „Leistungsfähigkeit = störungsbedingte Leistungsminderung +/- Kompensation“ (Gebauer 2012c) Grundlage der sozialmedizinischen Beurteilung der Leistungsfähigkeit ist außerdem das Belastungs-Beanspruchungskonzept (vgl. Kap. 1.3.3). 85 Die Beurteilung der Gesamtleistungsfähigkeit einer Person erfolgt in der sozialmedizinischen Begutachtung in Teilschritten, wobei je nach Gutachtenauftrag weitere Professionen (z. B. Psychologen) für Zusatzgutachten herangezogen werden. Beurteilung der Gesamtleistungsfähigkeit in Teilschritten: körperliche Leistungsfähigkeit, sensorische Leistungsfähigkeit geistige (mentalen) Leistungsfähigkeit psychosoziale Leistungsfähigkeit Die Gesamtleistungsfähigkeit wird in der Begutachtung nicht als eine allgemeine Größe (z. B. gesundheitliche Fitness) aus den genannten Teilbereichen zusammengefasst, sondern immer in Relation zu einem bestimmten Aufgabenbereich mit definierten Anforderungen beurteilt. D. h. die Beurteilung der Gesamtleistungsfähigkeit erfolgt im Hinblick auf gewisse Anforderungen, wobei u. U. einzelne Teilbereiche der Leistungsfähigkeit unterschiedlich zu gewichten sind. Bezugssysteme sind hierbei z. B.: der aktuell vorhandene Arbeitsplatz der überwiegend ausgeübte oder erlernte Beruf eine vom Auftraggeber benannte Verweisungstätigkeit der allgemeine Arbeitsmarkt bestimmte Aktivitäten des täglichen Lebens 5.3 Diagnostik der erwerbsbezogenen Leistungsfähigkeit Die Begutachtung der erwerbsbezogenen Leistungsfähigkeit orientiert sich an drei Komponenten: Begutachtung der Leistungsfähigkeit im Arbeits- und Erwerbsleben (nach Gebauer 2012c) Komponenten der Diag- Fragestellung an die Ärztin oder den Arzt nostik und Beurteilung 1. Medizinische Kom- „Liegt eine gesicherte Störung von Körperfunkponente tionen und Aktivitäten als Folge von Krank86 heit/Behinderung vor? Welche? Wie schwergradig sind diese Auswirkungen?“ 2. Erwerbsbezogene Ergeben sich aus der Störung Konsequenzen für Komponente die Leistungsfähigkeit am bisherigen Arbeitsplatz, im erlernten Beruf…? Positives/negatives Leistungsbild? Qualitative und quantitative Leistungsfähigkeit? Bei Vorliegen eines konkreten präzisen beruflichen Anforderungsprofils: „Passt das ermittelte Fähigkeitsprofil zum geforderten Arbeitsprofil?“ 3. Zeitliche Komponen- Seit wann besteht die Leistungsminderung? te Therapie/Rehabilitation ausgeschöpft? Prognose: Wie lange wird die Leistungsminderung voraussichtlich/mit überwiegender Wahrscheinlichkeit andauern? „Besserung (un)wahrscheinlich?“ Die Untersuchung der erwerbsbezogenen Leistungsfähigkeit stützt sich auf die Erhebung der Arbeits- und Sozialanamnese, eine klinische und apparative Funktionsdiagnostik sowie auf eine arbeitsbezogene Diagnostik. Wichtige Themen der Arbeits- und Sozialanamnese sind: die subjektive Einschätzung der Leistungsfähigkeit durch den Probanden mit Angaben zu Arbeitsunfähigkeit, Angaben zu Schwerbehinderung, Verlust des Arbeitsplatzes etc., die Beschreibung des aktuellen Arbeitsplatzes durch den Probanden, Angaben Arbeitszeiten, zu qualitativen und quantitativen Belastungen, körperlichen wie psychosozialen Belastungen, Exposition gegenüber besonderen Gefahrenstoffen etc. Berufs- und Sozialanamnese (beruflicher Werdegang, finanzielle Absicherung, persönliche Lebenssituation etc.) Bedeutung und Auswirkungen der Erkrankung sowie Ressourcen des Probanden. Hilfreich für den Gutachter ist eine Arbeitsplatzbeschreibung durch den Betrieb z. B. in Form von Videosequenzen. Klinische Funktionstests, die in der Begutachtung eingesetzt werden, sind z. B. Beweglichkeitsprüfungen, Belastungs-EKG, Lungenfunktionsprüfung, Seh- und Hör-Tests sowie neuropsychologische Tests zur Prüfung der kogni87 tiven Funktionen wie Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis- und Lernleistungen. Durch spezielle arbeitsbezogene Leistungstests können verschiedene Tätigkeitsmerkmale aus der Arbeitswelt geprüft werden. Grundsätzlich gilt dabei: je näher sich die Testung der Leistungsfähigkeit an den zu beurteilenden konkreten Anforderungen des Arbeitsplatzes orientiert, umso sicherer kann die gutachterliche Beurteilung sein. Deswegen wurden in den vergangenen Jahren umfassende arbeitsbezogenen Assessments entwickelt. 5.3.1 Spezielle Leistungsdiagnostik: arbeitsbezogene Assessments Spezielle arbeitsbezogene Assessments sind Instrumente zur Prüfung verschiedener Tätigkeitsmerkmale (to assess = engl. beurteilen, bewerten Die bisher entwickelten Instrumente beziehen sich überwiegend auf körperliche Leistungen. Zu diesen Assessments gehören die sog. FCE- Verfahren (Functional Capacity Evaluation): Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit nach Isernhagen (EFL) Arbeitssimulationsgerät ERGOS Abb. Einschätzung körperlicher Leistungsfähigkeit (Gebauer 2012c) FCE-Verfahren im Kontext der ICF Körperfunktionen und Strukturen Aktivitäten Funktions- und Strukturdiagnostik Aktivitätsdiagnostik ursächlich orientiert Teilhabe/Partizipation Partizipationsdiagnostik anforderungskontextorientiert orientiert und und situationsabhängig situationsunabhängig arbeitsplatzbezogenes Assessment 88 Die arbeitsbezogenen Assessments konzentrieren sich auf die Aktivitätsebene. Sie liefern Zusatzinformationen z. B. für die berufliche Wiedereingliederung von Probanden, bei denen mehr Wissen über Einzelfähigkeiten oder Ausdauerbelastung benötigt wird oder wenn Diskrepanzen zwischen klinischem Befund und subjektiven Angaben von Probanden bestehen. Inzwischen bieten manche Rehabilitationskliniken auch die Erprobung der Belastbarkeit in einer beruflichen Werkstatt an (Buchard 2009). Eine Reihe weiterer Assessmentinstrumente erfassen die Selbsteinschätzung der Leistungsfähigkeit. Es handelt sich dabei um standardisierte Fragebögen, die von den Probanden auszufüllen sind. Hierzu gehören z. B. der vor allem in der Rehabilitation eingesetzte IRES-Fragebogen (Indikatoren des RehaStatus) und der Work Ability Index (WAI). In seiner neuesten Version wurde der IRES-Fragebogen (IRES 3) dem Konzept der ICF angepasst. Neben der Einschätzung somatischer Symptome und Funktionen erfasst er auch psychisches Befinden, Bewältigungs- bzw. Kontextfaktoren und berufsbezogene Funktionsfähigkeit. 5.3.2 Work Ability Index (WAI) Der WAI wurde in Finnland als Konzept zur Bestimmung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit entwickelt. Es handelt sich um ein Messinstrument zur Erfassung der Arbeitsfähigkeit von Erwerbstätigen. Der WAI wird auch als Arbeitsfähigkeitsindex oder Arbeitsbewältigungsindex bezeichnet. Der Fragebogen, kann entweder von den Befragten selbst oder von Dritten, z.B. Betriebsärzt/innen bei der betriebsärztlichen Untersuchung, ausgefüllt wird. Ziel der Anwendung des WAI ist die Förderung bzw. Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten. Mit dem Fragebogen werden sieben Dimensionen erfasst: derzeitige Arbeitsfähigkeit im Vergleich zur besten jemals erreichten Arbeitsfähigkeit Arbeitsfähigkeit im Vergleich zu den Anforderungen der Arbeitstätigkeit Anzahl der aktuellen vom Arzt diagnostizierten Erkrankungen geschätzte Beeinträchtigung der Arbeitsleistung durch die Erkrankungen 89 Arbeitsunfähigkeitstage während der letzten 12 Monate subjektive Prognose der Arbeitsfähigkeit in den nächsten beiden Jahren psychomentale Ressourcen zur Bewältigung der Arbeitsanforderungen Aus den Antworten ergibt sich der WAI-Wert, der mit Referenzdaten verglichen wird. Ziel ist es, über die betriebsärztliche Betreuung oder die betriebliche Gesundheitsförderung frühzeitig Präventionsmaßnahmen anzubieten, um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten (WAI Netzwerk o. Jahr) In Deutschland wurde 2003 das WAI-Netzwerk von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) initiiert. Aktuell wird es von der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) finanziert. Da psychische Erkrankungen immer häufiger Ursache einer Frühberentung sind, gewinnt die Erfassung psychomentaler Belastungen und (Fehl-) Beanspruchungen insbesondere in der Rehabilitation und in der beruflichen Wiedereingliederung zunehmend an Bedeutung. In der Diagnostik von beruflichen Beanspruchungen wird z. B. der AVEM, ein Fragebogen zur Erfassung von arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmustern eingesetzt. 5.3.3 Erfassung von arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmus- tern Schaarschmidt und Fischer (2006) haben einen standardisierten Fragebogen zur Erfassung persönlicher Ressourcen entwickelt, die in der Auseinandersetzung mit beruflichen Anforderungen von Bedeutung sind (Arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster, AVEM). Der Fragebogen erlaubt Aussagen über gesundheitsförderliche und gesundheitsgefährdende Verhaltensund Erlebensmuster bei der Bewältigung von Arbeits- und Berufsanforderungen. Somit kann er zur Früherkennung gesundheitlicher Risiken und zur Begründung und Ableitung von präventiven Maßnahmen eingesetzt werden. Es handelt sich um ein mehrdimensionales persönlichkeitsdiagnostisches Verfahren mit Selbsteinschätzungen auf elf Dimensionen: „Subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit, Beruflicher Ehrgeiz, Verausgabungsbereitschaft, Perfektionsstreben, Distanzierungsfähigkeit, Resignationstendenz bei Misserfolg, Offensive Problembewältigung, Innere Ruhe und Ausgeglichenheit, Erfolgserleben im Beruf, Lebenszufriedenheit, Erleben sozialer Unterstüt90 zung“. Aus der Fragebogenauswertung lassen sich sowohl positive als auch negative arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster erkennen. Negativen Mustern mit einem erhöhten Risiko für Gesundheitsprobleme werden von den Testautoren spezifische Interventionsmaßnahmen zugeordnet (Schaarschmidt u. Fischer 2006), z. B.: Selbstüberforderung Nein-Sagen lernen Veränderung der individuellen Arbeitsorganisation und des Zeitmanagements Koordinierung und Ausbalancierung von beruflichen Anforderungen, häuslichen Pflichten und Freizeitaktivitäten Eingeschränkte kommu- Kommunikations- und Konfliktbewältigungsnikative Kompetenz, training, Förderung offensiven Kommunikatidefensive Problembewäl- ons- und Konfliktlöseverhaltens tigung Das Verfahren kann zur genaueren Abklärung berufsbezogener gesundheitlicher Risiken genutzt werden sowie zur individuellen Abstimmung von rehabilitativen Maßnahmen und zur Verlaufs- und Erfolgskontrolle des Rehabilitationsprozesses. A11 5.4 Abschließende Beurteilung des erwerbsbezogenen Leis- tungsvermögens in der sozialmedizinischen Begutachtung Auf der Basis der Sozialanamnese und der Untersuchungsbefunde beurteilt der Gutachter die erwerbsbezogene Leistungsfähigkeit in enger Orientierung an der Fragestellung des Gutachtenauftrags. Dabei ist zu berücksichtigen, ob nach dem Leistungsvermögen bezüglich einer konkreten beschriebenen Tätigkeit gefragt ist oder nach dem Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. In beiden Fällen muss sowohl das qualitative als auch das quantitative Leistungsvermögen beurteilt werden. 91 5.4.1 Qualitatives Leistungsvermögen Es ist zu beurteilen, welche Anforderungen aufgrund der ermittelten Fähigkeiten vom Probanden noch oder nicht mehr geleistet werden können bezüglich der Arbeitsschwere: körperlich leichte, mittelschwere, schwere Arbeiten Arbeitshaltung: im Stehen, Gehen, Sitzen, gebückt etc. Arbeitsorganisation: Tagesschicht, Spätschicht etc. Zusätzlich sind spezielle qualitative Leistungsmerkmale zu berücksichtigen (z. B. Verantwortung für Personen, Steuerung komplexer Arbeitsvorgänge, Sehvermögen, Gebrauchsfähigkeit der Hände etc.). In die Beurteilung der Leistungsfähigkeit ist außerdem die subjektive Beanspruchung des Probanden einzubeziehen. Entsprechend dem Belastungs-Beanspruchungskonzept stellen gleiche Belastungen für verschiedene Menschen unterschiedliche Beanspruchungen dar (vgl. Kap. 1.3.3). 5.4.2 Quantitatives Leistungsvermögen In verschiedenen Rechtsbereichen werden drei quantitative Stufen der Leistungsfähigkeit unterschieden: unter 3 Stunde pro Tag bis unter 6 Stunden pro Tag 6 und mehr Stunden pro Tag Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei einer Leistungsminderung auf unter drei Stunden für die zuletzt ausgeübte Tätigkeit noch eine Leistungsfähigkeit für drei bis unter sechs Stunden für leichte Arbeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gegeben sein kann. Daraus wird auch deutlich, dass sich eine gutachterliche Stellungnahme zur Leistungsfähigkeit nicht auf die Defizite beschränken sollte, sondern auch das Restleistungsvermögen bzw. das, was durch eine weitere Förderung noch zu erreichen ist, beschreiben sollte (Ressourcenorientierung). Eine Leistungsfähigkeit unter drei Stunden pro Tag bezogen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt entspricht einer vollen Erwerbsminderung. Sie ist bei schwerer dauernder oder länger anhaltender Leistungseinschränkung, z. B. infolge einer unheilbaren Krebserkrankung gegeben. Die Feststellung einer 92 vollen Erwerbsminderung setzt voraus, dass die üblichen Therapie- und Rehabilitationsmaßnahmen ausgeschöpft sind (Gebauer 2012c). Grundlage der abschließenden Beurteilung der erwerbsbezogenen Leistungsfähigkeit in sozialmedizinischen Gutachten ist der Vergleich des Fähigkeitsprofils eines in seinen Funktionen eingeschränkten/behinderten Menschen mit dem Anforderungsprofil des vorgesehenen Arbeitsplatzes. Abb. Vergleich als Entscheidungshilfe (Gebauer 2012c) Behinderter Mitarbeiter Arbeitsplatz Ergebnisse von Arbeitsplatzanalysen Medizinischer Befund Fähigkeiten Möglichkeiten zur Verbesserung der Fähigkeiten? Vergleich Anpassung Mensch, Arbeit notwendig/ möglich? Arbeitsanforderungen Möglichkeiten zur Veränderung der Anforderungen? Entscheidung über geeigneten Arbeitsplatz Behindertengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes Einarbeitung am gestalteten Arbeitsplatz 93 5.5 Leistungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer Einschränkungen der erwerbsbezogenen Leistungsfähigkeit im Alter sind meist nicht primär durch das Alter bedingt, sondern durch chronische Erkrankungen. Der Höhepunkt körperlicher Leistungsfähigkeit liegt für Männer ungefähr bei 25 Jahren, für Frauen bei ca. 22 Jahren. Erwerbstätige ab dem 45. Lj. Werden in die Kategorie der älteren Arbeitnehmer eingeordnet. Während körperliche Leistungsfähigkeit, geistige Beweglichkeit, Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung, Kurzzeitgedächtnis und Risikobereitschaft mit zunehmendem Alter abnehmen, kommt es zu einer Zunahme von Lebens- und Berufserfahrung, Urteilsfähigkeit, Expertenwissen, Zuverlässigkeit, Kooperationsfähigkeit und Pflichtbewusstsein. Ältere Arbeitnehmer sind seltener krankheitsbedingt arbeitsunfähig als jüngere, aber aufgrund chronischer Erkrankungen fallen sie meist länger aus (Bangali u. Schmid 2006, BAuA 2011, DAK-Gesundheit 2012). Nach Groner (2012) sind dementsprechend folgende Tätigkeitsmerkmale für ältere Arbeitnehmer ungünstig: starker Zeit- und Leistungsdruck hohe körperliche Belastungen hohe Anforderungen an Feinmotorik, Aufmerksamkeit, Reaktionsschnelligkeit Nacht- und Schichtarbeit ungewohnte Arbeitsaufgaben Günstige Arbeitsanforderungen für ältere Arbeitnehmer sind dagegen: Autonomie Sorgfalt und Erfahrung Nutzung vorhandenen Wissens soziale Kompetenz selbstbestimmtes Lerntempo Anknüpfungsmöglichkeiten an Bekanntes (Groner 2012). A12 94 6. Literaturverzeichnis Alavinia SM, Burgdorf A (2008) Unemployment and retirement and illhealth: a cross-sectional analysis across European countries. Int Arch Occ Environ health 82: 39-45 Bangali L, Schmid J (2006) Altersatlas für Baden-Württemberg. Das Potenzial älterer Arbeitnehmer in Baden-Württemberg. http://www.uni- tuebingen.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Uni_Tuebinge n/Fakultaeten/SozialVerhalten/Institut_fuer_Politikwissenschaft/Prof.Schmi d/Documente/Forschung/%C3%A4ltere_Arbeitnehmer/Bangali_Schmid_20 06_a.pdf&t=1356973419&hash=77d3b4774b463fe9bec64de98749d6d152dc d240 (30.12.2012) Beland F, Birch S, Stoddart G (2002) Unemployment and health: contextual level influences on the production of health in populations. Social Science & Medicine 55: 2033-2052 Berth H, Förster P, Brähler E (2003) Gesundheitsfolgen von Arbeitslosigkeit und Arbeitsplatzunsicherheit. Ergebnisse einer Studie bei jungen Erwachsenen in den neuen Bundesländern. Sozial- und Präventivmedizin 50: 361-369 Berth H, Förster P, Brähler E (2005) Arbeitslosigkeit, Arbeitsplatzunsicherheit und Lebenszufriedenheit bei jungen Erwachsenen. Das Gesundheitswesen 10: 555-560 Berth H, Förster P, Brähler E, Zenger M, Stöbel-Richter Y (2009) Arbeitslosigkeit und Gesundheit – Ergebnisse der Sächsischen Längsschnittstudie. http://www.wiedervereinigung.de/sls/PDF/berthetal2011arbeitslosigkeit.pdf (03.01.2013) Birbaumer N & Schmidt RF (2006) Biologische Psychologie. Springer, Heidelberg 95 BKK Bundesverband (Hrsg.) (2009) BKK Gesundheitsreport 2009. Gesundheit in Zeiten der Krise. Essen BKK Bundesverband (2010) BKK-Gesundheitsreport. Gesundheit in einer älter werdenden Gesellschaft. Essen BKK Bundesverband (Hrsg.) (2011) BKK Gesundheitsreport 2011. Zukunft der Arbeit. Essen Blättner B, Waller H (2011) Gesundheitswissenschaft. Kohlhammer, Stuttgart Brenner MH (1979) Mortality and the national economy: a review and the experiences in England and Wales. Lancet ii: 568-573 Brussig M (2010) Alters-Übergangsreport 2011-02 Buchard PA (2009) Evaluation in der beruflichen Werkstatt. Ein neues Instrument für den Arzt. Suva Medical: 71-78 Buck H, Kistler E, Mendius H (2002) Demografischer Wandel in der Arbeitswelt. Chancen für eine innovative Arbeitsgestaltung. Stuttgart, Fraunhofer-IRB-Verlag Bundesagentur für Arbeit (BAG) (2012a) Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Arbeitsmarktberichterstattung Mai 2012. Strukturen der Arbeitslosigkeit. http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Arbeitsmarktberichte/B erichte-Broschueren/Arbeitsmarkt-Nav.html Bundesagentur für Arbeit (BAG) (2012b) Der Arbeitsmarkt in Deutschland Der Arbeitsmarkt für schwerbehinderte Menschen. Veröffentlichung der Arbeitsmarktberichterstattung, Nürnberg März 2012 (aktualisiert Juni 2012) http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Arbeitsmarktberichte/B erichte-Broschueren/Arbeitsmarkt-Nav.html 96 Bundesagentur für Arbeit (BAG) (2013) Der Arbeitsmarkt im Dezember 2012 (Stand 03.01.2013) http://www.arbeitsagentur.de/nn_27030/zentralerContent/Pressemeldungen/2013/Presse-13-001.html Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2011) Arbeitswelt im Wandel Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) (2006) ICF- Praxisleitfaden 1 Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) u. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2006) Erwerbstätigenbefragung 2006 – Arbeit und Beruf im Wandel, Erwerb und Verwertung beruflicher Qualifikationen. http://www.bibb.de/de/26738.htm Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ, 2006) Fünfter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) (2011) BPtK-Studie zur Arbeitsunfähigkeit. Psychische Erkrankungen – Keine Frage des Alters Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) (2012) BPtK-Studie zur Arbeitsunfähigkeit. Psychische Erkrankungen und Burnout. Bundesregierung (Hrsg.) (20) Lebenslagen in Deutschland. Der 3. Armutsund Reichtumsbericht der Bundesregierung. Berlin Bundesverband der Unfallkassen (2005) Betriebliche Prävention im Lichte des demographischen Wandels: Herausforderung und Chancen. Kurzinformationen über Forschungsergebnisse zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im öffentlichen Dienst 2005/02 http://www.dguv.de/inhalt/medien/bestellung/documents/FFDP22005.pdf DAK-Gesundheit (Hrsg.) DAK-Gesundheitsreport 2012 97 Deck R, Schramm S, Hüppe A (2012) Begleitete Eigeninitiative nach der Reha („neues Credo“) – ein Erfolgsmodell? Rehabilitation 51: 316-325 DGAUM (2006) Arbeitsmedizinische Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e. V. Arbeitsmed. Sozialmed. Umweltmed. 41, 8: 390-397 DGPPN (2012) S3-Leitlinie Unipolare Depression Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV, Hrsg) (2010) Sicherung und Gesundheit bei der Arbeit Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV; Hrsg.) (2010) Leitfaden für Betriebsärzte zu psychischen Belastungen und den Folgen in der Arbeitswelt. Deutsche Rentenversicherung (2012) Reha-Bericht. Die medizinische und berufliche Rehabilitation der Rentenversicherung im Licht der Statistik. DIMDI. Klassifikationen. http://www.dimdi.de/static/de/klassi/index.htm (03.01.2013) Drogenbeauftragte der Bundesregierung (2011) Frauen und Sucht. http://drogenbeauftragte.de/drogen-und-sucht/suchtstoffuebergreifendethemen/frauen-und-sucht.html (eingesehen 18.07.2012) Drogenbeauftragte der Bundesregierung (2012) Drogen- und Suchtbericht. www.drogenbeauftragte.de Elkeles T, Seifert W (1993) Arbeitslose und ihre Gesundheit: Langzeitanalysen für die Bundesrepublik Deutschland. Sozial- u. Präventivmedizin 38: 148-155 Elkeles T (2001) Arbeitslosigkeit und Gesundheitszustand. In: Mielk A, Bloomfield K (Hrsg) Sozial-Epidemiologie. Einführung in die Grundlagen, Ergebnisse und Umsetzungsmöglichkeiten. Juventa Verlag, 71–82 98 Feuerlein W (1995) Definition, Diagnose, Entstehung und Akuttherapie der Alkoholkrankheit. In: HK Seitz, CS Lieber, UA Simanowski (Hrsg.) Handbuch Alkohol, Alkoholismus, Alkoholbedingte Organschäden. Johann Ambrosius Barth, Leipzig, Heidelberg: 1-20 Fischer K & Irle H (2009) Psychische Störungen – Sozialmedizinische Bedeutung und Entwicklungen in der medizinischen Rehabilitation Frese M (1987) Arbeit und psychische Störungen. http://library.fes.de/gmh/main/pdf-files/gmh/1987/1987-11-a-679.pdf Freudenberger H, North G (1992) Burn-out bei Frauen – Über das Gefühl des Ausgebranntseins. Fischer Verlag Frankfurt Fuchs T (2006) Was ist gute Arbeit? INQA-Bericht Gatzke N (2007) Lebenslanges Lernen in einer alternden Gesellschaft. Friedrich-Ebert-Stiftung. Berlin Gebauer E (2012a) Einführung in die Begutachtungsmedizin. In: R Diehl, E Gebauer, A Groner (Hrsg.) Kursbuch Sozialmedizin, Deutscher ÄrzteVerlag Köln: 497-575 Gebauer E (2012b) Spezielle (sozial-)medizinische Begutachtung. In: R Diehl, E Gebauer, A Groner (Hrsg.) Kursbuch Sozialmedizin, Deutscher Ärzte-Verlag Köln: 581-652 Gebauer E (2012c) Leistungsdiagnostik und Beurteilungskriterien bei ausgewählten Krankheitsgruppen. In: R Diehl, E Gebauer, A Groner (Hrsg.) Kursbuch Sozialmedizin, Deutscher Ärzte-Verlag Köln: 657-736 Gordo LR (2006) Beeinflusst die Dauer der Arbeitslosigkeit die Gesundheitszufriedenheit? Auswertungen des Sozioökonomischen (SOEP) von 1984 bis 2001. In: A Hollederer u. H Brand (Hrsg.) Arbeitslosigkeit, Gesundheit und Krankheit. Huber, Bern: 53-73 99 Grobe TG, Schwartz FW (2003) Arbeitslosigkeit und Gesundheit. In: RKI (Hrsg.) Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 13 Berlin Grobe TG (2006) Sterben Arbeitslose früher? In: A Hollederer u. H Brand (Hrsg.) Arbeitslosigkeit, Gesundheit und Krankheit. Huber, Bern: 75-83 Groner A (2012) Arbeitsmedizinische Grundbegriffe. In: R Diehl, E Gebauer, A Groner (Hrsg.) Kursbuch Sozialmedizin, Deutscher Ärzte-Verlag Köln: 429-480 Gundel K (1981) Sucht und Situation – eine „Ökoanalyse“. Wiener Zeitschr Suchtforschung 4: 17-34 Gutzwiller F, Paccaud F (2007) Prävention und Gesundheitsförderung. In: F Gutzwiller & F Paccaud (Hrsg.) Sozial- und Präventivmedizin Public Health. Huber, Bern S. 195-230 Hölzinger J (2011) Prävention: krankmachende Arbeitswelt. Deutsches Ärzteblatt 5: 212 Hoffmann H& Hofmann J (2008): Rentenzugang 2007: Trendwende bei Zugängen in die Regelaltersrente? RVaktuell 5/6: 150-159 Hollederer A, Brand H (Hrsg.) (2006) Arbeitslosigkeit, Gesundheit und Krankheit. Huber, Bern Jacobi F, Wittchen HU, Holting C, Höfler M, Pfister H, Müller N, Lieb R. (2004) Prevalence, co-morbidity and correlates of mental disorders in the general population: results from the German Health Interview and Examination Survey (GHS). Psychol Med 34(4):597-611. Jaggi F (2008) Burnout – praxisnah. Thieme, Stuttgart 100 Jahoda M, Lazarsfeld PF, Zeisel H (1975) Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit. Frankfurt/M., Suhrkamp Jellinek EM (1952) Phases of alcohol addiction. Quart J Stud Alc 13: 673 Karasek R u. Theorell T (1990) Healthy work. Stress, productivity, and the reconstruction of working life. New York, Basis Books KivimäkiM, Virtanen M, Vartia M, Elovainio M, Vahtera J, KeltikangasJärvinen L (2003) Workplace bullying and the risk of cardiovascular disease and depression. Occup Environ Med 60: 779-783 Kroll LE, Müters S, Dragano N (2011) Arbeitsbelastungen und Gesundheit. Hrsg. Robert Koch-Institut Berlin, GBE kompakt 2(5) www.rki.de/gbe-kompakt (Stand: 28.06.2011) Kroll LE, Lampert T (2012) Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung und Gesundheit. Hrsg. Robert Koch-Institut Berlin, GBE kompakt 1(3) www.rki.de/gbe-kompakt (Stand: 18.10.2012) Lampert T, Kroll LE, Kuntz B et al. (2011) Gesundheitliche Ungleichheit. In: Destatis, WZB (Hrsg) Datenreport 2011: Der Sozialbericht für Deutschland. Bundeszentrale für politische Bildung, Wiesbaden, S 247–258 Lazarus RS (1991) Emotion and adaptation. Oxford University Press, Oxford, New York Leymann H (2000) Mobbing – Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehrt. Rowohlt Verlag, Reinbek Linden M, Schippan B, Baumann K, Spielberg R (2004) Post-traumatic embitterment disorder (PTED). Differentiation of a specific form of adjustmrnt disorders. Nervenarzt 75: 51 101 Lopez AD, Mathers CD, Ezzati M, Jamison DT, Murray CJ. Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: systematic analysis of population health data. Lancet 2006: 367(9524):1747-57 Marmot M, Shipley M, Rose G (1984) Inequalities in death - specific explanation of a general pattern? Lancet 1: 1003-1006 Marmot M, Bosma H, Hemingway H, Brunner E, Stansfeld S (1997) Contribution of job control and other risk factors to social variations in coronary heart disease incidence. Lancet 350: 235-239 Meschkutat B, Stackelbeck M, Langenhoff G (2002) Der Mobbing-Report. Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – Forschung – Fb 951 Mirowsky J & Ross CE (1989) Social causes of psychological distress. Aldine de Gruyter, New York Möller-Leimkühler AM, Schwarz R, Burtscheid W, Gaebel W(2012) Alcohol dependence and gender-role orientation. European Psychiatry 17: 1-8 Müller U, Heinzel-Gutenbrunner M (2001) Krankheiten und Beschwerden (subjektive Gesundheit) unter Bewertung der eigenen Gesundheit. Materialien zur Bevolkerungswissenschaft, Bundesinstitut fur Bevolkerungsforschung Nägele G, Sporket M (2007) Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Betrieb – betriebliche Fallbeispiele zur Beschäftigungsförderung in ausgewählten Ländern der Europäischen Union. Hans Böckler Stiftung Nagel U, Gerecke U, Jessulat R, Kainrat S (2011) Erweiterte Prävention in der Arbeit: Erfassung psychischer Fehlbelastungen, Fehlbeanspruchungen und Gesundheitsressourcen mit den validierten Diagnoseinstrumenten psy.Risk®. Zbl Arbeitsmed 61: 230-242 Ott G, Oberlinner C, Lang S et al. (2009) Health and safety protection for chemical industry employees in a rotating shift system: program design and acute injury and illness experience at work. Am Coll Occupational Environmental Med, JOEM 51: 221-231 102 Parent-Thirion A, Macias EF, Hurley J, Vermeylen G (2007) Fourth European Working Conditions Survey. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Ed.) http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/98/en/2/ef0698en.pdf Parent-Thirion A, Vermeylen G, van Houten G, Lyly-Yrjänäinen M, Biletta I, Cabrita J (2012) Fifth European Working Conditions Survey. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Ed.) http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/82/en/1/EF1182EN.pdf Paoli P, Merllié D (2001) Third European Working Conditions Survey. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Ed.) http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2001/21/en/1/ef0121en.pdf Paul KI, Hassel A, Moser K (2006) Die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die psychische Gesundheit – Befunde einer quantitativen Forschungsintegration. In: Hollederer/Brandt (Hrsg.) Arbeitslosigkeit, Gesundheit und Krankheit. Bern, Hans Huber: 35-51 Rehfeld UG (2006) In: RKI (Hrsg.) Gesundheitliche Frühberentung. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 30, Berlin Reik R (2011) Zielgruppenspezifische Gesundheitsförderung von produzierenden Schichtarbeitern. Dissertation Universität Konstanz. http://kops.ub.uni-konstanz.de/bitstream/handle/urn:nbn:de:bsz:352150941/Diss_Reik.pdf?sequence=3 Rösing I (2003) Ist die Burnout-Forschung ausgebrannt? Analyse und Kritik der internationalen Burnout-Forschung. Asanger Verlag Rose U, Jacobi F (2006) Gesundheitsstörungen bei Arbeitslosen – ein Vergleich mit Erwerbstätigen im Bundesgesundheitssurvey 98. Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 41: 556-564 103 Ruppenthal S, Lück D (2009) Jeder fünfte Erwerbstätige ist aus beruflichen Gründen mobil. Berufsbedingte räumliche Mobilität im Vergleich. In: Informationsdienst Soziale Indikatoren (ISI) 42: 1-5. Ruppenthal S, Rüger H (2011) Berufsbedingte räumliche Mobilität - Konsequenzen für Wohlbefinden und Gesundheit. In: Zukunft der Arbeit. BKK Gesundheitsreport 2011. http://www.bkk.de, S. 120-125 (05.12.2012) Schaarschmidt U (2006) AVEM - ein persönlichkeitsdiagnostisches Instrument für die berufsbezogene Rehabilitation. In Arbeitskreis Klinische Psychologie in der Rehabilitation BDP (Hrsg.).Psychologische Diagnostik Weichenstellung für den Reha-Verlauf. Deutscher Psychologen Verlag GmbH, Bonn. S. 59-82 Schaarschmidt U, Fischer A (2006) Arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster AVEM, Manual. Harcourt Test Services Schmidt G (2005) Qualitätssicherung in der Begutachtung – Herausforderung für Leistungsträger und Gutachter – aus Sicht eines Sozialrichters. Med Sach 101: 62-64 Schuntermann MF (ohne Jahresangabe) Die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) – Kurzeinführung. http://www.deutsche- rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/35814/publicationFile/17936/icf_kurzeinfue hrung.pdf Schwickerath J, Carls W, Zielke M, Hackhausen W (2004) Mobbing am Arbeitsplatz – Grundlagen, Beratungs- und Behandlungskonzepte. Pabst Science Publishers, Lengerich Seidel D, Solbach T, Fese R, Donker L, Elliehausen HJ (2007) In: RKI (Hrsg.) Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 38, Berlin 104 Siegrist J (1996) Soziale Krisen und Gesundheit. Göttingen, Hogrefe Siegrist J (2005) Medizinische Soziologie. Elsevier, Urban & Fischer, München, Jena Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (1998) Gesundheitsbericht für Deutschland. Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Metzler-Poeschel, Stuttgart Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2011) Im Blickpunkt. Ältere Menschen in Deutschland und in der EU. Destatis, wissen.nutzen. Stöver H (2006) Mann, Rausch, Sucht: Konstruktionen und Krisen von Männlichkeiten. Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis 38: 63-76 Techniker Krankenkasse (2010) Gesundheitsreport 2010. Veröffentlichungen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement der TK, Band 24 Techniker Krankenkasse (2012) Gesundheitsreport 2012. Veröffentlichungen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement der TK, Band 27 Toumi I (2006) Die Rolle der Sozialmedizin bei der Umsetzung des SGB II. In: A Hollederer, H. Brand (Hrsg.) Arbeitslosigkeit, Gesundheit und Krankheit. Huber, Bern: 199-213 Turtle AM, Ridley A (1984) Is unemployment a health hazard? Healthrelated behaviours of a sample of unemployed Sidney youth in 1980. Australian J Social Issues 19: 27-42 WAI-Netzwerk. Work Ability Index. http://www.arbeitsfaehigkeit.uniwuppertal.de/ (03.01.2013) Wamala S, Mitteleman MA, Horsten M, Schenck-Gustafsson K, OrthGomer K (2000) Job stress and the occupational gradient in coronary heart disease risk in women. Social Science & Medicine 51: 481-489 105 Weber A, Lehnert G (1997) Unemployment and cardiovascular diseases: a causal relationship? Int Arch Occup Environ Health 70: 153-160 Weber A, Weltle D, Lederer P (2004) Frühinvalidität im Lehrerberuf: Sozial- und arbeitsmedizinische Aspekte. Dtsch Ärztebl 101: A850-A859 Weber A, Hörmann G, Köllner V (2007a) Mobbing – eine arbeitsbedingte Gesundheitsgefahr der Dienst-Leistungs-Gesellschaft? Gesundheitswesen 69: 267-276 Weber A, Hörmann G, Heipertz W (2007b) Arbeitslosigkeit und Gesundheit aus sozialmedizinischer Sicht. Dtsch Ärztebl 104: A 2957-2962 106 Anhang Aufgaben, Vertiefungsliteratur und weiterführende Links A1 Welche Auswirkungen hat der demografische Wandel auf den Arbeitsmarkt? A2 Was versteht man unter Empowerment? Unter welchen Bedingungen wirkt sich Arbeit positiv auf Selbstwertgefühl und Gesundheit aus? Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen Bildung, Teilhabe am Erwerbsleben und Gesundheit. Stellen Sie die wichtigsten Modelle zur Erklärung der Zusammenhänge von Arbeit und Gesundheit dar und diskutieren Sie ihre Stärken und Schwächen. A3 Beschreiben Sie den Wandel der Arbeitsbedingungen und –belastungen in den vergangenen Jahrzehnten. Definieren Sie die Begriffe „arbeitsbedingte Erkrankungen“ und „Berufskrankheit“. Welche kausalen Zusammenhänge müssen erfüllt sein, damit eine Berufskrankheit anerkannt wird? Welches sind die häufigsten anerkannten Berufskrankheiten? 107 Welche Gesundheitsprobleme sind häufig mit Nacht- und Schichtarbeit verbunden? Vertiefungsliteratur Seidel D, Solbach T, Fese R, Donker L, Elliehausen HJ (2007) In: RKI (Hrsg.) Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 38, Berlin http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichter stattung/GesundAZ A4 Was versteht man unter Stress? Erklären Sie die Zusammenhänge von Stress und Gesundheit bzw. Krankheit. Was versteht man unter Mobbing? Nennen Sie typische MobbingHandlungen. Wie wirkt sich Mobbing am Arbeitsplatz auf die Gesundheit der Betroffenen aus? Wie wirkt sich berufsbedingte räumliche Mobilität auf die Gesundheit älterer Arbeitnehmer aus? Was versteht man unter Burnout? Welche Bedeutung haben psychische Störungen und Erkrankungen für Arbeitsunfähigkeit, insbesondere bei älteren Erwerbstätigen Vertiefungsliteratur Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) (2012) BPtK-Studie zur Arbeitsunfähigkeit. Psychische Erkrankungen und Burnout. http://www.bptk.de/uploads/media/20120606_AU-Studie-2012.pdf 108 A5 Welche Veränderungen haben sich in den letzten Jahren bezüglich des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand ergeben? Nennen Sie die Hauptgründe für Frühberentungen. Was versteht man unter dem „healthyworker-effect“? Welche Interventionsansätze gibt es, um einen längeren Verbleib älterer Arbeitnehmer im Berufsleben zu erreichen? Welche Faktoren sind bei solchen Interventionen zu berücksichtigen? Vertiefungsliteratur Rehfeld UG (2006) In: RKI (Hrsg.) Gesundheitliche Frühberentung. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 30, Berlin http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichter stattung/GesundAZ A6 Wie ist Arbeitslosigkeit/Langzeitarbeitslosigkeit definiert? Welche Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und Gesundheitsverhalten bzw. Lebensstilfaktoren werden beschrieben? Welche Erkrankungen sind besonders mit Arbeitslosigkeit assoziiert? Welche Unterschiede finden sich für Männer und Frauen? A7 Was versteht man unter einer „posttraumatischen Verbitterungsstörung“? Wodurch unterscheidet sich dieses Störungsbild von einer Depression? Welche Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und Alkoholabhängigkeit werden diskutiert? 109 Welche Zusammenhänge zwischen Erwerbstätigkeit und Alkoholabhängigkeit werden diskutiert? In welchen Berufen besteht eine besondere Gefährdung? A8 Wie unterscheiden sich Kurzzeit- und Langzeitarbeitslose unter Berücksichtigung von Alter und Geschlecht hinsichtlich ihres Gesundheitszustands? Erläutern Sie mögliche kausale Zusammenhänge von Arbeitslosigkeit und Krankheit und diskutieren Sie verschiedene Erklärungsmodelle. Schildern Sie ein Fallbeispiel aus Ihrer beruflichen Praxis, was eher die Kausalitätshypothese oder die Selektionshypothese belegt. Vertiefungsliteratur Kroll LE, Lampert T (2012) Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung und Gesundheit. Hrsg. Robert Koch-Institut Berlin, GBE kompakt 1(3) www.rki.de/gbe-kompakt (Stand: 18.10.2012) A9 Welches sind die wichtigsten international gebräuchlichen medizinischen Klassifikationssysteme? Wo werden sie eingesetzt? Warum wurde zusätzlich zur ICD die ICF entwickelt? Welche Dimensionen werden in der ICF klassifiziert? Welches Modell von Gesundheit und Krankheit steht hinter der ICF? 110 A10 Nennen Sie Beispiele für Bereiche der sozialmedizinischen Begutachtung. Beschreiben Sie die Kommunikationsprozesse der (sozial)medizinischen Begutachtung. Erläutern Sie die Begriffe „finale“ und „kausale Betrachtung“ im Zusammenhang mit medizinischen Gutachten und nennen Sie Beispiele entsprechender Begutachtungsbereiche Wie sind die Begriffe „Minderung der Erwerbsfähigkeit“ und „Erwerbsminderung“ definiert und welchen Sozialleistungbereichen sind sie zuzuordnen? Wie sind die Begriffe „Grad der Schädigung“ und „Grad der Behinderung“ definiert und welchen Sozialleistungsträgern sind sie zuzuordnen? Welche Aufgaben hat der ärztliche Dienst der Agenturen für Arbeit? A11 In welchen Bereichen der sozialmedizinischen Begutachtung ist die Beurteilung der erwerbsbezogenen Leistungsfähigkeit von Bedeutung? Wie sind die Begriffe „Leistungsfähigkeit unter Realbedingungen“ und Leistungsfähigkeit unter Idealbedingungen“ definiert? Welche Faktoren beeinflussen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft und müssen entsprechend bei der Beurteilung berücksichtigt werden? Was versteht man unter dem Work Ability Index? Informieren Sie sich unter folgendem Link über das arbeitsbezogenen Assessment ERGOS: http://www.youtube.com/watch?v=_fXmXgpibwY 111 A12 Nennen Sie Merkmale des qualitativen/quantitativen Leistungsvermögens. Wodurch unterscheidet sich die erwerbsbezogene Leistungsfähigkeit von jüngeren und älteren Arbeitnehmer_innen? Welche Tätigkeitsmerkmale sind für ältere Erwerbstätige eher günstig, welche eher ungünstig? 112