Der PfarrPlan und seine Auswirkungen auf Strukturen und
Werbung

Der PfarrPlan und seine Auswirkungen auf Strukturen und Verwaltung der Kirchengemeinden Die meisten von Ihnen werden sich noch an Oberkirchenrat Pfisterer erinnern. Für ihn trat immer dann der nervliche Super-GAU ein, wenn einer der Prälaten das Wort „ekklesiologisch“ in den Mund nahm. Für ihn war dieses Adjektiv Inbegriff aller theologischen Schleiertänze. Und wenn dieses Wort fiel, war klar: Ab jetzt herrscht Nebel. Für einen württembergischen Verwaltungsbeamten eine ausgesprochen unangenehme Situation! Ich weiß das. Und deshalb freue ich mich einerseits über die Einladung. Andererseits habe ich ordentlich Respekt davor. Was kann vor Ihren kritischen Ohren Bestand haben und ab welchem Zeitpunkt werden Sie wohl den Eindruck haben, dass dem klar strukturierten Denken und Handeln einer geordneten Verwaltung das kreative Chaos der Pfarrer/innen entgegenkommt, das Sie aus Ihrem Alltag ja ganz gut kennen und mit dem Sie oft genug zu kämpfen haben? Ich lasse mich dennoch auf dieses Unternehmen ein. Die Gefahren nicht ganz genau einschätzen könnend, die auf mich warten. Und bin gespannt auf Aussprache und Diskussion. Der PfarrPlan und seine Auswirkungen auf die Strukturen und Verwaltung der Kirchengemeinden … Der PfarrPlan ist zu einem Symbol geworden. In ihm verdichtet sich alles, was als Unheil „von oben“ über die Kirchengemeinden hereinbricht und über alle, die in den Kirchengemeinden Verantwortung tragen. Das sind neben den Pfarrer/innen, auch die Mitglieder in den Kirchengemeinderäten, die Kirchenpfleger/innen und viele andere haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende. Kurz: alle, die sich mit einer Gemeinde verbunden fühlen. Wenn ich nun eine Umfrage auf der Königsstraße in Stuttgart machen würde oder auf dem Wochenmarkt in Leonberg, dann würden – da lege ich meine Hand ins Feuer – die meisten Menschen mit dem Wort PfarrPlan nichts anfangen können. Entsprechend ausgesprochen käme es evtl. zum Missverständnis, warum sie nach einem „Fahrplan“ gefragt würden. 1 Ganz anders sieht es aus, wenn man auf einer Bezirkssynode zu Gast ist. Da wird heftig und leidenschaftlich gestritten. Aber selbst in einer Gemeinde, in der es hoch hergeht, weil sie vom PfarrPlan zum zweiten Mal in Folge betroffen ist: Dort kamen zu einem Gesprächsabend, zu dem ich eingeladen wurde, Gemeinde immerhin knapp 30 Leute. Das ist viel für eine Gemeinde mit rund 800 Seelen. Aber eben doch auch nur 30 Leute. Und das in einer überschaubaren Struktur und einer dörflichen Kultur des Sich-Kennens und Schwätzens und einer hohen Verbundenheit mit Kirche und Gemeinde. Was ich damit sagen will? Zunächst einmal nur dieses: Wir sollten die Diskussion um den PfarrPlan und um andere Strukturanpassungen in unserer Landeskirche nicht überschätzen. Für die meisten unserer Gemeindeglieder sind sie überhaupt nicht relevant und werden nicht einmal wahrgenommen. Anders sieht es mit den Betroffenen aus. Die sind oft sehr gekränkt und voller Wut und Enttäuschung, aber auch Sorge um die Zukunft der Kirche, um die Zukunft Ihrer Gemeinde. Ich begegne in den innersten Zirkeln der Kirche oft einer großen Resignation und stillen, manchmal lauten Verzweiflung, die sich in Anklagen ergeht und die das Ende nahe sieht. Und ich begegne außerhalb der Kirche einer unglaublichen Wertschätzung, manchmal Überschätzung dessen, was Kirche ist, was sie kann und was sie alles hinkriegt. Ich glaube, wir müssen uns das ab und zu mal wieder sagen lassen: Wir sind, Sie alle sind besser als Sie denken. Und dass nicht alles optimal ist, ja, dass manches – um es vorsichtig zu sagen – suboptimal ist, das gehört zum Lauf dieser Welt. Trotzdem will ich es mir nicht zu einfach machen und einfach einen Deckel über Ihre emotionalen Gestimmtheiten stülpen und deshalb frage ich weiter: Was ist in unserer Kirche eigentlich los? 2 Ich verdanke dem Praktischen Theologen, Jan Hermelink, eine Begriffsbildung, die mir sehr eingeleuchtet hat und die ich außerordentlich aufschlussreich finde. Jan Hermelink spricht von einer „Reformation von oben“ und charakterisiert mit diesem Begriff, das was derzeit von Oberkirchenräten und Landeskirchenämtern EKD-weit angegangen und angefangen wird. Ausgehend von der Debatte um die EKD Schrift „Kirche der Freiheit“ macht sich Jan Hermelink Gedanken zum Thema Kirche. Mir ist an seinen Ausführungen der Systembruch der letzten 15 Jahre in seiner ganzen Schärfe bewusst geworden. Hermelink führt aus, dass sich die Resonanz, die „Kirche der Freiheit“ gefunden hat, nicht nur einer guten Öffentlichkeitsarbeit verdankt. Das auch. Vor allem aber sieht er die außerordentliche Wirkung darin begründet, dass in diesem Papier wesentliche Entwicklungen und Tendenzen gebündelt sind, die seit rund 15 Jahren die kirchliche Debatte beherrschen. „Kirche der Freiheit“ gehört in eine längere Reihe von Publikationen, in denen sich - und das ist eben der Systembruch – kirchenleitende Gremien programmatisch zur Zukunft der Kirche äußern. Den Anfang machte die Evangelische Kirche von Hessen Nassau mit der Schrift „Person und Institution – Volkskirche auf dem Weg in die Zukunft“. Das war 1992. Inzwischen haben zahlreiche Synoden, Oberkirchen- und Landeskirchenräte Perspektivpapiere oder Leitlinien verfasst, in denen sich Analysen mit mehr oder weniger konkreten Modellüberlegungen oder Handlungsanweisungen (meistens auch Sparvorschlägen) verbinden. Es weht ein ausgesprochen pragmatischer Geist durch diese Papiere. Konkrete Ziele werden formuliert. Klare Mitarbeiterprofile und Strukturen definiert. Kirche wird als Organisation entdeckt, die Visionen braucht und für deren Wachstum etwas getan werden muss. Die Kirchentheorie der Gegenwart – so Hermelink – ist zu einem guten Teil eine Theorie kirchlicher Gestaltung. genauer: kirchlicher Reformanstrengung. Befragungen spielen in all diesen Papieren eine große Bedeutung. Sie spüren davon etwas, wenn ungefähr jede Woche eine andere landeskirchliche Dienststelle eine statistische Untersuchung durchführt. 3 Auf Ebene der EKD gehören dazu die Mitgliedschaftsuntersuchungen. Auf der Ebene der Landeskirche werden die demographischen Entwicklungen in den Blick genommen. Die Finanzentwicklung wird in Kurven regelmäßig publiziert. Das Erstellen der Mittelfrist ist in jedem Jahr eine mittlere Katastrophe. Handlungsleitend sind Maximen wie das „Wachsen gegen den Trend“ oder „eine immer weitere Pluralisierung und Ausdifferenzierung des kirchlichen bzw. religiösen Angebots“. Man ist offen. Offen für außertheologische Einsichten, Theorien und Sprachformen. Und wenn auch die ökonomische Diktion immer noch geeignet ist, Widerstände – zumindest in der Pfarrerschaft - hervorzurufen, so ist doch ein bestimmtes Sprach-setting von Zielvereinbarung, Mitarbeitendengespräch, Evaluierung, Budgetierung inzwischen ebenso selbstverständlich geworden, wie die Redeweise von kirchlichen Angeboten und Zielgruppen. Die „Reformation von oben“ zielt auf Strukturfragen. Neue Gemeindeformen sind im Blick, ebenso wie die Stärkung des Ehrenamts oder die Frage, was macht eine Landeskirche zu einer funktionsfähigen Landeskirche. Darin spiegelt sich der Kontext der gegenwärtigen Debatte: sinkende Kirchensteuereinnahmen, schwindende gesellschaftliche Bedeutung und eine zunehmende Präsenz nicht-christlicher Religionsgemeinschaften. Diese Ausgangslage macht Kirchenleitungen nervös, und versetzt Kirchenämter unter einen Veränderungsdruck, der von den Gemeinden vor Ort nicht unbedingt nachvollzogen oder gar mitvollzogen wird. Ich zitiere Jan Hermelink: „Während die Kirche vor Ort eher als Institution, als eingebettet in vielfältige biographische und kulturelle Lebensbezüge erscheint, tritt für die Leitungsinstanzen der Organisationscharakter der Großkirchen in den Vordergrund; kirchliche Reform lässt sich aus dieser Perspektive eher über Strukturveränderung bewerkstelligen als über die inhaltliche Arbeit an leitenden Begriffen und Theorien.“ Energisches Handeln wird gefordert – und von vielen – vor allem auch von der Synode eingeklagt! Alles Reflektierende, Abwartende, Zögernde wird als wenig hilfreich angesehen und schnell in Misskredit gebracht. Als typisch akademisch. Als typisch deutsch abqualifiziert. Und nicht zuletzt als selbstbezügliche Genügsamkeit gebrandmarkt, die ins Scheitern verliebt ist und den Erfolg meidet wie der Teufel das Weihwasser. Charakteristisch ist das Stichwort Krise für diese Form des Nachdenkens über die Kirche. 4 Ich habe es schon angedeutet, dass diese Krise als Mitglieder-, als Finanz- und als Relevanzkrise wahrgenommen wird. Die Forderungen für die Zukunft richten sich deshalb auf Mitgliederorientierung, auf die Erschließung neuer Finanzquellen und äußert sich nicht zuletzt im Ruf nach einer deutlichen Profilierung der Kirche - frei nach dem Motto „wo evangelisch drauf steht, muss auch evangelisch drin sein“. Der Mitgliederorientierung entspricht das gewachsene Interesse an Mitgliedsschaftsuntersuchungen und Statistiken, wobei deren Deutung – ich sage es vorsichtig – nicht so einfach ist. Wie ist z.B. die viel zitierte distanzierte Kirchlichkeit zu bewerten? Ist sie Ausdruck einer außerordentlich stabilen und fraglosen Einbettung des Einzelnen in das kirchliche bzw. gesellschaftliche Leben? Oder – werden die kirchlich Distanzierten unter dem Druck schwindender Ressourcen zu einer Gruppe, die es „wiederzugewinnen“ bzw. neu zu beheimaten gilt? Und auch die derzeit sehr in Mode gekommene Milieutheorie fördert an manchen Orten eine Euphorie und einen Gestaltungsoptimismus, der den kirchlichen Handlungsspielraum meines Erachtens deutlich überschätzt. Der Problematik der kirchlichen Finanzen entspricht eine hitzige Debatte um alternative Finanzierungssysteme. Hermelink erklärt hierzu: „Eine theologisch-theoretische Deutung dieser herkömmlichen Verhältnisse …, die sich gegenwärtig unter dem Stichwort „fundraising“ vollziehen, ist …bisher nur punktuell und ansatzweise zu erkennen. So lange dies nicht geschieht, besteht jedoch sowohl die Gefahr einer theologischen Überhöhung des etablierten Kirchensteuersystems wie umgekehrt einer Verklärung alternativer, mehr auf Eigeninitiative und Projektbezug setzender Finanzierungskonzepte.“ Auf den öffentlichen Relevanzverlust haben die Kirchen – so Hermelink – mit dem vielfältigen Ausbau ihrer Öffentlichkeitsarbeit, vor allem aber auch mit episkopaler/personaler Medienpräsenz reagiert. Aber auch mit events, die zeigen sollen: Kirche ist modern, ist spritzig, ist ganz anders als man immer denkt … Dass Kirche auch anders präsent ist: in Gebäuden, in Gottesdiensten, in Personen, in Gruppen und Kreisen, das wird eher weniger wahrgenommen oder in Qualitätsoffensiven zum Thema gemacht. Beides birgt in sich ein enormes Kränkungspotential. 5 Die Äußerungen des früheren Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber, aber auch des früheren bayerischen Landesbischofs haben selbst in der württembergischen Pfarrer/innenschaft für ziemliche Irritationen gesorgt. Die geheime Angst (vielleicht in Württemberg besonders verbreitet), dass ich nicht genüge, wurden durch Aussagen über ungenügende oder mangelhafte Predigten wie ein Keulenschlag wahrgenommen. Aber auch die regelmäßig wiederkehrende Schelte über schlechte Gottesdienste geäußert von Redakteuren der Zeit oder Süddeutschen Zeitung vor Heiligabend haben eine unglaubliche Wirkung auf Kollegen. Aber zurück zu unserer Fragestellung. Wie stabil, wie instabil ist die Kirche? Wie wahrnehmungsstark sind unsere Analysen? Von welchen Interessen, von welchen Traumbildern sind sie geleitet? Und welches Bild von Kirche leitet uns? Natürlich wollen wir alle wahrnehmen und sehen, was ist. Aber die Wirklichkeit ist unübersichtlich und nicht auf einen Nenner zu bringen. Ich habe selbst an einer kleinen EKD-Studie mitgearbeitet „Wandeln und Gestalten – missionarische Chancen und Aufgaben der evangelischen Kirche in ländlichen Räumen“ (eine Art Fortsetzung von Kirche der Freiheit in der Konkretion für die ländlichen Räume). Da war der erste wichtige Schritt: Sehen lernen. Mit Hilfe von Sozialraumanalysen und sozialplanerischen Daten sollen da Kirchengemeinderäte, Kreissynode und Landeskirchenämter ermutigt werden, den Ist-Stand zu erheben und verstehen, wo man lebt und unter welchen Bedingungen man lebt. Aber wenn man das ernst nimmt und das wirklich versucht – und ich habe das mit Dekanen und Dekaninnen in unserer Landeskirche dann einmal ansatzweise ausprobiert, dann stellt man fest: In ein und demselben Kirchenbezirk wird man Gemeinden vom Typ 1 und vom Typ 7 finden und alles was dazwischen ist. Und wenn man das für eine Gemeinde durchbuchstabiert, wird man Straßenzüge finden, von denen man sagt: hier hat man einen sozialen Brennpunkt und hier hat man ein etabliertes Wohngebiet. Hier wohnt die bürgerliche Mitte, dort steht das Haus eines modernen Performers und da drüben haben wir die Konsummaterialisten, die uns immer auch ein bisschen unheimlich sind. 6 Kurz gesagt: Die Situation gestaltet sich uneinheitlich und unübersichtlich. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen kann einem ganz schön zu schaffen machen. Wir begegnen in unseren Gemeinden eben nicht nur der Postmoderne, sondern auch dem 19. Jahrhundert! Und das Verheißungsparadigma „junge Familien“ ist nicht wirklich tragfähig, denn auch junge Familien werden älter. Und die Neubaugebiete von heute sind in 15-20 Jahren absolut tote Ecken in einer Gemeinde. Da, wo sich gar nichts mehr tut. Gebiete ohne jede Entwicklungs- und fast ohne Wachstumsverheißung. Ich merke an mir selbst, wie mich das Alarmistische an der Diskussion immer stärker abstumpft und auf innere Distanz gehen lässt. Ich bin mir sicher, dass wir mit Leuchttürmen und Leuchtfeuern keine Menschen gewinnen werden können. Denn Menschen merken sehr wohl, wenn sie instrumentalisiert werden sollen. Das macht sie misstrauisch und renitent. Klar ist, dass sich vieles ändern wird. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und ich merke auch, dass ich diejenigen, die meinen, es werde alles immer so bleiben, wie es jetzt ist, nicht verstehen kann. Es wird anders werden. Wir werden von den Verhältnissen, von den Veränderungen verändert werden, und sind es ja auch schon. Und – das ist das Entscheidende: Wir werden den Rückbau organisieren müssen. Wir werden den maßlosen Ausbau an Strukturen der 60-er, 70-er und 80-er Jahren zurückbauen müssen. Wenn wir das schaffen, dann ist das – da bin ich mir sicher – auch so etwas wie die Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Wie das im Einzelnen funktionieren kann, ist jeweils im Einzelnen auch zu entscheiden und zu prüfen. Ich glaube nicht an die Gesamtentwürfe, auch wenn wir uns gerade in Württemberg mal wieder an ein solches Projekt gemacht haben. Für viel entscheidender halte ich die Frage: in welcher inneren Haltung gehen wir diesen Weg? Als einzelne, als Gemeinden, als Kirche. Mir erscheinen die Versuche der Reformation von oben, die von den Kirchenleitungen angestrebt werden, zu denen ich mich auch zähle (keine Frage), zunehmend wie der krampfhafte Versuch, Kirche auf der Höhe der Zeit zu präsentieren. Es fällt ja nicht umsonst immer wieder das Stichwort, man sei eine lernende Organisation. 7 Das ist im Prinzip völlig richtig und auch gut. Nur vermittelt man damit den Eindruck, man habe unendlich viel nachzuholen. Man möchte mithalten können. Man möchte eben auch wegen seiner Werke gerühmt werden. Wegen seiner Leistungen vor der Welt Anerkennung und Respekt finden. Man möchte nicht mehr beschämt werden. Nur in Klammern gesagt: Vielleicht ist deshalb der Wunsch nach der Messe auf Latein wieder so lebendig. Wenn man nicht versteht, was die Priester sagen, dann ist es wenigstens geheimnisvoll und bedeutend, was sie von sich geben… Die Kirche steht im 21. Jahrhundert etwas entzaubert da … Sie ist wirklich nicht mehr eine triumphierende Kirche. Man schämt sich ein bisschen. Man braucht keine Kirchenmitgliedschaft mehr, um etwas zu werden … Auch als Bürgermeister kann man inzwischen auf der Schwäbischen Alb aus der Kirche ausgetreten sein und wird trotzdem gewählt. Wir müssen – so glaube ich – mit dieser „Schmach“ leben lernen. Wir müssen damit leben lernen, dass der Pfarrberuf nicht mehr der angesehenste Beruf ist, dass Friedrich Wilhelm Graf in der Frankfurter Allgemeinen öffentlich über die Feminisierung des Pfarramts räsonieren und darüber jammern darf, dass die hochqualifizierten tollen Männer mit den hervorragenden Examina eben nicht ins Pfarramt gehen, sondern sich einen anderen, einen richtig „guten“ Arbeitgeber suchen. Wir müssen endgültig mit dem Verlust des landesherrlichen Kirchenregiments fertig werden und die Säkularisierung der Gesellschaft ausbuchstabieren – auch in ihren für uns bitteren und schmerzlichen, auch peinlichen Dimensionen. Erst wenn wir das hinkriegen und wirklich kapiert haben, dass wir eine Minderheit sind (und das existentiell kapiert haben), erst dann kann ein neues Selbstbewusstsein wachsen. Ein Selbstbewusstsein, das nicht mehr etwas verkrampft festhalten muss, das es nicht mehr gibt, und das vor allem, entspannt, das nehmen und akzeptieren kann, was ist. Der Prophet Jeremia erlebt in seiner Berufung eine sehr paradoxe Beauftragung. Er wird eingesetzt, um auszureißen und einzureißen, zu zerstören und zu verderben und zu bauen und zu pflanzen. Eine geprägte Formel des deuteronomistischen. Geschichtswerks, das den Propheten Jeremia begleitet. Diese Verben tauchen immer wieder auf, um sein Handeln, sein Wirken zu 8 charakterisieren. Auf den ersten Blick ist Destruktion angesagt; aber es gibt auch - in der Fluchtlinie sozusagen - eine Phase der Konstruktion. Wenn nun immer so gebaut, gezimmert und konstruiert wird und von Visionen und Zielen die Rede ist, scheint es mir an der Zeit, auch diese Dimension des biblischen Wortes in Erinnerung zu rufen. Es gibt eine sehr markante Predigt von Dietrich Bonhoeffer, deren Aktualität und Direktheit mich tief beeindruckt. Ich möchte deshalb eine Passage daraus zitieren, um deutlich zu machen, dass wir uns oft mit den vorletzten Dingen so sehr beschäftigen, vielleicht deshalb, weil uns der Mut für die letzten Dinge fehlt. Aber nun zu Bonhoeffer, der in seiner Predigt zum Kirchenwahlsonntag 1934 in einer Auslegung zu Mt 16 („Du bist Petrus – und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen“) folgendes ausführte: „Aber nicht wir sollen bauen, sondern er will bauen. Kein Mensch baut die Kirche, sondern Christus allein. Wer die Kirche bauen will, ist gewiss schon am Werk der Zerstörung. Denn er wird einen Götzentempel bauen, ohne es zu wollen und zu wissen. Wir sollen bekennen – er baut. Wir sollen verkündigen – er baut. Wir sollen zu ihm beten – er baut. Wir kennen seinen Plan nicht. Wir sehen nicht, ob er baut oder einreißt. Es mag sein, dass die Zeiten, die nach menschlichem Ermessen Zeiten des Einsturzes sind, für ihn die großen Zeiten des Bauens sind. Es mag sein, dass die menschlich gesehen großen Zeiten der Kirche Zeiten des Einreißens sind. Es ist ein großer Trost, den Christus seiner Kirche gibt: Du bekenne, verkündige, zeuge von mir allein. Ich allein aber will bauen, wo es mir gefällt...“ Ich baue, sagt Christus, wo es mir gefällt – das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass alles, was wir an Bauvorhaben so tätigen, nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sein muss. Natürlich haben wir für das, was wir tun, eine Verantwortung. Aber wir müssen nicht denken, dass von uns die Zukunft der Kirche abhinge. Ein altmodisches Wort: Bescheidenheit – oder – in diesem Kontext kann ich es verwenden: Demut – kommt mir in den Sinn, wenn ich darüber nachdenke, wie man diese Haltung mit einem Begriff benennen könnte. Aber was bedeutet das konkret – sozusagen im Alltag gelebt? 9 Wenn Menschen sich darüber im Klaren sind, dass nicht sie es sind, die alles in der Hand haben und machen können, dann kann das eine sehr heilsame Selbstbegrenzung sein und eine tiefe Einsicht in die Grenzen des eigenen Vermögens und Unvermögens. Wenn weder das Bauen noch das Einreißen in unserer Verantwortung und in unserer Macht liegt, d.h. wenn wir die Kirche Jesu Christi weder retten müssen noch zerstören können, dann ist das eine außerordentliche Entlastung. Und zugleich auch eine Beauftragung. Denn das wäre der Auftrag – gerade auch im Blick auf die Zukunft, gerade auch in einer Gesellschaft, in der die kirchliche Bindung durchaus zur Disposition steht. Der Auftrag der Kirche, um es mit Dietrich Bonhoeffer zu sagen, wäre dieser: Bekennen, Verkündigen, Beten. Das machte – wenn wir es denn ernst nähmen – einen großen Unterschied. Es macht nämlich einen Unterschied, wenn wir bekennen, dass wir unser Leben nicht uns selbst verdanken, sondern dem Vater im Himmel. Und wenn wir das Evangelium von der Liebe Gottes zu Gehör bringen und wenn wir Gott um das bitten, was wir zum Leben brauchen – dann sind wir als solche erkennbar, die nicht an das Schema dieser Welt, nicht an das Erscheinungsbild dieser Zeit und ihrer Vorstellung von Machbarkeit angepasst sind. Wenn wir mit unserem Leben bezeugen, dass Leben nicht zur Ware verkommen darf, dann ist damit ein unüberhörbar kritischer Akzent gesetzt, den es in der Welt braucht, auch wenn viele es nicht akzeptieren können oder auch nicht akzeptieren wollen. Das Evangelium ist eben kein Produkt. Auch wenn uns das immer wieder gesagt wird und vorgeworfen wird, wir würden es nur schlecht vermarkten. Das Evangelium ist auch kein Wertelieferant. Werte sind ja etwas sehr schwankendes. Mal stehen sie hoch im Kurs, mal ganz unten. Freilich: Wir sind auf dem Markt. Aber schon Paulus hat erleben müssen, dass er auf dem Markt gescheitert ist. Die spöttischen Athener meinten, von der Auferstehung möchten wir ein anderes Mal hören. Wir können und müssen reden, argumentieren – auf die Macht des Wortes vertrauen, das sich durchsetzt und nicht leer zurückkommt. Aber wir müssen und dürfen nicht denken, dass das alles einfach und selbstverständlich und selbsterklärend wäre. Das Evangelium ist und bleibt das fremde, das andere Wort. Wort, von dem wir leben und das uns dennoch nicht gehört. Diese Spannung auszuhalten --- und mit der ganzen Existenz durchleben und durchleiden, dass Kirche Geschöpf des Wortes Gottes ist. 10 Nicht mehr und nicht weniger, aber nichts anderes --- und um das zu sagen und immer wieder neu auszubuchstabieren, braucht man den Pfarrdienst. Nicht um Gruppen und Kreise am Leben zu erhalten und neu zu gründen, sondern um als Zeuge und Anwalt dieses fremden Wortes in den Gemeinden zu leben, damit Trost, Unterweisung und der Dienst der Liebe an jedermann getan werden kann. Wie das geschieht, wie das organisiert wird --- das hängt nicht an den PfarrPlänen, sondern an unserer Einstellung. Oder anders gesagt: an unserem Glauben. 11
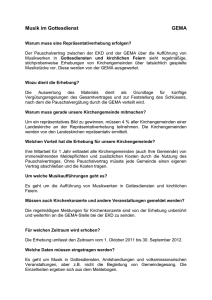
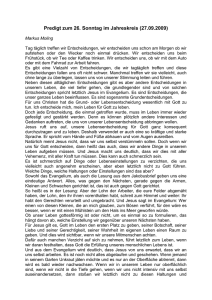
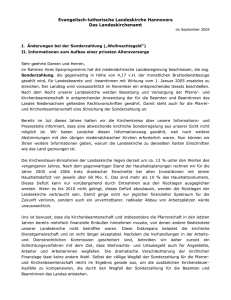

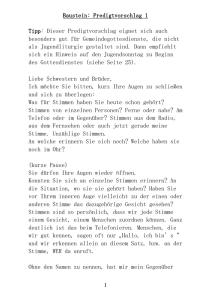

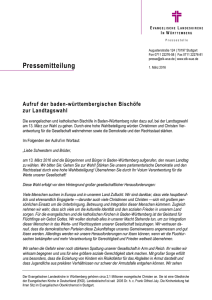
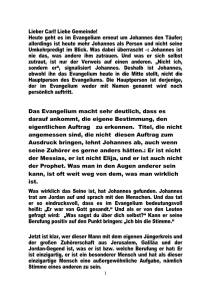
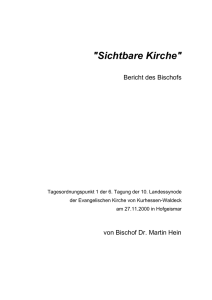
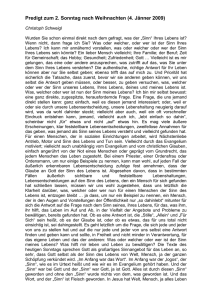

![[Titel]](http://s1.studylibde.com/store/data/002051245_1-d3d5a2cc91e1f2f156d6a212b7e4c41a-300x300.png)