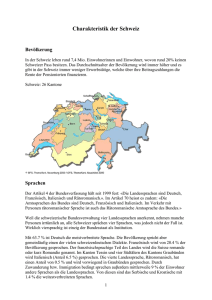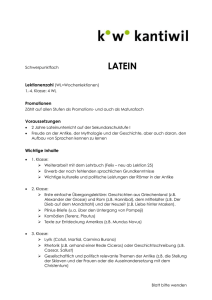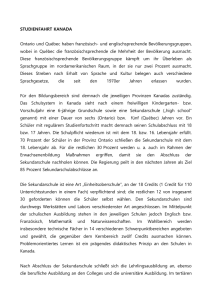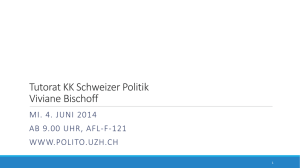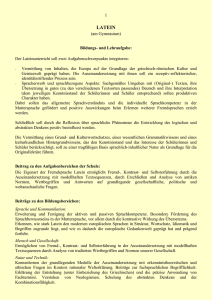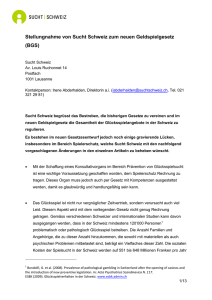Was macht die Schweizer so reich
Werbung
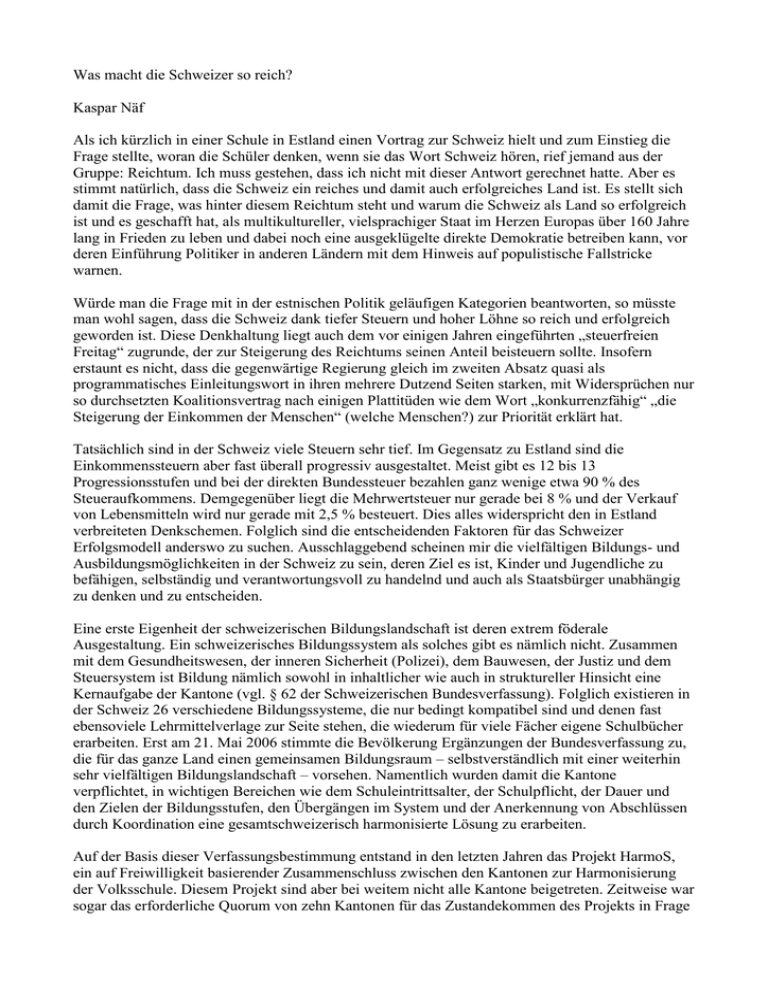
Was macht die Schweizer so reich? Kaspar Näf Als ich kürzlich in einer Schule in Estland einen Vortrag zur Schweiz hielt und zum Einstieg die Frage stellte, woran die Schüler denken, wenn sie das Wort Schweiz hören, rief jemand aus der Gruppe: Reichtum. Ich muss gestehen, dass ich nicht mit dieser Antwort gerechnet hatte. Aber es stimmt natürlich, dass die Schweiz ein reiches und damit auch erfolgreiches Land ist. Es stellt sich damit die Frage, was hinter diesem Reichtum steht und warum die Schweiz als Land so erfolgreich ist und es geschafft hat, als multikultureller, vielsprachiger Staat im Herzen Europas über 160 Jahre lang in Frieden zu leben und dabei noch eine ausgeklügelte direkte Demokratie betreiben kann, vor deren Einführung Politiker in anderen Ländern mit dem Hinweis auf populistische Fallstricke warnen. Würde man die Frage mit in der estnischen Politik geläufigen Kategorien beantworten, so müsste man wohl sagen, dass die Schweiz dank tiefer Steuern und hoher Löhne so reich und erfolgreich geworden ist. Diese Denkhaltung liegt auch dem vor einigen Jahren eingeführten „steuerfreien Freitag“ zugrunde, der zur Steigerung des Reichtums seinen Anteil beisteuern sollte. Insofern erstaunt es nicht, dass die gegenwärtige Regierung gleich im zweiten Absatz quasi als programmatisches Einleitungswort in ihren mehrere Dutzend Seiten starken, mit Widersprüchen nur so durchsetzten Koalitionsvertrag nach einigen Plattitüden wie dem Wort „konkurrenzfähig“ „die Steigerung der Einkommen der Menschen“ (welche Menschen?) zur Priorität erklärt hat. Tatsächlich sind in der Schweiz viele Steuern sehr tief. Im Gegensatz zu Estland sind die Einkommenssteuern aber fast überall progressiv ausgestaltet. Meist gibt es 12 bis 13 Progressionsstufen und bei der direkten Bundessteuer bezahlen ganz wenige etwa 90 % des Steueraufkommens. Demgegenüber liegt die Mehrwertsteuer nur gerade bei 8 % und der Verkauf von Lebensmitteln wird nur gerade mit 2,5 % besteuert. Dies alles widerspricht den in Estland verbreiteten Denkschemen. Folglich sind die entscheidenden Faktoren für das Schweizer Erfolgsmodell anderswo zu suchen. Ausschlaggebend scheinen mir die vielfältigen Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Schweiz zu sein, deren Ziel es ist, Kinder und Jugendliche zu befähigen, selbständig und verantwortungsvoll zu handelnd und auch als Staatsbürger unabhängig zu denken und zu entscheiden. Eine erste Eigenheit der schweizerischen Bildungslandschaft ist deren extrem föderale Ausgestaltung. Ein schweizerisches Bildungssystem als solches gibt es nämlich nicht. Zusammen mit dem Gesundheitswesen, der inneren Sicherheit (Polizei), dem Bauwesen, der Justiz und dem Steuersystem ist Bildung nämlich sowohl in inhaltlicher wie auch in struktureller Hinsicht eine Kernaufgabe der Kantone (vgl. § 62 der Schweizerischen Bundesverfassung). Folglich existieren in der Schweiz 26 verschiedene Bildungssysteme, die nur bedingt kompatibel sind und denen fast ebensoviele Lehrmittelverlage zur Seite stehen, die wiederum für viele Fächer eigene Schulbücher erarbeiten. Erst am 21. Mai 2006 stimmte die Bevölkerung Ergänzungen der Bundesverfassung zu, die für das ganze Land einen gemeinsamen Bildungsraum – selbstverständlich mit einer weiterhin sehr vielfältigen Bildungslandschaft – vorsehen. Namentlich wurden damit die Kantone verpflichtet, in wichtigen Bereichen wie dem Schuleintrittsalter, der Schulpflicht, der Dauer und den Zielen der Bildungsstufen, den Übergängen im System und der Anerkennung von Abschlüssen durch Koordination eine gesamtschweizerisch harmonisierte Lösung zu erarbeiten. Auf der Basis dieser Verfassungsbestimmung entstand in den letzten Jahren das Projekt HarmoS, ein auf Freiwilligkeit basierender Zusammenschluss zwischen den Kantonen zur Harmonisierung der Volksschule. Diesem Projekt sind aber bei weitem nicht alle Kantone beigetreten. Zeitweise war sogar das erforderliche Quorum von zehn Kantonen für das Zustandekommen des Projekts in Frage gestellt. In vielen Kantonen wurde von Gegnern der Schulreform gegen den Beitritt zu HarmoS das Referendum ergriffen, was die Angelegenheit an die Urne brachte und im Vorfeld der Volksabstimmungen lokal zum Teil zu sehr emotionalen Diskussionen führte. In einigen Kantonen wurde der Beitritt zu HarmoS abgelehnt und überall fielen die Abstimmungsresultate relativ knapp aus. Diese Abstimmungsresultate zeigen, dass die Schweizerinnen und Schweizer in vielen Kantonen nicht bereit sind, trotz offensichtlich hoher Kosten (und damit höherer Steuern) auf eine weitgehende Autonomie in der Bildung zu verzichten. Qualität, Flexibilität (schnelle Anpassungsfähigkeit), Bürgernähe und vor allem ein Mitspracherecht gehen vor. Das kann etwa soweit führen, dass der Hausmeister eines Einkaufszentrums in Luzern an einem Elternabend eine Diskussion darüber initiiert, ob es zulässig sei, dass die Geschichtslehrerin in der Klasse seiner Tochter auf Sekundarschulstufe (7.-9. Schuljahr) ein anerkanntermaßen gutes Lehrmittel des Kantons Zürich verwende. Damit, so der besorgte Vater, bestünde die Gefahr, dass seine Tochter die Geschichte Zürichs und nicht diejenige Luzerns lernen würde. In Luzern möchte selbstverständlich niemand, dass aus den Kindern Zürcher werden. Eine zweite wichtige Eigenschaft des schweizerischen Bildungswesens ist die duale Ausgestaltung der Bildungswege. Da ist zum einen die praxisnahe Berufsausbildung, welche im gesamtschweizerischen Durchschnitt von mehr als 70 % der Jugendlichen gewählt wird. Dieser Berufsausbildung steht zum anderen eine relativ anspruchsvolle allgemeinbildende Gymnasialbildung gegenüber, die nur von einer Minderheit der Jugendlichen – in einigen Kantonen gar nur rund 15 % eines Jahrganges – absolviert wird. Wichtig ist aber, dass es für Absolventen des Berufsbildungsweges immer wieder Abzweigungen nach oben gibt, die im Einzelfall sogar zu einem Universitätsabschluss führen können. Die Bildungswege sind als durchlässig und genießen beide in der Gesellschaft eine hohe Reputation. Mit der Neuordnung der Verfassungsbestimmungen zur Bildung wurden der Bundesstaat (d.h. die Schweiz) und die Kantone sogar dazu verpflichtet, sich explizit dafür einzusetzen, „dass allgemein bildende und berufsbezogene Bildungswege eine gleichwertige gesellschaftliche Anerkennung finden.“ (§ 61a Absatz 3 der Schweizerischen Bundesverfassung.) Da mit der zunehmenden Harmonisierung die Primarschule nun mit zwei Ausnahmen (Kantone Aargau und Tessin) in allen Kantonen sechs Jahre dauert, steht heute im sechsten Schuljahr mit der Wahl zwischen dem Eintritt in ein so genanntes Langzeitgymnasium (meist 6 Jahre) oder eines der drei Niveaus der Sekundarschule (3 Jahre) eine erste Entscheidung an. Der Eintritt ins Gymnasium ist in vielen Kantonen an eine Prüfung geknüpft. In einigen anderen Kantonen entscheidet allein der Notendurchschnitt des sechsten Primarschuljahres. Der Eintritt ins Gymnasium ist aber immer mit einer Probezeit verbunden. Ein ungenügender Notenschnitt an deren Ende hat den Austritt und die Herabstufung in eine Sekundarschule zur Folge. Für die Wahl des Niveaus der Sekundarschule (A, B oder C) ist ebenfalls der Notenschnitt im letzten Primarschuljahr ausschlaggebend. Zum Teil gibt es die Möglichkeit, über eine Prüfung den Eintritt in ein höheres Niveau zu versuchen. Die Wahl zwischen Gymnasium und Sekundarschule ist ein erster Richtungsentscheid. Wer nämlich nicht ins Langzeitgymnasium geht, hat zwar nach zwei Jahren Sekundarschule auf dem Niveau A erneut die Möglichkeit, ins so genannte Kurzzeitgymnasium (meist 4 Jahre) zu wechseln und kann diesen Wechsel gegebenenfalls auch nach dem dritten Sekundarschuljahr ein weiteres Mal versuchen. Dennoch ist die Sekundarschule grundsätzlich auf die Vorbereitung für eine Berufsausbildung ausgelegt. Wichtig ist im Übrigen auch die Rolle des Primarlehrers bzw. der Primarlehrerin: Er bzw. sie hat wegen des hohen Stellenwerts des Notendurchschnitts im letzten Primarschuljahr eine wichtige Funktion in der Selektion zu: Mit den Noten sagt er bzw. sie dem Schüler oder der Schülerin ein erstes Mal, welchen Bildungsweg er für richtig hält. Das kann im Einzelfall und gerade dort, wo keine Prüfungen bestehen, allerdings zu schwierigen Gesprächen mit den Eltern führen. Die drei Jahre Sekundarschule mögen für einige Jugendlichen eine Zeit sein, in der sie ihre anfängliche Entscheidung nochmals überdenken. Wer die für eine Gymnasialbildung nötigen schulischen Leistungen nicht erbringen kann oder auch einfach nicht an ein Gymnasium möchte oder, was auch nicht selten ist, wegen Nichtgefallen („genug von der Schule“) wieder aus dem Gymnasium austreten möchte, muss sich in diesem Jahr für einen Beruf entscheiden. Um die Berufswahl zu erleichtern, werden einerseits in der Schule verschiedene Berufe vorgestellt und andererseits von vielen Betrieben möglichen Bewerberinnen und Bewerbern während der Schulferien so genannte Schnupperlehren angeboten. Darunter werden einwöchige unbezahlte Praktika verstanden, in denen Jugendlichen die Möglichkeit geboten wird, Einblick in den einen oder anderen Beruf zu bekommen. Anschließend muss der zukünftige Lehrling bzw. die zukünftige Lehrtochter sich um eine so genannte Lehrstelle bemühen – am besten natürlich in dem Betrieb, in dem er bzw. sie eine Schnupperlehre absolviert hat. Unter einer Lehrstelle versteht man in der Schweiz eine spezielle Arbeitsstelle in einem beliebigen Betrieb, deren Ziel es ist, je nach Berufsgattung in drei oder vier Jahren einen Beruf zu erlernen und ein Berufsdiplom zu erhalten. Um dies zu ermöglichen und um auch gewisse Qualitätskriterien zu garantieren, ist der Lehrvertrag im schweizerischen Zivilrecht (Obligationenrecht) als spezieller Arbeitsvertrag geregelt. Damit erhält der Lehrling bzw. die Lehrtochter gewisse Sicherheiten. Gleichzeitig wird der Lehrmeister, welcher im Betrieb für die fachliche Ausbildung verantwortlich ist und bei Bedarf beim Staat für die Ausbildung Gelder beantragen kann, in die Pflicht genommen. Inhaltlich erfolgt der größte Teil der berufspraktischen Ausbildung direkt in den Ausbildungsbetrieben, in denen die Auszubildenden drei bis vier Tage die Woche arbeiten. Auszubildende gleicher oder ähnlicher Berufe treffen sich jeweils nur 1-2 Tage die Woche in der Berufsschule, wo sie in Grundlagenfächern wie Mathematik, Muttersprache und mindestens eine Fremdsprache unterrichtet werden und die theoretische Basis zu ihrem Beruf vermittelt bekommen. So erhalten etwa Detailhandelsfachleute – landläufig Verkäufer und Verkäuferinnen – etwa in den Fächern Detailhandelskenntnisse, Buchhaltung sowie Wirtschaft und Recht theoretisches Wissen zu ihrem Beruf. Friseure wiederum lernen in der Berufsschule gewisse Schneidetechniken und das Benennen der Arbeitsschritte oder auch Kenntnisse zu verschiedenen Frisuren. Fragen aber, wie man aber beim Haareschneiden praktisch und konkret vorgeht oder mit dem Kunden oder der Kundin die gewünschte Frisur bespricht, werden bei der täglichen Arbeit gezeigt und anschließend möglichst viel geübt. Für diese Arbeit erhalten die Lernenden auch vom ersten Tag an einen Lohn, der mit jedem Lehrjahr ansteigt. Neben der beruflichen Grundausbildung in der Berufsschule besteht in Absprache mit dem Lehrbetrieb und je nach Fähigkeiten die Möglichkeit, weitergehende allgemeinbildende Fächer zu belegen und die Lehre nicht nur mit einer normalen Abschlussprüfung zu beenden, sondern eine so genanntes Berufsabitur (in der Schweiz selbst Berufsmatur genannt) zu erlangen. Diese steht je nach Angebot in der Berufsschule allen Berufen offen. So kann durchaus auch eine Friseurin oder ein Detailhändler, ein Schneider oder eine Schreinerin, aber auch ein Informatiker oder eine Automechanikerin ergänzend zur Lehre eine Berufsmatur machen. Diese Berufsmatur berechtigt zu einem Studium an einer Fachhochschule. Für ein Studium an einer Universität hingegen wären Zusatzprüfungen nötig. Es gibt aber auch andere Weiterbildungsmöglichkeiten, etwa höhere Fachschulen, an denen etwa Fähigkeitszeugnisse erlangt werden können, die dazu berechtigen, selbst als Ausbildner oder Ausbildnerin im Betrieb selbst tätig zu werden. Dieses System der Berufsausbildung hat sich als sehr vielversprechend erwiesen und bewährt, denn die Auszubildenden lernen vom ersten Arbeitstag an, genau und präzise zu arbeiten. Sie müssen für Ihre Arbeiten selbst Verantwortung übernehmen und diese auch tragen lernen lernen, denn ihre Produkte und Dienstleistungen sind nicht etwa für den Papierkorb bestimmt, sondern für einen Kunden oder eine Kundin. Dies wiederum erzeugt bei den Lernenden das befriedigende Gefühl, etwas machen zu können, was wirklich gebraucht wird. Gleichzeitig lernen die Auszubildenden, welche Fragen in der Berufspraxis von den Kunden gestellt werden und welche Probleme eine echte Herausforderung darstellen. Gegebenenfalls können Erfahrungen aus dem Berufsalltag auch in der Schule besprochen werden. Ebenso klar ist aber, dass nicht alles in jedem Betrieb genau gleich gemacht wird. Dies führt zum Primat der Praxis vor der Theorie in der Schule. Kleine Unterschiede in gewissen Arbeitsschritten können dabei zu eigenständigem Denken anregen und im besten Fall zu innovativen Ideen und Weiterentwicklungen führen. Abweichungen vom theoretisch gelernten Wissen werden somit nicht als Wissenslücken bestraft und können vielmehr auf positive Weise genutzt werden. Damit werden auch wichtige Fähigkeiten eingeübt, um im Markt bestehen zu können, denn letztlich ist für den Erfolg eine Unterscheidung von den Konkurrenten wichtig. Für die Kundinnen und Kunden wiederum hat das System den Vorteil, es auch in einfacheren Berufen (etwa im Verkauf) mit gut ausgebildetem Personal zu tun zu haben, das fähig ist, Fragen selbständig und fachkundig zu beantworten. Das erhöht die Bereitschaft, mehr für eine Dienstleistung oder ein Produkt zu bezahlen. Darüber hinaus werden durch das schweizerische Berufsbildungssystem auch soziale Kompetenzen wie etwa den Umgang mit Vorgesetzten und weiteren Mitarbeitenden gefördert. Damit lernen die Lehrlinge und Lehrtöchter sich in Hierarchien zurecht zu finden. In Betrieben, in denen mehrere Lernende in Ausbildung sind, kommt noch der Effekt hinzu, während der Ausbildungszeit selbst aufzusteigen und sich mit verschiedenen Rollen als Auszubildende (jüngere Lernende (in der Schweiz: Unterstift/in), ältere Lernende (Oberstift/in)) auseinanderzusetzen. Dass sich dies positiv auswirken kann, haben auch Forschungen in Klassen gezeigt, in denen mehrere Jahrgänge (z.B. 1. und 2. Klasse) zusammen unterrichtet werden. Demgegenüber ist das Ziel der schweizerischen Gymnasien darin, so die Konferenz der kantonalen Bildungsdirektoren EDK im Jahre 1995 anlässlich der Gymnasialreform, dass die „Schülerinnen und Schüler [...] zu jener persönlichen Reife [gelangen], die Voraussetzung für ein Hochschulstudium ist und die sie auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft vorbereitet.“ Und: „Die [gymnasialen] Schulen streben eine breit gefächerte, ausgewogene und kohärente Bildung an, nicht aber eine fachspezifische oder berufliche Ausbildung.“ Deshalb steht im Zentrum jeder Gymnasialbildung eine umfassende Allgemeinbildung. So erhält jeder Gymnasiast und jede Gymnasiastin eine weitreichende mathematisch-naturwissenschaftliche, sprachliche und geistesund sozialwissenschaftliche und musische Schulbildung. Als Leitfaden für die Lehrenden gilt dabei immer, den Schülern möglichst viel Orientierungswissen zu vermitteln, das heißt Lerninhalte, welche die Schülerinnen und Schüler befähigen, das Fach als solches zu verstehen und Alltagsfragen disziplinär zu analysieren. So stehen etwa bei der Behandlung der Amerikanischen Verfassung von 1787 deren Prinzipien (Stichwort „checks and balances“) und die Frage im Vordergrund, warum es auf der Basis dieser Verfassung fast unmöglich, in den USA eine absolute Herrschaft zu errichten. Demgegenüber nehmen die historischen Fakten eine eher sekundäre Rolle ein. Oder im Fach Rechtslehre, das am Wirtschaftsgymnasium unterrichtet wird, geht es darum, die Schüler zu befähigen, selbst Rechtsfälle zu lösen und zu beurteilen. Die Theorie der Volkswirtschaftslehre wiederum wird anhand der Lektüre von Zeitungsartikeln eingeübt und immer die Frage gestellt, wo sich der Fachautor mit seinen Aussagen in der Theorie gerade befindet. Im Gegensatz zu anderen Ländern fällt auch auf, dass die Schweiz als Staat und auch ihre Geschichte in den Lehrplänen der meisten Kantone eine eher sekundäre Rolle einnehmen. Dies hängt sicherlich damit zusammen, dass die Schweizer einerseits, wie oben dargelegt, vor allem in kantonalen Kategorien denken und andererseits das Ziel der Bildung darin geht, selbständig zu werden und die Welt zu verstehen, in der die Schweiz selbst eine untergeordnete Rolle einnimmt. Trotz diesem Fokus auf der Allgemeinbildung und Analyse gibt es in der Schweiz kein einheitliches Abitur (Matur). Vielmehr müssen sich die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten vier Jahre vor den Maturitätsprüfungen für ein Profil entscheiden. Bis 1995 standen dafür fünf Maturitätstypen (Altgriechisch und Latein, Latein, Naturwissenschaften, Neuere Sprachen, Wirtschaftswissenschaften) zur Auswahl. Mit Beginn des Schuljahres 1996/97 wurden diese Typen ersetzt. Seither muss jeder sein Profil selbst zusammenstellen und eines von acht Schwerpunktfächern (alte Sprachen (Griechisch und/oder Latein); eine moderne Fremdsprache (eine dritte Landessprache, Englisch, Spanisch oder Russisch); Physik und Anwendungen der Mathematik; Biologie und Chemie; Wirtschaft und Recht; Philosophie/Pädagogik/Psychologie; Bildnerisches Gestalten; Musik) mit einem Ergänzungsfach (Physik, Chemie, Biologie, Anwendungen der Mathematik, Geschichte, Geographie, Philosophie, Religionslehre, Wirtschaft und Recht, Pädagogik/Psychologie, Bildnerisches Gestalten, Musik, Sport) kombinieren. Damit kann jeder und jede neben der Allgemeinbildung seinen persönlichen Neigungen Rechnung tragen. Bis zur Maturitätsreform 1995 war übrigens die Matur mit Latein als Schwerpunktfach die am meisten gewählte und damit beliebtest. Dies mag auf den ersten Blick erstaunen. Der Grund lag wohl zum einen in einer langen Latein-Tradition im Bildungsbürgertum. Die Typen ohne Latein wurden erst in der Nachkriegszeit nach und nach geschaffen. Zum anderen waren Lateinkenntnisse bis zur Einführung des Bologna-Systems an allen Schweizer Universitäten für viele Studienfächer und insbesondere alle großen Philologien angefordert. Darüber hinaus waren Lateinschüler auch in naturwissenschaftlichen Studienfächern gerne gesehen. Es galt bis in die 1990er Jahre hinein als offenes Geheimnis, dass man anhand des Latein ganz offensichtlich sehr viel Implizites lernen konnte – nicht zuletzt, wie eine systematische Sprache funktioniert und wie man bei der Analyse und Lösung von fast unlösbaren Problemen vorgehen muss. Abschließend ist zu sagen, dass sich die Schweizer Art, junge Menschen auf ihr Leben und dessen Herausforderungen vorzubereiten, auch in einem so wichtigen Gebiet wie der Sexualaufklärung und der Drogenprävention bewährt. Der Rückgang von HIV-Ansteckungen in den letzten Jahren wie auch der Drogensüchtigen und -toten sprechen dabei eine eindeutige Sprache. Gerade auf diesen beiden Feldern zeigt sich, ob die Schule es schafft, ihren Abgängern auch in manchmal schwierigen Situationen vernünftig und verantwortungsbewusst zu handeln. Verantwortungsvolles Handeln und Interesse für sich und sein Bildungsumfeld spart (vor allem) Kosten und führt zu Erfolg und Reichtum, auch wenn die Bildungslandschaft, die das ermöglicht, auf den ersten Blick föderalistisch kleinkariert, kompliziert und viel zu teuer zu sein scheint. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kaspar Näf über sich: Kaspar Näf, geboren in Zürich, studierte an der Universität Zürich und Basel Allgemeine Geschichte mit Schwerpunkt Osteuropa, Russische Sprachwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre und lernte im Rahmen des Programms Studia Baltica der Universität Münster Estnisch und Litauisch. Seit 2007 kommentiert er regelmässig in verschiedenen estnischen Zeitungen die estnische und internationale Politik und nimmt auch Stellung zu Wirtschaftsfragen und gesellschaftlichen Problemen. Im Vikerradio analysiert er Ereignisse in der Schweiz und Österreich.