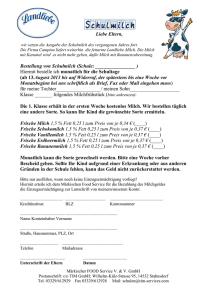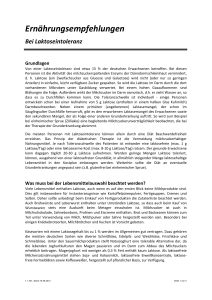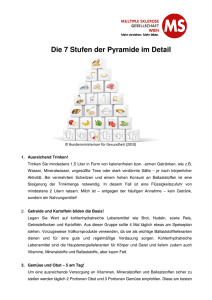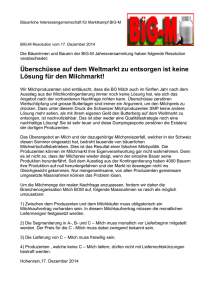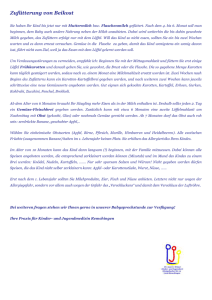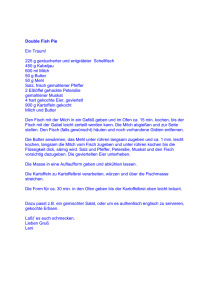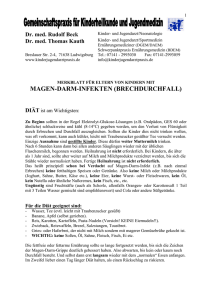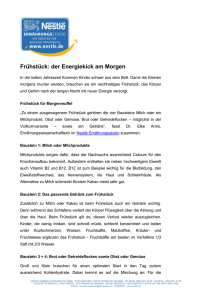Aufbau einer Alveole
Werbung

Alveole Querschnitt Aufbau einer Alveole Ansicht B M M B mit Basalmembran L E M Basalmembran entfernt E Milchg. L = Alveolarlumen B = Basalmembran M = Myoepithelzelle E = Epithelzelle Milchg.= Milchgängchen Laktose Protein Fett Mechanismen der Sekretion MV ZM SV F "Magermilch" MT GA Wasser, Ionen, Proteine, (Milch-)Zucker im selben Vesikel K Fett RER MEZ BM BM K MV SV Basalmembran Kern Mikrovilli Sekretorischer Vesikel F MEZ ZM RER Fetttröpfchen GA Golgiapparat Myoepithelzelle MT Mikrotubuli Zellmembran raues Endoplasmatisches Retikulum Umhüllung des Fetttröpfchens erst beim Ausschleusen EZF lZF Milch (Alveolarzelle) K+ Na+ Cl - Na+ K+ Cl - K+ Wanderung wichtiger Ionen Cl- Na+ Cl+ Na H O 2 K+ Laktose a) transzellulär Hoch [Laktose] und [K + ] Niedrig [Na+ ] und [Cl - ] gesundes Gewebe BASAL a) transzellulär b) parazellulär K++ Laktose Na+ + Cl - b) parazellulär erkranktes Gewebe Wanderung wichtiger Ionen, der Laktose und des Wassers zwischen extrazellulärer Flüssigkeit (EZF), intrazellulärer Flüssigkeit (IZF) und Milch bei intakten (a) und nicht intakten (b) Verbindungen zwischen den Zellen Veränderungen in der Milch bei Mastitis Die Veränderungen: Natrium Kalium Chlor Gesamteiweiss Kasein Molkenprotein Fett Zellen Moduliert durch: - Schwere der Erkrankung - Art der Erreger - Lage der Schädigungen (Oberfläche der Gänge; sezernierendes Gewebe; tief im Bindegewebe) - Laktationsstadium Nachweis "unter der Kuh" - Leitfähigkeit - Zelltest (`Schalm´-Test) Anreicherung von Immunglobulinen (IG) in der Milchdrüse Hohe Östrogenspiegel Induktion von IG-Rezeptoren aktiver Transport durch die Zelle Ausschüttung ins Alveolarlumen Wasser, Laktose, Na+, K+, Cl- strömen zurück ("tight junctions" noch nicht dicht) Es verbleiben IG und Kaseinmizellen (dies erklärt den hohen Kaseingehalt im Kolostrum) Veränderung der Milchbestandteile nach der Geburt 20 % in der Milch 10 % in der Milch 15 10 Laktos e Fett 5 5 0 0 50 100 150 Stunden nach dem Abkalben 200 0 50 100 Protei Kasein n Molkeprotei n 150 200 Stunden nach dem Abkalben (Dehnhard, 2002) Synthese und Sekretion von Milchzuckern X1 X2 L Oligosaccharide Zucker Proteine L Lumen GT Laktose Glukose GT UDPGalaktose RER Golgi Vesikel GT = Galactosyltransferase (+Mn++) L = Lactalbumin X1, X2 = div. Transferasen UDP = Uracyldiphosphat AGRARTECHNIK HOHENHEIM PlasmaMembran VTP Physiologie der Milchdrüse 9 Grimm Blut Endothel Sezern. Epithel Milch ~50% Oxidation Acetat ß - Hydroxybutyrat Fett / Leber- FFA Pansen C4 - C16 Neusynthese po FFA 60% Di-/Monoglyceride 38 g Triglyc. 0,1g Diglyc. 0,01g Monoglyc. 0,06g FFA C16 - C18 je kg Glycerol Li Triglyceride Phospholipide Apolipoprotein 20-80nm Lipoproteinpartikel u. Chylomicron 120-1100nm p ro t . Li se a p 40% wichtig für Aktivität der Lipoproteinlipase Glycerol Acetyl - CoA Glucose (nicht für FSSynthese) Lactose Herkunft der Vorstufen für die Milch - Triglyceride Diese Werte gelten nicht für den Zeitpunkt der Sekretion, sondern nach dem Melken! Fettsäurezusammensetzung der Milch % Mol in Triglyceriden Kettenlänge Mensch Schwein Ziege Kuh Gesättigte: C4 / C6 / C8 - 6 16 14 C10 / C12 / C14 19 6 32 14 C16 / C18 32 35 29 32 49 61 23 40 Ungesättigte: C18:1 / C18:2 Zusammensetzung der Milch von Nutztieren Zusammensetzung Mensch Wasser Pferd Kuh Schaf Ziege Büffel Rentier 87,2 % 90,1 % 87,5 % 82,7 % 86,6 % 82,8 % 66,9 % Kohlenhydrate 7,0 % 5,9 % 4,8 % 6,3 % 3,9 % 5,5 % 2,8 % Milchfett 4,0 % 1,5 % 4,2 % 5,3 % 3,7 % 7,4 % 16,9 % Eiweiße 1,5 % 2,1 % 3,5 % 4,6 % 4,2 % 3,6 % 11,5 % Spurenelemente 0,3 % 0,4 % 0,7 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 1,9 % "Globulinmilch", nur ~60% Casein, bei den anderen Nutztieren ~80% Die häufigsten Proteine (etwa 80 % der Gesamtproteinmenge) sind die Caseine. Die übrigen Proteine werden auch als Molkenproteine zusammengefasst. ß-Lactoglobulin, α-Lactalbumin, Albumine, Immunglobuline und die Proteosepeptone. Das wichtigste Kohlehydrat in der Milch ist Lactose, daneben sind Galactose, Glucose und Spuren anderer Kohlehydrate enthalten 1,5 mm 2 mm Lumen Zunahme des Durchmessers um ~ 1/3 reicht aus, um den Strichkanal vollständig zu öffnen. Keratin Strichkanal geschlossen Strichkanal geöffnet (geweitet) (gefaltet) Original: Williams, D.M. and Mein, G.A. 1982 Transport pathogener Mikroben durch den Strichkanal Infektions-Abwehr durch: unspez.: Leukozyten, Laktoferrin, Lysozym u.a. spez.: Immunglobuline, sekret. IgA, IgO1, IgG2, lgM Biologische Barriere (Ubiquitin, Leukozyten) Chemische Barriere (Keratin, FFA) Weg der invadierenden Mikroben mech. Herausschwemmen der eingedrungenen Mikroben Invasion in die Zitzenzisterne beim Milchentzug Physikalische Barriere (Sphincter) Invasion in den Zitzenkanal Kontamination Invasions - Risiko bei kontaminierter Drüsenöffnung: während des Milchentzugs außerhalb des Milchentzugs - Passiver Transport der Mikroben durch: - Passiver Transport der Mikroben Pumpeffekt bei Pulsierung durch kapillaren Milchspalt Rückluft bei Hysteresis - Aktives Eindringen durch Wachstum Rückspray (nach Tolle, 1983) Mastitiserreger Häufiger vorkommend ~ähnliche Häufigkeiten auch bei nicht gemolkenen Tieren (Kamele, Schafe, Kühe!!) Selten gefunden Staph. aureus Strep. agalactiae Strep. disgalactiae Strep. uberis E. coli Klebsiella spec. Enterobacter spec. Actinomyces pyogenes Pseudomonas aeruginosa Bacillus cereus Corynebacterium bovis Nocardia und Mycobacteria Corynebact. ulcerans Clostr. perfringens Algae Fungi Mycoplasma spec. Einflüsse auf die Häufigkeit von Mastitiden Rasse / Genetik Zitzenmaße ( Ø, Länge) Bodenfreiheit der Zitzenspitzen Laktationsnummer Mastitis"geschichte" Viertelposition Form der Zitzenkuppe Strichkanal Ø Milchfluss Keratin Hyperkeratosen?? Effekt von Mastitiden auf Milch und Milchprodukte Substrat Defekte Rohmilch ranziger Geschmack, geringe Hitzestabilität des Molkenproteins pasteurisierte Milch Geschmacksveränderungen konzentrierte Milch unstabile Produkte, Sedimente Käse verzögerte Gerinnungszeit, Bruchfestigkeit nimmt ab, Fett- und Eiweißverluste mit der Molke niedrigere Ausbeuten Butter Geschmacksbeeinträchtigung, weniger Aroma (längere Butterungszeit) Oxidationsgeschmack (nach MUNROE et. al., 1987) Stimulationsdauer (s) 120 90 60 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aber: Starke Stimulation am Anfang der Laktation erhöht die Milchleistung! Laktations Monate Stimulationsbedarf laktierender Kühe Angaben verschiedener Autoren Stimulation: Milchmenge je Woche (l) 80 70 60 Whittlestone `68 0 30 + 16% Fett Philipps `60 0 30 + 32% Fett Philipps `65 10 -60 Admin `72 20 -60 50 40 30 20 10 Ergebnis: vollständige Stimulation Kurz Reinigen Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Milchleistung und Stimulation + 27% Milch + 30% Fett + 11% Milch 4,0 Liter/Tag 40 kg/Tag 3,0 30 2,0 20 1,0 10 8 16 24 g/Tag 40 250 30 150 20 50 10 32 40 Wochen g/Tag Tage 20 40 Tage 20 [aus “Biochemistry of Lactation" ed. T. B. Mepham, 1983] 40 Laktationskurven unterschiedlicher Tierarten RNA % Veränderungen des RNA - Gehaltes nach dem Absetzen der Jungen (Kaninchen) 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 RNA %: 100 5 6 7 8 9 10 Gehalt während Laktation t (Tage) M2 10 Milch pro MZ [kg] M1 Milchsekretion [g/h] 8 Legende: 6 1200 4 1100 S2 2 S1 0 1000 900 M1 = durchschnittl. Gemelksmenge (Gruppe 1) M2 = durchschnittl. Gemelksmenge (Gruppe 2 S1 = durchschnittl. Sekretionsrate (Gruppe 1) S2 = durchschnittl. Sekretionsrate (Gruppe 2) 800 3 4 5 6 7 ZMZ (h) 8 9 10 Milchmenge und Milchsekretionsrate in Abhängigkeit von der Zwischenmelkzeit a Milchfluß b c a b c Zeit tLin tMHG tGM Blind tMNG melken a: voller Milchfluss aus allen Vierteln b: ein Melkbecher ist geklettert, der Milchfluss des Viertels beendet c: Zug am Sammelstück öffnet die Euter - Zitzen - Passage, das Euter kann ausgemolken werden AGRARTECHNIK HOHENHEIM Interaktion Zitze - Zitzengummi VTP 370107 Grimm/Ne