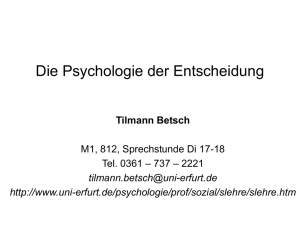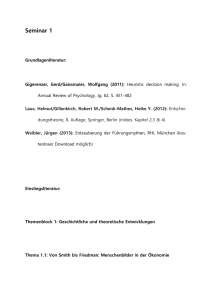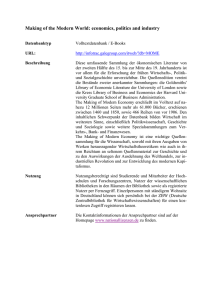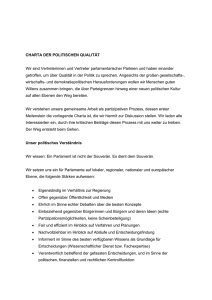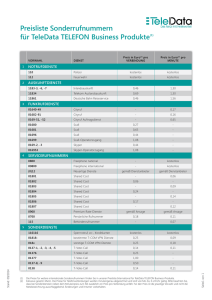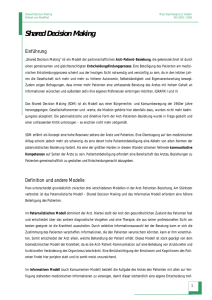Obwohl Patienten von einem Prozess der partizipativen
Werbung
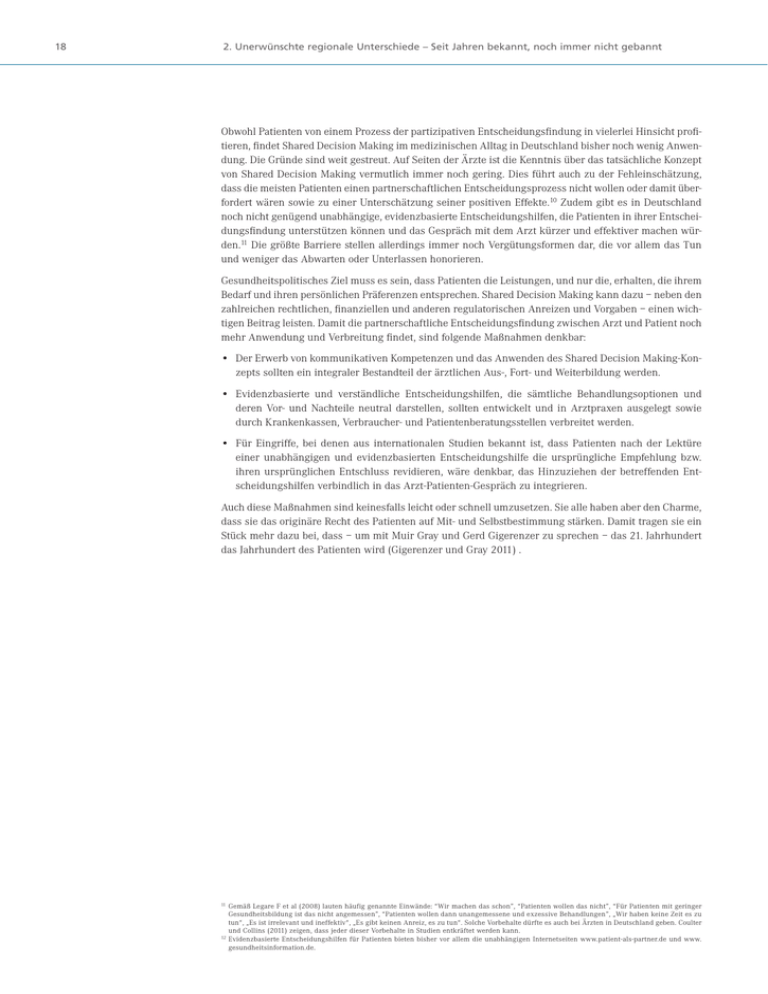
18 2. Unerwünschte regionale Unterschiede – Seit Jahren bekannt, noch immer nicht gebannt Obwohl Patienten von einem Prozess der partizipativen Entscheidungsfindung in vielerlei Hinsicht profitieren, findet Shared Decision Making im medizinischen Alltag in Deutschland bisher noch wenig Anwendung. Die Gründe sind weit gestreut. Auf Seiten der Ärzte ist die Kenntnis über das tatsächliche Konzept von Shared Decision Making vermutlich immer noch gering. Dies führt auch zu der Fehleinschätzung, dass die meisten Patienten einen partnerschaftlichen Entscheidungsprozess nicht wollen oder damit überfordert wären sowie zu einer Unterschätzung seiner positiven Effekte.10 Zudem gibt es in Deutschland noch nicht genügend unabhängige, evidenzbasierte Entscheidungshilfen, die Patienten in ihrer Entscheidungsfindung unterstützen können und das Gespräch mit dem Arzt kürzer und effektiver machen würden.11 Die größte Barriere stellen allerdings immer noch Vergütungsformen dar, die vor allem das Tun und weniger das Abwarten oder Unterlassen honorieren. Gesundheitspolitisches Ziel muss es sein, dass Patienten die Leistungen, und nur die, erhalten, die ihrem Bedarf und ihren persönlichen Präferenzen entsprechen. Shared Decision Making kann dazu – neben den zahlreichen rechtlichen, finanziellen und anderen regulatorischen Anreizen und Vorgaben – einen wichtigen Beitrag leisten. Damit die partnerschaftliche Entscheidungsfindung zwischen Arzt und Patient noch mehr Anwendung und Verbreitung findet, sind folgende Maßnahmen denkbar: • Der Erwerb von kommunikativen Kompetenzen und das Anwenden des Shared Decision Making-Konzepts sollten ein integraler Bestandteil der ärztlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung werden. • Evidenzbasierte und verständliche Entscheidungshilfen, die sämtliche Behandlungsoptionen und deren Vor- und Nachteile neutral darstellen, sollten entwickelt und in Arztpraxen ausgelegt sowie durch Krankenkassen, Verbraucher- und Patientenberatungsstellen verbreitet werden. • Für Eingriffe, bei denen aus internationalen Studien bekannt ist, dass Patienten nach der Lektüre einer unabhängigen und evidenzbasierten Entscheidungshilfe die ursprüngliche Empfehlung bzw. ihren ursprünglichen Entschluss revidieren, wäre denkbar, das Hinzuziehen der betreffenden Entscheidungshilfen verbindlich in das Arzt-Patienten-Gespräch zu integrieren. Auch diese Maßnahmen sind keinesfalls leicht oder schnell umzusetzen. Sie alle haben aber den Charme, dass sie das originäre Recht des Patienten auf Mit- und Selbstbestimmung stärken. Damit tragen sie ein Stück mehr dazu bei, dass – um mit Muir Gray und Gerd Gigerenzer zu sprechen – das 21. Jahrhundert das Jahrhundert des Patienten wird (Gigerenzer und Gray 2011) . 11 Gemäß Legare F et al (2008) lauten häufig genannte Einwände: “Wir machen das schon”, “Patienten wollen das nicht”, “Für Patienten mit geringer Gesundheitsbildung ist das nicht angemessen”, “Patienten wollen dann unangemessene und exzessive Behandlungen”, „Wir haben keine Zeit es zu tun“, „Es ist irrelevant und ineffektiv“, „Es gibt keinen Anreiz, es zu tun“. Solche Vorbehalte dürfte es auch bei Ärzten in Deutschland geben. Coulter und Collins (2011) zeigen, dass jeder dieser Vorbehalte in Studien entkräftet werden kann. 12 Evidenzbasierte Entscheidungshilfen für Patienten bieten bisher vor allem die unabhängigen Internetseiten www.patient-als-partner.de und www. gesundheitsinformation.de.