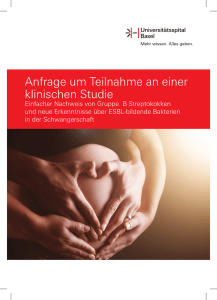WA BFH Arial - Word 2007 - BFH: Gesundheit
Werbung

Knoblauchtherapie bei schwangeren Frauen mit einer vaginalen Streptokokken B Kolonisation – Eine Alternative zur intrapartalen Antibiotikaprophylaxe? Eine Literaturreview Bachelor-Thesis Jeannine Troendle Marisa Zumbrunn Berner Fachhochschule Fachbereich Gesundheit Bachelor of Science Hebamme Basel, 6. August 2012 Knoblauchtherapie INHALTSVERZEICHNIS Abstract ...................................................................................................................... 3 1 2 3 4 5 Einleitung........................................................................................................... 4 1.1 Zielsetzung und Fragestellung ........................................................... 6 1.2 Eingrenzung ........................................................................................ 6 Theoretische Grundlagen ................................................................................. 7 2.1 Aktuelle Screeningmethoden für Streptokokken B................................. 7 2.2 Streptokokken B Infektion in der Schwangerschaft ................................ 8 2.3 Antibiotikatherapie bei Streptokokken B Infektionen .............................10 2.4 Knoblauch (Allium sativum Linn) ..........................................................12 2.5 Forschungsdesigns ..............................................................................13 2.6 Ethik .....................................................................................................15 Methoden ..........................................................................................................16 3.1 Literaturrecherche ................................................................................16 3.2 Analysemethoden ................................................................................18 3.3 Methode zur Proposalentwicklung ........................................................20 Ergebnisse........................................................................................................21 4.1 Suchergebnisse ...................................................................................21 4.2 Ergebnisse aktueller Behandlungsmethoden .......................................22 4.3 Ergebnisse antibakterieller Wirkung von Knoblauch ......................32 Diskussion ........................................................................................................43 5.1 Proposal für eine Studie zur vaginalen Knoblauchtherapie ...................50 6 Schlussfolgerung .............................................................................................58 7 Literaturverzeichnis .........................................................................................59 8 Tabellenverzeichnis .........................................................................................66 9 Abkürzungsverzeichnis ...................................................................................66 10 Glossar..............................................................................................................68 11 Poster ...............................................................................................................70 2 Knoblauchtherapie ABSTRACT Einleitung: EOD weisen eine hohe Morbidität und Mortalität auf, weshalb eine Prävention wichtig erscheint. Aktuelle Behandlungsempfehlungen werden auf ihre Evidenz untersucht, da sie Risiken für Mutter und Kind mit sich bringen. Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit liegt in der Abwägung, ob eine präpartale Knoblauchtherapie eine wirkungsvolle Alternative darstellt. Sollte Forschungsbedarf zur präpartalen Knoblauchtherapie bestehen, wird ein Forschungsplan erstellt. Theoretische Grundlagen: Grundlagen für diese Arbeit sind die GBS Infektion in der Schwangerschaft, deren Screening- und Behandlungsmethoden, Knoblauch, Forschungsdesigns und Ethik. Methoden: Systematische Review mit Literatursuche in den für die Fragestellung relevanten Datenbanken. Es wird nach Literatur zum aktuellen Management bei einer Streptokokken B Kolonisation in der Schwangerschaft und zur antibakteriellen Wirkung von Knoblauch gesucht. Die eingeschlossene Literatur wird nach AWMF & ÄZQ (2008), Behrens & Langer (2006), Kunz et al. (2000) und Polit et al. (2004) analysiert. Ergebnisse: Die Analyse umfasst neun quantitative Studien, zwei Reviews, zwei Leitlinien und eine Empfehlung eines Berufsverbandes. Aktuell werden das Screeningbased, Risk-based, restriktive und zurückhaltende Management zur Behandlung einer GBS Infektion in der Schwangerschaft empfohlen. Die Leitlinien weisen Widersprüche und ein schwaches Evidenzniveau auf. Knoblauchextrakte haben in-vitro eine hemmende Wirkung gegenüber Streptokokken B aufgezeigt. In-vivo konnte die Symptomatik einer GBS Vaginitis mit einer vaginalen Knoblauchtherapie therapiert werden. Diskussion: Aufgrund der Kosten-Nutzen Effizienz, der schwachen Evidenzen und der hohen Risiken wird in der Antibiotikatherapie keine längerfristig anwendbare Lösung gesehen. Knoblauch ist leicht zugänglich, kosteneffizient und bei vaginaler Anwendung mit wenig Risiken und Nebenwirkungen verbunden, und scheint daher als geeignete Alternative zum Antibiotikum in der Prophylaxe von EOD. Gegenüber dem Antibiotikum hat er den Vorteil, dass Bakterien keine Resistenz entwickeln können. Schlussfolgerung: Da die antibakterielle Wirkung von Knoblauch in-vitro mehrfach belegt ist, wird eine Empfehlung zur Untersuchung der kurz- und längerfristigen Wirkung einer vaginalen Knoblauchtherapie bei schwangeren Frauen ausgesprochen. Schlüsselwörter: Streptokokken B, Knoblauch, antibakterielle Wirkung, Prävention. 3 Knoblauchtherapie 1 EINLEITUNG Gruppe B Streptokokken (GBS) gehören zu den gram-positiven Bakterien und besiedeln beim Menschen, meist symptomlos, den Urogenital- und Intestinaltrakt. Ihren Krankheitswert erhalten GBS oft erst rund um eine Mutterschaft. Sie können unter der Geburt von der Mutter auf das Kind übertragen werden und zählen zu den häufigsten Ursachen einer frühen Neugeboreneninfektion (Early onset Disease [EOD]). Bevor Massnahmen zur Prävention der GBS Erkrankungen bei Neugeborenen eingeleitet wurden, erkrankten 1-3 Neugeborene pro 1000 Geburten an einer EOD. Davon starben 20-50% (Rausch, Gross, Droz, Bodmer & Surbek, 2008). Ab 1980 wurde aktiv nach Strategien gesucht, welche eine Übertragung der Streptokokken B unter der Geburt von der Mutter zum Kind verhindern (Centers for Disease and Control [CDC], 2010). Aktuelle Zahlen zeigen eine Prävalenz der GBS positiven Schwangeren in der Schweiz zwischen 15-21% (Rausch et al., 2008; Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe [SGGG], 2006). Etwa die Hälfte der Kinder dieser positiven Frauen wird während der Geburt mit Streptokokken B besiedelt. Insgesamt erkranken 0.2 bis 2 Neugeborene pro 1000 Geburten in der ersten Lebenswoche an einer Sepsis, Pneumonie oder Meningitis als Folge der Streptokokken B Besiedlung. 5% dieser erkrankten Neugeborenen sterben (Köster, 2011). Für die aktuelle Situation in der Schweiz mit rund 80‘000 Geburten jährlich (Bundesamt für Statistik, 2012) bedeutet dies, dass 1-8 Neugeborene pro Jahr an einer EOD sterben. Vergleicht man diese aktuellen Zahlen mit den Inzidenzen der Zeit bevor es prophylaktische Massnahmen gab, wird ersichtlich, dass eine Prävention der EOD wichtig und wirkungsvoll ist. Aktuell werden national und international verschiedene Präventionsstrategien empfohlen und in die Praxis umgesetzt. Die Empfehlung der SGGG (2006) ist die einzige, national empfohlene Präventionsstrategie in der Schweiz. Darin wird ein generelles Screening aller schwangeren Frauen auf GBS in der 35.–37. Schwangerschaftswoche (SSW) empfohlen. Positiv getestete Schwangere erhalten eine intrapartale Antibiotikaprophylaxe (IAP). Bei unbekanntem Trägerstatus der Frau und auftretenden Risikofaktoren (Geburt vor der 37. SSW, Blasensprung länger als 18 Stunden und Fieber über 38˚ C unter der Geburt), aktueller GBS-Bakteriurie und bei einem bereits an EOD erkranktem Kind, ist eine IAP ebenfalls indiziert (SGGG, 2006). Die aktuell empfohlenen, nationalen und internationalen Managements weisen Widersprüche betreffend des optimalen Vorgehens auf. Die Kontroverse ist bei den Empfehlungen 4 Knoblauchtherapie zum Screening in der Schwangerschaft und den Indikationen für eine IAP ersichtlich. Die Effektivität des beschriebenen Managements in der Schweiz liegt bei 80% (Rausch et al., 2008). Gründe für das Empfehlen einer zurückhaltenden Präventionsstrategie (kein generelles Screening, keine routinemässige IAP) sind die entstehenden Nachteile des Screenings und der IAP. Dazu zählen steigende Kosten, ein erhöhtes Risiko für anaphylaktische Reaktionen und ein vermehrter Gebrauch von Antibiotika in der Geburtshilfe (Rausch et al., 2008). Der zunehmende Gebrauch von Antibiotika führt zu Antibiotikaresistenzen, welche im Gesundheitswesen viele Probleme verursachen. Sie gefährden die Behandlung schwerwiegender Infektionen, da die Resistenz der Bakterien gegen ein Antibiotikum dessen Wirkung abschwächt oder ganz verhindert (Stille, Brodt, Groll & Just-Nübling, 2005). Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge sterben in Europa jährlich rund 25'000 Menschen an Infektionen mit antibiotikaresistenten Bakterien (WHO, 2011). Die Resistenzen führen zu erheblichen Mehrkosten durch erhöhte Sterblichkeit, verlängerte stationäre Spitalaufenthalte wegen längerer Krankheit, Isolationsmassnahmen und aufwändigere Behandlung. Auch in der Geburtshilfe, bei der Therapie von GBS, sieht man die Problematik der Resistenzen (Rausch et al., 2008). In einer Studie wurde die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen von GBS untersucht. Dabei wurde eine Resistenz gegen Clindamycin und Erythromycin bis zu 25% festgestellt. Diese Antibiotika finden bei Frauen mit einer GBS Infektion und einer Penicillinallergie zur IAP Verwendung (Panda, Iruretagoyena, Stiller & Panda, 2008). Zur Bekämpfung der Ausbreitung solcher Antibiotikaresistenzen hat die WHO einen Strategieplan entwickelt, worin sie Massnahmen, wie die Förderung eines umsichtigeren Umgangs mit Antibiotika, beschreiben (WHO, 2011). Die Gesundheit von Frau und Kind zu fördern ist ein Grundsatz aus dem Kompetenzprofil der Hebamme (Berner Fachhochschule Gesundheit, 2008). Es liegt demnach in ihrem Interesse, aktiv zu einem umsichtigeren Umgang mit Antibiotika im Gebärsaal beizutragen. Um die Gesundheitsförderung von Frau und Kind umsetzen zu können, ist es nötig, eine wirksame Therapie- und Präventionsstrategie von GBS Erkrankungen ohne Risiken zu kennen. Hebammen in einem Geburtshaus der Schweiz empfehlen schwangeren Frauen mit einem positiven Streptokokken B Abstrich eine Knoblauchtherapie, um eine Antibiotikatherapie zu vermeiden. Dabei soll die Frau eine Knoblauchzehe an einem Faden befestigen und über Nacht vaginal einführen. Dies wiederholt sie eine Woche lang täglich. Die Anwendung basiert auf dem Wissen der antimikrobiellen Wirkung des 5 Knoblauchtherapie Knoblauchs. Die Pflanze enthält den Wirkstoff Allicin, welcher die Enzyme der Bakterien hemmt, wodurch das Bakterium abgetötet wird (Prager-Khoutorsky et al., 2007). Die Hebammen aus der Praxis sind daran interessiert, dass alternative Möglichkeiten zur IAP bezüglich der EOD Prävention geklärt werden. Ihr Anliegen ist es, die Wirksamkeit der Knoblauchtherapie zu untersuchen, da bisher keine Evidenzen dazu vorliegen. 1.1 Zielsetzung und Fragestellung Ziel dieser systematischen Literaturreview ist es, zu prüfen, welche aktuellen Behandlungsempfehlungen bei Streptokokken B Infektionen in der Schwangerschaft nachgewiesen wirksam oder nicht wirksam sind. Zudem soll herausgefunden werden, ob laut aktueller Evidenzlage eine Knoblauchtherapie bei schwangeren Frauen mit einer Streptokokken B Infektion wirksam ist und ob weitere Untersuchungen dazu notwendig sind. Sollte weitere Forschung indiziert sein, wird mit Hilfe eines Forschungsplanes die Möglichkeit aufzeigt, wie eine Studie durchgeführt werden kann. Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen: Welche Behandlungsmethoden werden aktuell bei Streptokokken B Infektionen in der Schwangerschaft empfohlen? Wie sind die Evidenzen der aktuellen Behandlungsmethoden? Kann eine präpartale Knoblauchtherapie bei Streptokokken B positiven Frauen einen ausreichenden Schutz vor schwerwiegenden Infektionen beim Neugeborenen gewährleisten? Wenn die Evidenz zur Wirkungsweise der Knoblauchtherapie bei Streptokokken B positiven Frauen in der Schwangerschaft nicht ausreichend erbracht ist, wie würde ein Forschungsplan zur Überprüfung dieses Vorgehens aussehen? 1.2 Eingrenzung Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt bei der Behandlung von Streptokokken B Infektionen in der Schwangerschaft und der damit verbundenen Prävention von GBS Erkrankungen der Neugeborenen in den ersten sieben Tagen nach der Geburt (EOD). Es wird nicht auf das Management bei Frühgeburten eingegangen. Die Krankheitsbilder einer GBS Infektion bei Neugeborenen werden nicht differenziert beschrieben. Zudem sind Auswirkungen einer Streptokokken B Infektion auf die Befindlichkeit der Frauen und die Therapie einer akuten vaginalen Infektion mit GBS nicht Bestandteil dieser Arbeit. 6 Knoblauchtherapie 2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN Im folgenden Kapitel wird das Vorwissen für die anschliessende Literaturanalyse beschrieben. Dabei werden Begriffe zur Thematik der Streptokokken B Infektion in der Schwangerschaft und deren Screening- und Behandlungsmethoden, welche als Grundlage dieser Arbeit dienlich waren, erklärend aufgezeigt. Anhand des Biochemismus des Knoblauchs wird erläutert, wie die Pflanze als Alternative zum Antibiotikum gegen Streptokokken der Gruppe B (GBS) eingesetzt werden kann. Abschliessend werden die verschiedenen Forschungsdesigns und die Ethik in der Forschung beschrieben, welche bei der Proposalentwicklung als Grundlage dienen sollen. 2.1 Aktuelle Screeningmethoden für Streptokokken B Ein Screening dient dazu, Erkrankte aus der Menge der Gesunden heraus zu sieben. Das dazu nötige Sieb ist der Screeningtest (Kürzl, 2006). Um schwangere Frauen mit einer vaginalen Streptokokken B Besiedlung aufzudecken, wird ein mikrobiologischer Abstrich durchgeführt. Der Abstrich kann vaginal, rektal oder rektovaginal erfolgen. Trappe, Shaffer und Stempel (2011) zeigten, dass die Resultate von vaginalen und rektovaginalen Abstrichen eine hohe Übereinstimmung aufweisen. Im Gegensatz dazu sagt die Studie von El Aila et al. (2010) aus, dass der rektovaginale Abstrich die Anzahl der entdeckten GBS positiven Frauen im Vergleich zum vaginalen oder rektalen Abstrich erhöht. Der vaginale Abstrich weist bei den Frauen eine höhere Akzeptanz gegenüber dem rektalen auf (Daniels et al., 2009; Trappe et al., 2011). Wissenschaftliche Ergebnisse zum optimalen Zeitpunkt des Screenings in der Schwangerschaft sind kontrovers. Itakura et al. (1996) beschreiben die vaginale Kolonisation mit GBS als ein ständig wechselnder Status, welcher chronisch, intermittierend oder vorübergehend sein kann. Es besteht ein statistischer Unterschied zwischen der Besiedlung von Streptokokken B einen Tag vor der Geburt und jener am Tag der Geburt. Es wurde nachgewiesen, dass 13% der Frauen, die zwischen der 35.-36. SSW als positiv getestet worden sind, bei der Geburt nicht mehr von Streptokokken B besiedelt sind. Im Vergleich dazu bleiben 96% der in der Schwangerschaft negativ getesteten Frauen bis zur Geburt unbesiedelt (Yancey, Schuchat, Brown, Lee Ventura & Markenson, 1996). Ein Screening, welches maximal fünf Wochen vor der Geburt durchgeführt wurde, hat eine signifikant höhere Aussagekraft als eines, das länger zu- 7 Knoblauchtherapie rückliegt (Yancey et al., 1996). Um präanalytische Fehlerquellen zu vermeiden, sind die genauen Anleitungen des jeweiligen Labors zu beachten. Für die Diagnostik von GBS gibt es verschiedene mikrobiologische Verfahren. Als Standard gilt der Kulturnachweis auf einem Nährmedium. Für die Anzucht dient bluthaltiger Agar, auf dem die Erreger einen deutlichen ß-Hämolysehof entwickeln. Die gewachsenen Streptokokken B werden jetzt serologisch durch Nachweis des gruppenspezifischen Zellwandantigens mittels spezifischer Antikörper identifiziert (Ziesing, Heim & Vonberg, 2009). Als Alternative kann zur selektiven Anreicherung der Erreger ein flüssiges Kulturmedium (Todd-Hewitt Bouillon) verwendet werden, welches die Erkennung der besiedelten Frauen im Vergleich zur Standardmethode erhöht (Rallu, Barriga, Scrivo, Martel-Laferrière & Laferrière, 2005). Das Resultat ist nach 48 Stunden ersichtlich. Die Kosten eines Kulturnachweises belaufen sich in der Schweiz zwischen 50.- bis 70.- CHF pro Analyse (persönliche Mitteilung, 11. Mai, 2012). Molekularbiologische Verfahren dienen als Alternative zum Kulturnachweis. Anhand einer Polymerasekettenreaktion (PCR) werden bestimmte Nukleinsäuresequenzen von GBS stark vermehrt und können dadurch leicht nachgewiesen werden (Ziesing et al., 2009). In der Schweiz findet der GenXpert-GBS-Test Anwendung. Es ist ein exakter Schnelltest, der nach der PCR Methode funktioniert und gut unter der Geburt angewendet werden kann. Das Resultat ist nach 2-3 Stunden bekannt (Daniels et al., 2009; El Helali, Nguyen, Ly, Giovangrandi & Trinquart, 2009; Gavino & Wang, 2007; Honest, Sharma & Khan, 2006). Die Kosten in der Schweiz betragen 180.- CHF pro Analyse (persönliche Mitteilung, 11. Mai, 2012). 2.2 Streptokokken B Infektion in der Schwangerschaft Die Bakteriengattung Streptococcus umfasst zahlreiche Spezies gram-positiver Kokken und ist ein typischer Schleimhautparasit. Die ß-hämolysierenden Streptokokken der Gruppe B bilden die Spezies S. agalactiae, sie kommen vorwiegend bei Tieren vor (Gatermann & Miksits, 2009). Beim Menschen besiedeln sie die Schleimhäute des Intestinaltraktes und können physiologischer Bestandteil der Darmflora sein (Neumann, Feucht, Becker & Späth, 2010; Petersen, 2003). Alle Keime des Darmes kommen in relativ hohen Konzentrationen auch im Perinealbereich vor, von wo aus sie in die Vagina gelangen können (Petersen, 2003). Ist das üblicherweise widerstandsfähige, saure Scheidenmilieu gestört (erhöhter pH-Wert von 4.8-5.5), bietet es den Darmkeimen günstige Vermehrungsbedingungen (Köster, 2011). Antibiotikatherapien, Fremdkörper (Tampon), mangelnde Hygiene, Scheidenspülungen, Östrogenmangel, schlechte Durchblutung oder Stress können Störfaktoren der Vaginalflora darstellen 8 Knoblauchtherapie (Neumann et al., 2010). Eine vaginale Streptokokken B Kolonisation verläuft oft asymptomatisch, daher wird in der Regel auch keine Antibiotikatherapie durchgeführt (Shaw, Mason & Scoular, 2003). Zum Problem wird die Kolonisation oft erst in der Schwangerschaft. In der Schweiz sind 15-21% der schwangeren Frauen mit GBS besiedelt (Rausch et al., 2008; SGGG, 2006). Beim Durchtritt durch den Geburtskanal der besiedelten Mutter kann sich das Neugeborene infizieren (Köster, 2011). Die neonatale Infektion ist das wichtigste Krankheitsbild der Streptokokken B. Das klinische Spektrum der GBS Infektionen in der Perinatalzeit weist eine hohe Variabilität auf und kann eine Sepsis, Meningitis oder Pneumonie verursachen (Mylonas & Friese, 2006). Sie lässt sich in eine Frühform (early onset) und eine Spätform (late onset) unterteilen. Die Frühform ist die schwerwiegendste Form der neonatalen GBS Infektion und kann innerhalb weniger Stunden bis 5 Tage post partum (p.p.) einsetzen (Luyben & Stiefel, 2007). 0.2 bis 2 Neugeborene pro 1000 Geburten erkranken an einer Early onset Disease (EOD) (Köster, 2011). Es kann davon ausgegangen werden, dass sich zuerst die kindliche Lunge mit GBS besiedelt und eine Pneumonie hervorruft. In deren Folge gelangen die Erreger rasch in die Blutbahn. Dadurch wird eine Sepsis verursacht, welche unbehandelt innerhalb weniger Stunden zum septischen Schock mit Multiorganversagen und zum Tod (bei 5% der erkrankten Neugeborenen) führen kann. 20% der Kinder mit einer Sepsis entwickeln begleitend eine Meningitis, welche bei Überleben mit lebenslangen neurologischen Schäden verbunden ist (Köster, 2011). Für die genannten Formen der Früherkrankung gibt es keine spezifischen Symptome. Frühzeichen können sich durch aschgraue Haut, Atemstörungen, Fieber und Tachykardie äussern (Mylonas & Friese, 2006). Folgende Faktoren stehen in Verbindung mit einer höheren Inzidenz an EOD und wurden von nationalen (SGGG, 2006) und internationalen (CDC, 2010) Leitlinien als Risikofaktoren definiert: Intrapartale Amnioninfekte GBS-Bakteriurie in der aktuellen Schwangerschaft Blasensprung > 18 Stunden Fieber > 38˚ C Frühgeburt < 37 SSW vorausgegangenes an EOD erkranktes Kind 9 Knoblauchtherapie Die Wahrscheinlichkeit der Erkrankung des Neugeborenen steht in direktem Zusammenhang mit der Dichte der Keimbesiedelung der Mutter und der Unreife des Kindes (Enkin et al., 2006). 2-7% der Schwangeren weisen eine GBS-Bakteriurie auf, was ein Hinweis auf eine besonders ausgeprägte Kolonisation des Genitaltraktes ist (CDC, 2010). Die Späterkrankung der neonatalen GBS Infektion, die 1 bis 6 Wochen nach der Geburt einsetzt, verläuft vorwiegend als Meningitis. Die Spätform wird oft durch Schmierinfektionen übertragen (Mylonas & Friese, 2006). Eine Antibiotikabehandlung des Neugeborenen ist bei einem Nachweis der GBS Besiedlung durch Kultivierung und gleichzeitiger klinischer Symptomatik indiziert (Mylonas & Friese, 2006). 2.3 Antibiotikatherapie bei Streptokokken B Infektionen Antibiotika sind Arzneimittel zur Therapie von bakteriellen Infektionen. Bereits in geringen Mengen hemmen sie das Wachstum der Mikroorganismen (bakteriostatische Wirkung) oder töten diese ab (bakterizide Wirkung) (Pschyrembel, 2002). Ursprüngliche Antibiotika sind natürlich gebildete Stoffwechselprodukte von Pilzen und Bakterien, wie das Penicillin und deren halbsynthetisch hergestellten Abkömmlinge. Heute sind auch vollsynthetisch oder biotechnologisch gewonnene Antibiotika erhältlich. Nicht jedes Antibiotikum hat denselben Wirkungsmechanismus (Vgl. Abb. 1). Es gibt Schmal- und Breitspektrum-Antibiotika. Schmalspektrum-Antibiotika zeigen nur bei wenigen Bakterienarten Wirkung, während Breitspektrum-Antibiotika bei einer Vielzahl von unterschiedlichen Keimen wirksam sind (Stille et al., 2005). Antibiotika werden intrapartal bei schwangeren Frauen mit einer Streptokokken B Kolonisation eingesetzt, um eine Übertragung auf das Kind und somit eine GBS indizierte Neugeboreneninfektion zu verhindern. Internationale (CDC, 2010) und nationale (SGGG, 2006) Leitlinien empfehlen dafür eine intravenöse Therapie mit Penicillin G oder Amoxicillin unter der Geburt. Um einen ausreichenden Schutz für Mutter und Kind zu erreichen, müssen zwischen der ersten Antibiotikagabe und der Geburt des Kindes mindestens vier Stunden vergehen. Die Initialdosis sollte deshalb so früh wie möglich verabreicht und alle vier bis sechs Stunden wiederholt werden (SGGG, 2006). Eine Antibiotikatherapie bei Streptokokken B positiven Frauen in der Schwangerschaft wird nicht empfohlen, da sich eine solche Behandlung nur kurzfristig auf die vaginale Besiedlung auswirkt und es bis zur Geburt zu einer Rekolonisation kommen kann. Eine 10 Knoblauchtherapie pränatale Therapie müsste daher bis zur Geburt fortgesetzt werden (Enkin et al., 2006). Die empfohlenen Wirkstoffe Penicillin G und Amoxicillin sind bakterizide Antibiotika, welche die bakterielle Zellwandsynthese hemmen (Arzneimittelkompendium, 2012). Bei einer Penicillinallergie wird Clindamycin oder Erythromycin verwendet, wobei eine Resistenzbestimmung angefordert werden muss, da Resistenzen von GBS gegenüber Clindamycin und Erythromycin in bis zu 25% der Fälle vorkommen (Panda et al. 2008). Unter einer Antibiotikaresistenz versteht man die Widerstandsfähigkeit eines Bakteriums gegen ein Antibiotikum. Dabei führt eine Behandlung mit dem spezifischen Antibiotikum weder zur Wachstumshemmung, noch zur Abtötung des Bakteriums. Eine Resistenz kann natürlich (primäre Resistenz) oder erworben (sekundäre Resistenz) sein. Bei der primären Resistenz sind Bakterien natürlicherweise gegen bestimmte Antibiotika resistent, da eine Aufnahme des Wirkstoffes durch die Zellstruktur des Bakteriums verhindert wird. Die sekundäre Resistenz kann durch eine Mutation des Bakteriums oder durch eine genetische Informationsübertragung zwischen zwei verschiedenen Bakterien erfolgen (Stille et al., 2005). Die Ausbreitung der antibiotikaresistenten Keime ist vor allem auf den freizügigen Einsatz von Antibiotika in der Humanund Veterinärmedizin, aber auch in der Landwirtschaft (Massentierhaltung) zurückzuführen (Sköld, 2011). Abb. 1: Wirkungsmechanismus Antibiotika (abgerufen am 19. April 2012 unter: http://www.zum.de/Faecher/Materialien/beck/13/bs13-7.htm9) 11 Knoblauchtherapie 2.4 Knoblauch (Allium sativum Linn) Der Knoblauch (Allium sativum L.) ist eine Pflanzenart der botanischen Familie der Zwiebelgewächse (Alliaceae). Er besteht aus schwefelhaltigen und nicht-schwefelhaltigen Stoffen und ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt, welche ihre Anwendung als Gewürz und Heilmittel bereits im Zeitraum von 9000-4000 v.Chr. fand. Das beweisen neolithische Funde aus dem Orient und Mitteleuropa (Koch & Hahn, 1988). Der Knoblauch stammt ursprünglich aus Mittelasien, wo er bis heute im wilden Zustand wächst. Von dort aus kam das Knollengewächs, erst durch Hirten, dann mit dem Seidenhandel aus China in den Mittelmeerraum (Koch & Hahn, 1988). Die lange Tradition der Pflanze verdankt der Knoblauch vor allem seinen Heileigenschaften, welche durch seinen komplizierten Biochemismus zu begründen sind. Ried, Frank, Stocks, Fakler & Sullivan (2008) haben in ihrer Studie aufgezeigt, dass der Knoblauch sowohl als Antisklerotikum (gegen Arterienverkalkung) wirksam ist, als auch zur Behandlung von Herzerkrankungen eingesetzt werden kann. Andere Studien untersuchten die krebshemmende Wirkung der Pflanze. Es zeigte sich, dass die Aktivität eiweissspaltender Enzyme, welche das Wachstum von Tumorzellen begünstigen, durch Inhaltsstoffe des Knoblauchs gehemmt werden konnten (Fleischauer, Poole & Arab, 2000; Ngo, Williams, Cobiac & Head, 2007). Weitere Wirkung zeigt A. sativum bei Parasiten, Pilzerkrankungen, sowie bei Rheuma- und Nervenschmerzen (Konvicka, 2001). Beachtlich ist vor allem die antibiotische Wirkung von Knoblauch, was mehrfach in-vitro bewiesen werden konnte (Arzanlou & Bohlooli, 2010; Cutler et al., 2008; Fujisawa et al., 2009). Das wichtigste Antibiotikum der Pflanze ist das schwefelhaltige Allicin. Der Gehalt an schwefelhaltigen Inhaltsstoffen in Frischknoblauch unterliegt einer erheblichen biologischen Variabilität (Schulz & Hänsel, 2004). Das Allicin ist im Knoblauch nicht vorhanden, sondern entsteht erst nach einer mechanischen Verletzung der Knoblauchzehe. Dabei wird das Enzym Allinase freigesetzt, worauf das Alliin in Allicin zerlegt wird. Auch der typische Knoblauchgeruch wird erst mit der Zerlegung von Alliin in Allicin freigesetzt (Konvicka, 2001). Mit dieser chemischen Reaktion und dem Entstehen von Allicin werden zwei Enzymgruppen, die Zystein-Proteinasen und AlkoholDehydrogenasen, blockiert. Beide Enzymgruppen kommen bei Streptokokken der Gruppe B, sowie bei vielen anderen Mikroorganismen vor und spielen eine wesentliche Rolle für ihren Stoffwechsel und somit ihr Überleben. Eine hemmende Wirkung auf die DNA Polymerase des Bakteriums scheint wahrscheinlich, ist aber bisher nicht vollstän- 12 Knoblauchtherapie dig bewiesen (Ankri, Miron, Rabinkov, Wilchek & Mirelman, 1997). Konvicka (2001) beschreibt in seinem Buch über Knoblauch, dass Allicin selbst bei einer Verdünnung von 1:125000 noch gram-positive sowie gram-negative Bakterien vollumfänglich hemmen kann. Ein Milligramm Allicin ist mit der antibiotischen Wirksamkeit von 15 I.E. Penicillin vergleichbar (Konvicka, 2001). Sowohl Allicin als auch Penicillin, oder das halbsynthetisch gewonnene Amoxicillin, haben bakterizide Eigenschaften. Beim Allicin handelt es sich um eine Schwefelsauerstoffverbindung, welche sehr instabil ist. Dies wird als Nachteil für die Herstellung von Medikamenten angesehen. Eine Resistenzentwicklung gegen Allicin wird von den Wissenschaftlern als sehr unwahrscheinlich eingestuft, da die Bakterien dafür ausgerechnet gegen Enzyme resistent werden müssten, die ihr Überleben sichern (Koch & Hahn, 1988). 2.5 Forschungsdesigns In der Pflegeforschung wird der Begriff „Forschungsdesign“ oft unterschiedlich definiert. So verwendet Mulhall (1998) den Begriff ausschliesslich bei quantitativer Forschung, während Polit, Beck & Hungler (2004) das Design als eine Art Forschungsplan des generellen Forschungsprozesses beschreiben. Es soll das Vorgehen der Forschenden während des Prozesses aufzeigen. Ausgehend von Polit et al. (2004), werden die Forschungsdesigns nach qualitativem und quantitativem Ansatz gegliedert. Nicht immer können klare Grenzen zwischen den einzelnen Designs gemacht werden. Kommt es zur Vermischung mehrerer Ansätze oder Methoden, spricht man von Triangulation. Möchte eine Studie die Kausalbeziehung von Ursache-Wirkung untersuchen (wie die Wirksamkeit der Knoblauchtherapie), so verwenden die Forschenden meist einen quantitativen Ansatz. Dabei wird das Phänomen nicht wie beim qualitativen Forschungsdesign aus der Sicht des einzelnen Studienteilnehmers erforscht (Polit et al. 2004). Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt deshalb beim quantitativen Ansatz. In der quantitativen Forschung lassen sich drei klassische Arten von Forschungsdesigns unterscheiden. Das experimentelle Forschungsdesign wird dann gewählt, wenn man einen Wirkungsnachweis erbringen will. Es ist durch drei Merkmale gekennzeichnet: Es findet eine Manipulation der unabhängigen Variable statt (Intervention), es gibt Kontrollen der Variablen (Kontrollgruppen) und die Studienteilnehmer werden nach dem Zufallsprinzip der Interventions- oder Kontrollgruppe zugeteilt (Randomisierung). 13 Knoblauchtherapie Die randomisierte kontrollierte Studie (RCT), die zu den experimentellen Designs gehört, gilt als Goldstandard der Forschung. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass sie beim Testen von der Ursache-Wirkungsbeziehung am aussagekräftigsten ist, und dass aufgrund der Randomisierung verzerrende Effekte verhindert werden. Nachteile ergeben sich aus dem hohen Zeit- und Kostenaufwand und daraus, dass eine Randomisierung aus praktischen oder ethischen Gründen nicht immer anwendbar ist. Das quasi-experimentelle Design hat Ähnlichkeiten mit der experimentellen Studie. Auch hier gibt es eine Intervention, jedoch fehlen die Randomisierung und/oder eine Kontrollgruppe, wodurch die kausale Schlussfolgerung geschwächt wird. Die dritte Art eines quantitativen Forschungsdesigns ist die nicht-experimentelle Studie, welche dann zum Einsatz kommt, wenn eine Manipulation der unabhängigen Variable nicht möglich oder unethisch ist. Die nicht-experimentelle Forschung ist praxisnah und ermöglicht das Erfassen von grossen Datenmengen, jedoch lassen sich keine Rückschlüsse auf die Kausalität ziehen (Cluett und Bluff, 2003). Die Population einer quantitativen Studie muss genau ausgewiesen werden, um aufzuzeigen, welche Merkmale die Probandinnen haben sollten. Zudem wird durch die genaue Festlegung der Grundgesamtheit die Gruppe dargelegt, auf die sich die Ergebnisse der Studien verallgemeinern lassen. Um die Anzahl von Probandinnen einer quantitativen Studie zu bestimmen, gibt es keine fest etablierten Kriterien oder Regeln. Grundsätzlich gilt, je grösser der Umfang, desto repräsentativer ist die Studie. Die Schätzung der Populationsgrösse sollte auf vorangegangene Forschungsarbeiten oder auf die persönliche Erfahrung von forschenden Personen gestützt werden (Polit et al., 2004). Die Datenerhebungsmethode bei quantitativen Studien sollte sich der genauen Messung und Quantifizierung anbieten. Die Wahl der Datenerhebungsmethode wird oft durch die Forschungsfrage bestimmt. Die Daten sollten strukturiert und objektiv erhoben werden. Daten, welche statistisch analysiert werden sollen, müssen auf eine Weise erhoben werden, welche sich quantifizieren lässt. In den Humanwissenschaften lässt sich ein grosser Teil an Informationen durch direktes Befragen der Personen gewinnen. Mittels strukturierten Fragebögen können mit wenig Kosten und geringem Zeitaufwand relevante Informationen gewonnen werden. Um neue Interventionen in der Pflege zu testen, werden biophysiologische Messmethoden empfohlen (Polit et al., 2004). 14 Knoblauchtherapie 2.6 Ethik Die Ethik ist ein allgemeiner Begriff für verschiedene Arten des Verstehens und Untersuchens des moralischen Lebens (Beauchamp & Childress, 2008). Die Hebamme soll sich in ihrer Tätigkeit von den ethischen Werten und Prinzipien des internationalen Ethik-Kodex für Hebammen, welcher 1993 von der International Confederation of Midwives (ICM) veröffentlicht wurde, leiten lassen. Der Kodex soll als Grundlage für Ausbildung, Berufsausübung und Forschung der Hebammen dienen (Schweizerischer Hebammenverband [SHV], 1994). Des Weiteren sollen die vier biomedizinethischen Prinzipien (Respekt der Autonomie, Schadenvermeidung, Fürsorge und Gerechtigkeit) von Beauchamp & Childress (2008) im Bereich des heilberuflichen Handels ethische Orientierung bieten. Sie gelten heute als klassische Prinzipien der Medizinethik und bilden die leitenden Grundsätze der Leitlinie zur Forschung mit Menschen der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW, 2009). Während der Berufsausübung sowie in der Forschung sollte stets der Respekt vor der Autonomie gewährt werden. Jede medizinische Handlung bedingt, dass der Patient aufgeklärt wurde, alles verstanden hat, freiwillig handelt, entscheidungskompetent ist und zustimmt (informed consent). Der Autonomie-Anspruch eines Patienten entspricht nicht immer seiner Autonomie-Fähigkeit. Deshalb ist wichtig, die Entscheidungsfähigkeit der Patienten zu fördern und all jenen mit eingeschränkter Autonomie und damit erhöhter Abhängigkeit vermehrten Schutz vor Schädigung und Missbrauch zu bieten (SAMW, 2009). Schädliche Eingriffe sollen unterlassen werden (Beauchamp & Childress, 2008). Fehler sollen vermieden, oder auf ein Minimum reduziert werden (SAMW, 2009). Handeln, welches das Wohl des Patienten fördert und ihm nützt, soll aktiviert werden (Beauchamp & Childress, 2008). Zudem besteht die Pflicht, den möglichen Nutzen zu maximieren (SAMW, 2009). Menschen müssen stets gleichwertig anerkannt und behandelt werden. (Beauchamp & Childress, 2008). Lasten, Risiken, Chancen und Nutzen sollen fair auf beteiligte Personen verteilt werden (SAMW, 2009). Die Besonderheit der Forschung mit Schwangeren aus ethischer Sicht ist, dass ein doppeltes Risiko besteht: Sowohl für die Mutter als auch für das Kind. Aus diesem Grund müssen solche Studien immer beide Risiken berücksichtigen. Zusätzlich sollten 15 Knoblauchtherapie für Nichtschwangere bereits genügend positive Resultate bezüglich der Verträglichkeit vorliegen (SAMW, 2009). Bei Studien mit einer Randomisierung stellt sich aus ethischer Sicht das Problem, dass die Behandlung der Beteiligten nicht mehr individuell erfolgen kann, da die Teilnehmenden nach einem Zufallsprinzip in die verschiedenen Gruppen aufgeteilt werden. So werden Entscheidungen, die eigentlich Gegenstand der medizinischen Beurteilung sind, studienbedingt zumindest teilweise dem Zufall überlassen (SAMW, 2009). 3 METHODEN In der vorliegenden Arbeit geht es darum herauszufinden, welche aktuellen Behandlungsmethoden zu Streptokokken der Gruppe B (GBS) in der Schwangerschaft empfohlen werden. Zudem soll anhand aktueller Evidenz festgestellt werden, ob der Knoblauch eine antibakterielle Wirkung gegen GBS und somit einen ausreichenden Schutz vor Early onset Disease (EOD) aufweist. Für die Beantwortung der Fragestellung wurde die Methode einer systematischen Literaturreview gewählt. Ergibt die Auswertung der Daten eine unzureichende Datenlage zur Knoblauchtherapie bei schwangeren Frauen mit einer Streptokokken B Kolonisation, wird zusätzlich ein Proposal für ein Forschungsprojekt entwickelt. Im nachfolgenden Kapitel werden das Vorgehen während der Literaturrecherche, sowie die Analysemethoden zur Auswertung der Daten beschrieben. 3.1 Literaturrecherche Die Literaturrecherche ist aufgrund der Fragestellung in zwei Suchstrategien gegliedert worden. In einem ersten Durchgang wurde nach aktuellen Behandlungsmethoden bei Frauen mit einer GBS Kolonisation in der Schwangerschaft gesucht. Bei der zweiten Recherche ging es darum, Evidenz für die antibakterielle Wirksamkeit des Knoblauchs gegen Streptokokken der Gruppe B zu finden. Die Recherche fand im Zeitraum zwischen dem 19. Oktober 2011 und dem 23. Mai 2012 statt. Für die systematische Übersichtsarbeit wurde von beiden Autorinnen unabhängig in den für ihre Fragestellung relevanten Datenbanken recherchiert. Bei der Recherche zu den aktuellen Behandlungsmethoden bei Frauen mit einer Streptokokken B Kolonisa- 16 Knoblauchtherapie tion waren dies die Datenbanken Cochrane Library und PubMed. Zusätzlich wurden Leitlinien zu den Behandlungsstrategien über die Datenbanken der Geneva Foundation for Medical Education and Research (GFMER), des National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) und der SGGG gesucht. Für die Literatursuche zur antibakteriellen Wirkung von Knoblauch wurden die Datenbanken PubMed, Medpilot, TripDatabase, Science Direct, Biosis sowie die Cochrane Library verwendet. Weitere Bestandteile der Recherche waren Literaturempfehlungen von Fachpersonen, Hinweise auf PubMed zu ähnlichen Studien oder Reviews, sowie relevante Literatur aus Literaturverzeichnissen der bereits analysierten Studien und Reviews. Eine Studie, welche nicht in der Volltextversion veröffentlicht wurde, konnte über die Kontaktaufnahme mit der Autorin besorgt werden. Die verwendeten Suchbegriffe waren, wie in Abbildung 2 graphisch dargestellt, für die aktuellen Behandlungsmethoden: Streptococcus B, GBS, Intrapartum antibiotic prophylaxis, prevention early onset sepsis, review und pregnancy. Für die antibakterielle Wirksamkeit des Knoblauchs in Englisch: Allicin, Streptococcus B, Streptococcus agalactiae, GBS, antibacterial activity, garlic und allium sativum. In Deutsch: Knoblauch, Streptokokken und antibiotische Wirkung. Streptococcus B Intrapartum antibiotic prophylaxis Streptococcus B / GBS Streptokokken review Behandlungsempfehlungen pregnancy S. agalactiae Allicin prevention early onset sepsis GBS Knoblauchtherapie bei GBS antibacterial activity antibiotische Wirkung Garlic Knoblauch Allium sativum Abb. 2: Suchbegriffe zu den aktuellen Behandlungsmethoden und der Knoblauchtherapie bei GBS Die Suchbegriffe wurden für die Recherche einzeln oder kombiniert in den erwähnten Datenbanken verwendet. 17 Knoblauchtherapie Für die Empfehlungen von aktuellen Behandlungsmethoden wurde nach Leitlinien oder Studien und Reviews, die solche Leitlinien beurteilen, gesucht. Die Einschlusskriterien für eine Leitlinie waren, dass sie von einer nationalen Gesundheitsorganisation oder einem Berufsverband lanciert wurde, die Referenzen vollständig und nachvollziehbar sind, und dass sie dem Beantworten der Fragestellung dient. Spitalinterne Leitlinien wurden ausgeschlossen. Zu Beginn der Literaturrecherche zur antibakteriellen Wirkung von Knoblauch wurden die Limitationen festgelegt, dass Studien und Reviews nicht älter als zehn Jahre alt sind (2002-2012) und sie die antibakterielle Wirkung am Menschen untersuchen. Auch wurde anfänglich nur nach Literatur gesucht, worin die antibakterielle Wirkung bei GBS untersucht wird. Im Verlauf der Arbeit musste die Literatursuche aufgrund der wenigen Ergebnisse in den Datenbanken jedoch offener gestaltet werden. Somit wurden auch Studien und Reviews eingeschlossen, in welchen die antibakterielle Wirksamkeit von Allicin gegen andere Bakterien untersucht wird. Da nur wenig Literatur bezüglich der antibakteriellen Wirkung von Knoblauch an Menschen vorhanden war, wurde auch nach Studien mit Tierversuchen gesucht. Die erste Auswahl der Studien, Reviews und Leitlinien erfolgte nach einer unabhängigen Beurteilung der Titel und Abstracts beider Autorinnen. Wenn die Studie, Review oder Leitlinie den Anforderungen dieser Arbeit entsprach, wurde die Volltextversion (meist über den Zugang einer Bibliothek) besorgt. Teilweise wurde Literatur auch nach dem Volltextstudium ausselektiert. 3.2 Analysemethoden Zur Beurteilung der quantitativen Studien wurde ein Analyseraster nach Kunz, Ollenschleger, Raspe, Jonitz & Kolkmann (2000) und Polit et al. (2004) verwendet. Kunz et al. (2000) zeigen Schlüsselkriterien und Leitfragen zur Beurteilung einer Interventionsstudie auf. Diese Leitfragen werden mit Empfehlungen von Polit et al. (2004) zur kritischen Würdigung einer Studie ergänzt. Die Studien wurden auf ihre methodische Qualität bewertet. Dabei wurde analysiert, ob das verwendete Forschungsdesign und die Studienteilnehmenden passend zur Forschungsfrage ausgewählt wurden. Zudem wurde das Risiko für systematische Fehler eingeschätzt. Dabei wurde geprüft, ob das Vorgehen der Forscher/innen mögliche Verzerrungen der Ergebnisse zur Folge hatte. Für randomisierte Studien wurde zudem eine mögliche Verblindung oder verdeckte Zuordnung erläutert. Die Interventionen und Ergebnisse wurden auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit geprüft. Abschliessend wurde die Glaubwürdigkeit 18 Knoblauchtherapie der Ergebnisse eingeschätzt. Diese Einschätzung erfolgte anhand der Gütekriterien für quantitative Forschung (Objektivität, Validität, Reliabilität und Überprüfbarkeit) und dem Vergleich zu den Resultaten ähnlicher Forschungsarbeiten. Die externe Evidenz wurde nach dem Bewertungssystem der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) & Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) (2008) bestimmt. Bei den analysierten in-vitro Studien wurden diese Bewertungskriterien als nicht zutreffend eingeschätzt. Deshalb wurde die methodische Qualität als hoch, mittel oder niedrig eingestuft. Dabei wurde der Schwerpunkt auf das Einschätzen des Risikos für systematische Fehler gelegt. Das Raster nach Behrens & Langer (2006) wurde für die Analyse der Reviews verwendet. Behrens & Langer (2006) verfassten zwölf Fragen zur Beurteilung von systematischen Übersichtsarbeiten, welche auf verschiedene vorhandene Bewertungshilfen basieren. Sowohl bei systematischen als auch unsystematischen Reviews wurde zu Beginn das methodische Vorgehen der Reviews beurteilt. Dabei wurde darauf geachtet, ob Kriterien für die Auswahl der Studien definiert und angemessen sind. Es wurde geprüft, dass alle relevanten Studien in die Review eingeschlossen wurden und auf mögliche relevante Unterschiede der einzelnen Studien geachtet. Zudem wurde analysiert, ob die Forscher/innen die Glaubwürdigkeit der Studien anhand von Kriterien eingeschätzt haben, und diese Einschätzung nachvollziehbar ist, und von mindestens zwei Personen vorgenommen wurde. Die Ergebnisse der Review wurden anschliessend auf ihre Nachvollziehbarkeit und Übertragbarkeit auf andere Populationen geprüft. Abschliessend wurden Nutzen und Risiken der Intervention eingeschätzt. Die externe Evidenz wurde nach dem Bewertungssystem der AWMF & ÄZQ (2008) bestimmt. Grundlage für die Beurteilung der Leitlinien bildete das Raster nach dem Dokument Deutsches Instrument zur Methodischen Leitlinienbewertung (DELBI) (AWMF & ÄZQ, 2008). Das Deutsche Leitlinien Bewertungsinstrument entstammt einer Kooperation der AWMF und ÄZQ und soll die Bewertung der methodischen Qualität medizinischer Leitlinien ermöglichen. Die Autor/innen formulierten Leitfragen zu insgesamt sieben Domänen. Es wurde geprüft, ob die Verfasser/innen den Geltungsbereich und Zweck ihrer Leitlinie definieren. Zudem wurde abgeschätzt, ob die relevanten Berufs- und Zielgruppen eingeschlossen wurden. Die Methode zur Leitlinienentwicklung wurde in Bezug auf ein systematisches Vorgehen bewertet. Es wurde geprüft, ob die Empfehlungen eindeutig dargestellt, schnell erfassbar und generell anwendbar sind. Die Leitlinien wurden zudem auf eine redaktionelle Unabhängigkeit und Interessenkonflikte ge- 19 Knoblauchtherapie prüft. Die externe Evidenz wurde nach dem Bewertungssystem der AWMF & ÄZQ (2008) bestimmt. Gemeinsamer Parameter aller drei Analyseraster war das Abwägen der Nützlichkeit der Ergebnisse für die Fragestellung dieser vorliegenden Arbeit. Dabei wurde zusammenfassend erklärt, welche Aspekte zur Klärung der Fragestellung beitragen. Zudem wurden bei der gesamten analysierten Literatur auf mögliche ethische Probleme geachtet. Folgende Ergebnisparameter wurden definiert: antibakterielle Wirkung von Knoblauch (insbesondere gegen GBS), Vorgehensweise in den Studien bezüglich Herstellung und Verwendung der Knoblauchextrakte, sowie das von den Forscher/innen verwendete Studiendesign. 3.3 Methode zur Proposalentwicklung Bei der Entwicklung des Forschungsplans stützte man sich auf die Empfehlungen von Cummings, Holly and Hulley (2001) und Divan (2009). Ein Proposal dient der Beschaffung von Förderungsgeldern, um die Studie zu finanzieren. Es ist also von grosser Bedeutung im Forschungsplan die Relevanz einer solchen Studie darzulegen, um zu überzeugen und mögliche Sponsoren zu finden. Cummings et al. (2001) beschreiben das Vorgehen beim Schreiben und definieren relevante Inhalte eines Forschungsplans. Das Proposal der vorliegenden Arbeit richtete sich nach den Standardinhalten eines Forschungsplanes, welche die Relevanz der Studie bis zum methodischen Vorgehen differenziert beschreiben und einen Zeit- und Budgetplan beinhalten. Bei der Wahl des Forschungsdesigns wurden die ethischen Prinzipien nach Beauchamp und Childress (2008) und der SAMW (2009) beachtet. Für die Berücksichtigung der ethischen Aspekte sind ausserdem das Beilegen eines Informationsblattes und der Einverständniserklärung zur Studie von Bedeutung. Dabei wurde nach der Checkliste der Kantonalen Ethikkommission Bern vorgegangen (KEK, 2012). Als Hilfestellung für die Ausarbeitung des Proposals wurde zudem bei der Analyse der eingeschlossenen Literatur darauf geachtet, wie die jeweiligen Forscher/innen methodisch vorgegangen sind (Vgl. Ergebnisparameter Kapitel 3.2). 20 Knoblauchtherapie 4 ERGEBNISSE Im folgenden Kapitel werden in einem ersten Teil die Suchergebnisse der zuvor beschriebenen Literaturrecherche (Kapitel 3.1) dargestellt. Anschliessend werden die Ergebnisse der Literaturanalyse, die zur Beantwortung der Fragestellung relevant sind, beschrieben. Es werden zuerst die Ergebnisse zu den aktuellen Behandlungsmethoden und anschliessend zur antibakteriellen Wirkung von Knoblauch erläutert. Um die Ergebnisse vereinfacht darzustellen, werden die relevanten Aspekte zudem in einer Tabelle zusammengefasst. 4.1 Suchergebnisse Bei der Literaturrecherche zu den aktuellen Behandlungsmethoden von Streptokokken B Infektionen in der Schwangerschaft wurden insgesamt 84 Resultate in den Datenbanken und auf den zusätzlichen Internetseiten der Berufsverbände gefunden. Nach dem Volltextstudium wurden insgesamt eine Studie (Renner et al., 2006), zwei Reviews (Koenig & Keenan, 2009; Ohlsson & Shah, 2009), zwei Leitlinien (CDC, 2010; RCOG 2003) und eine Empfehlung eines Berufsverbandes (SGGG, 2006) für die Analyse der systematischen Übersichtsarbeit verwendet. Die beiden NICE Guidelines (NICE, 2008 und NICE, 2007) wurden noch vor dem Volltextstudium ausgeschlossen. Die eine geht nur auf die Empfehlung zum GBS Screening ein, und die andere schliesst Frauen mit einem positiven Streptokokken B Abstrich von der Leitlinie aus. Nach dem Lesen der Volltexte wurden drei Leitlinien (American Academy of Pediatrics [AAP], 2011; Health Technology Assessment [HTA], 2007 & Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada [SOGC], 2004) aufgrund schwacher Evidenz, fehlender Referenzen oder Nichtbeantwortung der Fragestellung ausgeschlossen. Tabelle 1 gibt einen Überblick zu den Suchergebnissen während der Literaturrecherche. Tab. 1: Suchergebnisse zu den aktuellen Behandlungsmethoden Datenbanken Treffer Abstract Volltext Analyse Pubmed 39 7 2 2 (Renner et al., 2006; Koenig & Keenan, 2009) Cochrane Library 8 4 1 1 (Ohlsson & Shah, 2009) GFMER 28 6 5 3 (RCOG, 2003; CDC, 2010) NICE 8 2 0 0 SGGG 1 1 1 1 (SGGG, 2006) Bei der Literaturrecherche zur antibakteriellen Wirkung von Knoblauch wurden insgesamt 242 Treffer auf sechs verschiedenen Datenbanken erzielt. Nach dem Lesen von 21 Knoblauchtherapie 40 Abstracts wurden 11 Volltexte besorgt, welche relevant für die Fragestellung schienen. Zwei Artikel von Cohain (2004 & 2009) wurden ausgeschlossen, da es sich um Artikel handelte, welche lediglich Auszüge aus einer Studie enthielten. Durch die Kontaktaufnahme mit Frau J. S. Cohain konnte die zitierte Studie in der Volltextversion organisiert werden und ist in der Übersichtsarbeit mit eingeschlossen. Nach dem Lesen des Volltextes wurde die Studie von Daka (2009) von der Analyse ausgeschlossen, da sie der Beantwortung der Fragestellung nicht diente. Des Weiteren wurde nach der Literaturanalyse die unsystematische Übersichtsarbeit von Ankri & Mirelman (1999) aufgrund schwacher Qualität aus dieser Arbeit ausgeschlossen. Insgesamt wurden acht quantitative Studien zur Beantwortung der Fragestellung verwendet. Die Suchergebnisse der jeweiligen Datenbanken können Tabelle 2 entnommen werden. Tab. 2: Suchergebnisse zur antibakteriellen Wirkung von Knoblauch Datenbanken Treffer Abstract Volltext Analyse Pubmed 94 22 7 4 (Arzanlou & Bohlooli, 2010; Cutler et al., 2008; Fujisawa et al., 2008; Gull et al., 2012) Cochrane Library 1 1 0 0 ScienceDirect 64 7 1 1 (Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn, 2008) TripDatabase 1 1 0 0 Medpilot 18 9 2 2 (Fani, Kohanteb & Dayaghi, 2007; Fujisawa et al., 2009) Biosis 64 1 1 0 Handrecherche Treffer Abstract Volltext Analyse 1 1 (Cohain, 2010) 4.2 Ergebnisse aktueller Behandlungsmethoden In Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit sind aus den Ergebnissen der Analyse Unterthemen gebildet worden. Es wurde darauf geachtet, welche Präventionsstrategien empfohlen werden (Screening und Intrapartale Antibiotikaprophylaxe), welche Empfehlung zum Vorgehen beim Screening von Streptokokken der Gruppe B abgegeben wird, und wo der Nutzen und die Risiken des empfohlenen Managements liegen. Ausserdem wurde die Literatur auf ihre Qualität und Evidenz bewertet (Vgl. Tab. 7). 22 Knoblauchtherapie Empfehlungen zum Management bei GBS Kolonisation in der Schwangerschaft Aus der Literaturanalyse ergaben sich vier aktuell empfohlene Präventionsstrategien zu Streptokokken der Gruppe B (GBS) Infektionen. Das Screening-based, Risk-based, das restriktive und das zurückhaltende Management. Die Empfehlungen zum Screening und der IAP, sowie das detaillierte Vorgehen des jeweiligen Managements sind in Tabelle 3 auf Seite 24 dargestellt. Die CDC (2010), die SGGG (2006) und die Review von Koenig & Keenan (2009) sprechen alle eine Empfehlung zum Screening-based Management aus, wobei die SGGG (2006) die Risk-based und die restriktive Strategie als eine geeignete Alternative zum reinen Screeningbased Vorgehen beschreibt. Die Studie von Renner et al. (2006) untersucht das restriktive Management auf ihre Effektivität als Prophylaxe von Early onset Sepsis (EOS). Dabei kommen die Autor/innen zum Ergebnis, dass die restriktive Strategie bei einer niedrigen Prävalenz der GBS Kolonisationen, wie sie auch in der Schweiz zu finden ist, die Inzidenz der EOS signifikant reduzieren kann. Ein noch besseres Ergebnis würde laut Renner et al. (2006) die Screening-based Methode erzielen, doch ist das Kosten-Nutzen Verhältnis bei der restriktiven Strategie effektiver. Eine andere Empfehlung ergibt sich aus der Leitlinie des Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG, 2003). Sie empfiehlt kein routinemässiges Screening in der Schwangerschaft und eine intrapartale Antibiotikaprophylaxe (IAP) nur dann, wenn eine GBS Infektion in der aktuellen Schwangerschaft zufällig entdeckt wurde. Ohlsson & Shah (2009) erachten in ihrer Review die aktuelle Evidenzlage als unzureichend, um eine Empfehlung zum Management abzugeben. Die Risikofaktoren unter der Geburt, bei denen eine IAP indiziert ist, wurden von allen Autor/innen gleich definiert (Vgl. Kapitel 2.2). Die RCOG (2003) gibt als einzige die Empfehlung ab, das weitere Vorgehen bezüglich IAP beim Vorhandensein eines Risikofaktors mit der Frau zu besprechen und individuell zu entscheiden. Sie sagen aus, dass der Frau Hilfsstrukturen geboten werden sollen, die ihr eine informierte Wahl ermöglichen. Erst bei zwei oder mehr Risikofaktoren macht die RCOG (2003) eine Empfehlung zur IAP. Alle anderen Autor/innen empfehlen die IAP bereits beim Auftreten eines Risikofaktors unter der Geburt. 23 Knoblauchtherapie Tab. 3: Die vier aktuell empfohlenen Präventionsstrategien für GBS Infektionen beim Neugeborenen Präventionsstrategie Empfehlung Screening Indikation Intrapartale Literatur Antibiotikaprophylaxe (IAP) Screening-based Generelles Screening zwi- Alle Frauen mit einem positiven CDC, 2010; Management schen der 35.-37. SSW. Kein GBS Abstrich in der aktuellen Koenig & Screening ist nötig bei Frauen Schwangerschaft. Keenan, 2009; mit einer GBS-Bakteriurie in der aktuellen Schwangerschaft, sowie bei Frauen mit Frauen mit einem unbekannten SGGG, 2006 Trägerstatus und einem zusätzlichen Risikofaktor unter der Geburt. einem bereits an GBS-Sepsis erkranktem Kind. Frauen mit einer GBS-Bakteriurie in aktueller Schwangerschaft oder mit einem bereits an GBS-Sepsis erkrankten Kind. Keine IAP bei Frauen mit elektiver Sectio ohne Wehentätigkeit und Blasensprung. Risk-based Kein generelles Screening auf Frauen mit einem vorhandenen Management GBS in der Schwangerschaft. Risikofaktor unter der Geburt. SGGG, 2006 Frauen mit einer GBS-Bakteriurie in aktueller Schwangerschaft oder mit einem bereits an GBS-Sepsis erkrankten Kind. Restriktives Generelles Screening aller Bei positivem GBS Abstrich mit Renner et al., Management Schwangeren zwischen der zusätzlichem Risikofaktor unter der 2006; 35.-37. SSW. Geburt. SGGG, 2006 Bei unbekanntem Trägerstatus mit zusätzlichem Risikofaktor unter der Geburt. Zurückhaltendes Kein generelles Screening auf Management GBS. Keine routinemässige IAP. RCOG, 2003 IAP bei Frauen mit einem zufällig erhobenen GBS positiven Befund, Frauen mit einem bereits an GBSSepsis erkrankten Kind oder einer Bakteriurie in der aktuellen Schwangerschaft. Einzelfall betrachten, wenn mindestens ein Risikofaktor vorhanden ist. 24 Knoblauchtherapie Empfehlungen zum Vorgehen beim Screening Keine Empfehlung bezüglich eines Screenings machen Ohlsson & Shah (2009) und die Autor/innen der RCOG (2003) Leitlinie. Die RCOG (2003) Leitlinie sagt aus, dass keine Evidenzen vorhanden sind, die die Kosteneffektivität und der Nutzen eines generellen Screenings aufzeigen. Renner et al. (2006) und Koenig & Keenan (2009) sprechen aufgrund der Ergebnisse eine Empfehlung zum generellen Screening aus, gehen jedoch nicht konkret auf das Vorgehen des Screenings ein. Auf das genaue Verfahren des Screenings gehen die Autoren der CDC (2010) Leitlinie und der SGGG (2006) ein. Beide empfehlen eine vagino-perianale und/oder eine vagino-rektale Abstrichentnahme. Während die SGGG (2006) lediglich eine Kultivierung auf Spezialnährböden empfiehlt, geht die CDC (2010) detailliert auf die einzelnen Testverfahren (PCR, ToddHewitt Broth) ein. Doch auch die CDC (2010) empfiehlt aus Kostengründen die Kultivierung als Goldstandard. Das Schnelltestverfahren (PCR) soll nur Anwendung finden, wenn für eine Kultivierung nicht mehr genügend Zeit vorhanden ist. Koenig & Keenan (2009) sehen das Schnelltestverfahren als eine Alternativmethode zum jetzigen Screening Management. Sie legen in ihrer Review die Resultate einer Studie zum PCR-Test dar, die eine gute Sensitivität des Testes zeigen. Alle Autor/innen der analysierten Literatur, welche ein Screening empfehlen, nennen den Zeitraum zwischen der 35.-37. SSW als optimalen Screeningzeitpunkt. Auch gibt es eine Empfehlung zur präanalytischen Handhabung des Testmaterials durch die SGGG (2006), die aussagt, dass der Abstrich bei 4°-22°C bis zu vier Tagen gelagert werden kann. Nutzen der empfohlenen Strategien Alle Autor/innen zeigen mit ihren Ergebnissen eine Reduktion der Inzidenz zur GBS-Sepsis durch ihre Strategie auf. Einige geben in ihren Arbeiten die Ergebnisse aus amerikanischen Studien wieder, in denen die bestmögliche Reduktion der Inzidenz (von 1.7/1000 auf 0.34/1000 Lebendgeburten) mittels des Screening-based Managements erzielt wurde (CDC, 2010; Koenig & Keenan, 2009; Ohlsson & Shah, 2009; Renner et al., 2006). Die Effektivität der IAP als Prophylaxe einer Early onset Disease (EOD) beträgt 86-89% (CDC, 2010). Renner et al. (2006) zeigen eine Reduktion der Inzidenz der EOS von 1/1000 auf 0.53/1000 Lebendgeburten mittels der restriktiven Präventionsstrategie auf. Der Schweregrad einer 25 Knoblauchtherapie Sepsis konnte dabei von einem schweren Verlauf auf keinen gesenkt werden. Auch wurden in dieser Untersuchung weniger Antibiotika unter der Geburt verabreicht, sowohl mit der Screening-based, als auch mit der Risk-based Methode. Risiken des empfohlenen Managements Das Risiko der wachsenden Antibiotikaresistenzen durch die steigende Anzahl der IAP wird durch einige Autoren als Thematik aufgegriffen (CDC, 2010; Koenig & Keenan, 2009; RCOG, 2003; SGGG, 2006). Auch zeigt die CDC (2010) und RCOG (2003) das Risiko einer durch penizillinresistente Bakterien verursachte Septikämie beim Neugeborenen auf. Genaue Zahlen zu solchen Todesfällen werden nicht genannt. Die RCOG (2003) sieht die anaphylaktische Reaktion auf Penicillin als ein weiteres Risiko. Die Autor/innen der Leitlinie zeigen auf, dass bei einer Prävalenz der IAP von 30% (United Kingdoms) zwei Frauen pro Jahr an den Folgen eines anaphylaktischen Schocks sterben. 26 Knoblauchtherapie Tab. 4: Ergebnisse der Studienanalyse zu den aktuellen Behandlungsmethoden Autor/innen Fragestellung Design Jahr Population Methode / Intervention relevante Ergebnisse Sample Renner et Evaluieren der Qualitatives Forschungs- Die verwendeten Daten Die Forscher/innen haben eine Seit der Implementierung des restriktiven al., 2006 Wirksamkeit der design, retrospektive stammen aus der retrospektive Studie zum restrik- Managements ist die Inzidenz der EOS Präventionsstra- Durchführung Datenbank. 16‘126 tiven Management durchgeführt. von 1/1000 auf 0.53/1000 Lebendge- tegie zur Early Lebendgeburten Dazu haben sie zwei Strategien burten gesunken. Diese Inzidenz liegt onset Sepsis zwischen 1984-1993 miteinander verglichen. G1 hat leicht über der des Screening-based Ma- (EOS) in der (G1) und 9‘385 kein generelles Screening und nagement (0.32/1000). Auch der Schwe- Frauenklinik des Lebendgeburten keine routinemässige IAP er- regrad einer Sepsis konnte von einem Unispital Basels. zwischen 1997-2002 halten, G2 wurde nach dem schweren Verlauf auf keinen schwerwie- (G2). Zusätzliche restriktiven Management be- genden Fall gesenkt werden. Daten, wie das handelt. Gestationsalter, der GBS Status, das Verglichen mit der Screening-based und der Risk-based Strategie, werden mit dieser Methode weniger IAP verabreicht. Vorhandensein eines Risikofaktors, das Das Kosten-Nutzen Verhältnis ist bei einer Screening, die niedrigen Prävalenz mit dem restriktiven mütterliche Morbidität, Management effektiver als mit dem die neonatale Mortalität, Screening-based Management. zuvor geborene Kinder mit einer EOS und die IAP sind vorhanden. 27 Knoblauchtherapie Tab. 5: Ergebnisse der Reviewanalyse zu den aktuellen Behandlungsmethoden Autor/innen Fragestellung Jahr Anzahl Methode relevante Ergebnisse eingeschlossener Studien Koenig & Es wird keine Die analysierten Stu- Unsystematische Die Autoren zeigen eine grosse Kontroverse in der Datenlage auf. Sie Keenan, klare Fragestel- dien werden nicht ge- Literaturreview, das kommen zum Ergebnis, dass ein Screening-based Management die Inzidenz 2009 lung genannt nau erläutert. Es ist genaue Vorgehen ist von EOD signifikant senkt, aber gleichzeitig den Gebrauch von Antibiotika nicht erkennbar wie nicht nachvollziehbar. unter der Geburt enorm erhöht und verbunden damit die Anzahl der gram-ne- viele eingeschlossen gativ resistenten Bakterien gegen Ampicillin steigt. wurden. Als Alternative zu den heute angewendeten Managements sehen die Autoren eine Impfung gegen die krankheitsverursachenden GBS, das Verwenden eines Schnelltestverfahrens als Screening für GBS, eine Knoblauchtinktur zur Therapie einer GBS Kolonisation oder eine Therapie mit Chlorhexidine. Ohlsson & Untersuchen der Von anfänglich 13 Systematische Das Risiko für eine EOD kann durch die IAP signifikant gesenkt werden. Shah, 2009 Wirkung der IAP analysierten Studien Literaturreview Einen Zusammenhang zwischen der neonatalen Gesamtsterblichkeit und der bei schwangeren wurden nur vier in die Behandlung ohne Antibiotika unter der Geburt konnte nicht festgestellt Frauen mit einem Review mit einge- werden. positiven GBS schlossen. Die Autorinnen sind zum Ergebnis gekommen, dass die Qualität der einge- Abstrich. schlossenen Studien sehr schlecht und das Risiko für Bias hoch ist. Aus diesem Grund werden keine Empfehlungen abgeben. Tab. 6: Ergebnisse der Leitlinienanalyse zu den aktuellen Behandlungsmethoden Autor/innen Zweck Jahr CDC, 2010 Beteiligte Methode relevante Ergebnisse Interessengruppen Die Leitlinie wurde Es wurden relevante Die Leitlinie wurde Die Autor/innen empfehlen eine Screening-based Strategie: entwicklet, um in Fachpersonen in die aufgrund einer bereits Generelles Screening aller Schwangeren auf GBS in der 35.-37. SSW mittels der Praxis als Leitlinienentwicklung bestehenden Leitlinie rektovaginalem Abstrich und einer Kultivierung. Prävention von mit eingeschlossen. Die der CDC systematisch IAP bei allen positiv getesteten Frauen, Frauen mit einer Bakteriurie in der 28 Knoblauchtherapie GBS indizierten Ansichten der überarbeitet und aktua- aktuellen Schwangerschaft und Frauen die bereits ein an GBS-erkranktes Kind EOD eingesetzt Patient/innen werden lisiert. Empfehlungen geboren haben. Bei Unbekanntem Trägerstatus, empfehlen sie eine IAP bei zu werden. nicht ermittelt. aufgrund von Studien Auftreten von Risikofaktoren (>38 Grad Fieber, >18h Blasensprung, <37 und Expertenmeinung. SSW). Keine IAP wird empfohlen bei elektiver Sectio, ohne Wehentätigkeit und Blasensprung. RCOG, Die Leitlinie soll Relevante Berufsgrup- Systematische Die Autor/innen empfehlen ein zurückhaltendes Management: 2003 Gynäkolog/innen, pen sind in die Leitli- Leitlinienentwicklung. Ein generelles Screening auf GBS ist nicht empfohlen. Hebammen und nienentwicklung mit Neonatolog/innen eingeschlossen. Kein routinemässiges Verabreichen einer IAP. Eine IAP wird nur empfohlen, falls GBS zufällig in der aktuellen Schwangerschaft entdeckt wurde oder bei Empfehlungen zur Frauen mit einem bereits an GBS Sepsis erkranktem Kind und bei GBS indi- Prävention von zierten Bakteriurie in der aktuellen Schwangerschaft. GBS indizierten Wenn eine IAP empfohlen ist, müssen der Frau Hilfsstrukturen geboten wer- EOD abgeben. den, um eine informierte Wahl treffen zu können. SGGG, Empfehlung (mit Ist nicht nachvollzieh- Unsystematisches Die Autor/innen empfehlen eine Screening-based Strategie: 2006 möglichen Alter- bar dargestellt. Vorgehen bei der Generelles Screening auf GBS in der 35.-37. SSW mittels rektovaginalem nativen) an die Empfehlungsentwick- Abstrich und einer Kultivierung. Praxis abzuge- lung. ben. Die EOD zu senken ohne das Risiko einer Resistenz zu fördern. IAP bei alle positiv getesteten Frauen, Frauen mit einer Bakteriurie in der aktuellen Schwangerschaft und Frauen die bereits ein an GBS-erkranktes Kind geboren haben. Bei Unbekanntem Trägerstatus, empfehlen sie eine IAP bei Auftreten von Risikofaktoren (>38 Grad Fieber, >18h Blasensprung, <37 SSW). Keine IAP bei elektiver Sectio, ohne Wehen und Blasensprung. Als Alternative dazu empfehlen sie ein restriktives Management: Kein generelles Screening auf GBS. Eine IAP ist nur bei Auftreten von Risikofaktoren unter der Geburt indiziert. 29 Knoblauchtherapie Stärken und Schwächen der Empfehlungen zu den Präventionsstrategien Renner et al. (2006) stellen das Vorgehen und die Ergebnisse nachvollziehbar und klar dar. Sie verwendeten für ihre Studie ein retrospektives Forschungsdesign, was systematische Fehler bei der Datenerhebung zur Folge haben kann. Koenig & Keenan (2009) sind in ihrer Review unsystematisch vorgegangen. Es wird nicht klar, ob die eingeschlossene Literatur für die Thematik relevant ist. Die Ergebnisse sind deshalb nicht nachvollziehbar und überprüfbar. Die Autoren zeigen den Nutzen und die Risiken der untersuchten Intervention auf. Dabei gehen sie konkret auf die Antibiotikaresistenzen und Morbidität ein. Die Cochrane Review von Ohlsson & Shah (2009) ist aufgrund der nachvollziehbaren Ergebnisse und dem systematischen Vorgehen von hoher Qualität. Sie kommen aber zum Ergebnis, dass die von ihnen analysierte Literatur ein hohes Risiko für Bias hat (kein Placebo in den Kontrollgruppen, keine Verblindung, kleine Populationsgruppen) und die Evidenzlage zu den aktuellen Behandlungsmethoden allgemein von schwacher Qualität ist. Die Leitlinien der RCOG (2003) und der CDC (2010) sind von guter Qualität, aber auf schwacher Evidenz basierend. Die verwendeten Studien waren teilweise älteren Datums und untersuchten eine nur sehr kleine Population. Beide Organisationen verwendeten für ihre Leitlinienentwicklung nur wenige randomisierte kontrollierte Studien (RCT). Wenn keine Evidenzen von hoher Qualität gefunden werden konnten, stützen sich die Empfehlungen auf Expertenerfahrungen (CDC, 2010). Die RCOG (2003) und CDC (2010) sind systematisch bei ihrer Leitlinienentwicklung vorgegangen, es besteht eine nachvollziehbare Verbindung zwischen der Evidenz und der Empfehlung. Die Kriterien für die Evidenzbestimmung der Empfehlungen sind nachvollziehbar dargestellt und die Einschätzung dadurch überprüfbar. Die Empfehlungen der SGGG (2006) sind klar dargestellt und leicht identifizierbar. Auch zeigen die Autor/innen die Anwendbarkeit im schweizerischen Gesundheitswesen auf. Die Qualität der Empfehlung wurde jedoch als eher tief eingeschätzt, da die Autor/innen keine Quellen angeben und deshalb nicht ersichtlich ist, worauf sie ihre Empfehlung stützen. 30 Knoblauchtherapie Tab. 7: Einschätzung der Stärken und Schwächen der analysierten Literatur zu den aktuellen Behandlungsmethoden AutorInnen Einschätzung: Stärken Einschätzung: Schwächen Jahr Evidenzstärke Renner et Die Daten sind vollständig Es wurde ein retrospektives Design ge- Level 3: Stufe al., 2006 und nachvollziehbar darge- wählt, was systematische Fehler zulassen III nach stellt. Die Ergebnisse sind könnte. Dieses Risiko wurde von den Canadian objektiv. Autor/innen nicht eingeschätzt. Hypertension Society(AWMF & ÄZQ, 2008) Koenig & Der Nutzen und die Risiken Unsystematisches Vorgehen. Die Aus- Level 4: Stufe Keenan, der untersuchten Interventio- wahlkriterien der eingeschlossenen Litera- IV nach 2009 nen sind aufgezeigt und konk- tur sind nicht genannt. Es wird nicht klar, Canadian ret beschrieben. ob die eingeschlossene Literatur relevant Hypertension ist. Das genaue Vorgehen bei der Analyse Society ist nicht nachvollziehbar. (AWMF & ÄZQ, 2008) Ohlsson & Systematisches Vorgehen, Die verwendeten Studien haben ein hohes Level 4: Stufe Shah, 2009 Analyse nachvollziehbar. Risiko an Bias. II nach CDC, 2010 Relevante Literatur ist mit Canadian einbezogen worden. Die Hypertension Verbindung zwischen der Society Analyse und den Ergebnissen (AWMF & ist aufgezeigt. ÄZQ, 2008) Nachvollziehbares und über- Die Empfehlungen stützen sich auf Studien B (AWMF & prüfbares Vorgehen, Zusam- die vor mehr als 30 Jahren veröffentlicht menhang zwischen Evidenz wurden. Auch untersuchen diese Studien und Empfehlung ist gegeben. zum Teil nur kleine Populationen. Es wur- ÄZQ, 2008) Einschätzungen der einzelnen den nur wenig RCT verwendet. ExperEmpfehlungen sind überprüf- tenerfahrungen lassen subjektive Ein- bar dargestellt. schätzungen zu. RCOG, Systematisches Vorgehen, Nur sehr wenige RCT in Leitlinienentwick- B (AWMF & 2003 nachvollziehbare Einschät- lung mit eingeschlossen. ÄZQ, 2008) zungen der Evidenz der einzelnen Empfehlungen. SGGG, Empfehlungen sind klar dar- Unsystematisches Vorgehen. Die Ergeb- C (AWMF & 2006 gestellt. Die Autor/innen zei- nisse sind nicht überprüfbar. Die Referen- ÄZQ, 2008) gen die Anwendbarkeit im zen sind nicht vollständig angegeben. schweizerischen Gesundheitswesen. 31 Knoblauchtherapie 4.3 Ergebnisse antibakterieller Wirkung von Knoblauch Methode und Vorgehen Die analysierte Literatur besteht ausschliesslich aus quantitativen Studien. Alle Autor/innen der Studien wenden ein quasiexperimentelles Forschungsdesign an. Sieben von acht Studien finden im Setting Labor statt und testen die antibakterielle Wirkung von Knoblauchextrakten in-vitro. Die Forscher/innen verwenden biophysiologische Messinstrumente in Form von mikrobiologischen Messgrössen. Diese werden mittels zwei Testverfahren zur Empfindlichkeitsprüfung gegen antibakterielle Substanzen (Verdünnungsmethode und Agardiffusion) erhoben (Arzanlou & Bohlooli, 2010; Cutler et al., 2008; Fani et al., 2007; Fujisawa et al., 2008; Fujisawa et al., 2009; Gull et al., 2012; Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn, 2009). Die Studie von Cohain (2010) findet in einem realen Setting (in-vivo) statt. Die Daten werden anhand von Befragung der Teilnehmerinnen erhoben (Symptome der chronischen GBS Vaginitis). Biophysiologische Messinstrumente werden beim Einschlussverfahren der Studie angewendet (positiver GBS Abstrich). Getestete Bakterien Insgesamt wurde die antibakterielle Wirkung gegen sechs gram-positive (Streptococcus epidermidis, Streptococcus mutans, Streptococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptokokken A und GBS) und vier gram-negative Bakterien (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Shigella und Klebsiella pneumoniae) getestet. Alle untersuchten Bakterien waren sensibel gegenüber den verwendeten Knoblauchextrakten. Gram-positive Bakterien wiesen eine höhere Sensibilität als gram-negative Bakterien auf (Fujisawa et al., 2008; Fujisawa et al., 2009; Gull et al., 2012). Knoblauchextrakte und ihre antibakterielle Wirkung in-vitro Der Knoblauch, welcher für die Zubereitung der Präparate verwendet wurde, stammte aus Japan (Fujisawa et al., 2008; Fujisawa et al., 2009), dem Iran (Arzanlou & Bohlooli, 2010), Pakistan (Gull et al., 2012) und aus Thailand (Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn, 2009). Bei zwei Studien wird die Herkunft des verwendeten Knoblauchs nicht beschrieben (Cohain, 2010; Fani et al., 2007). In der Studie von Cutler et al. (2008) wurde eine Allicinlösung (5000 mg/L) von Allicin International zur Verfügung gestellt. 32 Knoblauchtherapie Der verwendete Knoblauch wurde gemörsert, homogenisiert, zentrifugiert, mit der jeweiligen Lösung vermischt und anschliessend sterilisiert und gelagert (Arzanlou & Bohlooli, 2010; Fani et al., 2007; Fujisawa et al., 2008; Fujisawa et al., 2009). In der Studie von Gull et al. (2012) wurde der pürierte Knoblauch nach dem Zentrifugieren noch gedämpft. Bei Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn (2009) wurde der Knoblauch zuerst 72 Stunden in einem Ofen getrocknet, anschliessend zerkleinert, mit der Lösung vermischt, zentrifugiert und gelagert. Zur Herstellung des Allicin-Gels wurde ein handelsüblicher Gel mit der wässrigen Allicinlösung vermischt (Cutler et al., 2008). Der wässrige Knoblauchextrakt wurde in sechs der acht analysierten Studien auf seine antibakterielle Wirkung untersucht und mit anderen Extrakten verglichen. Der Gehalt von Allicin und die antibakterielle Wirkung in einer wässrigen Lösung nehmen linear zur Raumtemperatur und zeitlichen Lagerung ab (Arzanlou & Bohlooli, 2010; Fujisawa et al., 2008). Die Halbwertszeit bei Raumtemperatur variiert zwischen 6 bis 11 Tagen (Fujisawa et al., 2008) und 20 Tagen (Arzanlou & Bohlooli, 2010). Die Halbwertszeit kann bei einer Lagerung bei 2˚C auf 150 Tage verlängert werden (Arzanlou & Bohlooli, 2010). Das reine Allicin wies eine antibakterielle Aktivität gegenüber dem Streptolysin O (SLO) auf, welche jedoch geringer war als die des wässrigen Knoblauchextraktes (Arzanlou & Bohlooli, 2010). Auch gegenüber dem E. coli war die Hemmzone des reinen Allicin zweimal niedriger, als jene des mit Wasser verdünnten Präparates (Fujisawa et al., 2008). Cutler et al. (2008) untersuchten die antibakterielle Wirkung eines Allicin-Gels. Die Hemmzonen des Allicin-Gels gegen GBS waren im Vergleich zu denjenigen des wässrigen Allicinextraktes etwas grösser. Gegenüber acht verschiedenen Bakterienstämmen wies der Knoblauchextrakt mit einer Ethanollösung in der Studie von Gull et al. (2012) eine schwächere antibakterielle Aktivität auf als die wässrige Lösung. In der Studie von Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn (2009) wies der Knoblauchextrakt mit Ethanol im Vergleich zur Methanollösung und dem wässrigen Extrakt die stärkste antibakterielle Wirkung auf. Fujisawa et al. (2008) zeigen, dass das Allicin in einer 20% Ethanollösung mehr Stabilität aufwies, als in einer wässrigen Lösung. Gull et al. (2012) zeigten, dass ein Knoblauchextrakt mit Methanol gegenüber den acht untersuchten Bakterienstämmen im Vergleich mit dem wässrigen Extrakt und der Ethanollösung die schwächste antibakterielle Wirkung aufweist. 33 Knoblauchtherapie In der Studie von Fujisawa et al. (2008) wurde der Knoblauchextrakt mit pflanzlichem Öl (bestehend aus Soja- und Rapsöl) vermischt und seine Aktivität gegen E. coli und S. aureus untersucht. Des Weiteren wurde der Knoblauchextrakt mit n-Hexan vermischt und ebenfalls mit E. coli und S. aureus getestet. Die Forscher/innen zeigen auf, dass das Allicin im Öl sowie im n-Hexan sehr instabil ist und beide Lösungen daher nicht geeignet sind, um eine antibakterielle Wirkung zu erzielen. Antibakterielle Wirkung von Knoblauchextrakten gegen GBS Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn (2009) untersuchten die Wirkung von Knoblauch in Wasser, Ethanol und Methanol gegen S. agalactiae. Die getesteten Bakterien stammen aus erkrankten Fischen (Oreochromis niloticus) aus Thailand. Alle verwendeten Extrakte waren fähig, das Wachstum von GBS zu hemmen. Die Ethanollösung wies die niedrigste minimale Hemmkonzentration (MHK) (125 mg/L) im Vergleich zur Methanollösung (500 mg/L) und dem wässrigen Extrakt (>500 mg/L) auf. Die Studie von Cutler et al. (2008) verwendet GBS-Isolate von vaginalen Abstrichen aus einem Londoner Krankenhaus. Die untersuchten Extrakte (Allicin-Gel und wässriger Allicinextrakt (MHK: 70 mg/L, minimale bakterizide Konzentration [MBK]: 155 mg/L)) wiesen eine bakteriostatische und bakterizide Wirkung gegen GBS auf. Die Hemmhöfe des Allicin-Gels waren etwas grösser als jene des wässrigen Extraktes. Es zeigte sich, dass bei einer Anwendungsdauer der Extrakte von 8 und 24 Stunden kein Unterschied in der Wirkung besteht (Cutler et al., 2008). Die Autor/innen diskutieren den Vorteil von topischen Wirkstoffen gegen vaginale GBS Infektionen. Zudem wird im getesteten Allicin-Gel ein Wirkstoff mit Zukunft, wozu es jedoch noch weitere Forschung braucht, gesehen. Cohain (2010) konnte in ihrer Studie zeigen, dass eine vaginale Knoblauchtherapie die Symptome einer von GBS indizierten Vaginitis therapieren kann. Die Studie schliesst neun nicht-schwangere Frauen mit einer chronisch, symptomatischen GBS Vaginitis (vaginaler Abstrich) ein. Alle teilnehmenden Frauen haben im Vorfeld eine 14-tägige erfolglose Antibiotikatherapie durchlaufen. Die Teilnehmerinnen führten sich jede Nacht eine halbierte Knoblauchzehe vaginal ein. Nach einer Therapiedauer von 4-6 Monaten waren acht von neun Frauen symptomfrei. Es wurde kein erneuter GBS Abstrich abgenommen. Die Autorin zeigt zudem mögliche Nebenwirkungen einer Knoblauchanwendung auf (unangenehmer Geruch, Hautreizung, zähflüssiger Ausfluss, seltene allergische Reaktionen). Zum Schluss der Studie wird der weitere Forschungsbedarf zur vaginalen Knoblauchtherapie diskutiert (Cohain, 2010). 34 Knoblauchtherapie Weitere Ergebnisse Die antibakterielle Wirkung wird von Fani et al. (2007) zusätzlich gegen multidrug-resistente Streptococcus mutans untersucht. Zuerst wurde getestet, gegen welche Antibiotika die S. mutans resistent sind. Anschliessend wurde an diesen resistenten Keimen der Knoblauchextrakt auf seine Wirkung untersucht. Alle S. mutans, auch diejenigen, welche gegen Antibiotika resistent waren, waren 100% sensibel gegenüber dem Knoblauchextrakt. Fujisawa et al. (2009) vergleichen die Wirkung von drei Antibiotika (Streptomycin, Vancomycin und Colistin) mit einem reinen Allicin und einem wässrigen Knoblauchextrakt. Die antibakterielle Wirkung gegen S. aureus der Antibiotika war 10- bis 60-fach erhöht im Vergleich zu den Knoblauchpräparaten. Bei dem gram-negativen E. coli zeigte sich der Unterschied noch viel deutlicher. Durch das Hinzufügen von Sulfhydryl(SH)-Komponenten auf die Agarplatte zeigte sich, dass Sulfhydryde die antibakterielle Aktivität des Allicins vollständig hemmen. Die Mengen von SH-Komponenten im menschlichen Gewebe werden als zu niedrig angesehen, damit die Wirkung des Allicins in-vivo gehemmt werden könnte (Fujisawa et al., 2009). 35 Knoblauchtherapie Tab. 8: Ergebnisse zur antibakteriellen Wirkung von Knoblauch Autor/innen Fragestellung Design Jahr Population Methode / Intervention Relevante Ergebnisse Sample Arzanlou & Bohlooli, Untersuchen des Quasiexperimentelle Vier isolierte Verdünnungsmethode zur Bestimmung der Alle Extrakte sind wirksam 2010 Effektes von purem Studie im Setting Stämme von minimalen Hemmkonzentrationen (MHK) der gegen das SLO. Allicin und eines Labor. Gruppe A Strepto- Extrakten. wässrigen Knoblauchextraktes auf die hämolytische Wirkung von Streptolysin O (SLO). kokken (GAS). Der Allicingehalt im - Pures Allicin Knoblauchextrakt nimmt biophysiologischen - „Alter“ wässriger Knoblauchextrakt (49 linear zu Zeit und Tempe- Messinstrumenten Tage, bei 2˚C gelagert) und frischer ratur ab. Halbwertszeit bei Anwendung von in Form von mikro- wässriger Knoblauchextrakt biologischen Mess- 2˚C: 150 Tage, bei 22˚C: 20 Tage . Knoblauch aus dem Iran, in Stücke ge- grössen. schnitten, gewaschen, 20g Stücke gemörsert, und homogenisiert, in 60ml destilliertes Wasser, zentrifugiert, steril verpackt Analyse Allicingehalt mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC). Cohain, 2010 Auswirkung einer Quasiexperimentelle 9 Frauen mit einer Einschlusskriterien: GBS indizierte Vaginitis 8 von 9 Frauen waren 4-6 vaginal eingeführ- Studie, in-vivo. chronisch sympto- (positiver vaginaler Abstrich), mindestens ein Monate nach Beginn der ten Knoblauchzehe matischen GBS Symptom, 14-tägige erfolglose Antibiotika- Knoblauchtherapie auf die Symptome indizierten Vaginitis. therapie durchlaufen. symptomfrei. Kein erneu- einer GBS indizier- - frische Knoblauchzehe ten Vaginitis. ter Abstrich abgenommen, um GBS Kolonisation zu frische, trockene, geschälte Knoblauch- prüfen. zehe halbieren, über Nacht vaginal einführen. Nebenwirkungen werden erwähnt (Geruch, Hautreizung, Ausfluss). 36 Knoblauchtherapie Cutler et al., 2008 Wirksamkeit eines Quasiexperimentelle 76 Streptokokken B Agardiffusionstest zur Bestimmung der Der wässrige Allicinextrakt wässrigen Studie im Setting positive Abstriche MHKs und minimale bakterizide sowie der Allicin-Gel sind Allicinextraktes und Labor. aus einem Konzentration (MBK) der Extrakte. wirksam gegen GBS. eines Allicin-Gels gegen GBS. Anwendung von biophysiologischen Krankenhaus in - wässriger Allicinextrakt Woolwich. Messinstrumenten in Form von Extraktes: 55-80 mg/L, von Allicin International zur Verfügung MBK: 155mg/L.Die gestellt, Konzentration mittels HPLC be- Hemmzonen des Allicin- stimmt . Gels waren etwas grösser - Allicin-Gel als jene des wässrigen mirkobiologischen Messgrössen. MHK des wässrigen reines Allicin wurde mit handelsüblichen Gel vermischt (500mg /L Allicin). Extraktes. Keine Unterschiede der antibakteriellen Wirkung bei einer Anwendungsdauer von 8h und 24h. Vorteil topische Wirkstoffe wird diskutiert. Fani et al., 2007 Untersuchen der Quasiexperimentelle 105 Karieszähne, Agardiffusionstest und Bouillon-Verdün- Der wässrige Knoblauch- Hemmwirkung von Studie im Setting 13 davon wurden nungsmethode zur Bestimmung der MHK. extrakt ist wirksam gegen Knoblauchextrakt Labor. ausgeschlossen, da gegen antibiotikaresistente Streptococcus mutans. Anwendung von - wässriger Knoblauchextrakt sie in den letzten 3 S. mutans. MHK wässriger Monaten mit Antibi- (Allicingehalt 260mg/ml) otika therapiert geschälter, frischer Knoblauch (80g) zer- zwischen 4 bis 32 mg/ml wurden. hackt und homogenisiert in 100ml sterilem, (16-128 mg/ml Allicin). biologischen Mess- destilliertem Wasser, zentrifugiert, filtriert und Häufigster MHK 16mg/ml. grössen. sterilisiert, aufbewahrt bei -70˚C. biophysiologischen Messinstrumenten in Form von mikro- Knoblauchextrakt Auch multidrug-resistente Bakterien waren sensibel gegenüber Knoblauch. 37 Knoblauchtherapie Fujisawa et al., 2008 Untersuchung der Quasiexperimentelle E. coli (gram- Agardiffusionstest zur Bestimmung der Alle Extrakte wiesen eine Instabilität von Studie im Setting negativ) und S. Hemmzone. antibakterielle Wirkung Allicin in verschie- Labor. aureus (gram- denen Lösungen. Anwendung von - wässriger Knoblauchextrakt positiv). gegen E. coli und S. aureus auf. - Ethanol (20%, 50%, 70%,100%) biophysiologischen Die Hemmzone beim Messinstrumenten - Pflanzenöl (Salatöl, Kombination von gram-positiven Bakterium in Form von mikro- Raps- und Sojaöl) war 3x grösser als beim biologischen Mess- - n-Hexan gram-negativen Bakte- grössen. Knoblauch aus Japan, bei 4˚C gelagert, für max. 30 Tage. rium. Ethanollösungen sind geeignete Extrakte für Alli- 10g frischer Knoblauch von Hand zerstückeln, mit 10ml Wasser gemischt, 10x geschüttelt, für 10min. bei Raumtemperatur cin. Im Ethanol war die Stabilität von Allicin 20% höher als im Wasser. stehen gelassen und anschliessend zentrifugiert und mit der jeweiligen Lösung ver- Pflanzliches Öl und n-He- mischt. xane sind nicht geeignete Extrakte. HPLC zur Bestimmung des Allicingehaltes unmittelbar nach dem Herstellen der Extrakte Der Gehalt von Allicin und Einschätzung der Stabilität von Allicin. die antibakterielle Wirkung in Wasser und Ethanol nehmen bei Raumtemperatur linear ab. Halbwertszeit: 6-11 Tage bei 23˚C. 38 Knoblauchtherapie Fujisawa et al., 2009 Wirksamkeit von Quasiexperimentelle E. coli und S. Agardiffusionstest zur Bestimmung der Lineare, antibakterielle reinem Allicin und Studie im Setting aureus. Hemmzone. Wirkung von beiden Ex- wässrigem Knob- Labor. lauchextrakt gegen gram- positive und gram-negative Bakterien. Anwendung von - reines Allicin trakten gegen E. coli und S. aureus. - wässriger Knoblauchextrakt biophysiologischen Gegen das gram-positive Messinstrumenten (Allicingehalt 217±72 mg / 100g) Bakterium war die Wir- in Form von mikro- Knoblauch aus Japan, bei 4˚C gelagert, kung des wässrigen Ex- biologischen Mess- für max. 30 Tage. traktes 2x höher als die grössen. des reinen Allicins. 10g frischer Knoblauch von Hand zerstückeln, mit 10ml Wasser gemischt, 10x ge- Durch das Beifügen eines schüttelt, für 10min. bei Raumtemperatur Sulfhydryl (SH)-Kompen- stehen gelassen und anschliessend zentrifu- ten wurde die antibakteri- giert Bestimmung Allicingehalt mittels elle Wirkung von den Ex- HPLC. trakten vollständig gehemmt. Die Mengen von Sulfhydrylen, welche im menschlichen Gewebe vorkommen, sind zu klein, um die Wirkung des Allicins zu hemmen. Die antibakterielle Wirkung gegen S. aureus der Antibiotika war gegenüber Koblauch 10- bis 60fach erhöht. 39 Knoblauchtherapie Gull et al., 2012 Antibakterielle Quasiexperimentelle 8 verschiedene Agardiffusionstest zur Bestimmung der Alle Bakterienstämme Wirkung von ver- Studie im Setting Bakterienstämme MHKs der Extrakte. waren sensibel auf die schiedenen Knob- Labor. von zwei Kranken- lauchextrakten. Anwendung von biophysiologischen Messinstrumenten in Form von mikrobiologischen Messgrössen. - wässriger Knoblauchextrakt häuser in Pakistan Extrakte. Gram-positive Bakterien (S. typhi, Shigella, - Ethanol P. aeruginosa, E. - Methanol sibilität gegenüber Knob- Knoblauch aus Pakistan nach 7 Tage lauchextrakten auf als Lagerung zu Pulver püriert, 10g Pulver in je gram-negative. 100ml der Lösung vermischt, 72h bei Der Methanolextrakt Raumtemperatur langsam zentrifugiert, zeigte die schwächste anschliessend bei 25˚C für 10min. schnell antibakterielle Wirkung, zentrifugiert, alkoholische Extrakte bei 50˚C, der wässrige Extrakt die wässriger Extrakt bei 80˚C gedämpft, bei 4˚C stärkste. coli, B. subtillus, S. aureus, S. epidermidis und K. pneumoniae). wiesen eine höhere Sen- gelagert. Rattanachaikunsopon Untersuchung der Experimentelle GBS Bakterien- & Phumkhachorn, antibakteriellen Studie im Setting stämme von 2009 Wirkung von ver- Labor. Fischen aus schiedenen Pflanzenarten. Anwendung von biophysiologischen Thailand. - wässriger Knoblauchextrakt - Ethanol 95% Alle Extrakte waren fähig, das Wachstum von GBS in-vitro zu hemmen. Agardiffusionstest und Verdünnungsmethode zur Bestimmung der Hemmzonen und MHKs der Extrakte. Messinstrumenten Der wässrige Knoblauchextrakt wies die schwächste antibakterielle in Form von mikro- - Methanol 99.8% Wirkung auf. biologischen Mess- Knoblauch aus Thailand, bei 80˚C im MHK wässriger Extrakt: > grössen. Ofen über 72h getrocknet, im Mörser zer- 500µg/mL; MHK Ethanol kleinert, in einem Verhältnis von 1:10 mit den 95%: 125µg/mL; MHK Lösungen vermischt, bei Raumtemperatur für Methanol 99.8%: 10min zentrifugiert, anschliessend filtriert und 500µg/mL. bei -20˚C gelagert. 40 Knoblauchtherapie Stärken und Schwächen der Studien zur antibakteriellen Wirkung von Knoblauch Die angewendeten mikrobiologischen Messverfahren lassen genaue Ergebnisse zu. In sechs der sieben in-vitro Studien wendeten die Forscher/innen Kontrolltests an, um das Risiko für systematische Fehler möglichst gering zu halten. So konnte jeweils ausgeschlossen werden, dass die antibakterielle Wirkung durch andere Einflüsse als durch den Knoblauchextrakt hervorgerufen wurde. Die Anwendung dieser Kontrollverfahren erhöht die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse. Jedoch wurde die Qualität dieser angewendeten Kontrollverfahren von allen Forscher/innen nicht eingeschätzt. Bei einer Studie ist die Anwendung eines Kontrolltestes nicht ersichtlich (Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn, 2009). Bei allen analysierten in-vitro Studien ist die externe Validität nicht gegeben. Es ist unklar, ob die Ergebnisse auch in einem realen Setting erreicht würden. In der Studie von Cohain (2010) ist das Risiko für Verzerrungen hoch, da die Ergebnisse nicht alle gleich erfasst wurden (E-Mail, Telefon, klinische Untersuchung) und so auch subjektive Wertungen der Autorin und der Teilnehmerinnen einfliessen können. Die Ergebnisse beruhen demnach auf subjektiven Einschätzungen. Zur Ergebnissicherung wurde keine erneute Messung (Abstrich) vorgenommen. Zudem umfasst die Studie mit neun Frauen eine nur sehr kleine Population. 41 Knoblauchtherapie Tab. 9: Einschätzung der Stärken und Schwächen der Studien zur antibakteriellen Wirkung von Knoblauch Autor/innen Einschätzung: Stärken Einschätzung: Schwächen Jahr Evidenzstärke Arzanlou & Bohlooli, Daten sind objektiv, reliabel, Population wird nicht näher 2010 intern valide und überprüfbar; beschrieben; es werden keine Anwendung von Kontrolltests. Ein- und Ausschlusskriterien Hoch beschrieben; Kontrolltest werden nicht auf ihre Qualität eingeschätzt. Cohain, 2010 Cutler et al., 2008 Die Population, sowie die Ein- Objektivität der Ergebnisse ist Level 3: und Ausschlusskriterien wer- nicht gesichert, da die Daten Stufe VI den detailliert beschrieben; unterschiedlich erhoben wur- nach Untersuchung findet im realen den (E-Mail, klinische Unter- Canadian Setting (in-vivo) statt. suchung, Gespräch); Ergeb- Hypertensi- nisse werden nicht durch er- on Society neute Messung (Abstrich) (AWMF & gesichert; kleine Population. ÄZQ, 2008) Anwendung von Kontrolltests; Mögliche Beeinflussung der Hoch interne Validität, Reliabilität Objektivität durch Autoren von und Überprüfbarkeit der Daten Allicin International; Kontroll- sind gegeben. tests werden nicht auf ihre Qualität eingeschätzt. Fani et al., 2007 Anwendung von Kontrolltests; Qualität der angewendeten Mehrfaches wiederholen der Kontrolltests wird nicht einge- Intervention, um Verzerrungen schätzt. Hoch auszuschliessen; Daten sind objektiv, reliabel, intern valide und überprüfbar; Forscher/innen prüfen auch antibiotikaresistente Keime. Fujisawa et al., 2008 Anwendung von Kontrolltests; Reinheit der untersuchten Daten sind objektiv, intern Materialien wird nicht geprüft, valide und überprüfbar. daher fragliche Reliabilität; Hoch Qualität der Kontrolltests wird nicht eingeschätzt. Fujisawa et al., 2009 Anwendung von Kontrolltests; Kontrolltests werden nicht auf Daten sind objektiv, reliabel, ihre Qualität eingeschätzt. Hoch intern valide und überprüfbar. Gull et al., 2012 Anwendung von Kontrolltests; Qualität der verwendeten Daten sind objektiv, reliabel, Kontrolltests wird nicht einge- intern valide und überprüfbar. schätzt. Rattanachaikunsopon Erweiterung der Studie nach Keine Anwendung von Kon- & Phumkhachorn, in-vitro Experimenten auf trolltests ersichtlich. 2009 einen RCT in-vivo. Hoch Hoch 42 Knoblauchtherapie 5 DISKUSSION Antibiotikatherapien, Fremdkörper, mangelnde Hygiene, Scheidenspülungen, Östrogenmangel und Stress können Ursache für ein gestörtes Scheidenmilieu (pH von 4.85.5) darstellen (Neumann et al., 2010). Durch diese Störfaktoren können Streptokokken der Gruppe B (GBS), welche physiologisch in der Darmflora vorkommen, die Vagina besiedeln (Köster, 2011). Diese vaginale Besiedlung mit GBS weist ein ständig wechselnder Status auf (Yancey et al., 1996). Das physiologische Vorkommen im Rektalbereich, der oft asymptomatische Verlauf der Infektion und der ständige Wechsel der Vaginalbesiedlung stellen die Herausforderungen eines Screenings sowie einer Therapie der GBS Kolonisationen in Bezug auf die Prävention der Early onset Disease (EOD) dar. Empfehlungen zu den Screeningmethoden Als Goldstandard unter den Screeningmethoden zur Diagnose einer GBS Kolonisation gilt bis heute die selektive Kultur (CDC, 2010; Koenig & Keenan, 2009; SGGG, 2006; Ziesing et al., 2009). Daniels et al. (2009) beschreiben die heute verfügbaren Schnelltestverfahren (PCR-Methode) als eine exakte Screeningmethode, die gut unter der Geburt angewendet werden kann. Der Nachteil dieser Methode liegt bei den Kosten, die in der Schweiz CHF 180.- pro Analyse betragen (persönliche Mitteilung, 11. Mai, 2012). Auch die CDC (2010) nehmen in ihrer Leitlinie Bezug zu den Schnelltestverfahren und empfehlen einen PCR-Test dann, wenn eine Frau mit einem unbekannten Trägerstatus zur Geburt eintritt. Aus Kostengründen soll routinemässig aber die Kultivierung angewendet werden. Die Empfehlungen zur Abnahme und Zeitpunkt der Abstriche sind kritisch zu betrachten, da Widersprüche der wissenschaftlichen Literatur erkennbar sind. Die CDC (2010) und SGGG (2006) empfehlen sowohl ein vaginaler als auch ein rektovaginaler Abstrich. Beide Methoden weisen eine hohe Übereinstimmung der Ergebnisse auf (Trappe et al, 2011). Im Gegensatz dazu zeigte eine Studie, dass der rektovaginale Abstrich die Anzahl der entdeckten GBS positiven Frauen erhöht (El Aila et al., 2010). GBS können aber physiologischer Bestandteil der Darmflora sein, weshalb ein rektovaginaler Abstrich kritisch betrachtet werden sollte. Die Autor/innen der analysierten Literatur, die ein generelles Screening empfehlen, nennen den Zeitraum zwischen der 35.-37. SSW als günstig (CDC,2010; Renner et al., 2006; SGGG, 2006), doch sagen Yancey et al. (1996), dass die GBS Kolonisation ein 43 Knoblauchtherapie wechselnder Status ist, der sich vom Zeitpunkt des Screenings bis zur Geburt noch ändern kann und empfehlen deshalb ein Screening so spät wie möglich. Nach den Resultaten einer Studie würden 13% der Frauen, welche anfänglich positiv getestet worden sind und unter der Geburt einen negativen Befund aufweisen, eine IAP erhalten (Yancey et al., 1996). Aktuelle Behandlungsstrategien bei GBS Kolonisationen in der Schwangerschaft Jede der vier aktuell empfohlenen Präventionsstrategien, wie sie in Kapitel 4.2 beschrieben sind, senkt effektiv die Inzidenz der GBS indizierten EOS (Koenig & Keenan, 2009; Ohlsson & Shah, 2009; Rausch et al., 2009). Die von der CDC empfohlene Screening-based Strategie wird als das effektivste Management gegen EOD angesehen (CDC, 2010; Koenig & Keenan, 2009; Rausch et al., 2009; Renner et al., 2006). 1996 wurden bereits erste Präventionsstrategien von der AAP und CDC entwickelt (CDC, 2010), welche seither immer wieder überarbeitet und von diversen Berufsverbänden weltweit adaptiert wurden. Die intrapartale Antibiotikaprophylaxe (IAP) blieb, sowohl international, als auch national die einzige Behandlungsempfehlung zu Streptokokken B in der Schwangerschaft (APP, 2011; CDC, 2010; RCOG, 2003; SGGG, 2006) und ist somit seit dem Entdecken der GBS als Hauptursache einer EOD ein fester Bestandteil im Gebärsaal. Obwohl in allen Leitlinien zu Streptokokken B Kolonisationen in der Schwangerschaft das Antibiotikum eine wichtige Rolle spielt, werden die Risiken der vermehrten Anwendung von IAP (von 16% auf 85% (Bizzaro, Dembry, Baltimore & Gallagher, 2008)), seit dem Einführen der Präventionsstrategien, thematisiert und als Problematik angesehen (CDC, 2010; Koenig & Keenan, 2009; Ohlsson & Shah, 2009; RCOG, 2003; Renner et al., 2006; SGGG, 2006). Neben der Penicillin indizierten Anaphylaxie sorgen auch steigende Antibiotikaresistenzen von GBS gegen Clindamycin und Erythromycin (Panda et al., 2008) und durch andere penicillinresistente Mikroorganismen hervorgerufene Septikämien bei Neugeborenen (Enkin et al., 2006) für Besorgnis. Die Resistenzen bringen nicht nur im Gebärsaal neue Risiken für Mutter und Kind, sondern sorgen allgemein in der Medizin für neue Herausforderungen. Dass die Thematik rund um die Antibiotikaresistenzen ein generell globales Problem ist, macht auch die WHO mit ihrem „Strategieplan zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen“ deutlich (WHO, 2011). 44 Knoblauchtherapie Mit der restriktiven Präventionsstrategie werden weniger Antibiotika unter der Geburt verwendet als mit der Screening-based Strategie. Dies ist dadurch zu erklären, dass weder Frauen mit einem negativen GBS Abstrich und einem zusätzlichen Risikofaktor, noch GBS positive Frauen ohne Risikofaktoren mit Antibiotika behandelt werden (Renner et al., 2006). Einige Autor/innen äussern sich bezüglich der Kosteneffizienz einzelner Strategien. Rausch et al. (2009) zeigen, dass die Kosten bei ihrer untersuchten Population bei der Screening-based Methode leicht höher als bei der Risk-based Strategie liegen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Koenig & Keenan (2009) in ihrer Review. Sie sagen aber weiter aus, dass bei einer generell hohen Anzahl an mütterlichen GBS Kolonisationen das routinemässige Screening kosteneffizienter sei. Das Nachvollziehen solcher Berechnungen fällt jedoch schwer, da keine der Autor/innen die Kosten der Behandlung einer EOD der nicht verhinderten Fälle beachtet. Die Analyse hat gezeigt, dass sich die einzelnen Strategien auf zum Teil schwache Evidenz stützen (Ohlsson & Shah, 2009). So basiert zum Beispiel die Empfehlung der RCOG (2003), kein routinemässiges Screening und IAP anzuwenden, auf einer Studie, die eine sehr niedrige Inzidenz der GBS indizierten EOS der United Kingdoms aufzeigt (0.5/1000 Lebendgeburten). Diese Studie ist aber zum Zeitpunkt der Empfehlung bereits 20 Jahre alt. Auch dienten der Empfehlung in der Leitlinie der CDC (2010) nur wenig randomisiert kontrollierte Studien. Die Anzahl der Studienteilnehmerinnen ist in allen Studien sehr gering (Ohlsson & Shah, 2009). Eine kritische Betrachtung der aktuellen Behandlungsmethoden ist demnach notwendig. Aus der Literaturanalyse und der geführten Diskussion gehen deutliche Unterschiede der einzelnen Empfehlungen zum Management bei GBS Kolonisationen hervor. Ohlsson & Shah (2009) geben in ihrer Review keine Empfehlungen ab, da die Evidenz bei allen Strategien unzureichend ist. Auch wird der Nutzen des Screenings in Frage gestellt durch einen zu frühen Screeningszeitpunkt (Yancey et al., 1996). Zudem liegen keine vergleichenden Untersuchungen zur Kosten-Nutzen Effizienz vor. Diese Kontroversen der Empfehlungen unterstreichen, dass das Problem der Prävention der GBS indizierten EOD noch nicht ausdiskutiert ist, und Alternativen zur IAP gesucht werden müssen. In der Review von Koenig & Keenan (2009) werden solche Alternativen zur IAP aufgezeigt. Neben einer Impfung gegen Streptokokken der Gruppe B, die erst noch erforscht werden muss, und einer vaginalen Therapie mit Chlorhexidin, erwähnen die Autoren 45 Knoblauchtherapie eine vaginale Knoblauchtherapie als Alternative. Eine solche Therapie findet bereits Anwendung in der Praxis (persönliche Mitteilung, 5. Januar 2012). Die Therapie beruht auf Wissen das bis in das 19. Jahrhundert reicht. Bereits damals vermutete man die antibakterielle Wirkung des A. sativum (Konvicka, 2001). Seither ist der Knoblauch immer wieder in- vitro auf seine antibakterielle Wirkung untersucht worden. Die antibakterielle Wirkung von Knoblauch konnte in sieben von acht analysierten Studien nachgewiesen werden. Alle Forscher/innen der in-vitro Studien wenden für die Untersuchung der antibakteriellen Wirkung der jeweiligen Knoblauchextrakte ein Testverfahren an, welches von Ziesing et al. (2009) zur Empfindlichkeitsprüfung gegen antibakterielle Substanzen empfohlen wird. Sowohl die zwei verwendeten Testverfahren, wie auch der Durchmesser des Hemmhofes und die minimalen Hemmkonzentrationen (MHK) korrelieren miteinander (Ziesing et al., 2009). Die Ergebnisse der Studien können somit gut miteinander verglichen werden. Instabilität von Allicin Vergleicht man die Wirkung der untersuchten Knoblauchextrakte wird klar, dass die Instabilität des Allicins nicht bei allen Lösungsmitteln gleich ausgeprägt ist. So ist beispielsweise der Knoblauchextrakt in einer alkoholischen Lösung (Ethanol/Methanol) wirksamer und stabiler als in einer Lösung mit destilliertem Wasser (Fujisawa et al., 2008; Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn, 2009). Dieses Phänomen lässt sich durch verschiedene mögliche Faktoren erklären. Allicin hat eine wasserabweisende Wirkung, dadurch ist auch die Löslichkeit des Allicins in Wasser herabgesetzt. Zudem weisen die Hydroxylgruppen der Ethanol-Moleküle eine Allicin-stabilisierende Wirkung auf (Fujisawa et al., 2008). Alkoholische Lösungen blockieren das Enzym Aliinase. Dadurch bleibt die Stabilität länger erhalten (Konvicka, 2001). Gull et al. (2012) kommen in ihrer Studie zu einem anderen Ergebnis. Dieses beschreibt, dass die alkoholischen Lösungen (Ethanol/Methanol) eine schwächere antibakterielle Wirkung aufzeigen als der wässrige Extrakt. Gründe für diese Differenz sind nicht klar erkennbar. Möglich ist, dass die genaue Konzentration der alkoholischen Lösung und der Verdünnung des wässrigen Extraktes, welche beide in der Studie nicht genau beschrieben werden, Einflüsse auf die Wirkung zeigen. Knoblauchextrakte mit pflanzlichem Öl und n-Hexan werden als sehr instabil beschrieben. Als Ursache dafür wird die niedrige Polarität dieser Lösungen diskutiert (Fujisawa et al., 2008). 46 Knoblauchtherapie Die zum Teil unterschiedliche Datenlage zeigt, dass zurzeit noch kein geeignetes Lösungsmittel für den Knoblauchextrakt empfohlen werden kann. Die Instabilität des Allicins wird auch anhand der tiefen Halbwertszeit (zwischen 6 bis max. 20 Tage bei Raumtemperatur) ersichtlich. Der Gehalt von Allicin und die antibakterielle Wirkung nehmen linear zu Raumtemperatur und zeitlichen Lagerung ab (Arzanlou & Bohlooli, 2010; Fujisawa et al., 2008). Dadurch erscheint es sinnvoll den Knoblauch möglichst frisch zu verwenden und ihn erst kurz vor der Anwendung zu schälen/schneiden, damit die Wirkung des Allicins länger erhalten bleibt. Mögliche Einflussfaktoren auf die antibakterielle Wirkung von Knoblauch Das reine Allicin wies eine deutlich geringere antibakterielle Wirkung gegenüber der des wässrigen Knoblauchextraktes auf (Arzanlou & Bohlooli, 2010; Fujisawa et al. 2009). Dadurch lässt sich vermuten, dass nicht nur das Allicin für die antibakterielle Wirkung verantwortlich ist, sondern noch weitere Inhaltsstoffe beteiligt sind, welche im reinen Allicin fehlen (Konvicka, 2001). Es könnte auch sein, dass das Allicin der einzige antibakterielle Wirkstoff ist, jedoch die weiteren Komponenten für bessere Bedingungen sorgen und so die Wirkung verstärken (Fujisawa et al., 2008). Daraus folgt, dass es empfohlen ist, den Knoblauch in seiner natürlichen Form zu verwenden, damit eine maximale antibakterielle Wirkung erzielt werden kann. Ein weiterer Einfluss auf die antibakterielle Wirkung der Knoblauchextrakte könnte die Herkunft des verwendeten Knoblauchs sein. Schulz und Hänsel (2004) erklären, dass eine grosse Variabilität beim Allicingehalt eines frischen Knoblauchs besteht. Diese Unterschiede können sich durch regionale Differenzen des Klimas und der Nährböden erklären lassen. So enthält ein Knoblauch aus China beispielsweise 0.62% Allicin wohingegen ein Knoblauch aus dem Iran nur 0.05% Allicin enthält. Der Allicingehalt eines Knoblauchs aus Westeuropa liegt bei 0.15% (Schulz & Hänsel, 2004). Bei der Verwendung von Knoblauch zur Behandlung von Bakterien sollten diese Einflüsse berücksichtigt werden und allenfalls der Allicingehalt mittels HPLC bestimmt werden. Aus der Literaturanalyse wird ersichtlich, dass das Allicin je nach Art des Bakteriums eine andere antibakterielle Wirkung zeigt. Gram-positive Bakterien reagierten sensibler auf das Allicin als gram-negative (Fujisawa et al. (2008); Fujisawa et al. (2009); Gull et al. (2012). Dieser Unterschied lässt sich durch den Aufbau der Zellwände dieser Bakterien erklären. Gram-positive Bakterien besitzen keine Proteine in ihrer Zellwand, wohingegen die Zellwand gram-negativer Bakterien aus 9% Proteinen besteht. Dadurch 47 Knoblauchtherapie ist diese Zellwand weniger sensibel gegenüber den Proteinen von Allicin, was die Wirkung vom Allicin abschwächt (Fujisawa et al., 2009). Streptokokken der Gruppe B, welche zu den gram-positiven Bakterien gehören, sind demnach gut ansprechbar auf die antibakterielle Wirkung von Allicin. Dies wird auch durch zwei Studien belegt (Cutler et al., 2008; Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn, 2009). Die bisher verglichenen Studien wurden alle in-vitro durchgeführt. Diese Ergebnisse lassen sich nicht direkt auf das reale Setting übertragen. In-vivo Studien zum Nachweis der antibakteriellen Wirkung von Allicin sind bisher nicht bekannt. In-vivo Anwendung der Knoblauchextrakte bei vaginalen GBS Kolonisationen Die Studie von Cohain (2010) untersucht zwar eine vaginale Knoblauchtherapie bei einer GBS indizierten Vaginitis, jedoch wird durch diese Studie die antibakterielle Wirkung des Knoblauchs nicht nachgewiesen, da kein erneuter Abstrich vorgenommen wurde. Cohain (2010) zeigt mit ihrer Studie eine weitere Möglichkeit der Knoblauchverwendung auf. Die vaginale Anwendung einer rohen, geschälten Knoblauchzehe über Nacht konnte die Symptomatik der Vaginitis bei acht von neun Teilnehmerinnen bekämpfen (Cohain, 2010). In-vitro sind keine Daten bekannt, welche die Wirkung einer rohen, unverarbeiteten Knoblauchzehe untersuchen. Dennoch kann vermutet werden, dass auch diese Art der Verwendung eine antibakterielle Wirkung aufweist, da das Allicin durch das Schälen/Zerschneiden freigesetzt wird (Konvicka, 2001; Schulz & Hänsel, 2004). 100g Knoblauch enthalten etwa 220mg Allicin (Fujisawa et al., 2009). Eine handelsübliche Knoblauchzehe wiegt etwa 2g. Berechnet man nun den Allicingehalt auf diese 2g Knoblauch, erhält man einen Gehalt von 4.4mg Allicin in einer Knoblauchzehe. Dies entspricht auch den ungefähren Prozentangaben des Allicingehaltes im Knoblauch von Schulz & Hänsel (2004). Der untersuchte Allicin-Gel, welcher eine nachgewiesene bakterizide Wirkung hat, enthält umgerechnet bei einer Applikationsmenge von 5ml 2.5mg Allicin (Cutler et al., 2008). Es kann also vermutet werden, dass eine Knoblauchzehe die gleiche oder leicht stärkere Wirkung gegen Streptokokken B hat. Cutler et al. (2008) betonen in ihrer Studie den Vorteil einer Lokaltherapie zur Bekämpfung einer vaginalen GBS Infektion. Durch eine lokale Anwendung kann der Wirkstoff dort wirken, wo er benötigt wird. Zudem gelangt nur eine niedrige Dosis in den systematischen Körperkreislauf (tiefe Resorption). Die SH-Komponenten im 48 Knoblauchtherapie menschlichen Gewebe sind zu gering, um die Allicinwirkung vor Ort hemmen zu können (Fujisawa et al., 2009). Von den diskutierten Knoblauchextrakten kommen nur wenige für eine vaginale Anwendung in Frage. Alkoholische Extrakte lassen sich aufgrund der grossen Reizung der Vaginalschleimhaut ausschliessen. Wässrige Extrakte müssten mit Hilfe eines Tampons angewendet werden, was jedoch den Nachteil einer veränderten Vaginalflora (durch Feuchtigkeitsverlust und Fremdkörper) mit sich bringt, und dadurch eine vaginale Infektion hervorgerufen werden könnte. Öl- und n-Hexanextrakte lassen sich aufgrund der diskutierten Instabilität ausschliessen. Der Allicin-Gel könnte vaginal gut und einfach angewendet werden. Zusätzlich kann beim Gel die verabreichte Dosis kontrolliert werden (Cutler et al., 2008). Auch die halbierte Knoblauchzehe kommt für eine Lokaltherapie in Frage. Häufige Nebenwirkungen einer vaginalen Knoblauchtherapie können ein zähflüssiger Ausfluss, ein unangenehmer Geruch (vaginal und oral) sowie Hautreizungen der Vaginalschleimhaut sein. Selten treten allergische Reaktionen auf (Cohain, 2010; Cutler et al., 2008). Die Nebenwirkungen der vaginalen Anwendung sind mit tiefen Risiken verbunden. Daher ist eine Therapie in der Schwangerschaft vertretbar. Cohain (2010) empfiehlt eine Anwendung der Knoblauchzehe während der ganzen Nacht. Auch Cutler et al. (2008) kommen zum Ergebnis, dass nach einer AllicinAnwendung von acht Stunden keine Wirkung mehr ersichtlich ist. Wird die Knoblauchtherapie also für acht Stunden angewendet, wird eine maximale Wirkung erreicht. Sowohl Cohain (2010) als auch Cutler et al. (2008) sehen in der vaginalen Knoblauchtherapie eine zukünftige Alternative zur Antibiotikagabe, um Streptokokken B zu bekämpfen. Vergleicht man die MHK von Antibiotika und Allicin, ist eine 10- bis 60-fach höhere Konzentration des Allicins nötig, um das Wachstum von Bakterien zu hemmen (Fujisawa et al., 2009). Dieses höhere Level des Allicins kann akzeptiert werden, da bei einer vaginalen Anwendung nur eine geringe Menge systemisch absorbiert wird (Cutler et al., 2008). Der Vorteil einer Knoblauchtherapie liegt bei einer möglichen lokalen Anwendung und der nachgewiesenen Wirkung gegen multidrug-resistente Keime (Cutler et al., 2008; Fani et al., 2007). Zudem können Bakterien gegen Knoblauch keine Resistenzen entwickeln (Koch & Hahn, 1988). Trotz diesen Vorteilen von Knoblauch gegenüber dem Antibiotika konnte sich der Knoblauch mangels in-vivo Evidenzen noch nicht in der Geburtshilfe durchsetzen. 49 Knoblauchtherapie Aufgrund der Ergebnisse dieser Review kann die Fragestellung wie folgt beantwortet werden: Es bestehen vier verschiedene Präventionsstrategien zu Streptokokken B in der Schwangerschaft. Jede dieser Methoden senkt effektiv die Inzidenz der EOD. Die Leitlinien zu den aktuellen Präventionsmanagemnets basieren auf Studien von mittlerer bis schwacher Qualität (CDC, 2010; RCOG, 2003). Die einzelnen Empfehlungen zum Screening (Zeitpunkt und Vorgehen) und der Indikation einer IAP sind kontrovers. Die antibakterielle Wirksamkeit des Knoblauchs gegen Streptokokken der Gruppe B ist in-vitro durch mehrere wissenschaftliche Arbeiten belegt worden. Eine Studie, die diese Wirkung in-vivo an schwangeren Frauen aufzeigt, um einen ausreichenden Schutz vor schwerwiegenden Infektionen beim Neugeborenen zu gewährleisten, existiert noch nicht. Der Forschungsbedarf in diese Richtung wird aber von mehreren Autor/innen deutlich gemacht (Cutler et al., 2008; Cohain, 2010). Die Ergebnisse heben die Relevanz einer Studie zur Knoblauchtherapie bei Streptokokken B positiven Frauen in der Schwangerschaft hervor. Es werden deshalb Empfehlungen für eine Studie in Form eines Forschungsplanes, der sich auf die gesammelten Evidenzen dieser Arbeit stützt, abgegeben. 5.1 Proposal für eine Studie zur vaginalen Knoblauchtherapie In den folgenden Abschnitten werden im Rahmen des Forschungsplanes die Empfehlungen betreffend Methodik und Intervention der durchzuführenden Studie ausgearbeitet und abgegeben. Forschungsdesign Aus der Literaturanalyse konnte keine Empfehlung bezüglich des Forschungsdesigns für das Proposal abgeleitet werden, da alle Studien, welche die antibakterielle Wirkung von Knoblauch untersuchten, zwar einen quantitativen Ansatz wählten, doch nur eine von acht ein reales Setting verwendete. Auch fand bei keiner dieser acht Studien eine Randomisierung statt. Für die Empfehlungen zum Forschungsdesign wurde deshalb auf bestehende Literatur zurückgegriffen. Aus der Literatur ging hervor, dass für das Untersuchen der Ursache-Wirkung Beziehung ein quantitativer Ansatz mit einem experimentellen Forschungsdesign gewählt werden sollte (Polit et al., 2004). In einer Studie zur Knoblauchtherapie möchte man 50 Knoblauchtherapie die Kausalbeziehung zwischen der Intervention (Knoblauchtherapie) und der Wirkung (GBS Kolonisation) überprüfen. Cluett & Bluff (2003) nennen hierfür die randomisiert kontrollierte Studie (RCT) als aussagekräftigstes experimentelles Forschungsdesign. Auch werden durch eine Randomisierung verzerrende Effekte verhindert. Um ein hohes Evidenzniveau zu erzielen, sollte für diese Studie also eine RCT in einem realen Setting gewählt werden. Eine Verblindung wird nicht empfohlen, da sich die Kontrollgruppe vaginal ein Placebo einführen müsste, was eine Veränderung der Vaginalflora zur Ursache und so wiederum einen Einfluss auf die Infektion haben könnte (Köster, 2011). Aus ethischer Sicht betrachtet, liegt das Problem einer randomisierten Zuteilung bei der nicht mehr individuellen Behandlung der einzelnen Klientinnen, da diese studienbedingt dem Zufall überlassen wird (SAMW, 2009). Da eine Streptokokken B Besiedlung während der Schwangerschaft kein signifikant erhöhtes Risiko für Mutter und Kind darstellt, ist eine Randomisierung aus ethischer Sicht zulässig. Laut SAMW (2009) müssen bei Forschungen mit Schwangeren die Risiken immer für Mutter und Kind beachtet werden. Auf die Studie zur Knoblauchtherapie bezogen bedeutet das konkret, dass die Frauen vor Studienbeginn auf allfällige Nebenwirkungen der Therapie aufmerksam gemacht werden müssen. Dies geschieht mittels Informationsblatt. Solche ethischen Fragen sind Gründe, weshalb der Forschungsplan durch die kantonale Ethikkommission genehmigt werden sollte. Die Studie soll sich ausserdem an den biomedizinethischen Prinzipien nach Beauchamp & Childress (2008) orientieren. Population Die durchzuführende Studie, die zur Beantwortung der Forschungsfrage dienen soll, sollte 400 Probandinnen umfassen. Eingeschlossen werden Schwangere mit einem aktuellen, positiven Streptokokken B (GBS) Abstrich, welche von Gynäkologen/innen und/oder Hebammen der Schweiz betreut werden. Frauen mit einer GBS-Bakteriurie in der aktuellen Schwangerschaft und Mütter, eines an Early onset Disease (EOD) erkrankten Kindes werden ausgeschlossen, da die Evidenz zeigt, dass Neugeborene jener Frauen ein erhöhtes Risiko für eine EOD aufweisen (CDC, 2010; RCOG, 2003; SGGG, 2006). Wünschenswert wäre eine Erweiterung der Studienpopulation auf insgesamt 800 Teilnehmerinnen, weil dadurch die Studie repräsentativer würde (Polit et al., 2004). Dafür wäre es nötig, die Studie in mehreren Institutionen in der Schweiz durchzuführen und auf eine multi-center Studie zu erweitern. Eine weitere Möglichkeit, 51 Knoblauchtherapie um eine Populationsgrösse von 800 Teilnehmerinnen zu erreichen, wäre, die Studie über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Datenerhebung Um das für die Rekrutierung der Teilnehmerinnen notwendige GBS Resultat zu erheben, wird ein vaginaler Abstrich (biophysiologisches Messinstrument) bis spätestens zur 36 0/7 SSW empfohlen. Der Zeitpunkt wird so gewählt, da die nationale Empfehlung der SGGG (2006) ein Screening zwischen der 35.-37. SSW vorsieht und dies auch in den meisten schweizerischen Praxen/Spitälern so umgesetzt wird. Der Abstrich sollte vaginal von einer Hebamme oder von Gynäkologen/innen abgenommen werden. Aufgrund des physiologischen Vorkommens der GBS in der Darmflora (Neumann et al., 2010; Petersen, 2003) wird ausschliesslich der vaginale Abstrich empfohlen, um eine vaginale Besiedlung aufzudecken. Anleitungen des zuständigen Labors sind genauestens zu befolgen, damit präanalytische Fehlerquellen vermieden werden. Das empfohlene Diagnostikverfahren ist die Kultivierung mit einem flüssigen Kulturmedium (Todd-Hewitt Bouillon) (Rallu et al., 2005). Nach dem Abstrichresultat werden die Frauen nach Einverständnis an die Studienverantwortlichen zur Rekrutierung weitergeleitet. Nach Zustimmung der Frau an der Studie teilzunehmen, wird ein Assessment zum gesundheitlichen Zustand der Frau mittels Fragebogen erhoben. Dieses dient der Erhebung von Einflussfaktoren bezüglich einer vaginalen Infektion (Hygiene, Ernährungsund Bewegungsverhalten, Stress). Durch dieses Wissen können anschliessend die Ergebnisse diskutiert werden. Es wird ersichtlich, welche Faktoren die vaginale GBS Kolonisation zusätzlich beeinflussen. Die teilnehmenden Frauen werden dann der Kontroll- oder Interventionsgruppe zugeteilt. Acht Tage nach Beginn der Knoblauchtherapie (Interventionsgruppe) bzw. in der 38. SSW (Kontrollgruppe), bei Geburtsbeginn sowie nach Ende des Frühwochenbettes (8 Wochen p.p.) wird ein erneuter Abstrich bei allen Teilnehmerinnen durchgeführt. Der Abstrich acht Tage nach Beginn der Knoblauchtherapie dient dem Vergleich mit den anderen Resultaten aus der Interventionsgruppe bei gleicher Therapiedauer. Zudem können so die Indikationen für eine IAP unter der Geburt für die Interventionsgruppe bestimmt werden. Um eine EOD vorzubeugen ist der Abstrich unter der Geburt ausschlaggebend. Deshalb ist der GBS Status bei Geburtsbeginn notwendig. Der letzte Kontrollabstrich nach Versiegen des Wochenflusses soll die Langzweitwirkung der Therapie untersuchen. Um Verzerrungen zu vermeiden, sollten die Prinzipien des Vor52 Knoblauchtherapie gehens denen des ersten Abstrichs entsprechen (vaginal, Anleitungen des Labors befolgen, Kultivierung) und der Abstrich sollte von der gleichen Person wie der Erste abgenommen werden. Wünscht eine Frau unter der Geburt ein aktuelles Abstrichresultat, um möglicherweise eine Antibiotikaprophylaxe zu vermeiden, kann die PCR Methode (GenXper-GBS-Test) als Diagnoseverfahren angewendet werden, da das Resultat nach 2 bis 3 Stunden verfügbar ist und ebenfalls exakt ist (El Helali et al., 2009; Daniels et al., 2009; Gavino & Wang, 2007; Honest et al., 2006). Zur Evaluation der Knoblauchtherapie wird bei der Nachkontrolle (8 Wochen p.p.) den Teilnehmerinnen der Interventionsgruppe ein Fragebogen ausgehändigt. Dieser soll die Erfahrungen der Frauen mit der Knoblauchtherapie (allfällige Nebenwirkungen, Aufwand) erfragen. Zudem wird die Anzahl aufgetretener GBS Infektionen bei Neugeborenen von Studienteilnehmerinnen erhoben. Datenanalyse Die erhobenen Daten sollten anhand von statistischen Tests analysiert werden. Dabei soll aufgezeigt werden, ob ein signifikanter Unterschied zwischen der Kontroll- und Interventionsgruppe betreffend der Streptokokken B Kolonisation und der Anzahl aufgetretener GBS Neugeboreneninfektionen besteht oder nicht. Dafür wird eine Nullhypothese (ungerichtet) formuliert, welche bei einem statistisch signifikanten Unterschied verworfen werden kann. Das Signifikanzniveau sollte im Vorfeld der Studie definiert werden und muss passend zum Forschungsdesign gewählt werden. Intervention Die Empfehlung zum genauen Vorgehen bei der Intervention orientiert sich an den Ergebnissen der Literaturanalyse und den Empfehlungen von Polit et al. (2004). Eine Intervention wird als Manipulation der unabhängigen Variabel bezeichnet, um deren Auswirkung auf die abhängige Variabel einzuschätzen (Polit et al. 2004). In der Studie zur Knoblauchtherapie stellt der Knoblauch die unabhängige und die GBS Kolonisation die abhängige Variabel dar. Die Intervention einer Studie zur Knoblauchtherapie soll daraus bestehen, dass täglich eine rohe, frische Knoblauchzehe geschält, leicht angeschnitten über Nacht vaginal eingeführt wird. Die Therapie soll acht Nächte dauern bevor der erste Kontrollabstrich durchgeführt wird. Die Vorgehensweise ist die gleiche, wie in der Studie von Cohain 53 Knoblauchtherapie (2010). Der Vorteil dieser Intervention liegt in der leichten Anwendbarkeit, der Zugänglichkeit jeder Frau und der Kosteneffizienz. Ausserdem kann davon ausgegangen werden, dass die antibakterielle Wirkung auch bei dieser Applikationsform vorhanden ist, da das Allicin bei einer mechanischen Verletzung der Zehe freigesetzt wird (Konvicka, 2001; Schulz & Hänsel, 2004). Nachteile einer solchen Anwendung können allfällige Nebenwirkungen wie eine Hautreizung, zähflüssiger Ausfluss, ein unangenehmer Geruch und in seltenen Fällen eine allergische Reaktion (Cutler et al., 2008; Cohain, 2010), sowie die ungenaue Dosierung des Allicins sein. Der Allicingehalt ist nicht nur vom Alter der Zehe abhängig, sondern auch von deren Herkunft. Es sollten bei der Studie lediglich frische Knoblauchzehen verwendet werden, da die Konzentration des Allicins höher ist (Schulz & Hänsel, 2004; Cohain, 2004). Zur Qualitätssicherung sollten Stichprobenweise Knoblauchzehen im Labor auf ihren Allicingehalt getestet werden, bevor sie für die Studie verwendet werden. Cutler et al. (2008) haben in ihrer Studie eine Wirkungsdauer des Allicins von 8 Stunden aufgezeigt. Eine Anwendung über Nacht ist daher optimal. Die Behandlung soll ununterbrochen vom Erheben des Trägerstatus bis zur Geburt angewendet werden. Selbst wenn der erste Kontrollabstrich negativ sein sollte, muss die Therapie bis zur Geburt fortgesetzt werden, da eine GBS Kolonisation ein ständig wechselnder Status ist und Streptokokken rezidivierend sein können (Itakura et al., 1996). Auch Enkin et al. (2006) beschreiben, dass eine Behandlung gegen GBS in der Schwangerschaft, die nicht bis zur Geburt weitergeführt wird, sich nur vorübergehend auf die GBS Besiedlung auswirkt und zu keiner Reduktion der Septikämien beim Neugeborenen führt. Ist der Status beim ersten Kontrollscreening weiterhin positiv, wird unter der Geburt ein Schnelltest mittels PCR-Methode durchgeführt, um den aktuellen Status zu überprüfen. Sollte der Test dann immer noch positiv sein, oder hat die Frau die Therapie vorzeitig abgebrochen, wird sie nach den Richtlinien der Institution behandelt. Von der Geburt bis zum dritten Kontrollscreening acht Wochen p.p. gibt es keine Intervention mehr. Weiterführende Interventionen Stress, mangelnde Hygiene oder übertriebene Hygiene (Scheidenspülungen), mangelnde Bewegung (schlechte Durchblutung), Antibiotikatherapien, Fremdkörper (Tampon) und Östrogenmangel tragen zu einer gestörten Vaginalflora bei und machen die Vagina auf Infektionen anfällig (Neumann et al., 2010). Die Tatsache, dass viele dieser Faktoren durch eine Verhaltensänderung beeinflusst werden können, zeigt die Notwe54 Knoblauchtherapie nigkeit einer Aufklärung. In einer weiterführenden Studie sollten die Frauen über die Einflussfaktoren aufgeklärt werden und Möglichkeiten aufgezeigt bekommen ihr Verhalten zu ändern. So kann z.B. ein saures Scheidenmilieu (pH Wert von 4.8-5.5) durch eine pH-Wert Messung frühzeitig erkannt und durch eine sanfte Sanierung der Vaginalflora (z.B. mittels einer Milchsäurekur, Ovulum) therapiert werden. Zeitplanung Der Zeitaufwand der gesamten Studie wird auf drei Jahre geschätzt. In der Vorbereitungsphase sollen geeignete Institutionen (Geburtshäuser, Spitäler) zur Durchführung der Studie gesucht werden. Zudem sollen Sponsorenanfragen und Anträge an die Ethikkommission erfolgen. Für die Vorbereitungsphase werden in der Zeitplanung sechs Monate einberechnet. In der Durchführungsphase werden 400 Probandinnen rekrutiert und die Datenerhebung und Intervention durchgeführt. Dafür stehen insgesamt 21 Monate zur Verfügung. Im folgenden Halbjahr werden die erhobenen Daten analysiert. Anschliessend steht ein weiteres halbes Jahr für die Auswertung der Studie und das Ausarbeiten (und gegebenenfalls Veröffentlichen) eines Forschungsberichtes zur Verfügung. Budget Aus Kosteneffizienz sollte in der Studie die Kultivierung bei der Screeninganalyse gewählt werden. Trotzdem müssen im Budget eine kleine Anzahl Schnelltests (GenXpert) mit einberechnet werden. Dieses Schnelltestverfahren wird Frauen angeboten, die beim zweiten Abstrich positiv waren und die Therapie bis zur Geburt weiterführen möchten. Die Intervention ist mit einem kleinen Budget verbunden. Der Knoblauch, der aus einem kontrolliert biologischen Anbau stammen muss und Stichprobenweise von einem Labor überprüft werden sollte, wird bei der Rekrutierung der Frau abgegeben. Es wird mit CHF 3.- pro Knoblauchknolle gerechnet. Die Mehrkosten für die Bestimmung des Allicingehalts werden im Projektmanagement mit einberechnet. Für das Fundraising werden diverse nationale und internationale Forschungsgemeinschaften angeschrieben. Eine Teilnahme an Forschungswettbewerben wäre eine weitere Möglichkeit, um an finanzielle Unterstützung zu gelangen. Interesse an einem Sponsoring könnte bei den Herstellern der Abstriche oder bei Firmen mit Komplementärmedizin bestehen. 55 Knoblauchtherapie Zusammengefasst werden folgende Empfehlungen für eine Studie zur Überprüfung der Wirksamkeit einer Knoblauchtherapie abgegeben: Randomisiert kontrollierte Studie 400 Studienteilnehmerinnen mit einem positiven GBS Status (200 Interventions- und 200 Kontrollgruppe) Datenerhebung durch zwei Fragebogen (Assessment: Kontroll- und Interventionsgruppe und Evaluation: Interventionsgruppe) und vier vaginale Abstriche: 1. Routineabstrich bis spätestens bis zur 36 0/7 SSW 2. Erster Kontrollabstrich acht Tage nach Beginn der Knoblauchtherapie 3. Zweiter Kontrollabstrich bei Geburtsbeginn 4. Dritter Kontrollabstrich bei der gynäkologischen Nachkontrolle (8 Wochen p.p.) Vorgehen Interventionsgruppe: ununterbrochene Knoblauchtherapie ab individuell besprochenen Zeitpunkt bis zur Geburt. Eine frische Knoblauchzehe vaginal über Nacht einführen (8h). Sind die Kontrollabstriche und / oder der allenfalls gewünschte Schnelltest bei Geburtsbeginn weiterhin positiv, wird die Frau nach den Richtlinien der jeweiligen Institution behandelt. Vorgehen Kontrollgruppe: Keine Intervention, drei Kontrollabstriche in der 38 0/7 SSW, bei Wehenbeginn und 8 Wochen p.p. Evaluation: Im Rahmen der gynäkologischen Nachkontrolle p.p. erhalten die Frauen der Interventionsgruppe einen Fragebogen, um Erfahrungen mit der Therapie zu erfragen. Ethische Aspekte: die Studie orientiert sich an den biomedizinethischen Prinzipien nach Beauchamp & Childress (2008), Risiken für Frau und Kind müssen eingeschätzt sein und geringer sein als der Nutzen, die Studie ist freiwillig und jederzeit abbrechbar, die Eiverständniserklärung und das Teilnehmerinneninformationsblatt ist nach den Vorgaben der KEK Bern erstellt. 56 Knoblauchtherapie Chancen und Stolpersteine Die Chancen einer Studie, welche nach den genannten Empfehlungen durchgeführt wird, werden in der möglichen Senkung des Antibiotikagebrauchs in der Geburtshilfe gesehen. Sollte die Studie nachweisen, dass eine präpartale Knoblauchtherapie eine vaginale Streptokokken B Infektion in der Schwangerschaft therapiert, kann ein grosser Nutzen erzielt werden. Die Risiken und Nebenwirkungen für Frau und Kind sind geringer als jene einer intrapartalen Antibiotikatherapie. Die Antibiotikaresistenz ist ein viel diskutiertes Thema und Alternativen für den Antibiotikaverbrauch sind erforderlich. Die Knoblauchtherapie ist zudem einfach anwendbar und für jede Frau zugänglich. Der Knoblauch ist im Vergleich zur Antibiotikatherapie kosteneffizienter. Betroffene Frauen erhalten durch die Knoblauchtherapie die Möglichkeit, selber etwas gegen die Infektion zu unternehmen. Zudem kann der notwendige Zeitaufwand für die Teilnehmerinnen möglichst gering gehalten werden, da die meisten Datenerhebungen in Routinekontrollen durchgeführt werden können. Ein Abstrich findet ausserhalb von routinemässig durchgeführten Konsultationen statt. Zur Knoblauchtherapie bei nicht-schwangeren Frauen liegen nur wenige Resultate bezüglich der Verträglichkeit vor, was ein Grund für eine Nichtannahme der Ethikkommission darstellen könnte. Ein grosser Stolperstein, welcher die Durchführung der Studie verhindern könnte, ist, dass die Schlüsselpersonen (Probandinnen, Gynäkologen/innen, Hebammen) nicht für die Studie gewonnen werden können. Die Studie setzt eine enge Zusammenarbeit mit Gynäkologen/innen voraus. Die Mehrheit der Frauen in der Schweiz wird von Gynäkologen/innen in der Schwangerschaft betreut, daher sind sie die wichtigsten Schlüsselpersonen, um Probandinnen für die Studie zu erhalten. Es ist also Voraussetzung, dass Gynäkologen/innen in Praxen aber auch in Spitäler Interesse gegenüber dieser Studie zeigen. Zudem muss ein Sponsor gefunden werden, welcher die zusätzlichen Kosten der Studie (drei vaginale Abstriche) übernehmen würde. Grund für eine Widerrufung der Teilnahme der Frauen könnte das Auftreten diverser Nebenwirkungen von Knoblauch sein. Die Notwendigkeit der täglichen Durchführung der Therapie, könnte eine weitere Schwierigkeit darstellen, da Frauen, welche die Therapie für eine Nacht unterbrechen, aus der Studie ausgeschlossen werden müssen. Die Studie setzt ein grosses Interesse und die Zuverlässigkeit der Frau voraus. Ziel dieser Studie ist es, die Wirkung der Knoblauchtherapie gegen Streptokokken B nachzuweisen und die EOD Inzidenz dadurch zu senken. Wird dieses Ziel erreicht, kann die Inzidenz der EOD und der Antibiotikagebrauch in der Geburtshilfe nachhaltig 57 Knoblauchtherapie gesenkt werden. Eine weitere nachhaltige Wirkung kann durch die weiterführenden Interventionen erzielt werden. Durch Aufklärung über die Einflussfaktoren einer vaginalen Infektion kann das Bewusstsein für ein gesundheitsförderndes Verhalten nachhaltig gestärkt werden. 6 SCHLUSSFOLGERUNG Die Thematik rund um die Behandlung bei Streptokokken B Kolonisationen in der Schwangerschaft ist nicht nur für Hebammen ein relevanter Gesprächspunkt, sondern auch fachübergreifend von grosser Bedeutung. Sowohl Hebammen, Gynäkolog/innen, als auch Neonatolog/innen und Pädiater/innen haben Interesse daran, eine evidenzbasierte und effektive Behandlungsstrategie zu GBS in der Schwangerschaft anzuwenden. So kann die Inzidenz der EOD gesenkt und die Gesundheit von Frau und Kind gefördert werden. Diese systematische Übersichtsarbeit hat gezeigt, dass die aktuell empfohlenen Behandlungsmethoden auf schwacher Evidenz basieren und zum Teil grosse Unterschiede in der Vorgehensweise aufweisen. Die mehrheitlich empfohlene IAP reduziert effektiv die Inzidenz der EOD, jedoch folgt daraus die aktuelle Problematik der Antibiotikaresistenzen. Die Kontroverse der verschiedenen Empfehlungen und die in Zusammenhang mit der IAP auftretenden Risiken unterstreichen, dass das Problem der Prävention von EOD mit den aktuellen Managements noch nicht gelöst ist. Aufgrund dessen sind Alternativen gefragt. Eine mögliche Alternative stellt die vaginale Knoblauchtherapie bei schwangeren Frauen dar. Da die antibakterielle Wirkung von Knoblauch mehrmals durch in-vitro Studien belegt ist, aber noch keine in-vivo Untersuchungen an schwangeren Frauen mit einer GBS Kolonisation bekannt sind, geht aus dieser systematischen Review die Empfehlung hervor, die kurz- und längerfristige Wirkung einer präpartalen Knoblauchtherapie an schwangeren Frauen mit einer GBS Kolonisation in einer Studie zu untersuchen. 58 Knoblauchtherapie 7 LITERATURVERZEICHNIS American Academy of Pediatrics [AAP] (2011). Recommendations for the Prevention of Perinatal Group B Streptococcal (GBS) Disease [Electronic Version]. Pediatrics, 2011; 128: 611-615. Ankri, S. & Mirelman, D. (1999). Antimicrobial properties of allicin from garlic [Electronic Version]. Microbes and Infection, 1999; 125-129. Paris: Elsevier. Ankri, S., Miron, T., Rabinkov, A., Wilchek, M. & Mirelman, D. (1997). Allicin from garlic strongly inhibits cysteine proteinases and cytopathic effects of Entamoeba hystolytica [Electronic Version]. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1997; 41 (10): 2286-2288. Arbeitsgemeinschaft der Wissenaschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften [AWMF] (2008). Deutsches Instrument zur methodischen Leitlinienbewertung (Delbi). Fassung 2005/2006 & Domäne 8 (2008). Abgefragt am 06.04.2012 unter: http://www.leitlinien.de/leitlinienqualitaet/delbi/view. Arzanlou, M. & Bohlooli, S. (2010). Inhibition of streptolysin O by allicin – an active component of garlic [Electronic Version]. Journal of Medical Microbiology, 2010; 59: 1044-1049. Arzneimittelkompendium der Schweiz (2012). Basel: Documed AG. Beauchamp, T. L. & Childress, J. F. (2008). Principles of Biomedical Ethics. 6. Aufl., Oxford: University Press. Behrens , J. & Langer, G. (2006). Evidence-based Nursing and Caring. Bern: Huber. Berner Fachhochschule Gesundheit (2008). Kompetenzprofil Diplomierte Hebamme BSc. Abgerufen am 16.04.2012 unter: http://www.gesundheit.bfh.ch/fileadmin/wgs_upload/gesundheit/2_bachelor/heb amme/Austrittsprofil_Berufskonf_HEB_2007_web1.pdf Bizzaro, M. J., Dembry, L. M., Baltimore, R. S. & Gallagher, P. G. (2008). Changing patterns in neonatal Escherichia coli sepsis and ampicillin resistance in the era of intrapartum antibiotic Prophylaxis [Electronic Version]. Pediatrics, 2008; 121: 689-696. Bund Deutscher Hebammen [BDH] (2005). Schwangerenvorsorge durch Hebammen. Stuttgart: Hippokrates. 59 Knoblauchtherapie Bundesamt für Statistik (2012). Geburten und Geborene. Abgerufen am 10.07.2012 unter: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/06/blank/key/02/01.html Centers for Disease Control [CDC] (2010). Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Disease. Revised Guidelines from CDC [Electronic Version]. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2010; November 19; Vol. 59. Cluett, E. R. & Bluff, R. (Hrsg.) (2003). Hebammenforschung. Grundlagen und Anwendung. Bern: Huber. Cohain, J. S. (2004). GBS, pregnancy and garlic: be a part of the solution. Midwifery Today International Midwife, 2004 Winter; 72: 24-25 Cohain, J. S. (2009). Long-term symptomatic group B streptococcal vulvovaginitis: eight cases resolved with freshly cut garlic [Electronic Version]. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2009 Sep; Vol. 146: 110-111. Cohain, J. S. (2010). Case series: Symptomatic Group B Streptococcus Vaginitis treated with fresh garlic [Electronic Version]. Integrative Medicine, 2010; Vol. 9, No. 3: 40-43. Cutler, R. R., Odent, M., Hajj-Ahmad, H., Maharjan, S., Bennett, N. J., Josling, P. D., et al. (2008). In vitro activity of an aqueous allicin extract and a novel allicin topical gel formulation against Lancefield group B streptococci [Electronic Version]. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2009; 63: 151-154. Cummings, S. R., Holly, E. A. & Hulley, S. B. (2001). Writing and Funding a Research Proposal. In Hulley, S. B… [et al.], Designing clinical research: an epidemiologic approach. 3rd ed.; 285-299. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins. Daka, D. (2009). Antibacterial effect of garlic (Allium sativum) on Staphylococcus aureus: An in vitro study [Electronic Version]. African Journal of Biotechnology, 2011; 10 (4); 666-669. Daniels, J., Gray, J., Pattison, H., Roberts, T., Edwards, E., Milner, P., et al. (2009) Rapid testing for group B streptococcus during labour: a test accuracy study with evaluation of acceptability and cost-effectiveness. [Electronic Version]. Health Technology Assessment, 2009; 13 (42). Divan, A. (2009). Writing a research proposal. In Divan, A., Communication Skills for the Biosciences. A graduate guide. 1st ed.; 112-143. Oxford: University Press. 60 Knoblauchtherapie El Aila, N. A., Tency, I., Claeys, G., Saerens, B., Cools, P., Verstraelen, H., Temmerman, M., Verhelst, R. & Vaneechoutte, M. (2010). Comparison of different sampling techniques and of different culture methods for detection of group B streptococcus carriage in pregnant women. [Electronic Version]. BMC Infection Diseases, 2010; 10:285 El Helali, N., Nguyen, J.-C., Ly, A., Giovangrandi, Y. & Trinquart, L. (2009). Diagnostic Accuracy of a Rapid Real Time Polymerase Chain Reaction Assay for Universal Intrapartum Group B Streptococus Screening. [Electronic Version]. Clinical Infectious Diseases, 2009; 49: 417-423. Enkin, M., Keirse, M. J. N. C., Neilson, J., Crowther, C., Duley, L., Hodnett, E. & Hofmeyr, J. (2006). Effektive Betreuung während Schwangerschaft und Geburt. Ein evidenzbasiertes Handbuch für Hebammen und GeburtshelferInnen (2. Aufl.). Bern: Hans Huber Fani, M. M., Kohanteb, J. & Dayaghi, M. (2007). Inhibitory activity of garlic (Allium sativum) extract on multidrug- resistant Streptococcus mutans [Electronic Version]. Journal of the Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry, 2007; 25: 164-168. Fleischauer, A. T., Poole, Ch. & Arab, L. (2000). Garlic consumption and cancer prevention: meta-analyses of colorectal and stomach cancers [Electronic Version]. American Journal of Clinical Nutrition, 2000; 72: 1047-1052. Fujisawa, H., Suma, K., Origuchi, K., Kumagai, H., Seki, T. & Ariga, T. (2008). Biological and Chemical Stability of Garlic-Derived Allicin [Electronic Version]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008; 56: 4229-4235. Fujisawa, H., Watanabe, K., Suma, K., Origuchi, K., Matsufuji, H., Seki, T., et al. (2009). Antibacterial Potential of Garlic-Derived Allicin and Its Cancellation by Sulfhydryl Compounds [Electronic Version]. Bioscience Biotechnology Biochemie; 73 (9): 1948-1955. Gatermann, S. & Miksits, K. (2009). Streptokokken. In H. Hahn, S. H. E. Kaufmann, T. F. Schulz, & S. Suerbaum (Hrsg.), Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie (6. Aufl., S. 203-221). Heidelberg: Springer Gavino, M. & Wang, E. (2007). A comparison of a new rapid real-time polymerase chain reaction system to traditional culture in determing group B streptococcus colonization. [Electronic Version]. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 2007; 197: 388. 61 Knoblauchtherapie Gull, I., Saeed, M., Shaukat, H., Aslam, S. M., Samra, Z. Q. & Athar, A. M. (2012). Inhibitory effect of Allium sativum and Zingiber officinale extracts on clinically important drug resistant pathogenic bacteria [Electronic Version]. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 2012; 11:8. Health Technology Assessment [HTA] (2007). Prenatal screening and treatment strategies to prevent group B streptococcal and other bacterial infections in early infancy: cost-effectiveness and expected value of information analyses [Electronic Version]. Health Technology Assessment, 2007; 11 (29). Honest, H., Sharma, S. & Khan, K. S. (2006). Rapid Tests for Group B Streptococcus Colonization in Laboring Women: A Systematic Review [Electronic Version]. Pediatrics, 2006; 117; 1055-1066 Itakura, A., Kurauchi, O., Morikawa, S., Matsuzawa, K., Mizutani, S. & Tomoda, Y. (1996). Variability of peripartum vaginal group B streptococcal colonization. [Electronic Version]. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 1996; 55: 19-22. Kantonale Ethikkommission Bern [KEK] (2012). Checkliste für einzureichende Gesuchsunterlagen bei der KEK Bern. Abgerufen am 20.04.2012 unter: http://www.kek-bern.ch/downloads/Checkliste_KEK_Einreichung_ab_Maerz_ 2012.pdf Koch, H. P. und Hahn, G. (1988). Knoblauch: Grundlagen der therapeutischen Anwendung von Allium sativum L. München: Urban und Schwarzenberg. Koenig, J. M. & Keenan, W. J. (2009). Group B Streptococcus and Early-Onset Sepsis in the Era of Maternal Prophylaxis [Electronic Version]. Pediatric Clinics of North America, 2009; 56 (3): 689-708. Köster, H. (2011). B-Streptokokken – aktueller Forschungsstand und Perspektiven. Die Hebamme, 2011; 2: 74-83. Konvicka, O. (2001). Knoblauch (Allium sativum L.): Grundlagen der Biologie und des Anbaus, Inhaltsstoffe und Heilwirkungen. Olomouc: Buchholz. Kürzl, R. (2006). Grundlagen diagnostischer Tests und Screeningverfahren. In H. Schneider, P. Husslein & K. T. M. Schneider (Hrsg)., Die Geburtshilfe (S. 103115). Heidelberg: Springer Kunz, R., Ollenschläger, G., Raspe, H., Jonitz, G. & Kolkmann, F. W. (2000). Lehrbuch evidenzbasierte Medizin in Klinik und Praxis. Köln: Deutscher Ärzte Verlag. 62 Knoblauchtherapie Luyben, A. & Stiefel, A. (2007). Erkrankungen und Komplikationen in der Schwangerschaft. In Ch. Geist, U. Harder & A. Stiefel (Hrsg.), Hebammenkunde. Lehrbuch für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Beruf (4. Aufl., S. 205-206). Stuttgart: Hippokrates. Mayer, H. (2007). Pflegeforschug kennenlernen. Elemente und Basiswissen für die Grundausbildung. Wien: Facultas. Mulhall, A. (1998). Nursing, research and the evidence [Electronic Version]. Evidecebased nursing. 1998; 1 (1): 4-6. Mylonas, I. & Friese, K. (2006). Infektionen in der Geburtshilfe. In H. Schneider, P. Husslein & K. T. M. Schneider (Hrsg)., Die Geburtshilfe (S. 384-385). Heidelberg: Springer Neumann, G., Feucht, H. H., Becker, W. & Späth, M. (2010). Gynäkologische Infektionen. Heidelberg: Springer Ngo, S. N. T., Williams, D. B., Cobiac, L. & Head, R. J. (2007). Does garlic reduce risk of colorectal cancer? a systematic review. Journal of Nutrition, 2007; 137(10): 2264-2269. National Institute for Health and Clinical Excellence [NICE] (2007). Intrapartum Care. Abgerufen am 16.04.2012 unter: http://publications.nice.org.uk/intrapartumcare-cg55 National Institute for Health and Clinical Excellence [NICE] (2008). Antenatal Care. Abgerufen am 16.04.2012 unter: http://publications.nice.org.uk/antenatal-carecg62 Ohlsson, A. & Shah, V. S. (2009). Intrapartum antibiotics for known maternal Group B streptococcal colonization (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews, 2009; Issue 3: Art. No.: CD007467. Panda, B., Iruretagoyena, I., Stiller, R. & Panda, A. (2008). Antibiotic resistance and penicillin tolerance in ano-vaginal group B streptococci. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, February 2009; 22 (2): 111-114. Abgefragt am 23.02.2012 unter: http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1080/14767050802488212 Petersen, E. E. (2003). Infektionen in Gynäkologie und Geburtshilfe. (3. Aufl.) Stuttgart: Georg Thieme Polit, D. F., Beck, Ch. T. & Hungler B. (2004). Lehrbuch Pflegeforschung. Bern: Huber. 63 Knoblauchtherapie Prager-Khoutorsky, M., Goncharov, I., Rabinkov, A., Mirelman, D., Geiger, B. & Bershadsky, A. D. (2007). Allicin inhibits cell polarization, migration and division via its direct effect on microtubules [Electronic Version]. Cell Motility and the Cytoskeleton, 2007; 64 (5): 321-337. Pschyrembel Klinisches Wörterbuch (2002). 259. Aufl. Berlin, New York: De Gruyter. Rallu, F. Barriga, P., Scrivo, C. Martel-Laferrière, V. & Laferrière, C. (2005). Sensitivities of Antigen Detection and PCR Assays Greatly Increased Compared to That of the Standard Culture Methode for Screening for Group B Streptococcus Carriage in Pregnant Women [Electronic Version]. Journal of Clinical Microbiology, 2006; 44 (3): 725-728. Rattanachaikunsopon, P. & Phumkhachorn, P. (2009). Prophylactic effect of Andrographis paniculata extracts against Streptococcus agalactiae infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) [Electronic Version]. Journal of Bioscience and Bioengineering, 2009; 107 (5): 579-582. Rausch, A.-V., Gross, A., Droz, S., Bodmer, T. & Surbek, D. V. (2008). Group B Streptococcus colonization in pregnancy: prevalence and prevention strategies of neonatal sepsis [Electronic Version]. Journal of Perinatal Medicine, 37 (2009): 124-129. Renner, R. M., Renner, A., Schmid, S., Hoesli, I., Nars, P., Holzgreve, W. & Surbek, D. V. (2006). Efficacy of a strategy to prevent neonatal early-onset group B streptococcal (GBS) sepsis [Electronic Version]. Journal of Perinatal Medicine, 34 (2006): 32-38. Ried, K., Frank, O. R., Stocks, N. P., Fakler, P. & Sullivan, T. (2008). Effect of garlic on blood pressure: a systematic review and meta-analysis [Electronic Version]. BMC Cardiovascular Disorders, 2008; 8: 13. Royal College of Obstetricians and Gynecologists [RCOG] (2003). Prevention of Early Onset Neonatal Group B Streptococcal Disease [Electronic Version]. Guideline No. 36, Edinburgh: Royal College of Obstetricians and Gynecologists. Schulz, V. & Hänsel, R. (2004). Rationale Phytotherapie. Ratgeber für Ärzte und Apotheker. (5. Aufl.). Heidelberg: Springer Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften [SAMW] (2009). Forschung mit Menschen. Ein Leitfaden für die Praxis. Abgefragt am 06.05.2012 unter: http://www.samw.ch/de/Publikationen/Leitfaden.html 64 Knoblauchtherapie Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe [SGGG] (2006). Prophylaxe der Early Onset Neugeborenensepsis durch Streptokokken der Gruppe B. Expertenbrief Nr. 19. Abgefragt am 19.10.2011 unter: http://sggg.ch/files/Expertenbrief%20No%2019.pdf Schweizerischer Hebammenverband [SHV] (1994). Internationaler Ethik-Kodex für Hebammen SHV, Bern. Abgefragt am 18.02.2012 unter: http:/www.hebamme.ch/x_data/allgdnld//Ethikkodex%20d_Logo.pdf Shaw, C., Mason, M. & Scoular, A. (2003). Group B streptococcus carriage and vulvovaginal symptoms: causal or casual? A case-control study in a GUM clinic population. [Electronic Version]. Sexually Transmitted Infection, 2003; 79: 246248. Sköld, O. (2011). Antibiotics and antibiotic resistance. Hoboken, New Jersey: John Wiley. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada [SOGC] (2004). The Prevention of Early-Onset Neonatal Group B Streptococcal Disease [Electronic Version]. Journal of Obstetrics and Gynaecologists of Canada, 2004; 26 (9): 826-832. Stille, W., Brodt, H. R., Groll, A. H. & Just-Nübling, G. (2005). Antibiotika-Therapie. Klinik und Praxis der antiinfektiösen Behandlung. 11. Aufl. Stuttgart: Schattauer. Trappe, K., Shaffer, L. & Stempel, L. (2011). Vaginal-perianal compared with vaginalrectal cultures for detecting group B streptococci during pregnancy. [Electronic Version]. Obstetrics and Gynecology, 2011; 118: 313-317. Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro für Europa [WHO] (2011). Strategischer Aktionsplan zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen. Abgefragt am 19.10.2011 unter: http://search.who.int/search?q=antibiotika+resistenz+aktionsplan&ie=utf8&site= default_collection&client=_en&proxystylesheet=_en&output=xml_no_dtd&oe=ut f8 Yancey, M. K., Schuchat, A., Brown, L. K., Lee Ventura, V. & Markenson, G. R. (1996). The Accuracy of Late Antenatal Screening Cultures in Predicting Genital Group B Streptococcal Colonization at Delivery. [Electronic Version]. Obstetrics and Gynecology, Vol. 88, No. 5, 1996: 811-815. Ziesing, S., Heim, A. & Vonberg, R.-P. (2009). Methoden der mikrobiologischen Diagnostik. In H. Hahn, S. H. E. Kaufmann, T. F. Schulz & S. Suerbaum (Hrsg.), 65 Knoblauchtherapie Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie. 6. Aufl.: S. 131-150. Heidelberg: Springer. 8 TABELLENVERZEICHNIS Tab. 1: Suchergebnisse zu den aktuellen Behandlungsmethoden...............................21 Tab. 2: Suchergebnisse zur antibakteriellen Wirkung von Knoblauch ..........................22 Tab. 3: Die vier aktuell empfohlenen Präventionsstrategien für GBS Infektionen beim Neugeborenen.....................................................................................................24 Tab. 4: Ergebnisse der Studienanalyse zu den aktuellen Behandlungsmethoden .......27 Tab. 5: Ergebnisse der Reviewanalyse zu den aktuellen Behandlungsmethoden .......28 Tab. 6: Ergebnisse der Leitlinienanalyse zu den aktuellen Behandlungsmethoden .....28 Tab. 7: Einschätzung der Stärken und Schwächen der analysierten Literatur zu den aktuellen Behandlungsmethoden .........................................................................31 Tab. 8: Ergebnisse zur antibakteriellen Wirkung von Knoblauch .................................36 Tab. 9: Einschätzung der Stärken und Schwächen der Studien zur antibakteriellen Wirkung von Knoblauch .......................................................................................42 9 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS AAP American Academy of Pediatrics AWMF Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften ÄZQ Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin BDH Bund Deutscher Hebammen CDC Centers for Disease Control and Prevention DELBI Deutsches Instrument zur Methodischen Leitlinienbewertung EOD Early onset Disease 66 Knoblauchtherapie EOS Early onset Sepsis GAS Streptokokken der Gruppe A GBS Streptokokken der Gruppe B GFMER Geneva Foundation for Medical Education and Research HPLC Hochleistungsflüssigkeitschromatographie HTA Health Technology Assessment IAP intrapartale Antibiotikaprophylaxe ICM International Confederation of Midwives KEK Kantonale Ethikkommission MBK Minimale bakterizide Konzentration MHK Minimale Hemmkonzentration NICE National Institute for Health and Clinical Excellence PCR Polymerasekettenreaktion p.p. postpartum RCOG Royal College of Obstetricians and Gynaecologists RCT randomisiert kontrollierte Studie SAMW Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften SGGG Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe SH Sulfhydryl SHV Schweizerischer Hebammenverband SLO Streptolysin O SOGC Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada SSW Schwangerschaftswoche WHO World Health Organisation (Weltgesundheitsorganisation) 67 Knoblauchtherapie 10 GLOSSAR Allicin Umsetzungsprodukt der in Knoblauch vorkommenden Aminosäure Alliin. Bildet sich wenn die Zellstruktur (Knoblauch) zerstört wird.1 Agarplatte Nährboden, Kulturmedium zur Anzucht von Bakterien.2 Agardiffusionstest Die Agarplatten werden mit Bakterien geimpft. Dann werden kleine Filterpapierplättchen mit Wirkstoff aufgelegt, dieser diffundiert aus dem Filterpapier in den Agar. Bei Wachstumshemmung zeigt sich ein Hemmhof. Im Randbereich dieses Hemmhofes entspricht die Konzentration des Wirkstoffes im Agar der MHK.2 Bakterizid Bakterien werden abgetötet.2 Bakteriostatisch Bakterien werden an der Vermehrung gehindert.2 Hochleistungsflüssig- HPLC ist ein Flüssigkeitschromatographie-Verfahren, mit dem man keitschromatographie nicht nur Substanzen trennt, sondern diese auch identifizieren und (HPLC) quantifizieren (die genaue Konzentration bestimmen) kann.1 Inzidenz Anzahl Neuerkrankungen in einer definierten Zeitperiode oder Population.3 Kausalität Beziehung zwischen zwei Variablen, bei der das Vorliegen einer Variablen (Ursache) das Vorhandensein oder den Wert der anderen (Wirkung) bestimmt.3 Minimale Hemm- (engl. MIC) Die niedrigste Konzentration eines Wirkstoffes, die zur Konzentration (MHK) Wachstumshemmung führt.2 Minimale bakterizide (engl. MBC) Die niedrigste zur Abtötung der Bakterien notwendige Konzentration (MBK) Konzentration eines Wirkstoffes.2 Multidrug-resistent beschreibt das Phänomen, dass Zellen eine Resistenz gegenüber Arzneistoffen (hier: Antibiotika) haben.1 n-Hexan n-Hexan ist eine den Alkanen zugehörige chemische Verbindung.1 Polymerasekettenrea Molekularbiologisches Verfahren, um unter anderem Bakterien ktion (PCR) nachzuweisen.2 Präanalytische Fehler in der Phase, in der die zu untersuchenden Proben entnom- Fehlerquellen men und zur Analyse vorbereitet werden.2 1 Wikipedia Ziesing et al. (2009) 3 Polit et al. (2004) 2 68 Knoblauchtherapie Prävalenz Die Prävalenz beschreibt den Anteil Erkrankter an der Gesamtzahl einer definierten Population zu einem bestimmten Zeitpunkt.4 Randomisierung Verfahren, das eine zufällige Verteilung der Patienten auf eine Therapie- und eine Kontrollgruppe bewirkt (randomisierte kontrollierte Studie).4 Sensitivität Beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem positiven Testergebnis die Testperson auch tatsächlich erkrankt ist.2 Sulfhydryl- Thioalkohole sind organisch-chemische Verbindungen, die eine oder Komponenten mehrere gebundene Thiolgruppen (−SH) als funktionelle Gruppen tragen (Bsp: Aminosäuren).1 Spezifität Beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem negativen Testergebnis die Testperson auch tatsächlich nicht erkrankt ist.2 Streptolysin O (SLO) Ein Hämolysin, welches von Bakterien der Gattung Streptokokken gebildet wird (vor allem der Gruppe A). Es bewirkt eine Schädigung von Erytrozyten- (Hämolyse) und anderen Zellmembranen.1 Todd-Hewitt Broth Todd-Hewitt Broth ist ein Mehrzweckmedium, das primär zur Kulti- (THB) vierung von ß-hämolytischen Streptokokken zum Einsatz kommt.5 Topische Anwendung Synonym: Lokaltherapie; Anwendung von medizinischen Wirkstoffen dort, wo sie therapeutisch wirken sollen.1 Unabhängige Die Variable, von der angenommen wird, dass sie die abhängige Variable Variable verursacht oder beeinflusst; in der experimentellen Forschung die manipulierte Variable (Behandlungsvariable).3 Verdünnungsme- Alle Verdünnungsstufen werden mit einer identischen Erregermenge thode beimpft und anschliessend bebrütet. Erregerwachstum wird über die makroskopisch sichtbare Trübung, Wachstumshemmung über das Ausbleiben der Trübung angezeigt.2 Vulnerabilität Synonym: Verletzbarkeit; in der Forschung spricht man von vulnerablen Personen bei kleinen Kindern, Behinderten, Schwangeren, da diese Personen einen besonderen Schutz bedürfen.3 4 5 Cochrane-Glossar (http://www.cochrane.de/de/cochrane-glossar) www.bd.com/leaving/?/resource.aspx?IDX=22904 69 Knoblauchtherapie 11 POSTER 70