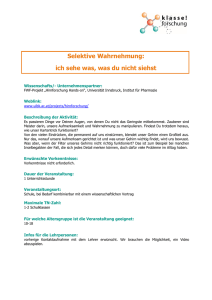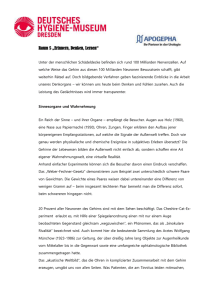Der Beobachter im Gehirn
Werbung

Inhalt Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auf dem Weg nach innen. Jahre Hirnforschung in der Max-Planck-Gesellschaft . . Das Jahrzehnt des Gehirns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Was kann ein Mensch wann lernen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vom Gehirn zum Bewußtsein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wahrnehmen, Erinnern, Vergessen. Über Nutzen und Vorteil der Hirnforschung für die Geschichtswissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neurobiologische Anmerkungen zum Konstruktivismus-Diskurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hirnentwicklung und Umwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hirnentwicklung oder die Suche nach Kohärenz Determinanten der Hirnentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . Der Beobachter im Gehirn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Im Grunde nichts Neues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neugier als Verpflichtung Warum der Mensch unentwegt weiterforschen muß . . . . . Für und wider die Natur Was weiß die Wissenschaft, und was darf sie wissen? . . . . Die Architektur des Gehirns als Modell für komplexe Stadtstrukturen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neurobiologische Anmerkungen zum Wesen und zur Notwendigkeit von Kunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nachweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Das Jahrzehnt des Gehirns Der amerikanische Senat hat die neunziger Jahre zur decade of the brain, zum Jahrzehnt des Gehirns, erklärt. Etwa zur selben Zeit wurde das weltumspannende »human science frontier program« beschlossen, in dem die Förderung der Neurowissenschaften ebenfalls beträchtlichen Raum einnimmt. Die Beweggründe für diese gezielte Intensivierung der Hirnforschung sind ebenso vielfältig wie die möglichen Folgen der erhofften Ergebnisse. Zunächst drängen medizinische Gründe. Die Geistes- und Gemütskrankheiten, so die Schizophrenie und die Depression, entbehren bisher jeglicher kausaler Erklärung und Therapie. Obgleich sich die Hinweise mehren, daß diese Erkrankungen auf fehlerhaften Funktionen des Gehirns beruhen, also strukturelle und biochemische Ursachen haben, die zum Teil sogar genetisch bedingt sind, ist es bisher nicht gelungen, die Störungen einzugrenzen. Bei einer Gruppe anderer Erkrankungen sind Ort und Art der pathologischen Prozesse bekannt, es fehlen jedoch wirksame Therapien. Dies gilt für die multiple Sklerose ebenso wie für eine Vielzahl degenerativer Erkrankungen des Zentralnervensystems. Die Alzheimersche Erkrankung, die wegen der steigenden Lebenserwartung immer bedrohlicher wird, gehört hierzu. Diesen ungelösten Fragen stehen Erfolge bei Krankheiten gegenüber, die hoffen lassen, daß eine langfristig angelegte Grundlagenforschung schließlich zur Entwicklung kausaler Therapieverfahren führen wird. Wir wissen, daß wesentliche Fortschritte bei der Behandlung von Epilepsien, Schmerzsyndromen, Angstzuständen und der Parkinsonschen Erkrankung auf der Analyse zellulärer und biochemischer Prozesse im Gehirn beruhen. Und selbst die schwierige Lage der Hirnverletzten und Schlaganfallpatienten könnte sich als weniger ausweglos erweisen, als es zunächst scheinen mag. Man entdeckte natürliche Substanzen, die das Wachstum von Nervenzellen kontrollieren. Mit ihnen lassen sich selbst nach Abschluß der Hirnentwicklung regenerative Wachstumsvorgänge stimulieren. Außerdem zeigte sich, daß auch Nervenzellen transplantierbar sind und unter ganz bestimmten Bedingungen die Funktion zerstörter Zellen übernehmen können. Die Untersuchung der Hirnentwicklung brachte die überraschende und klinisch bedeutsame Erkenntnis, daß die strukturelle Reifung des Gehirns höherer Säugetiere einschließlich des Men schen bei der Geburt noch lange nicht abgeschlossen ist, sondern sich bis in die Pubertät fortsetzt. Während dieser Zeit erfährt die Verschaltung verschiedener Hirnzentren noch eine tiefgreifende Überformung. Die Grundverschaltung des Gehirns ist zwar genetisch festgelegt, doch werden zunächst Verbindungen im Überschuß angelegt. Während der postnatalen Entwicklung erfolgt dann eine Auswahl der Verbindungen, die den funktionellen Anforderungen am besten entsprechen. Unpassende Verbindungen werden unwiderruflich zerstört. Aufregend ist, daß das heranwachsende Gehirn die Kriterien für diesen Selektionsvorgang zum Teil aus der Interaktion mit seiner Umwelt gewinnt. Wenn etwa die Augen während der ersten Lebensjahre wegen einer Hornhauttrübung nicht benutzt werden können, werden die für den normalen Sehvorgang in der Hirnrinde erforderlichen Verbindungen nicht optimiert. Die Patienten bleiben blind, selbst wenn im Auge durch Hornhauttransplantation normale optische Bedingungen hergestellt werden. Das Gehirn hat gleichsam versäumt, die Strukturen auszubilden, die für die Interpretation von Signalen aus den Augen erforderlich sind. Ähnliches scheint für alle kognitiven Funktionen zu gelten, so auch für den Spracherwerb. Ein Beispiel dafür ist das Unvermögen des Japaners, den Unterschied zwischen R und L zu hören. Diese Laute kommen in seinem Sprachraum nicht vor. Entsprechend hat das Gehirn die entsprechenden kognitiven Strukturen nicht optimiert. Japanische Kinder, die in anderen Sprachräumen aufwachsen, »lernen« diese Unterschiede natürlich mühelos. Das provoziert die spannende Frage, ob wir nicht alle für bestimmte kognitive Bereiche empfindungslos sind, weil wir während unserer Entwicklung keine einschlägigen Erfahrungen sammeln konnten. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum wir zwar alle lesen, schreiben und rechnen können, nicht aber komponieren, malen und tanzen. Nun hängt natürlich nicht alles von der Umwelt ab. In der genetisch vorgegebenen Grundverschaltung des Gehirns ist bereits erhebliches »Wissen« über die Welt repräsentiert, in welche das werdende Gehirn hineingeboren wird. Dieses Wissen wurde im Laufe der Entstehung der Arten in den Genen gespeichert und drückt sich in den angeborenen Verhaltensmustern aus. Aufgrund dieses Vorwissens ist das junge Gehirn in der Lage, selbst Fragen an die Umwelt zu stellen und die Informationen abzurufen, die es für seine Entwicklung benötigt. Postnatale Hirnentwicklung vollzieht sich also auf der Basis eines Frage-und-Antwort-Spiels, wobei das werdende Gehirn meist die Initiative hat. Von außerordentlicher Brisanz wäre es schließlich, wenn sich herausstellte, daß auch die kognitiven Fähigkeiten, die wir für unser soziales Verhalten benötigen, über einen solchen Dialog entwickelt werden müssen. Die medizinischen Perspektiven der Hirnforschung sind aber nicht die einzigen Gründe für ein wachsendes gesellschaftliches Interesse an den Neurowissenschaften. So zeigte sich, daß künstliche »intelligente« Systeme, die »Elektronengehirne«, bei all jenen Problemen versagen, die von natürlichen Gehirnen mit besonderer Eleganz und Leichtigkeit gelöst werden. Der Grund ist, daß die bisher entwickelten Rechner- und Expertensysteme nach gänzlich anderen Prinzipien organisiert sind als ihre natürlichen Vorbilder. Zwar lassen sich gewisse Analogien zwischen den logischen Funktionen einzelner Nervenzellen und den Schaltelementen in Rechnern herstellen; die Architekturen, in welche diese logischen Elemente jeweils eingebettet sind, unterscheiden sich jedoch radikal. Da sich die Organisationsprinzipien unseres Gehirns offenbar weder durch Selbsterkenntnis noch durch angestrengtes Nachdenken erschließen lassen, richtet sich die Hoffnung auf die Neurowissenschaften. Eine weitere Attraktion der Hirnforschung liegt darin, daß natürliche Gehirne als ideale Modelle für das Studium von Wechselwirkungen in komplexen, sich selbst organisierenden Systemen erkannt werden. In keiner anderen uns bekannten Struktur sind so viele Einzelelemente zu einem funktionstüchtigen Ganzen verkoppelt. Das Nervensystem ist »lebender Beweis« dafür, daß komplexe, stark vernetzte Systeme stabile Zustände einnehmen können und zu zielgerichtetem Handeln fähig sind, obgleich sie einer übergeordneten Steuerzentrale entbehren. Die Hoffnung ist nun, daß ein vertieftes Verständnis des Gehirns helfen wird, jene Regeln zu erkennen, die zur Stabilisierung und Selbstorganisation hochkomplexer, dynamischer Systeme beitragen. Diese Regeln sind deshalb von erheblicher Bedeutung, da ähnliche Organisationsprobleme in Ökound Wirtschaftssystemen, aber auch in sozialen Systemen auftreten. Während die Erforschung anderer Organe ausschließlich Domäne der Biowissenschaften ist, stellt das Gehirn auch für Psychologen, Linguisten, Psychiater, Neurologen, Verhaltensforscher und Informatiker eine faszinierende Herausforderung dar. Bis vor wenigen Jahren entwickelten sich diese Wissensgebiete jedoch recht autonom. Besonders tief war natürlich die Trennung zwischen den Ver haltenswissenschaften und den biologischen Disziplinen. Insbesondere in Deutschland gab es bis vor einigen Jahren kaum Kontakte zwischen Psychologen und Neurobiologen. Jetzt aber erfolgt Annäherung der verschiedenen Wissensgebiete, wodurch die Hirnforschung in eine besonders erkenntnisträchtige Phase eingetreten ist. In Einzelfällen kann man jetzt für bestimmte Verhaltensleistungen von Tieren die zugrundeliegenden neuronalen Prozesse über die verschiedenen Ebenen hinweg bis hinunter zu den molekularen Vorgängen fast lückenlos angeben. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die Aufklärung von Lernmechanismen bei der Meeresschnecke Aplysia. Faszinierend ist besonders, daß die gleichen molekularen Abläufe auch in der Hirnrinde von Säugetieren gefunden wurden, wo sie ebenfalls mit Lernvorgängen in Verbindung zu stehen scheinen. Ein weiterer Beweis, daß grundlegende und erfolgreiche »Erfindungen« in der Natur über die stammesgeschichtliche Entwicklung der Arten hinweg beibehalten werden. Auch Teilleistungen komplexer Gehirne konnten auf neuronaler Ebene analysiert werden. Hierzu zählen die Vorverarbeitung von Sinnessignalen, das Erkennen von Mustern, Lern- und Gedächtnisvorgänge und das Entwerfen von Handlungsfolgen. Mit Hilfe leistungsfähiger Rechenanlagen ließen sich zum Beispiel die Neuronengruppen orten, die eine Erinnerung an nur kurz sichtbare Objekte ermöglichen und die sicherstellen, daß eine spätere Greifbewegung zu dem nun unsichtbaren Objekt dennoch zum Ziel führt. Die entsprechenden Zellen werden aktiv, sobald das Objekt erscheint, halten ihre Aktivität aufrecht, auch nachdem es wieder verschwunden ist, und verstummen erst, wenn Minuten später die Bewegung abläuft. Den Hirnforschern wird es zunehmend möglich, auch für menschliches Verhalten enge Beziehungen zwischen Struktur und Funktion darzustellen. Ganz wesentlich war hierfür die Entwicklung bildgebender Verfahren. Dadurch lassen sich mentale Prozesse wie das Aufrufen von Gedächtnisinhalten, das Vorstellen von Szenen, das stumme Sprechen und das Planen von Handlungen bestimmten Hirnregionen zuordnen. Psychologische Modelle über die Struktur und Repräsentation kognitiver und mentaler Vorgänge können auf diese Weise mit Abläufen im Gehirn in Verbindung gebracht werden. So führt die Analyse von Gedächtnisleistungen zu dem Schluß, daß es verschiedene Arten von Gedächtnis geben müsse: ein prozedurales Gedächtnis, welches das Erlernen und Wie deraufrufen motorischer Fertigkeiten, etwa Fahrradfahren, ermöglicht. Ein räumliches Gedächtnis, ohne das wir uns in einer bekannten Stadt nicht zurechtfinden könnten. Ein episodisches Gedächtnis, das uns erlaubt, eigene Erlebnisse zu erinnern, und schließlich ein deklaratives Gedächtnis, das wir brauchen, um bekannte Objekte benennen zu können. Neuropsychologische Untersuchungen haben nun tatsächlich gezeigt, daß diese verschiedenen Erinnerungsleistungen aufgrund von Läsionen in unterschiedlichen Hirnregionen einzeln ausfallen können. Ein weiteres Beispiel liefert die Sprachforschung. Linguisten kamen aufgrund sprachenanalytischer Untersuchungen zu dem Schluß, daß es für die Repräsentation von Lexikon und Grammatik, für das Vokabular und das Regelwerk der Sprache verschiedene funktionell unterscheidbare Module geben müsse. Diese sollten zudem für Erst- und Zweitsprachen unterschiedlich organisiert sein. Neuropsychologen haben dies bestätigt und weitere unerwartete Ergebnisse erzielt. So zeigte sich zum Beispiel, daß Eigennamen an anderen Stellen gespeichert werden als funktionsbezogene Bezeichnungen und hier wiederum Begriffe für Lebewesen anders abgelegt werden als Worte für unbelebte Objekte. Die Konvergenz vormals getrennter Wissensbereiche findet in zunehmendem Maße auch ihre institutionelle Verankerung in eigenen, interdisziplinär strukturierten Forschungseinrichtungen. In den Vereinigten Staaten gibt es bereits zahlreiche Institute im Bereich der »neuroscience«. In Deutschland, sowohl in den alten wie in den neuen Bundesländern, sind solche Einrichtungen jedoch noch selten. Die Neurowissenschaften werden bei uns vorwiegend von Lehrstühlen in den klassischen Disziplinen der Medizin und Biologie vertreten, gelegentlich auch von biochemisch ausgerichteten Fachbereichen der Chemie. An psychologischen Instituten fehlen sie fast ganz. Dagegen haben sich an vielen physikalischen Instituten neuerdings Arbeitsgruppen konstituiert, die auf dem Teilgebiet »theoretische Neurobiologie« tätig werden. Hier mangelt es jedoch meist an der Verbindung zur Biologie. Entsprechend verschlungen sind oft die Wege, über die Studenten den Zugang zur Hirnforschung finden. Es scheint an der Zeit, darüber nachzudenken, ob wir das fächerübergreifende Unternehmen Hirnforschung nicht durch einen eigenen Studiengang und durch multidisziplinäre Hirnforschungsinstitute besser koordinieren sollten. Die Tatsache, daß im Bereich der Hirnforschung immer häufiger