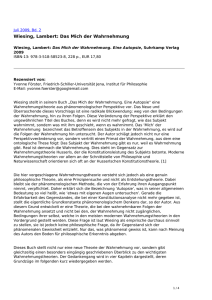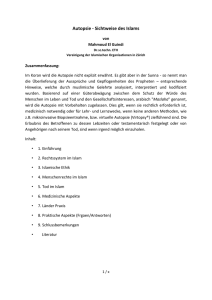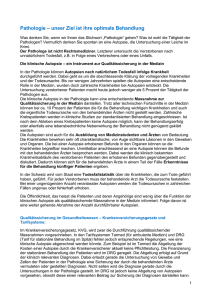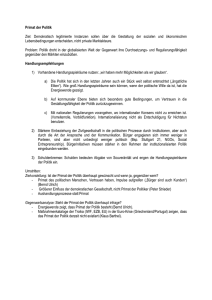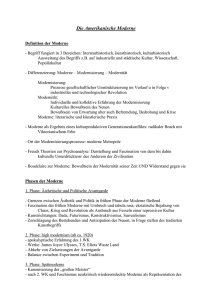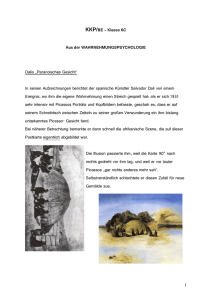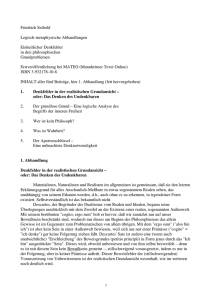Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung. Eine Autopsie
Werbung

Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung. Eine Autopsie, 04.06.10 Frankfurt a.M. 2009 (empfohlene Zitierweise: Detlef Zöllner zu Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung. Eine Autopsie, Frankfurt a.M. 2009, 04.06.2010, in: http://erkenntnisethik.blogspot.de/) Lambert Wiesing reagiert mit seinem Buch „Das Mich der Wahrnehmung. Eine Autopsie“ auf eine allgemeine wissenschaftspolitische Situation, in der nicht zum ersten Mal in der Wissenschaftsgeschichte eine einzelwissenschaftliche Disziplin bis an die Grenzen allgemein menschlicher, anthropologischer Grundprobleme vorstößt. Aktuell handelt es sich um die Neurowissenschaften, die sich als eine die bisherigen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften dominierende oder sogar ablösende Wissenschaft vom Menschen konstituiert. Die Geisteswissenschaften und insbesondere die Philosophie werden allenfalls als Stichwortgeber und Ideenlieferanten im Dienste der Neurowissenschaftler geschätzt, ansonsten aber als durch die neurowissenschaftliche Forschung weitgehend überholt wahrgenommen. Wiesing beschreibt nun die Philosophie in seinem gerade erschienenen Buch als ein interdisziplinär einzigartiges, unverzichtbares Denk- und Wissensprojekt, dessen Aufgabe darin besteht, im Feld des Menschlichen ein sicheres, unangreifbares Terrain unbezweifelbarer Gewißheiten abzustecken. Damit erweist sie den anderen Disziplinen ihren eigentlichen Dienst, den auch der überzeugteste Neurophysiologe nicht geringschätzen sollte. Denn ohne dieses Fundament gäbe es keinen menschlichen Verstand. Und ohne menschlichen Verstand gäbe es keine Wissenschaft. Das sichere Terrain, das Fundament, von dem hier die Rede ist, ist die Wirklichkeit der Wahrnehmung: „Geht man in der Beschreibung der Wahrnehmung von ihrer Wirklichkeit aus, so werden Behauptungen möglich, deren Geltungsanspruch durch die Gewißheit der eigenen Erfahrung begründet ist ...“ (Autopsie, S. 9) – So schlicht dieser Satz erscheint, so ist er doch gerade in seiner Schlichtheit und Unangreifbarkeit genial. Die Wahrnehmung liefert uns eine Wirklichkeit, die wir nicht in Frage stellen können, ohne zugleich unseren Verstand außer Kraft zu setzen; oder anders formuliert: ohne verrückt zu werden! Nun können wir auf viele verschiedene Weisen die Wahrnehmung selbst zum Thema unseres Denkens und Forschens machen. Gerade auch die Neurophysiologen haben es ganz zentral mit der Frage zu tun, wie Wahrnehmung möglich ist, also mit ihrer Entstehung bzw. mit ihrer Genese. Aber ganz gleich wer sich den- kend und forschend mit der Entstehung von Wahrnehmung befaßt, – Wiesing zeigt, daß es grundsätzlich drei Möglichkeiten gibt, sie zu thematisieren. Diese drei Möglichkeiten bilden zugleich drei verschiedene Paradigmen der Wahrnehmungstheorie, und nur einem dieser drei verschiedenen Paradigmen gesteht Wiesing die Eigenschaft zu, philosophisch zu sein. Bei den drei Paradigmen der Wahrnehmungstheorie handelt es sich um das Primat des Wahrnehmungsgegenstands (vgl. Autopsie, S.115f.), das Primat des Wahrnehmungssubjekts (vgl. Autopsie, S.116f.) und um das Primat der Wahrnehmung selbst (vgl. Autopsie, S.118f.). Beim Primat des Wahrnehmungsgegenstands geht es Wiesing zufolge um eine „Eindrucksbeziehung“ (vgl. Autopsie, S.147f.), bei der der Wahrnehmungsgegenstand auf das Wahrnehmungssubjekt einwirkt. Hier wird das Wahrnehmungssubjekt auf den Wahrnehmungsgegenstand zurückgeführt. Dem liegt der „Mythos des Gegebenen“ zugrunde (vgl. Autopsie, S.33-39), in dem alles Wissen auf die Wirklichkeit einer Außenwelt bezogen wird, was üblicherweise in den Naturwissenschaften geschieht. Als „Mythen“ bezeichnet Wiesing diejenigen Erklärungsversuche, die sich nicht darauf beschränken, „Modelle“ zur Erklärung der Wirklichkeit zu konstruieren, sondern diese Modelle zugleich als Antworten auf ontologische Fragen nach der Realität und der Wahrheit verstehen. Denn: „Sobald eine modellierende Theorie auf Fragen bezogen wird, in denen es um Wahrheit geht, muß jedes Modell scheitern.“ (Vgl. Autopsie, S.23) Beim Primat des Wahrnehmungssubjekts geht es Wiesing zufolge um eine „Ausdrucksbewegung“ (vgl. Autopsie, S.148f.), bei der der Wahrnehmungsgegenstand auf das Wahrnehmungssubjekt zurückgeführt wird. Hier wird die Wahrnehmung als verursacht durch das Wahrnehmungssubjekt thematisiert. Dem liegt der „Mythos des Mittelbaren“ zugrunde (vgl. Autopsie, S.40-48), in dem alles Wissen als interpretativ verstanden wird, was üblicherweise in den Geisteswissenschaften geschieht. Alles Wissen über die Wirklichkeit der Außenwelt ist demnach vermittelt über Modelle und Medien. Es gibt keinen direkten, unmittelbaren Bezug zu irgendeinem Gegenstand, sei er nun geistiger oder physikalischer Art. Auch hier haben wir es also mit einem Mythos zu tun, und zwar mit einem „Weltentstehungsmythos“ (vgl. Autopsie, S.56), wie Wiesing schreibt. Denn der „Mythos des Mittelbaren“ unterstellt eine „unbewußte() Interpretationstätigkeit“ (vgl. Autopsie, S.56), in der unterhalb der bewußten Wahrnehmung (oder ‚hinterrücks‘: hinter unserem Bewußtsein) uns unbewußte Prozesse der Interpretation dessen, was wir ‚wahrnehmen‘, ablaufen, die längst darüber vorentschieden haben, was wir gerade jeweils zur Kenntnis nehmen. Unsere bewußte Aufmerksamkeit ist also unfrei und abhängig von unbewußten Prozessen, seien es nun im freudianischen Sinne kulturelle, ‚hinter‘ unserem Bewußtsein ablaufende Prozesse oder im Sinne der Neurophysiologie biologische Prozesse unterhalb der Bewußtseinsschwelle. Beide beschriebenen Paradigmen arbeiten mit einem „Paradigma des Zugangs“ (vgl. Autopsie, S.61ff.), d.h. sie thematisieren die Wahrnehmung als einen „Zugang‘ des Subjekts zur Außenwelt, in die eine oder in die andere Richtung: wie kommt das Subjekt zur Außenwelt bzw. wie kommt die Außenwelt zum Subjekt? Damit verräumlichen sie das Mensch-Weltverhältnis: sie stellen den Menschen bzw. das Bewußtsein der Welt gegenüber und thematisieren aus diesem räumlichen Bezug heraus die Wahrnehmung. Und je weiter sie ihre genetischen Forschungen vorantreiben, um so weiter entfernen sie mit ihren Erklärungsmodellen das Subjekt von der Außenwelt, so daß schließlich auf der einen Seite das Subjekt verschwindet: die einzige Wirklichkeit ist die Außenwelt, bzw. auf der anderen Seite die Außenwelt: die einzige Wirklichkeit ist das Subjekt. Beim dritten Paradigma, dem Primat der Wahrnehmung, handelt es sich um die im eigentlichen Sinne philosophische Perspektive auf die Wahrnehmung. (Vgl. Autopsie, S.118f.) Dabei geht es nicht um eine räumliche, sondern um eine „Teilhabe-Relation“. (Vgl. Autopsie, S.151ff.) Wiesing zufolge ist das Bewußtsein nämlich „kein räumliches Vorkommnis.“ (Vgl. Autopsie, S.150) Es läßt sich nicht der Welt gegenüberstellen, sondern Bewußtsein und Welt bilden eine „Teil-GanzesBeziehung“, die sich über die Wahrnehmung „realisiert“. (Vgl. Autopsie, S.153f.) In dieser Teil-Ganzes-Beziehung lassen sich das Ich und die Welt nicht voneinander isolieren, sondern sie bilden Pole, die ohne das jeweils andere nicht bestehen können. Man kann sie zwar in ‚Modellen‘ einander gegenüberstellen, aber diese Modelle dürfen eben nicht den Anspruch erheben, das Ich bzw. die Welt jeweils für sich in zureichender Weise erklären zu können. Aber Modelle kommen für den Philosophen sowieso nicht in Betracht. Für ihn zählt nur die Gewißheit der Wahrnehmung selbst, und diese bildet eine Einheit aus Wahrnehmungssubjekt und Wahrnehmungsobjekt. Bei der Wahrnehmungsgewißheit handelt es sich um eine andere Art von Gewißheit als bei der cartesianischen Existenzgewißheit, daß ich bin, in der Descartes vom Bewußtsein als einer Substanz ausgeht. (Vgl. Autopsie, S.83ff.) Mit der Existenzgewißheit gehen keine Gewißheiten hinsichtlich der „anthropologischen Lage“ des Menschen, also hinsichtlich seiner Daseinsform einher. (Vgl. Autopsie, S.14, 81u.ö.) Menschen wissen aber mit absoluter Gewißheit mehr, als daß sie nur existieren: „Menschen, und wahrscheinlich nur Menschen, wissen, wie es ist, ein Mensch zu sein.“ (Vgl. Autopsie, S.73) – Und dieses anthropologische Wissen, wie es ist, ein Mensch zu sein, ist es, das uns die Wirklichkeit unserer Wahrnehmung verleiht. Von der Wahrnehmung her erwächst uns ein Wissen, das uns niemand nehmen kann, denn wenn es darum geht, zu wissen, wie es ist, ein Mensch zu sein, ist uns gegenüber nicht einmal Gott im Vorteil. (Vgl. Autopsie, S.163) Von welcher Art ist also dieses Wissen, wenn die Philosophie sich keiner Modelle bedienen kann? Zunächst einmal ist es eben kein Wissen: „Die Existenzsicherheit des Wahrgenommenen ist die des Schmerzes und nicht die des Wissens.“ (Vgl. Autopsie, S.138) Wir haben es mit einer Gewißheit zu tun, und mit Gewißheiten kann man nicht argumentieren, so wenig wie man mit Schmerzen argumentieren kann. Wie kann uns aber die Wahrnehmung dennoch etwas Wißbares über unsere „anthropologische Lage“ in der Welt mitteilen, wenn wir es nicht mit Wissen zu tun haben und auch keine Modelle und Erklärungen zur Hilfe nehmen dürfen, ohne den Bereich der Philosophie zu verlassen? Die einzige Form, etwas über die Wahrnehmung und unsere über die Wahrnehmung festgelegte Daseinsform zu erfahren, besteht Wiesing zufolge in der sich jeden Urteils enthaltenden phänomenologischen Beschreibung. Und der Gegenstand dieser Phänomenologie sind die Folgen, die die Wahrnehmung dem Wahrnehmungssubjekt auferlegt. (Vgl. Autopsie, S.111ff.u.ö.) Diese Folgen sind nicht kausaler Natur. In ihnen geht es ausschließlich um die unmittelbaren, logischen Auswirkungen, die der phänomenale Zustand einer Wahrnehmung auf das Subjekt hat. Wobei auch das Wort ‚Logik‘ die Sache nicht trifft, denn es wird nicht wirklich ‚geschlußfolgert‘. Es gibt keine Induktion und keine Deduktion. Es wird lediglich eidetisch variiert:„Die eidetische Variation ist ein dritter Weg neben Induktion und Deduktion, welcher spezifisch für phänomenologische Beweise ist ...“ (Vgl. Autopsie, S.102) In der eidetischen Variation geht es um den Nachweis unvermeidbarer Intuitionen – Metzinger („Ego-Tunnel“) würde hier von ‚Illusionen‘ und ‚Selbsttäuschungen‘ sprechen, wie z.B. durch Lichtbrechungen, die uns ‚vortäuschen‘, daß ein im Wasser steckender Stock an der Wasseroberfläche gebrochen ist. Wir können uns im Augenblick der Wahrnehmung diesem Eindruck nicht entziehen, auch wenn wir es besser wissen. Das ‚bessere‘ Wissen um den ‚in Wirklichkeit‘ unversehrten Stock ist kontraintuitiv. Doch was heißt hier überhaupt ‚in Wirklichkeit‘? Wenn ich meinen Wahrnehmungen mißtraue, wenn ich an ihrer Wirklichkeit zu zweifeln beginne, löst sich alles in Illusionen auf, und es gibt tatsächlich keine Wirklichkeit mehr. Wenn wir also nach den Folgen der Wahrnehmung für das Wahrnehmungssubjekt fragen, wie es beim dritten Paradigma, dem Primat der Wahrnehmung, geschieht, so gehen wir also vor allem intuitiv vor, während jede kontraintuitive Vorgehensweise genau den Gegenstand, um den es hier geht: die Wahrnehmung, zunichte machen würde. Und eine weitere Voraussetzung, die mit diesem Vorgehen unmittelbar zusammenhängt, ist, daß die Welt, in der wir uns über die Wahrnehmung wiederfinden, real ist: „Nur dann hat man es mit einem Wahrnehmenden zu tun, wenn dieser das, was er wahrnimmt, für real und gegenwärtig hält.“ (Vgl. Autopsie, S.143) Die Vorgehensweise ist also intuitiv und ihre Methode ist die „eidetische Variation“. Das heißt, daß wir unseren Gegenstand in Gedanken variieren, ihm versuchsweise Eigenschaften mal zusprechen und mal absprechen, um dabei herauszufinden, welche Eigenschaften unbezweifelbar zu diesem Gegenstand gehören. Wir suchen also nach Eigenschaften und Qualitäten der Wahrnehmung, ohne die wir die Wahrnehmung nicht denken können. Kant hatte z.B. Raum und Zeit als Anschauungsformen des Verstandes bezeichnet, weil wir uns prinzipiell keine Gegenstände in der Welt denken können, ohne ihnen räumliche und zeitliche Eigenschaften zu verleihen. Raum und Zeit sind also Eigenschaften der Wahrnehmung, die in dem Moment, wo wir etwas wahrnehmen, mitgegeben sind. Eine unmittelbare Folge für das Wahrnehmungssubjekt ist also, daß es gleichursprünglich mit ihm räumlich und zeitlich strukturierte Wahrnehmungsgegenstände geben muß. Das ist so fundamental, daß man schlichtweg nicht mehr von Wahrnehmung reden kann, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind. Wiesing nennt insgesamt sieben für die Wahrnehmung unverzichtbare Qualitäten: die Raum-Zeitlichkeit des Wahrgenommenen (vgl. Autopsie, S.158) wurde schon erwähnt. Eine weitere Qualität der Wahrnehmung besteht im Gefühl der Präsenz bzw. der Anwesenheit von Wahrnehmungssubjekt und Wahrnehmungsgegenstand, das der schon erwähnten Teilhabe-Relation entspricht. (Vgl. Autopsie, S.124ff., 129, 132, 152) Das Wahrnehmungssubjekt ist unweigerlich in Situationen verstrickt. Es partizipiert, ob es will oder nicht. Zur Partizipation gehört auch unverzichtbar die Leiblichkeit des Wahrnehmenden (vgl. Autopsie, S.152, 162). Zum Realitätscharakter der Wahrnehmung gehören wiederum Unabhängig- keit und Kontinuität des Wahrgenommenen (vgl. Autopsie, S.170) und das Erlebnis, daß Wahrnehmungen durch das Wahrgenommene kausal verursacht sind (vgl. Autopsie, S.177 (Affizierbarkeit (vgl. Autopsie, S.182))). Wiederum eine weitere Qualität der Wahrnehmung besteht in der Öffentlichkeit bzw. Sichtbarkeit (vgl. Autopsie, S.182ff.) von Wahrnehmungssubjekt und Wahrnehmungsgegenstand: Was ich sehen kann, können andere auch sehen. Wenn andere sehen können, was ich sehe, können sie auch mich sehen. Ich bin also in meiner Person jederzeit für andere prinzipiell sichtbar wie irgendein anderer Wahrnehmungsgegenstand auch. Und eine letzte Qualität, besteht in der Identität und Entwicklung des Wahrnehmungssubjekts, die Wiesing beide als ein und dieselbe Qualität der Wahrnehmung zusammenfaßt. (Vgl. Autopsie, S.187ff.) Die Identität des Wahrnehmungssubjekts ergibt sich aus der Notwendigkeit, daß die Kontinuität der Wahrnehmungsgegenstände nur vor dem Hintergrund einer Kontinuität des Wahrnehmungssubjekts selbst erlebbar werden kann. Wenn ich mir in der Wahrnehmung selbst nicht identisch gegeben bin, kann ich auch die Welt vor meinen Augen nicht als kontinuierlich und unabhängig wahrnehmen. Nun geht Wiesing an dieser Stelle aber – wie ich finde – noch einen unnötigen Schritt weiter. Nicht nur die Identität des Wahrnehmungssubjekts soll demnach eine unverzichtbare Qualität der Wahrnehmung sein, sondern auch dessen Zeitlichkeit und Veränderlichkeit. Da wir, so Wiesing, die Gegenstände in der Welt als veränderlich wahrnehmen, müssen wir uns selbst als sich in der Zeit verändernde und entwickelnde Subjekte wahrnehmen. (Vgl. Autopsie, S.188) Hier wird meiner Ansicht nach aber zu viel unnötig vorausgesetzt und geurteilt, so daß Wiesing hier den sicheren phänomenologischen Boden verläßt. Wäre es tatsächlich so, daß sich Wahrnehmung nur ineins mit einem Bewußtsein von der eigenen Zeitlichkeit und Veränderlichkeit denken ließe, dann könnten Kinder keine Wahrnehmungssubjekte sein. Kinder haben weder ein Bewußtsein von ihrer eigenen Zeitlichkeit noch von der Zeitlichkeit ihrer engsten Lebenswelt. Die Vorstellung, daß ihre Eltern selbst einmal Kinder gewesen sind und daß sie auch einmal sterben können, ist für sie keine Gewißheit, sondern reine Theorie. Alle diese Qualitäten der Wahrnehmung beinhalten nun eine ganz bestimmte Daseinsform, in der wir, wenn wir wahrnehmen, uns in einer Welt, die wir als real erleben (sonst hätten wir keine Wahrnehmungen!), wiederfinden. Würde auch nur eine dieser Qualitäten fehlen, könnte man zwar immer noch von intentionalen Zuständen, von Erlebnissen sprechen, von Erinnerungen, Träumen, Phantasien etc., aber nicht mehr von Wahrnehmungen. Auch die anderen phänomenalen Zustände beinhalten zwar alle die Notwendigkeit eines sie begleitenden Erlebnissubjektes und vermitteln einem so die cartesianische Existenzgewißheit, aber ihnen fehlen immer einige der anderen notwendigen Wahrnehmungsqualitäten, so daß bei ihnen von keiner Wahrnehmung gesprochen werden kann. Wenn ich z.B. in der Erinnerung oder in der Phantasie meinen Gegenstand ganz nach Belieben herbeirufe und betrachte, so fehlt ihm die Qualität der Kontinuität und Unabhängigkeit, und ich selbst, als Subjekt meiner Phantasie, bin es, der das Erlebnis verursacht. Ich bin das Ich des Erlebnisses und nicht das Mich der Wahrnehmung: „Man kann nicht sehen, was man will, und wenn etwas gegenwärtig ist, weil man es will, dann sieht man es nicht.“ (Vgl. Autopsie, S.176) Vollends der traumlose Tiefschlaf ‚unterbricht‘ sogar die Existenzgewißheit des Wachbewußtseins, so daß in ihm mit dem Wahrnehmungssubjekt die Welt aufhört zu sein. (Vgl. „Unterbrechung“ und „Pause“, in: Autopsie, S.197ff.) Aber in keinem dieser verschiedenen Zustände unseres Bewußtseins gibt es irgendwo einen Beleg dafür, daß die Wahrnehmung selbst nichts Wirkliches sei und wir uns deshalb ihrer Gewißheiten nicht mehr gewiß sein dürften. Wollte man Wahrnehmungen wie Metzinger lediglich als Simulationen oder als Illusionen kennzeichnen, so hätten wir es eben schlicht und einfach nicht mehr mit Wahrnehmungen zu tun, und wir würden auch gar nicht mehr über Wahrnehmungen reden, sondern über etwas ganz anderes. Aus all dem bisher Gesagten geht also hervor, daß es ein Wahrnehmungssubjekt nur gibt, so lange wir wahrnehmen. Wenn wir nicht mehr wahrnehmen wie z.B. im Schlaf, gibt es auch kein Wahrnehmungssubjekt. Es macht auch keinen Sinn zu fragen, wo es denn ist, wenn wir schlafen. Weder im Tiefschlaf noch beim Träumen ‚habe‘ ich Wahrnehmungen. Also macht es auch keinen Sinn nach einem ‚Ich‘ zu suchen, das im Schlaf keine Wahrnehmungen hat, denn als Wahrnehmungssubjekt kann es nur ‚da‘ sein, wenn es wahrnimmt. Im Schlaf gibt es allenfalls ein Traumsubjekt, das es dann auch nur so lange ‚gibt‘, wie es träumt, also nur ‚im‘ Traum und nur dort und sonst nirgendwo. Wiesing macht in seinem Buch über das „Mich der Wahrnehmung“ klar, daß es aus phänomenologischer Perspektive nur Sinn macht, von einem ‚Ich‘ im Bezug auf seine jeweiligen phänomenalen Zustände zu sprechen. Es ist eins mit ihnen, bildet also mit ihnen eine Teil-Ganzes-Beziehung, und es kann nicht in eine räumliche Relation seinen Erlebnissen gegenüber gestellt werden, als handele es sich um verschiedene Entitä- ten. Die Teil-Ganzes-Beziehung ist ein Moment aller phänomenalen Zustände, und darin unterscheidet sich die Wahrnehmung nicht. Egal, ob ich nun phantasiere oder einkaufen gehe, immer bilden Erlebnissubjekt und Erlebnisgegenstand ein spannungsvolles Ganzes, zwei aufeinander bezogene Pole und kein räumliches Verhältnis. Wiesing bringt das Beispiel vom Torwart und der Fußballmannschaft, bei denen es sich auch nicht sinnvoll fragen läßt, ob der Torwart einen direkten oder einen indirekten Zugang zur Mannschaft hat. (Vgl. Autopsie, S.153f.) Ein anderes Beispiel erinnert an Metzinger („Ego-Tunnel“) mit seiner Behauptung, das Selbstbewußtsein habe keinen direkten ‚Zugang‘ zum Körper. Schon die Metapher vom Tunnel arbeitet mit einer räumlichen Beziehung zwischen Ich und Welt. Wiesing fragt schlicht und entwaffnend: „Hat meine Leber einen mittelbaren oder unmittelbaren Zugang zu meinem Körper?“ (Autopsie, S.154) Die Wahrnehmung unterscheidet sich nun von allen anderen phänomenalen Zuständen dadurch, daß in ihr das Erlebnissubjekt nicht Herr über das Erlebnis ist, sondern: „Das wahrgenommene Ding herrscht über den Wahrnehmenden und die Wahrnehmung.“ (Autopsie, S.116) Das Erleben widerfährt dem Wahrnehmungssubjekt, es stößt ihm zu, weshalb Wiesing eben nicht vom ‚Ich‘, sondern vom ‚Mich‘ der Wahrnehmung spricht. Die Wahrnehmung übt einen Zwang aus auf das Wahrnehmungssubjekt und involviert es in ein Weltgeschehen: „Die Wahrnehmung zwingt den Wahrnehmenden in eine irdische Situation, die sich dadurch auszeichnet, daß er dort in ein perspektivisches Verhältnis zu den dort mit ihm anwesenden Dingen eintritt.“ (Autopsie, S.156) So zwingt also die Wahrnehmung dem Wahrnehmungssubjekt eine Daseinsform auf, und es ist nicht frei, die Welt, die es wahrnimmt und in der es wahrnimmt, für eine bloße Illusion zu halten, weil es sie dann eben nicht mehr wahrnehmen würde. (Vgl. Autopsie, S.172f.) Demnächst mehr ... Kommentar (Detlef Zöllner – 22.03.2011): Wiesing spricht bei der Beschreibung des Primats des Wahrnehmungssubjekts von der irreleitenden Vorstellung einer räumlichen Beziehung zwischen dem Wahrnehmungssubjekt und der Welt, in der es der Welt gegenübergestellt wird, so daß die Frage nach dem möglichen Zugang dieses Subjekts zur Welt aufgeworfen wird. Er kritisiert diese Vorstellung, weil sie dazu führt, daß das Wahrnehmungssubjekt bei der Suche nach diesem ‚Zugang‘ immer weiter von der Welt entfernt wird, bis es schließlich ganz verschwindet. Bei Plessner gehört nun diese Gegenüberstellung von Mensch und Welt zur exzentrischen Positionalität, die in seiner Anthropologie das Wesensmerkmal des Menschen im Vergleich zu den Tieren bildet. Stehen deshalb Plessner und Wiesing im Widerspruch zueinander? Nicht unbedingt. Denn Plessner beschreibt die exzentrische Positionalität des Menschen, also die Gleichzeitigkeit von Peripherie und Mitte, nicht als räumliche Beziehung. Die 'Mitte' des menschlichen Subjekts ist eine ortlose, im Nirgendwo des Körperleibs. Und die Peripherieposition, als weltliches Objekt unter anderen Objekten, beschreibt zwar eine räumliche Dimension, aber im Sinne des „Mich“, also im Sinne von Wiesings Primat der Wahrnehmung. Plessners exzentrische Positionierung des Menschen sich selbst und der Welt gegenüber und Wiesings Kritik am Primat des Wahrnehmungssubjekts als Gegenüberstellung von Ich und Welt müssen sich also nicht widersprechen. Kommentar (Nico Liebe – 26.01.2013): Auch Wiesing benutzt (scheinbar allerdings unreflektiert) Modelle und Denkfiguren zur Veranschaulichung eines nicht direkt erfahrbaren Zusammenhangs: die „Teil-Ganzes-Beziehung“ ist selbst auch ein Bild bzw. ein Modell! Und er muss es auch, denn selbst phänomenologische Betrachtungen brauchen (private) Theorien und Modelle, wenn die Erfahrungen (bzw. das Erleben) der Wahrnehmung im Rahmen einer (sprachlichen) Reflexion verbalisiert werden! Kommentar (Detlef Zöllner – 27.01.2013): Da gebe ich Ihnen völlig Recht. Vielleicht kann man Wiesings Ablehnung von Modellen darauf zurückführen, daß er es ablehnt, sich auf Kosten der eigenen Wahrnehmung/Erfahrung der Autorität von Modellen zu beugen. Natürlich sind Modelle dort gut, wo sie das selber-Denken unterstützen und anregen. Oft hindern sie uns aber daran, selber hinzusehen (Autopsie). Rousseau hat schon in seinem „Emile“ eine ganz ähnliche Kritik geäußert.