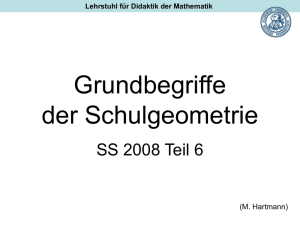MUSEUM | DIFFERENZ | VIELFALT
Werbung

Schreib- und Denk-Werkstatt Museologie Drosendorf | 28. Mai – 3. Juni 2007 MUSEUM | DIFFERENZ | VIELFALT Roswitha Muttenthaler In der kritischen wissenschaftlichen Reflexion des Museums wurde es als "kultureller Schlüsselort"1 bezeichnet, als Ort "umkämpfter Identitäten"2 oder "zivilisierender Rituale"3, es wurden Forderungen erhoben wie die nach einer "Schule des Befremdens"4 oder einem "Laboratorium konkurrierender Sinnstiftungsentwürfe"5. Gemeinsam ist diesem Nachdenken, dass das Museum als zentrale Instanz zur Verhandlung von Repräsentationen erkannt wird. Dass Museen als Orte der Identitätsstiftung und Repräsentation gelten, als Orte, in denen Gedächtnisbeziehungen hergestellt werden,6 als Orte, in denen sich Gesellschaften ihrer sozialen und kulturellen Praktiken versichern, inkludiert zentrale Fragen nach der Definitions- und Handlungsmacht. Welche Geschichten, Bilder und Deutungen auch immer in Museen und Ausstellungen angeboten werden, es sind auch Erzählungen und Projektionen zu Männern und Frauen bzw. deren Verhältnis zueinander, zu "Eigenem" und "Anderem" etc. So einfach diese Einsicht ist, Differenzkategorien wie Gender, Race und Class werden in der Praxis noch immer wenig mitreflektiert. Wie sind Forderungen nach kultureller Diversität in die musealen Praktiken des Sammelns, Dokumentierens, Forschens, Ausstellens und Vermittelns zu verankern? Wer ist ermächtigt, wie auf sich und andere zu schauen? Museen und Ausstellungen sind längst nicht mehr Orte, wo etwa die adäquate Repräsentation von Frauen oder ethnischen Gruppen mit politischem Aktionismus eingefordert wird. Mit Paradigmenwechseln wie der Verlagerung des Fokus von der Kategorie Frauen auf das Geschlechterverhältnis oder der Überschneidung verschiedener Differenzkategorien erweiterten sich die Fragestellungen, vielfältige Differenzen gerieten in den Blick. Welche Möglichkeiten und Strategien gibt es nun- Abb. 1 Installation von Nasen, Ausstellung "Fremdkörper – fremde Körper" 2000. Hygienemuseum Dresden. Foto: DHMD mehr, die Wahrnehmung von Doing Gender in der visuellen Kultur zu sensibilisieren und die in Museen eingeschriebenen Diskurse lesbar zu machen? Wie können mit aktuellen Diskursen zu Alterität und kultureller Diversität museale Praktiken im Hinblick auf die Produktionsmacht von Zuschreibungen und kulturellen Ausgrenzungen befragt und unterlaufen werden? Welche Konzeptionen für gender- und diversitätssensibles Sammeln und Ausstellen können entwickelt werden? Darüber könnte in der diesjährigen Denk- und Schreibwerkstatt nachgedacht und diskutiert werden. Mit der Frage nach der Inanspruchnahme des Museums als Repräsentationsort für Identitätsbildungswünsche eröffnet sich auch das Spannungsfeld von eigen und fremd, das als ein konstituierendes Element des Museums gesehen werden kann, sowohl in museologischer Hinsicht als auch auf erkenntnistheoretischer und gesellschaftspolitischer Ebene. So konstatierte Gottfried Korff: "Der, die, das Fremde ist Gegenstand des Museums."7 Das im Museum gesammelte und gezeigte Objekt ist als musealisiertes per se fern gerückt und fremd, da es sich um Dinge handelt, die aus räumlich und/oder zeitlich entfernten Welten stammen und nicht mehr gebraucht werden.8 Dies meint Ethnographica ebenso wie den Schreibkiel oder die Rauchküche. So steht bereits im Kern des Museums die Erfahrung mit dem Fernen und Fremden. Im Museum wird nun das ehemals Lebensweltlich-vertraute durch die Musealisierung nicht nur fremd gemacht, sondern andererseits dieses Fremde durch die sinnliche Erlebbarkeit in der Ausstellung nah gerückt, zur mentalen Fremdheit kommt die physische Nähe des Objektes. Aus diesem Spannungsverhältnis leiten sich Staunen und Neugierde her und damit die Möglichkeit einer sinnlichen Erkenntnis.9 Die Herausforderung für jedes Museum besteht nun darin, welche museums- und ausstellungswirksamen Impulse im Umgang mit diesem Spannungsverhältnis freigesetzt werden. Ergreift es die Chance, Identitäts- und Fremdheitserfahrung in ihrer Verflechtung offen zu Abb. 2 Ausstellung "Heimatfabrik", Expo Schweiz 2002. Foto: Herbert Posch halten oder domestiziert es – wie Gottfried Korff formuliert – Alteritäten zu "Fluchtwelten, die das Fremde, das historisch überholte, konträr-faszinativ zur Befriedigung der Sehnsucht nach regionaler Identität einsetzen."10 Damit stellt sich die Frage, mit welchen Zielen und in welcher Weise Museen den Konstituierungsprozess von eigen und fremd wahrnehmen. Identität und Differenz sind eine zentrale Frage politischen Handelns, gesellschaftlicher wie kultureller Selbstkon- 2 zeptionen und Praktiken. Die Auseinandersetzung über eigen und fremd beruht auf kollektiven Konstruktionen von (Geschichte als) Gedächtnis. Museen bilden als Kulturinstitutionen einen Rahmen dafür, denn "Identitäten werden in und durch Kultur produziert, konsumiert und reguliert, indem Bedeutungen durch symbolische Repräsentationssysteme geschaffen werden."11 Da Identitätskonzepte der Logik der Moderne verpflichtet sind, die besagt, dass die Konstruktion von Identität der Differenz bedarf,12 sind Ausschlüsse programmiert. Obgleich diesem Problem nicht zu entkommen ist, ist es entscheidend, inwiefern ein Museum reflektiert, dass es auf Differenzierungen entlang von Kategorien wie Gender, Race und Class gründet. Diese sind für die Art und Weise zentral, wie Museen ihr Selbstverständnis begründen, ihre Räume, Sammlungen und Ausstellungen organisieren. Werden diese Kategorien als historische und damit der Veränderung unterliegende Konstrukte und die Grenzen als fließend erkannt, eröffnet sich das Potential, individuelle wie kollektive Prozesse von Sinnstiftungen im Rahmen jeweiliger gesellschaftlicher Verfasstheiten zu reflektieren.13 In diesem Sinn gilt es für Museen, nicht die Fiktion universeller Identitäten und den Anspruch auf neutrale Allgemeingültigkeit aufrechtzuerhalten, sondern Raum für Auseinandersetzung um konkurrierende Entwürfe zu geben. Gefordert sind nicht mehr vereinheitlichende Spiegelungen kollektiver Identität, sondern differenzierende Repräsentationen. Repräsentationen werden als kollektive Vorstellungen, als soziale Formen und als vergegenwärtigende Repräsentanten verstanden. Wesentliche Eigenschaften von "Repräsentationen" sind unter anderem die Wirkung im öffentlichen Raum, die Macht der Oberfläche und der kollektive Repräsentationscharakter. Diese galt es zu analysieren. In den 1980er Jahren wurde der Begriff Repräsentation zu einem Schlüsselbegriff, dies ging mit der Kritik an der Repräsentation einher, die im Wesentlichen eine Machtkritik ist: also wer und was ist wie repräsentiert, was sind die Effekte von Repräsentationen. Aufgrund der Erkenntnis, dass es unterschiedliche, Abb. 3 Ausstellungsmöbel in Form einer Frau, Ausstellung "Aufmüpfig & angepasst" 1998. Foto: Roswitha Muttenthaler miteinander verschränkte und aufeinander bezogene Repräsentationsregimes gibt, verloren historische "Meistererzählungen" ihren Sinn. Zwar gab es den Impuls, der Repräsentation zu entkommen, doch auch die Erkenntnis, dass ein Entkommen nicht gelingen kann. Wenn es kein Entkommen aus der Repräsentation gibt, so ist sie doch der Machtkritik verpflichtet. Stuart Hall behauptet, dass jedes Repräsentationssystem ein Machtsystem sei. Er meint damit ein System, das Unmittelbarkeit, Präsenz und Wahrheit als seine Gründe in Anspruch nimmt.14 Dekonstruktivismus, Poststruk- 3 turalismus, Diskursanalyse und Cultural Studies bemühten sich, das Denken der Repräsentation zu demystifizieren. In der dekonstruktivistischen Diskursanalyse wird Repräsentation folgendermaßen beschrieben: Repräsentation ist ein Vermittlungsvorgang, der durch Verweisen und Stellvertreten funktioniert, und Repräsentation ist ein zentrales Merkmal sprachlich-symbolischer Prozesse. Repräsentation beschreibt den Prozess der Sinnkonstituierung über Zeichen, die in Rahmen von Codes bzw. Systemen Bedeutung gewinnen. Poststrukturalistische Theorien verweisen auf die prinzipiell instabile Beziehung zwischen Zeichen und Objekt. Gleichzeitig hört das Subjekt auf, Ursprung, Zentrum und Herr seiner Repräsentationen zu sein. Das Vermögen der Sprache, Erfahrungen, Ideen und Intentionen zum Ausdruck zu bringen, ist damit grundlegend in Frage gestellt. Repräsentation ist nicht länger Darstellung, Vorstellung oder Vergegenwärtigung von etwas, das der Darstellung vorgängig wäre, sondern verweist auf die komplexen Prozesse der Realitätskonstruktion.15 DAS MUSEUM ALS UMKÄMPFTES FELD DES SYMBOLISCHEN Zum Museum als Ort der Repräsentation gibt es – angeregt durch verschiedene Disziplinen – einen breiten Diskurs. Seit den 1980er Jahren griff etwa die Geschichtswissenschaft den Begriff Repräsentation auf. Es wurde den Beziehungen zwischen materiellen Erzeugnissen und ihrem Verweischarakter sowie ihrer symbolisch-sinnhaften Struktur nachgegangen. Hier kam auch das Museum ins Spiel. Hinterfragt wurde der Status und interpretatorische Wert von Quellen, zu denen auch Objekte zählen. In den Blick genommen wurde zum einen die Funktion von Quellen als "Repräsentanz" von historischen Momenten und von repräsentatorischen Regimes, die ihre Aufzeichnung konstituierten. Zum anderen wurde den historischen Funktionen von Relikten nachgegangen, insbesondere jenen, Abb. 4 Inszenierung zu "Der Schwarze", Ausstellung "Fremdkörper – fremde Körper". Hygienemuseum Dresden 2000. Foto: DHMD die "auf Wirkung" bei der Produktion von Sinn, Handlung oder Vorstellungen angelegt sind. Ins Zentrum rückte die Macht von Quellen als vermittelnde "Repräsentationen" zwischen Strukturen und Vorstellungen. Auch die Ethnologie fokussierte seit den 1980er Jahren die Problematik der Repräsentation, beschäftigte sich mit den symbolischen und vor allem sprachlichen Darstel- 4 lungsweisen kultureller Selbst- und Fremdbeschreibung. Vor allem in USamerikanischen Publikationen wurden auch Fragen der Repräsentation von kolonisierten Völkern und Minderheiten in Museen diskutiert, etwa die Autorisierung von Ausstellungen, die Herkunft und die heutigen Eigentümer von Museumsobjekten, die Anerkennung der Forschungsobjekte als Subjekte, die Partizipation von communities, die Problematik von Ausgrenzung und Integration durch Repräsentationsstrategien. "Die Herstellung von Bedeutung in der musealen Klassifizierung und Präsentation wird als adäquate Repräsentation mystifiziert. Zeit und Ordnung der Sammlung löschen die konkrete gesellschaftliche Arbeit ihrer Erzeugung aus."16 Ein- und Ausschlussverfahren sind also für die Institution Museum konstitutiv. Museen schaffen demnach nicht nur Bilder, die den gesellschaftlichen Normen und Werten entsprechen, sondern "sprechen" auch über Verborgenes. Denn sie repräsentieren nicht nur das, was zu sehen ist, sondern auch, was dem öffentlichen Diskurs und der Wahrnehmung entzogen werden soll und damit ausgeschlossen wird.17 Museen sind ein Teil der kulturellen Praktiken, in denen sich Repräsentationsbedürfnisse, individuelle und kollektive Narrationen sowie gesellschaftliche Diskurse und Wissensformen manifestieren. Sie sind Orte von hohem Prestige, an denen die Frage, welche Personen und Gruppen wie dargestellt sind, von besonderer gesellschaftlicher Relevanz ist. Bestimmte gesellschaftliche Gruppen oder Kulturen wurden von Repräsentationspraktiken entweder ausgeschlossen oder als Andere markiert, wie beispielsweise außereuropäische Kulturen in den Völkerkundemuseen und Völkerschauen. Als Repräsentationsorte von gesellschaftlichen Eliten wurden Museen daher immer wieder für unterschiedliche marginalisierte Gruppen zu Kristallisationspunkten in der Auseinandersetzung um kulturelles und soziales Kapital. Vor dem Hintergrund kollektiver Identitätspolitiken wurde das Feld des Sehens zu einem umkämpften Schauplatz, wo es darum ging, instabile Normen andauernd und vehement zu verfestigen. Seit den 1970er Jahren war die Institution Museum in zweifacher Hinsicht in den Blickpunkt der Kritik geraten: Zum einen rekurrierte die Kultur- und Museumspolitik zunehmend auf den demokratischen Anspruch, dass Museen der gesamten Gesellschaft verpflichtete Orte des kulturellen Erbes seien. Zum anderen stell- 5 Abb. 5 Inszenierung "Männer(blicke)", Ausstellung "Reiz & Scham" Textilmuseum Ratingen 2005. Foto: Roswitha Muttenthaler ten in Museen Marginalisierte, wie Frauen, ethnische Minderheiten und einige soziale Schichten die Forderung nach eigenbestimmten Repräsentationen an die bestehenden Institutionen, oder sie versuchten, eigene Museumsräume zu schaffen. Museen stützen nicht nur durch Einschluss- und Ausschlussverfahren Herrschaftsdiskurse, auch durch die Art, wie Inhalte präsentiert werden, manifestieren sich gängige Konstruktionen der Geschlechterverhältnisse und im Umgang mit unterschiedlichen Ethnien sowie marginalisierten sozialen Gruppen.18 Im Unterschied zu museal vernachlässigten sozialen Schichten – wie ArbeiterInnen, die bis in die 1970er Jahre kaum in Museen vertreten waren, oder Erwerbslose oder MigrantInnen, die bis heute in den meisten Museen fehlen – stellte sich die Situation bei Frauen und ethnischen Gruppen etwas anders dar. Denn insbesondere Kunstmuseen waren immer schon voll von Frauenbildern ebenso wie die ethnographischen Museen voll von Darstellungen fremder Kulturen waren. Die Frage war hier vielmehr die nach der (Verfügungs-)Macht über die Bildproduktionen und Narrative. KULTURELLE DIVERSITÄT In der Präsentation der Anderen können etwa zwei Darstellungsverfahren wirksam werden: Je nachdem, ob die Herstellung von Differenz oder Ähnlichkeit im Vordergrund steht, kann von exotisierenden oder assimilierenden Ausstellungsstrategien gesprochen werden.19 Museen tendieren dazu, das Besondere zu betonen, also das, was sich von unserer Kultur oder unserem Lebensalltag unterscheidet. So wird bei der Präsentation nichtwestlicher Gesellschaften oftmals der Schwerpunkt auf traditionelle Lebensweisen gerichtet, auch wenn das dem Großteil der Bevölkerung schon lange nicht mehr entspricht. Aber auch der Versuch, Ähnlichkeiten in den kulturellen Ausdrucksformen herauszuarbeiten, kann problematisch sein. Zum Beispiel wenn nichtwestliche traditionelle Artefakte wie moderne Kunst präsentiert Abb. 6 Detail der Vitrine "Plains", Museum für Völkerkunde Wien 2004. Foto: Roswitha Muttenthaler werden. Denn diese "Gleichstellung" war nur um den Preis der Entkontextualisierung und der Reduktion auf rein formale Kriterien möglich. Die Ähnlichkeit von Motiven und Formen wurde vor allem darauf zurückgeführt, dass die künstlerische Produktion nichtwestlicher Kulturen vielen KünstlerInnen der Moderne als Inspirationsquelle diente. Damit wurde auch die Präsentationsweise gerechtfertigt: da ethnografische 6 Objekte die künstlerische Produktion der Moderne anregten und bereicherten, sei es legitim sie wie moderne Kunst auszustellen.20 Dass es sich bei der Einordnung der Objekte in ein spezifisch (westliches) kulturelles Raster auch um eine Vereinnahmung handelt, gilt es aber mitzureflektieren. Einen breiten Diskurs zur Frage der Repräsentation nichtwestlicher Kulturen in Museen gibt es seit ca. 30 Jahren vor allem im anglo-amerikanischen Raum, wo auch von diversen ethnischen Bevölkerungsgruppen dementsprechende Forderungen an Museen gestellt wurden. Unter anderem wurden partizipatorische Angebote entwickelt, um Communities in die Repräsentation einzubinden. Museumsinhalte von VertreterInnen der betroffenen Bevölkerungsgruppen bearbeiten zu lassen, garantiert zwar nicht, dass die erzählten Geschichten "authentischer", im Sinne von näher an der "Wahrheit" sind, aber dadurch können weitere, vielleicht gegenläufige Perspektiven eingeführt werden. Die Innensicht einer Problematik gewährleistet einerseits Erkenntnisse und Sensibilitäten, die Außenstehenden oftmals fehlen, andererseits kann das Involviertsein auch den Blick verstellen. Da jedoch alle an der Geschichtserzählung und am Musealisierungsprozess beteiligten AkteurInnen von ihren kulturellen Denkmustern geprägt sind, besteht die eigentliche Herausforderung nicht so sehr darin, die "Wahrheit" herauszufinden, sondern in der multiperspektivischen Repräsentation von kulturellen Praktiken, Geschichtsbildern und Wissenschaftskonzepten. Voraussetzung dafür ist jedoch, die "Forschungsobjekte" als Subjekte anzuerkennen und Museen als aktiven Teil eines Prozesses zu sehen, kollektive Konstruktionen von Kultur, Identität, Geschichte und Gedächtnis auszuhandeln, in einen aktuellen Austausch mit ihrem gegenwärtigen Publikum einzutreten. GENDER Die Kritik der Repräsentation bildete seit den 1980er Jahren auch ein zentrales Anliegen feministischer Kritik. Stereotype Darstellungen und Repräsentationen von Frauen waren insofern zentrales Thema feministischer Ansätze, als sie lange Zeit als direkter Ausdruck sozialer Realität angesehen wurden. Das Ziel vieler feministischer Initiativen war es daher, eigenbestimmte Bilder zu produzieren, wo Frauen als handelnde Subjekte, als Trägerinnen historischer und kultureller Leistungen gezeigt wurden. Dabei kamen unterschiedliche Strategien und Taktiken zum Einsatz: eine lief darauf hinaus, autonome Orte zu schaffen, um darin frei über Sammelstrategien und Ausstellungspolitik 7 entscheiden zu können. Eine andere bestand darin, die Spielräume innerhalb des Systems zu nutzen und so die Grenzen der Ordnung des Ortes zu verschieben.21 Zur Frage der Repräsentation argumentierte etwa Teresa de Lauretis in den 1980er Jahren, dass das Bild der Frau eine bestimmte Funktion in einem kulturell tradierten Repräsentationssystem zu übernehmen hat. Die Repräsentation der Frau als Bild umfasst die Frau als Objekt, auf das geschaut wird, die Frau als Bild der Schönheit, die Repräsentation des weiblichen Körpers als Ort der Sexualität und des visuellen Vergnügens. Dieser imaginierten Weiblichkeit kommt dabei die zentrale Aufgabe zu, bestimmte Bedeutungen zu repräsentieren. Auch Elisabeth Bronfen konstatierte: "Der Wert der Abb. 8 Detail aus Inszenierung des Autos "Aurelia", Autostadt Wolfsburg 2002. Foto: Herbert Posch Frau im Netz der kulturellen Repräsentationen besteht darin, gleichsam Telos und Ursprung des männlichen Begehrens und des männlichen Drängens nach Repräsentation zu sein, gleichsam Objekt und Zeichen seiner Kultur und seiner Kreativität."22 De Lauretis schlägt vor, zwischen Frau (woman) und Frauen (women) zu unterscheiden. ‚Die unterschiedlichsten Frau’ stellt eine Referenzpunkte Konstruktion des dar, gesamten die die westlichen Repräsentationssystems durchdringt, und ‚die Frau’ als das Andere markiert. Dem Begriff ‚Frauen’ kommt dagegen eine reale historische und physische Existenz zu, die allerdings nicht außerhalb der kulturellen Diskurse definiert werden kann. Das Besondere aber ist, dass ‚die Frau’ als das Andere für etwas einsteht, quasi also eine Leerstelle der kulturellen Fiktionen selbst ist, auf die beliebige Attribute projiziert und appliziert werden können. Repräsentationen der Frau können oft als Spiegel und Projektionsfläche für den sie erschaffenden Mann dienen. Als Imaginationen bringen diese Repräsentationen seine Macht, Kreativität und Kulturprodukte stellvertretend zum Ausdruck. Als Repräsentationsbild ist die Frau anwesend, als repräsentiertes Subjekt und Produzentin ist sie abwesend.23 Dies wurde auch für museale Repräsentationen festgestellt. Wegweisend beschrieb Viktoria Schmidt-Linsenhoff, wie Frauen in Abb. 7 Inszenierung Alma Mahler-Werfel, Ausstellung "Aufmüpfig & angepasst" 1998. Foto: Roswitha Muttenthaler Museen und Ausstellungen als handelnde Subjekte abwesend seien, doch gleichzeitig herrschende, von männlichen Projektionen dominierte Vorstellungen von Frauen im Objektstatus in den Repräsentationen verfügbar gemacht werden.24 Auch Irit Rogoff analysierte das Museum als Ort hegemonialer Kultur, indem sie Verfahrensweisen und 8 Instrumente der musealen Bedeutungsproduktion in den Blick nahm. Dabei hinterfragte sie auch, in welcher Form und Funktion bisher nicht legitime Erzählungen – wie die von Frauen und Alltagskultur – in die Museen Eingang finden können. An Hand einiger Ausstellungen, die die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs aus dem Blickwinkel der Zivilbevölkerung zeigten, problematisierte sie, dass nur das Alltägliche thematisiert wurde und der politische Macht- und Gewaltapparat des NS-Regimes hier ausgespart blieb. Indem vor allem die Lebensrealität von Frauen ins Zentrum gerückt wurde, erhielten diese Repräsentationen eine integrative Funktion: Rogoff bezeichnete dies als Feminisierungsprozess, zum einen wegen der Themen- und Objektwahl. Zum anderen verweist der Begriff Feminisierung auf ein "Darstellungssystem, das anhand binärer Oppositionen von starken und schwachen Zeichen funktioniert".25 In dieser traditionellen binären Logik der Symbolisierungen wird dem schwachen Zeichen der Begriff des Weiblichen zugeordnet. Da die Zivilbevölkerung und vor allem Frauen die Narrative zum Zweiten Weltkrieg tragen, konnten teilnehmende Reaktionen und Identifikationsprozesse eines breiten Publikums gefördert werden. Indem jedoch die TäterInnen und die politisch Verantwortlichen aus dem Blick geraten, können sich alle als Opfer etwa des Bombenkriegs der Alliierten und der materiellen Notlage fühlen. Problematisch dabei ist, dass es durch dieses Instrument der "Feminisierung" zu einer Nivellierung des Opferbegriffes kommen kann.26 Seit den 1980er Jahren wurde – mit der zunehmenden Infragestellung des kohärenten Subjekts Frau – auch die alleinige Konzentration auf die Repräsentation der Frau oder von Frauen kritisiert: Da in den meisten Frauenausstellungen vor allem die verschütteten Leistungen von Frauen oder Zeugnisse ihres Alltagslebens gezeigt werden sollten, würde der Referent Mann als Bezugspunkt in den Geschlechterbeziehungen vernachlässigt. Durch den Fokus auf die Frauengeschichte würde das Wissen um die Geschlechterverhältnisse vorausgesetzt und damit geriete die sozial bedingte männliche Dominanz aus dem unmittelbaren Blick. Rückblickend betrachtet leisteten auch gesellschaftskritische Ausstellungen zur Frauengeschichte und -kultur ungeachtet ihrer politischen und emanzipatorischen Bedeutung einen Beitrag, dass das Geschlecht vor allem dann ins Spiel kam, wenn es 9 Abb. 9 Top-Ten der Männerunterhosen, Ausstellung "Reiz & Scham" Textilmuseum Ratingen 2005. Foto: Roswitha Muttenthaler sich um Frauen handelte. Mit dem Paradigmenwechsel von der Kategorie Frauen zur Kategorie gender war verbunden, Männer ebenso in ihrer Geschlechtlichkeit zu thematisieren. Indem die Geschlechterverhältnisse, die unterschiedlichen Lebenschancen und -bedingungen von Frauen und Männern anschaulich gemacht wurden, konnten auch die patriarchalen Strukturen sinnfälliger werden. In dem Bewusstsein, dass es kein völliges Entkommen aus den gegebenen Denk-, Macht- und Handlungsstrukturen gibt, verlagerte sich der Anspruch neuerer feministischer Theorien dahingehend, dass es nur innerhalb des Systems zu Verschiebungen der Grenzen kommen kann. Nach Judith Butler, gibt es keine Klarheit darüber, was Frauen oder Männer konstituiert oder konstituieren sollte. Weder die soziale noch die biologische Geschlechtsidentität seien die Widerspiegelung eines "natürlichen" Zustandes, vielmehr handelt es sich dabei um Imitationen, die das Original, das sie zu imitieren scheinen, allererst performativ im Sinne eines wiederholenden Prozesses hervorbringen.27 Jeder Repräsentation wohnt ein performatives Moment inne. Mit den Gender Studies wurden in Anlehnung an poststrukturalistische und dekonstruktivistische Ansätze der Repräsentationsbegriff weiterentwickelt, es wird nicht mehr von fixierten sondern variablen und symbolischen Repräsentations-Positionen ausgegangen. BLICKE VERSCHIEBEN – ERZÄHLUNGEN EINBRINGEN Die Auseinandersetzung mit hegemonialen Museums- und Ausstellungsstrategien erfolgte nicht nur diskursiv. Erkenntnisse aus der wissenschaftlich-analytischen Beschäftigung manifestieren sich seit einigen Jahren nicht allein in schriftlicher Form, sondern finden auch ausstellungsgemäße Umsetzungen: Mit den Mittel der Ausstellung werden Praktiken von Museen und Ausstellungen reflektiert. In Bezug auf Alterität und kulturelle Diversität ist etwa das Musée d’Ethnographie de Neuchâtel zu erwähnen, das den eigenen Blick auf die Anderen mitdenkt. In den Ausstellungen ist es Konzept, seine Zugänge, insbesondere das Verhältnis von Eigenem und Anderem zu reflektieren. So wurden in der Ausstellung "Le Musée cannibale" 2002 die musealen Praktiken, das Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen, zum Thema gemacht, indem das museale Aneignen und Aufbereiten von Objekten in unmittelbare Beziehung zum Einverleiben im wahrsten Sinne des Wortes, also dem Essen, gestellt wurden. Eine Fragestellung, die insbesondere bei einem ethnografischen Museum von besonderer Brisanz ist. Mit der Metapher des Verzehrens sollte die Faszination des "exotischen Festmahls" ebenso wie der Gewaltaspekt im Ausstellen fremder Kulturen den oftmals 10 "nach Alterität hungernden" BesucherInnen anschaulich gemacht werden.28 So wurde unter dem Titel "Der Geschmack der anderen" mit der Inszenierung eines Arbeitstisches, der dem Inventarisieren, Dokumentieren und Erforschen von Ethnographica diente, zunächst die Rolle der Sammler reflektiert. Dem folgten Abschnitte, die sich der Praxis der Bevorratung und Aufbereitung widmeten, wobei die Museumspraktiken auch visuell in Analogie zur Essenzubereitung gesetzt wurden. Unter dem Titel "Der Kühlraum" waren die Museumsdepots als Vorratskammern zu lesen. Zu sehen waren Regale vollgefüllt mit Objekten sowie ein Kühlschrank und eine Kühltruhe, in denen Objekte verpackt in Gläsern oder wie Gefriergut in Plastik- und Aluminiumbehältnissen lagen. In einer Küchen-Inszenierung übertitelt mit "Blackbox" wurde das Ausstellungsmachen mit dem Vorgang des Kochens gleichgesetzt. In Form von Rezepten mit den Rubriken Zutaten, Zubereitung etc. wurden Konzeptionen bekannter Ausstellungsmacher und Ethnografen charakterisiert oder gar persifliert: "Association poétique á la Harald Szeemann" oder "Sacralisation à la Jacques Kerchache". Im Ambiente eines großen Speisesaals – "Der Lebemann" benannt und mit roten Abb. 10 Gedeckter Tisch, Ausstellung "Le musée cannibale" Musée d'ethnographie Neuchâtel, 2002. Foto: MEN Wandtapeten, Lustern, goldgerahmten Abbildungen, Spiegeln, festlich gedeckten Tischen ausgestattet sowie erfüllt von Speisesaalgeräuschen – wurde ein Zusammenhang zwischen dem Verzehren von Speisen und dem Rezipieren von Ausstellungen hergestellt. Die stark vergrößerten Abbildungen an den Wänden zeigten kannibalistische Szenen, die von Weißen im 19. Jahrhundert angefertigt worden waren. Zu den als Speisen vorgesetzten Objekten wurden den BesucherInnen in Form von Menukarten auch Beschreibungen des Anderen aufgetischt – der edle, kunstfertige oder primitive Wilde. Zwei Tische boten hingegen Bilder des Eigenen, etwa Stereotype der Schweizer Kultur. Die BesucherInnen konnten das Präsentierte goutieren, es abstoßend – wie die auf Tellern angerichteten Augen –, exotisch oder vertraut finden. Bekanntes wie die Inszenierung Schweizer Klischeebilder erfuhren durch die Kontextualisierung der ste- 11 Abb. 11 Gedeckter Tisch, Ausstellung "Le musée cannibale" Musée d'ethnographie Neuchâtel, 2002. Foto: MEN reotypen Blicke auf die Anderen eine Verfremdung. Plötzlich konnten die vertrauten Bilder ebenso exotisch und kurios anmuten. Ein ähnlicher Effekt wurde im letzten Raum unter dem Titel "Selber Menschenfresser" provoziert. Opferthemen aus Religion und Kultur westlicher und nicht-westlicher Prägung waren dort gegenübergestellt. Im Zentrum der Präsentationen stand die Frage nach der Ähnlichkeit und des Unterschieds, das Verhältnis von Hier und Anderswo, wobei vermeintlich eindeutige Zuweisungen immer wieder irritiert wurden. Von den Beispielen, die sich der Geschlechtsspezifik von Sammlungen und Präsentationen widmeten, sei nur auf zwei verweisen: das Ausstellungsprojekt "Männerwelten Frauenzimmer" 2005 und die Kunstausstellung "vis-à-vis: kleine unterschiede" im Karl Ernst Osthaus Museum in Hagen 1996. Erstere hatte die Form der Intervention in eine bestehende Präsentation - eine Ausstellung in der Ausstellung. Letztere widmete sich der Sammlungsstruktur des Museums und den gängigen Inszenierungen von Frauen- und Männerdarstellungen. "… das eine gegenüber dem anderen zu sehen geben" – unter diesem Motto stand die Kunstausstellung "vis-à-vis: kleine unterschiede" im Karl Ernst Osthaus Museum in Hagen 1996. Dabei betrachtete die Kuratorin Birgit Schulte die Kunstwerke nicht nur unter dem Aspekt des autonomen künstlerischen Schaffens und des kunsthistorischen Kanons, sondern als kulturgeschichtliche Zeugnisse, die Aussagen über die Geschlechterdifferenz transportieren. Bewusst wurde die Aufmerksamkeit nicht nur auf Frauendarstellungen gerichtet, damit nicht Männer als die Norm und Frauen als das Besondere, die Abweichung, die einer eigenen Betrachtung bedürfen, wahrgenommen werden. Dem wollte die Ausstellung entgegenwirken, indem auch Männer in ihrer Geschlechterrolle thematisiert wurden.29 Ziel der Ausstellung war jedoch nicht nur die Gegenüberstellung von Männer- und Frauenbildern, sondern auch die Thematisierung von traditionellen Wahrnehmungsformen und Blicken. Beispielsweise wurden weibliche Aktskulpturen auf unterschiedlich hohen Sockeln so positioniert, dass sie den BetrachterInnen den Rücken zuwandten und sich das Gesäß der Figuren in einer Linie etwa in Augenhöhe der BesucherInnen befand. Mit der Betonung der erotischen Komponente der Rückenansicht wurde die stereotype Pose sich darbietender weiblicher Körper auf den Punkt gebracht. Demgegenüber befanden sich Büsten bedeutender Männer. Doch statt wie gewohnt vereinzelt auf Sockeln wurden sie auf einer niedrigen Palette dicht gedrängt präsentiert. Auf diese Weise büßten sie entindividualisiert Rang und Autorität ein. Während den Köpfen der Blick entzogen wurde, und sie einer "erniedrigenden" Betrachtung ausgeliefert waren, suchten die Frauenakte, das Gesicht zur Wand gewen- 12 det, dem Blick "aktiv" zu entkommen. Auf diese Weise wurde die männlich-aktive Betrachterposition und die weiblich-passive Rolle ironisch unterlaufen.30 Weiters war den montageartigen Zusammenstellungen immer eine Figur beigestellt, die den Blick auf das Präsentierte richtete und so die AusstellungsbesucherInnen in ihrer konventionellen Rezeptionshaltung spiegelte. Indem auf unterschiedliche Weise öffentliche und heimliche, nahe und distanzierte, diskrete und voyeuristische Blicke durch die Anordnung der Objekte und Inszenierungen gezielt eingerichtet wurden, sollten diese auch bewusst gemacht werden.31 Ausgangspunkt für die Intervention "Männerwelten Frauenzimmer" war die Frage, was das Wien Museum als kulturhistorisches und stadtgeschichtliches Museum in seiner Dauerausstellung explizit und implizit an Geschichtskonstruktionen in Hinblick auf die Kategorie Geschlecht anbietet. Welche Bilder und Erzählungen werden zum Geschlechterverhältnis, zu Männern und Frauen vermittelt. Dazu wurde an 5 ausgewählten Punkten eine Ausstellung in die vorhandene Ausstellung gestellt. Das Ziel war, die Effekte sichtbar zu machen, die durch die Auswahl von Themen und Objekten und deren spezifische Präsentation in Bezug auf die Geschlechterbilder entstehen und was ausgeblendet bleibt. Durch die Interventionen sollte ausgetestet werden, welche Möglichkeiten und Verschiebungen sich eröffnen, wenn dem Vorhandenen ein anderer Kontext gegenübergestellt wird. Damit wurden die Verfahrensweisen im Museum selbst thematisiert, also durch welche Präsentationsformen welche Erzählungen gestützt werden. In diesem Sinne waren die Interventionen als Statements zu begreifen. Die Stationen waren als Eingriffe in der Dauerausstellung kenntlich gemacht und arbeiteten in erster Linie mit Exponaten, die im Depot des Wien Museum zu finden waren. Beispielsweise wurde in der so genannten "Grillparzer-Wohnung" die Wohngemeinschaft mit Anna, Katharina und Josephine Fröhlich und deren Beziehungskonstellationen thematisiert, die im Museum völlig ausgeblendet waren. Die Intervention zielte aber nicht darauf, allein die ausgelassenen Frauen in die Erzählung einzubringen, sondern es ging um das Beziehungsgeflecht, die Geschlechterrollen der gewählten Lebensform und so auch um einen neuen, geschlechtersensiblen Blick auf die Person Grillparzer. So wurden um das Grillparzerbild die Bilder der drei Schwestern Fröhlich 13 Abb. 12 Intervention in Grillparzer-Wohnung, "Männerwelten Frauenzimmer", Wien Museum 2005. Foto: Roswitha Muttenthaler so hinzugefügt, dass sie das Grillparzerbild partiell überlagerten, ohne es aber zu verdecken. In den Räumen waren Klanginstallationen zu hören, die überwiegend auf dem Briefverkehr zwischen Grillparzer und den Fröhlich-Schwestern basierten und Einblicke in das Beziehungsgeflecht und das Zusammenleben gaben. Im Wohnzimmer wurde die eingefrorene, stillgestellte Atmosphäre eines Künstlerzimmers durch zwei kleine Eingriffe unterlaufen. Zum einen wurde jener Kasten, der die Verbindungstür zur Fröhlich-Wohnung verstellte, etwas verrückt. Der beleuchtete Spalt zwischen dem Kasten und der Tür stand sowohl für die unterbrochene Beziehung Grillparzers zu Katharina Fröhlich als auch für die Nähe zu den Schwestern durch das gemeinsame Wohnen. Gegenüber wurde ein Ring, ein Geschenk Grillparzers an Katharina Fröhlich, als symbolisches Objekt der Kontinuität gezeigt. Der Ring und der Kasten konnten als gegensätzliche Symbole ihres ambivalenten Verhältnis aufgefasst werden: Steht der Ring für Verbundenheit, sorgt der Kasten für Abstand. Als Abschluss wurde außerhalb der Wohnräume nicht nur das Leben der Schwestern Fröhlich, die ledig blieben und sich ihren Lebensunterhalt durch Musik verdienten, gezeigt, sondern es wurden auch alle Objekte aus dem Sammlungsbestand des Wien Museums präsentiert, die den Schwestern Fröhlich gehörten. Diese wenigen Objekte wurden in der Art einer Depotaufstellung angeordnet und standen so im Gegensatz zu der auf Vollständigkeit angelegten Präsentation der Grillparzer-Zimmer. Als weitere Anregung, die Präsentationsformen – also wie Bedeutungen konstruiert und Zuschreibungen vorgenommen werden – zu reflektieren, möchte ich auf die Strategien der Parodie und der Maskerade verweisen, die insbesondere auch Judith Butler aufgegriffen hat. Beide Strategien spielen in der Kunst zunehmend eine Rolle, und sind auch für Ausstellungen zu denken. Davon ausgehend, dass die Parodierbarkeit des Originals die Konstruiertheit des Originals zeigt, können Wahrnehmungen durch das Fremde, Inkohärente verunsichert und ein Weg eröffnet werden, die als selbstverständlich hingenommenen Kategorisierungen als eine Konstruktion zu verstehen, die auch anders konstituiert sein könnten. Durch eine parodistische Aneignung vollzieht sich ein Prozess der De-Regulierung von Bedeutungen, der beständigen Verschiebung von Zeichen, die den normativen Gebrauch irritieren. Mit dem Konzept der Maskerade in Form von Verhüllung, Fetischismus, Ver-Kleidung, Travestie etc. können sich die zentralen Oppositionen westlicher Kulturdiskurse – Sein und Schein, Wahrheit und Täuschung, Identität und ihr ‚Mangel’ – überkreuzen. Die Maskerade ermöglicht die Dechiffrierung kultureller Einschreibeprozesse, die sich als ordnungsstiftend und irri- 14 tierend zugleich offenbaren. Bei der Maskerade wird das Uneigentliche Modus der (Re-)Präsentation.32 Wenn Differenz und Vielfalt im Museum thematisiert werden sollen, gilt es, für das Museum als reflexive und selbst-reflexive Institution zu plädieren, d.h. für das Museum als Verhandlungsort im Sinn eines zwischen dem individuellen und kollektiven angelagerten "kommunikativen Gedächtnisses".33 Welche Wege kann das Museum nun gehen, um Forum zu sein, in dem entsprechende Fragestellungen am Gegenständlichen entwickelt und provoziert werden können, ein Forum, um Symbolisierungen zu verhandeln? Dies meint neben der Auseinandersetzung mit vergangenen wie gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen sowie den sozialen und kulturellen Praktiken auch jene mit ästhetischen Ausdrucksformen und Manifestationen.34 Dies inkludiert den von Irit Rogoff eingeforderten "verantwortlichen Blick"35, das heißt in Repräsentationen die Annahmen offen zu legen, so dass diese als Deutungsangebote begriffen werden können. Wesentlich scheint dabei, Differenzen als Verhandlung von Grenzen zu verstehen, wie dies etwa Homi Bhabha und Gaytari Spivak thematisierten. Mit solchen Verhandlungsprozessen gilt es weniger Innen und Außen voneinander abzugrenzen, sondern ein In-Between zu denken. 15 Abb. 13 Gefrierkammer, Ausstellung "Aqua extrema", Expo Schweiz 2002. Foto: Herbert Posch 1 Sharon Macdonald, Gordon Fyfe (Hg.): Theorizing Museums. Representing Identity and Diversity in a Changing World. Oxford 1996, S.2 2 Der Diskurs um Museen als Orte von "contested identities" nahm vor allem im angloamerikanischen Diskursen seinen Ausgang. Vgl. z.B. Margaret Anderson: Material Culture & Australian Cultural Politics. In: Museums Australia Journal 2-3/1991-92, S.6 3 Carol Duncan beschreibt Museen als säkulare Räume einer rituellen Transformation. Ordnung und Konsens bewirkende Rituale treten an die Stelle der Erfahrungen des alltäglichen Lebens. Civilizing rituals dienen der Bildung wie Normierung und Regulierung des Subjekts. Vgl. Carol Duncan: Civilizing Rituals inside the Public Art Museums. London, New York 1995 4 Peter Sloterdijk: Museum. Schule des Befremdens. In: Frankfurter Allgemeine Magazin, 17.3.1989 5 Gottfried Fliedl: Museum, Erinnerung, Öffentlichkeit. Zur Projektreihe Ein Viertel Stadt. In: Ein Viertel Stadt. Zur Frage des Umgangs mit dem ehemaligen jüdischen Viertel in Hohenems. Innsbruck 1997, S.103 6 Nach Sabine Offe wird in Museen eine Gedächtnisbeziehung konstituiert: "Der (kollektiven) Erinnerung ist an empirischen oder historisch authentischen Orten nicht habhaft zu werden, und sie läßt sich auch in realen Objekten nicht dingfest machen. Nicht die Museen […] nicht die Objekte, […] repräsentieren Gedächtnis. Sie sind vielmehr Elemente oder Vehikel einer Beziehung zwischen Museumsbesuchern und -machern, Objekten und Subjekten der Anschauung. Sie sind Teil von Beziehungen, die alle Beteiligten […] dazu aufnehmen, körperliche, visuelle und sprachliche, bewußte und unbewußte." Sabine Offe: Ausstellungen, Einstellungen, Entstellungen. Berlin 2000, S. 40 "Erst an den Schnittstellen so disparater Beziehungen entsteht Gedächtnis als bewegliches Produkt von Strategien der Darstellung, der Wahrnehmung, der Perspektiven, Redeweisen und Lesarten, politischen Kalküls und individueller Lebensgeschichten." Offe, Ausstellungen, 2000, S. 43 Gottfried Korff: Fremde (der, die, das) und das Museum, in: Jürg Steiner (Hg.), Museumstechnik, Berlin 1997, S. 8 7 8 Das Museumsobjekt "ist zum Semiophor geworden, wie Krzysztof Pomian mit einem merkwürdig klingenden Namen, als wolle er das Fremdwerden der Museumsgegenstände auch sprachlich ausdrücken, die Dinge im Museum genannt hat: Zeichenträger. Es sind die Dinge, die lebensweltlich nicht mehr gebraucht werden, dennoch eine wichtige Funktion erfüllen, nämlich die der Vermittlung des Unsichtbaren im Sichtbaren." Korff, Fremde, 1997, S. 8 9 Korff, Fremde, 1997, S. 9f; Das Spannungsverhältnis von nah und fern im Museum entspricht der Bedeutungskonfiguration des Benjaminschen Aura-Begriffes: "Wenn Aura die ‚einmalige Erscheinung einer Ferne (ist), so nah sie sein mag‘, […] dann ist mit der Aura tatsächlich eine Grundkonstellation des Museums umrissen. Die physische Nähe des Objektes ist ebenso gegeben wie die psychische Fremdheit, also die Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag." ebenda 10 Korff, Fremde 1997, S. 11 11 Kathryn Woodward zit.n. Christina Lutter, Markus Reisenleitner: Cultural Studies. Eine Einführung. Wien 1998, S. 95 12 "Die Logik der Moderne beinhaltet die Logik der Differenz, d.h. Identität wird immer in Abgrenzung zum Anderen definiert. Diese Opposition bzw. das Absolutsetzen von Differenz als binärem Gegensatz verunmöglicht Theorien der "Andersheit" (otherness), die davon ausgehen, daß Differenz selbst ein historisch entstandenes, in modernen Machtstrukturen entwickeltes Produkt ist: Differenz wie Identität sind demnach Effekte von Macht. Das moderne Denken ist nicht nur binär, sondern erzeugt Binaritäten als konstitutive Differenzen, in denen der/das Andere immer durch seine "Negativität" definiert werden." Lutter, Reisenleitner, Cultural Studies, 1998, S. 101 13 Nach Jürgen Habermas steht die kollektive Identität der individuellen nicht als Traditionsinhalt gegenüber, an dem sich das Individuum wie an einem feststehenden Objektiven bildet, sondern die Individuen beteiligen sich am Prozess einer erst zu entwerfenden Identität. Fliedl, Museum, Erinnerung, Öffentlichkeit, 1997, S. 103 14 Astrid Deuber-Mankowsky: Repräsentationskritik und Bilderverbot. In: http://www.bu.edu/mzank/tr-deutsch/Bilderverbot.html, 3.8.22006, S.2 15 http://differenzen.univie.ac.at/glossar.php?sp=38, 3.8.2006 16 James Clifford: Sich selbst sammeln. In: Gottfried Korff, Martin Roth (Hg.) Das historische Museum. Labor, Schaubühne, Identitätsfabrik. Frankfurt, New York 1990, S. 91 16 17 Vgl. Sabine Offe: Ausstellungen, Einstellungen, Entstellungen. Berlin 2000 18 Vgl. Roswitha Muttenthaler / Regina Wonisch: Gesten des Zeigens. Zur Repräsentation von Gender und Race in Ausstellungen. Bielefeld 2006 19 Ivan Karp / Steven D. Lavine (Hg.): Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display, Washington, London 1991, S. 374f 20 Karp, Lavine, Exhibiting Cultures, 1991, S. 376 21 vgl. dazu: Gerlinde Hauer / Roswitha Muttenthaler / Anna Schober / Regina Wonisch: Das inszenierte Geschlecht. Feministische Strategien im Museum, Wien 1997 22 Dagmar von Hoff: Performanz/Repräsentation. In: Christina von Braun, Inge Stephan (Hg.): Gender@Wissen. Ein Handbuch der Gender-Theorien. Köln u.a. 2005, S. 171 23 Ebenda, S.170f 24 Viktoria Schmidt-Linsenhoff: Sexismus und Museum, in: kritische berichte, 3 (1985), S. 47 25 Irit Rogoff: Von Ruinen zu Trümmern, in: Silvia Baumgart u.a. (Hg.), Denkräume zwischen Wissenschaft und Kunst, Berlin 1993, S. 269. 26 Ebd., S. 269ff. 27 http://differenzen.univie.ac.at/glossar.php?sp=38, 3.8.2006. Vgl. Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt 1991 28 Vgl. Musée d’Ethnographie de Neuchâtel (Hg.): Le musée cannibale, Neuchâtel 2002. 29 Birgit Schulte: Die Ausstellung vis-à-vis: kleine Unterschiede im Karl Ernst Osthaus-Museum Hagen. Eine Revision zum Thema ‚gender‘, in: Roswitha Muttenthaler/Herbert Posch/Eva S.-Sturm (Hg.), Seiteneingänge. Museumsidee & Ausstellungsweisen, Wien 2000, S. 117ff. 30 Ebd., S. 130ff. 31 Ebd., S. 132. 32 von Hoff: Performanz/Repräsentation, 2005, S. 172f 33 Der von Jan Assmann geprägte Begriff entspringt seiner Erkenntnis, dass es unmöglich sei, zwischen dem individuellen und sozialen Gedächtnis strikt zu unterscheiden, weshalb er für den Zwischenraum den des kommunikativen Gedächtnisses heranzieht. 34 So plädiert Aleida Assmann für Museen als "Orte der Gegenstände, der Objekte, die sich den Subjekten entgegenstellen", für "Museen als Orte des Erlernens des kleinen Einmaleins der Wahrnehmung" in Bezug auf ein kritisches Verständnis der Informationstechnologien. Vgl. Korff, Fremde, 1997, S. 18. 35 Vgl. Irit Rogoff: Der unverantwortliche Blick. Kritische Anmerkungen zur Kunstgeschichte. In: kritische berichte, 4/1993, S. 41-49 17