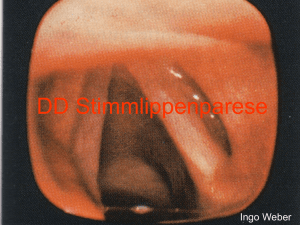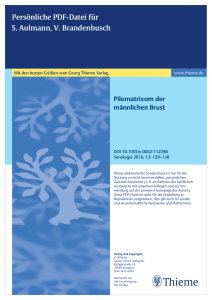Osteopathische Medizin Die Schulter - Overzicht e-books
Werbung

Osteopathische Medizin Die Schulter Luc Peeters & Grégoire Lason Die Schulter Luc Peeters & Grégoire Lason Copyright von Osteo 2000 bvba © 2014. Diese Publikation darf ohne schriftliches Einverständnis des Verlags weder kopiert noch in sonstiger Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder jegliche andere Form) veröffentlicht werden. Kontakt: Osteo 2000, Kleindokkaai 3-5, B – 9000 Gent, Belgien Mail: [email protected] Web: http://osteopedia.iao.be und www.osteopathie.eu Tel: +32 9 233 04 03 - Fax: +32 55 70 00 74 ISBN: 9789074400688 The International Academy of Osteopathy – I.A.O. 2 Inhalt 1. Einleitung ............................................................................................................... 9 2. Biomechanik und wichtige anatomische Aspekte ........................................... 10 2.1. Allgemein ....................................................................................................... 10 2.2. Anatomische Lage des Schultergürtels ...................................................... 10 2.3. Mobilität im Schulterkomplex ...................................................................... 11 2.4. Normales Bewegungsausmaß des Schultergürtels .................................. 11 2.5. Gelenkspezifikationen .................................................................................. 12 2.5.1. Das Sternoclaviculargelenk (SCG) ........................................................... 12 2.5.2. Das Acromioclaviculargelenk (ACG) ........................................................ 13 2.5.3. Das Glenohumeralgelenk ......................................................................... 16 2.5.4. Das Scapulothorakalgelenk ...................................................................... 26 2.5.5. Der scapulo-humerale Rhythmus ............................................................. 27 2.6. Funktionen der Schulter ............................................................................... 29 2.7. Schultermuskeln ........................................................................................... 29 2.8. Nerven ............................................................................................................ 43 2.8.1. Plexus cervicalis ....................................................................................... 43 2.8.2. Hautäste des Plexus cervicalis ................................................................. 43 2.8.3. Plexus brachialis ....................................................................................... 44 2.8.4. Muskuläre Innervation der oberen Extremität ........................................... 44 2.8.5. Segmenten ............................................................................................... 46 2.8.6. Sensibilität ................................................................................................ 49 2.8.7. Dermatome ............................................................................................... 49 2.8.8. Nervenwurzel Syndrome .......................................................................... 50 2.9. Vaskularisation .............................................................................................. 51 2.9.1. Arteriell ..................................................................................................... 51 2.9.2. Venös ....................................................................................................... 54 3. Mögliche funktionelle Läsionen ......................................................................... 55 3.1. Allgemein ....................................................................................................... 55 3.2. Das Sternoclaviculargelenk ......................................................................... 55 3.2.1. Anterior Läsion der Clavicula .................................................................... 55 3.2.2. Posteriore Läsion der Clavicula ................................................................ 56 3.2.3. Superiore Läsion der Clavicula ................................................................. 56 3.2.4. Inferiore Läsion der Clavicula ................................................................... 57 3.3. Das Acromioclaviculargelenk ...................................................................... 57 3.3.1. Superiore Läsion der Clavicula ................................................................. 57 3.3.2. Läsion Clavicula in anteriorer Rotation ..................................................... 58 3.3.3. Läsion Clavicula in posteriorer Rotation ................................................... 58 3.3.4. Anteriore Läsion der Clavicula .................................................................. 59 3.3.5. Posteriore Läsion der Clavicula ................................................................ 59 3 3.4. Das Glenohumeralgelenk ............................................................................. 60 3.5. Das Scapulothorakalgelenk (Artikulation) .................................................. 60 4. Schulter Schmerzen ............................................................................................ 62 4.1. Allgemein ....................................................................................................... 62 4.2. Mechanische Probleme ................................................................................ 62 4.2.1. Das Sternoclaviculargelenk ...................................................................... 62 4.2.2. Das Acromioclaviculargelenk ................................................................... 63 4.2.3. Das Glenohumeralgelenk ......................................................................... 65 4.2.4. Labrumriss ................................................................................................ 67 4.2.5. Subacromiales Impingement Syndrom (SIS) ........................................... 68 4.2.6. Schwimmer Schulter ................................................................................. 69 4.2.7. Hill-Sachs Defekt ...................................................................................... 69 4.2.8. Bankart-Läsion ......................................................................................... 70 4.2.9. Humerusfrakturen ..................................................................................... 70 4.2.10. Weichteilverletzungen ............................................................................ 71 4.2.11. Bursitis subacromiale ............................................................................. 73 4.2.12. Biceps Tendinopathie ............................................................................. 75 4.2.13. Kapsulitis der Schulter ............................................................................ 77 4.2.14. Frozen Shoulder Syndrom ...................................................................... 77 4.2.15. Thoracic-Outlet Syndrom (TOS) ............................................................. 79 4.3. Vaskuläre Probleme ...................................................................................... 81 4.3.1. Vena Cava Superior Syndrom .................................................................. 81 4.3.2. Subclavian-Steal-Syndrom ....................................................................... 81 4.4. Neurologische Probleme .............................................................................. 82 4.4.1. Zervikale Stenose ..................................................................................... 82 4.4.2. Schmerzausstrahlung aus den zervikalen Facettengelenken .................. 84 4.4.3. Überdehnung oder Kompression des Plexus brachialis ........................... 84 4.4.4. Cervicobrachial Neuralgie ........................................................................ 85 4.4.5. Viszerosomatische Schmerzausstrahlung in Richtung Schulter .............. 85 4.5. Metabolische Probleme ................................................................................ 87 4.5.1. Complex Regional Pain Syndrom (CRPS) ............................................... 87 4.5.2. Synoviale Chondromatose ....................................................................... 89 4.5.3. Avaskuläre Nekrose des Humeruskopfes ................................................ 89 4.6. Degenerative Probleme ................................................................................ 90 4.6.1. Osteoarthrose ........................................................................................... 90 4.6.2. Osteochondritis Dissecans ....................................................................... 92 4.7. Rheumatische Probleme .............................................................................. 93 4.7.1. Rheumatoide Arthritis - RA ....................................................................... 93 4.8. Infektiöse Probleme ...................................................................................... 95 4.8.1. Septische Arthritis ..................................................................................... 95 5. Untersuchung ...................................................................................................... 96 5.1. Anamnese ...................................................................................................... 96 5.2. Observation ................................................................................................... 97 4 5.2.1. Allgemein .................................................................................................. 97 5.2.2. Observation der verkürzten Strukturen ..................................................... 97 5.2.3. Observation der Körperhaltung und der hochthorakalen Region ............. 99 5.3. Tests des Thoracic-Outlet .......................................................................... 103 5.4. Provokations-Tests ..................................................................................... 106 5.4.1. Palpation ................................................................................................. 106 5.4.2. Provokation des Thoracic-Outlet ............................................................ 106 5.4.2.1. Provokation Abstand Pectoralis minor/Rippen ................................. 106 5.4.2.2. Provokations-Test der Öffnung oberhalb der ersten Rippe, zwischen M. scalenus anterior und medius .................................................................. 107 5.4.2.3. Provokation Abstand Clavicula/ erste Rippe .................................... 107 5.4.2.4. Allgemeiner Provokationstest des Thoracic-Outlets ........................ 108 5.4.2.5. Allgemeiner Provokationstest des Thoracic-Outlet – Test von Pemberton .................................................................................................... 108 5.4.2.6. Adson Test ....................................................................................... 109 5.4.2.7. Elevations Stress Test ..................................................................... 109 5.4.2.8. Neers Zeichen .................................................................................. 110 5.4.2.9. Hawkins-Kennedy Test .................................................................... 110 5.4.2.10. Jobes Test ..................................................................................... 110 5.4.2.11. Crank Test ..................................................................................... 111 5.5. Mobilitätstests ............................................................................................. 112 5.5.1. Aktive Tests ............................................................................................ 112 5.5.1.1. Aktiver Test der Innen- und Außenrotation ...................................... 112 5.5.1.2. Aktiver Test der horizontalen Ab- und Adduktion mit Evaluation der Scapulothorakalgelenke ................................................................................ 113 5.5.1.3. Aktiver Test der Flexion mit Evaluation der Scapulothorakalgelenke ...................................................................................................................... 113 5.5.1.4. Test für aktive Abduktion beider Schultern ...................................... 114 5.5.1.5. Test für aktive Flexion beider Schultern ........................................... 114 5.5.1.6. Test für aktive horizontale Ab- und Adduktion beider Schultern ...... 115 5.5.1.7. Test für aktive Flexion der Schultern und thorakolumbale Beteiligung ...................................................................................................................... 115 5.5.2. Passive Tests ......................................................................................... 116 5.5.2.1. Bilateraler Test des Sternoclaviculargelenks in anterior und posterior Translation .................................................................................................... 116 5.5.2.2. Bilateraler Test des Sternoclaviculargelenks in medio/ kranialer und latero/ kaudaler Richtung .............................................................................. 117 5.5.2.3. Test der Sternoclaviculargelenke in anterior und posterior Translation ...................................................................................................................... 117 5.5.2.4. Test des Sternoclaviculargelenks in medio/ kranialer und latero/ kaudaler Richtung ......................................................................................... 118 5.5.2.5. Mobilität des Processus coracoideus ............................................... 119 5.5.2.6. Mobilitätstest des Scapulothorakalgelenks ...................................... 119 5 5.5.2.7. Test auf Öffnung des Winkels zwischen Clavicula und Spina scapula ...................................................................................................................... 120 5.5.2.8. Test der Anterior- und Posterior-Rotation der Clavicula im Acromioclaviculargelenk ............................................................................... 121 5.5.2.9. Test des ACG in Anterior- und Posterior-Translation ...................... 122 5.5.2.10. Translationstest des Glenohumeralgelenks ................................... 122 5.5.2.11. Posterior Translationstest des Glenohumeralgelenk ..................... 123 5.5.2.12. Anterior Translationstest des Glenohumeralgelenks ..................... 123 5.5.2.13. Test der Superior- und Inferior-Translation im Glenohumeralgelenk ...................................................................................................................... 124 5.5.2.14. Test der Flexion mit Beteiligung der unteren Rippen und Wirbelsäule ...................................................................................................................... 124 5.5.2.15. Test der Flexion mit Rippenbeteiligung .......................................... 125 5.5.3. Tests der Muskelkraft ............................................................................. 125 5.5.3.1. Krafttest des M. triceps brachii ......................................................... 125 5.5.3.2. Krafttest des M. biceps brachii ......................................................... 126 5.5.3.3. Krafttest der Außenrotatoren ........................................................... 126 5.5.3.4. Krafttest der Innenrotatoren ............................................................. 127 5.5.3.5. Krafttest der Abduktoren .................................................................. 127 5.5.3.6. Krafttest der Adduktoren .................................................................. 128 6. Techniken ........................................................................................................... 129 6.1. Manipulationen ............................................................................................ 129 6.1.1. Allgemein ................................................................................................ 129 6.1.2. Manipulation einer superior Läsion des medialen Claviculakopfes gegenüber dem Manubrium ............................................................................. 132 6.1.3. Manipulation einer anterior Läsion des medialen Claviculakopfes ......... 132 6.1.4. Manipulation einer inferior/lateralen Läsion des medialen Claviculakopfes .......................................................................................................................... 133 6.1.5. Manipulation einer anterior rotierten Clavicula ....................................... 133 6.1.6. Manipulation einer posterior rotierten Clavicula ..................................... 134 6.1.7. Allgemeine Dekoaptation des ACG ........................................................ 134 6.1.8. Manipulation einer superior Läsion des lateralen Claviculakopfes gegenüber dem Acromion ................................................................................ 135 6.1.9. Manipulation der langen Bicepssehne .................................................... 136 6.1.10. Manipulation einer anterior Läsion des Humerus ................................. 136 6.1.11. Manipulation einer posterior Läsion des Humeruskopfes ..................... 137 6.1.12. Manipulation einer superior Läsion des Humeruskopfes ...................... 137 6.1.13. Manipulation einer superior Läsion des Humeruskopfes ...................... 138 6.1.14. Manipulation einer inferior Läsion des Humeruskopfes ........................ 138 6.2. Mobilisationen ............................................................................................. 139 6.2.1. Allgemein ................................................................................................ 139 6.2.2. Mobilisation einer superior/medialen Läsion des medialen Claviculakopfes gegenüber dem Manubrium ............................................................................. 140 6 6.2.3. Mobilisation einer posterior Läsion des medialen Claviculakopfes gegenüber dem Manubrium ............................................................................. 141 6.2.4. Öffnen des Winkels zwischen Clavicula und Spina scapula .................. 141 6.2.5. Allgemeine Dekoaptation von SCG und ACG ........................................ 142 6.2.6. Allgemeine Mobilisation des Scapulothorakalgelenks ............................ 142 6.2.7. Allgemeine Mobilisation des Glenohumeralgelenks ............................... 143 6.2.8. Allgemeine Traktion der glenohumeralen Kapsel ................................... 143 6.2.9. Mobilisation einer superior Läsion des Humerus .................................... 144 6.2.10. Mobilisation der posterioren Kapsel des Glenohumeralgelenks ........... 145 6.3. Muscle Energy Techniques – MET ............................................................ 146 6.3.1. Allgemein ................................................................................................ 146 6.3.2. Dehnung der Außenrotatoren ................................................................. 148 6.3.3. Dehnung der Innenrotatoren .................................................................. 149 6.3.4. Dehnung der Flexoren ............................................................................ 150 6.3.5. Dehnung der Extensoren ........................................................................ 151 6.3.6. Dehnung der horizontalen Abduktoren ................................................... 152 6.3.7. Dehnung von M. infraspinatus, M. teres minor und M. teres maior. ....... 153 6.3.8. Dehnung des M. biceps brachii .............................................................. 154 6.3.9. Dehnung des M. triceps brachii .............................................................. 155 6.4. Strain and Counterstrain Techniques - SCT (Spontaneus Positional Release Techniques – SRT) .............................................................................. 156 6.4.1. Allgemein ................................................................................................ 156 6.4.2. SRT bei Dysfunktion des anterioren ACG .............................................. 156 6.4.3. SRT bei Dysfunktion des anterioren ACG (alternative Technik) ............ 157 6.4.4. SRT bei Dysfunktion des Caput longum des Biceps .............................. 157 6.4.5. SRT bei Dysfunktion der Schleimbeutel in der Schulter ......................... 158 6.4.6. SRT bei Dysfunktion des M. latissimus dorsi ......................................... 158 6.4.7. SRT bei Dysfunktion des M. subscapularis ............................................ 159 6.4.8. SRT für eine Frozen Shoulder ................................................................ 159 6.4.9. SRT einer posterior ACG Dysfunktion .................................................... 160 6.4.10. SRT für eine Teres Maior Dysfunktion ................................................. 160 6.4.11. SRT für eine Dysfunktion des M. supraspinatus .................................. 161 6.4.12. SRT für eine Dysfunction des M. infraspinatus .................................... 161 6.4.13. SRT für eine Dysfunktion des M. infraspinatus .................................... 162 7. Bibliographie ...................................................................................................... 163 8. Über die Autoren ................................................................................................ 168 9. Danksagung ....................................................................................................... 169 10. Terminologie der Osteopathie ........................................................................ 170 10.1. Die drei anatomischen Achsen ................................................................ 170 10.2. Die drei anatomischen Ebenen ................................................................ 171 10.3. Biomechanik der Wirbelsäule .................................................................. 172 10.4. Abkürzungen ............................................................................................. 174 7 10.5. Spezifische Begriffe .................................................................................. 175 11. Alle Videos ....................................................................................................... 176 8 1. Einleitung Die Schulter ist ein sehr komplizierter Bereich des Körpers. Es ist ein Komplex von Gelenken mit einem hohen Grad an Mobilität, aber mit recht geringer Stabilität. Der Gelenkkomplex ist an vielen Bewegungen beteiligt, sowohl im täglichen Leben, als auch im Sport. Daher ist er gleich für mehrere Wiederholungs- und Überanstrengungsverletzungen anfällig. Die Schulter ist gut gestaltet und die Gelenkmechanismen ermöglichen die Platzierung, Funktion und Kontrolle der Hand vor dem Körper im visuellen Arbeitsbereich. Die Schulter ist wegen der minimalen knöchernen Einschränkungen und der ausgefeilten Weichteilinsertion hierzu gut geeignet. Diese anatomischen Gegebenheiten gewährleisten ein großes Maß an Bewegungsfreiheit. Diese ausgezeichnete Bewegungsfreiheit der Schulter wird durch den Verzicht auf Eigenstabilität erreicht. Dadurch erklärt sich auch, warum Instabilität ein gemeinsames Merkmal von Schulterpathologien ist. Der Schulterkomplex besteht aus drei Gelenken und einer Artikulation, die in einer präzisen, koordinierten und synchronen Weise funktionieren. Für diejenigen, die nicht mit der typischen osteopathischen Terminologie vertraut sind, verweisen wir auf das Kapitel 10 am Ende dieses E-Books. 9 2. Biomechanik und wichtige anatomische Aspekte (Colas et al 2004, Grant & Boileau 2004, Gray 1995, 2000, Kapandji 2001, Kelkar et al 2001, Lippit & Matsen 1993, Moore & Dalley 1999, Netter 2003, Modi & Shah, O’Brien et al 1990, Plancher et al 2005, Andart & Petersen 2002, Rowe 1988, Schneck & Bronzino 2002, Sobotta 2001, Ward 2003) 2.1. Allgemein Die Schulter oder der Schulterkomplex /-gürtel besteht aus drei Gelenken und einer Artikulation: • • • • Das Sternoclaviculargelenk. Das Acromioclaviculargelenk. Das Glenohumeralgelenk. Das Scapulothoracalgelenk (Artikulation). 2.2. Anatomische Lage des Schultergürtels Die Clavicula liegt im 20°-Winkel hinter der Frontalebene. Die Scapulaebene liegt im 35°-Winkel vor der Frontalebene. Das Glenohumeralgelenk ist um 30° hinter der medial-lateralen Achse des Ellenbogens retrovertiert. 35° 30° 20° Abbildung 1 - Anatomische Lage des Schultergürtels 10 2.3. Mobilität im Schulterkomplex GELENK Sternoclaviculargelenk Acromioclaviculargelenk Glenohumeralgelenk Scapulothoracalgelenk (Artikulation) BEWEGUNG Elevation & Depression Protraktion & Retraktion Rotation der Clavicula Rotation der Scapula (Acromion) Protraktion/Abduktion & Retraktion/Adduktion Aufwärts- und Abwärtsrotation Flexion & Extension Abduktion & Adduktion Innen- & Außenrotation Elevation & Depression Protraktion & Retraktion Abwärts-/Aufwärts- (medial & lateral) Rotation Scapula alata Kippen der Scapula 2.4. Normales Bewegungsausmaß des Schultergürtels 180° 180° 45° 50° Abbildung 2 - Flexion und Extension Abbildung 3 - Abduktion und Adduktion 11 90° 40° 90° 30° Abbildung 4 - Außen- und Innenrotation Abbildung 5 - horizontale Add- und Abduktion 2.5. Gelenkspezifikationen 2.5.1. Das Sternoclaviculargelenk (SCG) Das Sternoclaviculargelenk ist ein diarthrotisches Sattelgelenk. Es ist ein eher flaches Gelenk und relativ inkongruent. Es ist das einzige Gelenk, das den Arm mit dem Thorax verbindet. Das Gelenk hat einen intraartikulären Diskus. Die Kapsel des SCG ist stark und wird von Ligamenten unterstützt: • • • Lig. costoclaviculare: verhindert Bewegung nach oben und hinten. Lig. sternoclaviculare: verhindert Bewegung nach vorne, hinten und oben. Lig. interclaviculare: verhindert Bewegung nach oben. Lig. interclaviculare Clavicula Clavicula 1. Rippe Lig. costoclaviculare Intraartikulärer Diskus Sternum Lig. sternoclaviculare Abbildung 6 - Sternoclaviculargelenk 12 3. Mögliche funktionelle Läsionen 3.1. Allgemein Da der Arm ein sehr langer Hebel ist, und die Schulter nur wenig Stabilität besitzt, ist sie in allen Ebenen sehr Beweglich, aber auch sehr anfällig für Verletzungen. In diesem Kapitel beschreiben wir die funktionellen Läsionen für jedes Gelenk im Schultergürtel. 3.2. Das Sternoclaviculargelenk 3.2.1. Anterior Läsion der Clavicula Der mediale Kopf der Clavicula ist in einer anterioren Position. Dies ist meistens kein Bewegungsverlust, sondern eine Hypermobilität nach anterior. Die posteriore Kapsel kann jedoch verkürzt sein. Anterior Posterior Abbildung 105 - Anterior Läsion der Clavicula 55 3.2.2. Posteriore Läsion der Clavicula Der mediale Kopf der Clavicula steht gegenüber dem Sternum in einer posterioren Position. Diese Läsion geht mit einer anterioren Position der Schulter einher. Diese Läsion ist wichtig, da der posterior platzierte Kopf der Clavicula Venen komprimieren kann. In sehr schweren Fällen von Subluxation können sogar der Ösophagus und die Trachea eingeengt werden. Diese Läsion verengt das Thoracic-Outlet. Die anteriore Gelenkkapsel ist verkürzt. Anterior Posterior Abbildung 106 - Posteriore Läsion der Clavicula 3.2.3. Superiore Läsion der Clavicula Der mediale Kopf der Clavicula ist in einer superioren/ medialen Position. Diese Läsion entsteht nicht immer durch einen Bewegungsverlust, sondern häufig durch eine Hypermobilität in superomedialer Richtung. Das geht meistens mit einer “dropped” Schulter einher. Medial Lateral Abbildung 107 - Superiore Läsion der Clavicula 56 3.2.4. Inferiore Läsion der Clavicula Der mediale Kopf der Clavicula ist in einer inferioren und lateralen Position. Diese Läsion wird selten vorgefunden. Lateral Medial Abbildung 108 - Inferiore Läsion der Clavicula 3.3. Das Acromioclaviculargelenk 3.3.1. Superiore Läsion der Clavicula Der laterale Kopf der Clavicula ist gegenüber dem Acromion in einer superioren Position. Bei einer Ruptur der superioren Kapsel wird dies auch Klaviertasten-Phänomen genannt. Abbildung 109 - Superiore Läsion der Clavicula 57 4. Schulter Schmerzen (Andrews et al 1991, Blasier et al 1992, Burkhard & Rockwood 1992, Chang 2002, Cleland & Durall 2002, Downing 1988, Dunlap 2002, Emig et al 1995, Johnson et al 2003, Killian et al 2012, Levin & Dellon 1992, McMahon & Kaplan 2006, Mengiardi et al 2004, Mercier 2008, Neviaser & Neviaser 1981, Nunley & Urbaniak 1996, Rowe 1988, Shah & Lewis 2007, Vastamaki et al 2012, Woodard & Best 2000, Wright & Haq 1976) 4.1. Allgemein Die Beschwerden im Schultergürtel können in folgende Probleme eingeteilt werden: • • • • • • • Mechanisch. Vaskulär. Neurologisch. Metabolisch. Degenerativ. Rheumatisch. Infektiös. 4.2. Mechanische Probleme 4.2.1. Das Sternoclaviculargelenk Das Sternoclaviculargelenk kann durch eine Verstauchung verletzt werden, die durch eine Kraft auf die Schulter verursacht wird (Sturz). Bei Erwachsenen können Dislokationen oder Frakturen der Clavicula auftreten. Bei Kindern handelt es sich fast immer um Frakturen. Dislokationen können in verschiedene Richtungen auftreten, abhängig von der Richtung initialen Kraft auf die Schulter. Posteriore Dislokationen sind besonders gefährlich, da die Trachea, der Ösophagus, Venen usw. hinter dem Gelenk liegen. Abbildung 116 - Posteriore und superiore Dislokation 62 4.2.2. Das Acromioclaviculargelenk Die meisten Verletzungen dieses Gelenks werden durch eine laterale Kraft auf das Acromion verursacht (Sturz auf die Schulter). Dieses Trauma wird auch als “shoulder separation” bezeichnet. Die Verletzungen reichen von einer milden Verstauchung der AC-Ligamente bis zu einer kompletten Dislokation mit einer möglichen Ruptur der claviculären Ansätze von M. deltoideus, M. trapezius oder einer kompletten Ruptur der coracoclaviculären Ligamente. Bei der Verletzung handelt es sich um eine Verschiebung des Acromions, meistens nach anterior und inferior, während die Clavicula relativ nicht bewegt. Das ist in 95% der Dislokationen in diesem Gelenk der Läsionsmechanismus. Die Kraft kann durch einen direkten Sturz auf das Acromion oder einen Aufprall über den Humerus übertragen werden. Die Symptome sind: • • Schmerzen und Deformität des ACG. Schmerzen bei Schulterbewegungen (insbesondere bei gekreuzter Abduktion). Abbildung 117 - Dislokation Einteilung: • • • Grad 1: keine Dislokation. Grad 2: Clavicula 50% erhöht. Grad 3: Clavicula 100% erhöht. Die Behandlung: • Wenn es sich nur um eine Bänder- und Kapselüberdehnung handelt: Ruhe in Mitella. 63 • • Wenn es sich um eine totale Ruptur der Ligamente und der Kapsel handelt: Chirurgie. Chirurgie bei Grad 3. Clavicula Fraktur Wird meistens durch einen Sturz auf die Schulter verursacht. Obwohl mehrere wichtige Strukturen in der Nähe der Clavicula liegen, werden diese Gewebe nur selten beschädigt. Ein Sturz auf den ausgestreckten Arm kann auch eine Claviculafraktur verursachen. Bei Babys können diese Frakturen während der Passage durch den Geburtskanal auftreten. Claviculafrakturen können sehr schmerzhaft sein. Sie machen es schwer, den Arm zu bewegen. Die Symptome sind: • • • • • Schulterposition unten und vorne. Wegen der Schmerzen Unfähigkeit den Arm zu heben. Schleifgefühl beim Versuch den Arm zu heben. Deformität oder sichtbare “Delle”. Blutergüsse, Schwellungen und Schmerzen über der Clavicula. Die Behandlung besteht aus: • • • • Schmerzmedikation. Armschlinge (achtförmig). Manchmal Chirurgie (im Fall von Dislokation). Manchmal heilt die Fraktur in einer Fehlstellung. Das bedeutet, dass die Knochen in einer nicht anatomischen Position zusammen wachsen. Abbildung 118 - Claviculafraktur 64 5. Untersuchung (Good et al 1984, Kuchera 1994, 1996, Peeters & Lason 2005) Der Begriff Läsion bedeutet, dass es einen Bewegungsverlust gibt. Dysfunktionen im Schultergürtel können Beschwerden auslösen. Dysfunktionen können sowohl Hyper- als auch Hypomobilitäten sein. 5.1. Anamnese In der Anamnese versucht der Osteopath die Art der Schmerzen zu identifizieren: • • • • • • • Bohrende Schmerzen können von einem Ligament ausgehen, besonders wenn sie morgens mit Steifheit auftreten. Ebenso, wenn sie nach einer Zeit der Immobilisation auftreten. Ligamentäre Beschwerden sind häufig mit Osteoarthrose verbunden. Vorübergehende morgendliche Schmerzen, die verschwinden, wenn der Patient sich bewegt, aber bei Belastung wieder auftreten sind typisch für degenerative Schultererkrankungen. Scharfe Schmerzen bei bestimmten Bewegungen können durch Muskelzerrungen oder -entzündungen, Tendinitis oder Bursitis verursacht werden. Erschöpfung kann durch eine schlechte Haltung und schlechte muskuläre Balance (besonders der Rotatorenmanschette) verursacht werden. Sie kann aber auch mit Arteriosklerose, rheumatoider Arthritis oder Krebs in Verbindung stehen. Ausstrahlende Schmerzen deuten auf einen neurogenen Faktor, sie können radikulär oder pseudoradikulär sein. Detaillierte neurologische Tests müssen durchgeführt werden. Taubheit oder Muskelschwäche weist auf Kompression oder Beschädigung eines Nervs hin. Bilaterale Schmerzen in den Schultern können mit einer zervikalen Myelopathie oder rheumatischen Erkrankung assoziiert werden. Nächtliche Schmerzen indizieren häufig Krebs, Entzündung/ Infektion oder rheumatische Erkrankungen. Der Patiententyp (Kind, Erwachsener, Älterer, Schwanger, perimenopausale Frau) kann auch Informationen an den Osteopathen geben. Der Beginn der Schulterschmerzen ist sehr wichtig. Gab es ein Trauma? Wie ist es abgelaufen? War der Beginn plötzlich oder progressiv schlechter werdend? Wodurch werden die Schmerzen besser oder schlechter? Gibt es ein knallendes Gefühl, schmerzhaft oder nicht schmerzhaft? Gibt es Probleme beim Heben, Erreichen, Werfen, etc.? 96 Gibt es einen painful arc? Gab es kürzlich eine Infektion? Gibt es Symptomverschlechterung und psychische Belastung? (oberflächliche und nicht-anatomische Schmerzverteilung, nicht-anatomische sensorische oder motorische Störungen, widersprüchliche neurologische Anzeichen, unangemessene oder übermäßige Verbalisierung der Schmerzen) 80% der Diagnose sollten mit einer guten Anamnese gestellt werden. 5.2. Observation 5.2.1. Allgemein In der allgemeinen Observation achtet man auf: • • • • • • • Muskuläre Konturen (Asymmetrie). Muskuläre Atrophie. Schwellung und/ oder Erythem. Andere Deformitäten. Bilateraler Vergleich. Wo sind die somatischen Dysfunktionen? (mehr Details im E-Book “Integration und angewandte Prinzipien in der Osteopathie” von den selben Autoren) Observation der anderen Gelenke, wie Ellenbogen und Hände (Position und eventuelle Deformationen). 5.2.2. Observation der verkürzten Strukturen Der Osteopath observiert die Position der Schultern und der Wirbelsäule im Raum am stehenden Patienten. Es ist wichtig, dass er die Lokalisation der verkürzten Strukturen erkennt. Das Ziel dieser Observation (der verkürzten Strukturen) ist, zu sehen, wo lokal behandelt werden kann. Eine lokale Behandlung kann nur auf der verkürzten Seite durchgeführt werden (Mobilisation oder Manipulation). Die Beschwerden des Patienten können auf der verkürzten oder auf der überdehnten Seite auftreten. 97 Normale Achse Normale Biomechanik Normale Beweglichkeit Normale, gleichmäßige Belastung aller peri-artikulärer Strukturen Aphysiologische Achse, peri-artikuläre Strukturen sind verkürzt Aphysiologische Biomechanik Aphysiologische Beweglichkeit Abnorme, ungleichmäßige Belastung periartikulärer Strukturen mit chronischer Überdehnung auf der gegenüberliegenden Seite der aphysiologische Achse Verkürzte periartkuläre Strukturen Schlechte Zirkulation in allen Geweben um die aphysiologische Achse herum Abbildung 145 - Verkürzte Strukturen oder aphysiologische Gelenkachse Es ist wichtig, zu verstehen, dass der Osteopath nicht nur versucht, die Amplitude (range of motion – ROM) des Gelenks zu verbessern. In diesem Beispiel (Abbildung 145) bleibt die Rotation zwischen den zwei Strukturen möglich. Allerdings, unabhängig von den Veränderungen des Bewegungsausmaßes, ist die Biomechanik falsch und muss korrigiert werden. Die retrahierten periartikulären Strukturen erschaffen die dreidimensionale aphysiologische Achse. Dieses Konzept ist einer der wesentlichen Unterschiede zwischen der Osteopathie und anderen manuellen Therapieformen, bei denen das Bewegungsausmaß als dominante Evaluation für die Beweglichkeit eines Gelenks herangezogen wird. 98 6. Techniken (Camargo & Halk 2013, Cooperstein & Gleberzon 2004, Crow 2010, Danto 2005, Fryette 1954, Haldeman & Dagenais 2004, Hartman 1997, Johnston et al 2005, Peeters & Lason 2005, Savarese et al 2003, Wyatt 2004) 6.1. Manipulationen 6.1.1. Allgemein Eine Manipulation oder HVLAT (High Volocity Low Amplitude Thurst) ist eine kurze, spezifische und schnelle Stoßbewegung in ein Gelenk. Das Ziel einer Manipulation hängt von der Läsion und dem behandelten Gelenk ab. Das Ziel einer Manipulation: • Reponierung einer Gelenk-Subluxation. • Reduzierung der Muskelspasmen in verkürzter Muskulatur. • Dehnung der kapsulo-ligamentären Retraktionen (Korrektur der aphysiologische Achse – verkürzte Strukturen) Manipulationen sind in manchen Situationen notwendig, vor allem in Fällen von Gelenkblockaden und Subluxationen. Diese sind häufig schwer von einer Restriktion zu unterscheiden (Bewegungsverlust mit elastischem Endgefühl). In manchen Fällen sind Manipulationen auch die effektivere Behandlung für Restriktionen. Wo ein elastisches Endgefühl vorhanden ist, können Mobilisationen verwendet werden, aber, solange keine Kontraindikationen vorliegen, ist auch eine Manipulation eine Option. Die Manipulation kann Cross-links aufbrechen. Vor dem Alter von 20 Jahren treten “echte” Gelenkblockaden nur selten auf. Kontraindikationen: Bevor ein Osteopath beschließt, eine Manipulation zu benutzen, muss er sicher sein, dass keine Kontraindikationen vorliegen. Es bestehen Kontraindikationen von verschiedenen Arten. • Medikation o Der Osteopath wird nicht manipulieren, wenn der Patient Antikoagulantien oder Corticosteroide nimmt. • Trauma o Der Osteopath manipuliert direkt nach einem Trauma nur, wenn radiologische Tests keine knöchernen Verletzungen oder Blutungen zeigen. o Der Osteopath wird nicht zu früh nach einer Operation manipulieren, wegen der Gefahr einer Blutung. 129 • • • • • • Hebeleinsatz o Sollte der Patient Schmerzen oder neurologische Symptome bekommen, während der Osteopath ihn für die Technik aufbaut, so wird der Osteopath nicht manipulieren. Osteoporose o Der Osteopath wird nicht in Fällen von offensichtlicher Osteoporose manipulieren, wie z.B. bei einer Sudeck Atrophie. Kinder o Echte artikuläre Blockaden kommen bei Kindern nicht vor, deshalb ist eine Manipulation nicht notwendig. Schwangerschaft o Manipulationen von Läsionen während der Schwangerschaft sind keine absoluten Kontraindikationen, aber verdienen zusätzliche Aufmerksamkeit. Hypermobilität ist nicht selten, so dass jede manipulative Technik sehr spezifisch durchgeführt werden muss. Ältere o Bei älteren Patienten ist Arthrose häufig Realität. Dadurch verändert sich die Gelenkoberfläche. Eine Manipulation ist nicht unbedingt kontraindiziert, aber Vorsicht ist geboten. Manipulationen sind nur im Fall einer Subluxation nötig. o Bei der Behandlung von arthrotischen Gelenken ist es nicht das Ziel. erheblich den Bewegungsumfang zu verbessern. Das würde nur zu einer Gelenkinstabilität führen. In Fällen von arthrotischen Gelenken ist es notwendig, den allgemeinen Bewegungsverlust in Ruhe zu lassen, da dieser als eine normale Schutzfunktion des Körpers anzusehen ist. Ziel ist es, dass sich keine aphysiologischen Achsen entwickeln und die Durchblutung zu verbessern. Herzpatienten o Manipulationen, die einen potentiellen neurovegetativen Einfluss auf das Herz darstellen können, sind kontraindiziert. Diese Patienten sind nicht die idealen Patienten für eine gesamte osteopathische Behandlung, weil die Osteopathie so effektiv auf das Kreislaufsystem einwirkt. Herzpatienten haben einen fehlerhaften „Motor“ in ihrem HerzKreislaufsystem und eine Verbesserung in diesem Kreislauf kann auch zu einer Überlastung des Herzens führen. o Andere Autoren meinen, es sei angezeigt, die neurovegetativen Einflüsse auf das Herz über Manipulationen, MET und Mobilisationen der thorakalen und zervikalen Region zu optimieren. Allerdings haben diese Autoren keine spezifischen Erfahrungen damit und so kann es nur nahe gelegt werden, dass diese Behandlungen nur in einer klinisch kontrollierten Umgebung durchgeführt werden. 130 • • • Krebspatienten o Es wird dringend empfohlen, Manipulationen bei Krebspatienten zu vermeiden. Knöcherne Metastasen sind immer möglich, genauso wie geschädigtes Gewebe durch Chemo- oder Strahlentherapie. o Diese Patienten sind nicht die idealen Patienten für eine komplette osteopathische Behandlung, weil die Osteopathie so effektiv auf das Kreislaufsystem einwirkt. Dadurch kann eine schnellere Ausbreitung von Metastasen ermöglicht werden. Eine postoperative Behandlung von Beschwerden ist möglich, wenn sie durch den betreuenden Facharzt erlaubt wird. Dies muss von Fall zu Fall geprüft werden. Psychiatrische Patienten o Bei diesen Patienten muss mit viel Sorgfalt vorgegangen werden, da Manipulationen unerwartete emotionale Reaktionen auslösen können. Bei dieser Patientengruppe ist dies nicht erwünscht, da die angemessene Reaktion für den Osteopathen nicht immer ersichtlich ist. Prothesen o Prothetische Gelenke werden nicht manipuliert. 131 6.1.2. Manipulation einer superior Läsion des medialen Claviculakopfes gegenüber dem Manubrium Der Patient ist in Rückenlage. Der Osteopath führt den Arm in 120° Abduktion. Er übt Traktion am Arm aus und thrustet den medialen Teil der Clavicula nach lateral und kaudal. Video 32 - Manipulation einer superior Läsion des medialen Claviculakopfes gegenüber dem Manubrium 6.1.3. Manipulation einer anterior Läsion des medialen Claviculakopfes Der Patient ist in Rückenlage. Der Osteopath bringt die Schulter nach vorne. Mit dem Pisiforme auf der Vorderseite der medialen Clavicula thrustet er die Clavicula nach posterior. Video 33 - Manipulation einer anterior Läsion des medialen Claviculakopfes 132 6.1.4. Manipulation einer inferior/lateralen Läsion des medialen Claviculakopfes Der Patient ist in Rückenlage. Der Osteopath bringt die Schulter nach kaudal. Mit dem Pisiforme an der Inferiorseite der medialen Clavicula thrustet er die Clavicula nach kranial/medial. Video 34 - Manipulation inferior/lateralen Läsion des medialen Claviculakopfes 6.1.5. Manipulation einer anterior rotierten Clavicula Der Patient sitzt. Der Osteopath unterstützt die Schulter in 90° Abduktion. Mit der medialen Hand hält er die Clavicula in einer posterior rotierten Position. Mit dem Arm als Hebel bringt er die Schulter in Innenrotation und an der Bewegungsgrenze manipuliert er das Acromion in anteriore Rotation. Video 35 - Manipulation einer anterior rotierten Clavicula 133 8. Über die Autoren Grégoire Lason Gent (B), 21.11.54 Luc Peeters Terhagen (B), 18.07.55 Beide Autoren haben einen osteopathischen Universitätsabschluss (Master of Science in Osteopathie) und engagieren sich für Förderung und Akademisierung der Osteopathie in Europa. 1987 gründeten sie “The International Academy of Osteopathy” (IAO) und sind bis heute deren Co-Direktoren. Die IAO ist seit einigen Jahren das größte Lehrinstitut für Osteopathie in Europa. Beide Osteopathen sind Mitglieder in diversen Berufsverbänden, beispielsweise der “American Academy of Osteopathy” (AAO), der “International Osteopathic Alliance” (IOA) und der “World Osteopathic Health Organisation” (WOHO). Diese osteopathische Enzyklopädie hat das Ziel, das ganzheitliche OsteopathieKonzept der IAO vorzustellen, welches auf einer integrierten osteopathischen Untersuchung und Behandlung des musculoskelettalen, des viszeralen und des craniosacralen Systems basiert. 168 Dieses E-Book ist eine Veröffentlichung von Osteo 2000 bvba. Sind Sie interessiert, ein E-Book mit uns zu veröffentlichen, haben Sie Fragen oder Vorschläge? Nehmen Sie Kontakt auf mit uns per: Mail: [email protected] Fax: +32 55 70 00 74 Tel: +32 9 233 04 03 Web Osteopedia: http://osteopedia.iao.be Web The International Academy of Osteopathy - IAO: http://www.osteopathie.eu 178