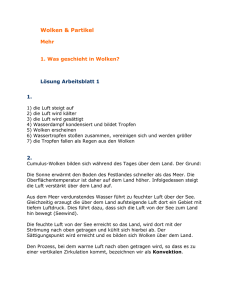nuvole clouds - Komparatistik
Werbung

Wolken Zur Einführung März 2014 mse Wolken – Zur Einführung Monika Schmitz-Emans „Wer das Wort Wolke ausspricht, denkt sich weder die Definition noch Ein bestimmtes Bild dieser Naturerscheinung. Alle verschiedenen Begriffe und Bilder derselben, alle Empfindungen, die sich an ihre Wahrnehmung anreihen, alles endlich, was nur irgend mit ihr und ausser uns in Verbindung steht, kann sich auf einmal dem Geist darstellen, und läuft keine Gefahr, sich zu verwirren, weil der Eine Schall es heftet und zusammenhält.“ (Wilh. v. Humboldt: Latium und Hellas oder Betrachtungen über das classische Alterthum. In: Ges. Schriften, Bd. III=Werke III, hg. Albert Leitzmann. Berlin 1904, 169.) „In der Bandbreite zwischen der Vorstellung, dass in der Wolke Gott anwesend sei, als schlechthin unfassbar und überwältigend dem Menschen sich zuwende, und der anderen, dass in der Wolke der Mensch sich artikuliere, der sich zwischen Himmel und Erde selbst ermächtigt, um beide seinem Zugriff zu unterwerfen, hat die Literatur von der Antike bis zur Gegenwart den mythischen Nimbus der Wolken entfaltet.“ (Greiner, Nimbus 70f. 1) „Wolken sind konsequent individualistisch, haben etwas angenehm Antiautoritäres (...). Wolken sind undogmatisch, wechseln pausen- und mühelos ihre Erscheinung und lassen sich nicht benennen, weshalb sie eine potenzielle Gefahr für Gesinnungen darstellen, die sich auf eine einzige, starre und unverrückbare Wahrheit reduzieren. Ihre sich stetig ändernde Form, ihre Variationen in feinsten Nuancen ergeben einen unendlichen Prozess, der, wie Lyotard schreibt, Philosophie und Maler verrückt machen kann. Gerade dadurch versinnbildlichen sie jedoch das wesen der Moderne in exemplarischer Weise.“ (Kutzenberger, Wolken und Striptease 77) ( 1 ) Die Wolken und die Götter: Das Numinose und der Nimbus Wenn Gott und die Götter auftauchen, sehen die Menschen oftmals Wolken. Letztere haben im Alten wie im Neuen Testament wie auch in Homers „Ilias“ die Funktion, das Göttliche einerseits erscheinen zu lassen, es andererseits dem menschlichen Blick aber zugleich zu entziehen. Indem sie Gott oder Götter verhüllen, verweisen Wolken den Menschen auf die Begrenztheit seines Fassungsvermögens gegenüber dem Transzendenten, sei es, daß dieses seinen Sinnen überhaupt nicht zugänglich ist, sei es, daß es sie auf schockhafte Weise überfordern würde, sei es auch, daß die Götter sich einfach nicht zeigen wollen und ihre Unsichtbarkeit ihre Macht gegenüber den Menschen und ihre radikale Unkontrollierbarkeit ausdrückt und bekräftigt. 2 Welches Motiv hinter der ‚wolkigen’ Göttererscheinung steckt, ist insofern jeweils genauer zu erwägen. In einer Wolke ist Jahwe auf dem Sinai anwesend und ruft Moses zu sich, der dann die Gesetzestafeln erhält (vgl. II. Buch Mose, Kap. 19,9: „Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich will zu Dir kommen in einer dicken Wolke (...).“), und in einer Wolken- bzw. einer Feuersäule zieht Jahwe den Israeliten beim Auszug aus Ägypten voran – präsent und doch nicht faßbar, mächtig in seiner Unfaßbarkeit und durch sie. Im Alten Testament ist die Wolke eine vor allem darum signifikante „Erscheinungsweise Gottes“ (Greiner, Nimbus 67), weil sie wie der Genesisbericht daran erinnert, daß dem menschlichen Erkennen Grenzen gesetzt sind. - Auch Homer zufolge benutzen die Götter Wolken zur Erzeugung von Unsichtbarkeit, wobei er allerdings anders akzentuiert als das Alte Testament. Die griechischen Götter erscheinen zwar manchmal in Wolken, sie haben selbst aber keine Wolkengestalt. Die Verführung der Io durch Zeus geschieht nur deshalb durch Verhüllung des Gottes in einer Wolke, weil Hera getäuscht werden soll. Wo sich der eigentlich strahlend-helle Olymp in 1 Siehe zu den Kurztiteln das Literaturverzeichnis am Ende „Von Homer bis Joseph Beuys verbirgt die Wolke in erster Linie, sie hüllt die Götter ein, die sich mit Blitz und Donner melden können.“ (Busch, Wolken zwischen Kunst und Wissenschaft 18) 2 Wolken hüllt, da verbirgt er sich den Menschen, um die Kommunikation mit diesen zu stören oder sie zu beeinflussen. 3 Denn eigentlich ist Klarheit das prägende Attribut der Götterwelt; die Menschenwelt ist es demgegenüber, in der es Unklarheit, Nebel, Diffusion, Schmerz und Unfaßlichkeit gibt. Hier hat das Unkonturierte seinen Ort, und der dumpfe Schmerz gleicht bei Homer der Wolke. 4 In Erinnerung daran, wie Götter ihre Überlegenheit u.a. dadurch anzeigen, daß sie sich dem Menschen auf verhüllte Art zeigen, werden sie vielfach als Gestalten vor- und dargestellt, die von einem Nimbus umgeben sind. Das Wort ‚Nimbus’ hat zunächst eine meteorologische Bedeutung (Wolke, Regenguß), bezeichnet dann einen Indikator des Transzendenten, wird in einer säkularisierten und verwissenschaftlichten Welt aber wieder zum (meteorologischen) Fachbegriff, zum Namen eines wissenschaftlich klassifizierten Wolkentypus. 5 Aber selbst in einer Welt, die an das Numinose nicht mehr glaubt, erscheinen Wolken manchmal noch als Erinnerung an dieses, als Verheißung möglicher Transgression in eine andere Sphäre, als Andeutung von Geheimnisvollem. („Es ist gewiß etwas sehr Geheimnisvolles in den Wolken (...). Sie ziehn und wollen uns mit ihrem kühlen Schatten auf und davon nehmen (...).“ (Novalis, Heinrich von Ofterdingen. Schriften I/330).) ( 2 ) Darstellung des Transzendenten, Darstellung des Unsichtbaren Die Erinnerung daran, daß überirdische Wesen sich in Wolken hüllen, wenn sie dem Menschen erscheinen, macht sich in der Geschichte künstlerischer Darstellungen des Transzendenten durch Entwicklung eines bestimmten Typus von Bildelement geltend: des Bildmotivs Heiligenschein, Aura oder Nimbus. Dabei verbindet sich das Motiv der nimbusartigen Umhüllung eng mit der Vorstellung, daß der Himmel Raum des Jenseitigen ist; der Wolken-Nimbus ist ja ein Stück ‚Himmel’. Gottes- und Heiligendarstellungen der christlichen Welt setzen das Wolkenmotiv ein, um den Himmel darzustellen, vor allem aber um Momente zu zeigen, in denen sich Heiliges dem Blick offenbart und insofern visuell mit der Erde und ihren Bewohnern kommuniziert. Wolken werden zu Vehikeln, auf denen - und zu Rahmen, in denen Gott und die Heiligen erscheinen (beispielsweise im Fall von Raffaels Dresdner Madonna). 6 Malerisch dargestellt werden sie als Medien des Transfers vom Diesseits ins Jenseits und umgekehrt – zu Schwellen und Übergangszonen zwischen dem Irdischen und dem Überirdischen, manchmal regelrecht als Transportvehikel, als Flug-Zeuge. Zudem stehen Wolken metonymisch für den Himmel, „der sonst, wenigstens tagsüber, bis auf seine Bläue nur gestaltlos anzuzeigen wäre“ (Lämmert, Wolkenlehre 342). Und so kommt es in der Wolkenmalerei zur Visualisierung von Unsichtbarem, was auch heißt: zum konstruktiven Umgang mit Unsichtbarkeit. Lessing deutet – daran erinnert Lämmert, Wolkenlehre (341) – die Wolke als ein Zeichen für ‚Unsichtbarkeit’, das auch Maler nutzen können: 3 Goethes „Prometheus“-Gedicht spielt hierauf an („Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst“). „Homer akzentuiert an den Wolken das Grenzenlose, aller Fassung und damit Gestalt sich Verweigernde, wenn er etwa von der ‚dunklen Wolke des Schmerzes’ (Ilias XVII, 591) oder von der ‚dunklen Wolke des Todes’ (Ilias IV, 274 u.ö.) spricht. der Sitz der Götter, der Olymp, ist nicht von Wolken umhüllt, er liegt ‚in himmlischer Klarheit wolkenlos’ (‚anephelos’, odyssee VI, 42).“ (Greiner, Nimbus 67) 5 „Die Geschichte der Wolken wird als Wortgeschichte eines bestimmten Wolkentypus, des ‚Nimbus’ in der Klassifikation Howards, entfaltet. Lateinisch ‚nimbus’ bezeichnet Wolke, auch Regenguss. Eine weitergehende Bedeutung hat das Wort aus der Vorstellung gewonnen, Götter würden, in Wolken gehüllt, den Menschen erscheinen, was eine mythische Welt anzeigt, in der Gott und Mensch, Himmel und Erde nicht grundlegend geschieden sind, wofür die Wolken als natürliche Zeichen der Verbindung zwischen beiden sich nahelegen. Der mit ‚Nimbus’ aufgerufene mythische Gehalt der Wolken ist, so das Gedicht, im Zeitalter ausdifferenzierter Wissenschaften, in dem sich die Meteorologie als Teildisziplin der Physik etabliert hat, entschwunden.“ (Greiner, Nimbus 66) 6 Busch: „In der barocken Tradition ist der Himmel auch der Erscheinungsort Gottes und der himmlischen Heerscharen, schon deswegen, weil er nicht zugänglich und vor allem weil er unendlich ist, nicht mess- und begreifbar. Das entsprach dem Göttlichen. Im barocken Deckenfresko, besonders in Kirchenräumen, versammelt sich das Überirdische, hier wird das Göttliche anschaulich vorgestellt. Und von da wirkt es in den Gemeinderaum. Nicht selten strömt das Himmelslicht durch eine Öffnung der Kuppel im Unterbau der Laterne ein, füllt den Raum mit göttlichem Licht (...). Das Himmlische und der Himmel sind sinngesättigt, damit als Unfassbare zugleich auch Projektionsfläche oder Projektionsraum unendlicher Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte. Da der Himmel aber ebenso Unwetter, Blitz und Donner schicken kann, ist er auch als Bedrohung zu erfahren, als Gottes Strafe für den Sünder (...).“ (Busch, Wolken zwischen Kunst und Wissenschaft 16) 4 „(...) diese Wolke ist hier eine wahre Hieroglyphe, ein bloßes symbolisches Zeichen, das den befreiten Held[en] nicht unsichtbar macht, sondern den Betrachtern zuruft; ihr müßt ihn euch als unsichtbar vorstellen.“ (Lessing, Laokoon, Erster Teil, Kap. XII, Werke Bd. 6, hg. Albert von Schirnding, München 1974, 93f.) Wolken haben in der Literatur, so Lämmert, Wolkenlehre (343), über die Funktion zur Darstellung einer Szene hinaus fast immer einen ‚instrumentellen oder allegorischen Zweitsinn’. Ein besonders wichtiges Thema der Wolkenmaler ist die „Unsichtbarkeit dessen, was sie [die Wolkenformationen] anzeigen sollen“ (Lämmert, Wolkenlehre 345). 7 Als Rahmen um oder als bergende Hülle vor das Heilige gelegt, besitzen gemalte Wolken eine darstellungsreflexive Dimension. Signalisieren sie doch nicht nur, daß hier irgendetwas visuell dargestellt wird, was eigentlich undarstellbar ist, weil man es ja eben nicht sehen kann – sie demonstrieren exemplarisch damit auch, was Maler alles können. Einerseits Elemente von Bildkompositionen, welche das Unsichtbare, das Immaterielle, das Transzendente zur Erscheinung bringen, verweisen gemalte Wolken als Darstellungen sich entziehender Naturerscheinungen andererseits aber doch auch wieder auf das Ungreifbare, das Unfaßliche des Dargestellten. Denn sie können ja auch das verbergen, worum es geht – so wie Grenzen einerseits trennen, andererseits Grenz-Räume eröffnen, in denen Übergänge möglich sind. Auf vielen Gemälden sind Wolken die „sichtbare Grenze zwischen Erde und Himmelreich“ (Lämmert, Wolkenlehre 341); die Wolke ist „Blickwand“ (342) – aber eben eine, die ein ‚Dahinter’ suggeriert und insofern zur Grenzüberschreitung stimuliert. Für Lessing plausibilisieren gemalte Wolken als Unterlagen schwebender Heiligen- und Götter-Erscheinungen zudem deren Schweben. Ein fliegendes Wesen einfach in die Luft hinein zu malen, wäre der angestrebten malerischen Illusion eher abträglich, während eine gemalte Wolke auch zwischen Vorstellbarem und Unvorstellbarem vermittelt. Gemalte Wolken sind in mehrfachem Sinn Grenz-Fälle von Repräsentation – die Wolke grenzt implizit Nichtrepräsentierbares gegen Repräsentiertes ab (als Rahmen), ebnet aber auch die Grenze zwischen Nichtrepräsentierbarem und Repräsentierbarem ein, indem sie andeutend ins Reich des Materiellen zieht, was wir uns als immateriell denken sollen. Was Wolken auf konkreten Gemälden bezogen auf das Göttliche und Transzendente jeweils an- und bedeuten sollen und können, hängt maßgeblich von den spezifischen Vorstellungen ab, die man sich unter den jeweiligen kulturell-religiösen Rahmenbedingungen darüber macht, ob und ggf. wie das Göttliche sich den menschlichen Sinnen überhaupt offenbart. In der katholischen Glaubenswelt geht man von der Möglichkeit einer physischen Selbstoffenbarung Gottes innerhalb der sinnlichen Welt aus. Hier besitzt das Wolkenmotiv eine andere Semantik und kann malerisch zu ganz anderen Zwecken eingesetzt werden als in einem protestantischen Glaubenshorizont, der die Idee solch physisch-sinnlicher Offenbarungen grundsätzlich ablehnt. Auch auf ‚protestantischen’ Bildern allerdings können Wolken auf Gott verweisen: Sie können dazu beitragen, die göttliche Schöpfung darzustellen - nicht aber den Schöpfer selbst! Sie erinnern – als Bestandteile von Landschaftsdarstellungen - an die Vorstellung, daß Gott unsichtbar präsent ist, auch und gerade, wenn er sich selbst nicht zeigt. Und als Naturerscheinungen gemalt, mögen ‚protestantische’ Wolken (in Abgrenzung gegen ‚katholische’ Wolken’) vielleicht sogar andeuten, daß sie eben nichts anderes sind, als Naturphänomene und Schöpfungswerk, keineswegs aber Wunderzeichen, die den Aberglauben der Katholiken bekräftigen könnten. 8 7 Vgl. Lämmert über Wolken und das Numinose: „Mythische Begebenheiten, Figuren und Naturerscheinungen werden gebraucht, um sinnlich erfahrbare Zeichen für diejenigen Mächte zu setzen, an die man glauben kann nur unter der Bedingung, daß sie dauernd unsichtbar bleiben. Die von Menschen selbst geschaffenen Gewölke um den Dreifuß des Delphischen Orakels oder die Vision von Hexenküchen stehen dafür, und selbst die künstlichen Verdampfungen auf dem Bühnenboden, um Theaterhelden oder auch nur Rock-Sänger ins Mythische zu erhöhen, bilden dazu die (...) Schwundstufen. Aber auch die sind noch Beweismittel dafür, daß der Mensch nicht nur Klarsicht, sondern von Fall zu Fall auch Wolken braucht, um seine Vorstellungskraft zu erweitern oder höhere Mächte willig anzuerkennen.“ (Lämmert 343) 8 Anläßlich eines Gemäldes („Christus am Kreuz aus Wolken gebildet“, 1734) von Louis Silvestre, schreibt Busch: „Bei Silvestre entbirgt die Wolke etwas, das eigentlich unsichtbar ist. So konkret der Körper sich zu bilden scheint, zugleich (...) ist er uns auch wieder entzogen. so ist die Wolkenmetapher in der Lage, tieferen religiösen Sinn zum Vorschein zu bringen, jedenfalls in katholischer Tradition. (...) . (19) Unabhängig von (oder doch nicht determiniert durch) konfessionelle Differenzen, werden Wolken zu Markierungen der Grenze zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit – und zugleich zu Zeichen für diese Grenze. Als Hinweise auf Unsichtbares (und als implizite Hinweise auf die Fähigkeit der Maler, Unsichtbares sinnlich zu repräsentieren), können gemalte Wolken aber nicht nur in Bezug auf einen religiös-theologischen Bedeutungshorizont fungieren. Sie verweisen auch unter anderen Akzentuierungen auf schwer oder gar nicht Faßliches, auf die Grenzen des Vorstellbaren. Auch die sich der Vergegenwärtigung entziehende Vergangenheit, die vom Konturverlust bedrohten, schemenhaften Erinnerungsbilder, Schreckens- und Wunschbilder finden im Motiv der Wolke eine reflexiv gebrochene, aber einprägsame Repräsentation. 9 So knüpfen sich an die Betrachtung von ziehenden Wolken in Goethes „Faust II“ Visionen, die zugleich ein „Lebensüberblick“ des soeben auf einer Wolke im Gebirge angekommenen Protagonisten und eine Antizipation von Künftigem ist (vgl. die Textauszüge am Ende). Wolken sind vieldeutig; sie sammeln gleichsam ‚Wolken’ von Bedeutungsoptionen um sich. 10 Als Repräsentationen von An-sich-Unsichtbarem werden sie in dem Maße zu wichtigen sinnlichen Zeichen, als des der literarischen und bildkünstlerischen Darstellung um „Unsichtbares“ geht. Auch und gerade die immaterielle Dimension des Psychischen, der Erinnerung, der Sehnsucht, der Hoffnung und der Angst findet daher ‚wolkige’ Gestaltungen. 11 ( 3 ) Säkularisierung des Himmels (a): zu Howards Typologie der Wolken und Goethes Howard-Rezeption An der semantischen Differenz zwischen ‚heaven’ und ‚sky’ wird eine historisch signifikante Verschiebung im Umgang mit dem „Himmel“ ablesbar, die das Zeitalter der Säkularisierung charakterisiert. Der Himmel wird von einem Raum der Transzendenz zu einem Bereich des Raums der Immanenz. Damit verbunden sind Bemühungen, den Himmel zu bereisen (also: zu fliegen), die physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Himmelserscheinungen wissenschaftlich zu erfassen (also auch die der Wolkenerscheinungen) und zu benennen; die Wolken werden klassifiziert und bekommen ihre Namen im Rahmen wissenschaftlicher Klassifikationen. 12 Den Weg für diese Umcodierung des Interesses am Himmel und der Auseinandersetzung mit ihm bahnen u.a. Darstellungen und Interpretationen von „Landschaft“. In der Landschaftskunst werden Wolkenformationen bereits im Vorfeld der Aufklärung gelegentlich als konstitutive Bestandteile eines säkularen Raumes aufgefaßt (während sie auf religiösen Darstellungen nebenher auch noch – und bis heute – die Funktion des Verweises auf Transzendentes haben können), eines Raumes der immanenten und prinzipiell erschließbaren (...) nach protestantischer Überzeugung offenbart sich Christus nicht dem Gläubigen, auch nicht im Akt der Wandlung. Glaubensgewissheit ist dem Protestantismus fremd, und besonders streng in dieser Hinsicht sind die Calvinisten. So fragt sich, was denn Wolken im calvinistischen Holland des 17. Jahrhunderts sein konnten. Die Vorstellung der Entbergung Gottes aus den Wolken wäre ihnen unvorstellbar (sic) gewesen. Doch so genau die holländische Wolkenbeobachtung gewesen zu sein scheint, eine eigentlich naturwissenschaftlichmeteorologische Begründung findet sie nicht.“ (Busch, Wolken zwischen Kunst und Wissenschaft 18f.) [Stehen demnach die ‚protestantischen’ Wolken für die ‚ausbleibende’ Offenbarung Christi?] - Busch über die protestantischen Wolken: Erstens kann man wohl die „Wolkendominanz holländischer Bilder (...) als nationales Identifikationsmerkmal betrachten“ (20f.); dazu komme aber noch etwas Weiteres: „Wenn die Wolken nicht durchschaubar waren und auch nichts Göttliches offenbaren konnten, so waren sie doch Gottes Schöpfung und als solche wert, dargestellt zu werden. (...) So können die Wolken, auch und gerade in ihrem ungreifbaren Wandel, in ihrem ewigen Anderssein, Gottes permanente unsichtbare Anwesenheit bezeugen.“ (Busch, Wolken zwischen Kunst und Wissenschaft, 21) 9 „(...) wegen ihrer Vielgestaltigkeit sind Wolken (...) vorzügliche Mittler, um Erinnerungsbilder neu zu beleben, also um nicht mehr Sichtbares zu vergegenwärtigen“ – so Lämmert (Wolkenlehre 345). 10 Lämmert weist darauf hin, daß sie in emblematischen Darstellungen allenfalls „hilfreiches Beiwerk“ sind. „Es ist (...) die uneingegrenzte Vielgestaltigkeit und obendrein die Übergänglichkeit ihrer Erscheinung, die eine feste Zuordnung von Bild und Spruch nur schwer zustandekommen läßt.“ (Lämmert, Wolkenlehre 350) Eine allegorisch-emblematisch vermittelbare „Lebenslehre“ lasse sich entsprechend schwer an sie knüpfen. 11 Als im 18. Jg. „sensible erfahrungem Seelenbewegungen und Gemütslagen“ zum Kernthema der Literatur werden, wird die Wolke wichtiges literarisches Motiv: in ihrer Beziehung zu „Vorstellungen, Erinnerungen und Sehnsüchte(n), die den gelebten Augenblick übersteigen.“ (Lämmert, Wolkenlehre 350) 12 Die Einstellung zum Himmel ändert sich grundlegend, wenn der „(...) Himmel säkularisiert [wird], weil man mittels Ballon in ihn aufsteigen kann und seine Bestandteile zu analysieren sind, [und weil] man begreift, was Wolken sind und warum sie steigen und fallen und dabei ihre Form verändern“ (Busch, Wolken zwischen Kunst und Wissenschaft, 16) Gesetzen unterworfen ist. Bezogen auf Wolken sind dies natürlich in erster Linie physikalische Gesetze, aber auch Gesetze des Sehens - eines menschlichen Wahrnehmens der Welt, dessen Ordnungen transparent gemacht werden können und sollen, auch wenn es sich nicht um absolute Ordnungen handelt. 13 Im Zeichen einer transzendentalphilosophischen Wende, die nach den Bedingungen menschlicher Welterfahrung fragt, und eines vertieften Bewußtseins für die Prägung der erfahrenen Welt durch die Organe der Wahrnehmung selbst kann es nicht mehr um die Frage gehen, was Wolken ‚sind’, sondern vielmehr darum, wie und als was sie wahrgenommen und erfahren werden, wie und als was sie auf den Betrachter wirken. 14 Wolkenfigurationen stimulieren mehr noch als andere Naturphänomene zu einer solchen reflexiven Besinnung auf die produktiv-konstruktive Seite aller Wahrnehmung und Erfahrung – laden sie doch dazu ein, Interpretationen auf sie zu projizieren, in ihnen etwas zu ‚sehen’, das der jeweiligen subjektiven Disposition zum Sehen, den jeweils subjektiven Interessen entspricht. Naturwissenschaftlich Wolkenbebachter sind durch die Wolken in ganz besonderer Weise herausgefordert. Verspricht eine Systematisierung und physikalische Fundierung des Wolkenwissens doch vertiefende Aufschlüsse über meteorologische Gesetzmäßigkeiten, über atmosphärische Phänomene, über den Funktionszusammenhang des irdischen Lebensraums. Aber welche Gesetze liegen dem scheinbar regellosen, jedenfalls aber oft unberechenbaren Spiel der Wolken zugrunde? Wolken bilden in ihrer Übergänglichkeit und Flüchtigkeit eine besondere Provokation, wenn es darum geht, bestimmende und klassifizierende Begriffe zu finden, auf denen sich ein gesichertes systematisches Wissen gründen läßt, und mittels dieser Begriffe gesetzliche Bedingungszusammenhänge erschließen zu wollen – einmal ganz abgesehen von der Frage nach prognostischen Möglichkeiten, die sich aus einem begrifflichsystematischen und gesicherten Wetter-Wissen ergeben könnten. Lässen sich Wolkenwelten begrifflich kartieren? Läßt sich das annähernd Gestaltlose, jedenfalls hochgradig Metamorphotische der Wolkenerscheinungen auf Grundgestalten zurückführen, die sie ihrerseits klassifizieren und in ihren Relationen zueinander auf eine verallgemeinernde Weise so beschreiben lassen, daß hinter den jeweils besonderen Erscheinungen allgemeine Gesetzlichkeiten greifbar werden? Gerade am Wolkenwissen scheint sich die differenzierende Kraft der Begriffe bewähren zu müssen. 15 Einen folgenreichen Vorschlag zur differenzierenden Klassifikation von Wolken-Typen machte im Zeichen dieses Interesses an einer Kartierung der Wolken der Engländer Luke Howard. Seine Abhandlung „On the Modification of Clouds“ erschien 1803. 16 Wie ihr Titel andeutet, ging es Howard nicht allein um die Beschreibung von Wolken, sondern um das, was deren „Modifikation“ bewirkte, also um die Regelmäßigkeiten hinter dem Gestaltwandel. Howard differenziert zwischen vier Grundtypen von Wolkenformationen, die er als ideelle Konstrukte begreift, auf die sich die wandelbaren Wolkenformen als konkrete Phänomene allerdings beziehen lassen, auch wenn sie nicht die ideale Repräsentation des jeweiligen 13 Vgl.: Jonathan Crary, Techniken des Betrachtens. Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert. Übers. v. A. Vonderstein, Dresden 1996. Vgl. ferner Busch, Wolken zwischen Kunst und Wissenschaft, 16: „Erst im 19. Jahrhundert werden Wolken klassifiziert und bekommen Namen. Dafür war die Luft- und Gasforschung verantwortlich, Voraussetzung dafür war das Ende der aristotelischen Elementenlehre. Doch Wolken fanden auch zuvor Interesse. Welches holländische Bild des 17. Jahrhunderts kommt ohne sich auftürmende Wolkenberge aus? (...) Auf holländischen Bildern nimmt der Himmel häufig mehr als drei Viertel der Bildfläche ein. In gewissem Sinn ist er der Hauptgegenstand, und mit ihm steuern die Maler die Licht-Schatten-Verteilung auf Erden und im Himmel.“ 14 „Die Vorstellung von der göttlichen Erfülltheit des Himmels endet, wenn er in seine Bestandteile zerlegt wird (...). Doch der Weg der Purifikation des Himmels von allem Glaubensmäßigen ist nicht einem immanent naturwissenschaftlichen, etwa allein meteorologischen Fortschritt zu verdanken, vielmehr hängt er in der bildenden Kunst eng mit der Entstehung von Wahrnehmungs- und Wirkungsästhetik zusammen, die den Anteil des Betrachters am Erkenntnisprozess und damit an der Sinnproduktion zu analysieren suchen. Perzeption und Rezeption werden Thema (...).“ (Busch, Wolken zwischen Kunst und Wissenschaft, 22) 15 „Im frühen 19. Jahrhundert bildet sich, auch literarisch, eine neue, nicht mehr mythisch-religiös, sondern wissenschaftlich geleitete Hinwendung zu den Wolken aus. Sie werden zum Gegenstand der Naturwissenschaft, wobei ihr dynamisches Wesen im Zentrum steht, ihr ständiger Gestaltwechsel, ihre Flüchtigkeit, die einen Halt für naturgesetzliche Bestimmungen zu verweigern scheinen. (72) So bieten sich die Wolken als ein genuines Feld der Metamorphose dar, zu der die Frage nach dem Bleibenden im Wandel der Gestalt und nach dessen Begreifbarkeit gehört.“ (Greiner, Nimbus 71f.) 16 Dazu Richard Hamblyn: Die Erfindung der Wolken. Wie ein unbekannter Meteorologe die Sprache des Himmels erforschte. Übers. v. Ilse Strasmann, Frankf./M./Leipzig 2003, hier 142-154. Typus sind. Neben den Howardschen Grundtypen, deren Namen noch heute geläufig sind – Cirrus, Cumulus, Stratus und Nimbus – gibt es für Howard Mischformen zwischen den Typen. Howard begründet die verschiedenen Typen physikalisch, indem er von einem Schichtenmodell der Atmosphäre ausgeht, von dem sich die entsprechenden Formationen physikalisch gemäß jeweils spezifischen Bildungsregeln ableiten lassen. Auf ein nachhaltiges Interesse stößt Howards Wolken-Typologie bei Goethe, der die Schrift „On the Modification of Clouds“ 1815 in einer Übersetzung, 1818 dann im Original liest, da er sich nachhaltig die naturwissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit Wolken interessiert. Nachdem er auf seiner zweiten Schweiz-Reise 1779 schon Wolken gezeichnet hat, wird er durch Gilberts „Annalen der Physik“ 1815 erstmals mit der Wolkenklassifizierungen Howards bekannt. In der englischen Ausgabe (1818-1820) sieht er auch Howards Illustrationen. 17 Howards Konzept ideeller Grundtypen, die den wechselhaften und variantenreichen Phänomenen zugrundelagen und damit eine Einheit im Wandelbaren begründeten, kam seinem eigenen Ansatz zur Modellierung natürlicher Erscheinungen entgegen, wie er sich etwa in den spekulativen Bemühungen Goethes um die „Urpflanze“ geltend macht. Das Konzept der Metamorphose, der metamorphotischen Entfaltung von Grundtypen, sowie die Idee einer sich darin manifestierenden Stetigkeit der Naturscheinungen hatte Goethe bis dahin bezogen auf organische Gebilde und auf die als stetig hypostasierte Naturgeschichte beschäftigt; Howards Wolkenlehre gestattete die Erweiterung auf den Bereich des Anorganischen. Für Goethe war diese Konzeptualisierung der Wolken also mehr als eine einzeldisziplinäre Spezialtheorie. Sie machte aus seiner Sicht sinnfällig, daß Einzelphänomene stets auf Ideen bzw. Idealtypen zu beziehen sind, welche sich von der Wissenschaft begrifflich bezeichnen lassen, daß das Einzelphänomen aber niemals exakt seiner Idee entspricht, sich entsprechend auch nie ganz begrifflich fassen läßt – wobei es gleichwohl dazu stimuliert, das Allgemeine zu suchen, auf das es bezogen ist. Eine Wolkentheorie wie die Howards eignete sich aus Goethes Perspektive dazu, die Spannung zwischen Einheitlichem und Vielgestaltigem im Zeichen der Idee des Wandels zu überwinden, und die Wolke machte für ihn eine „Einheit von Gestaltung und Entstaltung (...), von Werden und Vergehen“ sinnfällig (Greiner, Nimbus 73). Unter dem Eindruck der Goetheschen Howard-Studien entstehen zwei Texte: der Gedichtzyklus „Howards Ehrengedächtnis“ sowie den Aufatz „Wolkengestalt nach Howard“; hier fließen die Howardschen Unterscheidungen zwischen Wolkentypen ein. Als Lyriker spielt Goethe auf diese ebenfalls an. Der Gedichtzyklus „Howards Ehrengedächtnis“ enthält anschließend an ein Einleitungsgedicht je ein Gedicht zu Howards Wolkentypen: „Stratus“, „Kumulus“, „Cirrus“, „Nimbus“. 18 Auch der Vers „Wie Streife steigt, sich ballt, zerflattert, fällt“, läßt sich auf die Unterscheidung von Stratus, Cumulus, Cirrus und Nimbus beziehen. So demonstriert der Zyklus durch sich selbst erstens die für Goethe maßgebliche Leistung des Gedichts, in Symbolen – hier der Wolke – Ideen sinnfällig zu machen, zweitens aber auch den Anspruch, zwischen diesen Ideen und wissenschaftlicher Begrifflichkeit zu vermitteln. 19 ( 4 ) Säkularisierung des Himmels (b): Ausflüge in den Himmelsraum Aber nicht nur die im frühen 19. Jahrhundert erfolgenden Ansätze zur begrifflichen Kartierung des Wolken-Himmels und zur Begründung einer systematischen physikalischen Meteorologe sind relevant für die Semantik der Wolken im 19. Jahrhundert. Fahrten in Luftschiffen, wie sie seit einer spektakulären Ballonfahrt auf dem Pariser Marsfeld 1783 – 17 Die zunächst formlos erscheinenden Wolken nehmen so für Goethe Gestalt an (Busch, Wolken zwischen Kunst und Wissenschaft, 24). Goethe, Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche (Frankfurter Ausgabe), 1. Abt., Bd. 2: Gedichte 1800-1832, hg. v. Karl Eibl. Frankf./M.1988, 503. 19 „Genuines Feld, Ideen zur Anschauung zu bringen, ist, durch ihr Vermögen zum Symbol, die Poesie; die wissenschaftliche Klassifikation bildet Wahrnehmungen durch Zuordnen von Begriffen zur Erkenntnis. Goethe zielt auf Zusammenführen von Idee und Begriff (...). In diesem Sinn stellt er Howards Wolkenlehre selbst wissenschaftlich und poetisch vor (...).“ (Greiner 73) 18 unternommen wurden, standen aus mentalitätsgeschichtlicher Sicht auch in einer Beziehung zur Geschichte der Säkularisierung; sie arbeiteten der ‚Entgötterung’ des Himmels vor, weil Vorstöße des Menschen in die Lüfte aus diesem mit Glaubensvorstellungen traditionell besetzten Raum einen Leerraum werden ließen. Der Mensch selbst konnte die Welt jetzt so ‚von oben’ sehen, wie es einst Gott getan hatte. 20 Übernommen aus dem Französischen, bürgerte sich für den Aufstieg von Luftschiffen auch in Deutschland der Ausdruck „ascension“ ein, der bisher vor allem zur Bezeichnung der Himmelfahrt Christi gedient hatte. 21 Der Franzose Nicolas François Blanchard unternahm zwischen 1784 und 1809 riskante Ballon-Flugreisen, welche die zeitgenössische Öffentlichkeit faszinierten und den Luftschiffer weithin berühmt machten – nicht zuletzt infolge des Presseechos, das seine Luftreisen fanden, bis er 1809 bei einem Absturz ums Leben kam. Aufstiege ins Reich der Wolken sowie Beobachtungen von Wolken und Gewittern werden im 19. Jahrhundert zu wichtigen Sujets literarischer Darstellung. Jean Paul läßt seinen Luftschiffer Giannozzo („Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch“, 1800) mit einer Montgolfiere in den Himmel aufsteigen. Er ist dabei ein Vertreter jener säkularisierten Haltung gegenüber dem Himmel, für den dieser ein Luft-Raum, aber kein Raum oder auch nur Sinnbild der Transzendenz mehr darstellt. Seitenhiebe Giannozzos gelten aber auch jenen fortschrittsoptimistischen zeitgenössischen Schwärmern, die mit dem in der Luftfahrttechnik bezeugten technischen Fortschritt das Ziel der Menschheitsgeschichte nah glaubten. 22 ( 5 ) Wolkenbeobachter: Poetische Wolkentexte und Wolkenmalerei des 19. Jahrhunderts Vor dem Hintergrund der neuzeitlich-säkularen Geschichte des Wolken-Wissens, wie sie insbesondere durch Howards Theorie repräsentiert wird, aber auch im Zeichen einer Tendenz zur poetisch-symbolischen Überhöhung solchen Wissens werden Wolken und bewölkte Himmelsräume im 19. Jahrhundert zu einem wichtigen poetischen Motiv. In Percy Byssehe Shelleys Gedicht „The Cloud“ (1820) ist es eine Wolke, die spricht; sie schildert, welche Wege sie nimmt und was sie dabei bewirkt. 23 Aus den Meeren und Flüssen schöpft sie Wasser, das sie lebenspendend über das Land ausgießt, sei es als Tau, Regen oder Hagel – der Donner des Gewitters ist dabei ihr Lachen. Wenn sich die Wolke bei ihrer Tätigkeit auch verausgabt und vom Wind wie vom Sonnenschein schließlich aufgelöst wird, so geht sie doch nicht zugrunde. Indem sie sich nach einem Gewitter und seinem Regenbogen in Himmelsblau verwandelt, weiß sie doch, daß sie im Durchgang durch den gestaltwandel wiederkehren wird; der Himmel ist ihr Grab, aber sie Auferstehung ist gewiß. Veränderlich wie sie ist, stirbt die Wolke doch nie. „I am the daughter of Earth and Water, And the nursling of the Sky; I pass through the pores of the ocean and shores; I change, but I cannot die.“ 24 Auch Adalbert Stifter gewinnt der Auseinandersetzung mit Wolken verschiedene für sei Werk und seine Ästhetik prägende Bedeutungsfacetten ab. 25 Gerade die Entdeckung des 20 Vgl. Dazu auch Sabine Eickenrodt: Augen-Spiel. Jean Pauls optische Metaphorik der Unsterblichkeit. S. 214. Eickenrodt, Augen-Spiel 218. Die Analogie von Dichtern und Luftschiffern wird bei Jean Paul vielfach durchgespielt, und Flüge und Flugobjekte gehören zu seinen wichtigsten poetologischen Metaphern, und. In der Vorrede zum „Komet“ wird das geplante Werk selbst mit einem Flugobjekt verglichen, mit einem aus diversen Papieren zusammengeklebten „Papierdrachen“, den der Autor als „Spielsache gegen das elektrische Gewölke wolle zum Schere, zum Untersuchen und zum Ableiten steigen lassen, wenn der rechte Wind dazu bliese.“ (I/6,569f.) Sehr ähnlich wird in der „Clavis Fichtiana“ der Text als ein „fichtischer papierner Drache“ bezeichnet, der „in die anti-fichtische Wetterwolke auffahren“ solle (I/3,1023); der „Komet“ wird mit einem „Papierdrachen“ verglichen. Im „Leben Fibels“ soll die „papierne Bespannung“ eines Drachens den Stoff zur Darstellung der „Epiphanie“ des Autors Fibel liefern. (Studienhefte zum „Komet“, SW II/6, 292). Vgl. Eickenrodt, Augen-Spiel 219. 23 vgl. Lämmert, Wolkenlehre 353. 24 Percy Bysshe Shelley: The Cloud (1820). In: P.B. Shelley_ Ausgewählte Werke, ausgew. v. Manfred Wojcik, Frankf./M. 1990, 136. 25 Vgl. Adalbert Stifter, Historisch-Kritische Gesamtausgabe Bd 4.2, 34f. und 37f. 21 22 vermeintlich „Wesenlosen“ wird unter verschiedenen Akzentuierungen wichtig. So handeln seine Texte von Versuchen, wetterprognostisch in Wolkenformationen zu lesen, thematisieren anläßlich von Wolken die Frage nach Sicherheit oder Unsicherheit menschlichen Wissens. Erörtert wird aber auch die Frage, ob sich Atmosphärisches malen läßt. Stifters Erzählung „Katzensilber“ berichtet davon, wie eine kleine Gruppe von Menschen um ein Haar einem lebensgefährlichen, weil mit heftigem Hagel verbundenen Gewitter entgeht. Das Erfahrungswissen der alten Großmutter reicht trotz ihrer Naturnähe nicht aus, um die Himmelszeichen richtig zu deuten; sie täuscht sich, von einem bei aller Erfahrung dich unsicheren Wissen geleitet, in den vermeintlich harmlosen Wolkenformationen. Ein wildes und naturverbundenes Mädchen hingegen (dessen rätselhafte Herkunft niemals geklärt wird und das als eine letztlich flüchtige zeitweilige Begleiterin der Familie mit einer vorüberziehenden Wolke manches gemeinsam hat) versteht die Wolken, obwohl es sein Wissen verbal nicht kommunizieren kann - und trifft lebensrettende Vorsichtsmaßnahmen. In der Malerei des 19. Jahrhunderts nehmen Wolkendarstellungen eine prominente Stellung ein. Dabei spielt der durch die zeitgenössische Wolkentheorie eröffnete Vorstellungsraum eine signifikante Rolle, überlagert allerdings durch eine ausgeprägte Tendenz, Wolken und Wolkenformationen metaphorisch oder symbolisch zu interpretieren. (Diese Tendenz ist aus Goethes Perspektive ja bei Howard bereits angelegt, insofern dieser mit seiner Konzeption von Grundtypen der Wolken ideelle Einheiten im Wechselhaften und Mannigfaltigen heraushebt.) Bei aller Aufmerksamkeit für meteorologische Wolkenstudien setzen sich die Maler natürlich andere Ziele als die, einschlägige Diskurse zu illustrieren, aber die Inszenierung von Landschaften mit Wolkenformationen ist von der wissenschaftlichen Semantisierung der Wolken doch nicht abzukoppeln. 26 Verzeitlichung und Wandel, Flüchtigkeit der Erscheinungen und die Frage nach Beständigkeit im Wechsel, nach Einheit in der Vielfalt, nach Kohärenz in der zeitbedingten Dissolution aller Dinge – diese Themen verbinden wissenschaftliche und künstlerische Bestrebungen und Modellierungen. Die Reflexion über Zeitlichkeit kann auch als Grundanliegen solcher Maler gelten, die den Himmel weiterhin als Bild oder Metapher des Transzendenten gestalten. Bei Caspar David Friedrich lassen sich Wolken und Nebel in ihrer Positionierung zwischen Himmel und Erde als Symbole einer Kommunikation zwischen endlicher Welt und Unendlichkeit interpretiert werden – einer Kommunikation an der Grenze zur Immaterialität, die sich in solch bedeutungsgeladenen meteorologischen Phänomenen gleichwohl sichtbar andeutet. 27 Für Wolken- und Nebel-Maler des 19. (sowie auch des 20. Jahrhunderts) maßgeblich ist insbesondere der semantische Horizont, der durch die Begriffsoppositionen von Dauer und Flüchtigkeit, Beständigkeit und Wandel, Vielfalt und Einheit in der Natur umrissen wird. Die Wolke wird zum Sinnbild einer Welt, die sich zwischen diesen Polen als eine durch und durch verzeitlichte Welt immer wieder neu konfiguriert, deren Erscheinungen sich ständig im Übergang zwischen Werden und Vergehen befinden – oder auch (und in Zusammenhang damit) zu Symbolen für das Leben in seiner Flüchtigkeit, seiner Ungreifbarkeit und seiner Regenerationskraft – letzteres ist ja eine Idee, die auch in Shelleys Wolken-Gedicht poetisch entfaltet wird. 28 26 Johannes Stückelberger betont nicht Unrecht die Unterschiede; ergänzend wäre aber von den Konvergenzen naturkundlicher und klünstlerischer Auseinandersetzung mit den Wolken auszugehen. (Johannes Stückelberger, in: Wolkenbilder des 20. Jahrhunderts, in: Wolken. Welt des Flüchtigen. (Katalog, erschienen anläßlich der Ausstellung gleichen Titels, Wien 22.3.-1.7.2013), Ostfildern 2013, 2735): „In der Darstellung der Natur wurden um 1800 neue Sichtweisen erschlossen, die auch für das 20. Jahrhundert wegweisend blieben. (...) Wie in der Meteorologie lässt sich auch bei den Künstlern um 1800 eine neue und intensivierte Beschäftigung mit Wolken feststellen. Doch während die Meteorologen in jenen Jahren vor allem daran arbeiteten, die vielfältigen Formen von Wolken zu systematisieren, wobei hier besonders Luke Howard zu nennen ist, interessierten sich die Maler vor allem dafür, wie der sich dauern verändernde Wolkenhimmel eine Landschaft in immer neuem Licht erscheinen lässt.“ (Stückelberger, Wolkenbilder des 20. Jahrhunderts, 27) 27 „In vielen Bildern [C. D.] Friedrichs, senken sich die wolken auf die erde nieder, beziehungsweise steigen Nebel aus den Tälern auf. Wie Friedrich mithilfe der Wolken den Himmel gleichsam auf die Erde holt, kann als bildliche Umsetzung dessen interpretiert werden, wie sein Freund (...) Schleiermacher Religion definiert: als Anschauung des Unendlichen im Endlichen.“ (Stückelberger, Wolkenbilder des 20. Jahrhunderts, 28; Verweis auf Friedrich Schleiermacher: Über die Religion. Rede an die Gebildeten unter ihren Verächtern, Stuttgart 1969) 28 „Constables und Friedrichs Darstellungen der Wolken in ihrer Flüchtigkeit sind Metaphern für eine Welt, die sich dauernd neu erschafft. Hodlers Landschaftsbilder, in denen Erde und Himmel spiegelbildlich aufeinander bezogen sind, können als Metaphern für die Einheit der John Constable schuf sich selbst durch zahlreiche Wolkenstudien eine „Wolkensprache“ mit vielen Ausdrucksnuancen. Er folgte beim Malen der eigenen Stimmung, die er ins Bild einfließen lassen wollte, suchte gerade in den verschiedenen Wolkenphänomenen und – formationen also eine Ausdrucks- und Kommunikationsmöglichkeit für Subjektives, an deren Möglichkeit nur glauben kann, wer von einer inneren Korrespondenz zwischen meteorologischen Erscheinungen und innerpsychischen Regungen ausgeht. 29 Doch nicht nur deshalb nehmen Constables Wolkenbilder in der Geschichte der Wolkenmalerei eine wichtige Stellung ein. Denn er setzte sich zudem nachhaltig mit einem Problem auseinander, das sich dem Wolkenmaler wegen der Flüchtigkeit und Unkonturiertheit seiner Objekte grundsätzlich stellt, mit dem in der Kunstgeschichte aber unterschiedlich umgegangen worden war – und das nun, im Zeichen eines intensivierten Bewußtseins von Verzeitlichung und Wandel virulenter denn je erschien: Wie läßt sich der Inbegriff des Wandelbaren und Vergänglichen in ein Bild bannen? Welche Art von Bild kann einer Wolke gerecht werden, die doch stets im Übergang ist, deren momentane Erscheinung also ihrem zeitlich-flüchtigen wesen stets nur unzulänglich entspricht? Constable experimentierte mit einer Darstellungstechnik, die die Bewegung der Wolke im Malakt nachbildete, also mit einer malerischen Manifestation von Bewegungen, deren Resultate auf der Leinwand keine kalkulierten Abbilder mehr waren – sondern, zumindest im Ansatz, Zufallsbilder. 30 ( 6 ) Wolkenbilder als Stimulationen der Phantasie und Zufallsbilder in der Malerei Indem mit dem späten 18. Jahrhundert in der Philosophie, der Anthropologie, der Ästhetik und den Künsten die Frage nach den jeweils subjektiven Bedingungen von Wahrnehmung virulent wird, indem insbesondere der Anteil der Einbildungskraft an der Konstitution der Wirklichkeit zu einem Kernthema literarischer Reflexion wird, gewinnt die Wolke als Erfahrungsgegenstand an Brisanz. Haben doch seit je her Wolken ihre Betrachter dazu stimuliert, in ihnen Gestalten zu sehen – und insofern Anlaß dazu geboten, sich des Anteil der Imagination an Erfahrungsprozessen bewußt zu werden. Wolkenformen in ihrer Variabilität und Beweglichkeit laden dazu ein, als ‚Bilder’ von allerlei Wesen und Erscheinungen betrachtet zu werden (wobei dem Betrachter in der Regel durchaus klar ist, daß es sich nicht um Bilder im engeren Sinn handelt, sondern um Zufalls-Bilder, Bilder ohne intentional abbildenden Urheber). Wolkengestalten lösen Assoziationen aus, reizen die Phantasie – und ihre Veränderlichkeit hält die Produktivität dieser Phantasie in Gang. Die eigentlichen ‚Bilder’ werden durch den Anblick der Wolken im Betrachter selbst erzeugt. Die Genese von Bildern der Imagination, die Zufallskonfigurationen am Wolkenhimmel als Gegenstände respektive als deren Bilder deutet, steht im Mittelpunkt einer Szene aus Shakespeares „Hamlet“. Der Titelheld zeigt dem Höfling Polonius (der sich nicht gerade durch Willensstärke und Rückgrat auszeichnet, sondern sich anzupassen und anderen willfährig zu sein sucht) eine Wolke und schlägt ihm mehrere Deutungen vor – die Wolke erscheint nacheinander als Abbild verschiedener Tiere -, und Polonius geht auf all diese Deutungsangebote ein, obwohl er sich damit widerspricht; zugleich verzichtet er darauf, einen eigenen Deutungsvorschlag der Wolke zu machen. Die Szene läßt – hierin selbst der thematisierten Wolke analog – mehrere Deutungen zu: Will Hamlet, der hier das lebhafte und widerspruchsfreudige Spiel seiner Phantasie demonstriert, mentale Überspannung und Welt gelesen werden. Stieglitz deutet seine Wolkenbilder selbst als Metaphern für das Leben.“ (Stückelberger 35). Zu weiteren WolkenSemantiken in der Malerei vgl. ebda.: „Arps Zufallsbilder sind Metaphern dafür, dass der Zufall einen Großteil unserer Wirklichkeit bestimmt. Francis Bacon versteht seine Wolkenbilder als Metaphern für das Erhabene, das und Ängstigt, das und aber auch erhebt. Und [Gerhard] Richter praktiziert in seinen abstrakten Wolkenbildern eine Malmethode, die er metaphorisch als ‚Methode des Lebendigen’ umschreibt.“ (Stückelberger, Wolkenbilder des 20. Jahrhunderts, 35) 29 Vgl. dazu Busch, Wolken zwischen Kunst und Wissenschaft, 24. 30 „(...) John Constable (...) erkannte, dass man die in dauernder Bewegung und Veränderung begriffenen Wolken nicht abmalen, sondern nur analog nachbilden kann. Das Wolkenstudium diente ihm dazu, eine Technik auszubilden, die es ihm erlaubte, die schnell sich verändernden Phänomene in der Natur zu erfassen.“ (Stückelberger, Wolkenbilder des 20. Jahrhunderts, 27) Verwirrung simulieren; steckt hinter seiner Entscheidung, sich interpretierend an einer Wolke auszutoben, ein metaphorisch-verschlüsselter Topos, nämlich die Gleichsetzung des eigenen Geistes mit einer Wolke und ihrer Flüchtigkeit? 31 Agiert er als ein Künstler, der durch seine Phantasie die anderen dazu anleitet, Erscheinungen zu interpretieren? Oder demonstriert er dadurch, daß er Polonius diverse Sichtweisen suggeriert, die dieser annimmt, die eigene Überlegenheit über den willenlosen Höfling? Robert Musils Ulrich interpretiert Polonius als Unseresgleichen – und sieht darin die von Hamlet/Shakespeare ‚sichtbar’ gemachte Bedeutung der Szene. „Die Wolke des Polonius, die bald als ein Schiff, bald als Kamel erscheint, ist nicht die Schwäche eines nachgiebigen Höflings, sondern bezeichnet ganz und gar die Art, in der uns Gott geschaffen hat.“ (Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. Reinbek 1978, 1435) Als Bildungen des Zufalls betrachtet, schienen sich die Wolken von der Malerei in den Dienst künstlerischer Darstellung nehmen zu lassen - was vor allem dann relevant wurde, wenn letztere als eine primär von der Phantasie geleitete Tätigkeit erschien. Schon Plinius hatte behauptet, daß der Zufall ‚Wahres’ darstellen könne (Naturalis historia, Buch 35). Die Renaissance, insbesondere Leonardo, interessiert sich für Zufallsbilder in ihrer Wirkung auf eine kreative Phantasie, die in ihnen aus eigener gestalterischer Kraft heraus Vieles und Unterschiedliches sehen kann. 32 Zufallsbilder stimulieren einer solchen Ästhetik der Imagination zufolge die Phantasie der Maler (die in Wolkenfiguren und anderen nichtintentionalen Bildungen Gegenstände und Ereignisse sehen mochten) ebenso wie die der Rezipienten (die in malerisch geschaffenen Zufallsbildern Abbilder sehen sollten). 33 Leonardo legitimiert gegenüber dem kritischen Botticelli das Zufallsbild als Stimulation der Phantasie, die, so angeregt, ihrer Macht innewird - auch beim Anblick von Wolkenfigurationen: „So sagte unser Botticelli, dies Studium sei eitel, denn wenn man nur einen Schwamm voll verschiedenerlei Farben gegen die Wand werfe, so hinterlasse dieser einen Fleck auf der Mauer, in dem man eine schöne Landschaft erblicke. Es ist wohl wahr, dass man in einem solchen Fleck mancherlei Erfindungen sieht - d. h. ich sage, wenn sie Einer darin suchen will nämlich menschliche Köpfe, verschiedene Thiere, Schlachten, Klippen, Meer, Wolken oder Wälder und andere derlei Dinge, und es ist gerade, wie beim Klang der Glocken, in den kannst du auch Worte hineinlegen, wie es dir gefällt. Aber obschon dir solche Flecken Erfindungen geben, so lehren sie dich jedoch nicht irgend einen besonderen Theil zu vollenden.“ 34 Und Vasari erzählt in den „Viten“ von dem florentinischen Maler Piero di Cosimo: „Bisweilen blieb er vor einer Mauer stehen, gegen welche kranke Leute lange gespuckt hatten, und schuf sich daraus Reiter und Schlachten, die seltsamsten Städte und die größten Landschaften, welche je gesehen worden sind. Dasselbe that er mit den Luftgebilden der Wolken.“ (Vasari 1985, III 78.) 31 Zu dieser Deutung vgl. Greiner: „Hamlet drängt Polonius immer neue Deutungen einer Wolkenformation auf, um so einen Zustand geistiger Verwirrung zu markieren (III, 2)“ (Greiner, Nimbus 71 – als ein Beispiel dafür, „daß Shakespeare die wandelbare Wolke zum Gleichnis macht für einen „Menschen, der sich verlorengeht“, 71; vgl. auch ‚Antonius und Kleopatra’ IV, 12) 32 Für Leonardo da Vinci stellt das Sehen bereits einen produktiven Prozeß dar, der Konfigurationen schafft. Sein inventorisches Vermögen kann er an Zufallsbildern besonders gut üben. „Ich werde nicht ermangeln unter diese Vorschriften eine neu erfundene Art des Schauens herzusetzen, die sich zwar klein und fast lächerlich ausnehmen mag, nichtsdestoweniger aber doch sehr brauchbar ist, den Geist zu verschiedenerlei Erfindungen zu wecken. Sie besteht darin, dass du auf manche Mauern hinsiehst, die mit allerlei Flecken bekleckst sind, oder auf Gestein von verschiedenem Gemisch. Hast du irgend eine Situation zu erfinden, so kannst du da Dinge erblicken, die diversen Landschaften gleichsehen, geschmückt mit Gebirgen, Flüssen, Felsen, Bäumen, grossen Ebenen, Thal und Hügeln in mancherlei Art. Auch kannst du da allerlei Schlachten sehen, lebhafte Stellungen sonderbar fremdartiger Figuren, Gesichtsmi(e)nen, Trachten und unzählige Dinge, die du in vollkommene und gute Form bringen magst.“ (Leonardo da Vinci 1970, S. 57-58, zit. nach Hoffmann-Praeger, S. 141) 33 „(...) lange war man überzeugt, die Wolken seien Zufallsbildungen. Festhalten im Moment können wir sie nur, wenn wir Gestalten in sie projizieren (...). Seit Plinius’ Naturgeschichte existiert der Topos, dass auch ‚in der Malerei der Zufall die Naturwahrheit’ schaffen kann. [dazu: Plinius, Naturkunde, Buch 35, Farben, Malerei, Plastik. Hg. u. übers. v. Roderich König, München 1978, S. 80] Das war leicht als Kreativitätsmodell zu verstehen: Im (...) bewusstlosen künstlerischen Tun kann Gestalt entstehen und zugleich eine an- und aufgeregte Fantasie in allen nur denkbaren Bildungen ganze Schlachten, Landschaften oder Städte sehen (Leonardo).“ (Busch, Wolken zwischen Kunst und Wissenschaft, 17) 34 Leonardo da Vinci, zit. nach Hoffmann/Praeger S. 142. - „Dass man in den Wolken einen Elefanten, einen Hund oder was auch immer entdeckt, diese Sicht auf die Wolken beziehungsweise allgemein auf die Natur hat eine lange Tradition, die bis in die antike zurückreicht und an die Leonardo anknüpft mit seinen Empfehlungen an junge Maler, sie sollten, wenn sie Anregungen für neue Bilder bräuchten, auf eine alte fleckige Mauer schauen, in die Glut eines Feuers oder in die Wolken.“ (Stückelberger, Wolkenbilder des 20. Jahrhunderts, 29; Verweis auf Leonardo da Vinci, Treatise on Painting, hg.v. Philip Mahon, Princeton 1956, Bd. 1, S. 50-51, 93, 333) In Wackenroders und Tiecks teilweise auf Vasari beruhenden „Herzensergießungen“ wird diese Episode Jahrhunderte später noch einmal erzählt. 35 Renaissance-Gemälde, auf denen Wolken zu sehen sind, spielen gelegentlich auf diese Produktivität der Einbildungskraft an. Auf Mantegnas Darstellung des Heiligen Sebastian nimmt eine Wolke die Gestalt eines Reiters an, und wie Werner Busch betont, steckt hinter diesem Bildeinfall ein darstellungsreflexiver Impuls – ein Bewußtsein vom bildnerischen Prozeß als solchem. 36 Für Lichtenberg, der über das Hineinsehen von Formen und Figuren in nicht-artifiziell erzeugte Ausschnitte der sichtbaren Welt jahrhunderte später nachdenkt, ist das Bedürfnis, Gesichter und Landschaften auch dort zu sehen, wo sich kein Gesicht zeigt, keine Landschaft geschaffen wurde, ein Hinweis auf die Neigung des Menschen, in allem Seinesgleichen zu sehen und sich folglich bei aller Beobachtung der Dinge letztlich sich selbst zu beobachten – in dem Sinn, daß er auf diese Dinge jeweils Eigenes projiziert und folglich den Selbstbespiegelungen nicht entkommt. 37 Der Maler und Zeichenlehrer Alexander Cozens (1717-1786) hat das Zufallsbild als wichtigen Katalysator künstlerischer Produktivität geschätzt. Er veröffentlichte 1759 einen „Essay to facilitate the inventing of landskips“; hier stellte er eine Klecks-Methode vor, die er „blotting“ nannte. 1785/86 folgte eine umfassendere Darstellung: „A new method of assisting the invention in drawing original compositions of landscape“. Cozens betrachtet die Kleckskunst als didaktisches Hilfsmittel. Er empfiehlt Schülern der Malkunst seine Klecksmethode anstelle des Kopierens – und sogar anstelle des Malens von Landschaften „nach der Natur“. Er selbst produzierte Landschaftsstrukturen aus Tintenklecksen (blots), setze also bewußt den (gesteuerten) Zufall ein. Cozens erinnert dabei an Leonardo, betont jedoch, er selbst gehe in der Verwendung von Zufallsbildern anders vor als dieser, da er letztere selbst erzeuge. Zwischen Klecksen und Skizzieren besteht für ihn ein grundlegender Unterschied: bei letzterem gehe die Idee dem Bild begründend voran; das Bild ist mimetisch bezogen auf eine Bild-Idee. Klecksen dient demgegenüber der Generierung von Ideen. Zu den wichtigsten Künstlern des 19. Jahrhunderts, die sich für Zufallsbilder nicht nur interessierten, sondern diese auch selbst hervorbrachten, gehört Victor Hugo, der u.a. Klecksbilder produzierte. Für Hugo haben die beim Spazierengehen gesehenen „Landschaften“ der französischen Küstenregion einen analogen Status wie die selbsterzeugten Zufallsbilder: sie sind Appelle an den Blick, ihn ihnen Formen zu entdecken. Auf eine Interpretation der eigenen Zufallsbilder verzichtete Hugo oft, um den Betrachter zur Hypothesenbildung einzuladen. Experimente mit durch gesteuerte Zufälle entstehenden Phantasie-“Landschaften“ haben später dann vor allem die Surrealisten angestellt, wie etwa Max Ernst, der die Technik der Frottage entwickelte. 35 In den „Herzensergießungen“ (HKA, hg. v. S. Vietta, S. 102) heißt es anläßlich der „Seltsamkeiten des alten Malers Piero di Cosimo“: „So hatte er [...] einen geheimen Reiz, bey allen Mißgeburten in der physischen Natur, bey allen monströsen Thieren und Pflanzen, lange zu verweilen; er sah sie mit unverrückter Aufmerksamkeit an, um ihre Häßlichkeit recht zu genießen; er wiederholte sich ihr Bild nachher immerfort in Gedanken, und konnte es, so widrig es ihm auch am Ende ward, nicht aus dem Kopf bringen. Von solchen mißgeschaffenen Dingen hatte er nach und nach, mit der schärfsten Ämsigkeit, ein ganzes Buch zusammengezeichnet. Oft auch heftete er seine Augen starr auf alte, befleckte, buntfärbige Mauern, oder auf die Wolken am Himmel, und seine Einbildung ergriff aus allen solchen Spielen der Natur mancherley abentheuerliche Ideen zu silden Schlachten mit Pferden, oder zu großen Gebirgslandschaften mit fremdartigen Städten.“ 36 Wie Busch betont, „ist die Vorstellung (18) von der Fantasie als eigenständigem Produzenten in erster Linie ein Produkt der frühen Renaissance, weshalb sich erste Wolkendarstellungen, in denen sich Gestalten abzeichnen, auch erst ab diesem Zeitpunkt finden. Einer der Ersten, der dies gestaltet hat, dürfte Mantegna gewesen sein, der gleich ein berühmtes Beispiel liefert mit seinem ‚Heiligen Sebastian’ im Wiener Kunsthistorischen Museum, wo die Wolken oben links sich in einen Wolkenreiter verwandelt haben, der vorbeigaloppiert. Er mag mit tieferer Bedeutung befrachtet sein, etwa als vorüberziehender Zeitengott, er mag auf antike Erwähnungen von Wolkenbildern rekurrieren, entscheidend (...) ist, dass er hier Bild geworden ist, Dies setzt die malerische Möglichkeit voraus, zwischen Darstellung und nur erscheinender Darstellung unterscheiden zu können: Dafü ist ein besonderer Wirklichkeitszugriff vonnöten, wie ihn Mantegna (...) erreicht. selbst wenn es im Symbolismus und im Surrealismus des 19. und 20. Jahrhunderts die eine oder andere aus den Wolken geborene Figur gibt [Busch erinnert in einer Anm. u.a. an Dalí], so besteht bei diesen Beispielen kein Zweifel daran, dass es sich um psychische Projektionen handeln soll. Die Wolken gestalten sind nicht mehr Bildzeichen, die einem verbindlichen Text des Bildes zuarbeiten.“ (Busch, Wolken zwischen Kunst und Wissenschaft 17f.) 37 „So sieht man im Sand Gesichter, Landschaften usw. die sicherlich nicht die Absicht dieser Lagen sind. Symmetrie gehört auch hieher. Silhouette im Dintenfleck pp. Auch die Stufenleiter in der Reihe der Geschöpfe, alles das ist nicht in den Dingen, sondern in uns. Überhaupt kann man nicht genug bedenken, daß wir nur immer uns beobachten, wenn wir die Natur und zumal unsere Ordnungen beobachten.“ (Lichtenberg, Sudelbücher J 681) ( 7 ) Sprachwolken – Wolkensprache Wenn der alttestamentarische Jahwe dem Volk Israel in einer Wolke erscheint, um zu ihm zu sprechen, so läßt dies Wolke und Rede immerhin schon in eine potenzielle metonymische Beziehung treten; Bernhard Greiner weist daraufhin, daß im hebräischen Text des AT davon die Rede ist, daß das Volk Israel die Stimme des Herrn ‚sehe’, als es die Wolke sieht (Exodus, 20,18) – eine in Übersetzungen meist unterschlagene Bildlichkeit (‚Sehen der Stimme’). Aber auch metaphorische Beziehungen zwischen Wolken und Rede, Wolken und Wörtern, Wolken und Sprache haben eine lange Geschichte. In Aristophanes’ Komödie „Die Wolken“ („Nephelai“) sprechen die Wolken selbst mit: Hier tritt ein Chor von Wolken unter einer Chorführerin auf und bestreitet wichtige Teile des Dialogs. Gegenstand der komödiantischen Kritik sind die ‚wolkig’-nebulösen Reden der philosophischen Sophisten, als deren Hauptvertreter Sokrates agiert; die Wolken sind im Bund mit diesen Philosophen, welche sich vom ‚Nebel’ ihrer substanzlosen Reden ernähren und ihren zahlenden Kunden und Schülern damit ‚blauen Dunst’ vormachen. Die Wolken sind hier personifizierte Metaphern einer Redekultur, die sachlich substanzloses Blendwerk, damit aber eminent gestaltenreich und insofern wirkmächtig sein kann. Sie werden von Sokrates „die einzigen Götter“ genannt – verbunden mit einer Lehre vom Wasserkreislauf und der These, nicht die Götter erzeugten Donner und Blitz, sondern die Wolken beim Gewitter, wenn sie bersten und platzen. Auch in der Komödie „Die Vögel“ setzt Aristophanes das Bild der Wolken als Sinnbild der Substanzlosigkeit und Formbarkeit ein, um kritikwürdige Formen des Sprachgebrauchs zu bespiegeln. Wolkenkuckucksheim ist eine Stadt in den Wolken, die die Vögel gegründet haben, welche sich damit als Störenfriede zwischen Erde und Himmel, Menschen und Götter drängen. Der griechische Name „nephelekokkygia“, zusammengesetzt aus nephele: Wolke und kokkyx: Kuckuck, verweist auf das „Kuckucks“-hafte der Vögelstadt, die sich auf Kosten anderer breit macht und gedeiht – und wiederum zielt die Kritik auf eine Anmaßung, die sich verbal artikuliert und die für die wortgewandten philosophischen Weltausleger charakteristisch ist: die Anmaßung, zwischen Erde und Himmel zu treten und deren Beziehungen zueinander als Zwischen-Instanz zu kontrollieren. 38 Solche Wolkenreiche wie das, das hier Menschen und Götter voneinander trennt, um ihren Verkehr kontrollieren und davon einträglich leben zu können, entstehen durch Wortverdrehereien. Insofern ist das Wolkenreich mit seinem neologistischen Namen Sinnbild des Reichs der (verdrehbaren und mißbrauchbaren) Worte. 39 Elfriede Jelinek knüpft mit ihrem Stück „Wolken.Heim“ (1990, Urauff. 1988) an die „Wolken“ des Aristoteles an; auch dieser Text steht im Zeichen der kritischen Auseinandersetzung mit Formen des Sprachgebrauchs. Der Text ist kompiliert aus Zitaten und Redeweisen deutscher Philosophen und Dichter, die so ausgewählt und arrangiert werden, daß sie auf gefährliche Weise einen gewalttätigen Nationalismus zumindest vorbereiten. Wort-Wolken ohne sichtbare und bestimmbare Urheber ziehen gleichsam auf und deuten auf Unheilvolles voraus. 40 38 „Sich durch Worteverdrehung ein einträgliches Wolkenreich zu schaffen, spitzt die Komödie ‚Die Vögel’ zur Vorstellung einer Stadt der Vögel in den Wolken zu, indem man die Sphäre, ‚polos’, zwischen Himmel und Erde als den Vögeln (70) ureigen zukommend, zu einer Stadt, ‚polis’, bilde, die den Verkehr zwischen Himmel und erde unterbricht, ihren Bewohnern Wohlleben von dem Zoll verheißt, den sie für diesen Verkehr von nun an erheben. (...) in der Sphäre der Wolken macht sich mit dem Erfinder der Wolkenstadt ein MenschenKuckuck breit, der alsbald die Vögel tyrannisieren und die Götter zu Bittstellern erniedrigen wird, indem er trennt, was bisher produktiven Umgang miteinander hatte: Götter und Menschen, Himmel und Erde.“ (Greiner: Nimbus 69-70) 39 Greiner, Nimbus, 70: Aristophanes thematisiere die „Selbstermächtigung des Menschen zum neuen Herrn in den Wolken“, die hier dem Lachen preisgegeben werde. 40 Elfriede Jelinek: Wolken.Heim. In: E. Jelinek. Stecken, Stab und Stangl / Raststätte / Wolken.Heim. Neue Theaterstücke. Reinbek 1997. Vgl. Greiner, Nimbus, 70: Jelineks Stück „Wolken. Heim“, auf Aristophanes anspielend, verweise auf „einen jüngeren geistesgeschichtlichen Ort, die Selbstermächtigung des Ichs in der deutschen idealistischen Philosophie“. (70) „Der Kuckuck fehlt nur scheinbar. Wie es sein Wesen ist, macht er sich in fremdem Nest breit, hier dem Sprachmaterial des Stücks: gewollt bösartig aus dem Zusammenhang gerissene Zitate aus Reden Fichtes, Gedichten Hölderlins, Dramen Kleists, Vorlesungen Hegels und der Rektoratsrede Heideggers 1933, die, verstärkt durch leichte Entstellung von Wörtern und Sätzen, einen nationalistischen Unterton hören lassen, als Rede Auf das alttestamentarische Vorstellungsbild des sich in einer Wolke verbergenden Gottes spielt Walter Benjamin an, indem er in seinen Kindheitserinnerungen von einem Mißverständnis erzählt, das sich an eine Fehldeutung von gehörten Wörten knüpfte: 41 Als Kind habe er, so Benjamin, die Erwachsenen von der „Muhme Rehlen“ sprechen gehört, dies aber für den Namen rätselhafter Wesen („Mummerehlen“) gehalten. Und so hat sich die „Muhme Rehlen“ für ihn in Wörter gehüllt – analog zum sich in eine Wolke hüllenden alttestamentarischen Gott. 42 Selbst Wortbenutzer, kann man von solchem Mißverständnis, so suggeriert Benjamin, allerdings lernen: Fehlgehörte Worte können die Phantasie stimulieren (so wird aus einem „Kupferstich“ ein „Kopf-verstich“), und in solchen Wörtern zu leben lernt das Kind selbst früh: „Beizeiten lernte ich es, in die Worte, die eigentlich Wolken waren, mich zu mummen“ (Benjamin IV/1, 261). Das Fehl-Hören als produktiver Impuls tritt in dieser Kindheitserinnerung als auditives Pendant neben das ‚falsche’ und dabei produktive Sehen von Gestaltungen in Zufalls- in Wolkenbildern: als eine Herstellung von Korrespondenzen. „Wenn ich (...) mich und das Wort entstellte, tat ich nur, was ich tun mußte, um im Leben Fuß zu fassen. (...) Die Gabe Ähnlichkeiten zu erkennen, ist ja nichts als ein schwaches Überbleibsel des alten Zwangs, ähnlich zu werden und sich zu verhalten.“ (Benjamin IV/1, 261) Ferdinand de Saussure spricht auch metaphorisch über „Wolken“, wo er über Sprache reflektiert. Er setzt dabei jedoch einen ganz anderen Akzent: Nicht die Sprache ist ‚wolkig’ im Sinne von konturlos; vielmehr dient sie der Konturierung des Denkens, das ohne die Unterstützung der Wörter ‚wolkig’ bliebe. „Das Denken, für sich allein genommen, ist wie eine Nebelwolke, in der nichts notwendigerweise begrenzt ist. Es gibt keine von vornherein feststehenden Vorstellungen und nichts ist bestimmt, ehe die Sprache in Erscheinung tritt.“ (Ferdinand de Saussure: Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaft. Berlin 1967. S. 133) Eine entfernte Reminiszenz an die Wort-Wolken des Alten Testaments und der Antike mögen die Sprechblasen im Comic sein: wolkenartige Gebilde, die den sprachlichen Anteil der erzählten Geschichten vorstellen. Wolkiger noch als die Blasen, die tatsächlich gesagte Worte repräsentieren, sind die Denkblasen. ( 8 ) WOLKEN – aus den Blickwinkeln des Naturforschers und des Philologen Der Germanist Eberhard Lämmert hat in einem Aufsatz von 1997 die sehr unterschiedlich ausgeprägten Interessen der Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt am Thema Wolken verglichen. 43 Für Alexander, den Naturforscher, der „messend und beschreibend die Gesetzlichkeiten der Natur fassen möchte“, sind Wolken wenig interessant; sie entziehen sich der „exakten Naturbeobachtung“ und werden allenfalls flüchtig (und als etwas Flüchtiges) erwähnt. 44 Wilhelm, der Sprachforscher, interessiert sich für „Wolken“ – und zwar für das StichWORT „Wolke“ und seine vielen Bedeutungen. „Wer das Wort Wolke ausspricht, denkt sich weder die Definition noch Ein bestimmtes Bild dieser Naturerscheinung. Alle verschiedenen Begriffe und Bilder derselben, alle Empfindungen, die sich an ihre Wahrnehmung anreihen, alles endlich, was nur irgend mit ihr eines sich seiner selbst vergewissernden, in der Abgrenzung gegen andere sich als vorrangig behauptenden ‚Wir’ (das deutsche Volk). Suggeriert wird, dass diese Wolken entstellter philosophischer Menschen-Worte, analog der Komödie des Aristophanes, Himmel und Erde, das heißt hier: Wirklichkeit und Vernunft, gerade trennt, die die zitierten Autoren doch zusammenführen zu wollen behaupten.“ (Greiner, Nimbus 70) 41 Walter Benjamin, Die Mummerehlen (Berliner Kindheit um Neunzehnhundert): 42 Benjamin, so Greiner, setze die Passage in Bezug zur jüdischen „Verheißung, mit der aus entstalteten Wörtern gebildeten Wolke den als Wolke den Menschen sich darbietenden Worten Gottes zu ent-sprechen“ – also zu einer „jüdische(n) Urszene des Sehens der Wolke als präsentischer Stimme des mit seinem Volk sich verbindenden Gottes“ (Greiner 69) 43 Eberhard Lämmert: Kleine literarische Wolkenlehre. In: Lämmert, Eberhard: Erfahrungen mit Literatur. Gesammelte Schriften. Hrsg. von Wolfgang Maaz und Werner Röcke. Mit einem Vorw. der Hrsg. und einem Nachw. von Peter-André Alt. – Hildesheim: Weidmann, 2012. S. 338-355 44 Lämmert bezieht sich auf: Alexander von Humboldt: Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. In: Studienausgabe, hg.v. Hanno Beck. Bd. VII, 1. Darmstadt 1993. S. 307 und 310. Vgl. Lämmert, Wolkenlehre 338. und ausser uns in Verbindung steht, kann sich auf einmal dem Geist darstellen, und läuft keine Gefahr, sich zu verwirren, weil der Eine Schall es heftet und zusammenhält.“ (Wilh. v. Humboldt: Latium und Hellas oder Betrachtungen über das classische Alterthum. In: Ges. Schriften, Bd. III=Werke III, hg. Albert Leitzmann. Berlin 1904, 169.) Nicht ein integrierender Begriff, sondern der „Schall“ des Wortes „Wolke“ hält also für Wilhelm von Humboldt die differenten Vorstellungen zusammen, die sich an ihn knüpfen. Lämmert bemerkt dazu die beiden Haltungen Alexanders und Wilhelms stünden exemplarisch für die verschiedenen „Verfahren“ und die unterschiedliche „Materie“, bei Naturwissenschaftlern hier, Sprach- und Literaturwissenschaftlern dort: „Während der Naturforscher gar nicht umhin kann, eine Fülle weiterer Differenzierungen zu treffen und dazu ein System von neben- und unterordnenden, aber auch kontrastierenden Begriffen zu entwickeln, steht der Literaturwissenschaftler vor der Aufgabe, sich der außerordentlichen Fülle von Empfindungen und Bedeutungen anzunehmen, die allein das Wort ‚Wolke’ im Sprachgebrauch und vollends in der Prosaliteratur und in der Poesie entfalten kann.“ (Lämmert, Wolkenlehre 340) Daß Lämmert diesen Unterschied zwischen den Gegenständen der Natur- und denen der Literaturwissenschaft ausgerechnet anläßlich des Stichworts „Wolke“ erläutert, ist kein Zufall; geht es bei den Gegenständen letzterer doch gleichsam um etwas ‚Wolkiges’: etwas, das sich als lockeres Gebilde, als ‚Gegenstand’ betrachten läßt, aber doch nicht ‚greifen’ läßt: die ‚Wolke’ als Metapher einer unkonturierten Pluralität von Bedeutungen. (Insofern auch an die metaphorischen Potenziale von „Wolken“ gedacht ist, die sich gerade nicht definitorisch bestimmen lassen, ist die „Wolke“ eine Metapher der metaphorischen Rede.) Am Beispiel der unterschiedlichen Gegenstände, die sich der Reflexion anläßlich des Stichworts „Wolke“ eröffnen, erörtert Lämmert zwei differente, aber komplementäre Dimensionen literaturwissenschaftlichen Interesses an Texten: Es ist erstens immer auch das an literarisch dargestellten Gegenständen in ihrer Differenziertheit – an Gegenständen eines Wissens, das von den diversen Wissensdisziplinen bereitgestellt und verwaltet wird. Zweitens aber sind es die Vorstellungen, die sich an Wörter heften – und damit die Bedeutungspotenziale, die Wörter und Wortverbindungen über ihre konventionelle Bezeichnungsfunktion Funktion hinaus besitzen. (Man könnte Lämmerts Differenzierung vielleicht mit dem Begriffspaar Denotation und Konnotation erläutern.) „Natürlich gibt die Literatur auch Auskünfte über die physische Erscheinungsform der Wolken und über den Segen, die sie dem Landwirt, und die Gefahren, die sie dem Bergsteiger oder auch dem Piloten bringen. (...) Was jedoch die Wolken in der Literatur interessant macht, sind nicht bloß die Wolken selbst, sondern erst und vor allem das, was der Mensch in seiner Phantasie aus ihnen machen kann. Welche Macht üben Wolken aus auf sein Assoziationsvermögen, seine Einbildungskraft, seine Wunschund seine Albträume?“ (Lämmert, Wolkenlehre 340) Während man es den Meteorologen überlassen könne zu sagen, was Wolken sind, frage die Literaturwissenschaft danach, was sie dem Menschen bedeuten (Lämmert, Wolkenlehre 340). Verwendete Literatur • Walter Benjamin: Die Mummerehlen. (Aus: Berliner Kindheit um Neunzehnundert). In: Gesammelte Schriften Bd. IV/1 (Kleine Prosa. Baudelaire-Übertragungen). Hg. Tilman Rexroth, Frankf./M. 1991, 260-261. • Werner Busch: Wolken zwischen Kunst und Wissenschaft. In: Tobias G. Natter / Franz Smola: Wolken. Welt des Flüchtigen. (Katalog, erschienen anläßlich der Ausstellung gleichen Titels, Wien 22.3.-1.7.2013), Ostfildern 2013, 16-26. • Werner Busch: Himmelsdarstellungen in der Malerei bis zum 18. Jahrhundert. In: Werner Wehry / Franz J. Ossing (Hg.): Wolke, Malerei, Klima in Geschichte und Gegenwart, Berlin 1997, 73-97. • Werner Busch: Die Ordnung im Flüchtigen – Wolkenstudien der Goethezeit. In: Sabine Schulze (Hg.): Goethe und die Kunst. Ausst.-Kat. Schirn Kunsthalle Frankfurt; Kunstsammlungen zu Weimar, Stiftung Weimarer Klassik. Ostfildern-Ruit 1994, 518-527. • • • • • • • • • • • • • • • Hubert Damisch: Theorie der Wolke. Für eine Geschichte der Malerei. Aus d. Frz. v. Heinz Jatho, Zürich/Berlin 2013 Sabine Eickenrodt: Augen-Spiel. Jean Pauls optische Metaphorik der Unsterblichkeit. Göttingen 2006. Hans Magnus Enzensberger: Die Geschichte der Wolken, 99 Meditationen. Frankf./M.2003. Johann Wolfgang Goethe: Wolkengestalt nach Howard, 1820. In: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche (Frankfurter Ausgabe), 1. Abt., Bd. 25: Schriften zur allgemeinen Naturlehre, Geologie und Mineralogie. Hg. v. Wolf v. Engelhardt u. Manfred Wenzel. FfM 1989, 216. Bernhard Greiner: Nimbus: Wolken in der Literatur. in: Wolken. Welt des Flüchtigen. (Katalog, erschienen anläßlich der Ausstellung gleichen Titels, Wien 22.3.-1.7.2013), Ostfildern 2013, 6676. Durs Grünbein: „Brief über die Wolken“. In: Galilei vermißt Dantes Hölle. Aufsätze 1989-1995. Frankf./M. 1996, 105-116 Richard Hamblyn: Die Erfindung der Wolken. Wie ein unbekannter Meteorologe die Sprache des Himmels erforschte. Übers. v. Ilse Strasmann, Frankf./M/Leipzig 2003. (Zu Luke Howard.) Stefan Kutzenberger: Wolken und Striptease. Ein etymologischer Schleiertanz. In: Wolken. Welt des Flüchtigen. (Katalog, erschienen anläßlich der Ausstellung gleichen Titels, Wien 22.3.1.7.2013), Ostfildern 2013, 77-81. Eberhard Lämmert: Kleine literarische Wolkenlehre. In: E.L.: Erfahrungen mit Literatur. Gesammelte Schriften. Hrsg. von Wolfgang Maaz und Werner Röcke. Mit einem Vorw. der Hrsg. und einem Nachw. von Peter-André Alt. – Hildesheim: Weidmann, 2012, 338-355, zuerst in: Werner Wehry / Franz J. Ossing (Hg.): Wolke, Malerei, Klima in Geschichte und Gegenwart, Berlin 1997, 9-24. Jean-Francois Lyotard, Gott und die Marionette. In: ders.: Das Inhumane, 3. Aufl. Wien 2006, 259-277. Tobias G. Natter / Franz Smola: Wolken. Welt des Flüchtigen. (Katalog, erschienen anläßlich der Ausstellung gleichen Titels, Wien 22.3.-1.7.2013), Ostfildern 2013 Marília Librando Rocha: Unsichtbare Wolken. Eine Poetik der Latenz und Nuance. In: Hans Ulrich Gumbrecht / Florian Klinger (Hg.): Latenz. Blinde Passagiere in den Geisteswissenschaften. Göttingen 2011, 135-148 Albrecht Schöne: Goethes Wolkenlehre. In: Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen für das Jahr 1968. Göttingen 1969, 26-48. Percy Bysshe Shelley: The Cloud (1820). In: P. B. Shelley: Ausgewählte Werke, ausgew. v. Manfred Wojcik, Frankf./M. 1990. Johannes Stückelberger, in: Wolkenbilder des 20. Jahrhunderts, in: Wolken. Welt des Flüchtigen. (Katalog, erschienen anläßlich der Ausstellung gleichen Titels, Wien 22.3.-1.7.2013), Ostfildern 2013, 27- 35.