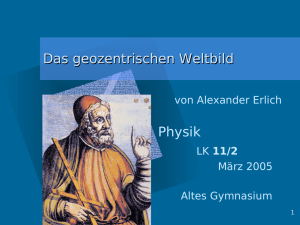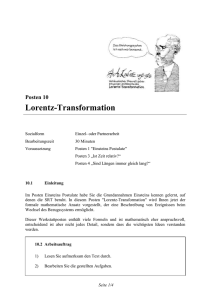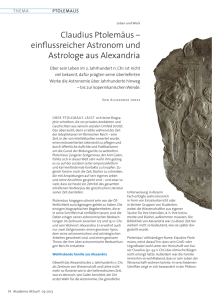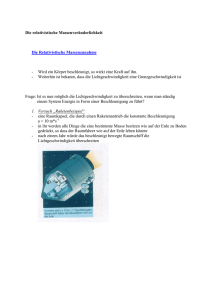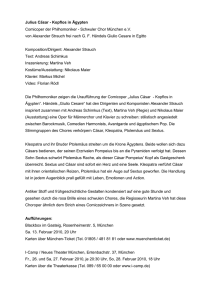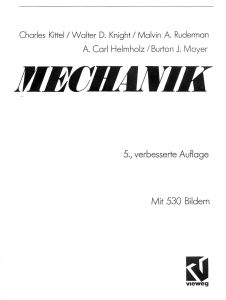Das geozentrische Weltbild - Spektrum der Wissenschaft
Werbung

14 0 Das geozentrische Weltbild Claudius Ptolemäus ca. 90–168 C laudius Ptolemäus (griechisch: Klaudios Ptolemaios), der alexandrinische Astronom, Geograph und Mathematiker, schuf mit seinem Almagest (der in seiner modernen Übersetzung 500 Seiten umfasst) ein Dogma, das fast 1 400 Jahre lang gültig blieb. Er sagte nicht nur, dass der Himmel sphärisch wirkte: Ihm zufolge bestand er wirklich aus exakten Kugeln. Da sich der Nachthimmel als perfekte Halbkugel darbot, musste sich die Erde im Mittelpunkt des Universums befinden — wo sie in der aristotelischen Kosmologie auch hingehörte. Außerdem bestritt Ptolemäus die Rotation der Erde; sie würde ja sonst den Vögeln und Wolken davoneilen. Der Almagest griff viele Themen auf, die 300 Jahre zuvor Hipparch behandelt hatte, darunter die scheinbare Umlaufbahn der Sonne um die Erde, Schätzungen der Entfernungen der Erde zum Mond und zur Sonne sowie einen Katalog der Sterne. Ptolemäus führte auch 44 Sternbilder auf und gab ihnen Namen, die wir heute noch verwenden (Orion und Löwe zum Beispiel). Ptolemäus’ bedeutendster Beitrag zur Himmelskunde war seine mathematische Theorie der Planetenbewegung. Zum Glück folgen die Planeten nahezu kreisförmigen Umlaufbahnen um die Sonne, sodass sein geozentrisches System die Vorhersage ihrer Positionen mit hinreichender Genauigkeit ermöglichte. Vereinfacht gesagt bewegten sich die Planeten Ptolemäus zufolge gleichförmig auf einem perfekten Kreis (dem Epizykel), dessen Mittelpunkt gleichförmig auf einem weiteren Kreis (Deferent genannt) um die Erde kreiste, die im Zentrum stand. Aber Ptolemäus musste komplizierte Zusatzgrößen wie den Ausgleichspunkt (Äquant) einführen, um den variierenden Planetengeschwindigkeiten und den in Wirklichkeit elliptischen Umlaufbahnen Rechnung zu tragen. Dennoch war sein Almagest eine mathematische Glanzleistung, aufgrund derer alle europäischen Astronomen bis zur Zeit von Tycho Brahe glaubten, die Sphären, auf denen sich die Himmelskörper bewegen sollten, wären reale physikalische Objekte. Ptolemäus schrieb auch viel über Astrologie und Geographie. Tatsächlich war seine geographische Abhandlung in der klassischen Geographie ebenso berühmt wie sein astronomisches Werk in der klassischen Astronomie. Siehe auch Frühe Astronomen S. 12, Sphärenmusik S. 14, Kosmische Vorhersagen S. 26, Das heliozentrische Universum S. 42, Die Gesetze der Planetenbewegung S. 52. 30 Als Astronom und Geograph prägte Ptolemäus das wissenschaftliche Denken bis ins 17. Jahrhundert hinein. 16 9 4 Die Sexualität der Pflanzen Rudolph Jakob Camerarius 1665–1721 D ie Vorstellung, dass es männliche und weibliche Formen von Pflanzen gibt, lässt sich bis zu Theophrast in das dritte Jahrhundert zurückverfolgen, aber erst Rudolph Jakob Camerarius, Medizinprofessor in Tübingen, belegte mit Experimenten, dass sich Pflanzen sexuell fortpflanzen. Camerarius wies durch anatomische Versuche mit Blüten schlüssig nach, dass Pollen auf die Narbe gebracht werden muss, damit eine Pflanze Samen bildet. Er entfernte Staubgefäße von Rizinuspflanzen sowie Narben von Maisblüten und stellte fest, dass die Pflanzen daraufhin keine Samen mehr ansetzen konnten. Auch die Isolierung männlicher und weiblicher Pflanzen von Arten wie Spinat und Bingelkraut führte zu ähnlicher Sterilität. Pflanzen, so schloss er daraus, pflanzen sich ebenso wie die meisten Tiere sexuell fort. Camerarius veröffentlichte seine Befunde im Jahre 1694 in seinem Werk Epistola de sexu plantarum („Über das Geschlecht der Pflanzen“), das er an den Gießener Medizinprofessor Michael Bernard Valentini richtete. Andere zeitgenössische Botaniker kamen offenbar unabhängig voneinander etwa zur gleichen Zeit zu ähnlichen Ergebnissen, und im Jahre 1676 hielt der englische Botaniker und Arzt Nehemiah Grew vor der Royal Society einen Vortrag, in dem er den Pollen als männlichen Teil der Blüte identifizierte. Gegen Ende des Jahrhunderts waren Camerarius’ Beobachtungen von anderen bestätigt worden. Als der Londoner Gärtner Thomas Fairchild vor 1720 die erste vom Menschen geschaffene Hybride zweier Arten schuf, indem er eine Gartennelke und eine Bartnelke miteinander bestäubte, war dies der Beginn der willkürlichen Arthybridisierung und selektiven Pflanzenzucht. Viel später, im Jahre 1830, wies der italienische Mikroskopiker Giovanni Battista Amici nach, dass aus dem Pollen ein Pollenschlauch hervorgeht, der am Griffel hinabwächst und über eine winzige Öffnung, die Mikropyle, in die Samenanlage eindringt, um die sexuelle Vereinigung herbeizuführen. Drei Jahrzehnte später wies Gregor Mendel durch sorgfältig überwachte Kreuzungen bei Gartenerbsen die Gesetze der Vererbung nach. Heute bilden die Manipulation der sexuellen Fortpflanzung und die Mendelsche Genetik die Eckpfeiler der modernen Pflanzenzucht. Siehe auch Die Geburtsstunde der Botanik S. 18, Die Benennung des Lebendigen S. 88, Mendels Gesetze der Vererbung S. 192, Stickstofffixierung S. 208, Die Vielfalt der Kulturpflanzen S. 292, Die grüne Revolution S. 428. 82 „Cupido haucht den Pflanzen die Liebe ein“ von Philip Reinagle, aus The Temple of Flora (1804, „Der Tempel der Flora“) von Robert Thornton. 18 2 8 Die Harnstoffsynthese Friedrich Wöhler 1800–1882 D ie Überzeugung, dass sich lebende oder „organische“ Materie fundamental von anorganischer Materie unterscheide und irgendeine „Lebenskraft“ (vis vitalis) die belebte Welt erfülle, war weit verbreitet. Auch wenn die Idee des Vitalismus stärker auf religiösen Überzeugungen als auf wissenschaftlichen Belegen beruhte, schien es unmöglich, aus anorganischen Bestandteilen organische Materie herzustellen. Dieses Dogma fiel, als der deutsche Chemiker Friedrich Wöhler 1828 an seinen ehemaligen Lehrer Jöns Jakob Berzelius schrieb: »Ich . . . muss Ihnen sagen, dass ich Harnstoff machen kann, ohne dazu Nieren oder überhaupt ein Tier, sei es Mensch oder Hund, nötig zu haben.« Harnstoff war biologischen Ursprungs, doch Wöhler hatte es aus Ammoniak und Blausäure (Cyansäure) hergestellt: Beides reagiert zu Ammoniumcyanat, aus dem beim Erhitzen eine Verbindung entsteht, die mit dem Naturprodukt identisch ist. Wöhler selbst war vorsichtig, was die philosophischen Konsequenzen seines „epochalen“ Experiments anging, wie andere es nannten, und meinte dazu: »Es ist auffallend, dass man für die Hervorbringung von Cyansäure (und auch von Ammoniak) immer doch ursprünglich eine organische Substanz haben muss, und ein Naturphilosoph würde sagen, dass sowohl aus der thierischen Kohle, als auch aus den daraus gebildeten Cyanverbindungen das Organische noch nicht verschwunden ist.« Berzelius vertrat unterdessen den Standpunkt, man solle Harnstoff als eine Substanz an der Grenze zwischen dem Organischen und dem Anorganischen betrachten. Spätere Untersuchungen von Verdauung und Gärung durch Justus von Liebig und Louis Pasteur enthüllten noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen den chemischen Prinzipien der organischen und der anorganischen Welt. Liebig argumentierte, man könne die Gärung (Fermentation) als rein chemischen Umwandlungsprozess betrachten; Pasteur war der Ansicht, Leben könne künstlich geschaffen werden, und vertrat die These, Chiralität (Händigkeit) — also die Existenz von Molekülen in spiegelbildlicher Form — sei für die Chemie des Lebens von grundlegender Bedeutung. Den Beweis, dass chemische Lebensprozesse keine besondere Lebenskraft erfordern, lieferte Eduard Buchner 1897, als er den Gärungsprozess in Abwesenheit von lebenden Zellen demonstrierte. Er zermahlte und presste Hefezellen, um einen zellfreien Saft (ein „unorganisiertes Ferment“) zu erhalten, der Zucker in Alkohol umwandelte, und zwar, so nahm man an, mit Hilfe chemischer Verbindungen, die 1876 von dem deutschen Physiologen Wilhelm Kühne als „Enzyme“ bezeichnet worden waren. Siehe auch Die spontane Entstehung von Leben S. 90, Die Keimtheorie S. 202, Die Wirkung der Enzyme S. 218, Die Ammoniaksynthese S. 256, Der Ursprung des Lebens S. 370. 142 Ein Harnstoffkristall, durch ein Polarisationsmikroskop betrachtet. Die Harnstoffsynthese war der Anfang vom Ende der Vorstellung, dass eine besondere „Lebenskraft“ die belebte Welt erfüllt. Von Newton bis Einstein Martin Rees M ehr als zwei Jahrhunderte nach Newton stellte Einstein seine Theorie der Gravitation auf, die als „Allgemeine Relativitätstheorie“ bekannt ist. Danach folgen Planeten im Gefüge einer „Raumzeit“, die durch den Schwerkrafteinfluss der Sonne gekrümmt ist, tatsächlich der direktesten und damit kürzesten Bahn. Oft wird behauptet, Einstein habe Newtons Physik „aus den Angeln gehoben“, doch das ist irreführend. Newtons Gesetz beschreibt die Bewegungen im Sonnensystem noch immer sehr präzise (die berühmteste Abweichung ist eine geringfügige Anomalie in der Umlaufbahn des Merkurs, die sich mit Einsteins Theorie erklären lässt) und erlaubt, die Flugbahnen von Raumsonden zum Mond und zu den Planeten zu programmieren. Im Gegensatz zu Newtons Physik kommt Einsteins Theorie jedoch auch mit Objekten zurecht, die sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, mit der äußerst starken Gravitation, die derartig enorme Geschwindigkeiten erzeugen kann, sowie mit der Wirkung der Schwerkraft auf das Licht selbst. Und schließlich — was noch wichtiger ist — verhalf uns Einstein zu einem tieferen Verständnis des Phänomens Schwerkraft. Für Newton war es rätselhaft, warum alle Teilchen mit derselben Geschwindigkeit fallen und sich auf identischen Umlaufbahnen bewegen — warum Schwerkraft und Trägheit für alle Stoffe exakt dasselbe Verhältnis haben (im Gegensatz zu elektrischen Kräften, bei denen „Ladung“ und „Masse“ nicht proportional sind). Für Einstein hingegen erklärte sich all dies zwangsläufig daraus, dass sämtliche Körper den „kürzesten“ Weg in einer durch Masse und Energie gekrümmten Raumzeit nehmen. Insofern war die Allgemeine Relativitätstheorie ein konzeptioneller Durchbruch — und ein besonders bemerkenswerter zugleich, weil er aus Einsteins fundamentalem Verständnis für die Natur der Schwerkraft erwuchs und nicht etwa von einem bestimmten Experiment oder einer besonderen Beobachtung angeregt worden war. Einstein „widerlegte“ Newton nicht etwa, sondern ging vielmehr über Newtons Theorie hinaus und baute sie in ein umfassenderes und weitreichenderes Konzept ein. Es wäre allerdings besser gewesen (und hätte einem verbreiteten Missverständnis über ihre kulturellen Konsequenzen vorgebeugt), wenn seine Theorie einen anderen Namen erhalten hätte: nicht „Relativitätstheorie“, sondern etwa „Invarianztheorie“. Einsteins große Leistung war es, eine Reihe von Gleichungen zu entwickeln, die von jedem Beobachter angewendet werden können und dem bemerkenswerten Umstand Rechnung tragen, dass die in einem beliebigen „lokalen“ Experiment gemessene Lichtgeschwindigkeit stets dieselbe („invariant“) ist, ganz gleichgültig, wie schnell sich der Beobachter bewegt . . . Unsere Intuition und unser „gesunder Menschenverstand“ werden von unserer Erfahrung geprägt: Wir nehmen die physikalischen Gesetze, die uns direkt betreffen, intuitiv auf. Newtons Gesetze sind in gewissem Sinne schon in dem Affen, der sich selbstsicher von Baum zu Baum schwingt, fest verdrahtet. Doch weit draußen im Universum liegen Welten, die sich enorm von der unsrigen unterscheiden. Dass unser auf gesundem Menschenverstand basierendes Vorstellungsvermögen angesichts riesiger kosmischer Entfernungen, enorm hoher Geschwindigkeiten oder gewaltiger Schwerkrafteinflüsse versagt, sollte uns eigentlich nicht überraschen. Eine Intelligenz, die rasch durch das Universum streifen könnte — eingeschränkt allein durch die grundlegenden physikalischen Gesetze, nicht aber durch den heutigen Stand der Technologie —, würde ihr intuitives Begreifen von Raum und Zeit so erweitern, dass darin auch Platz für die seltsamen und scheinbar bizarren Konsequenzen wäre, die sich aus der Relativitätstheorie ergeben. Die Lichtgeschwindigkeit hat dabei, wie sich herausstellt, eine ganz besondere Bedeutung: Man 246 kann sich ihr annähern, sie aber niemals überschreiten. Doch diese „kosmische Geschwindigkeitsbeschränkung“ setzt der Entfernung, die Sie im Laufe Ihres Lebens zurücklegen können, keine Grenzen, denn Uhren laufen langsamer (und die Zeit an Bord wird „gedehnt“), wenn sich die Geschwindigkeit eines Raumschiffes immer mehr der Lichtgeschwindigkeit annähert. Wenn Sie zu einem hundert Lichtjahre entfernten Stern reisten und dann zurückkehrten, wären allerdings auf Erden — ganz gleichgültig, wie jung Sie sich fühlen mögen — mehr als 200 Jahre vergangen. Ihr Raumschiff kann nicht schneller als das Licht gereist sein (wie von einem daheim gebliebenen Beobachter gemessen), doch je näher es der Lichtgeschwindigkeit gekommen ist, desto weniger sind Sie gealtert. Derartige Effekte widersprechen unserer Intuition, einfach deshalb, weil sich unsere Erfahrung auf geringe Geschwindigkeiten beschränkt. Ein Flugzeug fliegt mit nur einem Millionstel der Lichtgeschwindigkeit und ist damit nicht annähernd schnell genug, um die Zeitdehnung spürbar zu machen: Selbst der unermüdlichste Flugreisende würde durch eine solche relativistische Zeitdehnung im Laufe seine Lebens nicht einmal eine Millisekunde gewinnen. Dieser winzige Effekt ist nichtsdestotrotz inzwischen mit Atomuhren gemessen worden, die auf eine milliardstel Sekunde genau gehen, und tatsächlich stimmte das Ergebnis mit Einsteins Voraussagen überein. Eine ähnliche „Zeitdehnung“ wird von der Schwerkraft hervorgerufen: In der Nähe einer großen Masse laufen Uhren langsamer. Auch das ist hier auf Erden kaum spürbar, denn so wie wir lediglich an „langsame“ Bewegungen gewöhnt sind, erleben wir auch nur eine „schwache“ Gravitation. Diese Zeitdehnung muss jedoch — genau wie die Auswirkungen der Umlaufbewegung — bei der Programmierung des außerordentlich exakten Global-Positioning-Satellitensystems (GPS) einberechnet werden. Ein Maß für die Schwerkraft eines Körpers ist die Geschwindigkeit, mit der ein Projektil abgefeuert werden muss, um seiner Anziehung zu entkommen. Um die Erdanziehung zu überwinden, muss ein Körper auf 11,2 Kilometer pro Sekunde beschleunigt werden. Diese Fluchtgeschwindigkeit ist im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit (300 000 Kilometer pro Sekunde) nicht groß, stellt jedoch für Raketenbauer eine Herausforderung dar, denn die chemischen Treibstoffe, auf die sie angewiesen sind, setzen nur ein Milliardstel der so genannten „Ruhemassenenergie“ (Einsteins E = mc2) in Antriebsleistung um. Die Fluchtgeschwindigkeit von der Sonnenoberfläche beträgt 600 Kilometer pro Sekunde — auch das lediglich ein fünftel Prozent der Lichtgeschwindigkeit. 247 19 3 4 Nylon Wallace Hume Carothers 1896–1937 D er Chemiker Wallace Carothers stieß 1928 zur DuPont Company in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware und wurde dort Leiter einer Gruppe, die neue Polymere erforschte. Polymere sind Substanzen, die aus vielen Zehntausenden sich wiederholender Moleküleinheiten bestehen. Zu den organischen Polymeren gehören Cellulose, Kautschuk und Wolle. Im Jahre 1931 synthetisierte Carothers Neopren, einen synthetischen Kautschuk, den er durch Polymerisation eines einfachen Kohlenwasserstoffes herstellte — das heißt dadurch, dass er kurze Kohlenwasserstoffmoleküle zu (bis zu einer Million Atome) langen Ketten vereinigte. Carothers war davon überzeugt, dass sich auch die Enden unterschiedlicher Moleküle miteinander zu Polymeren verbinden ließen. 1934 wandte er sich Molekülen zu, die chemische Bindungen eingehen würden, wie sie für einige Naturfasern, beispielsweise Seide — ein Polymer mit Amidbindungen — typisch sind. Wenn ein Amin mit einer Säure reagiert, entsteht ein Amid. Carothers wies nach, dass sich aus Molekülen mit Ketten aus sechs Kohlenstoffatomen ein gutes Polymer herstellen ließ. Die Aminversion mit je einer Aminogruppe an beiden Kettenenden sollte mit einer Säureversion mit je einer Säuregruppe an den Enden reagieren. Als diese Verbindungen gemischt wurden, reagierten sie auch sofort. Das Ergebnis war 6,6’-Polyamid, ein bemerkenswert starkes Polymer, das sich zu feinen, seidenartigen Fäden ausziehen ließ. Im Jahre 1939 wurde die kommerzielle Produktion des neuen Stoffes, genannt Nylon 66, aufgenommen. Der Name leitet sich nicht, wie oft angenommen, von den Städtenamen New York und London ab. Das Unternehmen wollte das neue Material ursprünglich Nulon oder Nilon nennen; da diese Bezeichnungen jedoch bereits registrierte Markennamen waren, entschied man sich schließlich für Nylon. Öffentliches Aufsehen erregte Nylon erstmals in Form von glamourösen Strümpfen, die auf der Internationalen Ausstellung in San Francisco und auf der New Yorker Weltausstellung 1939 Furore machten. Leider war Carothers zu diesem Zeitpunkt bereits tot; er hatte sich — Opfer einer schweren Depression — zwei Jahre zuvor das Leben genommen. Bald darauf eroberten Nylonstrümpfe die Kaufhäuser. Sie waren jedoch nur kurze Zeit allgemein erhältlich, da im Zweiten Weltkrieg nahezu die gesamte Nylonproduktion auf die Herstellung von Fallschirmen umgestellt wurde. Siehe auch Mauvein S. 172, Der Benzolring S. 190. 316 Die Entwicklung von Nylon gab nicht nur der Strumpfindustrie Auftrieb, sondern läutete auch eine neue Ära der Synthetikfasern ein, als Chemiker lernten, wie man „Designerpolymere“ herstellt. 20 0 0 Sequenz des menschlichen Genoms Human Genome Sequencing Consortium / Celera Genomics R obert Sinsheimer von der Universität von Kalifornien schwärmte im Jahre 1985, die Sequenzierung des menschlichen Genoms wäre so etwas wie die Mondlandung der Biologie. Am 26. Juni 2000 wurde die Vollendung der „Rohfassung“ der menschlichen Genomsequenz verkündet — mehrere Jahre früher als geplant. An diesem größten je durchgeführten Projekt der Biowissenschaften haben sich Tausende von öffentlich wie privat finanzierten Forschern aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan und China beteiligt. Jede Zelle eines jeden Lebewesens enthält ein vollständiges Exemplar seines „Betriebshandbuches“, abgefasst in der chemischen Sprache der DNA: das Genom. Diese Sprache kennt nur vier Buchstaben: A, C, T und G. Die Rohfassung umfasst die Sequenz von etwa 90 Prozent der drei Milliarden Buchstaben des menschlichen Genoms. Das Genom verteilt sich auf 23 Chromosomen im Zellkern, die man unter dem Mikroskop erkennen kann. Die DNA jedes Chromosoms wurde in besser handhabbare Stücke zerschnitten, die dann durch ein chemisches Analyseverfahren sequenziert wurden. Leistungsstarke Computer suchten nach überlappenden Fragmenten und setzten das Puzzle zusammen, bis die ganze Genomsequenz rekonstruiert werden konnte. Die Technik wurde so schnell weiterentwickelt, dass man für die Sequenzierung der ersten Milliarde Buchstaben vier Jahre, für die zweite Milliarde hingegen nur vier Monate brauchte. Die Kartierung des Genoms erleichtert die Suche nach einzelnen Genen, jenen DNA-Abschnitten also, in denen vor allem die Bauanleitungen für die Proteine zu finden sind, welche alle Vorgänge in den Zellen steuern. Es scheint etwa 30 000 Gene zu geben, die zusammen nur knapp zwei Prozent des Genoms belegen. In ungefähr 1 100 Genen hat man bereits krankheitsverursachende Mutationen ausfindig gemacht, die unter anderem für Chorea Huntington, Mucoviscidose und erblichen Brustkrebs verantwortlich sind. Diese Zahl wird sich jetzt rasch erhöhen, und der Erkenntnisgewinn bei der Erforschung weit verbreiteter Krankheiten mit einer genetischen Komponente — darunter Krebs, Herzerkrankungen, Diabetes und Asthma — wird sich beschleunigen. Darüber hinaus enthält die Sequenz wichtige Hinweise auf die Entwicklungsgeschichte des Menschen. Siehe auch Gene und Vererbung S. 264, Die Sichelzellenanämie S. 358, Die Doppelhelix S. 374, Gentechnik S. 436, Menschliche Krebsgene S. 456, Der genetische Fingerabdruck S. 484, Das Männlichkeitsgen S. 502. 524 Genetisch kartiert: die 46 Chromosomen des Menschen, 23 von jedem Elternteil. Der bedeutende Molekularbiologe Sydney Brenner meinte noch 1986: »Die Vorstellung, sich Sequenz für Sequenz durch das Genom zu ackern, findet in Großbritannien nicht gerade großen, begeisterten Anklang.«