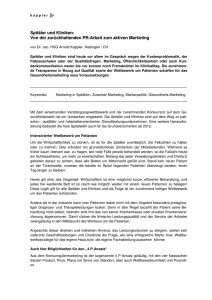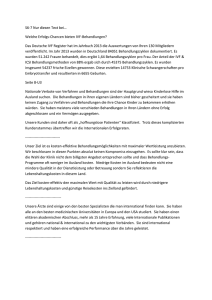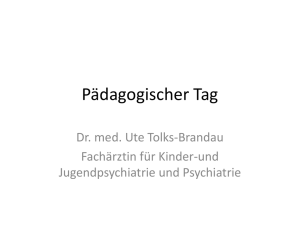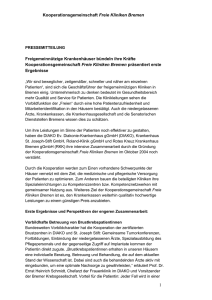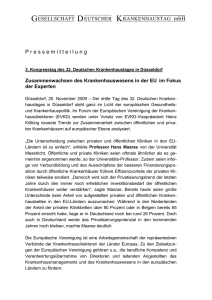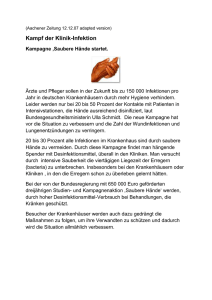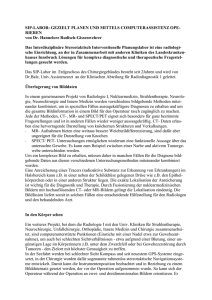Der Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung
Werbung
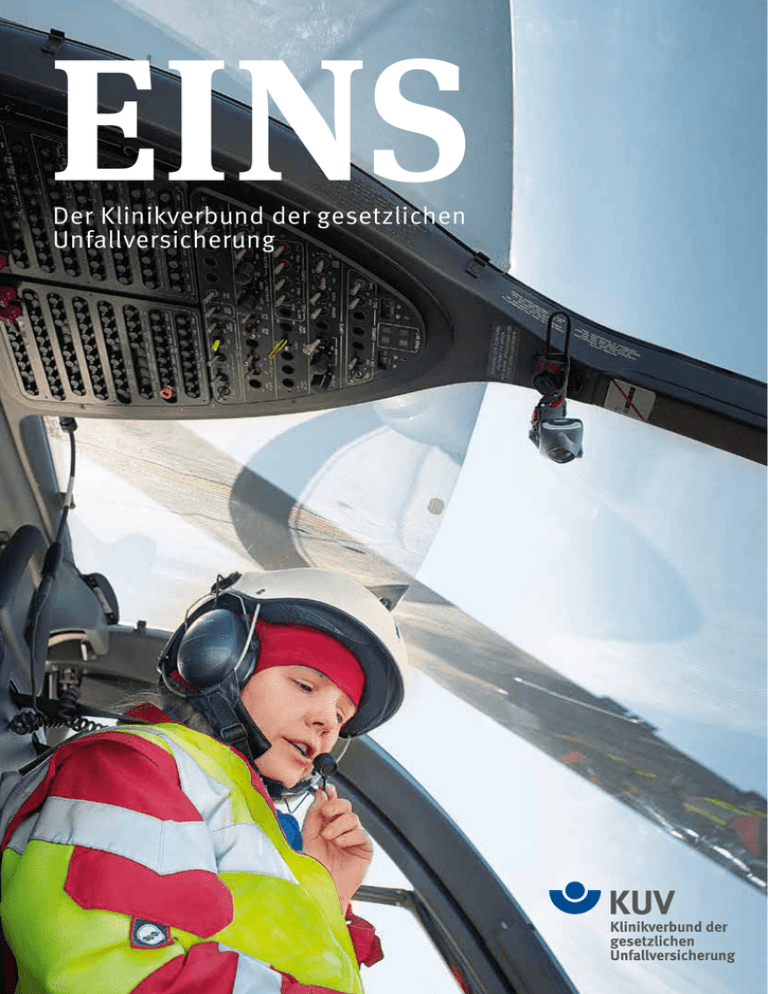
EINS Der Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung EINS Der Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung 2 EINS | Inhaltsverzeichnis Inhalt Der KUV Gemeinsam Neues wagen 04 KURS AUF DIE ZUKUNFT 18 V ERSORGUNG UND FORSCHUNG IM VERBUND Deutschland hat eine vielfältige medizinische Forschungs- Vorwort der Vorsitzenden des Vorstandes und der Mitgliederversammlung landschaft. Doch in einem ist sich die Fachwelt einig: An Versorgungsforschung mangelt es massiv. Diese Daten braucht die Gesundheitspolitik, um Reformen in die richtige Richtung weiterzutreiben. Der KUV liefert. 06 BLICK ZURÜCK NACH VORN 13 Standorte, über 11.000 Beschäftigte, mehr als 500.000 Patientinnen und Patienten pro Jahr – KUV-Geschäftsführer Reinhard Nieper über die Aufgaben und Ziele eines der jüngsten und größten Klinikverbunde Deutschlands 22 E HRGEIZIG, INNOVATIV, PATIENTENORIENTIERT Zusammen in die Zukunft Hochleistungsfähige Medizintechnik richtig anwenden, natürliche Mechanismen zur Heilung nutzen und Kranke und Verletzte mit schonenden Methoden behandeln: Berlin, Bochum, Murnau – drei Beispiele aus dem Forschungsalltag im Klinikverbund der gesetzlichen ­Unfallversicherung e. V. (KUV) 08 FIT FÜR DIE GENERATION Y 24 DIE DIGITALE KLINIK IST DA Pippi Langstrumpf im OP? Die kommende Ärzte­ generation hat ganz eigene Vorstellungen von Beruf und Familie. Damit sie sich am Arbeitsplatz Krankenhaus wohl­fühlt, lässt sich der KUV e­ iniges einfallen. Telemedizin wird zunehmend von der Ausnahme zur Regel. Das gilt zumindest für die Teleradiologie im KUV. Auch die innerklinische Organisation verlagert der ­Verbund schrittweise von Papier auf Computertechnik. 26 N EUE VERSORGUNGSSTANDARDS SETZEN Im Notfall muss es schnell gehen. Dafür sorgen o ­ ptimale Abläufe in Rettungsstellen und Notaufnahmen. Neueste Standards haben die Verbundkliniken Berlin und Frankfurt entwickelt. 14 DIE PFLEGE BRAUCHT PFLEGE Dem Gesundheitswesen droht ein gigantischer Fach­ kräftemangel. Krankenhäuser werben daher zunehmend um Nachwuchs, vor allem bei Pflegekräften, aber auch bei Physiotherapeuten. Drei dicke Pluspunkte machen den KUV zum attraktiven Arbeitgeber. 32 MELDUNGEN EINS | Inhaltsverzeichnis 3 Inhalt Miteinander mehr erreichen Füreinander da sein 34 D IE DGU-TRAUMANETZWERKE – EINE ERFOLGSSTORY 50 ALLES AUF ANFANG Der KUV wirkt maßgeblich an der Entwicklung und Weiterentwicklung der Traumanetzwerke der ­Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie mit. Auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung treibt die Netzwerkbildung voran. Nach einem schweren Unfall gilt: Das Leben geht weiter, aber nicht immer so wie bisher. Diese Menschen haben die Rückkehr in den Job gemeistert. Der KUV half ihnen dabei – mit Spitzenmedizin und menschlich. 60 ZURÜCK IN EINEN NEUEN ALLTAG 40 Prozent aller Betten für Querschnittverletzte in Deutschland stehen in berufsgenossenschaftlichen ­Kliniken. In deren Kompetenzzentren arbeiten Ex­ pertenteams Hand in Hand, um den Patienten zurück in einen lebenswerten Alltag zu führen. Bereits auf der Intensivstation beginnt die Rehabilitation. 36 R UNDUMVERSORGUNG AUS EINER HAND Deutschland hat ein hervorragendes Gesundheits­system. Doch es knirscht an den Schnittstellen. Das beklagen Fachleute seit Jahren. Dabei ist klar: P ­ atientinnen und Patienten profitieren von vernetzter Versorgung. Die ­Kliniken der Unfallversicherung zeigen, wie es geht. 66 ERSTE LIGA 42 SAUBERE HÄNDE, KLARER KOPF Ob Fußballprofi oder Patient in der Rehabilitation: Wer Fachkräfte für Sportmedizin und -therapie aus der ersten Liga sucht, ist in den berufsgenossenschaftlichen Kliniken richtig. Immer wieder sorgen Fälle von Infektionen und resistenten Erregern in Krankenhäusern für Aufsehen in den Medien. Dabei steigen die Zahlen seit Jahren nicht mehr. Was an den KUV-Kliniken für eine perfekte Hygiene getan wird, zeigt der folgende Bericht. 68 ZAHLEN UND FAKTEN 46 AUS FEHLERN LERNEN 68 IMPRESSUM Voneinander lernen Nobody is perfect. Das galt lange Zeit überall, nur nicht für die Ärzteschaft. Inzwischen hat sich aber auch in der Medizin die Einsicht durchgesetzt, dass es ohne Fehlerkultur und Qualitätsmanagement nicht geht. 48 MELDUNGEN 4 EINS | Der KUV Vorwort KURS AUF DIE ZUKUNFT Das deutsche Gesundheitswesen zählt zu den besten der Welt. Damit das so bleibt, muss es sich ständig fortentwickeln. Der nach dem Prinzip der Selbstverwaltung organisierte Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung (KUV) ist Garant für Fortschritt in medizinischer Forschung und Ver­sorgung. Seine Träger und Stützen sind die gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen mit dem Spitzenverband DGUV. Ihren Patientinnen und Patienten bieten alle neun Unfallkli­ niken, zwei Unfallbehandlungsstellen und zwei Kliniken für Berufserkrankungen absolute Spitzenleistungen. Bei der Versorgung von schwer und mehrfach Verletzten übernimmt der Klinikverbund eine führende Rolle im Rahmen der Traumanetzwerke. Seine Expertise auf dem Gebiet der Hand-, Brand- und Rückenmarkverletzungen ist unbestritten. Sie auszubauen ist ein Ziel der vielen Forschungsarbeiten in den K ­ liniken. Einige stellen wir Ihnen hier vor, in unserem Magazin EINS. EINS steht für unseren Anspruch, gemeinsam erstklas­ sige medizinische Versorgung in Deutschland sicherzustellen. Dabei zählt nicht nur medizinischer Fortschritt. Vielfach sind es die Kleinigkeiten, die dem Patienten im Alltag Probleme bereiten. Schnittstellen zwischen den Versorgungsbereichen werden dann zu großen Hürden. Der Heilungsprozess stockt. Der KUV baut diese Hürden ab. Denn es ist unser erklärtes Ziel, allen Patientinnen und Patienten eine Rundumversorgung aus einer Hand und auf höchstem Niveau zu bieten, die sie schnell zurück in den Beruf bringt. Wie das auch mit einer Querschnittlähmung oder einer anderen Behinderung gelingt, zeigen Ihnen Menschen, die es selbst erlebt haben. Am Beispiel der Notfallversorgung sehen Sie zudem, wie die Unfallkli­ niken Versorgungsketten gestalten und Abläufe optimieren. Im Bereich der Unfallversicherung nach dem Siebten Buch Sozialgesetzbuch sind die Übergänge zwischen den Sektoren offen. Davon profitieren auch alle Patientinnen und ­Patienten: unsere Kooperationen mit dem ambulanten Bereich bauen wir systematisch aus. In Gesundheitszentren stellen wir niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten Räume zur Verfügung oder bieten ambulante Reha unter einem Dach. Vernetzung braucht Technik. Telemedizin ist das Mittel der Wahl. Sie ist im Klinikverbund sehr weit entwickelt. Doch auch innerhalb der Kliniken spielt die technische Vernetzung eine immer größere Rolle. Automatische Datenübertragung kann viele Abläufe erleichtern. Der Verbund investiert daher laufend in technische Neuerungen. Wo es nötig ist, entstehen auch neue räumliche Strukturen, um die Versorgung auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln. All diese Spitzenleistungen wären nicht möglich ohne unsere engagierte Belegschaft. Sie lebt unser Motto „Spitzenmedizin menschlich“ tagtäglich vor Ort. Egal ob medizinisches oder pflegerisches Personal, Angestellte in der Reha oder Verwaltung – sie sind es, die die Höchstleistungen im Klinikverbund hervor- und zu den Patientinnen und Patienten bringen. Den wachsenden Fachkräftemangel beobachtet daher auch der Klinikverbund mit Sorge. Doch wir sehen nicht tatenlos zu. Damit wir auch in Zukunft als Arbeitgeber attraktiv bleiben und unsere Patientinnen und Patienten weiterhin von kompetentem und freundlichem Personal umsorgt werden, tun wir einiges. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir Arbeitsbedingungen, die auf ihre persönliche Situation Rücksicht nehmen, seien es Kindererziehung, nachlassende Kräfte oder eine Querschnittlähmung. Mit den Beiträgen in diesem Magazin wollen wir Ihnen zeigen, welche Antworten der Klinikverbund auf die drängenden Fragen im Gesundheitswesen gefunden hat. Wir wünschen ­Ihnen eine spannende Lektüre! Dr. Hans-Joachim Wolff Vorsitzender des Vorstandes Jürgen ­Waßmann Vorsitzender des Vorstandes Manfred Wirsch Dr. Fritz Bessell Vorsitzender der Vorsitzender der MitgliederversammlungMitgliederversammlung BG Unfallkrankenhaus Hamburg BG Unfallambulanz und Rehazentrum Bremen Unfallkrankenhaus Berlin BG Unfallbehandlungsstelle Berlin BG Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum BG Kliniken Bergmannstrost Halle BG Unfallklinik Duisburg BG Klinik für Berufskrankheiten Falkenstein BG Unfallklinik Frankfurt am Main BG Klinik Ludwigshafen BG Klinik Tübingen BG Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall BG Unfallklinik Murnau 6 EINS | Der KUV Interview BLICK ZURÜCK NACH VORN 13 Standorte, über 11.000 Beschäftigte, mehr als 500.000 Patientinnen und Patienten pro Jahr – KUV-Geschäftsführer Reinhard Nieper über die Auf­gaben und Ziele eines der jüngsten und größten Klinikverbunde Deutschlands Nach Gründung des Klinikverbundes und Aufbau von Strukturen in den Jahren 2010 und 2011 war 2012 sozusagen das erste „Betriebsjahr“ – wie fällt Ihre Bilanz aus? Unser erstes „Betriebsjahr“ war eine Herausforderung – die wir gemeistert haben. Sowohl strategisch als auch operativ konnten wichtige Weichen gestellt werden. Vor allem ist es den Kliniken gelungen, über die bisherige Organisationsform eine stabile Verbundstruktur zu legen, in der alle relevanten Themen und Aufgaben abgebildet werden. Dadurch wurde es möglich, bedeutende strategische Grundsatzentscheidungen zu treffen und die Voraussetzungen für deren Umsetzung zu schaffen, das sogenannte Klinik­ gesamtkonzept. Operativ können wir schon jetzt auf einen bunten Strauß erfolgreich implementierter Einzel- und Gemeinschaftsprojekte zurückblicken, von denen unsere Häuser nachhaltig profitieren. Insbesondere die gemeinsame Wirtschaftsprüfung und Planung von Bauprojekten, der koordi- nierte Einkauf von Großgeräten und anderer Medizintechnik sowie das zentrale Controlling und weitere IT-Projekte bringen uns vielfältige Synergien und schaffen ein solides Fundament für die Zukunft. Wie hat sich die interne Organisationsstruktur des Klinikverbundes entwickelt? Funktioniert die angestrebte ­Balance zwischen zentraler und dezentraler Steuerung? Die Kliniken und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht primär Adressaten, sondern gestaltende Protagonisten des Verbundes. Die Kombination von zentraler und dezentraler Steuerung sichert dabei die notwendige Entscheidungsfähigkeit innerhalb einer sich permanent weiterentwickelnden Organisationsstruktur. Zentrale und dezentrale Verantwortungsbereiche schließen sich aber nicht aus, sondern ermöglichen uns durch ihre Verschränkung echten Mehrwert, zum Beispiel indem einzelne übergreifende Aufgaben dezentralen Verantwortungsträgern zugeordnet werden. EINS | Der KUV 7 Welche konkreten Vorteile haben die Kliniken, wenn sie sich als Verbund organisieren? Erlauben Sie mir, dass ich die Frage umdrehe – die Kliniken sind kein Selbstzweck. Entscheidend ist, welche Vorteile das System der gesetzlichen Unfallversicherung hat. Nur eine V ­ erbundlösung kann sicherstellen, dass die angestrebte hohe Qualität an allen Standorten gleichermaßen erbracht wer-den kann. Es wäre un­ verantwortlich, wenn das Wissen und Können einzelner Häuser nicht allen zur Verfügung gestellt würde und nicht die jeweils beste Lösung für alle verbindlich wäre. Dies organisieren zu können, verlangt einen handlungs­fähigen Verbund und davon „profitiert“ auch jede Klinik. Um in Deutschland die Führungsrolle im Bereich der Versorgung unfallverletzter Menschen sicherzustellen, muss nicht nur die interne Struktur einzelner Kli­ niken, sondern auch ihr Zusammenwirken hoch professionell sein und immer einem Ziel untergeordnet werden: die Versicherten mit allen geeigneten Mitteln zu versorgen. Was unterscheidet den KUV von anderen Klinikgruppen? Der KUV verfügt über drei wesentliche Strukturmerkmale, die in dieser Kombination keine andere Klinikgruppe für sich in Anspruch nehmen kann: Im Rahmen der sektorübergreifenden Versorgung endet die Betreuungsarbeit der Kliniken nicht mit der Entlassung der Patientin oder des Patienten, sondern folgt einem übergeordneten Ziel: ihrer oder seiner Wiedereingliederung in das berufliche und private Umfeld. Weiterhin ist mit der durch Selbstverwaltung bis in die Vorstandsebenen abgebildeten Einbeziehung von Versicherten und Arbeitgebern die Ausrichtung unseres Handelns auf das Grundziel der Unfallversicherung jederzeit gewährleistet. Und schlussendlich gilt unsere Arbeit nicht dem Er­ wirtschaften von Gewinnen, sondern der erfolgreichen Ver­ sorgung von Menschen in Not. Dafür sorgen unsere Mitar­ beiterinnen und Mitarbeiter – jeden Tag, rund um die Uhr, in höchster Qualität und auf internationalem Spitzenniveau. Welche Großprojekte stehen 2013 und 2014 auf der Agenda? Neben einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Ver­ bundes und seiner Organisationsstrukturen stehen derzeit vor allem der Abschluss und erste Schritte zur Umsetzung des Klinikgesamtkonzeptes sowie eine klinikübergreifende Umstellung auf das neue fallpauschalenorientierte Vergütungssystem im Fokus. Wie wird sich das System der gesetzlichen Unfallver­si­cherung weiter entwickeln und vor welchen Herausforderungen steht dabei der KUV? Ich bin überzeugt: das einzigartige System sektorübergreifender Versorgung wird in Zukunft noch stärker als Modell für die allgemeine Gesundheitsfürsorge in Deutschland herangezogen werden. Diese Ausnahmestellung auch inhaltlich zu füllen, ist uns Herausforderung und Pflicht zugleich. Was sind die langfristigen Unternehmensziele des KUV? Alles zu tun, was notwendig und hilfreich ist, um mit den zur Verfügung stehenden Mitteln eine bestmögliche Versorgung für unfallverletzte oder berufserkrankte Menschen ­sicherzustellen. 1.099.625.461 Euro Umsatz hat der Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung 2012 erzielt. 11.387 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren 2012 im Klinikverbund beschäftigt. 8.219 Einsätze sind die Rettungshubschrauber der Kliniken 2012 geflogen – 16.977 Mal rückten ihre Notarztwagen aus. 507.348 Patientinnen und Patienten haben die BG-Kliniken 2012 behandelt. EINS | Zusammen in die Zukunft 9 Feature FIT FÜR DIE GENE­ RATION Y Pippi Langstrumpf im OP? Die kommende Ärzte­ generation hat ganz eigene Vorstellungen von Beruf und Familie. Damit sie sich am Arbeitsplatz Krankenhaus wohl­fühlt, lässt sich der KUV ­einiges einfallen. Der 37-jährige Assistenzarzt Michael Kähler, seine vierjährige Tochter und sein zweijähriger Sohn nehmen morgens mitunter den gleichen Weg. Alle drei fahren zum Unfallkrankenhaus Berlin (ukb). Bevor der Unfallchirurg seinen Dienst antritt, bringt er die beiden Kinder in die Kita des ukb. Die Tochter ist dort schon seit der Eröffnung 2011 untergebracht, der Sohn kam vor einem Jahr dazu. Beide sind meist nur in den Kernzeiten dort. Doch das eine oder andere Mal musste auch Familie Kähler schon auf die erweiterten Öffnungszeiten zurückgreifen. „Es ist eine Entlastung zu wissen, dass die Kita offen ist, wenn alle Stricke reißen“, sagt Michael Kähler. Den Ausschlag für die Wahl der Kita gaben aber nicht die erweiterten Öffnungszeiten, sondern das Konzept. Der Dussmann-KulturKindergarten am ukb hat die Eltern überzeugt. Er zählt zweifelsohne zu den Vorzeigemodellen deutscher Klinik-Kitas. Der Name ist Programm: Für die kulturelle Bildung der Kleinsten stehen Theaterbühne und Musikinstrumente zur Verfügung. Tanzen und malen gehört auch zum Kita-Alltag. Die Betreuung erfolgt zweisprachig, englisch und deutsch. ukb-Chef Prof. Dr. Axel Ekkernkamp betrachtet das Kita-Angebot als Unterstützung für Familien. Und damit liegt er genau richtig, wie der Marburger Bund bestätigt. Kinder hereinspaziert! Armin Ehl, Hauptgeschäftsführer der Gewerkschaft ange­ stellter und beamteter Ärztinnen und Ärzte Marburger Bund (MB) Deutschland weiß, was die Ärzteschaft heute wünscht: „Die Generation Y will leben vor dem Tod. Das ist nicht nur ein Spruch. Sie will überschaubare und planbare Arbeits­ zeiten haben und legt großen Wert auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“ Ehl verweist auf die regelmäßigen Um­ fragen des MB. Ein hervorstechendes Ergebnis: „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist seit 2006 in der Wertigkeit am stärksten gestiegen.“ Ganz wichtig ist es daher aus Ehls „ES IST EINE ENTLASTUNG ZU ­W ISSEN, DASS DIE KITA OFFEN IST, WENN ALLE STRICKE REISSEN.“ Michael Kähler, Unfallchirurg am Unfallkrankenhaus Berlin Sicht, dass Kliniken Betriebs­ kindergärten bereithalten, deren Öffnungszeiten an die Dienste der Eltern angepasst sind. Eine der ältesten Krankenhaus-Kitas in Deutschland überhaupt ist die bereits 1977 eröffnete Kita der BG Unfallklinik Murnau. Die Öffnungszeiten von 5.30 Uhr bis 21.30 Uhr an sieben Tagen in der Woche orientieren sich an den Dienstplänen der Angestellten. Kinder werden ab einem Alter von acht Wochen bis zum zehnten Lebensjahr in vier altersgestuften Gruppen betreut. Das ist nicht nur für die Eltern von Vorteil. Es rechnet sich auch für den Arbeitgeber: „Wir sparen durch die Kita rund 80.000 Euro pro Jahr, denn sie bindet ­Personal, sodass wir deutlich weniger in Fachkräfteakquise und Einarbeitungszeiten investieren müssen“, sagt der Ärzt­ liche Direktor Prof. Dr. Volker Bühren. Arzttarif auf Vordermann Zugleich ist dem Klinikverbund seine Ärzteschaft bares Geld wert. Daher hat der KUV 2012 einen neuen Ärztetarifvertrag mit dem MB vereinbart. Er bringt den rund 1.000 Ärztinnen und Ärzten an elf Verbundkliniken und zwei Behandlungsstellen 3,4 Prozent mehr Gehalt. „Mit diesem Tarifabschluss für die Ärztinnen und Ärzte an den BG-Kliniken wurde die tarifliche Führungsposition der BG-Kliniken bestätigt“, so der MB-Vorsitzende Rudolf Henke. „Im Wettbewerb um die besten Ärztinnen und Ärzte auf dem Arbeitsmarkt haben die BG-Kliniken nun sehr gute Chancen.“ Michael Kähler wusste schon in der Schule, dass er Arzt werden will. Für ihn war auch klar, dass er nach dem Medizinstudium an der Berliner Humboldt-Universität in die Patientenversorgung geht. „Aber ich kann nachvollziehen, dass viele das scheuen, wenn man sieht, was da alles dranhängt.“ Direkt nach dem Studium kam er 2004 ans ukb. Die Klinik hat er sich unter mehreren ausgesucht, die ihn gern schnell eingestellt hätten. „Die Möglichkeiten, die das ukb mir im Bewerbungsgespräch aufgezeigt hat, haben mich überzeugt“, sagt Kähler neun Jahre später. Das breite Spektrum der Ausbildung, die Dichte und Vielfalt an Aufgaben und Gelegenheiten zum Operieren in dem großen Krankenhaus haben von Anfang an gelockt. Mit der Zeit hat er noch etwas anderes zu schätzen gelernt: „Die Hierarchien sind recht flach, das Haus ist kompakt gebaut, man hat viel Kontakt zu Kollegen und Vorgesetzten.“ Ausbildung vom Feinsten Auch MB-Geschäftsführer Ehl bestätigt, dass der Klinikverbund beim medizinischen Personal ein hohes Ansehen als Arbeitgeber genießt. Die Dichte der Aufgaben in der Unfallchirurgie, Chirurgie und Anästhesie erlaubt es Assistenzärztinnen und -ärzten in diesen Bereichen, eine strukturierte Weiterbildung innerhalb der Mindest-Weiterbildungszeit abzuschließen. „Damit können die Unfallkliniken bei der jungen Ärzteschaft punkten“, sagt Ehl. Doch nicht nur für den Einstieg, sondern auch für eine langfristige Arzttätigkeit bietet der Klinikverbund gute Rahmenbedingungen. Ehl: „Die Unfallkliniken sind technisch auf dem neuesten Stand und haben in der Regel eine bessere Personaldecke als andere Krankenhäuser. Das macht sie für Ärztinnen und Ärzte attraktiv.“ Vom Ärztemangel spüren viele Kliniken im Verbund mithin noch nichts, auch nicht die BG Kliniken Bergmannstrost Halle im ärztlich unterversorgten Sachsen-Anhalt. Sie punkten mit Familienfreundlichkeit, die im Audit „Beruf und Familie“ dokumentiert ist, und erstklassiger Ausbildung. „Die Ausbildung ist ein ganz zentraler Faktor. Den muss man ernst nehmen“, sagt Dr. Joachim Zaage, stellvertretender Ärztlicher Direktor. Das „Bergmannstrost“ bietet jede Woche eine zweistündige Weiterbildungsveranstaltung für seine Medizinstudierenden im Prak­tischen Jahr (PJ) und seine Assistenzärztinnen und -ärzte. Auch praktischer Unterricht, zum Beispiel ein Knüpf- und Nahtkurs in der Chirurgie, findet statt. „So etwas kommt immens gut an“, sagt Dr. Zaage. Zusätzlich gibt es zweimal im Jahr jeweils kurz vor den Abschlussprüfungen einen Wochenendkompaktkurs. Diese Angebote machen das Haus beim Nachwuchs bekannt. „Dadurch haben wir eher mehr Bewerbungen als zu wenig“, sagt Dr. Zaage. Auch das BG Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum setzt auf Praxis in der ­Medizinerausbildung. Im „Skills Lab“ des BG-Uni-Klinikums erwartet Medizinstudierende ein sehr vielfältiges Programm. Unter anderem gibt es Sonografie-, Blutentnahme- und Anästhe­siekurse. Der Geschäftsführer des „Bergmannsheils“ Johannes Schmitz misst der Einrichtung einen hohen Stellenwert bei: „Skills Labs sind ein wichtiger Baustein, um die prak­tische Ausbildung von Medizinstudierenden zu optimieren. Hier lernen sie abseits des oft hektischen Stationsalltags unter realen Bedingungen und mit fachlicher Anleitung, Untersuchungen durchzuführen, zu interpretieren sowie Befunde und Diag­ nosen richtig zu stellen. Sie können sich somit auf praxisnahe Weise und in einer sehr konzen­trierten Arbeitsumgebung auf die Arbeit mit dem Patienten vor­bereiten“, sagt Schmitz. Arbeitszeit nach Maß Neben Familienfreundlichkeit, angemessener Bezahlung und guter Ausbildung steht bei der Generation Y nicht zuletzt die Freizeit hoch im Kurs. „Bei der Generation Y ist der Wunsch nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance sehr ausgeprägt. Für die ältere Ärztegeneration hieß das nichts anderes, als dass man gelegentlich auch mal freihat. Heute hat das einen anderen Stellenwert. Darauf müssen sich Kli­ niken einstellen“, sagt ukb-Chef Ekkernkamp. Das ukb ist im März 2013 mit einem Sonderpreis als einer der besten Arbeit­ geber Berlins ausgezeichnet worden. Elektronische Arbeitszeiterfassung mit Zeitkonten, individuelle Formen von Teilzeitarbeit und 30 Tage Urlaub für alle Beschäftigten im Jahr 2013 sind einige Pluspunkte des ukb für die neue Ärztegeneration. Im Klinikverbund ist das ukb bei Weitem nicht das einzige Krankenhaus, das die langjährige Forderung des Mar­ burger Bundes nach einer objektiven Zeiterfassung an Kliniken bereits umgesetzt hat. Michael Kähler gefällt das. „Grundsätzlich ist es schon so, dass man für den Arztberuf lebt. Da schaut man nicht, wann Feierabend ist“, sagt er. Doch seit Kähler Vater ist, hat er einen großen Wunsch: mehr Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Das will der Klinikverbund allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen. „DIE UNFALLKLINIKEN SIND TECHNISCH AUF DEM NEUESTEN STAND UND HABEN IN DER ­R EGEL EINE BESSERE PERSONALDECKE ALS ANDERE KRANKENHÄUSER. DAS MACHT SIE FÜR ÄRZTINNEN UND ÄRZTE ATTRAKTIV.“ Armin Ehl, Hauptgeschäftsführer des Marburger Bundes Deutschland 14 EINS | Zusammen in die Zukunft Bericht DIE PFLEGE BRAUCHT PFLEGE EINS | Zusammen in die Zukunft 15 Dem Gesundheitswesen droht ein gigantischer Fachkräftemangel. Krankenhäuser werben daher zunehmend um Nachwuchs, vor allem bei Pflegekräften, aber auch bei Physiotherapeuten. Drei dicke Pluspunkte machen den KUV zum attraktiven Arbeitgeber. Rund 8.000 Pflegestellen in Krankenhäusern sind schon heute unbesetzt. Der Deutsche Pflegerat (DPR) geht davon aus, dass im Jahr 2025 mehr als 100.000 Pflegefachpersonen in Deutschland fehlen werden. Denn der Altersdurchschnitt der Pflegekräfte steigt und damit die Zahl der Abgänge in den Ruhestand. Gleichzeitig rücken immer weniger Auszubildende nach. Die Politik hat den Handlungsbedarf erkannt. Doch mit Förderprogrammen allein ist nach Ansicht des Pflegerates nicht viel auszurichten. Nötig seien vielmehr neue Rahmen­ bedingungen. Konkret forderte der DPR in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel unter anderem eine sys­ tematische Aus- und Weiterbildung, attraktive Weiterentwicklungs- und Karriereperspektiven, flexiblere Arbeitszeitmodelle und nicht zuletzt eine realistische und angemessene Personalausstattung. All das und mehr finden Pflegekräfte beim KUV schon heute. Erstes Plus: Aufstiegschancen eröffnen Akademische Bildung für Gesundheitsberufe gewinnt im ­Klinikverbund wachsende Bedeutung. Damit trägt der KUV auch den Forderungen des Wissenschaftsrates und der Gesundheitssachverständigen Rechnung. „Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels kommt es darauf an, differenzierte Ausbildungsangebote zu machen, um möglichst viele junge Menschen für die Pflege oder für therapeutische Berufe zu begeistern“, sagt Johannes Schmitz, Geschäftsführer des BG Universitätsklinikums Bergmannsheil Bochum. Das „Bergmannsheil“ bietet Pflegeschülern in Kooperation mit der Hochschule für Gesundheit eine grundständige akademische Pflegeausbildung. Auch für Physiound Ergotherapeuten gilt dieses Angebot. „Wir unterstützen dieses bislang einzigartige Modellprojekt, weil wir dazu beitragen wollen, diesen Berufsgruppen neue berufliche Perspek­ tiven zu ermöglichen. Der besondere Charme dieses Konzeptes besteht darin, dass die Studierenden einen Berufsabschluss und einen akademischen Bachelorabschluss erhalten und damit vielfältige Möglichkeiten für ihre berufliche Laufbahn haben“, sagt Schmitz. Dass es ein solches Hochschulmodell gibt, zeigt nach seiner Auffassung auch, wie hoch heutzutage die inhalt­ lichen Anforderungen an Pflege- und therapeutische Berufe sind. Damit diese Berufe die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen, müssten viele weitere Stellschrauben bedient werden, so Schmitz. Unter anderem bietet das „Bergmannsheil“ in seinem klinikeigenen Bildungszentrum Kurse im Bereich der Fachpflege oder für leitende Aufgaben und Funktionen. Auch andere Verbundkliniken unterstützen den Trend zur Akademisierung der Gesundheitsberufe. So ist das Unfallkrankenhaus Berlin 2012 zum ersten Klinischen Zentrum der staatlichen Alice-Salomon-Hochschule (ASH) ernannt worden. „Die Hochschule braucht Plätze, wo Therapierende etwas in der Praxis lernen, und wir brauchen studierte Gesundheitsberufe“, sagt ukb-Geschäftsführer Prof. Dr. Ernst Haider. Die ­Zusammenarbeit hat bereits Tradition. Unter anderem betreuen Angestellte des ukb Studierende bei der Erstellung ihrer Bachelor- oder Masterarbeit. „Das ist für die Ehrgeizigeren in den Gesundheitsfachberufen eine sehr gute Möglichkeit, Studium und Beruf zu kombinieren“, sagt Haider. Ebenso eng sind die Schulen für Physiotherapie an den BG-Unfallkliniken Tübingen und Ludwigshafen mit der akademischen Welt verzahnt. Gemeinsam mit der Hochschule Reut- 16 EINS | Zusammen in die Zukunft lingen und der Universität Tübingen bieten sie eine vierjährige duale Physiotherapeuten-Ausbildung mit Bachelorabschluss an. Im Dezember 2012 erhielten die ersten 19 Absolventinnen und Absolventen in Tübingen ihr akademisches Abschlusszeugnis. Wer will, kann den akademischen Weg weitergehen. Die BG Klinik Tübingen beschäftigt als erste Klinik bundesweit einen Physiotherapeuten mit Doktortitel. Aufgrund seines Titels wird Dr. Joachim Merk von anderen schon mal für einen Arzt gehalten. Zweites Plus: Ausbildung organisieren Mit der Eröffnung einer eigenen Krankenpflegeschule hat die BG Unfallklinik Murnau 2012 auf den Nachwuchsmangel in der Pflege reagiert. „Der Markt ist so eng, dass wir selbst ausbilden müssen. Eine eigene Krankenpflegeschule eröffnet uns zudem die Auswahl der Personen, die zu unserem Haus passen“, sagt Prof. Dr. Volker Bühren. In diesem Zuge ist auch die BGU Murnau dabei, weitere Aufstiegschancen für ihre Pflegekräfte zu schaffen: In Kooperation mit der Universität Salzburg wird eine akademische Pflegeweiterbildung angeboten. Nach dem Abschluss der Grundpflegeausbildung können Pflegekräfte der BGU Murnau an der Uni Salzburg ein Bachelorstudium mit der Möglichkeit, um Master oder Dissertation zu ergänzen, absolvieren. Dafür werden sie von der Klinik freigestellt und finanziell unterstützt. Zwei Schwestern haben sich schon dafür angemeldet. „Die Pflege differenziert sich immer mehr. Wir wollen zeigen, dass wir eine Berufsausbildung bieten, die nach oben offen ist“, sagt Professor Bühren. Die BG Kliniken Bergmannstrost Halle werben um den Pflegenachwuchs schon an Gymnasien und Realschulen. Schülerinnen und Schüler werden zu Projekttagen in das Haus eingeladen, können sich dort beim Rollstuhltraining ausprobieren und lernen anschließend das Haus kennen. Damit hat das „Bergmannstrost“ vor mehr als zwei Jahren begonnen. „Das trägt dazu bei, dass wir heute keine Probleme mit dem Pflegenachwuchs haben“, sagt Pflegedirektor Henry Rafler. Zusätzlich werden die Ausbildungsplätze inzwischen bekannt gemacht. „Das mussten wir früher nie machen, weil wir genug Bewerbungen hatten“, sagt Rafler. So ist es in Halle bisher gelungen, selbst in den ausbildungsintensiven Bereichen der Intensiv-, OP- und Anästhesiepflege immer alle Stellen zu besetzen. „Das ‚Bergmannstrost‘ ist in der Pflegewelt als guter Arbeitgeber bekannt“, sagt Rafler, der auch Vorsitzender des Landespflegerates Sachsen-Anhalt ist. Auf gute Ausbildungsbedingungen für den Nachwuchs setzt auch die Pflegedienstleiterin der BG Unfallklinik Frankfurt am Main Beatrix Falkenstein. Die BGU Frankfurt stellt ­ihrem Pflegenachwuchs unter anderem Praxisanleiter zur Seite. „Sie nehmen die Schülerinnen und Schüler an der Hand und zeigen ihnen in der Praxis, was sie bislang nur aus der Theorie kennen“, sagt Falkenstein. Drittes Plus: Pflege wertschätzen Um Personal zu binden, setzt die Frankfurter Pflegedienst­ leiterin auf unbefristete Verträge, die nicht viele Kliniken bieten, eine vergleichsweise gute tarifliche Bezahlung, aber auch auf weiche Faktoren wie Personalentwicklung und Gesundheitsförderung. So können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BGU Frankfurt bei der MAIN.BGMED vergünstigte Sportangebote nutzen. Auch die Weiterbeschäftigung älterer Pflegekräfte mit gesundheitlichen Einschränkungen liegt der BGU Frankfurt am Herzen. „Wenn wir Stellen besetzen, bei denen wenig körperlicher Einsatz gefordert ist, halten wir gezielt nach solchen Kräften Ausschau“, sagt Falkenstein. Gesundheitsmanagement für ältere Angestellte hat auch an anderen Verbundkliniken wachsende Bedeutung. In der BG Unfallklinik Murnau ist ein Mitarbeiter des Sozialdienstes der Klinik inzwischen damit beschäftigt, sich um Klinikbeschäftigte zu kümmern, die länger oder wiederholt krank sind. Er sucht unter anderem nach neuen Einsatzbereichen, die der Leistungskraft der erkrankten Person entsprechen. Die BG Kliniken Bergmannstrost Halle haben 2012 mit den Vorarbeiten für ein systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement begonnen. In einer Mitarbeiterbefragung wurden die Probleme analysiert. In der Folge bietet das Haus seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nun unter anderem Raucherentwöhnung, kinästhetisches Arbeiten und ein Rückenkolleg an – damit sie möglichst lange im Beruf bleiben. „VOR DEM HINTERGRUND DER DEMOGRAFISCHEN ENTWICKLUNG UND DES FACHKRÄFTE­ MANGELS KOMMT ES DARAUF AN, DIFFERENZIERTE AUS­B ILDUNGSANGEBOTE ZU MACHEN.“ Johannes Schmitz, Geschäftsführer des BG Universitäts­klinikums Bergmannsheil Bochum „DIE PFLEGE DIFFERENZIERT SICH IMMER MEHR. WIR WOLLEN ZEIGEN, DASS WIR EINE BERUFSAUSBILDUNG BIETEN, DIE NACH OBEN OFFEN IST.“ Prof. Dr. Volker Bühren, Ärztlicher Direktor der BG Unfallklinik Murnau 18 EINS | Gemeinsam neues wagen Bericht VERSORGUNG UND FORSCHUNG IM VERBUND EINS | Gemeinsam neues wagen 19 Deutschland hat eine vielfältige medizinische Forschungslandschaft. Doch in einem ist sich die Fachwelt einig: An Versorgungsforschung mangelt es massiv. Diese Daten braucht die Gesundheitspolitik, um Reformen in die richtige Richtung weiterzutreiben. Der KUV liefert. „Versorgungsforschung ist heute so wichtig, weil wir große Probleme im Gesundheitswesen und in der Versorgung der Kranken haben“, sagt Prof. Dr. Holger Pfaff von der Uniklinik Köln. Seine Forderung: Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) sollte ein Prozent ihres Gesamtbudgets für Ver­ sorgungsforschung zur Verfügung stellen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) geht hier mit gutem Beispiel voran. Sie fördert zahlreiche Forschungsvorhaben in den Bereichen Prävention und Arbeitsmedizin. Auch der Klinikverbund ist aktiv. Er beobachtet immer wieder den Einsatz neuer Methoden oder Techniken in der Praxis. FORSCHUNG VERBESSERT VERSORGUNG Ob innovative Implantate, eine effizientere Behandlung oder neuartige Wundversorgung – nur was in der Praxis Verbesserung bringt oder ohne Qualitätsverluste Kosten senkt, interessiert das Wissenschaftlerteam im Klinikverbund. Denn ein Ziel eint alle Forschungsprojekte im KUV: Sie sollen die Lebensqualität des Patienten erhöhen und die Versorgungs- und Behandlungsqualität weiter verbessern. Dabei sind die Forschungsthemen im Klinikverbund so weitgefächert wie das Versorgungsspektrum: In Hunderten von Projekten stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etablierte Diagnose- und Behandlungsmethoden auch unter ökonomischen Aspekten auf den Prüfstand. Sie entwickeln neue medizinische Verfahren und Materialien und testen Innovationen auf ihre Wirksamkeit. Um ihre hohen medizinischen Standards zu sichern, kooperieren viele Verbundkliniken eng mit Partnerinstituten und Universitäten. Das BG Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum ist im Lauf der Jahre selbst zum Uni-Klinikum geworden. Es wirkt an rund 300 Forschungsprojekten mit. Unter anderem laufen dort die bundesweit ersten Erprobungen des japanischen Exoskelett-Systems HAL zum Bewegungstraining bei Querschnittlähmungen. Seit Herbst 2012 steht das Training mit dem Roboteranzug im ersten „Zentrum für Neurorobotales Bewegungstraining“ außerhalb Japans am „Bergmannsheil Bochum“ für die Versorgung von bewegungsbehinderten BG-Versicherten zur Verfügung. Die Anwendung der nervengesteuerten Bewegungstherapie wird begleitend erforscht. Dabei wurden eine deutlich gesteigerte Mobilität der gelähmten Personen, ein intensivierter Muskelaufbau, mehr Muskelleistung und ein höheres Aktivitätsniveau beobachtet. Die ersten Studiener­ gebnisse lassen neue Reha-Angebote erwarten. Viele Forschungsprojekte der Bochumer BG-Uniklinik sind preisgekrönt. So gab es zum Beispiel für die Erforschung der Zusammenhänge zwischen Querschnittlähmungen und krankhaften Knochenbildungen 2012 den Evidence-basedMedicine-Preis der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Ein Forschungsprojekt zum Einfluss von Hormonen auf die Schmerzwahrnehmung wurde mit dem „NachwuchsFörderPreis Schmerz“ ausgezeichnet. Auch auf dem Gebiet der Krebsforschung hat sich das „Bergmannsheil Bochum“ einen Namen gemacht, vor allem mit Arbeiten über Weichgewebstumore (Sarkome). Ein Projekt zur Erforschung des Einsatzes körpereigener Eiweiße gegen Krebs wird seit 2012 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. ÜBER GRENZEN HINWEG Bei allen Forschungsprojekten im Verbund gilt das Prinzip, über Institute und Disziplinen hinweg zu kooperieren. Ein gutes Beispiel dafür ist das Projekt „ICF Core Set Hand“, in dessen Rahmen klinikübergreifend ein Leitfaden zur Behandlung von Handverletzungen erstellt wird. Genaue Cluster sollen die Funk­ tionsfähigkeit und Behinderung von Menschen mit Verletzungen oder einer Erkrankung der Hand konkret definieren. Das kann eine standardisierte Behandlung erheblich vereinfachen. 20 EINS | Gemeinsam neues wagen Im Labor für Biomechanik des BG Unfallkrankenhauses Hamburg untersuchen Fachleute aus Medizin, Ingenieurwesen und Technik die Osteosynthese, also die Versorgung von Knochenbrüchen mit Implantaten. Das Team arbeitet unter anderem an der Entwicklung sogenannter intelligenter Implantate. Sie enthalten einen mikroelektronischen Sensor, der die Belastung übermittelt. Dadurch kann der Arzt den Heilungsprozess besser beurteilen und den Patienten rechtzeitig vor Überbelastung warnen. An den BG Kliniken Bergmannstrost Halle liegt ein Fokus auf der Wirbelsäulenchirurgie. Forscherteams entwickeln und testen neue Techniken und Implantate, wie eine neuartige Bandscheibenprothese an der Halswirbelsäule. Schwerbrandverletzte sind Forschungsthema an der BG Klinik Ludwigshafen. Dort wird unter anderem Knochengewebe gezüchtet, das Knochen ersetzen kann, die durch eine Verletzung oder Entzündung verloren gegangen sind. Auch in der Versorgungsforschung leistet der Klinik­ verbund einen wichtigen Beitrag. So werden die Versorgungskonzepte für Versicherte mit Berufskrankheiten laufend überprüft und optimiert. Davon profitieren die Patientinnen und Patienten der BG-Kliniken für Berufskrankheiten in Bad Reichenhall und in Falkenstein unmittelbar. Ihnen kommt auch die wissenschaftliche Expertise des Klinikverbundes über berufsbedingte Hautkrankheiten, Atemwegs- und Lungenerkrankungen und Psychotraumatologie zugute. DIE UNFALLVERSICHERUNG ALS WEGBEREITER „Im Bereich der Unfallversicherung passiert dankenswer­ terweise schon sehr viel“, sagt der Versorgungsforscher Pfaff. Er hält aber auch hier noch mehr Systematik für nötig. Dieser Forderung kommt der KUV nun damit entgegen, dass die Forschungsaktivitäten der einzelnen Kliniken gebündelt werden sollen. Der KUV koordiniert die Beantragung von Fördergeldern unter anderem bei der DGUV. Durch die Zusammenarbeit im Verbund wird die höchstmögliche Qualität der Forschungsanträge gesichert. 2012 haben die Kliniken Forschungsschwerpunkte und Ziele für die kommenden zehn Jahre festgelegt. Sie gliedern sich in die Bereiche Traumaversorgung, Berufskrankheiten, Versorgungsforschung und Rehabilitation. VORBILDLICHE VERSORGUNGSKETTEN Die Versorgung in der Unfallversicherung betrachtet der Ex­ perte Pfaff insgesamt als vorbildlich. Sie zeige an einem Sondermodell, wie das Gesundheitssystem organisiert werden könne. „Das ist der Idealfall, dass Arbeitgeber und Unfallversicherung an einem Strang ziehen“, sagt er. Dem System der gesetzlichen Krankenversicherung attestiert er dagegen schlechte Anreizstrukturen. „Dort ist keiner für das Gesamtsystem und das Gesamtergebnis verantwortlich“, so Pfaff. Wegen der Besonderheiten der Versorgung in der Unfallversicherung sei aber auch eine eigene Versorgungsforschung für diesen Bereich nötig. Wenn dort valide Ergebnisse vor­ liegen, kann das gesamte Gesundheitssystem von der Unfallversicherung lernen, wie man Versorgung optimiert. Dazu Pfaff: „Die Unfallversicherung zeigt am lebendigen Beispiel, wie man die Versorgungskette besser organisieren kann.“ FORSCHUNGSBEDARF ZUR NACHHALTIGKEIT VON REHA Speziellen Forschungsbedarf im Bereich der Rehabilitation macht Pfaff auf dem Feld der Nachhaltigkeit von Reha-Maßnahmen aus: „Viele Patienten kommen fit aus dem System ­heraus und lassen dann nach, bis sie wieder versorgt werden müssen. Das ist besonders bei chronisch Kranken ein Pro­ blem.“ Um die Probleme der Nachhaltigkeit und der langen Krankschreibungsdauern zu lösen, hält der Versorgungsforschungsexperte dringend weitere Studien für nötig. Für den Bereich der Unfallversicherung sieht er hier eine einmalige Chance. Sie kann untersuchen, welche Effekte die enge Verzahnung mit Personen und Gegebenheiten am A ­ rbeitsplatz auf Maßnahmen der Wiedereingliederung hat. Diese Chance nutzt der Klinikverbund ausgiebig. Für die Wiedereingliederung des Patienten in den Berufsalltag ist die ambulante Rehabilitation nach einem stationären Aufenthalt oder einer Verletzung von entscheidender Bedeutung. Sie zu optimieren ist unter anderem das Ziel der Forschung an der BG Unfallambulanz und Rehazentrum Bremen. Dort erproben und evaluieren Reha-Fachleute Nachhaltigkeitskonzepte in der ambulanten Rehabilitation und entwickeln verbindliche Standards. Auch die sogenannte „Erweiterte Ambulante Physiotherapie (EAP)“, eine von den gesetzlichen Unfallver­ sicherungen entwickelte ambulante Therapieform, wird in Bremen evaluiert. Die Bedeutung der Forschung in den Kliniken wächst weiter. 2012 sorgte die BG Klinik Tübingen mit der Gründung des „Siegfried Weller Instituts für Unfallmedizinische Forschung“ für eine deutliche Aufwertung der klinikeigenen Forschung. Sie setzte damit zugleich ein wichtiges Signal für die Zukunft. EINS | Gemeinsam neues wagen 21 „Die Unfallversicherung zeigt am l­ ebendigen Beispiel, wie man die Versorgungskette besser organisieren kann.“ Prof. Dr. Holger Pfaff, Direktor des ­Instituts für Medizinsoziologie, Versorgungs­forschung und Rehabilitations­ wissenschaft der Universität Köln Bericht EHRGEIZIG, INNOVATIV, PATIENTENORIENTIERT Hochleistungsfähige Medizintechnik richtig anwenden, natürliche Mechanismen zur Heilung nutzen und Kranke und Verletzte mit schonenden Methoden behandeln: Berlin, Bochum, Murnau – drei Beispiele aus dem Forschungsalltag im Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (KUV) EINS | Gemeinsam neues wagen 23 Die Forschungen der Medizinerinnen und Mediziner im KUV finden weltweit Beachtung. Auch im Jahr 2012 haben sie hervorragende Ergebnisse auf ganz verschiedenen Gebieten vorgelegt. KNOCHEN AUS EIGENEN STAMMZELLEN Knochen sind wahre Wunder der Natur. Sie sind das einzige Gewebe des Menschen, das von selbst ohne Narbe verheilt. Leider aber gibt es auch hier die Ausnahme – sogenannte kritische Frakturen, bei denen die Knochen nicht mehr zusammenwachsen. Prof. Dr. Thomas A. Schildhauer, Direktor der Chirurgischen Klinik, und Prof. Dr. Manfred Köller, Forschungs­ koordinator, am BG Universitätsklinikum Bergmannsheil ­Bochum sind dafür die Spezialisten. Ihr interdisziplinäres Team erforscht, wie körpereigene Stammzellen und Wachstums­ faktoren aus körpereigenen Thrombozyten helfen können, große und bislang irreparable Knochendefekte wieder mit eigenem Knochenmaterial aufzufüllen. Adulte Stammzellen, die alle Menschen in sich tragen, spielen dabei die zentrale Rolle. Als undifferenzierte Zellen entwickeln sie sich erst im Austausch mit ihrer Umgebung zu jenen Zellen, die vor Ort gebraucht werden – zum Beispiel Gelenk-, Knorpel- oder auch Knochenzellen. „Im Vergleich zu Fremdtransplantationen ist unser Verfahren eine höchst in­ dividuelle Behandlung. Der entscheidende Vorteil ist: Der ­Patient bekommt seine eigenen Zellen zurück. Der Körper versucht daher nicht, die implantierten Zellen wieder abzustoßen“, sagt Prof. Dr. Manfred Köller. In einem ersten Schritt werden die adulten Stammzellen durch eine Punktion des Beckenkammknochens gewonnen. Da nur etwa eine von 10.000 Blutzellen des Knochenmarks eine Stammzelle ist, werden sie im Labor vermehrt. Zusätzlich wird patienteneigenes Blutplasma als Träger für diese Zellen verwendet. Damit entsteht ein gelartiges Stammzell-Wachstumsfaktor-Komposit, das in der folgenden Operation direkt in den Knochendefekt eingesetzt wird. Das Verfahren hat offenbar eine Erfolg versprechende Zukunft. „Die BG Klinik Bergmannsheil Bochum investiert derzeit in ein Reinraumlabor, das für die zukünftige klinische Anwendung notwendig ist, um zellbasierte Verfahren zur Standardreife weiterzuentwickeln“, erklärt Forschungskoordinator Köller. EIN SCAN ZUR RECHTEN ZEIT Gute Diagnostik ist eine Frage leistungsfähiger Technik und des richtigen Gespürs. Davon ist Privatdozent Dr. Dirk Stengel, Leiter des Zentrums für Klinische Forschung am Unfallkrankenhaus Berlin (ukb), überzeugt. Er weiß, wie schwer es ist, im Notfall lebensrettende Entscheidungen zu treffen. Die Computertomografie (CT) kann als ideales Diagnostikinstrument wertvolle Hilfe leisten. Stengels Forschungen dürften dessen Einsatz noch sicherer machen. Beim Ganzkörperscan werden Schwerverletzte von Kopf bis Becken mittels CT durchleuchtet. Rechtfertigt die diagnostische Aussagekraft der Methode die zusätzliche Strahlenbelastung für den Patienten? Gemeinsam mit seinem Team hat Stengel die Befunde und Krankenakten von 1.000 Patientinnen und Patienten des ukb ausgewertet. Das Ergebnis: Die CT- Diagnostik liefert verlässliche Bilder aus dem Körperinneren, aber sie zeigt längst nicht alle Krankheitsherde und Verletzungen. „Das CT ist spezifisch und sicher, aber nicht sensitiv genug“, sagt Stengel. Verletzungen, die in der CT-Bildgebung nachgewiesen werden, sind definitiv vorhanden und können sofort behandelt werden. Bestimmte Gewebeschäden in der Lunge, der Leber oder der Milz zeigen sich jedoch erst im weiteren Krankheitsverlauf. Gefäßverletzungen zum Beispiel sind erst im CT zu erkennen, wenn der Kreislauf des Patienten wieder stabil ist. Unauffällige CT-Befunde bedürfen also der weiteren statio­ nären Beobachtung. Die Resultate der sogenannten PATRESStudie (Pan-Scan for Trauma Resuscitation Evaluation Study) haben in Forschungskreisen für Aufsehen gesorgt. Sie wurden im renommierten „Canadian Medical Association Journal“ veröffentlicht und Privatdozent Dr. Stengel war 2012 Key Note Speaker bei der Jahrestagung der „British Trauma Society“ in Leeds, Großbritannien. Jetzt wollen Stengel und seine radiologischen sowie unfallchirurgischen Kolleginnen und Kollegen anhand von Routinedaten klären, wann genau die CTDiagnostik einzusetzen ist. In einer randomisierten Studie mit 500 Patientinnen und Patienten soll dabei die Strahlen­ dosis auf das geringstmögliche Maß reduziert werden. GUT VERPACKT IST HALB GEHEILT Zu den Spezialdisziplinen im KUV zählt die Versorgung von Schwerbrandverletzten. Dass die BG-Ärztinnen und -Ärzte und ihre Behandlungskonzepte auf diesem Feld international an der Spitze stehen, hat viel mit Dr. Markus Öhlbauer zu tun, dem leitenden Arzt für Plastische Chirurgie an der BG Unfallklinik Murnau. In seinen klinischen Forschungen hat er gängige Behandlungskonzepte so weiterentwickelt, dass heute auch Verunfallte mit mehr als 70 Prozent brandverletzter Körperoberfläche gute Heilungschancen haben. Mehr als 150 schwerstverletzte Patientinnen und Patienten haben er und sein Team bereits mit der Wundunterdrucktherapie behandelt – ein exzellentes Therapiekonzept ist dabei entstanden. Das Ärzteteam bringt in einem ersten Schritt offenporige Polyurethan- oder Polyvinylalkoholschwämme auf den Brandwunden auf und dichtet die Körperteile mit einer Verbandfolie luftdicht ab. Mit einem Drainagesystem wird das Wundsekret kontinuierlich abgesaugt. Das schont den Organismus und mindert Risiken, die bei den konventionellen Verfahren oft schwere Komplikationen nach sich ziehen, zum Beispiel, dass sich Ödeme bilden, die die Durchblutung erschweren und das Absterben von Zellen begünstigen. Die Rundumverpackung des Patienten hat viele Vorteile: Ein Verbandswechsel ist nur ein Mal pro Woche nötig. Das mindert das Infektionsrisiko. Der Schmerzmittelbedarf sinkt, denn der Schwamm bleibt an der Wundoberfläche festgesaugt. Nicht zuletzt reduziert das Verfahren die Zahl der Hauttransplantationen: „Dies war früher bei etwa zwei Drittel unserer Verletzten notwendig, heute sind es nur ein Drittel“, sagt Öhlbauer. Egal ob Brandwunden, Diagnostik oder personalisierte Knochenheilung – die Beispiele zeigen die Forschungsexpertise im Klinikverbund. Die Ärztinnen und Ärzte im Verbund machen Spitzenforschung, von der der Patient unmittelbar profitiert. 24 EINS | Gemeinsam neues wagen Bericht DIE DIGITALE KLINIK IST DA Telemedizin wird zunehmend von der Ausnahme zur Regel. Das gilt zumindest für die Teleradiologie und -neurologie im KUV. Auch die innerklinische Organisation verlagert der Verbund schrittweise von Papier auf Computertechnik. EINS | Gemeinsam neues wagen 25 Die Digitalisierung von klinischen Prozessen birgt enormes Potenzial. Diese Auffassung vertritt Ernst-Ulrich Hafa, KUVBereichsleiter Technische Infrastruktur. „Ziel ist es, ein kli­ nikweites Datennetz zu schaffen“, sagt der IT-Koordinator des KUV. Die digitale Arztvisite ist dabei nur ein Bestandteil. An den Standorten Berlin und Frankfurt ist sie schon umgesetzt, auch Murnau und Halle ziehen mit, Ludwigshafen und Tübingen folgen als Nächstes. Der Klinikverbund setzt nun in der Pflege verstärkt auf mobile Arbeitsplätze. Für 2013 ist geplant, in mehreren Kliniken mobile IT-Arbeitsplätze auf kabellos vernetzten Pflegewagen einzurichten. Dabei zielt der KUV auf ein einheitliches Vorgehen bei neuen IT-Projekten. „Wir werden künftig neue Systeme nur noch gemeinsam einführen“, sagt Hafa. Dadurch könnten Kosten gespart, Qualität und Effizienz jedoch gesteigert werden. AUTOMATISIERTE DATENÜBERTRAGUNG Ein aktuelles Projekt ist das Patientendatenmanagementsystem PDMS. Es soll als gemeinsames System in praktisch allen Kliniken des Verbundes eingeführt werden. In das PDMS fließen die Daten der Überwachungsgeräte auf der Intensivstation ein. Dazu werden die Stand-alone-Geräte mit dem Klinikinformationssystem verbunden. In Halle, Murnau und Berlin wird PDMS bereits eingesetzt. „Überall dort, wo wir dafür sorgen, dass Daten automatisch übertragen werden und nicht mehr die Menschen die Datenträger sind, erreichen wir Qualitäts- und Effizienzverbesserungen“, sagt Hafa. Angestrebt ist auch, dass der Datenaustausch mit dem Reha-Management der Berufs­ genossenschaft zunehmend elektronisch erfolgt. Nicht zuletzt soll die neue Technik die Patientensicherheit erhöhen. Das betont Hermann Breitinger, KUV-Bereichsleiter Kaufmännische Infrastruktur. Fehlerquellen werden reduziert, wenn Daten nicht mehrfach abgeschrieben werden müssen, sondern einmal eingetragen überall zur Verfügung stehen. Ein weiterer Vorteil: „PDMS kann auch die Entwicklung von Behandlungspfaden unterstützen“, sagt Breitinger. Zudem könne die Medikamentenverabreichung elektronisch gestützt werden. Die Medikation von der Anordnung über die Verabreichung bis zur Nebenwirkungserfassung digital zu unterstützen ist nach Hafas Auffassung sogar recht kurzfristig möglich. Dabei betont er die Koordinierungsrolle des Verbundes. „Wir wollen auch organisatorisch und nicht nur medizinisch Spitze sein“, sagt der IT-Experte. ZUKUNFTSTRÄCHTIGE NETZWERKE Diese Kombination aus organisatorischen und medizinischen Spitzenleistungen hat die Verbundkliniken auf dem Gebiet der Telemedizin ganz weit nach vorn gebracht. Praktisch parallel zum Aufbau der Traumanetzwerke haben viele Kliniken im Verbund teleradiologische Netze aufgebaut. Der Standort Berlin betreut das größte teleradiologische Netz Deutschlands. Bochum und Halle sind in der Teleradiologie ebenfalls vorne dabei. Das teleradiologische Netz der BG Kliniken Bergmanns­ trost Halle ist praktisch identisch mit dem nun zertifizierten Traumanetzwerk. 13 Krankenhäuser betreut die Radiologie in Halle aus der Ferne mit. Der Ärztliche Direktor der BG-Kliniken Bergmannstrost Prof. Dr. Gunther O. Hofmann misst der elek­tronischen Vernetzung einen hohen Stellenwert bei: „Diese Netzwerke sind die Zukunft. Das gilt für alle Bereiche der Medizin. In der Traumaversorgung gehen wir hier lediglich voran.“ Was zunächst folgt ist die Teleneurologie. Auch auf diesem Gebiet sind die BG Kliniken Bergmannstrost Halle als überregionales Stroke-Zentrum bereits aktiv. VERTRAUENSVOLLE ZUSAMMENARBEIT Der Ärztliche Direktor des Unfallkrankenhauses Berlin (ukb) Prof. Dr. Axel Ekkernkamp beobachtet hier im Berliner Telemedizinnetzwerk seit 2012 eine neue Entwicklung: „Bisher war es so, dass die Teleneurologie der Teleradiologie folgte: Jetzt gibt es eine Verzweigung. Das ist eine wichtige Weichenstellung“, sagt er. Erste teleneurologische Kooperationen entstehen mit Kliniken, die nicht teleradiologisch vernetzt sind, so zum Beispiel mit zwei Kliniken im brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland. Dem teleradiologischen Netz des ukb misst Professor ­Ekkernkamp aber eine besondere Bedeutung bei. Das ukb sendet regelmäßig eine ärztliche und eine medizinisch-technische Fachkraft zu den Netzwerkkliniken. „Es hat sich gezeigt, dass es gegenseitigen Vertrauens bedarf“, sagt Professor ­Ekkernkamp. Keine Klinikerin und kein Kliniker zeige einer anonymen Instanz mittelschlechte Ergebnisse, aber ebenso produziere auch keiner nur perfekte Ergebnisse. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit hat inzwischen dazu geführt, dass die telemedizinische Kooperation über die Radiologie hinausgeht und beispielsweise auch mal chirurgische Kräfte zur Beurteilung der Arbeit ihrer Kolleginnen und Kollegen an einem anderen Klinikum hinzugezogen werden. Zudem finden sich die Kliniken auch zu gemeinsamen Studien zusammen. „Hier entstehen ganz viele Synergieeffekte“, sagt Professor Ekkernkamp. Seine Diagnose für die Entwicklungen der Telemedizin im Jahr 2012: „Mit Freude kann konstatiert werden, dass die Dekade des Zweifelns, ob Telemedizin der richtige Weg auch für die Bundesrepublik Deutschland und seine Flächenländer darstellt, jetzt – endlich – abgelöst wird von der kontinuierlichen Verbesserung des telemedizinischen Einsatzes in der Routine.“ „Wir wollen auch ­organisatorisch und nicht nur medizinisch Spitze sein.“ Ernst-Ulrich Hafa, KUV-Bereichsleiter ­ Technische Infrastruktur 26 EINS | Gemeinsam neues wagen EINS | Gemeinsam neues wagen 27 Feature NEUE VERSORGUNGS­ STANDARDS SETZEN Im Notfall muss es schnell gehen. Dafür sorgen opti­male Abläufe in Rettungsstellen und Notaufnahmen. Neueste Standards haben die Verbundkliniken Berlin und Frankfurt entwickelt. Dr. Uwe Schweigkofler liebt seinen Arbeitsplatz. Aber er wechselt ihn auch gerne mal. Genauso gern wie er im OP, in der Notfallambulanz oder auf der Intensivstation arbeitet, ist er im Notarzteinsatzfahrzeug oder mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 2“ unterwegs. „Ich freue mich auch heute noch über jeden Tag, an dem ich Hubschrauber fliege“, sagt der begeisterte Unfallchirurg. Sehr viel Gelegenheit dazu hat er aber nicht mehr, seit er Leiter des Notfall- und Rettungszentrums der BG Unfallklinik Frankfurt am Main ist. Das Zentrum fasst den präklinischen Rettungsdienst mit Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungshubschrauber mit der innerklinischen Notfallversorgung in Notfallambulanz, Schockraum und chirurgischer Versorgung der interdisziplinären Intensivstation organisatorisch zusammen. Geplant ist, dass auch der Notfall-OP und eine Aufnahmestation eingegliedert werden. Diese Organisationsform hängt eng mit der Person der Zentrumsleitung zusammen. Schweigkofler macht damit praktisch einen Schritt zurück nach vorn. „Ich gehöre zu den alten Allroundern hier im Haus“, sagt der 49-Jährige leicht schmunzelnd. Entsprechend hat er die Behandlungs­ pfade für die Notfälle aufgestellt. Doch das entstandene ­ onzept ist keineswegs altbacken. „Wenn es komplett umgeK setzt ist, haben wir wirklich einen neuen Standard gesetzt“, sagt Schweigkofler. Weniger Schnittstellen Die Abläufe folgen dem Prinzip „One Face to the Customer“: Wenn es möglich ist, dann begleitet ein Arzt den Verletzten vom Unfallort durch die Rettungsstelle bis in den OP. Das Ziel: „Wir wollen mit dieser neuen Ablauforganisation die innerklinischen Schnittstellen verringern und mehr Kontinuität bei der Informationsweitergabe erreichen“, so Schweigkofler. Jede Übergabe berge die Gefahr, dass Informationen verloren gehen. „Das neue System ist für beide Seiten vorteilhaft. Der Arzt kennt den Patienten von Anfang an. Und Patientinnen und Patienten wissen es zu schätzen, wenn der Arzt auf der Intensivstation weiß, was draußen los war.“ Wer den Unfallort gesehen habe, wisse auch bei der weiterführenden Diagnostik und Behandlung genauer, worauf er eventuell noch achten sollte. Das Modell hat der leitende Arzt aus eigener Erfahrung ent­wickelt. „Ich rette gern, aber wenn ich weiß, dass ich auch 28 EINS | Gemeinsam neues wagen EINS | Gemeinsam neues wagen 29 die Verantwortung für die initiale Notfallversorgung und -operation in der Klinik trage, habe ich noch mal eine ganz andere Motivation im Umgang mit dem Patienten, als wenn ich ihn an der Krankenhaustür abgebe“, sagt Dr. Schweigkofler. Mit dem neuen Konzept will er daher auch die Assistenzärztinnen und -ärzte motivieren, die im Rahmen ihrer Weiterbildung meist für sechs Monate ins Notfall- und Rettungszentrum rotieren sollen. Allerdings sei dafür auch ein großer Pool an Notarztkräften nötig. Für den Dienstbetrieb müssen rechnerisch 13 Arztstellen besetzt werden. Sie betreuen an der BG Unfallklinik Frankfurt am Main rund 5.000 Notarzteinsätze pro Jahr. Sehr feine Arbeitsbedingungen Zur Motivation trägt auch die neue Ausstattung des Rettungszentrums bei. „Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, haben wir sehr feine Arbeitsbedingungen“, sagt Schweigkofler. Die Wege sind wesentlich kürzer geworden. Der Hubschrauber landet praktisch auf dem Schockraum. „Das ist mit Blick auf Wege und Prozesse ein wesentlicher Vorteil“, sagt der Ärztliche ­Direktor der BGU Frankfurt Prof. Dr. Reinhard Hoffmann. Auch den neuen Schockraum selbst mit Platz für zwei Schwerverletzte und quasi integriertem CT schätzt Hoffmann sehr. Verkürzt haben sich zudem die Wege vom Schockraum in den OP. Die Zusammenfassung von Rettungshubschrauber, fahrendem Rettungsdienst, Notaufnahme und Schockraum zum Notfall- und Rettungszentrum bewirkt nach den Worten von Professor Hoffmann einen „integrativen Ansatz, der auch die Prozesse viel schlanker macht, sodass eine Maßnahme direkt in die andere greifen kann“. Dazu trägt auch bei, dass die gesamte Führungsverantwortung für diese Prozesskette bei Schweigkofler in einer Hand liegt. „Die Neuorganisation hat damit auch standardisierte Abläufe bis in den OP hinein gebracht“, sagt Hoffmann. Mehr Patientensicherheit Auch in Berlin wird die zentrale Notaufnahme neu strukturiert und bei laufendem Betrieb erheblich erweitert, um den mittlerweile über 60.000 Patientinnen und Patienten pro Jahr gerecht zu werden. Ein Teil der neuen Räume wurde 2012 eröffnet. Der Neubau ermöglicht ein völlig neuartiges Not­ aufnahmekonzept. Die gesamte Rettungsstelle ist nach einem offenen Konzept gestaltet, sodass ein Arzt alle Patienten im Blick haben kann. Auch die Behandlungsplätze sind offen angelegt, wahren aber die Intimsphäre des Patienten. Das hat mehrere Vorteile. Zunächst ist es leichter, die Kranken und Verletzten zu überwachen. Das ist in einer Notaufnahme essenziell. „Es steigert die Patientensicherheit“, sagt Privatdozent Dr. Gerrit Matthes, Chirurg und leitender Oberarzt der Notaufnahme des Unfallkrankenhauses Berlin (ukb). Gerade angesichts der Arbeitsverdichtung in der Krankenhausversorgung sei es gut, wenn ein Arzt alle Patienten, die er akut versorgt, auch im Blick habe. Doch auch ansprechbare ärztliche und Pflegekräfte sind einfacher zu finden. Das hat sich bereits ein halbes Jahr nach der Teileröffnung als Vorteil erwiesen, auch für den Austausch unter Kollegen. „Wenn alle verdichtet in einem Areal arbeiten und einen gemeinsamen 30 EINS | Gemeinsam neues wagen Arbeitsplatz haben, ist auch die Kommunikation schneller und reibungsloser“, sagt Matthes. „Das Konzept beinhaltet auch, dass alle Behandlungsplätze von jeder Disziplin besetzt werden können“, sagt Matthes. Dazu wurden mobile Monitore angeschafft, die an jedem Platz eingehakt werden können. Diese Abkehr von fachspezifischen Behandlungsplätzen ermöglicht eine effektive Raumnutzung und schafft mehr Flexibilität. Ein spezieller Monitor steht im neuen Schockraum mit vier Plätzen auf 185 Quadratmetern. Dort können Ankündigungen in einen digitalen Kalender eingetragen werden. Kürzere Wege Doch nicht nur baulich ändert sich in Berlin derzeit alles. Auch die Abläufe werden neu organisiert. So sind die Schränke mit Verbrauchsmaterial künftig nicht mehr alphabetisch sortiert, sondern nach dem ATLS-Prinzip (Advanced Trauma Life Support). Alles, was für ein spezielles Patientenproblem gebraucht wird, findet sich dann in einer Schublade. Das soll Arzt- und Pflegekräften Wege ersparen. Zudem wurden vor der Eröffnung im Mai 2013 Ablaufpläne für typische Gesundheitsprobleme in der Rettungsstelle erstellt. Sie legen fest, wo und wie Patienten in den neuen Räumlichkeiten versorgt werden. Noch eine Neuerung: Um den Versichertenstatus der Patien­ tinnen und Patienten zu erfassen, arbeiten jetzt auch Angestellte aus der Administration direkt auf der Notaufnahme mit. Die wesentliche organisatorische Änderung ist aber ­sicher die Einführung der sogenannten Manchester-Triage, einem System zur Klassifizierung von Notfallpatienten nach ­Behandlungsdringlichkeit. Einen positiven Effekt hat Matthes schon bei der Einführung des Systems beobachtet. Rettungsdienste, die Patienten bringen, haben sofort einen Ansprechpartner in der Klinik: die speziell geschulte Pflegekraft am zentralen Triage-Punkt. In der Innenorganisation der Notauf- „DAS NEUE SYSTEM IST FÜR BEIDE SEITEN VORTEILHAFT. DER ARZT KENNT DEN PATIENTEN VON ANFANG AN.“ Dr. Uwe Schweigkofler, Leitender Arzt des Notfall- und Rettungszentrums der BG Unfallklinik Frankfurt am Main nahme führt die Triage unter anderem dazu, dass sich Ärztinnen und Ärzte an digitale Arbeitslisten gewöhnen müssen. Dort ist farblich gekennzeichnet, welcher Triage-Stufe eine Patientin oder ein Patient zugeordnet wurde. Die Manchester-Triage ist im ukb im Krankenhausinformationssystem (KIS) elektronisch hinterlegt und wird wie die gesamte Dokumentation papierlos vorgenommen. Matthes’ Zwischenfazit nach einem halben Jahr: „Es gibt eine Lernkurve bei der Manchester-Triage, aber die ersten Erfahrungen sind gut.“ 32 EINS | Gemeinsam neues wagen Meldungen Gemeinsame Großgeräte­beschaffung Klinikneubauten künftig nach einheitlichem Konzept Der KUV koordiniert die Anschaffung von medizintechnischen Großgeräten und ­anderen Investitionsgütern. Die Kliniken melden ihre geplanten Anschaffungen für einen Zeitraum von fünf Jahren im Voraus. Der KUV wertet die Meldungen aus, bündelt den Bedarf und führt gemein­same Ausschreibungen durch. „Auf diese Weise wollen wir Einsparpotenziale für die einzelnen Kliniken realisieren“, sagt Hermann Breitinger, KUV-Bereichsleiter Kaufmännische Infrastruktur. Vorangegangen war die Einführung von Standards in der Bezeichnung der Investitionsgüter. Gebäudetechnik wird nach der Systematik der DIN 276 erfasst. Für Medizintechnik wurde das „Informationssystem Medizintechnik (IMT)“ eingeführt. Es liefert nicht nur technische und sicherheitsrelevante Informationen zu jedem Gerät, sondern auch Hinweise, welche Geräte mit gleichartigem Zweck und Leistungsspektrum am Markt angeboten werden. „Wir können und wollen Innovationen eher eine Chance geben als andere Kliniken. Auch das verstehen wir als Teil des gesetzlichen Auftrags der Unfallversicherung, den zu erfüllen wir mithelfen“, sagt Breitinger. Das setze aber auch voraus, dass Technik so wirtschaftlich wie nur möglich beschafft und betrieben werde. Steht ein Neubau in einer Unfallklinik, Klinik für Berufskrankheiten oder Unfallbehandlungsstelle an, dann soll künftig das Klinikgesamtbaukonzept des Klinikverbundes zum Tragen kommen. Die Initiative dazu wurde 2012 angestoßen. Geplant ist, dass eine Musterklinik entworfen wird, bei der Patientenzimmer und sonstige Flächen standardisiert sind. Sie dient dann als Modell für alle Neubauten im Klinikverbund. Aktuell entsteht in Frankfurt für rund 140 Millionen Euro ein kompletter Klinikneubau. Die neuen OP-Säle, Radiologie und Funktionsräume sind schon am Netz, die neuen Bettenhäuser und die Intensivstation noch im Werden. Große Bauarbeiten laufen zudem in Murnau. Weil die BG Unfallklinik Murnau bald aus allen Nähten platzt, baut sie für insgesamt rund 75 Millionen Euro ein sechsstöckiges Bettenhaus und ein zweistöckiges Parkhaus. Der Bereich für Rückenmarkverletzte wird erweitert und ein Hörsaal für Fortbildungen und Symposien wird neu geschaffen. Auch am BG Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum wird in großem Stil gebaut. Bereits Mitte 2013 werden ­Teile des neuen Funktionstraktes und des Bettenhauses genutzt werden können. Dazu gehören die neue Notfallaufnahme, ein OP-Zentrum, Intensiv- und Normalpflegestationen sowie Funktionsabteilungen wie Radiologie, Labor und Zentral­ sterilisation. In einem zweiten Bauabschnitt werden der neue Funktionstrakt und das neue Bettenhaus noch einmal erweitert. Die Gesamtbaumaßnahmen mit einer Investition von mehr als 100 Millionen Euro sollen 2016 abgeschlossen sein. EINS | Gemeinsam neues wagen 33 „Wir können und wollen Innovationen eher eine Chance geben als andere Kliniken.“ Hermann Breitinger, KUV-Bereichsleiter Kaufmännische Infrastruktur Die Bagger rollten auch in Ludwigshafen im Sommer 2012 an. Dort entsteht für rund 20 Millionen Euro bis Anfang 2014 ein neues Rehazentrum, das auch gesetzlich Krankenversicherten offenstehen soll. Auf über 10.000 Quadratmetern Nutzfläche werden 150 stationäre Betten und 80 ambulante Plätze geschaffen. Abgeschlossen wurden dagegen die Bauarbeiten für das neue Reha-Wohnhaus der BG Kliniken Bergmannstrost Halle. Nach rund einjähriger Bauzeit wurde das Gebäude mit 46 modernen Einzelzimmern, davon 22 barrierefrei, und einer Gesamtinvestition von 3,5 Millionen Euro im Mai 2012 eröffnet. soll in einem dreijährigen Projekt mit Förderung der Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (BGHW) ein innovatives Rettungskettenkonzept erarbeitet werden. Finanzierbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Realisierbarkeit und die Sicherheit des Systems werden dabei berücksichtigt. Die BGHW erhofft sich davon auch Verbesserungen für den Arbeitsschutz an diesen noch recht neuen Arbeitsplätzen. Dabei geht es nicht nur um die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Windrädern, sondern auch um die, die unter Wasser im Taucheinsatz sind. Dem Projektteam gehören neben Fachleuten der Notfall-, Rettungs- und Unfallmedizin auch solche aus den Disziplinen Biomechanik, Meereswissenschaft, Physik, Ingenieurwesen und Jura sowie der Berufsgenossenschaften an. Sie arbeiten in Kooperation mit anderen auch an einer maritimen Sicherheitspartnerschaft für Offshore-Windparks. O-Arm für alle Kliniken im KUV Hamburg erforscht ­Rettungswege aus ­Windparks auf See Wie können Unfallverletzte aus OffshoreWindkraftanlagen schnell und sicher geborgen werden? Das erforscht seit April 2012 das BG Unfallkrankenhaus Hamburg (BUKH). „Bisher sind Notfallpläne für komplexe Rettungssituationen vorhanden, die keine einheitliche Rettungskette vorgeben“, erklärt der Ärztliche Direktor des BUKH Prof. Dr. Christian Jürgens. Aus wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Rettungslogistik, -technik und -medizin Die BG Unfallklinik Murnau setzt im OP zunehmend auf den O-Arm statt auf den bisher üblichen C-Bogen. „Im Bereich der Operationssaal-Technik sind wir die Klinik mit der meisten Erfahrung beim Einsatz von sogenannten O-Armen“, sagt Prof. Dr. Volker Bühren, Ärztlicher Leiter der BGU Murnau. Der O-Arm ermöglicht Schnittbilder von Körperregionen, die mit dem herkömmlichen C-Bogen mitunter schwer erreichbar sind. Im OP hat er sich laut Professor Bühren besonders bei Eingriffen an der oberen Halswirbelsäule oder der Brustwirbelsäule und bei komplizierten Gelenkfrakturen bewährt. Der O-Arm mache sichtbar, ob ein Gelenk korrekt reponiert ist und ob alle Schrauben richtig liegen. „Durch die direkte CT-Kontrolle im OP spart man in vielen Fällen eine zweite Operation“, sagt Professor Bühren. Der KUV hat nun nach seinen Angaben einen Rahmenvertrag zur Anschaffung dieser Technik für den gesamten Klinikverbund abgeschlossen. Forschungspreis für Brandwundenbehandlung in Bochum Wie gezielte Stoßwellenbehandlung die Wundheilung bei großflächigen Verbrennungen verbessern kann, hat Dr. Ole Goertz vom BG Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum untersucht. Für seine Forschungsarbeit wurde der Oberarzt der ­Klinik für Plastische Chirurgie und Schwerbrandverletzte jetzt mit dem „Cicatrix Studienpreis 2012“ ausgezeichnet. Der Preis zählt mit einem Preisgeld von 10.000 Euro zu den höchstdotierten Auszeichnungen in der Plastischen Chirurgie. Großflächige Wunden bei Verbrennungen sind kritisch, weil sie zu Wundinfektionen und schlimmstenfalls zu einer Blutvergiftung führen können. Die Stoßwellenbehandlung scheint ein neuer Weg zu sein, den Heilungsprozess solcher Wunden zu beschleunigen. Darauf deuten erste experimentelle Studien des „Bergmannsheils“ hin. Die Forschergruppe beobachtete Verbesserungen bei einigen Parametern, die für die Wundheilung entscheidend sind. „Mittelfristig wäre zu prüfen, ob unsere Annahmen auch im Rahmen klinischer Patientenstudien standhalten“, so Goertz. Die Stoßwellentherapie ist in der Medizin bereits eta­ bliert. Sie wird zum Beispiel zum Zertrümmern von Nierensteinen und bei schlecht heilenden Knochenbrüchen eingesetzt. 34 EINS | Miteinander mehr erreichen Bericht DIE DGUTRAUMANETZWERKE – EINE ERFOLGSSTORY Der KUV wirkt maßgeblich an der ­Entwicklung und Weiterentwicklung der Traumanetzwerke der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie mit. Auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung treibt die Netzwerkbildung voran. Als „Erfolgsstory“ bezeichnet Prof. Dr. Reinhard Hoffmann, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) und Ärztlicher Direktor der BG Unfallklinik Frankfurt am Main die DGU-Traumanetzwerke. 38 zertifizierte Trau­ manetzwerke mit 521 zertifizierten Kliniken zählte die medi­ zinische Fachgesellschaft im Februar 2013. Eines der jüngsten ist das Traumanetzwerk „Sachsen-Anhalt Süd“. Es wurde im Dezember 2012 zertifiziert. Insgesamt 13 Kliniken sind dort organisiert. Mit der Zertifizierung dieses Traumanetzwerkes sind jetzt alle Kliniken im KUV als überregionale Versorgungszen­ tren in ein Traumnetzwerk eingebunden. Maßgeblichen Anteil an der Zertifizierung des Netzwerks in Sachsen-Anhalt hatten die BG Kliniken Bergmannstrost Halle. Sie haben die notwendigen Kurse für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Kliniken angeboten. VERSORGUNG FUNKTIONIERT BESSER „Die Verbundkliniken spielen in ihren jeweiligen Traumanetzen in der Regel eine wichtige Rolle, auch in der Moderation, Weiterbildung und Vernetzung mit anderen Kliniken“, sagt Hoffmann. Die DGU hat inzwischen nachgewiesen, dass die Netzwerke die Versorgung Schwerverletzter verbessern. Sie gewährleisten unter anderem, dass Schwerverletzte innerhalb von 30 Minuten in eine passende Klinik gebracht und sofort weiterbehandelt werden, wie die DGU anlässlich der Vorlage des neuen Weißbuches mitteilte. Das Weißbuch bildet praktisch die wissenschaftliche Basis des dreigliedrigen Systems der Traumanetzwerke mit ihren lokalen, regionalen und überregionalen Zentren. In der 2012 erschienenen zweiten Auflage liegt der Fokus darauf, dass die Rehabilitation frühzeitig einsetzen muss. Ziel ist es laut DGU „die noch deutlich vorhandenen Defizite in der funktionellen und psychischen Wiederherstellung der Verunfallten“ zu verbessern. EINS | Miteinander mehr erreichen 35 NETZWERKSTRUKTUREN ­ MACHEN SCHULE Die dreigliedrige Struktur der Traumanetzwerke spiegelt sich seit 2012 auch in der Struktur des neuen stationären Heilver­ fahrens der DGUV. Wie für die Zentren der Traumanetzwerke werden auch für die verschiedenen Versorgungsstufen in der Unfallversicherung unterschiedliche personelle, apparative und strukturelle Voraussetzungen gefordert. „Hier gibt es ­einen engen logischen Zusammenhang“, sagt Prof. Dr. Volker Bühren, Ärztlicher Direktor der BG Unfallklinik Murnau und Moderator der DGU-Traumanetzwerke in Bayern. Gab es in der Unfallversicherung bislang nur das D-ArztVerfahren (DAV) und das Verletzungsartenverfahren (VAV), so ist nun das Schwerverletzungsartenverfahren (SAV) neu hinzugekommen, das quasi den überregionalen Zentren der Traumanetzwerke entspricht. Es stellt deutlich höhere Anforderungen an die Präsenz und Verfügbarkeit von Fächern außerhalb der Unfallchirurgie, aber auch an die apparative Ausstattung. So ist für das SAV unter anderem eine neurochirurgische Vollabteilung am Standort des Krankenhauses gefordert, während für die Versorgungsstufe VAV ein neurochirurgischer Kooperationspartner genügt. Zudem müssen Krankenhäuser, die am SAV teilnehmen wollen, zwei betriebsbereite OP-Säle vorhalten. REHA RÜCKT INS BLICKFELD „Ganz wesentlich neu ist, dass die Rehabilitation und die ­Organisation der Reha mit eingeschlossen sind“, sagt Professor Bühren. Das SAV fordert ausdrücklich, dass ein Reha-­ Management für die Unfallversicherten eingeleitet wird. Es muss immer eine Oberärztin oder ein Oberarzt mit Weisungskompetenz für Reha-Maßnahmen verfügbar sein und eine ­Kooperation mit der Reha-Medizin bestehen. Professor Bühren spricht in diesem Zusammenhang von einem Paradigmenwechsel: „Bis zum Jahr 2000 zählte das Überleben, seitdem rückt die Lebensqualität immer mehr in den Vordergrund.“ Von dieser Neuordnung des Heilverfahrens könne auch die Struktur der Traumanetzwerke profitieren, meint Professor Bühren. „Ich denke, dass die Neuordnung der Heilverfahren diese Netzwerkstruktur sehr stärkt. Die DGU beleuchtet das von der wissenschaftlichen Seite und das neue Verletzungsartenverfahren der DGUV trägt nun auf Basis des Siebten Buches Sozialgesetzbuch die gesetzliche Grundlage dazu bei“, sagt er. TELEMEDIZIN SCHAFFT FORTSCHRITT Professor Hoffmann hält es für besonders zukunftsweisend, dass in den Traumanetzen zunehmend die Teleradiologie etabliert wird. So sind ortsübergreifende Fallkonferenzen und der Austausch von Bildern problemlos möglich. Der Ärztliche Direktor der BG Unfallklinik Frankfurt würde es begrüßen, wenn die DGUV diesen Standard auch für den Datenaustausch zwischen Häusern der Versorgungsstufen SAV und VAV fördert. „Es wäre günstig, wenn die DGUV die teleradiologische Vernetzung zwischen SAV- und VAV-Kliniken im Sinne einer Qualitätssicherung unterstützt. Ich bin überzeugt, dass der elektronische Datenaustausch im Klinikverbund immer wichtiger wird“, sagt er. Zudem plädiert Hoffmann für einen Schulterschluss zwischen DGUV und DGU im Bereich der Versorgungsdaten. „Das würde im Bereich der Schwerverletztenversorgung eine einzigartige Möglichkeit für Versorgungsforschung öffnen“, sagt Hoffmann. Das DGU-Traumaregister einerseits und die Statistiken der DGUV andererseits ergäben zusammen eine Datenquelle von großem Wert für die Versorgungswissenschaften und die Versorgungspolitik. 36 EINS | Miteinander mehr erreichen EINS | Miteinander mehr erreichen 37 Bericht RUNDUMVERSORGUNG AUS EINER HAND Deutschland hat ein hervorragendes Gesundheits­ system. Doch es knirscht an den Schnittstellen. Das beklagen Fachleute seit Jahren. Dabei ist klar: Patientinnen und Patienten profitieren von vernetzter Versorgung. Die Kliniken der Unfallversicherung zeigen, wie es geht. 38 EINS | Miteinander mehr erreichen An den Schnittstellen der Gesundheitsversorgung knirscht es laut und deutlich. Das Paradebeispiel: Eine Patientin oder ein Patient wird ohne Medikamente am Freitagnachmittag aus dem Krankenhaus nach Hause geschickt. Weder Hausarzt noch Pflegedienst sind erreichbar oder vorher informiert. Der Patient muss zwei Tage lang sehen, wie er zurechtkommt. Im schlimmsten Fall ruft er wegen seiner Schmerzen den Notdienst. Das ist nicht nur für den betroffenen Patienten alles andere als gut. Es schadet auch dem Gesamtsystem. Der Heilungsprozess verzögert sich. Zusätzliche Kosten entstehen, im Gesundheitssystem und darüber hinaus. Denn bis der Patient wieder arbeiten kann, vergeht mehr Zeit als nötig. Sachverständige fordern ­Schnittstellenmanagement Leider sind solche und ähnliche Fälle nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel in der Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das Knirschen wird immer lauter. Das stellt auch der Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen in seinem Sondergutachten 2012 fest. Seine Diagnose: „Durch die strukturellen Veränderungen in der Krankenhausversorgung ebenso wie durch die demografische Entwicklung und den damit einhergehenden Wandel der Patientenstruktur sind an dieser Schnittstelle neue Probleme und Herausforderungen entstanden.“ Patienten haben beim Verlassen des Krankenhauses einen höheren Weiterversorgungsbedarf als früher. Das Durchschnittsalter steigt. „Die Vorbe­ reitung der Anschlussversorgung ist daher oftmals aufwändig und anspruchsvoll. Zugleich haben sich die dafür zur Verfügung stehenden zeitlichen Spielräume verringert“, so die Ge- „IN DER BERUFSGENOS­ SENSCHAFTLICHEN ­V ERSORGUNG KÖNNEN PATIENTEN ZEITLICH ­N AHEZU UNBEGRENZT UND ÜBER SEKTOREN HINWEG BETREUT WERDEN.“ Prof. Dr. Ernst Haider, Geschäftsführer des Unfallkrankenhauses Berlin EINS | Miteinander mehr erreichen 39 sundheitssachverständigen. Als Therapie verordnen sie umfassendes Schnittstellenmanagement, in dem Arzt, Pflege und Sozialarbeit zusammenwirken. Dabei konzentrieren sich die Fachleute auf die Schnittstelle zwischen Krankenhäusern und ambulanter Versorgung durch Arztpraxen und medizinische Versorgungszentren. Von Physiotherapie, Rehabilitation und psychosozialer Betreuung ist hier noch keine Rede. Fallmanagement koordiniert die Versorgung Glück im Unglück hat, wer aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit im Klinikverbund behandelt wird. Denn er erfährt meist eine vorbildliche Versorgung aus einer Hand. Von der Akutversorgung bis zur Wiedereingliederung in den Beruf wird die gesamte Versorgungskette koordiniert. Weil der Klinikverbund alles aus einer Hand anbietet, können viele Behandlungsschritte miteinander verknüpft werden, die in der gesetzlichen Krankenversicherung in getrennter Verantwortung nacheinander kommen. So können Unfallversicherte auch lange nach ihrer Entlassung zu Sprechstunden in die ­Kliniken des Verbundes kommen, um Spätfolgen mit den vertrauten Personen zu besprechen. Zudem beginnt die Reha meist direkt mit der Akutversorgung. Physiotherapeutisches Personal ist oft schon am Tag nach einer Operation beim ­Patienten. Das beschleunigt den Heilungsverlauf enorm. Auch für frühzeitige psychosoziale Betreuung ist gesorgt. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ein Berufsunfall das Leben einschneidend verändert. In solchen Fällen und bei besonderem Hilfebedarf ­unterstützt zusätzlich der persönliche Reha-Manager der Berufsgenossenschaft den Patienten dabei, zurück in seinen ­Alltag zu finden. Er nimmt meist schon im Krankenhaus Kontakt zu dem Patienten auf und bespricht mit ihm die Schritte von der Krankenhausentlassung bis zum beruflichen Wieder- einstieg. Das geht weit über Medizin und Reha hinaus. Wenn nötig, veranlasst er zum Beispiel, dass ein Auto so umgebaut wird, dass ein Querschnittgelähmter damit zum Büro fahren kann, und kümmert sich auch um die entsprechende Gestaltung des Arbeitsplatzes. Dieses umfassende Fallmanagement hat die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) inzwischen im Rahmen von sogenannten integrierten Versorgungsangeboten stellenweise übernommen. In der Regelversorgung der GKV ist eine solche koordinierte Behandlung jedoch noch Wunschtraum. Die ­Kliniken der Unfallversicherung arbeiten dagegen schon weiter an der Optimierung ihrer vernetzten Strukturen. Sie wollen GKV-Versicherten die gleiche umfassende Versorgung bieten wie ihren BG-Versicherten. Dazu rücken sie vielerorts enger mit Arztpraxen Niedergelassener zusammen, wie es der Sachverständigenrat fordert. Klinikverbund rückt mit ­Niedergelassenen zusammen Als „Brücke in den ambulanten Sektor“ betrachtet Prof. Dr. Ernst Haider, Geschäftsführer des Unfallkrankenhauses Berlin (ukb), das Gesundheitszentrum, das seit 2012 am ukb entsteht. „In der berufsgenossenschaftlichen Versorgung können Patienten zeitlich nahezu unbegrenzt und über Sektoren hinweg betreut werden. Diese Möglichkeit gibt es in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht. Das ist aus Patientensicht teilweise problematisch. Sie verstehen das nicht und fühlen sich alleingelassen“, sagt Haider. Er hofft daher, dass die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten im Gesundheitszentrum Hürden auf den Behandlungspfaden der GKV-Versicherten abbaut. Der symbolische erste Spatenstich zu dem 30-MillionenEuro-Projekt mit zwei Gebäudeteilen auf 10.000 Quadratmetern Grundfläche erfolgte am 7. September 2012. Die Eröffnung der Gebäude ist für das Jahr 2014 geplant. In dem L-förmigen Gebäude für das Gesundheitszentrum sollen 40 Arztpraxen auf 40 EINS | Miteinander mehr erreichen fünf Etagen unterkommen. Eine große Fläche ist für ambu­ lante Physiotherapie vorgesehen. Das ukb will in dem Gesundheitszentrum ein eigenes medizinisches Versorgungszentrum betreiben. Doch auch Arztpraxen sollen sich einmieten. Es gibt bereits zahlreiche Mieter und Interessenten. „Wir versuchen das komplette Facharztspektrum in ­seiner ganzen Breite abzubilden. Dabei können manche Fachrichtungen auch doppelt vorhanden sein, ohne dass sie sich Konkurrenz machen. Der Bedarf ist hier vor Ort gegeben“, sagt Cornelia Iken, Leiterin Strategie und Organisation des ukb. Der Fokus liege auf dem berufsgenossenschaftlichen Auftrag, doch auch der Versorgungsauftrag für den Berliner Bezirk Marzahn spiele eine Rolle. „Wir wollen hier am Standort der Gesundheitsanbieter schlechthin sein und komplett von am­ bulant über stationär bis Reha alles anbieten“, so Iken. Angestrebt ist ein reger Austausch zwischen den Ärztinnen und Ärzten aus Praxis, Medizinischem Versorgungszentrum (MVZ) und Klinik bei der gemeinsamen Patientenbehandlung, sodass die Niedergelassenen genau wissen, welche Unterlagen ihre Patientinnen und Patienten für den Klinikaufenthalt brauchen. Mehrfachuntersuchungen können dann vermieden werden. Auch bei der Entlassung aus dem Krankenhaus soll eine enge Abstimmung mit den nachbehandelnden Kolleginnen und Kollegen erfolgen, damit es nicht zu ­einem Bruch in der Behandlung kommt. Synergien will das ukb zudem erschließen, indem es den Niedergelassenen zum Beispiel die Nutzung der Krankenhaus-Sterilisation oder Laborleistungen anbietet. Verbundkliniken bauen die ­Versorgungskette aus Auch die BG Unfallklinik Frankfurt am Main sucht die sek­ torübergreifende Zusammenarbeit – und zwar nicht nur in der Akutmedizin, sondern auch in der Reha. Dazu hat sie die MAIN.BGMED ins Leben gerufen. Unter dieser Dachmarke sind alle ambulanten Angebote der BGU Frankfurt zusammengefasst. Das sind bislang das Medizinische Versorgungszen­trum mit fünf Kassenärztinnen und -ärzten als 100-prozentige Tochter der BGU und das ambulante Rehazentrum, bei dem die BGU einen Managementpartner mit 49 Prozent beteiligt hat. Die Rehaklinik und das MVZ sollen im Sommer 2014 in das neue Gesundheitszentrum umziehen, das die BGU Frankfurt seit Herbst 2012 für 13 Millionen Euro baut. Zusammen werden sie rund 2.000 Quadratmeter in der ersten und zweiten Etage des dreigeschossigen Baus belegen. Im Erdgeschoss werden weitere 1.000 Quadratmeter an Arztpraxen und Gesundheitsdienstleister vermietet. Der Vermietungsstand ist ausgezeichnet. Ein Neurologe, ein Psychologe, ein Unfallchirurg mit D-Arzt-Zulassung und ein Kardiologe haben bereits Praxis­ räume reserviert. Bewusst setzt die BGU Frankfurt auf die Zusammenarbeit mit diesen Fachgruppen, weil sie einen wichtigen Baustein für die Rundumversorgung der Patienten bilden. Das Rehazentrum ist erst im Juli 2012 gestartet und jetzt schon voll ausgelastet. „Wir mussten bisher einige Patientinnen und Patienten nach der stationären Reha wegschicken. Dem wollten wir mit dem Ausbau des letzten Elements in der Versorgungs- und Wertschöpfungskette entgegenwirken und vor allem den Unfallversicherungsträgern ein umfassendes Leistungsangebot bieten“, sagt Dr. Uwe Kage, Kaufmännischer ­Geschäftsführer der BGU Frankfurt. Mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Million Euro Umsatz 2012 ist das ambulante Rehazentrum auf klarem Expansionskurs. Die Strategie hinter dem neuen Geschäftszweig: „Es war unser Ziel, eine integrierte Versorgungskette anzubieten, damit der Patient die gesamte Behandlung aus einer Hand hat“, so Dr. Kage. Der Vorteil aus Patientensicht ist, dass bei der integrierten ambulanten Reha die medizinische Vorgeschichte deutlich besser berücksichtigt werden kann als bei einem externen Anbieter. EINS | Miteinander mehr erreichen 41 „Die Rückkopplung zwischen ambulantem Therapeuten und behandelnden Klinikärzten ist eng, was den Unfallversicherungsträgern besonders wichtig ist“, sagt Kage. Der Patient lernt seinen ambulanten Therapeuten schon beim Klinikaufenthalt kennen und wird bis in den Arbeitsalltag hinein von ihm begleitet. Denn geplant ist, dass die ambulante Reha, wie bei der arbeitsplatzbezogenen Reha üblich, auch Arbeitsplatzanalysen durchführt. Auf dieser Basis werden individuelle Trainingsangebote entwickelt – übrigens zukünftig auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BGU Frankfurt selbst. Bedeutung der Reha wächst Das Vorzeigemodell der berufsorientierten Reha in Deutschland ist und bleibt aber das B.O.R-Reha-Zentrum der BG Unfallklinik Duisburg. Nirgends sonst werden so viele realitätsgetreue Trainingsmöglichkeiten für den Wiedereinstieg in den Job geboten. Brummifahrer und Logistiker finden dort zum Beispiel einen halben LKW mit Ladefläche, an dem sie alle Bewegungsabläufe üben können. Die Kassiererin setzt sich zum Training an die Supermarktkasse mit Laufband. Dachdecker und Zimmermänner probieren sich am Übungsdach aus. So wird die funktionelle Leistungsfähigkeit des Patienten gleichzeitig gesteigert und geprüft. Auch lässt sich so ermitteln, ­welche Therapiemaßnahmen noch nötig sind, damit der Patient seinen alten Beruf wieder ausüben kann. „Die berufsorientierte Reha ist ungeheuer wichtig, denn sie bringt eine hohe Quote an Berufsrückkehrern“,sagt Friedhelm Bohla, Geschäftsführer des B.O.R-Reha-Zentrums. Auch im Rahmen der berufsgenossenschaftlichen Heilverfahren wächst der Stellenwert der berufsorientierten Reha und der Reha im Allgemeinen zusehends. Dabei überwindet der Klinikverbund die Trennung in ambulant und stationär in diesem Bereich schon durch die baulichen Voraussetzungen. Unter anderem ist an der BG Klinik Ludwigshafen ein großes Rehazentrum geplant. Ab 2014 sollen auf vier Ebenen mit 10.000 Quadratmetern Nutzfläche insgesamt 150 Betten für BG- und GKV-Patientinnen und -Patienten und ein ambu­ lantes Therapiezentrum entstehen. „Die Vorteile liegen auf der Hand“, sagt Prof. Dr. Paul A. Grützner, Ärztlicher Direktor der BGU Ludwigshafen. Der akutstationäre Bereich werde so mit qualifizierter Reha eng verknüpft. Zusätzliche Syner­ gieeffekte ergäben sich durch die unmittelbare Nähe zum Gesundheitszentrum Rhein-Neckar. Das Gesundheitszentrum hat die BGU Ludwigshafen bereits 2010 eröffnet. Betrieben wird das OP-Zentrum von vier niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten als Praxisklinik. Es kann von der BGU selbst genauso wie von Mietern des Gesundheitszentrums oder extern Niedergelassenen genutzt werden. Dieses ambulante Angebot sichert wie andere Versorgungskooperationen des Klinikverbundes den Patienten eine Rundumversorgung, bei der es nicht knirscht. Ohne Reibungsverluste versorgen der Klinikverbund und seine Partner ihre BG-Patientinnen und -Patienten. Auch gesetzlich Krankenversicherte profitieren von den Angeboten aus einer Hand. EINS | Voneinander lernen 43 Bericht SAUBERE HÄNDE, KLARER KOPF Immer wieder sorgen Fälle von Infektionen und resistenten Erregern in Krankenhäusern für Aufsehen in den Medien. ­Dabei steigen die Zahlen seit Jahren nicht mehr. Was an den KUV-Kliniken für eine perfekte Hygiene getan wird, zeigt der folgende Bericht. Wenn es in einem Krankenhaus zu einer schweren Infektion kommt, ist Aufregung vorprogrammiert. Besonders besorgt reagiert die Öffentlichkeit, wenn Antibio­ tika nicht mehr anschlagen. Dann geht schnell das hässliche Wort von den resistenten „Krankenhauskeimen“ um – und das sogar dann, wenn der Grund der Infektion weit außerhalb des Krankenhauses liegt. Doch 20 bis 30 Prozent dieser Infektionen könnten laut Expertenmeinung vermieden werden. Grund genug, sich dieses wichtigen Themas anzunehmen. Auch die Poli­ tik hat mit der jüngst in Kraft getretenen Novelle des Infektionsschutzgesetzes reagiert. Wie erfolgreich der Kampf gegen die Krankenhausinfektionen ausgeht, hängt aber letzten Endes von den Krankenhäusern selbst ab. Der KUV kann hier auf ein breites Engagement verweisen. PRAKTISCHE UMSETZUNG Vielfach beklagen Krankenhäuser Per­ sonalmangel als Hürde bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben. Die Krankenhaushygiene des BG Universitätsklinikums Bergmannsheil Bochum hat gehandelt und 2012 ein neues Schulungskonzept eingeführt, um Pflegefachkräfte zu sogenannten Hygienebeauftragten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen weiterzubilden. Das Themenspektrum der 40-stündigen Basisschulung reicht von normativen Hygieneregeln über Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe bis zu organi­ satorischen, baulichen und technischen Anforderungen an die Krankenhaus­ hygiene. Die ersten elf Teilnehmer haben die Fortbildung Ende 2012 erfolgreich abgeschlossen. Sie unterstützen nun die hauptamtlichen Hygienefachkräfte der Klinik bei der Überwachung und Durchführung der nötigen Hygie­ nestandards, sind in ihren Teams Ansprechpartner in Hygienefragen, wirken aber auch in übergreifenden Qualitätszirkeln und Arbeitsgruppen mit, um die betrieblichen Hygienestandards weiterzuentwickeln. Noch 2013 soll es in Bochum auf jeder Station und in jedem Funktionsbereich eine pflegerische Hygienebeauftragte bzw. einen pflegerischen Hygienebeauftragten geben, die oder der nach dem neuen Curriculum geschult wurde. „Wir freuen uns, dass wir damit sehr zeitnah die neuen Anfor- derungen erfüllen“, so Pflegedirektor Peter Fels. SYSTEMATISCHE ERFASSUNG Ein Qualitätssiegel für den Umgang mit MRSA und anderen antibiotikaresistenten Erregern hat das Unfallkrankenhaus Berlin erhalten. Aber was kann ein Krankenhaus gegen diese tückischen Erreger tun, gegen die nur wenige wirksame Mittel existieren? „Das Erste ist, sich Klarheit zu verschaffen“, sagt Therese Köln, leitende Hygienefachkraft am ukb. „Risikopatienten werden bei der Aufnahme systematisch auf MRSA untersucht.“ Ein Schnelltest verschafft in anderthalb Stunden Gewissheit. Zu Risikopatienten zählen etwa solche, die in den vergangenen zwölf Monaten schon einmal in einem Krankenhaus zur Behandlung waren. Fällt der Test positiv aus, wird der Patient isoliert und einer Behandlung mit einer Nasensalbe und speziellen antiseptischen Waschungen unterzogen. Dabei ist das ukb nicht auf sich a ­ l­lein gestellt. Die Erfassung von Infek­tionen wird im sogenannten KrankenhausInfektions-Surveillance-System (KISS) 44 EINS | Voneinander lernen koordiniert, das vom Nationalen Referenzzentrum (NRZ) des Robert-Koch-Instituts betreut wird. Das System wurde bereits Ende der 90er-Jahre entwickelt. Inzwischen hat sich gezeigt, dass seit 17 Jahren die Häufigkeit nosokomialer Infektionen nicht weiter gestiegen ist, trotz zunehmender invasiver Fortschritte und einer steigenden Zahl von Risikopatienten. GEFAHR DURCH GRAMNEGATIVE ERREGER Auch die BG Unfallklinik Duisburg nimmt seit 2004 an mehreren KISS-Modulen teil. Die sogenannte Surveillance, also die Erfassung der Infektionen, ist die Basis für einen Vergleich, zum Beispiel mit anderen Kliniken oder im Zeitverlauf. „Benchmarking ist ein in der Wirtschaft etabliertes Verfahren. Der große Vorteil am KISS ist, dass es ein validiertes Verfahren ist“, so Hygienefachkraft und Gesundheitsmanagerin Ute Storm von der BGU Duisburg. Doch während die Technik Fortschritte macht und das Klinikpersonal immer weiter dazulernt, entwickeln sich auch die Gefahren weiter. Inzwischen gilt den MRSA gar nicht mehr ­unbedingt die größte Sorge. „Schlimmer ist, dass die sogenannten gram­ negativen Erreger in letzter Zeit zunehmen“, sagt Storm. „Gegen diese gibt es so gut wie gar keine wirksamen Anti- biotika mehr.“ Kliniken können gegen diese heimtückischen Erreger kaum etwas tun. „Leider treten diese Resistenzen immer wieder bei Überführungen aus Krankenhäusern aus dem Ausland auf – vor allem aus Südeuropa oder der Türkei“, so Storm. Hier stehen die Krankenhäuser am Ende einer Kette, auf die sie nur wenig Einfluss haben. „Das Grundproblem ist der Antibiotika-Missbrauch in vielen Ländern, wo sie oft schon wegen Kleinigkeiten verschrieben werden oder sogar ganz frei in der Dro­ gerie erhältlich sind“, so Storm. BRANDWUNDEN IM FOKUS Sehr viel mehr Handlungsmöglichkeiten haben Kliniken bei der Vermeidung von Infektionen in den Krankenhäusern selbst. Die BGU Duisburg hat sich hier vor allem dem Thema Brandwunden gewidmet. Brandverletzte sind besonders anfällig für Infektionen. Ein Fokus liegt auf Infektionen der Atemwege. An den Standorten Duisburg und Hamburg des Klinikverbundes werden inzwischen versuchsweise Mundhygiene-Sets ohne Wasser mit dem Wirkstoff Chlorhexidin genutzt. So sollen Infektionsrisiken durch Wasser reduziert werden. Seit 2010 koordiniert Ute Storm ein spezielles Projekt zum Benchmarking „Händehygiene ist das A und O.“ Therese Köln, leitende Hygienefachkraft am Unfallkrankenhaus Berlin der Infektionen bei Schwerbrandver­ letzten im Klinikverbund. Daraus sollen Handlungsempfehlungen abgeleitet ­werden. Denn anders als bei anderen Infektionen gibt es bei Brandwunden bislang noch keine internationalen Behandlungsstandards. Um Fortschritte zu erzielen, muss auch hier erst einmal Klarheit geschaffen werden, denn bei Brandwunden lässt sich besonders schwer sagen, ob eine Infektion die direkte Folge der Verletzung ist. ZENTRALE HÄNDEHYGIENE Die größte Wirkung gegen vermeidbare Infektionen hat, da sind sich Fachleute einig, jedoch eine ganz einfache, scheinbar banale Sache: die Händehygiene. Wohl mit nichts anderem lassen sich in Kliniken Menschenleben so einfach und mit so wenig Kosten retten, wie mit sauberen Händen. „Händehygiene ist das A und O“, sagt daher Therese Köln, leitende Hygienefachkraft am ukb. Das Per­ sonal wurde geschult und gezielt darauf angesprochen. „In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auch bei den Besuchern“, sagt Köln. Diese seien oft viel zu wenig sensibilisiert. „Hier kann man mit recht wenig Aufwand viel erreichen.“ In Krankenhäusern kommt es zu vielen Kontakten. Einen besonders stark ausgeprägten Bedarf an Hilfe­ stellungen durch das Personal haben querschnittgelähmte Patienten. Am ­Zentrum für Rückenmarkverletzte im ukb wird das Thema Hygiene darum besonders hoch gehängt. Auch dem Reinigungspersonal kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Seine Gründlichkeit ist letztlich die Voraussetzung für die Sauberkeit in der Klinik. Von der Perfektion, mit der medizinische Geräte nach einem ausgeklügelten Verfahren sterilisiert werden, ist gar nicht zu reden. Perfekte Sterilisation ist ohnehin Standard. EINS | Voneinander lernen 45 46 EINS | Voneinander lernen Bericht AUS FEHLERN LERNEN Nobody is perfect. Das galt lange Zeit überall, nur nicht für die Ärzteschaft. Inzwischen hat sich aber auch in der Medizin die Einsicht durchgesetzt, dass es ohne Fehlerkultur und Qualitätsmanagement nicht geht. „Patientensicherheit ist gerade in Zeiten gestiegenen Drucks, schneller Behandlung und höherer Standards ein zentrales Thema“, sagt Dr. Günther Jonitz, Vorsitzender der Qualitäts­ sicherungsgremien der Bundesärztekammer und Ärztekammerpräsident in Berlin. Kein Krankenhaus könne es sich leisten, nichts zu diesem Thema zu tun. „Kluge Krankenhäuser haben darüber hinaus erkannt, dass eine bessere Sicherheitskultur, also ein offener, konstruktiver und wertschätzender Umgang bei Fehlern und Beinahefehlern, Schäden und Aufwand reduziert und darüber hinaus auch andere Reibungsverluste und Organisationsmängel ausgleichen kann“, so Dr. Jonitz. KOLLEGIALES LERNEN Die Initiative Qualitätsmedizin (IQM), der alle Kliniken im KUV bereits seit 2008 als Gründungsmitglieder angehören, bewertet der Qualitätssicherungsexperte der Bundesärztekammer als eines der besten Verfahren zur Qualitätsdarlegung und Qualitätsentwicklung im Krankenhaus. „Durch die Routinedaten wird Dokumentationsaufwand reduziert und Transparenz über harte Endpunkte erzeugt“, sagt Dr. Jonitz. Die größte Bedeutung misst er aber dem Peer-Review-Verfahren bei. Es sei für den Erfolg ausschlaggebend. „Das kollegiale Gespräch vor Ort bringt unmittelbar wirksame Erkenntnisse – auch für die Peers“, so Dr. Jonitz. An manchen Stellen im IQM fehlen ihm jedoch noch aussagekräftige Qualitätsindikatoren. „Die Sterblichkeit bei Leistenbruchoperationen ist ein mäßiger Qualitätsindikator. Die Kliniken im KUV können gerade mit ihrer größeren Erfahrung Vorreiter sein“, sagt Dr. Jonitz. Er verweist auf die „Qualitätsberichterstattung durch D-Arzt und andere Berichte“. Für die Zukunft der Qualitätssicherung in Krankenhäusern fordert Dr. Jonitz mehr politische Unterstützung. „Die Politik muss zeigen, dass sie Interesse an guter Versorgung und an deren Nachweis hat. Das hat sie in der Vergangenheit explizit nicht gemacht, sogar konkret abgelehnt. Solange die Politik Geld vor Qualität setzt, ist Qualitätssicherung ein Rudern gegen den Strom. Es lohnt sich trotzdem“, so das Plädoyer von Dr. Jonitz. HUNDERTPROZENTIGE TRANSPARENZ Prof. Dr. Axel Ekkernkamp, stellvertretender Präsident der IQM und Ärztlicher Direktor des Unfallkrankenhauses Berlin (ukb) weist auf drei Vorteile des IQM-Verfahrens hin. Als größten Vorteil wertet er, dass die Ärztinnen und Ärzte keine Extradokumentationen dafür vornehmen müssen, wie das bei vielen anderen Qualitätsmanagementsystemen der Fall ist. „Der zweite Pluspunkt ist, dass die Ergebnisse hundertprozentig transparent sind“, sagt Professor Ekkernkamp. Sie sind im Internet für jedermann nachlesbar. Eine weitere Stärke von IQM sieht Professor Ekkernkamp im Peer-Review-Verfahren. Dieses Verfahren der kollegialen Fehlerkritik ist inzwischen weit über IQM hinaus etablierte Praxis. Ekkernkamp verweist darauf, dass Peer-Review-Kurse der Ärztekammern hoffnungslos überbucht sind. Weil nicht genug externe Peer Reviews angeboten werden, hat das ukb bereits zwei interne Peer Reviews vorgenommen. In der Allgemeinchirurgie und in der Neurologie wurde simuliert, dass externe Peers vor Ort sind. Dabei war auch die Pflege eingebunden. „Dieser interprofessionelle Ansatz bringt hervorragende Ergebnisse“, sagt Professor Ekkernkamp. Peer Reviews der IQM wurden 2012 unter anderem an den KUV-Standorten Bochum und Halle vorgenommen. „Solange die Politik Geld vor Qualität setzt, ist Qualitätssicherung ein Rudern gegen den Strom. Es lohnt sich trotzdem.“ Dr. Günther Jonitz, Vorsitzender der Qualitäts­ sicherungsgremien der Bundesärztekammer und ­Ä rztekammerpräsident in Berlin 48 EINS | Voneinander lernen Meldungen KUV erarbeitet spezifische Murnau entwickelt Qualitätskennzahlen eigenes Reha-Zertifikat Bad Reichenhall komplett neu zertifiziert Der KUV arbeitet auf eine spezifische ­Weiterentwicklung von Qualitätskennzahlen hin. Denn allgemeine QM-Systeme sind selten in der Lage die spezielle Fachexpertise des Klinikverbundes bei der Schwerverletztenversorgung bis in die Tiefe darzustellen. „Damit wir unsere Qualitätsführerschaft besser darstellen können, streben wir an, spezielle für den Verbund und die berufsgenossenschaft­ liche Versorgung relevante Qualitätskennzahlen zu entwickeln“, sagt Dr. Beate Schmucker, KUV-Bereichsleiterin Qualität und Prozesse. Langfristig ist zudem geplant, dass alle Kliniken des Verbundes ein einheitliches Risikomanagement einführen. Das sieht schon die Satzung des KUV vor. Die BG Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall kann ihre Qualität seit September 2012 mit einem doppelten Zertifikat belegen. Sie wurde für ihr Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008 und nach den Qualitätsgrundsätzen der DEGEMED (Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation) ausgezeichnet. Im Vormonat war bereits das Bergmannsheil Bochum erstmals nach dem international anerkannten DIN-Standard zerti­ fiziert worden. „Wir sind stolz, unseren hohen Anspruch an Qualität mit dem Zertifikat sichtbar machen zu können. Das Vertrauen unserer Patienten und der Kostenträger ist grundlegend für unsere Arbeit. Die Zertifizierung gibt ihnen nun ein klares Zeichen“, so Dr. Wolfgang Raab, Ärztlicher Direktor in Bad Reichenhall. Er verwies auch auf die Bedeutung des Qualitätsmanagements für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die interne Strukturentwicklung in der Klinik: „Das Qualitätsmanagementsystem zeigt uns alle Möglichkeiten auf, wie wir die fachliche Vernetzung unseres Teams und damit den Erfolg der Klinik auch zukünftig vorantreiben können“, so Dr. Raab. Die BG Unfallklinik Murnau hat ein eigenes Qualitätsmanagementsystem für die Rehabilitation entwickelt. Anlass dazu gab die gesetzliche Forderung nach einer Zertifizierung für Rehakliniken gemäß den Vorgaben der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR). Viele Rehakliniken setzen dabei auf das Qualitätsmanagementsystem der „Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (KTQ)“. „Das hat uns nicht gereicht“, sagt Prof. Dr. Volker Bühren. Die BGU Murnau hat sich in der Folge daran gemacht, die Qualitätsnormen der DIN ISO 9001:2008 auf den Reha-Bereich anzuwenden. Herausgekommen ist ein QM-System mit dem Titel „BGU Murnau QM Reha Version 1.1“. „Das ist deutlich prozessorientierter“, so Professor Bühren. „Alles ist maximal praxisorientiert“, ergänzt der stellvertretende Geschäftsführer Karl-Heinz Kaufmann. Reha beginne schließlich schon am Unfallort. Die Eigenkreation der BG Unfallklinik Murnau erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und ist von der BAR anerkannt. Sämtliche Prozesse wurden gründlich beschrieben. Am Ende der Entwicklung stand das Zertifikat. Es wurde im März 2012 verliehen. Das Verfahren steht nun allen interessierten Rehakliniken und Kliniken mit Reha-Abteilung in Deutschland zur Verfügung. EINS | Voneinander lernen 49 Frankfurt für Alterstraumatologie aus­gezeichnet Als dritte Klinik bundesweit ist die BG Unfallklinik Frankfurt am Main im Juni 2012 in Kooperation mit der Geriatrie des Agaplesion-Diakonissen-Krankenhauses Frankfurt nach dem neuen Auditverfahren „Kompetenz zur Steigerung von Qualität und Sicherheit in der Alterstraumatologie“ zertifiziert worden. Das Audit hat die Arbeitsgruppe Alterstrauma der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie erarbeitet und in insgesamt 16 Pilotkliniken erprobt. Die BGU Frankfurt hat für die wachsende Zahl älterer Patienten eine unfallchirurgisch-orthopädische und medizinisch-geriatrische Mit- und Weiterbehandlung unter Einbeziehung aller erforderlichen pflegerischen, ärztlichen und therapeutischen Kompetenzen implementiert, um älteren Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten. Für das Zertifikat nahmen die Auditorinnen und Auditoren unter anderem die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fach­ abteilungen, den Sozialdienst, die Versorgung mit Hilfsmitteln und die Einbeziehung der Angehörigen unter die Lupe. Besonders positiv bewerteten sie die fachlich hoch qualifizierte interdisziplinäre Behandlung und Therapie der alterstraumatologischen Patienten. Zudem wurde die Kooperation mit der Geriatrie als optimal bewertet. So finden auch nach der Verlegung in das Agaplesion regelmäßig Rücksprachen mit der Unfallchirurgie der BGU statt. „Durch bestens ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die konstruktive Zusammenarbeit mit der Geriatrie ist die BGU Frankfurt am Main für den demografischen Wandel bestens aufgestellt“, so Prof. Dr. Reinhard Hoffmann, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer der BGU Frankfurt am Main. ukb erhält neues Qualitätssiegel für vorbildliches Infektionsmanagement Mit einem neuen Qualitätssiegel des MRSA-Netzwerks Berlin für die Vorbeugung von Infektionen durch Krankenhauskeime ist das Unfallkrankenhaus Berlin (ukb) am 7. November 2012 ausgezeichnet worden. „Der Kampf gegen Krankenhauskeime gehört zu den größten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit. Die Entwicklung unseres Pilotprojekts von unverbindlicher Zertifizierung bis zur Vergabe eines standardisierten Qualitätssiegels ist dabei ein wichtiger Erfolg“, so Prof. Dr. Julia Seifert, Unfallchirurgin und leitende Oberärztin am ukb. Gemäß einer Empfehlung der Gesundheitsministerkonferenz der Länder wurden seit 2010 zahlreiche MRSA-Netzwerke auf Länderebene und darunter eingerichtet. Das lokale MRSA-Netzwerk Marzahn-Hellersdorf von Berlin hat das Siegel als Pilotprojekt der Qualitätssicherung in der Klinikhygiene entwickelt. Das ukb wurde in diesem Rahmen bereits 2011 als „Aktives Krankenhaus im Netzwerk zur Prävention nosokomialer Infektionen und Anti­biotikaresistenzen in Berlin“ ausgezeichnet. Das darauf basierende neue Qua­ litätssiegel dokumentiert die strikte Einhaltung hoher Hygienestandards. Dazu zählen unter anderem die frühzeitige Untersuchung von Risikopatienten auf MRSAKeime, das Patientenmanagement bei MRSA und das Antibiotika-Management. Auch regelmäßige Schulungs- und Präventionsmaßnahmen des Krankenhauspersonals und eine ausreichende Zahl von speziell ausgebildeten Hygienefachkräften sind gefordert. Eine kontinuierliche Datenanalyse und eine aktive Teilnahme am Austausch des MRSA-Netzwerks dürfen ebenfalls nicht fehlen. Dreifaches KTQ-Siegel in Halle Die BG Kliniken Bergmannstrost Halle haben im März 2012 bereits zum dritten Mal das Krankenhauszertifizierungsverfahren der „Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (KTQ)“ abgeschlossen, erstmals aber unter Einbeziehung des Rehabilitationsbereiches. Diese Kombination der Zertifikate können nur zehn Kliniken in Deutschland vorweisen. „Das ‚Bergmannstrost‘ hat hier einen Standard etabliert, von dem auch wir als Gesellschaft lernen können“, so die stellvertretende Vorsitzende des KTQ-Gesellschafterausschusses Marie-Luise Müller. Für die Zertifizierung hat das „Bergmannstrost“ die Bereiche Patientenorientierung, Mitarbeiterorientierung, Sicherheit, Informationswesen, Führung und Qualitätsmanagement systematisch geprüft. Besonderes Augenmerk legt der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Gunther Hofmann auf die interdisziplinäre, fach- und hierarchieübergreifende Zusammenarbeit. Aber auch das „papierlose Krankenhaus“ mit einer nahezu vollständig di­gita­ len Patientenakte und das gesellschaftliche Engagement bei der Förderung des Rehabilitations- und Behindertensports stellten weitere wesentliche Aspekte dar. Das KTQ-Verfahren ist mit einer Ausnahme seit 2005 in allen Verbundkliniken eingeführt worden. Halle wurde bereits 2006 erstmals nach KTQ zertifiziert. „Der Kampf gegen Krankenhauskeime gehört zu den größten medizinischen ­Herausforderungen unserer Zeit.“ Prof. Dr. Julia Seifert, Unfallchirurgin und leitende Oberärztin am Unfallkrankenhaus Berlin 50 EINS | Füreinander da sein BJÖRN BOGDANSKI, 30, HAFENARBEITER VERLETZUNG: MEHRFACHVERLETZUNGEN AN UNTERSCHENKEL, UNTERARM UND BECKEN BG-KLINIK: BG UNFALLKRANKENHAUS HAMBURG EINS | Füreinander da sein 51 Bildstrecke ALLES AUF ANFANG Nach einem schweren Unfall gilt: Das Leben geht weiter, aber nicht immer so wie bisher. Diese Menschen haben die Rückkehr in den Job gemeistert. Der KUV half ihnen dabei – mit Spitzenmedizin und menschlich. 52 EINS | Füreinander da sein DANIELA HALBFAS, 43, REITTHERAPEUTIN V E R L E T ZU N G : D I S TA L E ­R A D I U SF R A K T U R BG-KLINIK: BG UNFALLAMBULANZ UND REHAZENTRUM BREMEN EINS | Füreinander da sein 53 SV E N J A B O N N E B E R G, 36, A LT E N P F L EG E R I N VERLETZUNG: BÄNDERRISS AM HANDGELENK BG-KLINIK: UNFALLBEHANDLUNGSSTELLE BERLIN CHRISTIAN GERG, 42, BAGGERFAHRER VERLETZUNG: OPERATIVER FINGER­E RSATZ NACH MITTELHANDAMPUTATION BG-KLINIK: BG UNFALLKLINIK MURNAU D R. SIEGHA RD BELOW, 57, SPORTWISSENSCHAFTLER VERLETZUNG: TIBIAKOPFFRAKTUR BG-KLINIK: UNFALLKRANKENHAUS BERLIN HEIKE FRIEDRICH, 36, SELBSTS TÄ N D I G E P H YS I OT H E R A P E U T I N VERLETZUNG: UNTERSCHENKELTEILLÄHMUNG NACH KNIEVERLETZUNG BG-KLINIK: BG UNFALLKLINIK FRANKFURT AM MAIN JÖRG MOZER, 44, AUSSENDIENSTMITARBEITER MIT MASCHINENMONTAGE VERLETZUNG: MEHRFACHFRAKTUREN UND NERVENVERLETZUNGEN AN HAND, ARM UND BEIN BG-KLINIK: BG KLINIK TÜBINGEN Feature ZURÜCK IN EINEN NEUEN ALLTAG EINS | Füreinander da sein 61 40 Prozent aller Betten für Querschnittverletzte in Deutschland stehen in berufsgenossenschaftlichen Kliniken. In deren Kompetenzzentren arbeiten Exper­ tenteams Hand in Hand, um den Patienten zurück in ­einen lebenswerten Alltag zu führen. Bereits auf der ­I ntensivstation beginnt die Rehabilitation. An einem sonnigen Wintertag auf Teneriffa im Februar 2010 veränderte sich das Leben von Klaus Greif schlagartig. Der durchtrainierte Fahrradhändler aus Tübingen war auf einer beruflichen Testfahrt mit einem Mountainbike in den Bergen der Insel unterwegs. Als er an einem Hang absteigen wollte, blieb er mit dem Fuß hängen und stürzte kopfüber in eine Schlucht. „Ich hörte einen Knacks in meiner Wirbelsäule und fühlte einen elektrischen Schlag, als würde ich in eine Steck­ dose fassen“, erinnert sich der heute 59-Jährige. Als er seine Beine nicht mehr spürte, wusste Klaus Greif sofort, dass er querschnittgelähmt war. Drei endlos lange Stunden dauerte seine Bergung in dem steilen Gelände. Helfer zogen den Schwerverletzten schließlich mit einer Seilwinde den Hang hinauf und brachten ihn in ein Krankenhaus auf der Insel. Einen Tag später wurde Klaus Greif auf Drängen seiner Lebensgefährtin in die BG Klinik Tübingen geflogen. Hier begann, was er sein zweites Leben nennt, eines, für das er „unglaublich dankbar“ ist – dankbar für das, was er menschlich nach seinem Unfall erlebte, dankbar vor allem aber auch für die exzellente Versorgung und Therapie in ­Tübingen. Sie hat ihn Schritt für Schritt in den Alltag und seinen Beruf zurückgeführt. Selbstmitleid ist nicht seine Art. „Ich habe Glück gehabt“, sagt er stattdessen: „Ich kann meine Arme noch bewegen.“ Modernste Behandlungsmethoden Klaus Greif ist einer von rund 2.000 Menschen, die jährlich in Deutschland eine Querschnittlähmung erleiden. 40 Prozent der 1.263 Betten, die es hierzulande für die Behandlung von Querschnittverletzten gibt, stehen im Klinikverbund. Die Häuser des Verbundes sind damit Spitzenreiter bei der medizinischen Versorgung und Reintegration von Unfallverletzten. 62 EINS | Füreinander da sein In spezialisierten Behandlungszentren versorgen interdiszi­ plinäre Expertenteams Patienten, die durch Unfälle, aber auch Tumore, angeborene Fehlbildungen oder Entzündungen eine Querschnittlähmung erlitten haben. Viele der dort eingesetzten Techniken, Geräte und Materialien sind Innovationen, die in den Häusern selbst erforscht und entwickelt wurden. Allein das Querschnittgelähmten-Zentrum am BG Unfallkrankenhaus Hamburg (BUKH) behandelt jährlich rund 200 neue Patientinnen und Patienten und damit etwa zehn Prozent der in Deutschland jedes Jahr eintretenden Querschnittlähmungen. Das Hamburger Zentrum ist eine Modelleinrichtung der Berufsgenossenschaften und mit seinen 121 Betten nicht nur im Klinikverbund, sondern unter allen deutschen Kliniken das größte. Der Klinikverbund hat den Bereich der Wirbelsäulenchirurgie in den vergangenen Jahren ständig ausgebaut. Dabei wurde das Spektrum der konservativen und chirurgischen Behandlungsverfahren kontinuierlich erweitert, zum Beispiel in der Stabilisierung von Wirbelbrüchen. Von Kunden und Bekannten wusste Klaus Greif, dass die BG Klinik Tübingen eine exzellente Adresse für die Versorgung und Betreuung Querschnittgelähmter ist. Er empfand daher eine „unglaubliche Erleichterung“, als er 30 Stunden nach seinem Unfall dort ankam, und wusste sich in den besten Händen. „Ab dem Moment habe ich mich entspannt.“ Zunächst wurde seine Wirbelsäule chirurgisch stabilisiert. Dann begann gleich nach der Operation die Rehabilitation – ein Ansatz, der den Klinikverbund auszeichnet. EINS | Füreinander da sein 63 Bereits auf der Intensivstation arbeiten Physiotherapeuten mit dem frisch verletzten Patienten. Dabei richtet sich die ­Behandlung an den Verletzungen und dem Alter der Betrof­ fenen aus. „Unser oberstes Ziel ist es, jede Patientin und jeden Patienten so selbstständig wie möglich zu machen“, sagt Privatdozent Dr. Andreas Badke, der in der Tübinger ­Klinik den Bereich Wirbelsäulenchirurgie leitet. Wenn möglich sollen die Rückenmarkverletzten zurück in ihre gewohnte Umgebung und in den Arbeitsalltag. Angehörige einbeziehen Anfangs stehen die Betroffenen vor der großen Herausfor­ derung, die mit der Verletzung einhergehenden enormen Einschränkungen zu akzeptieren. „Für viele Patienten ist es allerdings schwieriger, damit klarzukommen, dass sie Blase und Darm nicht kontrollieren können, als dass sie nicht mehr laufen können“, sagt Patrick Mayer, psychologischer Psychotherapeut am Unfallkrankenhaus Berlin (ukb). In ­diesen Zeiten sind Psychologen und Seelsorger Ansprechpartner. Ihre Arbeit ist in den berufsgenossenschaftlichen Kli­ niken fest in das stationäre Behandlungskonzept integriert. In einer ersten Phase kurz nach der Diagnose schützt häufig eine Art emotionaler Airbag vor einem psychischen Zusammenbruch. „Viele Patienten setzen plötzlich unglaub­ liche Kräfte frei“, hat Patrick Mayer beobachtet. Es sind eher die Angehörigen, die in dieser Phase überfordert sind und Stresssymptome zeigen. Daher werden Angehörige von Beginn an in die Therapie einbezogen. „Vor ihnen liegt ein ­Marathonlauf und wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht ihre gesamte Kraft in die ersten Kilometer investieren“, er­ läutert der Psychotherapeut. Das Berliner Behandlungszen­ trum für Rückenmarkverletzte veranstaltet regelmäßig ­Seminare für Patienten und Angehörige, in denen sie Informationen und Unterstützung im Umgang mit der neuen ­Situation erhalten. Ziel ist es körperliche, seelische und soziale Komplikationen, die ihre Krankheit oder Verletzung mit sich bringt, zu vermeiden oder zu minimieren. Mobiler als je zuvor Eine Heilung ihrer Krankheit ist jedoch derzeit nicht in Sicht. Zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten an dem Ziel, einen Rückenmarkdefekt zu über­ brücken und dem Patienten die Lähmung zu ersparen. „Hierzu gibt es interessante Ansätze, der große Durchbruch im ­Sinne einer Reparatur des Rückenmarkschadens ist jedoch noch nicht geglückt“, sagt Prof. Dr. Christian Jürgens, Ärzt­ licher Direktor des BG Unfallkrankenhauses Hamburg. Zumindest hat sich die Lebensqualität Querschnitt­ gelähmter in den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert: „In der Rehabilitation und den Möglichkeiten der Wieder­ eingliederung haben wir große Fortschritte erzielt“, betont der Tübinger Arzt Badke. Das Training motorischer Funk­ tionen macht den Patienten heute erheblich mobiler als früher, zudem sind elektronische Hilfen und Assistenzsysteme weiterentwickelt worden und im Alltag unentbehrlich. Hand in Hand arbeiten Ärzte, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, Sozialarbeiter, Psychotherapeuten, Seelsorger, Sporttherapeuten sowie Krankenschwestern und -pfleger an dem jeweiligen Therapieziel. Sie alle sind speziell für die Behandlung und Betreuung Querschnittgelähmter ­ausgebildet. In der Physiotherapie werden Muskelkräftigungen, Körperkontrolle und Bewegungsübergänge erarbeitet. In der Ergotherapie steht das Alltagstraining im Vordergrund: Fähigkeiten, die verloren gegangen sind, werden durch neue ersetzt. Im Rahmen eines Rollstuhltrainings wird der Patient beispielsweise auf die Hürden des Alltags vorbereitet. Außerhalb der Klinik sind Straßen und Wege nicht so glatt und bar­ rierefrei wie die Krankenhausflure. Klaus Greif erinnert sich: „Die ersten Wochen in der realen Welt waren wirklich hart.“ „Man muss Geduld haben.“ Doch Schritt für Schritt arbeitete sich der Fahrradhändler in den Alltag zurück. Am Anfang konnte er nicht aufrecht im Rollstuhl sitzen und hatte ständig Angst nach vorn zu fallen. Mit intensiver und dauerhafter Physio- und Ergotherapie schaffte er es schließlich, seinen Rollstuhl zu beherrschen. „Man muss Geduld haben“, sagt Klaus Greif. Auch sein Optimismus und sein Wille halfen bei den sichtbaren Fortschritten. Den Tübinger spornte es an, zu sehen, dass andere Patienten mit ähnlichen Verletzungen nach einigen Monaten Dinge tun konnten, von denen er kurz nach seinem Unfall noch weit entfernt war. Das kann ich bald auch – war sein Motto. Und tatsächlich fuhr er in seinem Rollstuhl schon bald durch den Klinikpark. Klaus Greif half es in dieser Zeit, dass er offen war und auf die Kom­petenzen des Teams vertraute. „Ich wusste, das sind Experten, die ihr Bestes für mich tun.“ In allen Kliniken ist das Sportprogramm ein wichtiger Baustein der Therapie (siehe Beitrag Seite 66). Auch die Vorbereitung auf den neuen Alltag nach der Klinik nimmt viel Raum ein. Wer will, kann noch während der Reha-Phase das Autofahren in speziell umgebauten Fahrzeugen lernen. Der Sozialdienst berät den Patienten hinsichtlich der häuslichen Versorgung und meist notwendiger Umbaumaßnahmen, beispielsweise in Küche und Bad. Fünf Monate nach seinem Unfall, im Sommer 2010, konnte Klaus Greif die Klinik verlassen. Er kehrte nicht nur in seine Wohnung, sondern auch in seine berufliche Selbstständigkeit zurück: in sein Fahrradfachgeschäft „Rad & Tat“, mit dem er sich vor dem Unfall einen guten Namen in der Radszene und ein gutes Einkommen gesichert hatte. Dort arbeitet er an drei Tagen pro Woche im Verkauf und gelegentlich auch in der Werkstatt. 64 EINS | Füreinander da sein Neues Leben im alten Job Heute ist Klaus Greif mit seinem „neuen Leben“ sehr zufrieden und steht damit repräsentativ für die Mehrheit: Rund 70 Prozent der Menschen mit einer Querschnittlähmung stufen ihre Lebensqualität als gut bis sehr gut ein. Klaus Greif genießt den Kontakt zu seinen „tollen Kunden“ und deren positive Rückmeldung. Im Geschäft und in der Werkstatt hilft ihm ein hydraulischer Rollstuhl, Material und Ware aus Regalen zu erreichen und mit Kunden quasi auf Augenhöhe zu kommunizieren. Statt früher 60 Stunden arbeitet er nun 35 Stunden in der Woche. Genau richtig, findet Klaus Greif, seine Arbeit sei seine beste Ablenkung und Therapie. Nicht nur die Versorgung in den berufsgenossenschaft­ lichen Kliniken ist anerkannt exzellent, auch die weitere Rehabilitation setzt alles daran, den Patienten möglichst vollständig in einen Arbeitsalltag zurückzuführen – durch umfassende Therapien, aber auch durch finanzielle Hilfe beim Umbau von Arbeitsplatz und Wohnung. 300 Meter von seinem Geschäft entfernt hat sich Klaus Greif vor zwei Jahren gemeinsam mit seiner Partnerin eine behindertengerechte Wohnung gekauft und sie seinen Bedürfnissen entsprechend ausgestattet. Klinik bleibt Ansprechpartnerin Nach wie vor kommt der Tübinger zweimal in der Woche zur Physiotherapie in seine Klinik. Die Ärztinnen und Ärzte dort bleiben für ihn Ansprechpartner in allen medizinischen Fragen. Querschnittgelähmte Patienten benötigen eine lebenslange Nachsorge. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen sichern ihre Lebensqualität und helfen, Komplikationen frühzeitig zu begegnen. Zum Beispiel leiden viele durch das ununterbrochene Sitzen unter Druckstellen (Dekubitus), die je nach Ausprägung plastisch-chirurgisch behandelt werden müssen. ­Hinzu kommen Blasenfunktionsstörungen und ein erhöhtes Risiko einer Gallenblasenentzündung oder einer Versteifung von Gelenken. Chirurgische Eingriffe lindern etliche Symptome, verhindern können sie sie bislang nicht. „Es existieren heute bessere Möglichkeiten zur Vermeidung oder Beherrschung typischer Komplikationen als früher. Die Lebenserwartung der ­Betroffenen steigt und trotz zweifellos vorhandener Mängel verbessern sich die Chancen auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“, sagt Dr. Roland Thietje, Chefarzt des Querschnittgelähmten-Zentrums am Hamburger Unfallkrankenhaus. Klaus Greif ist zurück im Leben, wenn auch in einem anderen als zuvor. Der anpackende Tübinger empfindet den neuen Abschnitt als ein großes Geschenk, eine Art Zugabe nach 56 gesunden Jahren. Früher lief er Marathonstrecken, heute begleitet Klaus Greif manchmal seine Lebensgefährtin, wenn sie Rennrad fährt, auf seinem umgebauten Rollstuhl mit Handantrieb und 27 Gängen. Ein elektrischer Zusatzantrieb kann die Leistung seiner Handkurbel um das bis zu Vierfache verstärken. Damit schafft er bis zu 90 Kilometer am Tag. Klaus Greif hat sich von seinem Unfall nicht aus der Bahn werfen lassen. Er ist überzeugt:„Dass es mir heute so gut geht, habe ich zu ­einem guten Teil der Tübinger Klinik zu verdanken.“ „ICH WUSSTE, DAS SIND EXPERTEN, DIE IHR BESTES FÜR MICH TUN.“ Klaus Greif, Patient der BG Klinik Tübingen 66 EINS | Füreinander da sein Bericht ERSTE LIGA Ob Fußballprofi oder Patient in der Rehabilitation: Wer F ­ achkräfte für Sportmedizin und -therapie aus der ersten Liga sucht, ist in den berufsgenossenschaftlichen Kliniken richtig. Ein wichtiger Wettkampf naht. Plötzlich meldet sich stechender Schmerz im Knie. In Momenten wie diesen schrillen bei Profisportlern und ihren Trainern die Alarmglocken. Jetzt kann eine exzellente medizinische Betreuung karriereentscheidend sein. Die sportmedizinischen Zentren der berufsgenossenschaftlichen Kliniken genießen das Vertrauen vieler bekannter Leistungssportlerinnen und -sportler im In- und Ausland und sind deren feste medizinische Partner. Dabei ist die Expertise der Mediziner und Therapeuten nicht nur im Verletzungsfall und bei Komplikationen gefragt, sondern auch im sportlichen Alltag der Athletinnen und Athleten. Die Teams in den Kliniken unterstützen und begleiten Profisportler häufig über viele Jahre. Auch mit professioneller Leistungsdiagnostik helfen sie, sportliche Spitzenleistungen zu erbringen. SPITZENMEDIZIN FÜR SPITZENSPORTLER In der Hauptstadt ist das Unfallkrankenhaus Berlin offizieller Partner des Olympiastützpunktes Berlin und zahlreicher prominenter Profisportlerinnen und -sportler. Die Mannschaft des Fußball-Erstligisten Hannover 96 wird von Ärztinnen und Ärzten des BG Unfallkrankenhauses Hamburg betreut. In Duisburg steht das „Zentrum für Sportmedizin und Sporttraumatologie“ der dortigen BG-Unfallklinik den Fußballern des MSV Duisburg zur Seite. Und die BG Unfallklinik Frankfurt am Main unterstützt während der Rollstuhlbasketball-EM 2013 in ihrer Stadt die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler mit Rat und Tat. Auch auf wissenschaftlicher Ebene spielen die Kliniken ganz oben mit. Bereits zum neunten Mal veranstaltete das Unfallkrankenhaus Berlin 2012 gemeinsam mit der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft das Symposium Hochleistungssport. Die BG Unfallklinik EINS | Füreinander da sein 67 Frankfurt am Main wiederum richtet regelmäßig das „Sportmedizinische Forum“ aus. Die Veranstaltungen haben sich zum Muss für Sportmediziner und zum renommierten Treffpunkt für Vereinsverantwortliche und Mediziner entwickelt. SPORTTHERAPIE HILFT BEI DER REHA Die positive Kraft der Bewegung nutzen die berufsgenossenschaftlichen Kliniken im Rahmen der Sporttherapie seit vielen Jahren. In angegliederten Sporthallen und Einrichtungen können Patientinnen und Patienten im Rahmen der Rehabilitation gemeinsam mit anderen wiedererlernte Fähigkeiten spielerisch testen. „Sport unterstützt den Rehabilitationsprozess entscheidend. Er motiviert die Betroffenen nicht nur im Sport selbst, sondern auch im Leben allgemein”, unterstreicht der Ärztliche Direktor der BG Unfallklinik Frankfurt am Main, Prof. Dr. Reinhard Hoffmann. Die Verfahren und Methoden der Sporttherapie im Klinikverbund genießen weltweit hohe Anerkennung. Viele Häuser haben enge Verbindungen zu Interessenverbänden und Sportvereinen. So hat beispielsweise der Deutsche Rollstuhl-Sportverband (DRS) seinen Sitz im BG Unfallkrankenhaus Hamburg. Gemeinsam führen beide Einrichtungen das Projekt „Rollstuhlsport macht Schule“ durch, bei dem Schüler und Lehrer für Rollstuhlsport und Inklusion im Sportunterricht sensibilisiert werden. BEHINDERTE SPORTLER SIND VORBILDER Welche große Bedeutung Sport für Menschen mit Behinderungen gewinnen kann, belegen auf eindrucksvolle Weise drei Goldmedaillengewinnerinnen, die zugleich im Klinikverbund tätig sind: Kirsten Bruhn, Edina Müller und Ilke W ­ yludda. Die Hallenserin Ilke Wyludda hatte bereits 1996 bei den Olympischen Spielen von Atlanta Gold im Diskuswerfen gewonnen und ihre Profikarriere seit zehn Jahren beendet, als ihr 2010 das rechte Bein über dem Knie amputiert werden musste. Sie erhielt 2011 ihre Approbation als Ärztin und arbeitet seitdem in den Berufsgenossenschaftlichen Kliniken Bergmannstrost Halle. Daneben kämpfte sie sich mit Ausdauer und Willenskraft in den Spitzensport zurück. Der Lohn: ein fünfter Platz im Kugelstoßen bei den Paralympischen Spielen 2012 in London. Für die querschnittgelähmte Schwimmerin Kirsten Bruhn eröffnete der professionelle Behindertensport nach einem Motorradunfall eine neue Lebensperspektive. Sie krönte in London ihre erfolgreiche Karriere mit einer Goldmedaille. Seit 2013 unterstützt sie die Pressestelle des Unfallkrankenhauses Berlin. „Ich habe gelernt, mich nicht über meine Behinderung zu definieren, sondern über das, was ich zu leisten imstande bin“, resümiert die Spitzensportlerin. Das Kinopublikum kennt die Schwimmerin durch den Film „Gold – du kannst mehr, als du denkst“, der Kirsten Bruhns Weg zum Olympiasieg einfühlsam nachzeichnet. In Hamburg inspiriert die Rollstuhlbasketballerin und Goldmedaillengewinnerin Edina Müller die Stadt und die Patientinnen und Patienten des BG Unfallkrankenhauses Hamburg gleichermaßen. Edina Müller arbeitet in der Klinik als Trainerin in der Sporttherapie und ist dort ein wichtiges Vorbild, wie Dr. Roland Thietje, Chefarzt des Querschnittgelähmten-Zentrums betont: „Sie zeigt unseren Patienten, dass es nach einem schweren Schicksalsschlag weitergehen kann, dass es lohnt zu kämpfen.“ Zugleich zeigen Bruhn, Müller und Wyludda, dass sie sich im Klinikverbund gut aufgehoben fühlen – als Mitarbeiterinnen ebenso wie zuvor als Patientinnen. 68 EINS | Zahlen und Fakten/Impressum Zahlen und Fakten Die Nachfrage nach dem Versorgungsangebot der BG-Kliniken nimmt stetig zu. Weitere Leistungszahlen des Klinikverbundes auf einen Blick: 101.177.978 91.920 Euro wurden 2012 in Bauprojekte, Forschung, Medizintechnik und Ausstattung ­investiert. stationäre und 16.012 ambulante Ope­rationen wurden 2012 in den Kliniken des KUV durchgeführt. 4.507 87% Planbetten wurden im Jahr 2012 in den BG-Kliniken vorgehalten. von 2.200 befragten Patienten würden ihre BG-Klinik weiterempfehlen. Impressum HERAUSGEBER REDAKTION Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (KUV) Friedrichstraße 152 10117 Berlin Hubert Beyerle, Dr. Petra Krimphove, Angela Mißlbeck, ­Susanne Werner KOORDINATION UND REDAKTIONELLE VERANTWORTUNG Alle Fotos Jan Pauls, außer Seite 66 und 67: Andreas Joneck, Peter Lindoerfer und Ralf Kuckuck Eike Jeske FOTOGRAFIE KONZEPTION UND GESTALTUNG DRUCK BÜRO WEISS Königsdruck Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (KUV) Friedrichstraße 152 10117 Berlin Telefon:030 330960-200 Telefax:030 330960-222 [email protected] www.k-uv.de