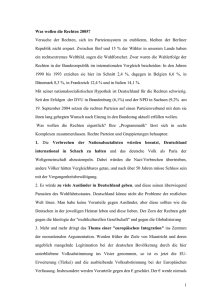Die klassische Kriminalprävention der Jugendhilfe
Werbung

IV TEIL C: JUGENDHILFE UND DIE ENTWICKLUNGSDYNAMIKEN FELD KRIMINALITÄTSKONTROLLE IM ‚Ich kann dir nur sagen Friederike, sei vorsichtig und denke daran, was alles vorkommt. Erst gestern stand wieder was drin’. ‚Ich weiß ja, gnäd´ge Frau. Aber man is ja doch auch kein Kind mehr’. ‚Und wenn es klingelt, mache nicht gleich auf und schiebe dir lieber erst eine Fußbank ran, dass du durchs Oberfenster sehen kannst wer eigentlich draußen ist […]’. ‚Ja gnäd’ge Frau’. ‚Und wenn du aufmachst, immer noch eine Kette vor und immer bloß durch die Ritze […] Neulich ist erst wieder eine Witwe totgemacht worden, und wenn du gleich alles aufreißt, kann es dir auch passieren, oder sie streuen dir Schnupftabak in die Augen, oder sie haben einen Knebel, und du kannst nicht mal schreien. Und dann rauben sie alles aus […]’ (Theodor Fontane ‚Die Poggenpuhls’ 1894)1. 1 zit. nach Legnaro et al 2001: 18 373 IV. 1 ‚(NO) MORE OF THE SAME’ – VERSCHIEBUNGEN IM PRÄVENTIONSDISKURS Das wesentliche Merkmal der Kontrolle und Sanktion von Abweichung im keynesianischen Wohlfahrtsstaat besteht darin, dass die Logiken und Rationalitäten des Sozialen auch das Feld der Kriminalitätskontrolle durchdringen. Kriminalität bzw. Devianz in einem allgemeineren Sinne werden im Kern als Ausdruck eines zugrundeliegenden Problems betrachtet: der ‚positional-dispositionalen Matrix’ - in der der Akteur zu verorten ist - und deren ‚Abstand’ von der fordistischen Normalität. Die Bearbeitung dieser Matrix geschieht im Feld der Kriminalitätskontrolle zwar zwangsförmig, folgt aber auf der Ebene der Technologien und Rationalitäten im Wesentlichen jenen Logiken, die auch für das Feld des Sozialen konstitutiv sind. Das Feld der Kriminalitätskontrolle im sozialen Interventionsstaat des keynesanischen Fordismus lässt sich insgesamt als ein ‚Straf-Wohlfahrtskomplex’ beschreiben. Vor dem Hintergrund ihrer, durch diesen Verweisungszusammenhang markierten, relativen Abhängigkeit, können die Rationalitäten und Praxisökonomien im Feld der Kriminalitätskontrolle von den Verschiebungen im Feld des Sozialen und den Modulationen der politischen Rationalitäten des sozialen Staates nicht unberührt bleiben: Die Verschiebungen im Feld der Kriminalitätskontrolle lassen sich im Kontext der selben gesellschaftlichen und politischen ‚Hintergrundsgrammatiken’ (vgl. Veyne 1992) analysieren, in die auch das Feld des Sozialen eingebettet ist. Im fortgeschritten liberalen Feld der Kriminalitätskontrolle, so die These, finden sich sehr analoge Verschiebungen zu denen im Feld des Sozialen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf Prozesse einer ‚Ökonomisierung’ und einen Aufstieg des Managerialismus, eine Fokussierung lokaler Gemeinschaften und vor allem in Hinblick auf die ‚Repräsentation’ bzw. die ‚Subjektivierung’ der ‚kontrollunterworfenen’ Akteure selbst. Einige der zentralen Verschiebungen und Umstrukturierungen im Feld der Kriminalitätskontrolle lassen sich anschaulich anhand einer Informationsschrift mit dem Titel ‚Jugend und Polizei gemeinsam gegen Kriminalität’ illustrieren, die die Landeskriminalämter Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (2000: 4 f) an den Schulen ihrer Länder verteilen. „Warum“, wird dort gefragt „brechen manche Kinder und Jugendliche das Gesetz?“. Diese Gretchenfrage des Krimsinalitäts-Präventionskomplexes, wird wie folgt beantwortet: „Es gibt da z.B. die tiefen Ursachen der Kriminalität, die in der Person des Täters oder in seinem Umfeld liegen. Kriminalität kann aber auch durch die konkrete Situation, durch Tatgelegenheiten, begünstigt werden, oder auch dadurch, dass es die Gesellschaft nicht schafft, bereits überführte Täter wieder auf den rechten Weg zu bringen. […] Wusstet ihr eigentlich, dass …? […] jeder Mensch die Chance hat, ein Leben zu führen, bei dem er nicht mit den Strafgesetzen in Konflikt kommt […] die Polizei in den meisten Fällen Kriminalitätsursachen nicht beheben kann und deshalb Kriminalitätsvorbeugung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, bei der das Engagement jedes einzelnen Menschen gebraucht wird Kriminalitätsursachen am besten dort bekämpft werden können, wo sie entstehen und dass es in vielen Gemeinden bereits kommunale Präventionsräte gibt […] ihr es selbst in der Hand habt, ob ihr kriminell werdet oder nicht“. Im Vergleich zur keynesianisch-fordistischen Logik der Kriminalitätskontrolle, werden in diesen, auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär klingenden, Ausführungen, zahlreiche Aspekte ausgeführt, die eine deutlich andere Konnotation aufweisen, als die Begründungen und impliziten 374 Ursachenzuschreibungen, die für die im Fordismus dominanten ‚normierend normalisierenden’ Präventionslogiken typisch sind. Dies impliziert zwar nicht, dass die bisherigen Begründungen und Strategien der Prävention als Ganze obsolet wären - sie bleiben in einigen gesellschaftlichen Bereichen, vor allem in jenen, die noch ausgeprägte Züge des fordistischen Wohlfahrtsstaates aufweisen, sogar dominant - allerdings rücken ihnen neue Strategien an die Seite und teilweise auch an ihre Stelle. Das Feld der Kriminalitätskontrolle befindet sich, vergleichbar mit dem Feld des Sozialen, in einem strukturellen Wandlungsprozess, der durch eine Vielzahl fragmentierter, teils konvergenter, teils widersprüchlicher Ungleichzeitigkeiten gekennzeichnet ist. Wenn man, wie es etwa Bourdieus Trias von Habitus Felder und Praxis nahe legt, davon ausgehen muss, dass sich auch die Praktiken sozialer Ordnungsformation, Regulation, Regierung bzw. der Gouvernementalität nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen auf dieselbe Weise entwickeln und wirksam werden (können), so ist jeder Versuch die Vielgestallt und Innovationen im Feld der Kriminalitätskontrolle flächendeckend abzubilden von Beginn an zum Scheitern verurteilt (vgl. Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalprävention 2000: 5). Nichtsdestoweniger lassen sich zentrale Entwicklungslinien und logiken rekonstruieren. Obwohl die Rationalitäten und praxisökonomischen Regelmäßigkeiten der beiden Felder relativ autonom, nicht auseinander deduzierbar und schon gar nicht aufeinander reduzierbar sind, finden deutliche Analogien und Strukturgleichheiten in den jüngeren Entwicklungen innerhalb der Felder des Sozialen und der Kriminalitätskontrolle, die jedoch von widersprüchlichen Entwicklungen in der Beziehung zwischen beiden Feldern begleitet werden. Während in einigen Bereichen der Kriminalitätskontrolle die Logiken des Sozialen zurückgedrängt, die Gestaltungsmacht seiner institutionellen Vertreter eskamotiert und die Grenze zwischen beiden Feldern in einigen Kontexten etwa dort, wo anti-sozialstaatliche, resozialisierungsfeindliche, polizeifixierte und abschreckungsgerichtete Strategien in den Vordergrund rücken (vgl. Sack 1995: 34) - deutlich rigider gezogen werden als bisher, findet sich zeitgleich eine Art ‚komplementäre Konkurrenz‘ (vgl. Lindenberg/Schmidt-Semisch 2000) zwischen den jeweiligen Ansätzen, sowie eine übergreifende Entwicklung ‚neo-sozialer’ Strategien der Risiko-Governance, in der die Grenzen beider Felder bis zur Unkenntlichkeit verschwimmen2 (dazu bereits Cohen 1985). Die Gleichzeitigkeit in der diese Entwicklungen stattfinden macht es erforderlich, auf die Annahme zu verzichten, dass „lediglich eine kohärente […] Ideologie durch eine andere ersetzt wird“ (Harris/Kirk 2000: 112). Die Feststellung von Bewegungstendenzen und Verschiebungen der Feldlogiken und Diskurskonstellationen impliziert nicht, dass andere, vorgängige Muster und Rationalitäten völlig verschwunden Relativierungen, wären, sondern verweist Revitalisierungen, auf Gewichtsverlagerungen, Überlappungen, Ziel- und Balanceverschiebungen, Rationalitätsmodulierungen etc. bekannter, wiederentdeckter, ‚umbenannter’ und neuer Strategien, die – so widersprüchlich sie im Insbesondere das letztgenannte Moment wird von Akteuren aus beiden Feldern mit einiger Regelmäßigkeit – je nach Perspektive – als ‚Kriminalisierung der Sozialpolitik’ oder als ‚Resozialisierung der Kriminalpolitik’ beschrieben, kritisiert, gefordert etc. 2 375 einzelnen auch sind - in ihrer Gesamtheit die Felder und Subfelder der Kriminalitätskontrolle wie des Sozialen strukturieren. Das Feld der Kriminalitätskontrolle kann, in Anlehnung an Bourdieu, als ein dynamisches Kräfte- und Kampffeld betrachtet werden, in dem die unterschiedlichen ökonomischen, sozialen und kulturellen Interessen von öffentlichen und privaten Gruppen, Institutionen und Professionen vertreten, vermarktet, bekämpft oder in ‚ressortübergreifenden’ Bündnissen zusammengeführt werden. Dies kann im Ergebnis, je nach Feld oder Teilfeld, nicht nur zu widersprüchlichen Zielen, sondern auch zu diversen Kontrollstilen führen, die sich in unterschiedlichem Maße als eher punitiv, entschädigend, befriedend oder therapeutisch beschrieben lassen (vgl. Cohen 1993). Die zeitgleich rekonstruierbaren, präventiven Strategien reichen dabei von Integrationsbemühungen bis zur Vertreibung, vom Sanktionsverzicht bis zu atavistischen Strafformen, von der Stärkung der ‚Zivilgesellschaft’ und der Mobilisierung ihrer informellen Konfliktlösungspotentiale bis zu einer ‚Wiederkehr des Leviathan’ (Hansen 1999) in einem ‚post-sozialen Sicherheitsstaat’ (Fitzpatrick 2001). Die Diversität und immanente Widersprüchlichkeit findet sich dabei nicht nur im Sinne einer - seit der ‚Geburt’ der Kriminologie bestehenden (vgl. Downes/Rock 1998) - Pluralität verschiedener Ansätze. Auch innerhalb eines Ansatzes, Konzepts oder Programms und selbst innerhalb von derselben wissenschaftlichen Abhandlung, finden sich - häufig mit nur wenigen Zeilen Abstand widersprüchliche Erklärungsmuster sowie ‚Subjektrepräsentationen’, in denen der ,homo oeconomicus’, der ‚psycho-sozial deprivierte’, der ‚verantwortungslose’, der ‚anders-’ oder der schlicht ‚bösartige’ Akteur, wie es Henner Hess (2001a) formuliert, „vergnügt miteinander kopulieren“. Diese widersprüchlichen Gleichzeitigkeiten verbieten es, eine durchgängige Logik der Kontrollstrategien in fortgeschritten liberalen Gesellschaften zu unterstellen (vgl. Cohen 1994, Groenemeyer 2002, O’ Malley 1999, Sparks/Leacock 2002). Es kann eher davon ausgegangen werden, dass je nach Feld, Feldstruktur, Verteilung der Gruppen und Stand der Kräfteverhältnisse in diesen Feldern die eine oder andere Strategie, Technik und Zielsetzung einflussreicher ist bzw. über eine Art konjunkturelle Vorrangstellung verfügt. In der Gesamtbetrachtung lässt sich jedoch nichtsdestoweniger davon sprechen, dass eine der zentralen Bewegungen und Verschiebungen im Feld sozialer Kontrolle in fortgeschritten liberalen Gesellschaftsformationen - analog zu den Entwicklungen im Feld des Sozialen – die Erprobung von Strategien ist, die sich im Gegensatz zu den klassischen sozialdisziplinierenden Präventionsstrategien von Versuchen der direkten Formung des Individuums verabschieden und versuchen, es als rationalen und eigenverantwortlichen Unternehmer seiner selbst zu reformulieren. Diese Kontrollrationalitäten zielen nicht mehr nur auf die Erzeugung eines die verallgemeinerten Ideale und Normalitätszumutungen verinnerlichenden und gleichzeitig selbstidentischen ‚Individuums’, sondern viel stärker auf die situative (Kontext)Steuerung (vgl. Wilke 1992) eines flexiblen (vgl. Sennett 1998), kontextsensiblen ‚Dividuums’ (vgl. Deleuze 1993), das sich „über aktive Selbstkontrolle durch Einsicht im Angesicht der aufgewiesenen Konsequenzen“ (Krasmann 2000: 306), rational kalkulierend und um sein Eigenwohl bemüht, gegenüber den unterschiedlichen Normen, Regeln und Regelmäßigkeiten der 376 je relativ eigenlogisch herrschenden Praxen einzelner gesellschaftlicher Felder verhält, bzw. verhalten (können) muss. Um die je unterschiedlichen Kontrollziele zu gewährleisten, findet sich eine zunehmende Subversion der in der fordistischen Phase des Kapitalismus dominanten Formen einer bürokratischen Überwachung und Erzeugung einer individuellen Bringschuld für die rechts- und sozialstaatlich garantierte soziale Teilhabe zugunsten von Kontrollstilen, die auf die Motivation und Befähigung zur Teilnahme in Lebens-, Praxis- und Sinnzusammenhänge gerichtet sind, die einerseits mit Marktanforderungen konfrontiert und nach ökonomischen Mustern restrukturiert und andererseits kleinräumig-partikulargemeinschaftlich gestaltet werden. Pointiert formuliert besteht ein zentrales Moment der Umstrukturierung des Feldes der Kriminalitätskontrolle darin, dass einer bürokratischen ‚Kolonialisierung von Lebenswelten’ eine Kolonialisierung des Einzelnen durch partikular-gemeinschaftliche Anforderungen seines lebensweltlichen Nahraums an die Seite tritt und dem ‚modernen’ Versuch der Erzeugung eines ‚homo sociologicus’ (Dahrendorf 1974) seine ‚Re-Subjektivierung’ als sozial, moralisch und ökonomisch selbstverantwortlicher rationaler Akteur. Damit verliert die seit Ende des Absolutismus in unterschiedlichen Formen immer feingliedriger gewordene Strategie der ‚Disziplinierung’, verstanden als der Versuch der Formung des Inneren eines ‚Subjekts’, seine vor allem auf dem Höhepunkt der fordistischen Phase des Kapitalismus kaum hinterfragte Dominanz gegenüber den unterschiedlichsten Formen der Exklusionsverwaltung (vgl. Steinert/Cremer-Schäfer 2000, Schaarschuch 1998) sowie der Regulation, des Managements (vgl. Scheerer 1997) und der Gestaltung von sozialen, ökonomischen und räumlichen Arrangements (vgl. Smandych 1999). IV. 1.1 VOM AUFSTIEG UND FALL DES PROFESSIONELLEN PARADIGMAS In ganz Europa werden Kriminalität und soziale Kontrolle etwa ab Mitte der 1970er Jahren zunehmend ‚polititisiert’ (vgl. Tham 2000, Garland 2001), d.h. die Frage des richtigen Umgangs bzw. der sinnvollen Bekämpfung von Kriminalität wird zu einem aktuellen Politikfeld und zu einer Frage der öffentlichen politischen Meinung (vgl. Kerner/Weitekamp 1997: 486). Diese Politisierung stellt einen bedeutenden Einschnitt in die praxisökonomischen Logiken des Feldes der Kriminalitätskontrolle seit der Nachkriegsphase dar. Insbesondere in der Hochphase des keynesianischen Wohlfahrtsstaates werden Abweichler in erster Linie als erziehungs- besserungs- oder heilungsbedürftige Klienten oder Patienten repräsentiert. Die Frage von Abweichung und deren Kontrolle wird entsprechend als eine ‚de-politisierte’ vor allem ‚technische’ Angelegenheit betrachtet, die am besten dem Expertenwissen der Professionellen des fordistischen Sozialstaats und des Strafwohlfahrtskomplexes überlassen bleibt (vgl. Garland/Sparks 2000, Gronemeyer 2001). Gleichzeitig sind es auch diese Professionellen aus den liberalen Mittelklassen selbst, die den zentralen Stellenwert wohlfahrtsstaatlicher Elemente in den Strategien sozialer Kontrolle sicherstellen und ausbauen und die den Einzug des Wohlfahrtsstaates bis in den 377 strafrechtlichen Umgang mit Abweichung hinein vorantreiben (vgl. Harris 2000, Ludwig-Mayerhofer 2000a). Vor allem aus diesen Professionellen rekrutiert sich in den umkämpften Feldern des Sozialen, wie der Kontrolle, eine einflussreiche Gruppe, der es gelingt eine in beiden Feldern maßgebliche ‚professionelle Ideologie’ (Cullen/Gendreau 2001) zu etablieren „[which] succeeded in characterising retributive or expressive concerns as irrational and inappropriate – unworthy emotions that ought best to be repressed – to the point where explicitly punitive sentiments came to be more or less absent from official discourse about crime and its control” (Garland 2000: 353). Die wohlfahrtsstaatliche Orientierung der liberalen Eliten ist jedoch nicht einfach einem uneigennützigen Altruismus geschuldet. Insbesondere als Professionelle des öffentlichen Sektors stellen sie – mehr noch als ‚die Armen’ selbst - Mitglieder einer gesellschaftlichen Klasse dar, die durch die Errungenschaften des Wohlfahrtsstaates, vor allem durch eine relative Aufwertung der Bedeutung des kulturellen Kapitals und die Umverteilungseffekte von „compensatory national insurance, social security, national health-care, mortgage subsidies and state-funded education“ (Garland 2000: 236) in mehr oder weniger allen westlichen Gesellschaften die höchsten praxisökonomischen und positionalen Gewinne erzielten können (vgl. Bourdieu 1997). Statistisch gesehen sind es ihre Söhne und Töchter, die von den neuen Aufstiegsmöglichkeiten im Bildungsbereich den größten Nutzen ziehen und sie es selbst, die von Berufsmöglichkeiten und gleichzeitigen Aufwertungen und Sicherung ihrer Positionen durch die Expansion sozialer Dienste auch im Bereich der Strafe und Kontrolle profitierten (vgl. Perkin 1989, Cremer-Schäfer 1999). Es ist vor allem die ‚Demokratisierung’ der akademischen Bildung, die sie als eine progressive Fraktion des gehobenen Kleinbürgertums hervorbringt. Allerdings muss sich diese Fraktion zunächst zwischen den bürgerlichen und den traditionalen Arbeiter- wie Angestelltenmilieus profilieren (vgl. Bourdieu 1982). Diese Profilierung vollzieht sich nicht zuletzt auf der Ebene ‚symbolischer Kämpfe’ (vgl. Bourdieu 1997, Mörth/Fröhlich 1994) wobei eine Demonstration ‚postmaterieller Werte’ (dazu: Featherstone 1991) inklusive einer ‚zivilisierte’ bzw. liberale Denk- Wahrnehmungs- und Handlungsweise gegenüber Kriminalität und Devianz, nicht nur professionsadäquat ist, sondern, im Sinne einer demonstrativ aufgeklärten und gebildeten Haltung, auch als ein symbolisch wirksames Distinktionsmerkmal fungiert, gegenüber den ‚beschränkten’, ‚reaktionären’ oder ‚vulgären’ Anschauung und Haltungen anderer Fraktionen der mittleren Klassen (vgl. Garland 1990, Mörth/Fröhlich 1994, Hess 2001). Ein solcher aufgeklärter Habitus ist in der ‚geordneten’ Welt des Fordismus (vgl. Bauman 1992) nicht zuletzt deswegen praxisökonomisch relativ leicht aufrecht zu erhalten, weil das kriminelle Bedrohungspotential, dem diese Gruppen ‚privat’ ausgesetzt sind, relativ bescheiden bleibt und auch von ihnen selbst, als marginal eingeschätzt wird. Insbesondere in den 1950er und 1960er Jahren lebt diese ‚beherrschte Fraktion der herrschenden Klasse’ (vgl. Ferchhoff/Peters 1981) üblicherweise in Gebieten und bewegten sich in sozialen Feldern – und ihr Nachwuchs besuchte Schulen – in denen relativ wenig direkter Kontakt zu deligitimierten, bedrohlichen und kriminellen Handlungsweisen der ‚Straßen’ zu erwarteten sind3: Dies war in einer historisch relativ kurzen Phase der Fall. Blickt man einige Jahrhunderte zurück kann von einer solchen ‚befriedeten’ urbanen Ordnung eher nicht die Rede sein (vgl. Eisner 2001). Bezeichnend sind die Ausführungen des 3 378 „Their daily routines did not often expose them to the threat of crime, nor did fear of crime occupy a prominent place in their consciousness. Their preferred image of the criminal was that of the under socialised, undereducated, undernourished adolescent – the ,juvenile delinquent’, for whom social reform and correctional treatment were the appropriate response” (Garland 2000: 357). Der ,Strafmodernismus’ bzw. der ‚Straf-Wohlfahrtskomplex’ und die Ablehnung repressiver Strategien durch die fordistischen Mittelklasseprofessionen wie Sozialpädagogen, Psychologen und Kriminologen, basiert demnach strukturell vor allem auf einigermaßen überschaubaren Kriminalitätsraten, einer relativ großen Distanz der Mittelklasse vom Kriminalitätsproblem (vgl. Garland 2001) sowie einer Dechiffrierung von Kriminalität als ‚soziales Problem’ (vgl. Brusten 1999), das in enger Verknüpfung mit jenen ‚schlechten sozialen Bedingungen’ steht, von denen angenommen wird, sie seien vor allem mit den staatlichen und sozialtechnologischen ‚top-down’ Lösungen zu lösen, die am sinnvollsten von Experten und Professionellen zu erbringen seien (vgl. Harris/Kirk 2000). In diesem Kontext wird es erreicht, ‚Kriminalpolitik’ weitgehend außerhalb von politischen Wahlkämpfen in einem „bipartisanian mode” zu formulieren „that delegated policy-formation to professionals and practitioners“ (Garland/Sparks 2000: 10). Die Frage der Gestaltung einer gesellschaftlichen Antwort auf das Problem der Non-Konformität stellt demnach zwar einen unsuspendierbar politischen und politisch umstrittenen Prozess dar (vgl. Downes/Rock 1998), aber kaum ein ‚Politikfeld’ im engeren Sinne. Dem politischen „Vertrauen in die Rolle des Professionals entsprach ein Typus der praktischen Umsetzung von Sozialer Arbeit in der Gestalt eines ‚bürokratisch-professionellen’ Systems […], das dem Expertenwissen von Soziarbeitern eine Vorrangstellung einräumte – sowohl im Hinblick auf die Kategorisierung der Bedürfnisse der Nutzer, als auch der sich daran anschließenden professionellen Reaktionsweise.“ (Harris/Kirk 2000: 113) Aus der professionsadäquaten Perspektive der definitionsmächtigen Gruppen ist die Lösung für Kriminalität weitgehend identisch jenen den Lösungen, die im weitesten Sinne wohlfahrtsstaatlich und mit Bezug auf die positional-dispositionale Matrix der betroffenen Akteure erbracht werden können: von der individualisierten Behandlung, Unterstützung und Supervision für Familien, bis zu Maßnahmen, die der Verbessung der Positionen gesellschaftlich unterprivilegierter Gruppen durch sozialstaatliche Reformen dienen sollen. Diese individual- und sozialreformerischen Strategien werden durch eine professionelle Unterstützung der Versuche einer weitgehenden Entkriminalisierung weniger schwerwiegender Delikte und ‚unordentlichen’ Verhaltensweisen ergänzt (vgl. Garland/Sparks 2000, Peters 1995). Zusammenfassend kann die fordistische Phase des Strafrechts als eine Phase seiner administrativen ‚Sozialisierung’ und der zunehmenden Zurückdrängung seines punitiven Gehalts gefasst werden, die in einem weitgehend entpolitisierten Diskurs von liberalen professionellen Eliten getragen wird, für die eine auf Besserung gerichtete, nicht punitive und der Tendenz nach mit dem ‚fehlgeleiteten’ Delinquenten sympathisierende oder zumindest ‚verständnisvolle’ Haltung charakteristisch ist. Allerdings darf diese prinzipielle, ‚sozialstaatliche’ Orientierung nicht darüber hinwegtäuschen, dass Schriftstellers Daniel Dafoe, die er 1730 dem Lord Mayor von London zukommen ließ: „The whole city, My Lord, is alarmed and uneasy. Wickedness has got such a head, and the robbers and insolence of the night are such that the citizens are no longer secure within their own walls, or safe even in passing their streets, but are robbed, insulted and abused, even at their own doors. [ …] The citizens are oppressed by rapin and violence” (nach: Graycar/ Nelson 1999). 379 auch in den sechziger und siebziger Jahren repressive und ausgrenzende Elemente an der kriminalpolitischen Tagesordnung sind (vgl. Ludwig-Mayerhofer 2000, Melossi 2000). Durch die Vermischung strafjustizieller und sozialstaatlicher Elemente (vgl. Feltes/Sievering 1990) wird eine Form der Bestrafung implementiert, die sich nicht nur auf die Taten, sondern auch auf die unterstellten Bedürfnisse der Unterprivilegierten richtet, die einseitig in den Blick der strafmodernistischen Instanzen sozialer Kontrolle genommen werden: Ihre (zwangsförmige) Behandlung erfolgt ‚for their needs as well as for their deeds’ (vgl. Muncie 1999). Ironischerweise wird gerade durch die diese, prinzipiell mit dem Abweichler sympathisierende Haltung, ein selektiver ‚netwidning’-Prozess (vgl. Cohen 1985) sozialer Kontrolle in Gang gesetzt, der tendenziell zu ungunsten deprivierter Gruppen verläuft (vgl. Albrecht 2000, Müller/Sünker 1995). Kaum weniger ironisch ist auch der genau umgekehrte Effekt, dass die nicht entpolitisierte, sondern im Gegenteil hochpolitische Phase eines ‚getting tough’, wie z.B. im Großbritannien der 1980er Jahre, zumindest phasenweise zu einer Senkung der Haftraten führt. Dies geschieht vor allem weil die Abkehr wohlfahrtsstaatlicher Behandlungskonzepte - über deren Ablehnung sich ‚konservative’ Wohlfahrtsstaatskritiker und ‚linke’ Legalisten einig sind - von einer, sich für eine gewisse Zeit durchsetzenden, Forderung nach ‚just deserts’ (vgl. von Hirsch 1976) und ‚einer Rückkehr zur Gerechtigkeit’ begleitet werden (vgl. Harris/Kirk 2000, vgl. Hudson 2001, Morris et al. 1980). Im Gegensatz zu Großbritannien kann sich eine solche ‚retributive’ Position, die ‚gerechte Strafen’ präferiert (vgl. Sumner 2001), in der Bundesrepublik nicht durchsetzen. Gleichwohl formiert sich auch hier eine keinesfalls nur von ‚Konservativen’ formulierte Kritik an den straf-wohlfahrtlichen Logiken (vgl. AWO 1994, H.J. Albrecht 2002b). So wirft etwa Detlev Peukert (1986) dem vorherrschenden professionellen Paradigma eine pauschale Problemgruppenkonstitution zum Zwecke der Sozialdisziplinierung von Kinder und Jugendlichen aus der Unterschicht vor und Micha Brumlik kritisiert eine mit dem ‚Soziale-Probleme-Deutungsmuster’ (vgl. Brusten 1999) verbundene „entmündigenden Wirkung von Hilfeinstitutionen“ und „Enteignung des Bewusstseins der Ausgeforschten“ (Brumlik 1980: 114). Dabei stellen die - politisch betrachtet im wesentlichen ‚linken’ - Kritiken jedoch in aller Regel nicht die sozialstaatliche Orientierung selbst in Frage. Die Kritik zielt vor allem auf die Konsequenzen einer pädagogisierenden Dispositionsorientierung, die statt den Blick auf Fragen der Distributionsgerechtigkeit zu richten, als vermeintlich oder tatsächlich pateranalistische und antiemanzipatorische Befriedung der Unterprivilegierten ‚entlarvt’ worden ist (vgl. Piven/Cloward 1971, Kunstreich 1999, Muncie 2002). In diesem Sinne sind behandlungsskeptischen Perspektiven der liberalen Kritiker kaum die treibende Kraft der zeitgenössischen Hinweise darauf, dass sich die Repräsentationen des Abweichlers nach einem sozialstaatsorientierten Schema einer ‚Soziale-Probleme-Definition’ durch die Professionellen deutlich verändert. Diese Veränderung lässt sich etwa anhand einer Literaturdokumentation der ‚Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention’ des DJI (1998) verdeutlichen, in der die im Zeitraum von 1985-1997 in den 50 für die Sozialpädagogik wesentlichsten Fachzeitschriften veröffentlichen, praktischen 380 kriminalpräventiven Ansätze und Projekte dargestellt werden. Zwar werden dieser Dokumentation zu Folge bei einigen der Projekte ‚sozial benachteiligte’ Jugendliche als Zielgruppe benannt, bei der Beschreibung präventiven Maßnahmen und Strategien lassen sich jedoch in der gesamten Dokumentation - mit Ausnahme von zwei Projekten, die darauf gerichtet sind Jugendliche „von der Straße holen“ (DJI 1998: 84) bzw. „aus dem Bahnhofmilieu zu lösen“ (DJI 1998: 59) - keine Aspekte finden, die unmittelbar mit einem Abbau sozialer Benachteiligung in Verbindung gebracht werden könnten4. Bei den dokumentierten Maßnahmen kommt vor allem den sogenannten Antiaggressionsprojekten und anderen Formen von Kursen und Trainings eine quantitativ und qualitativ zentrale Bedeutung zu. Diese Maßnahmen zielen im wesentlichen darauf, individuelle Gewaltbereitschaft abzutrainieren, ‚Empathie für Opfer’ zu entwickeln, ‚Konfliktmanagement’ und ‚soziale Kompetenz’ zu lernen, unerwünschte Verhaltenformen, Einstellungen, ‚Bewusstsein’ und ‚Orientierungslosigkeit’ grundlegend zu ändern, über Diskussionen Vorurteile zu irritieren, ‚Selbstkontrolle’ und Ausdauer aufzubauen, „die Jugendlichen wieder ans Aufstehen, ans Arbeiten zu gewöhnen“ (DJI 1998: 65) usw. (vgl. DJI 1998: 9 ff). Der - neben wenigen ‚bildungstheoretisch’ fundierten Ansätzen - überwiegend individualisierte und weitgehend alleine dispositionsbezogene Zugang, trifft auch für die Ansätze zu, die Kinder und Jugendlichen nicht nur als Täter, sondern auch als potentielle Opfer in den Blick nehmen. Diese sind vor allem darauf gerichtet ihre Adressaten Risiken gegenüber zu ‚sensibilisieren’, zur gegenseitigen Kontrolle zu aktivieren und Ratschläge bzw. Anweisungen für ‚kluges‘ und vorsichtiges Verhalten zu geben. Was neben dem Fehlen eines traditionellen engen Bezugs auf Armut und Deprivation als ‚Ursache’ von Abweichung in diesen Projekten als ein Indikator für den Wandel in der sozialpädagogischen Repräsentation des Abweichlers gewertet werden kann, ist die kritische Auseinandersetzung der Herausgeber - des Deutschen Jugendinstituts - mit dem scheinbar inflationären Gebrauch des Begriffs der ‚Benachteiligung’. Dieser Begriff sei dem „Vorwurf der Beliebigkeit“ und eines „generalstigmatisierende[n] Handeln[s]“ ausgesetzt, „weil [damit] ‚Benachteiligung’ per se als ausreichendes Kriterium für […] Kriminalprävention ausreicht“ (DJI 1999: 26). Mit guten Argumenten ist ja eine direkte und kausalistische ‚evil-causes-evil’ (vgl. Lindesmith 1968: 188 f) Annahme mit Blick auf die ‚Ursachen’ von Non-Konformität unter anderem bereits von Albert K. Cohen (1970) und vor allem von David Matza (1973) kritisiert worden. Diese Kritik wendet sich gegen die im Fordismus vorherrschende Repräsentation des Abweichlers, die gerade auch von den Sozialen Diensten geteilt und vorangetragen wird5 (vgl. Peters 1989, Janssen/Peters 1997, Scherr 2001, Cullen/Gendreau 2001). Was nun aber erstaunt, ist dass die Kritik an der pauschalen Annahme „schlechte Dinge […würden] sich aus schlechten Vorraussetzungen [ergeben]“ (Matza 1973: 29) in einer Weise zum Auch ein Projekt mit dem Titel „Stadtteilorientierte Gemeinwesenarbeit als Mittel der Prävention“ (DJI 1998: 20) kommt noch in die Nähe eines Bezug auf ‚soziale Benachteiligungen’, in so fern es neben acht weiteren Zielen auch darauf gerichtet ist, „[d]ie Isolation des Einzelnen“ (DJI 1998: 21) dadurch aufzulösen, dass begonnen wird, ein Stadtteilfest „als ‚Initialzündung’ zur Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner“ zu ‚planen’. 5 Diese Kritik hat in aller Regel nicht impliziert, dass Kriminalität und Kriminalisierung unabhängig von gesellschaftlichen Organisation, Herrschafts- und ‚sozialen Verhältnissen’ seien (vgl. Frehsee 1995, Grönemeyer 2001, Scherr 2001). 4 381 Selbstläufer geworden ist, dass sie selbst dort noch in den Mittelpunkt gestellt wird, wo ein Bezug auf schlechte soziale ‚Vorraussetzungen’ kaum erkennbar ist. Während sich der Rekurs auf ‚schlechte soziale Verhältnisse’ abschwächt (empirisch: Lösel 2002), werden von den Professionellen personenbezogener sozialer Dienste teilweise Aspekte in die präventiven Strategien aufgenommen, in einer retrospektiven Betrachtung des sozialstaatsorientierten Deutungsschemas der fordistisch-keynesianischen Phase des Kapitalismus auffällig abwesend waren: nämlich jegliches substanzielle Interesse am unmittelbaren Kriminalitätsereignis, an ‚kriminogenen’ Situationen und Orten, dem Opferverhalten, den alltäglichen sozialen und ökonomischen Routinen die Kriminalitätsgelegenheiten mit sich bringen usw. (vgl. Garland/Sparks 2000:9). All dies sind Aspekte die in den Mittelpunkt der kriminalpolitischen und kriminologischen Agenda gerückt sind, die sich selbst wiederum – zumindest in wesentlichen Bereichen – deutlich von den Logiken des Wohlfahrtsstaats und seinen Institutionen entfernt. Dabei verliert die ‚expertokratische’ Herstellung eines zuverlässigen Individuums gegenüber der Vermeidung, Regulierung und Kanalisierung von im weitesten Sinne ‚risikoträchtigen’ Situationen an Gewicht. Das erwachte Interesse an diesen unmittelbaren Kriminalitätshintergründen jenseits der klassischen ‚SozialeProbleme-Ätiologie’ leitete einen zentralen Bruch in der Analyse abweichenden Handelns in der Phase nach dem keynesianischen Wohlfahrstaat ein. Denn es ist vor allem das Vorrücken dieser Aspekte in das Feld der Kriminalitätskontrolle, durch die nicht nur die politische, sondern auch die bis dahin kaum bezweifelte technologische Relevanz der Betrachtungs- und Bewertungsdispositionen der Professionellen des keynesianischen Strafwohlfahrtssystems herausgefordert wird: „What Pierre Bourdieu would call the habitus of many trained practitioners – their ingrained dispositions and working ideologies, the standard orientations that ,go without saying’ – has been undermined and rendered ineffective” (Garland 2001: 5, vgl. Krasmann 2000b) Ein dadurch induzierter Perspektivenwechsel, weg von der sozialtechologischen Konzentration auf das Individuum, ist auch aus einer emanzipatorischen und gegen eine Expertokratie der Stakeholder der formellen Kotrollinstanzen gerichteten Perspektive eine Forderung (vgl. z.B. Steinert 1992, 1995 Sünker 1992) und - zumindest bis vor kurzem – keinesfalls ein Gegenstand der Kritik6. Das Anliegen eines nicht unbedeutenden Teils (herschafts)kritischer Sozialpädagogen und Kriminologen, den ‚Kriminellen’ als Individuum theoretisch wie handlungspraktisch ‚abzuschaffen’ oder ‚irrelevant’ zu werden lassen, um damit den moralisierenden und herrschaftlichen Zugriff auf das Individuum unnötig zu machen, weist zunächst deutliche Parallelen zu Kontrollstrategien auf, die sich mit einer Konzentration auf die Situation begnügen (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 1998, Krassmann 2000, Sessar 1997). So schlagen die dezidiert kritischen Kriminologen Hanak, Stehr und Steinert (1989) vor, den ‚alltäglichen Umgang mit Kriminalität’ auf der Basis einer genauen Beschreibung der prävalenten So etwa die Reaktion der kritischen Kriminologen Helga Cremer-Schäfer und Heinz Steinert (199: 229) auf die von Henning Schmidt-Semisch und Michael Lindenberg (1996) skizzierte Bewegung hin zu ‚situationsorientierten’ Präventionsformen in fortgeschritten liberalen Gesellschaftsformationen. Es entstehe so die vehemente Kritik von Cremer-Schäfer und Steinert, der irreführende Eindruck „die ‚Aus- und Vorverlagerung’ ergebe eine veränderte Qualität von Kontrolle: Tatsächlich baut sie immer noch und immer selbstverständlicher auf der Abwehr, dem Ausschluß von Personen auf […] Gäbe es stattdessen 6 382 Merkmale, der Situationen und Beteiligten zu analysieren, um somit die Möglichkeiten zur Vermeidung von Schädigung und Verlusten bei kriminalisierten wie nicht-kriminalisierten ‚Ärgernissen und Lebenskatastrophen’ herauszuarbeiten. Diese Möglichkeiten werden jenseits einer degradierenden, moralisch autoritären und individualisierenden Soziale-Probleme-Definition verortet (vgl. Steinert 1992). Statt Fälle von Kriminalität zu bestimmen, damit Konflikte zu enteignen und gleichzeitig dadurch zu personalisieren, dass die als problematisch identifizierten Individuen geläutert werden (vgl. Cremer-Schäfer 1993, Cremer-Schäfer/Steinert 1998), solle der Versuch unternommen werden, ‚problematischen Situationen’ zu ‚managen’ oder im besten Fall ex ante zu verhindern. Zwar gibt es auch in der Bundesrepublik einige ökonomietheoretische Versuche, die explizit oder implizit kriminogene Situationen als Situationen von Angebot und Nachfrageentscheidungen in den Blick nahmen (vgl. Pilgram 1993) aber in gewisser Weise waren es Vertreter einer kritischen Kriminologie, die zur Vermeidung selektiver Stigmatisierungen, individueller Zurichtungen und Kriminalisierungen Vorschläge unterbreiteten, die in der Legitimation von neuen, ‚postmodernen’ (Kunz 1998) Präventionskonzepten durchaus Anklang finden. Allerdings folgt eine faktische Abschwächung der ‚moralisch-autoritären’ Kontrolle zugunsten einer Konzentration auf kriminogene Situation, ‚gefährlicher Orte’ und räumlich-zeitlich Gefahrenzonen in den neuen Präventionsstrategie weniger jenen herrschaftskritischen Überlegungen, sondern ist vor allem Ausdruck einer pragmatischen, ‚täterabgewandten’ (vgl. Schmidt-Semisch 2002) bzw. ‚ursachenneutralen’ Kriminologie und Kriminalpolitik, die ihrerseits mit der Schwächung des keynesianischen Sozialstaates in Verbindung steht. Sie kann als eine Kontrollstrategie verstanden werden, die darauf reagiert, dass im Kontext gesellschaftlicher Pluralisierungen und Fragmentierung und der relativen Rücknahme sozialpolitischer Versuche der Erzeugung einer verallgemeinerten Form sozialer Kohäsion auch quasi-universelle Normen und Werte, und ein feldübergreifender sozialer Konsens abgeschwächt werden (vgl. Karstedt 1999a) und ihre gesellschaftliche Integrationsfunktion verlieren, so dass eine generalisierte konsensfähige Wertordnung nicht mehr ohne weiteres als garantiert vorausgesetzt werden kann. Vor diesem Hintergrund besteht ein funktionaler Bedarf an einem neuen Modus der Kontrolle, der sich weder ausschließlich disziplinierender Kontrollverfahren und moralischer Argumentationsfiguren (vgl. Lindenberg/Schmidt- Semisch 1996: 303) noch alleine des personalisierenden auf individuelle Normalisierung gerichteten Zugriffs durch Experten und Professionelle im Auftrag des Staates bedient. Während die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse und die strukturellen Verschiebungen im Feld des Sozialen demnach eine Veränderung vor allem der ‚expertokratischen’ Kontrollformen und -strategien als einen ersten systematischen Bruch mit der fordistischen Logik der Kontrolle implizieren, besteht eine zweite zentrale Veränderung in der Verschiebung des Gegenstandes, auf den sich die Kontrollbemühungen richten. wirklich mehr Situationskontrolle, wie Lindenberg und Schmidt-Semisch meinen, wäre das durchaus ein Fortschritt weg vom strafenden und ausschließenden Staat, der nun leider nicht stattfindet“. 383 IV. 1.2 ‚POLITISIERUNG’ DES ‚SICHERHEITSDISPOSITIVS’ UND DIE ‚STRUCTURE OF FEELING’ Fasst man mit Foucault (1978: 119 f) ein ‚Dispositiv’ als ein ‚Netz’, das zwischen einem ‚heterogenen Ensemble’ von Elementen geknüpft ist, das „Diskurse Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische und philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebenso wohl wie Ungesagtes umfasst“ und das darauf gerichtet ist „zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt […] auf einen Notstand zu antworten“, so lässt sich als das zentrale ‚Dispositiv’ des fortgeschritten liberalen Präventionsdiskurses weniger eine strafjustizielle fassbare Bestimmung Kriminalität, als ein ebenso manageriell wie normativ gefasstes Dispositiv der Sicherheit identifizieren (vgl. Frehsee 1998, Lindenberg/Schmidt-Semisch 1996). Dabei ist der Rekurs auf Sicherheit selbst jedoch zunächst kein Spezifikum eines fortgeschritten liberalen Präventionsdiskurses. Karl Marx (1956) bezeichnet Sicherheit als den zentralen Begriff des bürgerlichen Staates, und in historischer Betrachtung kann in der Tat angenommen werden, dass vom „Ursprung der Herrschaft bis in unsere Tage war es die vornehmste Aufgabe des Feudalherren, Landesfürsten und schließlich der demokratischen Regierungen, die zentrale Aufgabe jeder staatlichen Gewalt, den Vasallen, Untertanen oder Staatsbürgern Schutz zu bieten vor inneren und äußeren Feinden. Das war […] überhaupt die entscheidende Legitimation für Abgaben und Steuererhebungen, für die Konzentration der Waffengewalt beim Herrn und schließlich für das Gewaltmonopol des Staates. Eine genuin politische, ganz und gar ‚hoheitliche’ Aufgabe“ (Scheerer 1997: 13f). Allerdings haben sich die mit dem Staat verknüpften Sicherheitsbegriffe gegenüber den Bestimmungen von Friedensraum (‚pax’) im Römischen Imperium und der ‚securitas’ der Karolinger und Franken deutlich erweitert. So kennt z.B. die Bundesrepublik als verallgemeinerte Staatsziele, die rechtliche Sicherheit (Rechtsstaatspostulat) und die soziale Sicherheit (Sozialstaatspostulat), sowie im einzelnen grundgesetzlich definierte Staatsaufgaben Formen der Sicherheit wie die äußere Sicherheit (Art. 87a I), die polizeilich-innere Sicherheit (Art 35, II, III), die ökonomisch monetäre Sicherheit (Art. 88) und die wirtschaftliche Sicherheit (Art. 104a, 109). Ein auf das Innere des Staatswesens bezogener Begriff der ‚öffentlichen Sicherheit’ wird vor allem seit dem 17. Jahrhundert etabliert. Öffentliche Sicherheit markiert dabei die Notwendigkeit eines staatlich induzierten Regelungsbedarfs menschlichen Zusammenlebens (vgl. Kaufmann 1973), bei dem der Staat den legitimen Gebrauch der physischen und symbolischen Zwangsgewalt über ein bestimmtes Territorium (vgl. Bourdieu 1998: 99) zum Schutz des Einzelnen und zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung monopolisiert und verallgemeinert. In einem modernen rechtsstaatlichen Verständnis stellt ‚öffentliche Sicherheit’ als Rechtsbegriff zwar nach wie vor das Gewaltmonopol des Staates sicher, aber er dient auch der Begrenzung staatlicher Willkür, nämlich dadurch, dass er als Sicherheit von Rechten gleichzeitig den Freiheitsschutz der Bürger und die Grenzen des staatlichen Zugriffs markiert (vgl. Hansen 1998). Er lässt sich damit als „unbedingte Voraussetzung für das Funktionieren einer sozialen und rechtsstaatlichen Demokratie“ (Kapmeyer/Neumeyer 1993: 5) thematisieren. Demgegenüber ist der Begriff der ‚inneren Sicherheit’, als ein reflexive Pendant der staatlichen Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Rechtsfrieden konzipiert, aber kein 384 bestimmter Rechts-, sondern ein politischer und damit politisch disponibler Begriff, der auf der Vorstellung beruht, dass der Schutz des Versorgers ‚öffentlicher Sicherheit’, eine zentrale Voraussetzung Sicherheit der Bürger sei (vgl. Lehne 1993). Der Begriff ‚soziale Sicherheit’ stellt demgegenüber die historisch jüngste Komponente des Sicherheitsbegriffs dar (dazu Kaufmann 1973). Als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise wird er Mitte der 1930er Jahre zunächst in den USA Mitte geprägt (vgl. Dinges/Sack 2000) und rückt schließlich im fordistischen Sozialstaat in den Mittelpunkt staatlicher Sicherheitsbestrebungen. Dabei kommt es dem sozialen Staat zu, zur gesellschaftlichen Bewältigung von Bedrohungen und Risiken in einer Weise für Sicherheit zu Sorgen, die eine verallgemeinerte Form staatlich erzeugter Normalität vor allem durch die Sicherung sozialer Integration, einen kompensatorischen Bezug auf den sozialen und ökonomischen Bedarf der Bürger und eine Form der Prävention an den tatsächlich oder vermeintlich sozialstrukturellen Wurzeln von Risiken sicherstellen soll (vgl. Young 1998: 66). Diese Form der Sicherheitserzeugung ist bis in die 1970er Jahre hinein weniger eine Strategie unter anderen, sondern das in der Gesamtschau hervorragende Merkmal eines „für den fordistischen Nachkriegskapitalismus typische[n] ‚Sicherheitsstaat[s]’, der sich durch eine komplexe Verbindung von relativ umfassender wohlfahrtsstaatlicher Fürsorge und politisch-bürokratischer Kontrolle, Disziplinierung und Überwachung ausgezeichnet hatte“ (Hirsch 1995: 23). In diesem Modell staatlicher Integrationspolitik findet das Spannungsverhältnis von Freiheit, Gleichheit und Sicherheit in der bürgerlichen Gesellschaft seinen materiellen und institutionalisierten Ausdruck (vgl. Sachße 1990, Sachße/Engelhard 1990). Das zugrunde gelegte Konzept sozialer Sicherung steht für die Vergesellschaftung, aber damit verbunden auch der gesellschaftlichen Kontrolle individueller Lebensrisiken. Dieses ‚Sicherheitskonzept’ als Sicherheitserzeugung durch staatliche Integrationspolitik ist durch die Krise des Fordismus und den Wandel zu einer fortgeschritten liberalen Gesellschaftsformation grundlegend erschüttert worden (vgl. Beste 2000, 2000a, 2000b). In dem Maße wie die Erzeugung von Sicherheit durch ‚soziale Sicherheit’ nicht mehr möglich bzw. politisch nicht mehr erwünscht ist, scheint eine Form der ‚Sicherheitspolitik’ an dessen Stelle zu treten, „die Sicherheit von Menschen vor materiellen und physischen Schädigungen, vor Konflikten und sozialen Erniedrigungen mit der Sicherheit vor ‚Kriminalität’ gleich[setzt]“ (Cremer-Schäfer 1993: 13). „Zugespitzt formuliert: Je weniger es gelingt, die staatliche Aufgabe des Schutzes der BürgerInnen vor illegitimer Gewalt im Verhältnis zur strukturellen Gewalt der kapitalistischen Ökonomie zu realisieren […], um so bedeutsamer wird es im Interesse der Legitimationssicherung, dass staatliche Politik ihre Fähigkeit glaubhaft machen kann, Schutz vor personeller physischer Gewalt zu gewährleisten“ (Scherr 1997: 259). Zugleich wird die Sicherheitsgewährleistung ‚dezentralisiert’. Die Aufgabe einer Aufrechterhaltung nicht nur der ‚öffentlichen’, sondern auch der ‚inneren Sicherheit’ wird vom Staat, seinen Institutionen den Professionellen und Experten zu einer - staatlich angeleiteten – Aufgabe der zivilen Gesellschaft erweitert und gleichzeitig in seiner Bedeutung entgrenzt. So betont etwa der baden-württembergische Innenminister Schäuble (1997), dass eine „aus Gewaltmonopol abgeleitete Schutzpflicht des Staates […] nicht so ausgelegt werden [darf], dass es alleinige Aufgabe der Sicherheitsbehörden ist, für die Innere Sicherheit Sorge zu tragen. Die Sicherheitsorgane sind in ihrem Kampf gegen Kriminalität auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen“ 385 Dafür komme aber, wie sein nordrhein-westfälischer Kollege Behrens ergänzt, jedem Bürger „auch unterhalb der Grenze zur Straftat“ ein „Anspruch auf Schutz und Sicherheit“ zu (Innenministerium NRW 1998: 4). Dies radikalisiert sich in einer tendenziellen Abkehr von einem klaren Konzept des „Problem[s] Kriminalität“ in der polizeilichen Arbeit und der Bestimmung ihrer Aufgaben, gestützt durch die Begründung „dass Störungen und Problem außerhalb des strafrechtlich relevanten Bereichs die Bürger subjektiv und objektiv oftmals mehr belasten als Straftaten selbst“ (Feltes 2001: 1390). Damit ist eine entgrenzte und juristisch unbestimmte Form ‚persönlicher’ Sicherheit skizziert, auf die der zwar Bürger prinzipiell, aber - vergleichbar mit dem Bereich der ‚sozialen’ Sicherheit im ‚aktivierenden’ Staat – zugleich auch nur dann einen Anspruch hat, er selbst in partnerschaftlicher Weise das seine zur Produktion dieser Sicherheit beiträgt. Die Entgrenzung, Unbestimmtheit und die seiner partnerschaftlichen Erzeugung immanente Popularisierung des Sicherheitsbegriffs bedeutet aber nicht, dass seine konkreten Inhalte völlig zufällig sind. Vielmehr steht ihm komplementär zu der neuen Sicherheitserbringungslogik eine - in Bezug auf die ko-produktiven, zivilgesellschaftlichen Akteure - nachfrageorientierte Form der Er- und Bearbeitung dessen gegenüber, was als Gefahren und Risiken zu gelten hat, die ebenfalls zunehmend außerhalb und unterhalb der ‚öffentlichen Sicherheit’ und des rechts- und sozialstaatlichen Kontrakts verortet ist und die damit außerhalb bisheriger formaler staatlicher Zuständigkeits- und Zugriffsgrenzen liegen bzw. eher auf ‚moralischem’ als auf ‚legalem’ Kapital basieren. Ein ‚Gerechtigkeitsproblem’ dieser Entwicklung besteht in den ungleich verteilten den Kontroll- und Steuerungschancen bezogen auf das aktivierbare Schutzpotential (vgl. Hope 2001). Aufgrund der je individuell, klassen- sowie feldspezifisch ungleichen Ressourcenausstattungen und Möglichkeiten der kooperativen Einflussnahme sowie unterschiedlicher inhaltlicher Schwerpunktsetzung entstehen unterschiedliche Sicherheitsniveaus und Sektoren mit einem unterschiedlichen Grad an zugestandener persönlicher Freizügigkeit. Dabei droht sich der Rechtsstaat sowohl bezogen auf sein gegenüber jedem einzelnen ‚Rechtssubjekt’ gleichermaßen ausgesprochenen Freiheitsversprechen (vgl. Frehsee 1999), als auf sein garantiertes und staatlich verallgemeinert durchgesetztes Sicherheitsversprechen unglaubwürdig machen (vgl. von Trotha 1995). In so fern impliziert die Relativierung der zentralen Legitimationsgrundlage staatlicher Herrschaft weder ein Mehr an ‚Freiheit‘ noch unkontrolliertes Chaos, sondern verweist, wie Murck (1994: 76), der Direktor der Polizei-Führungsakademie befürchtet, auf eine „Refeudalisierung der öffentlichen Sicherheit“ (zit. nach Hitzler/Göschl 1997: 143). Während kritische Sozialwissenschaftler und Kriminologen darauf aufmerksam machen, dass die staatliche Zuschreibung und Feststellung normwidrigen Handelns Interessen reflektiert, die definitionsmächtige Gruppen in asynchronen Aushandlungs- bzw. Skandalisierungsprozessen durchgesetzt haben (vgl. Groenemeyer 1999, Karstedt 1999), wird nunmehr auch auf die formaldemokratische Prozedur verzichtet, die den ebenso prinzipiellen wie allgemeinen Charakter dessen feststellt, was durch das – mehr oder weniger - enge Nadelöhr des Rechts gelangen kann. Was als ordnungsgemäßes oder ordnungswidriges Verhalten gilt, wird, wie Hitzler und Göschl (1997: 144) nachzeichnen, 386 „in den Ermessensspielraum der Schutzgemeinschaft bzw. einzelner ihrer Mitglieder gestellt [, und zielt zunehmend auf …] Verhaltensweisen, die als Verstöße gegen die (sozusagen lokalidiosynkratisch) von der jeweiligen Schutzgemeinschaft (willkürlich) definierten Ordnung interpretiert werden“. In diesem Kontext weiten sich die öffentlichen Verhaltenskontrollen, in dem Maße wie sich die Sicherheits- und Ordnungsangebote nicht mehr „nach einer amtlichen, demokratisch legitimierten Einschätzung der Bedürfnisse des Gemeinwohls [… sondern] nach Partikularinteressen durchsetzungsfähiger und nachfragemächtiger Teilgruppen der Bevölkerung [… bestimmen] von der Kriminalitätsabwehr über die Ordnungssicherung in die Bereiche von Rücksichtnahme, Höflichkeit und Anstand aus“ (Frehsee 1999: 17). Gleichzeitig wird auch der Nachweis der Verletzung eines bestimmbaren, bzw. individuell zuzuordnenden Rechtsguts als formal demokratisch legitimer Anlass der Interventionen der Kontrollinstanzen hinfällig. Auch für den Fall dass, „no one particular is harmed by the conduct in question, this does not prevent the invocation of a collective victim – ‚the community’ and its ‚quality of life’ – that deemed to suffer the ill effects” (Garland 2001: 181), die aus ‚Disorder’- Phänomenen als „Formen der ‚Un-Ordnung’, wie z.B. Straßenprostitution, Trinken in der Öffentlichkeit, aggressive Bettelei, Graffiti oder Abfall in den Straßen“ oder ‚Incivilities’7 wie „rücksichtsloses, aggressives, ungehöriges Benehmen […und] Verstöße gegen die gegenseitige Achtung und Verpflichtung zum Anstand“ (BKA 1997) folgen. Die Konzentration auf Verstöße gegen einer eher durch moralisches als durch legales Kapital konstituierte Ordnung wird dadurch legitimiert, dass „den Bürger“, wie der Deutsche Städte- und Gemeindebund (1998) ausführt, „nicht so sehr das spektakuläre Verbrechen [schreckt], sondern vielmehr das tägliche Erlebnis von Verwahrlosung, Vandalismus und Zerstörung. Mehr als jeder [Z]weite […fühlt] sich dadurch mehr beeinträchtigt als durch ‚richtige Kriminalität’“. In dem Maße aber wie sich die formellen Kontrollinstanzen vor allem aber die Polizei nicht nur an juristischen, sondern zugleich am moralischen Kapital eines Feldes orientieren und dabei Maßnahmen etablieren, die nicht auf Verstöße gegen Strafrechtsnomen, sondern gegen Phänomene räumlicher, sozialer und moralischer Verlotterung gerichtet sind, erklären sie sich zuständig für alle Probleme, die den Bürger belasten und dabei im allerweitesten Sinne dem Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zugeordnet werden können (vgl. BKA 1997). Zugleich sind – bereits vor dem 11. September 2001 - durch zahlreiche neue polizeirechtliche Ermächtigungsnormen wie etwa der Einführung verdeckter Ermittler, dem ‚großen Lauschangriff’, der Schleier- und Rasterfahndungen, eigenmächtig aussprechbaren Aufenthaltsverbote (vgl. Kutscha 1998), technischen Raumüberwachungen, verdachtunabhängigen Personenkontrollen usw. auch die formalen Kompetenzen der Polizei enorm erweitert worden. In der Gesamtschau kann dies als ein Wörtlich übersetzt bedeutet der Begriff ‚Incivility’ nichts anderes als ‚Unhöflichkeit’. Dabei ist nicht zu Bezweifeln, dass sich ‚Unhöflichkeiten’ nicht gerade förderlich auf die ‚Lebensqualität’ jener Akteure auswirken, die sie erfahren. Es lässt sich auch noch für einen legitimen politischen Standpunkt halten, wenn sich die Präsenz von Unhöflichkeiten im öffentlichen Raum für konservative Neo-Hegelianer oder Neo-Aristoteliker als Politikum bzw. als erzieherisches Problem darstellt. Wenn es aber in sich als liberal demokratisch verstehenden Gesellschaften eine Institution gibt, die das Unhöflichkeitsproblem – jenseits der Formen die sich in ihren eigenen Reihen befinden – nun nichts, aber auch absolut überhaupt gar nichts anzugehen hat, dann ist dies die Polizei. Die Polizei oder andere strafjustizielle Institutionen für Unhöflichkeiten und andere Bereiche der Moral und Tugend zuständig zu erklären ist geht in so fern weit über den konservativen Kommunitarismus der im ‚aktivierenden Staat’ zum Ausdruck kommt hinaus, sondern verweist schlicht auf vor-aufklärerisches Verständnis von der politischen Regulation des öffentlichen Raums. 7 387 Ausdruck einer paradoxen Form der Verrechtlichung des staatlichen Eingriffshandelns verstanden werden (vgl. Kutscha 2001). Das Paradox dieser Verrechtlichung besteht darin, dass sie zu einer Entgrenzung staatlicher Zugriffsmöglichkeiten statt einer Ausweitung der Rechtssicherheit bzw. der ‚Zähmung’ und Kontrolle des Gewaltmonopolisten führt: „Die Polizei entwickelt sich zu einer ‚Superbehörde’ […] und erhält jene ausgedehnten Zuständigkeitsbereiche zurück, die sie im 19. Jahrhundert schon einmal hatte“ (Karstedt 2000: 41). Die Ausweitung der bestimmbaren polizeilichen Ermächtigungsnormen ist durch eine Vielzahl neuer und wiederentdeckter Schachteltatbestände ergänzt worden, wie etwa die Erweiterung der seit den 1980er Jahren eingeführten Aufgabe einer ‚vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten’ durch die an rechtlicher Unbestimmtheit der Aufgabenzuweisung an die Polizei kaum zu überbietende Aufgabe einer allgemein formulierten ‚Verhütung’ von Straftaten (vgl. Gusy 1996: 103). Damit wird letztlich auch auf der formalen Ebene eine Abkehr von einem die Polizei legalistisch begrenzenden, abwehrrechtlich konzipierten ‚due process of law’ zum Ausdruck gebracht (vgl. Narr 1999: 32). Vielleicht noch gravierender als Kompetenzerweiterungen der Kontrollinstanzen und die Verschiebungen von der Illegalität zur Immoralität bei den als kontrollrelevant fokussierten Handlungsweisen ist jedoch eine Umorientierung von ‚objektiven’, d.h. bobachtbaren oder rekonstruierbaren Handlungsereignissen, zu ‚subjektiven’ Eindrücken und dem ‚Gefühl’ relevanter aber nichtsdestoweniger partikularer Bevölkerungsgruppen, die sich als kriminalpolitische Wende von einem ‚War on Crime’ zu einem ‚War on Fear of Crime’ seit den 1970er und 1980er Jahren zunächst in den USA dann auch in Westeuropa vollzogen hat (vgl. Boers 1991). Dabei stehen zwei Argumente im Mittelpunkt: Zum einen wird betont, dass ein Krieg gegen die Kriminalität, zumal von den formalen Kontrollinstanzen, nicht gewonnen werden kann (vgl. Gramckow/Feltes 1994: 17). Zum anderen wird aus der epistemologischen Banalität einer Differenz zwischen den unterschiedlichen Elaborierungen der ‚subjektiv’ - auf der Basis je individuell angenommener Wahrscheinlichkeiten - wahrgenommenen kriminellen Bedrohungen (vgl. Lianos/Douglas 2000: 112) und der - in Form der polizeilichen Kriminalstatistik auf der Basis statistischer Aggregation ermittelten - nominalen Häufigkeit formal registrierter Verdächtigter (vgl. Kreissl 1997: 537), die handlungsrelevante Erkenntnis konstruiert, das ‚Kriminalitätsfurcht‘ eine von der ‚Kriminalitätsentwicklung‘ losgelöste soziale Tatsache (vgl. IM Baden-Württemberg 1996: 17) und nicht nur als eigenständiges, sondern als das primär durch präventive Maßnahmen zu bekämpfende soziale Problem zu verstehen sei (vgl. Gramckow/Feltes 1994: 17): „Vor allem geht es […in einer ‚bürgernahen’ Form der Kriminalprävention] darum, sich mit der subjektiven Kriminalitätsfurcht und dem individuellen Sicherheitsgefühl zu beschäftigen und die Ursachen dieser Furcht zu beseitigen“ (Feltes/Dreher 1996: 137). Ein solcher „Gefühlsansatz in der Kriminalpolitik“ (Walter 1995: 72) trägt unter anderem dazu bei, die Grenzen des ‚Kriminellen‘ und ‚Konformen‘ bis zur Unkenntlichkeit zu verwischen und zugleich die Notwendigkeit für weitreichende ‚kriminalpräventive‘ Maßnahmen zu begründen und zu legitimieren (vgl. Boers 2001), die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie sich viel stärker auf die Bekämpfung der Konsequenzen von Risiken, Kriminalität, Verwahrlosung etc. als auf die Verhinderung 388 von Kriminalität selbst oder auf die Bearbeitung ihrer - zumal ‚tieferliegenden‘ - ‚Ursachen’ konzentrieren (vgl. Garland 2001: 121). Damit können sich die kriminalitätsfurchtorientierten Präventionsstrategien in dem Maße, wie sie den Charakter eines nachfrageorientierten „Management[s] von empfundenen und erlebten Risiken und Unsicherheiten“ (Nogala 1998: 146) annehmen, massiv ausweiten und gleichzeitig den Versuch aufgeben, ein verallgemeinertes und umfassendes sozialgestalterisches bzw. gesellschaftssanitäres Projekt staatlich zu exekutierten. Eng mit einer Orientierung an der ‚subjektiv empfundenen’ Kriminalitätsfurcht ist eine verstärkte Orientierung an dem einstigen „Aschenputtel der Strafjustiz und der kriminologischen Forschung“ (Weigend 1994: 45) verbunden, nämlich dem (potentiellen) Opfer. Blankenburg (1996: 173) spricht sogar von einem umfassenden Wandlungsprozess von einem ätiologischen zu einem ‚vikimologischen Paradigma’. Das Ergebnis dieses ‚Paradigmenwechsel’ ist in bezug auf das gesamte Feld der Kriminalitätskontrolle überaus folgenreich: „Im Mittelpunkt stehen heute weniger die Täter und die sozialen Umstände der Täterwerdung, sondern eher das Opfer und die Vikimisierung; es ist weniger die sozialpolitische Prävention der Täterwerdung, sondern die Prävention der Vikimisierung ist gefragt. Mit anderen Worten: weniger die Ursachen der Kriminalität, sondern vor allem das pragmatische Verhindern und Bekämpfen ihrer Symptome und Folgen stehen im Mittelpunkt“ (Boers 1991: 23 f). Gegenüber dieser Form der aktuellen Kriminalpolitik in fortgeschritten liberalen Gesellschaften waren die ersten Versuche das Opfer in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen, ziemlich genau das Gegenteil einer pragmatischen Symptombekämpfung. Der Bezug auf die potentielle Opfer und ihre Ängste findet sich seit sechziger Jahre vor allem bei US-amerikanischen Bürger- bzw. Minderheitenrechtsgruppen. Dabei war eine Verbindung zwischen einer besonderen Vulnerabilität Opfer zu werden und sozialer Marginalisierung und Machtlosigkeit angesichts relativ klar bestimmbaren, sichtbar durch Kriminalität belasteten Viertel und sozialen Gruppen verhältnismäßig einfach und anschaulich herzustellen (vgl. Garland 2001). Da der Begriff des Opfers in diesem Zusammenhang in einer Weise mobilisiert werden konnte, durch die vor allem die Ergebnisse struktureller sozialer Benachteiligungen medien- und öffentlichkeitswirksam zum Ausdruck zu bringen waren, fungierte er primär für ‚linke’ politischen Gruppen als ein Vehikel um politisch missachtete Ungerechtigkeiten anzuprangern und die Verwirklichung sozialer Bürgerrechte einzufordern (vgl. Stanko 2000). In dieser Tradition führt etwa der 1967 veröffentlichte US-amerikanische Bericht der ‚President’s Commission on Law Enforcement and the Administration of Justice’ über Kriminalität und ihre Wirkung aus, dass „many Negroes believe that if only the white community realised what the ghetto was like and how its residents felt the ghetto would not be permitted to exist” (1967: 122, zit. nach Stanko 2000: 14). Entgegen den Kriminalitätsstatistiken der Kontrollbürokratien werden Opferstudien von den Interessenvertretern subdominanter Gruppen - etwa von ethischen Minoritäten, feministischen Bewegungen, Behinderten, sexuellen Minoritäten etc. - zur Skandalisierung der in ungleiche Sozial-, Herrschafts- und patriarchale Strukturen eingebetteten und im juristischen Sinne keinesfalls immer illegalen Handlungsweisen der herrschenden Majorität ebenso verwendet, wie zur Skandalisierung 389 ihrer eigenen - insbesondere im Vergleich zu den herrschenden Gruppen - unzureichenden Teilhabe am Schutz- und Sicherheitsversprechen der Gesellschaft (vgl. Stanko/Curry 1997). Ein Rekurs auf Kriminalitätsfurcht und auf viktiomologische Erkenntnisse zur Artikulation der prekären und sozial ungerechten Lage etwa von Frauen, Kindern, Migranten und Homosexuellen findet zwar vereinzelt immer noch statt (vgl. 6. Deutscher Präventionstag 2000), wird jedoch zunehmend von einem Diskurs verdrängt, in dem die Forderungen nach einem verbesserten Opferschutz, die nicht mit der Forderung nach Abbau ungerechter gesellschaftlicher Strukturen verbunden sind, sondern mit der Forderung nach einer konsequenten Bestrafung der Täter (vgl. Kant/Pütter 1998), wobei ‚für das Opfer’ und ‚gegen den Täter’ zu sein, zunehmend synonym verwendet wird. Mit einer Verlagerung der kulturellen Hegemonie und damit verbunden der symbolischen Macht der legitimen Benennungs-, Wahrnehmungs- und Bewertungsweisen im Kontext der Krisen des fordistisch-keynesanischen Sozialstaats seit den 1970er Jahren, hat sich demnach auch die Repräsentation und die politische Funktion des Opfers verschoben. Zunächst ist die bis in die 1980er Jahre hinein typische, tendenziell sympathisierende Haltung oder gar symbolische Identifikation der Professionellen in personenbezogenen sozialen Diensten mit dem Täter als Opfer der Gesellschaft, der mit dem Opfer des Täters gewichen (vgl. Hess 2001: 334). Zugleich hat aber auch die Betonung, dass prinzipiell jeder - insbesondere dann, wenn er oder sie sich nicht risikobewusst verhält - Opfer werden kann, die Frage nach dem Risiko der Opferwerdung aufgrund gesellschaftlicher Herrschafts- und Ungleichheitsstrukturen abgelöst. Vor allem mit Rekurs auf ‚Kriminalitätsängste’ und Unsicherheitsgefühle wird ein neuer Blick auf die Schicksale und Leidenswege der Opfer induziert, der sich vor allem „auf die Belange und Interessen des ‚normalen und ordentlichen Bürgers’ [konzentriert]“ (Rüther 2001: 60). Eine solche Politik der Kriminalitätsfurcht bezieht sich weniger auf die Selektivität und soziale Irregularität des Kriminellen, sondern rekurriert auf seine Massenhaftigkeit und (potentielle) Allgegenwart und personalisiert es zugleich in der Person des (potentiellen) Täters und des (potentiellen) Opfers. Dies stellt die Basis für eine politische Figuration dar, die Jonathan Simon (1997, 2002) als ‚Regierung durch Kriminalität’ beschreibt. „We govern through crime”, so Simon (2002: 8), „when ,crime’ and its analogs becomes the occasion, the context, or the justification for efforts to shape the conduct of others. We govern through crime when ,crime’ becomes the problem through which we seek to know and act on the conduct of others. We govern through crime when ,crime’ supplies the narratives and metaphors for people who seek to make claims on those who govern”. Diese Form des Regierens durch Kriminalität perpetuiert sich auf einer legitimatorischen Ebene alleine dadurch selbst, dass Kriminalität auch als eine politische Artikulation einer „kognitiven Ressource“ interpretieren werden kann, auf die „im öffentliche Diskurs über Sicherheit bezug genommen“ wird (Reuband 2002: 10). Diese ‚Ressource’ in Form eines ‚sozialen’ Problembewusstseins ist unabhängig von dem Maße des persönlichen Bedrohungsgefühls. In Hamburg etwa ist das individuelle Bedrohungsgefühl von 1997 auf 2000 von 60 % der Bevölkerung auf 43 % gesunken. Die Einschätzung, das Kriminalität ein wichtiges, bzw. das wichtigste Problem der Stadt sei, bleibt von diesem ‚Rückgang der Kriminalitätsfurcht’ aber unberührt. Zu beiden Zeitpunkten teilen konstant etwa 52 % der Bevölkerung diese Einschätzung (vgl. Reuband 2002). Offensichtlich ist das ‚soziale 390 Sicherheitsempfinden’ sowohl relativ unabhängig von der ‚objektiven Sicherheitslage’ als auch vom persönlichen Bedrohungsgefühl. Wenn eine ‚stärkere Bekämpfung der Kriminalität’ von einem ‚Marginalproblem’, das noch im Jahr 1990 von lediglich einem Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung als ‚dringlichstes Problem’ betrachtet wird, im Jahr 2002 aber – zwar weit hinter der Frage der Arbeitslosigkeit aber deutlich vor Fragen wie etwa der Sicherung von Sozialleistungen, Bildung, Gesundheitswesen und Umweltschutz - die insgesamt zweithöchste Priorität eingeräumt wird (vgl. GFK Pressedienst 2002) und wenn in bezug auf die Frage, was der Bevölkerung ‚große Sorgen’ mache, ‚die Entwicklung der Kriminalität’ zumindest zwischenzeitlich noch vor der Arbeitslosigkeit rangiert (etwa im SOEP von 1999 und 2000, vgl. auch BAT 2002), so wird ein weiterer zentraler Aspekt der Möglichkeit einer ‚Regierung durch Kriminalität’, bzw. der ‚Nützlichkeit’ der ‚Ressource’ Kriminalität für die Governance fortgeschritten liberaler Gesellschaften deutlich: Es stellt eine zentrale gesellschaftliche Sorge dar, die sich zumindest symbolisch auch dort bearbeiten lässt, wo andere politische Probleme nicht bzw. nicht mehr effektiv oder – wie etwa im Falle von Arbeitslosigkeit, sozialer Sicherung und Umweltschutz - nicht zur einvernehmlichen Zufriedenheit möglichst aller ‚relevanten’ Gruppen und ‚Stakeholder’ bearbeitet werden können. Weatherburn und Devery (1991: 23f) erläutern den ‚self-serving cycle’, der sich aus dem politischen Vorteil einer ‚symbolischen Ersatzpolitik’ (vgl. Casper/Brereton 1984, Frehsee 1998, Peters 1998) um das Thema Kriminalität bzw. ‚law and order’ ergibt, folgendermaßen: „Governments which can be said to be unable to control important social and economic processes are always electorally vulnerable. This is true whether the government can reasonably be expected to be in control or not. No one is likely to forgive a government for rising crime rates even if they can be shown to result from rapid population growth, poor urban development or an increase in households with portable electrical goods. Influential people, with less than honourable motives, can always be found to respond to rising crime rates by saying that the government has lost control of the streets. The effect of such comments, made at the right time, can be electric. Governments of every colour can be driven to pour millions of dollars into law enforcement just to defeat a growing perception that crime is, in some sense, out of control”. Da ‚Kriminalität’ jedoch gerade in diesem Kontext als ‚politisches Phänomen’ nicht nur eine ‚objektive Realität’ ist sondern, wie Sarre (1992: 102) zusammenfasst, „determined more by issues of politics, knowledge and power, and the struggle by various political and social forces to gain and support order, to resist order and to guarantee order than by settled and revered notions of what ,crime’ is”, kann die empirische Parallelität, logische Unabhängigkeit und teilweise auch faktische Gegenläufigkeit der Verlauskurven des registrierten Kriminalitätsaufkommens, von dem demoskopisch ermittelten Maß an Kriminalitätsfurcht, der Aufmerksamkeit, der diesem Phänomen massenmedial entgegengebracht wird sowie der Intensität und Form in der es politisch thematisiert und instrumentalisiert wird kaum verwundern (vgl. Beckett 1997). Insbesondere die in der ‚Regierung durch Kriminalität’ angelegte hegemoniale Repräsentation des Opfers - dem Adressaten des ‚Kriminalitätsproblems’ - als potenziell ‚jede Bürgerin und jeder Bürger’ (Behrens 1999: 41), hat dazu beigetragen, die zumindest in manchen Varianten der Kriminalpolitik vorhandene Potenz eines sozialreformerisch intendierten Verweises auf ‚die Gesellschaft’, ‚das Soziale’ etc. zu unterminieren (vgl. Garland 2001: 11). Das Ziel einer systematischen Veränderung der Gesellschaft durch eine ‚Kriminalpolitik als Gesellschaftspolitik’ (vgl. Hoffmann-Riem 2000), ist in so 391 fern auf eine Fokussierung der je individuell Betroffenen reduziert worden: „The ultimate effect is […] to distract attention from the basic causes and to leave the primary social injustice untouched“ (Rayan 1976: 24). Diese Form der Politik der Kriminalitätsfurcht wird entsprechend weniger von im weitesten Sinne ‚staatskritischen’ sozial progressiven Gruppen getragen, sondern vom Staat und dem ihm nahestehenden Institutionen selbst. Vor allem aber ist die Politik der Kriminalitätsfurcht nicht mehr mit der Forderung nach der Verwirklichung gleicher Rechte verbunden, sondern mit einer Erweiterung der Kompetenzen der Kontrollinstanzen und mit Anweisungen zu einem individuell vorsichtigen und risikobewussten Verhalten auf Seiten der potentiellen Opfer (vgl. Stanko 2000: 25 f, O´Malley 1992, Schmidt-Semisch 2002), die eher darauf gerichtet sind, bestehende gesellschaftliche Verhältnisse zu konservieren, als zu überwinden. Die Gleichzeitigkeit einer Verallgemeinerung der potentiell von Kriminalität Betoffenen und eine Individualisierung der daraus folgenden Strategien hat sich auch deshalb durchsetzen können, weil Kriminalität auch jenseits subdominanter Bevölkerungsgruppen ein gewöhnlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens geworden ist (vgl. Garland 1996). Dies liegt nicht zuletzt an der Verbreitung der Einsicht begründet, dass Normbrüche ein massenhaftes, allgemeines statistisch normales Phänomen sind (vgl. Schmidt-Semisch 2002) und einen Teil eines generelleren ‚Risikoklimas’ moderner Gesellschaften darstellen, dem, wie es (Giddens 1991: 125) formuliert, niemand entkommen kann. Im Kontext einer Steigerung der polizeilich registrierten Kriminalität von 1950 bis 1990 um jährlich etwa 4 % in westeuropäischen Gesellschaften (vgl. H. J. Albrecht 2001b) ist die Wahrnehmung einer Bedrohung durch Kriminalität als alltägliche Erfahrung zunehmend auch zu einem Teil des Alltagsdenkens und -verhaltens jener Angehörigen der mittleren Klassen geworden, die noch vor wenigen Jahrzehnten in beruhigender Distanz hierzu gelebt hatte: „What was once regarded as localized, situational anxiety, afflicting the worst-off individuals and neighbourhoods, has come to be regarded as major social problem and characteristic of contemporary culture“ (Garland 2001: 10). Gleichzeitig ist ein solches, persönliche Unsicherheit erzeugendes, ‚Risikoklima‘ aber mehr als ein substanzhaft gegebenes Nebenprodukt gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse (vgl. Blinkert 1988). Es ist zugleich eine Art politisch erzeugtes und verwendetes Deutungsmuster in dem Kriminalität bzw. der Kriminelle eine Figur darstellt, die die Unübersichtlichkeiten und ‚Orientierungsprobleme’ gesellschaftlichen Wandelns zu verdinglichen und zu konkretisieren in der Lage ist (vgl. Hennig/Lohde-Reiff 2002). US-amerikanische Untersuchungen weisen darauf hin, dass unabhängig von den gemessenen Trends der Kriminalitätsraten, die Art und Weise, in der Kriminalitätsthemen aufgegriffen und politischen Reaktionen vorgeschlagen und gefordert werden, ein entscheidender Faktor für Entwicklung von Kriminalitätsfurcht - im Sinne der von Boers (1991) vorgeschlagenen Kategorie der ‚sozialen Kriminalitätsfurcht’ - sind (vgl. Tonry 1998) und diese selbst nicht einfach eine Reaktion auf eine gegebene gesellschaftliche Tatsache mangelnden persönlichen Schutzes ist, sondern zugleich Ausdruck von Unsicherheits-, Hilflosigkeits- und Verletzlichkeitsgefühlen aber auch von Einstellungen die politische und moralische Vorstellungen – inklusive dem Grad an Strafmentalität bzw. Punitivität – zum Ausdruck bringen (vgl. Sparks 1992, Boers/Kurz 2001, Walter et 392 al. 2002), und die zumindest teilweise eher Verärgerung und ‚Wut’ gegenüber Abweichlern, als Ängstlichkeit in einem engen Sinne signalisieren (vgl. Ditton et al. 1999, Farell/Ditton 1999). Im Kontext der Durchsetzung einer an die Stelle des politischen Einforderns individuell gültiger Bürgerrechte gerückten Betonung des ‚öffentlichen Interesses’ oder gar eines angeblichen ‚Grundrechts’ auf Sicherheit (vgl. Knemeyer 1999: 17), im Sinne eines ‚Rechts’ der Allgemeinheit auf ein Leben ohne Ordnungsstörungen (vgl. Harris/Kirk 2000: 128), kommt diesen politisch-moralischen Einstellungen in Form des ebenso politisierten wie hybriden Konstrukts ‚Kriminalitätsfurcht’ eine entscheidende Rolle zu. Der disponible bis willkürlich Gehalt einer offiziellen Politik der Kriminalitätsfurcht (vgl. Boers 2001, Walter 1995), der weniger auf die Rechte der Bürger, als auch die Ausweitung der Rechte und Interventionsmöglichkeiten der Kontrollbürokratien verweist, zeigt sich vor allem darin, dass die Furcht als Gegenstand einer fortgeschritten liberalen Kriminalpolitik - im Gegensatz zur registrierten Kriminalität - weder als Verletzung eines Rechtsguts noch als Gefährdung eines polizeilich relevanten Schutzgutes bestimmt worden ist bzw. als solches auch nicht bestimmbar ist (vgl. Waechter 1999: 812). Soweit Kriminalitätsfurcht tatsächlich mit lokalisierbaren Verhältnissen in Verbindung steht, geht es oft weniger um hohe Kriminalitätsraten im engeren Sinne, sondern eher um die Form der Verankerung der Akteure in der von ihnen erfahrenen sozialen Welt. Kriminalitätsfurcht ist in dieser Hinsicht in erster Linie ein urbanes Phänomen, dass als eine Reaktion auf die Irritationen gefasst werden kann, die ‚Umwelt-’ (vgl. Boers/Kurz 2001) bzw. ‚Alltagsärgernisse’, mangelnde ‚urbane Lebensqualität’ und lokale Verlotterungen wie schlechte Straßenbeleuchtung, Vandalismus, Jugendliche, die an Straßenecken herumlungern, sichtbar präsente ‚Randgruppen’, Betrunkene und andere Signale einer bedrohlichen Umwelt (vgl. Hanak 1996, Crawford et al. 1990: 82) bzw. Unterbietungen des sektoralen Standards moralischen Kapitals auslösen, und die sich in einer spezifischen, mit bestimmten Personengruppen und Orten verbundenen, ‚local structure of feeling‘ (vgl. Taylor et al. 1996) niederschlagen. Dabei wird die „Wahrnehmung des sozialen Raums […] zunehmend zur Ordnungsfrage: Verschmutzungen, befremdliche Personen, Graffities usf. werden als Signale des Verfalls gelesen und in Unsicherheitsgefühle umgesetzt. Daraus entstehen wiederum Ansprüche auf Gestaltung und Instandhaltung des öffentlichen Raums, die mit der objektiven Bedrohung durch Kriminalität eigentlich nichts zu tun haben, jedoch aber mit der Produktion von Angst, die sich aus dem konkurrierenden Verhältnis verschiedener Lebensstile speist“ (Lehne 1996). In einer Form der Prävention, die gegen ‚Kriminalitätsfurcht’ gerichtet ist, geht es, wie der 4. Deutsche Präventionstag 1998 in seinen Thesen und Forderungen ausführt, darum, „schon kleine Zeichen der Störung des guten Zusammenlebens und der Verwahrlosung des öffentlichen Raums erst[zunehmen]“. Konsequenterweise wird in diesem Kontext ‚Kriminalprävention’ und damit verbunden die Einflussmöglichkeiten der Kontrollinstanzen auf nahezu die gesamte Bandbreite möglicher, öffentlich sichtbarer Risiken, Gefahren, Bedrohungen und ‚sozialer Probleme’ ausgeweitet, die von der Gestaltung öffentlicher Plätze und privater Areale, über die Felder der Gesundheitsvorsorge bis zur elterlichen Erziehung ihrer Kinder reichen (vgl. Taylor 1999: 206, Frehsee 1999). So ist es keine kriminalpräventive Verirrung, sondern absichtsvoll und systematisch in den Konzepten angelegt, dass es – in Deutschland nicht anders als in Großbritannien und Frankreich - in 393 etwa zwei Drittel der, in den einschlägigen, ‚kriminalpräventiven’ Programmen und Projekten formulierten Ziele, nicht um die Verhinderung von Kriminalität selbst geht, sondern darum, das ‚soziale Miteinander’ zu verbessern, die ‚Lebensqualität’ zu erhöhen, die Sauberkeit und Ordnung in der Stadt zu gewährleisten sowie - bzw. all dies zusammenfassend – darum, die Kriminalitätsfurcht zu senken, damit wirtschaftliche Unternehmen und das soziale und kommerzielle Leben gedeihen können (vgl. Pease 1994, Tilley 1994, Hohmeyer 1999, Lindenberg 2001). Auf die letztgenannte utilitaristischökonomische Dimension bestehen vor allem Interessengruppen wie Einzelhandelsverbände, der Deutsche Städtetag und das Deutsche Institut für Urbanistik, die sich darin einig sind, dass „Sicherheit und Ordnung in der Stadt sowie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung […] im interkommunalen Wettbewerb um Standortvorteile eine große Rolle“ spielen (Witte 1998: 1, vgl. Deutscher Städte- und Gemeindebund 1998), während die Bemühungen um eine Aufwertung der Innenstädte „durch Obdachlose, Trinker, Drogenabhängige, Straßenkids und Jugendgangs, die sowohl die Besucher als auch die Kunden belästigen“ konterkariert werden (Witte 1998: 1). In diesem Sinne verlassen die auf Basis dieser ebenso ‚moralischen’ wie ökonomisch-instrumentellen Legitimationen begründeten Interventionen der Kontrollinstanzen zunehmend ihre liberal- demokratisch begründete Funktion des Schutzes gesetzlich festgelegter Rechtsgüter zugunsten einer aus den USA exportierten - Form des ‚Quality of Life Policing’, das in den Bereich von - beliebigen und unaufhebbar partikularen – Vorstellungen von Glück und ‚gutem Leben’ ebenso hineinreicht, wie in den des Hütens und Herstellens von Moral. Der dabei bemühte Begriff der ‚Lebensqualität’ stellt sich nicht als eine normative Kategorie für eine expansive ‚sozialdemokratische’ Gesellschaftspolitik dar, wie er von neo-aristotelischen Sozialphilosophen eingefordert wird (vgl. Nussbaum/Sen 1993, Sen 2000) sondern fungiert im Gegenteil als ein Synonym „für eine Verteidigungslinie gegen Vandalismus, Klein- und Jugendkriminalität [und] störende ‚Szenen aller Art“ (Prätorius 2002a: 16) und steht für Strategien, die primär auf die Durchsetzung einer bestimmten ‚Ästhetik des öffentlichen Raums’ gerichtet sind, die mehr oder weniger deckungsgleich mit den Vorstellungen und Interessen der wohlhabenden Mittelschichten ist (Franz 2000: 80). Dies wird dadurch verstärkt, dass die Polizei – in Folge einer nach betriebswirtschaftlichen Kriterien verlaufenden institutionellen Umorganisation (vgl. Boers 2001: 10) -, auf Basis gängiger Mittel und Methoden der Neuen Steuerungsmodelle und des Benchmarkings, verstärkt die marktförmigen Kategorien der Wirtschaftlichkeit sowie der ‚Kundenorientierung‘ als Qualitätsmerkmale bemüht (vgl. Lange/Schenck 2002, Posiege/SteinschulteLeidig 1999, Schmidt 2000). In diesem Kontext definiert auch sie ihren Erfolg oder Misserfolg zunehmend über die ‚Zufriedenheit’ ihrer ‚Kunden’ (vgl. Schmidt 2000 Garland 2001). Zumindest mittelbar wird damit das ‚öffentliche Gut’ Sicherheit in diverse Sicherheits- und Ordnungsangebote transformiert, die sich von einer „amtlich demokratischen legitimierten Einschätzung der Bedürfnisse des Gemeinwohls“ (Frehsee 1998a: 750) verabschieden und zu einem ‚positionalen Individualgut’ (vgl. Hirsch 1977) werden, die sich an den Partikularinteressen der am stärksten deutungs- durchsetzungsund nachfragemächtigen Gruppen orientieren (vgl. Frehsee 1998a, Hope 2002, Prätorius 2002): „Erkenntnisse über die subjektiven Aspekte des Sicherheitsgefühls, der Einschätzung der Kriminalitätssituation und der Bewertung der Polizei durch die Bevölkerung“ so skizziert das BKA 394 (1999a) das neue Dienstleistungsverständnis der Polizei, „sind für erfolgreiche ‚kundenorientierte’, d. h. bürgernahe polizeiliche und kriminalpolitische Strategien und Maßnahmen unverzichtbar“. „Public opinion and informal social control”, so radikalisiert Thomas Feltes (2000a) diese Position, „have the central role […] in defining what is crime”. In den auf die Hebung der Lebensqualität und Senkung von Kriminalitätsfurcht gerichteten Strategien der Kriminalprävention wird die Rede von Sicherheit und Ordnung von dem Begriff der ‚Kriminalität’, als die Bezeichnung eines Verstoßes gegen strafrechtliche Normen abgekoppelt, und nimmt die diskursive Funktion eines symbolischen Codes an, der eine Art Residualkategorie für alle mit wenig oder negativem moralischem Kapital ausgestatteten Lebensäußerungen oder Personen darstellt, die unterhalb der symbolischen Demarkationslinie der ‚guten Gesellschaft’ bzw. der ‚guten Gemeinschaft’ liegen (Behr 2002, Beste 2000, Prätorius 2002). Während sich das Problem von einem Problem der Kriminalität zu einem Problem von Bedrohungsgefühlen und Ordnungswünschen verschiebt, bleibt die fassbare Figur des ‚Kriminellen’ als Archetyp der Konkretisierung von Unsicherheit nicht nur bestehen, sondern ihr kommt für die symbolische Bündelung und Kommunizierbarmachung von strukturellen und abstrakten Ängsten eine wachsende Bedeutung zu8: Was „‚der Markt‘, ‚die Globalisierung‘, ‚die Qualität des Standorts‘, ‚die Konkurrenz‘ an Konkretheit zu wünschen übrig lassen (wenngleich ihre Folgen höchst konkret sind), das bietet ‚der Kriminelle‘ in reichlichem Maße“ (Legnaro et al. 2001: 20). So erwächst die ‚soziale’ und zu einem gewissen Grad auch die ‚persönliche’ Kriminalitätsfurcht, wie das ‚British Crime Survey’ bereits 1983 ausführt, nicht - oder zumindest nicht primär - aus der offiziell ermittelten Kriminalitätsbelastungsziffer und auch nicht nur aus Reflexionen über performative Veränderungen des allgemeinen städtischen oder spezifischen lokalen Formen Zusammenlebens im Sinne fixierbarer Phänomene lebensweltlich erfahrener ‚Unordnung‘ oder ‚Inzivilität‘ – so schätzen fast 80 % der Westdeutschen ihre eigene Wohngegend als ,sicher’ oder ‚sehr sicher’ ein (vgl. Noll/Weick 2000: 4) - sondern auch aus allgemeinen Sorgen über den Verfall des städtischen Lebens, Perspektivlosigkeiten, Zukunftsängste sowie anderen diffusen und unbestimmten Formen der Sorge (vgl. Lehne 1998). In diesem Sinne ist Kriminalitätsfurcht „bound up in a context of meaning and significance, involving the use of metaphors and narratives about social change“ (Sparks 1992: 131). In diesem Sinne trifft die Feststellung Franz-Xaver Kaufmanns (1987: 38 f), dass „eine wesentliche Quelle für das fortgesetzte Wachsen des Sicherheitsstrebens aus Unsicherheiten der Orientierung und nicht aus einer Zunahme der Gefahren für Ansehen, Wohlstand, Leib und Leben resultiert“, in einem besonderen Maße auch für die Rede von ‚Kriminalitätsfurcht’ zu. Dabei spricht einiges dafür, dass die ‚Unsicherheit der Orientierung’ einer Wahrnehmung der ‚substantiell’ rekonstruierbaren furchtauslösenden Phänomene der urbanen Unordnung und lokalen ‚Verlotterung’ nicht nur folgt, sondern auch vorausgeht. So legt etwa eine US-amerikanische Studie von Ralph Taylor (1999) nahe, dass furchtsame Akteure in ein und demselben Wohngebiet einen wesentlich höheren Grad an ‚Unordnung’ feststellen als weniger furchtsame Bewohner. Konsistent mit Dies zeigt sich auch daran, dass ‚Kriminalität’ bei offenen Fragen zu Ängsten und Verunsicherungen nur einen niederen Rangplatz einnimmt, während Kriminalität bzw. Kriminalitätsbekämpfung bei geschlossenen Fragen in aller Regel als besonders wichtig bezeichnet wird. 8 395 diesem Ergebnis argumentieren Rountree und Land (1996), dass ‚Disorder’ primär ein (sozial)psychologisches Konstrukt reflektiere, dessen Ursache - und nicht etwa erst deren Folge - in Gefühlen der Unsicherheit und Verletzbarkeit liege. Im diesem Sinne kann davon ausgegangen werden, dass – auch wenn ‚objektive’ Faktoren, allen voran die ‚housing quality’ wesentliche Auswirkungen auf die lokale ‚Kriminalitätsfurcht’ haben - Gefühle von Sicherheit und Unsicherheit, weniger durch die Beschaffenheit der Umwelt der Akteure, als vielmehr durch die Art der Verankerung der Akteure in ihrer erfahrbaren Umwelt bestimmt werden, wobei die normative Interpretation ihrer ummittelbaren Umwelt zentrale Dimension darstellt (vgl. Walter et al. 2002: 29, Girling et al. 2000, Austin et al. 2002). Zumindest wenn man der von Bourdieu vorgeschlagen, sozialtheoretischen Interpretationsfolie folgt, muss gleichwohl in Betracht gezogen werden, dass es dabei nicht nur um rein individuelle Einschätzungen der Akteure als einzelne Subjekte gehen kann, sondern auch die durch gesellschaftliche ‚Constraints’ präformierte ‚Objektivität’ der Umwelt selbst, eng mit ihrer symbolischhabituellen Wahrnehmung und Bewertung sowie einer differenziellen Durchsetzungs- und Kommunizierbarkeit dieser Bewertung verknüpft bleibt. In diesem Sinne finden sich Gefühle der Unsicherheit zwar vermehrt bis in die mittleren Klassen, allerdings folgt die Kriminalitätsfurcht in einem deutlichen Maße der sozialstrukturellen Verteilung sozialer Vulnerabilität und Prekarität9: das Potential an materiellen und symbolischen Ressourcen, der Grad an sozialer Verletzbarkeit und Furcht vor Kriminalität stehen in einem deutlichen Zusammenhang (vgl. Noll/Schröder 1995). So findet sich zumindest in den alten Bundesländern der Bundesrepublik - das höchste Ausmaß an Kriminalitätsfurcht in „sozial, ökonomisch und normativ [symbolisch] ressourcenschwachen Milieus“. Dabei kann ein „Zusammenhang zwischen persönlicher Unsicherheit und (in einem milieutheoretischen Sinne ausdifferenzierten) sozialstrukturellen Ressourcenmängeln“ als bestätigt gelten (Boers/Kurz 2001: 132 f, vgl. Boers/Kurz 1997). Ähnliche Ergebnisse gelten auch international. So lassen etwa, wie Christina Pantazis (2000: 433) ausführt, die Daten des ‚British Crime Survey’ keinen Zweifel daran, dass „[t]he poorest people in society suffer the greatest from a whole range of insecurities that relate to crime and the prospect of experiencing a number of non-criminal incidents including job loss, financial debts, and illness. Thus ,fear of crime’ and worry about a range of non-criminal incidents can be seen as a part of a long chain of insecurities that are experienced more actually by people lining in poverty”. Insgesamt sprechen die Ergebnisse diverser Untersuchungen - bei allen Unterschieden im einzelnen dafür, dass der phänomenologisch-materielle Gegenstand der Kriminalitätsfurcht im Kontext von ‚sozialer Desorganisation’ (vgl. Sessar 1997: 133) und symbolischen bzw. ‚moralischen’ Unterbietungen sektoral hegemonialer Standards anzusiedeln ist. Dabei stellt allerdings der so verstandene ‚Gegenstand der Furcht’ in aller Regel weder die ‚strukturelle’ Ursache für Kriminalität noch der Furcht vor derselben dar. Schon früh haben Joe Sim et al. (1987: 161) davor gewarnt, aus der Erkenntnis, dass vor allem vulernerable, durch ‚reale Abstiegsgefahren’ und eine relative Dabei stellen jedoch die neuen Bundesländer, in denen aufgrund des historischen Ausnahmecharakters eines fundamentalen Systemwechsels, besondere Gruppen von ‚Modernisierungsgewinnern’ und ‚-verlierer’ hervorgebracht 9 396 Deprivation an effektiven ökonomischen, sozialen, kulturellen Ressourcen gekennzeichnete Akteure zur Furcht vor Kriminalität tendieren, eine ‚homogene Gruppe’ zu konstruieren „united by its fear of crime, despite the everyday divisions of gender, race, income and employment“. Völlig ohne den Realitätsgehalt der Kriminalitätsfurcht in Abrede zu stellen und ohne das ebenso zynische, wie schlicht falsche Argument (dazu: Boers/Kurz 1997, Crawford et al. 1990, Jefferson/Holloway 2000, Walklate 2001a) zu bemühen, dass die Tatsache, dass es zwischen dem Vikimisierungsrisiko und der Furcht vor Kriminalität eine sehr schwache, teilweise sogar negative, Korrelation gibt10 (vgl. Crawford et al. 1990, Hough/Mayhew 1983, Young 1988, Zedner 1997), auf eine Irrationalität der Furcht selbst verweisen würde11, lässt sich argumentieren, dass im Kontext der Kriminalitätsfurcht ‚reale’ Ängste, Unsicherheiten, Ressourcenschwächen und Vulnerabilitäten zwar auf kriminelle Bedrohungen bzw. auf die Bedrohungen delegitimierter Handlungsweisen - in der Regel subdominanter Akteure – bezogen werden, aber eben nicht alleine jene ‚objektiven’ Bedrohungen durch diese Handlungsweisen wiederspiegeln, sondern generelle Ängste und Gefühle der Schwäche und Verletzbarkeit untergründig mit transportieren symbolisch artikulieren12 (vgl. Girling et al. 2000, Hale 1996, Hermann et al. 2003, Jefferson/Holloway 1997, Kunz 1997, Reuband 1993, Sessar 1998, Sessar/Weinrich 2001). In dem Maße wie Ängste und Unsicherheiten als eine ‚kriminalitätsbezogene’ Form der Furcht (Sessar/Weinrich 2001) sozial akzeptierte und politisch aufgenommene Ausdrucksformen von Schwäche und Vulnerabilität darstellen (vgl. Koskela, 1997), sind sie nicht zuletzt Modalitäten einer defensiven, individuierten Antwort auf eine Reihe struktureller öffentlicher Unsicherheiten (vgl. Loader 1997: 156), die dadurch erst erzeugt, geformt und verstärkt worden sind, dass zugestandene und geschützte individuelle und soziale Rechte - als die Basis für das Gegenstück individuierter Unsicherheit, nämlich dem generalisierten sozialen Vertrauen (vgl. Karstedt 2001, Walklate 1998a, 2000) - im Kontext einer neoliberalen Sozial-, Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik massiv in Frage gestellt worden sind. Gedeckt wird diese Annahme empirisch etwa dadurch, dass das Sicherheitsgefühl – abgefragt durch den auch in Kriminalitätsfurchtsurveys typischen Indikator nach dem „Gefühl von Sicherheit nachts auf der Straße“ (Delhey/Newton 2002: 21) - sich in internationalen Studien als vergleichsweise guter Indikator für ‚allgemeines Vertrauen’ erwiesen hat (vgl. Delhey/Newton 2002, Walklate 1998a), wobei persönlicher Erfolg, Lebenszufriedenheit, vergleichsweise geringe soziale Spaltungen und Konflikte sowie Vertrauen in demokratische Institutionen weitere zentrale Indikatoren für soziales Vertauen sind (vgl. Delhey/Newton 2002), das - wurden auch eine historisch temporäre Ausnahme in der Entwicklung von Unsicherheitsgefühlen dar, die nicht unbedingt einer primär durch sozialstrukturelle Ungleichheit erklärbaren Verteilung folgen. 10 In diesen Kontext gehört auch das sogenannte ‚Kriminalitätsfurcht-Paradox’. 11 Es geht dabei in aller Regel um Gruppen die subjektiv oder objektiv wenig Möglichkeiten haben sich zu ‚wehren’ und zusätzlich einer Reihe unterschiedlicher (psycho-)sozialer Belastungen ausgesetzt sind. Das Gefühl des Kontrollverlustes im Kontext von Vikimisierungsrisiken, ist bei diesen Gruppen schon alleine deshalb stärker ausgeprägt da ihre (‚Coping’-) ‚Reserven’ schlicht geringer sind als bei ressourcenstarken Gruppen (vgl. Hale 1996, siehe auch Boers/Kurz 2001) 12 Kriminalität kann insofern auch als eine Chiffre oder ein Code betrachtet werden (vgl. Kunz 1997, Sessar 1998). Reuband (1993: 47, vgl. auch Girling et al. 2000) spricht davon, dass „Kriminalitätsfurcht mehr als nur Reaktion auf objektive Bedrohung [sei], sie ist zugleich Metapher für einen Wandel, der subjektiv für den einzelnen undurchschaubar ist und bedrohlich wirkt“ 397 kaum überraschender Weise - deutlich klassenspezifisch ungleich verteilt ist (vgl. auch Deutsche Shell 2002). In diesem Sinne findet sich in dem kriminalpolitischen Rekurs auf die Kriminalitätsfurcht ein merkwürdiger Gegensatz: Zunächst kann die ‚Regierung durch Kriminalität’ (vgl. Simon 1997, 2002) bzw. durch ‚Kriminalitätsfurcht’ – selbst wenn sich argumentieren lässt, dass in dem, was als ‚Kriminalitätsfurcht’ thematisiert wird, zu einem guten Teil soziale Unsicherheiten und Statusängste mitschwingt (vgl. BAT 2002) und dass diffuse Befürchtungen und Verärgerungen „auf die Kriminalitätsthematik projiziert und daran festgemacht“ werden (Reuband 1993: 47) – nicht zu Unrecht für sich reklamieren, die Sorgen sozial schwacher und verletzlicher Gruppen ernst zu nehmen (vgl. Hess 2000, Matthews 1987). Weil die Einschätzung, dass der Schutz vor Kriminalität nicht verwirklicht sei, sich vor allem in den gesellschaftlichen Klassen unterhalb der Mitte findet (vgl. Noll/Weick 2000: 2) kann sich die gewählte Alternative zu einer sozialpolitischen Bearbeitung struktureller Prekarisierungen in Form einer symbolischen Symptombekämpfung durch eine vorverlagerte und ausgreifende Kriminalpolitik als eine Politik darstellen, die gerade die Interessen der sozial Verletzbaren unterstützt. Zugleich lässt sie aber die Basis dieser Verletzbarkeit und die Ausweitungen der ‚Zonen der Verwundbarkeit’ (vgl. Castell 1996) unbearbeitet: das ‚Ernstnehmen’ der Sorgen verwundbarer sozialer Gruppen entfaltet sich weniger in einer Politik der Sicherung ‚sozialer Sicherheit’ als in einer ‚Sicherheitspolitik’, die sich in einer kaum verhohlenen Offensivität gegen sichtbare sozial, ökonomisch, kulturell und vor allem symbolisch ebenso deprivierte wie entwertete ‚Randgruppen’ richtet. An den realen Unsicherheiten und Ängsten in der ‚Zone der Verwundbarkeit’, etwa bei den ostdeutschen ‚Verlierern’ des Wiedervereinigungsprozesses (vgl. Ewald 2000) oder in ‚ressourcenschwachen Milieus’ und bei Akteuren, denen es an ‚Coping-Fähigkeiten’ mangelt um mit (potentiellen) Bedrohungen umzugehen (vgl. Boers/Kurz 1997, 2001, Jefferson/Holloway 1997, 2000; zur Frage der ‚unqual victims’ Crawford et al. 1990, Pantazis 2000, Walklate 2001a), ändert der ‚Gefühlsansatz’ in der Kriminalpolitik (vgl. Walter 1995) jedoch wenig. Im Gegenteil sprechen klassische wie moderne Studien dafür, dass kriminalpolitische Ansätze auf der Ebene der oberflächlichen Symptombekämpfung – insbesondere wenn sie darauf zielen, potentielle Opfer ‚aufzuklären’ und in kriminalpräventive Aktivitäten einzubeziehen – eher paradoxe Wirkungen auf die soziale wie individuelle Kriminalitätsfurcht zeitigen: So sind auch in der Bundesrepublik furchtreduzierende Effekte - insbesondere einer kommunalen Kriminalprävention - bisher nur behauptet, aber empirisch nicht festgestellt worden (vgl. Boers/Kurz 2001), während britische und US-amerikanische Studien einen solchen Effekt insgesamt nicht bestätigen (vgl. Boers/Kurz 2001, Hope 1995, Sherman et al. 1997), sondern vielmehr in bezug auf eher marginalisierte Stadtteile – in denen die soziale Vulnerabilität und Kriminalitätsfurcht ohnehin überdurchschnittlich groß ist - häufig einen zusätzlich furchterzeugenden Effekt nachweisen konnten, weil kriminalpräventive Anstrengungen die öffentliche Wahrnehmung von Risiken verstärken und gerade dadurch eine wachsende Furcht stimulieren (vgl. Garafalo 1979, Zedner 1997 2000, Kreissl 2000). 398 Demgegenüber weisen Untersuchungen darauf hin, dass durch verschiedene präventive Bemühungen in Mittelschichtvierteln ein wesentlicher Aspekt der Kriminalitätsfurcht dadurch reduziert werden kann, dass das wechselseitige Vertrauen innerhalb eines ‚Sozialraums’ vergrößert wird. Allerdings geht es dabei in aller Regel um eine Form des Vertauens, dass gestärkt wird „when a community shares a set of moral values in such a way as to create expectations of regular honest behaviour“ (Fukuyama 1996: 153). Dieses Vertrauen bezeichnet keine generalisierte Vertrauensformen, die sich auch auf Fremde und sozial nicht-gleichrangige Personen und sowie die Duldung oder gar Anerkennung anderer, eigensinniger Lebensäußerungen bezieht, sondern ein personales Vertauen, dass als die symbolische Form des ‚bindenden’ Sozialkapitals ein exklusives Gut darstellt (vgl. Hope 2001), das sich aus den engen Beziehungen zwischen den mit viel sektoral dominantem ‚moralischem Kapital’ ausgestatteten, feldspezifisch je Vertauenswürdigen (vgl. Stenson 1996) ergibt und dabei die symbolischen Demarkationslinie zu ‚den anderen’, denen mit erhöhtem Mistrauen zu begegnen ist, verstärkt bzw. erst konstituiert13. In diesem Sinne wird eine Dynamik reflektiert, die Richard Sennett (1998) als ein konstitutives Element für die ‚Kultur des neuen Kapitalismus’ thematisiert hat. Im Kontext einer Ausweitung und Verschärfungen von sozialen Verunsicherungen rekonstruiert Sennett (1998: 190) eine Vermehrung defensiver Konstruktionen kollektiver Identitäten, die sich im Sinne eines „‚Wir’ als Abwehr gegen Verwirrung und Entwurzelung“, auf eine feindseligen Abgrenzung gegenüber nichtzugehörigen Minderheiten wie Immigranten, Fremde, Arme und Außenseiter stützt, die des sozialen Kapitals des Vertrauens nicht würdig sind. Es scheint daher angemessen, die Reaktionen im Kontext der ‚Kriminalitätsfurcht’, der sozialen Verunsicherungen im Kontext der Ausweitung von Risiken der Armut und Arbeitslosigkeit, sowie Spaltungsprozesse, die sich in Ausweitungen der relativen Deprivation und verstärkten Einkommenspolarisierung in so fern in einen Zusammenhang zu stellen (vgl. die Beiträge im Jahrbuch Liber 99/00), dass sie nicht nur gravierende Effekte für die unmittelbar betroffenen Gruppen haben14, sondern auch die mittleren und höheren Klassen unter Druck setzen und deren Exklusionsneigungen verstärken (vgl. Hess 2001): „The lower the absolute standard of living of the lower classes“ so führt Lipset bereits mitten im ‚goldenen Zeitalter’ des sozialen Staates der 1960er Jahren aus, „the greater the pressure on the upper strata to treat the lower as vulgar, innately inferior, a lower caste beyond the pale of human society“ (Lipset 1976: 66). Robert Altemeyer (1998: 184) geht - in Anschluss an Banduras soziale Lerntheorie – soweit, Autoritarismus im wesentlichen durch die Erfahrung der Welt als einem ‚dangerous place’ zu erklären, und auch Detlef Oesterreich (1996: 108) spricht in seiner ‚Autoritarismustheorie’ davon, dass die ‚Flucht in die Autorität’ „ihre motivationale Grundlage in Angst und Verunsicherung“ finde. Nach einer Studie von Farrall et al. (2000: 409) gilt zumindest für Männer ganz allgemein, dass „not trusting stragers is associated with feeling more safe“. 14 Als ein Resultat gesellschaftlicher Spaltungs- und ‚Prekarisierungsprozesse‘ (Bourdieu 1998, 2001a) spricht Joachim Hirsch (1999: 6) von einer „generalisierte[n] Angst und eine[r] nur scheinbar paradox damit verbundene[n] Verstärkung konservativer Orientierungen an Werten wie Disziplin, Autorität und persönlicher ‚Leistung’, die in einem klaren Widerspruch 13 399 Auch wenn sich eine solche einseitige Form der Erklärung und Begründung des Autoritarismus insgesamt kaum aufrechterhalten lässt (vgl. Adorno 1973, Sanford 1973), ist es empirisch weitgehend unstrittig, dass sich Ängste in der Regel sozialstrukturell nach unten richten. Dabei werden sie vor allem auf Beobachtungen des ‚moralischen Verfalls’ als jene Lebensäußerungen projizierte, die nicht mit den sektoral hegemonialen Formen moralischen Kapitals ausgestattet sind und manifestieren sich z.B. in den Ängsten von autochtonen Mitgliedern der mittleren Klassen über den Zuzug ethnischer und sozial marginalisierter Minoritäten15 oder vor anderen Änderungen in ihrer Nachbarschaft16 (vgl. Skogan 1986: 138, vgl. Zedner 2001). Schon alleine weil sich das Bedrohungsgefühl der Bevölkerung in einem höheren Maße auf die unmittelbar sichtbaren ‚life style crimes‘ richtet (vgl. Hassemer 1999: 14), während etwa die ‚crimes of the suits‘ (vgl. Walklate 1996) oder die ‚Abweichung der Angepassten‘ (vgl. Frehsee 1991) als Projektionsflächen für Kriminalitätsfurcht nahezu völlig bedeutungslos sind17, lässt sich das Zentrum des Bedrohungspotentials gegen das sich eine Ordnungspolitik der Kriminalitätsfurcht formiert, vergleichsweise einseitig bei ‚der Jugend’ (vgl. Frehsee 1998b: 743) und vor allem bei den Trägern jener performativen Lebensstile lokalisieren, die der sektoralen Hegemonie, dem moralischen Kapital der praktischen Ökonomie und der feldspezifisch dominanten ‚Doxa’ zuwiderlaufen. In diesem Kontext geht es dann weniger um strafbare Handlungen, sondern vor dem Hintergrund einer bestimmten Semiotik der Aneignungsstrukturen in einem sozialen Raum ist die zum Ausdruck gebrachte Furcht vor Kriminalität „routinely […entangled] with other aspects of economic, social and moral life […] and draw lines of affiliation and distance between ‚us‘ and various categories of ‚them‘“ (Sparks et al. 2001: 896). So ist ein beträchtlicher Teil dessen, was in einschlägigen Surveys unter ‚Kriminalitätsfurcht’ firmiert, nicht zuletzt Ausdruck moralischer Empörung oder sozialer Verachtung gegenüber Abweichlern (vgl. Ditton et al. 1999, Farrall et al. 1997) als jene Akteure, die die je feldspezifisch gültige symbolische Demarkationslinie der Respektabilität unterschritten haben18 (dazu Vester et al. 2001). In einer Untersuchung zum Urteil von Bewohner über den Wandel der Sicherheit zur sowohl beruflichen wie privaten Lebensrealität stehen. Es ist diese Mischung von Konservativismus und Angst, die die Menschen verstärkt an die bestehenden Verhältnisse kettet“. 15 Dass sich das ‚Streben nach Sicherheit’ auf bzw. gegen die Figur des ‚Ausländers’ richtet, gilt für die Bundesrepublik im internationalen Vergleich in besonderem Maße (vgl. Zedner 2001: 210). 16 Hier geht es dann allerdings nicht darum, dass die in den Blick genommen Populationen ihrem Verhalten nach ‚objektiv‘ oder ‚subjektiv‘ riskant oder unangepasst wären, sie sind vor allem unpassend. 17 „Als besonders gravierende Einflussfaktoren für Kriminalitätsangst“ so die Ergebnisse einer Studie des BKA (1999a) „stellen sich Überfälle oder Einbrüche in der eigenen Gegend heraus, die jeden zweiten Befragten beunruhigen oder sogar in Angst versetzen. Es folgen schlechte Beleuchtung/dunkle Ecken, Rauschgiftkonsum oder -handel in der Öffentlichkeit und Schlägereien auf der Straße, die für etwa jeden dritten oder vierten Grund für Beunruhigung oder Angst geben. Aber auch Vandalismus, ‚herumlungernde’ Personen oder Anpöbeleien in der eigenen Gegend beunruhigen oder verängstigen etwa jeden fünften Befragten […]. Vor allem als Belästigung werden Schmutz/Müll, Betrunkene/,Penner’ oder aufdringliche Bettler in der eigenen Gegend empfunden“. In anderen vor allem jüngeren Studien wird der besonders große Effekt in Bezug auf die Auslösung von Kriminalitätsfurcht wie auf die Zuschreibung eines Bedrohungspotentials beschrieben, beschrieben, das von subjektiven Problemen mit vielen Ausländern und Asylbewerbern, sich langweilenden, nichtstuenden Jugendlichen, Betrunkenen sowie von Schmutz und Müll in öffentlichen Räumen ausgeht (vgl. Hermann/Laue 2003, Janssen/Schollmeyer 2001). 18 Die Politik der Kriminalitätsfurcht, die sich als eine Politik für die Interessen darstellen kann, die vor allem auch von Bevölkerungsgruppen in den Zonen sozialer Verwundbarkeit artikuliert werden, richtet sich ‚objektiv’ selbst gegen jene Gruppen, deren soziale Verwundbarkeit und Machtlosigkeit am deutlichsten und sichtbarsten ausgeprägt ist. 400 in der Wohngegend kommt etwa Reuband (2003: 99) zu dem Ergebnis, dass „weniger als 5 % der Befragten Veränderungen der Kriminalität vor Ort [... erwähnen]. Weitaus häufiger werden […] allgemeine Veränderungen in den Normen und Verhaltensweisen der Bevölkerung (wie weniger ‚Solidarität’ etc.) oder zu geringe Strafen genannt“. Neben der Abhängigkeit von prekären sozialen Positionierungen, gilt es als empirisch gesichert, dass die Wahrnehmung von Bedrohungen durch diese Gruppen mit generellen politisch-weltanschaulichen Einstellungen und Präferenzen verbunden ist (vgl. Boers/Kurz 2001: 132). ‚Kriminalitätsfurcht’ ist selbst in dem engen Sinne einer wahrgenommenen, persönlichen Bedrohung durch die Gefahr, die einer inkrimierten Handlungsweise zugeschrieben wird, kriminalsoziologisch betrachtet eine von mehreren ‚Kriminalitätseinstellungskomponenten’ (vgl. Boers 2001a), d.h. Ausdruck einer (politischen) Einstellung zu Fragen von Konformität und Anständigkeit. So weiten Studien darauf hin, dass „Befragte mit eher materialistisch-rechtskonservativen politischen Grundüberzeugungen […] deutlich mehr Unsicherheitsgefühle [zeigen,] als eher postmaterialistisch-linksliberal eingestellte Bürger/innen“ (Rüther 2001: 61 f): Während die Ängste und Befürchtungen im weitesten Sinne ein Produkt von erfahrenen, erwarteten oder zumindest als möglich betrachtetet ‚Verlierergeschichten’ sind, gibt es, wie etwa die etwa dies Untersuchungen von Uwe Ewald (2000) nahe legen, deutliche Hinweise dafür, dass ein hohes Maß an persönlicher (Kriminalitäts-)Furcht mit einer stärkeren Befürwortung rigider und disziplinierender Reaktionen Seitens des staatlichen Gewaltmonopolisten (‚law and order’) einhergeht (siehe auch: Rüther 2001, kritisch: Reuband 1992), oder zumindest mit der Einschätzung, dass Verbrechensbekämpfung eine der dringlichsten Aufgaben sei (vgl. Reuband 1993, 2003): „Die steigende ‚Verbrechensfurcht’, ausgedrückt und auch verstärkt durch die Boulevardmedien und deren Forderung an die Politik etwas gegen die ‚überhandnehmende’ Kriminalität zu tun [dazu: Beckett/Sasson 2000], führ[t] meist zu […] Maßnahmen […] sich oftmals nur in schärferen Gesetzen und härteren Sanktionen erschöpf[en]19. Damit traf und trifft man allerdings den Wunsch großer Teile der Bevölkerung, welche die Lösung des ‚Kriminalitätsproblems’ vor allem in härteren Sanktionen sehen - auch das ein immer wieder gefundenes Resultat internationaler Kriminalitätsforschung“ (Kury/Obergfell-Fuchs 2003). Teilweise erheblich verhärtete punitive Einstellungen (empirisch: Kury 1999, 2001) werden – unabhängig davon ob, sie nun kausal von der Kriminalitätsfurcht abhängen oder nicht - von einer offiziellen Kriminalpolitik als Politik gegen die Kriminalitätsfurcht adaptiert. Wie Galbraith (1992) in seinen Ausführungen zur ‚Kultur der Zufriedenheit’ nachgezeichnet hat, sind die Parameter der Politik ja im Wesentlichen dadurch bestimmt, was die steuerzahlenden Mittelklassen zu (er)tragen bereit sind. Gerade bezogen auf die Gegenstrategien der Kriminalitätsfurcht kann von einer „relativ starken Entkopplung von struktureller Problemlage [… und dem] zum Anliegen erhobenen sozialen Problem“ (Karstedt 1999: 88) ausgegangen werden. Eine solche Konstellation erleichtert interessegebundene Forderungen nach weiteren und verstärkten Formen der Kontrolle und Regulation symbolisch problematisierbarer Lebensäußerungen erleichtert, die vor allem von den „von sozialem Wandel bedrohten Gruppierungen […erhoben werden], die die Gefährdung ihrer eigenen Position und ihres Status in einem Konflikt über Lebensstile transportieren“ (Karstedt 1999: 88). Im Kontext einer vor 401 dem Hintergrund der Ausweitungen sozialer Verunsicherungen erfolgenden ‚Radikalisierung’ bedrängter Mittelschichten (vgl. Brand 1989, 1990) ist diese eine wesentliche Grundlage politisch artikulierter Forderungen nach Verstärkungen und Verschärfungen der Kontrollinterventionen insbesondere gegenüber dem Verhalten sozialer und ethnischer Minderheit20. Folgt man dem Jeremy Travis - dem Direktor des US amerikanischen National Institute of Justice - ist das was Beckett (1997: 8) als ‚demoracy at work’ bezeichnet, d.h. eine gesellschaftliche Besorgnis über steigende Kriminalitätsraten und unzureichende Bestrafung, auf die politisch mit dem entsprechenden ‚legalen Ressourcen’ im Sinne von Strafverschärfungen und Ausweitungen der Kompetenzen der Kontrollbürokratien und der zur Verfügungsstellung von ökonomischen Kapital, als Erhöhung des Budgets dieser Institutionen – aber auch mit einer entsprechenden Umorientierung beispielsweise der Sozialbürokratien (vgl. Wacquant 2001) - reagiert wird, durchaus nicht a-typisch: „The fear of crime may create a groundswell of public opinion favouring a […] more oppressive responses to crime; the governmental authorities may translate this popular demands into directions or expectations of the police, prosecutors and judges to ,get tough’; the laws would then be enforced too stringently, rights would be violated, harsh punishments imposed, all in the name of preserving domestic peace” (Travis 2000: 10). Aus einer makro-sozialen Perspektive betrachtet, stehen die im Kontext einer gesteigerten Strafmentalität erhobenen Forderungen und ihre politischen Umsetzungen in einem erkennbaren Verhältnis zum Ausmaß an Wohlfahrtsstaatlichkeit (vgl. Alber 2001, Ludwig-Mayerhofer 2000). Dies bedeutet nicht, dass Marginalisierung und Kriminalität in einem einfachen Kausalverhältnis in der Form stehen, dass ein ausgebauter Sozialstaat durch seine Existenz Kriminalität und Devianz abschaffen könne. Eine Relation findet sich eher auf zwei anderen Ebenen. Zum einen wird, wie Stuart Hall (1998) ausführt, jene von Ewald (2000) thematisierte persönliche Furcht (‚personal fear’) dadurch genährt, dass ein fortgeschritten liberaler Regulationsstaat, Verantwortlichkeiten zur Risikovermeidung auf die Akteure selbst disaggregiert. Bei einer Reduzierung kollektiver sozialer Risikoabsicherung durch einen aktiven Wohlfahrtsstaat, so das Argument, werden die Risiken und Ängste individualisiert und zu persönlichen Angelegenheiten (zum zersetzenden Effekt residualer sozialer Absicherung auf generalisiertes soziales Vertrauen siehe umfassend Rothstein 2001 und Rothstein/Stolle 2001). Zum anderen erscheint es in diesem Kontext aber politisch in einem besonderen Maße opportun, gerade dort als symbolisches Substitut sozialer, kollektivistischer Absicherung auf die sozial ausgegrenzten, ‚entkoppelten’ und ‚gefährlichen’ Gruppen mit Ordnungspolitik zu reagieren, wo sozialpolitische Gestaltungsmächtigkeit zurückgedrängt und aufgegeben wird (vgl. Wacquant 2000). Der Unwille bzw. die Unfähigkeit soziale Sicherheit erzeugen und die Erprobung einer ‚Politik der sozialer Unsicherheit’, die scheinbar notwenige ‚Flexibilisierung’ selbst voranzutreiben, lässt sich auf einer symbolischen Ebene durch die politische Betonung persönlicher Sicherheit und eine Die Verabschiedung des ‚Gesetzes zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten’ (1997) kann als ein besonders markantes Beispiel hierfür betrachtet werden. 20 So ist es beispielsweise ein zentrales Ergebnis des Eurobarometer-Reports der Europäischen Kommission (1997: 11), über Rassismus und Ausländerfeindlichkeit in Europa, dass es zwar kaum einen Zusammenhang zwischen tatsächlicher, aktueller Arbeitslosigkeit und Xenophobie gäbe aber „[t]he fear of loosing one’s job appeared to be a much more important factor”. 19 402 demonstrative bzw. expressive Form der Aufrechterhaltung innerer Sicherheit kompensieren (vgl. H.J. Albrecht 2001, Garland 2001, Legnaro 1998): „[D]er Nationalstaat, der als Sozialstaat eine Abfederung der strukturellen Gewalt der Ökonomie versprach, [nimmt] dieses Versprechen schrittweise zurück[…]. Damit wird die einzig verbleibende außerökonomische gesamtgesellschaftliche Sicherheitsgarantie eingeschränkt. Staatliche Politik bedarf in der Folge einer anderen Legitimationsgrundlage und findet diese im Kampf gegen Kriminalität und Gewalt, von denen wir angeblich alle bedroht sind“ (Scherr 1998). Wie Zygmunt Bauman (1998, 2000) ausführt, beinhaltet der deutsche Bergriff Sicherheit all jene Elemente, die im englischen Sprachraum als ‚safety’, ‚security’ und ‚certainty’ verhandelt werden. Die Ausprägungen dieser Elemente stehen unweigerlich in Korrespondenz zur Form, zum Modus und zur Reichweite gesellschaftlicher Organisation. Unabhängig davon, ob fortgeschritten liberale Gesellschaftsformen nun als durch die ‚Herrschaftsform Prekaritiät’ gekennzeichnet (vgl. Bourdieu 1998), als ‚labile Ordnungskonstruktion’ (Soeffner 2000), als ‚Risiko-’ (Beck 1986) oder als ,zerbrechliche Gesellschaften’ (Stehr 2001) rekonstruiert werden, scheinen sich sehr verschiedene Theoretiker und Gesellschaftsdiagnostiker in einem zentralen Punkt mit Zygmunt Bauman (2000: 35 vgl. Sachße 1990) einig zu sein: „Sicherheit is the prime victim of the late modern career of individual freedom“ oder, wie es Giddens (1990) formuliert, eine ‚ontological uncertainty’ erscheint als die zentrale ‚Konsequenz der Moderne’. Da eine solche Form der Freiheit - bzw. ‚Freisetzung’ (Marx) - des Individuums eine Basis, aber auch ein zentrales Versprechen der bürgerlichen Gesellschaft ist und es insbesondere auch das philosophisch zentrale und legitimatorisch starke Argument des ‚theoretischen Neoliberalismus’ ist, die Betonung der ‚negativen Freiheit’ (dazu: Berlin 1987) noch einmal zu forcieren (vgl. Hayek 1949, Nozick 1974), ist es nicht ‚irrational’21 wenn auch eine ,neo-soziale’ Form der Regulation des ‚NeoLiberalismus’ die Frage der Sicherheit gerade nicht in einer Weise verhandelt wissen möchte, die die ökonomisch, ideologisch und politisch gewünschte und geforderte Form der Autonomie der sozialen Akteurs in als solche in Frage stellt. Der rationale Gehalt, bzw. der ‚gesellschaftliche Nutzen von Law and Order’ (vgl. Bauman 1998) liegt darin, dass Sicherheitsversprechen zumindest symbolisch vor allem dort aufrecht zu erhalten, wo es die gewünschte Freiheit ab wenigsten stört - bzw. in diesem Bereich umso mehr zu betonen - je umfassender es in den anderen Bereichen zurückgenommen wird: Während die ‚existential security’ und die ‚psychological certainty’ (Baumann 1998: 16) durch eine (sozial)staatlich vergesellschaftete Form der Absicherung (‚socialized prudentialism’ O’Malley 1992) nicht mehr umfassend gewährleistet werden kann oder soll werden Fragen der ‚personal safety’ (vgl. Bauman 1998, 2000), in den politisch-regulatorischen Mittelpunkt gestellt. Die Konjunktur der Rede eines ‚Rechts auf Sicherheit’ bezieht sich nicht auf das Feld des Sozialen und nicht auf die Sicherheit sozialer Garantien. Rational, so klärt das Wörterbuch der Philosophischen Begriffe auf, ist gleichbedeutend mit ‚vernünftig’ d.h. im Gegensatz zu empirisch, durch Verstandesdenken gewonnen (vgl. Hoffmeister 1955). Mit Bezug auf die politischen Regulationsrationalitäten in fortgeschritten liberalen Gesellschaftsrationalitäten mag dies zwar ‚in-human’ bzw. im Sinne des Egalitarismus ‚a-liberal’ sein, aber im Gegensatz zu den Ausführungen einiger Kritiker (vgl. z.B. Humanistische Union 1994, Kunz 1998a, Neue Kriminalpolitik 2/1998) eben gerade nicht ‚irrational’ in dem Sinne, dass es nicht durch Verstandesdenken entstanden sei. 21 403 Das Spannungsverhältnis von Freiheit und Sicherheit bleibt dabei zwar bestehen, verkehrt sich aber in einer sozialtopologisch betrachtet selektiven Weise: Mit Blick auf das Spannungsverhältnis von Sicherheit und Freiheit im Wohlfahrtsstaat (vgl. Sachße/Engelhardt 1990) wird die Sicherheit von ‚neoliberaler’ Seite nicht zuletzt deshalb kritisiert, weil sie die Freiheit der ‚Geschickten’ und ‚Fleißigen’ – die, wie die libertäre Ideologie glauben manchen will ja gerade ob dieser Eigenschaften in der Topologie des sozialen Raums oben stehen – zu Gunsten der überbordenden Ansprüche nach (sozialer) Sicherheit einschränkt, die durch jene Akteure artikuliert wird, die – weil ihnen Fleiß und Geschick fehlen - unten stehen (vgl. Kersting 2000). Demgegenüber ist es im aktuellen Diskurs der Sicherheit nun vornehmlich die ‚personal safety’ der erstgenannten, die auf Kosten der Freiheit letzterer - bzw. zugunsten der Freiheit der ‚Geschickten’ und ‚Fleißigen’ von letztgenannten (vgl. Murray 1990) - aufrechterhalten werden soll (vgl. Fitzpatrick 2000, Lianos/Douglas 2000). In diesem Sinne lässt sich argumentiert, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber dem Problem von Devianz und Kriminalität in nahezu sämtlichen fortgeschritten liberalen Gesellschaften nicht nur dem Vormarsch eines ‚strafenden Staates’ geschuldet ist, sondern auch der Form der Umgestaltung des Sozialen selbst (vgl. Garland 2001, Wacquant 2000, Sack 2003). Die dominante Überzeugung, dass der Sozialstaat die ‚Verantwortungslosigkeit’, ‚Versorgungsmentalität’ und ‚individualistische Selbstauflösungen‘ induzieren würde und damit solidarischer Werte verstören, kommunitäre Strukturen unterminieren und die moralische Basis der Gesellschaft aushöhlen würde, hat - wie ausgeführt - weitreichende für eine neo-soziale Neukonstitution des Sozialen, die wesentliches Gewicht auf persönliche Verantwortung und kommunitäre ‚Solidarität’ legt. Die darin angelegte Verschiebung von der ‚interventionsstaatlichen’ Implementation von Rechten und der Redistribution von ökonomischen Kapital zu einer ‚regulationsstaatlichen’ Aktivierung von Human- und Sozialkapital als Modus Operandi einer Governance des Sozialen stellt den Hintergrund für eine – weitgehend ‚asoziologische’ (vgl. Low 1999) – disaggregierte Neubestimmung ‚sozialer Probleme’ dar, in deren Kontext zugleich der Bearbeitung bestimmter Formen von Problemen, allen voran dem Problem individueller Non-Konformität, Priorität eingeräumt wird22: offensichtlich ‚passt’ das Interesse an der Verhinderung an Devianz - als Verstoß eines individuellen Akteurs gegen eine auf moralischem Kapital basierte Ordnung - zu einer solchen Reformulierung des Sozialen und seiner Regulation besser, als beispielsweise das Problem der Armut - zumindest wenn es nicht als ‚individuelles Versagen’ sondern als strukturelle Positionierung eines Akteurs im sozialen Raum thematisiert wird (vgl. Bourdieu 1999). Es ist bezeichnend, dass sowohl bei Putnams als auch - und noch eindeutiger - bei Etzionis sozialpolitischen Ausführungen auffällig häufig auf ‚Kriminalität’ rekurriert wird. Auch James S. Coleman (1990) konzeptualisiert soziales Kapital als ein Mittel, das dazu dient Gruppennormen aufrecht zu erhalten und durchzusetzen (vgl. dazu Haug 1997, Portes 1998). Diskurslogisch ist ein Fokus auf das Phänomen der Devianz im Zusammenhang mit neo-sozialen Regulationsweisen alleine in so fern nicht verwunderlich, weil diesem im Kontext der Beobachtung dass „heute der Begriff der ‚Solidarität’ oder der der ‚Tugenden’ eine neue Konjunktur erfährt“ (Nagl-Docekal 2003: 302) eine augenscheinlich größere Bedeutung zukommt als im ‚sozialtechnologischen’ Projekt des ‚sozialen Staates’. In dem Maße wie ‚Pathologien des Sozialen’ (vgl. Honneth 1994) ‚moralisiert’ werden, erhält auch die auch die Frage von Abweichung ein neues Gewicht und vor allem eine neue symbolische Gewichtung. Die Moralisierung des Sozialen zeigt sich etwa daran, dass Kritiker betonen, dass sich in dem Maße wie „den Rechten und der Empfängerseite Vorrang“ eingeräumt wird eine „immer größere Entfernung des Gerechtigkeitsanliegens vom Tugendinteresse“ zeigt (O’Neill 1996: 183, 185). Dasselbe trifft offensichtlich auch umgekehrt zu: ein Abbau von Rechten und eine ‚Angebotsorientierung’ in der Sozial- wie Kriminalpolitik (vgl. Sack 2003) geht mit einem neo-konservativen Tugenddiskurs einher. 22 404 Die Möglichkeit eine ganze Palette ‚sozialer Probleme’, inklusive Armut und sozialer Deprivation, als Kriminalitäts- bzw. kriminalitätsbezogene Probleme umzudefinieren (vgl. Frehsee 1998, Benner/Groenemeyer 2000) - und damit auch in diesem Sinne das Soziale ‚durch Kriminalität zu regieren’ (Simon 1997, 2002) - findet in einer solchen Neufiguration des Sozialen einen ihrer Ausgangspunkte. Sie beschreibt die Gegenposition zur fordistisch-keynesanischen Formulierung des Sozialen, in dem ‚Kriminalität’ zumindest der Tendenz nach eher als ein Symptom und phänomenologischer Ausdruck eines tieferen sozialstrukturellen Problems – als das ‚wirkliche’ Problem - gefasst worden ist (vgl. Sparks/Loader 2002). Die sich aus diesen Formen der Reorganisation sozialer Ordnung speisende, tendenzielle ‚Ersetzung’ der Sozial- durch eine Kriminalpolitik in den USA bzw. die kriminalpolitische ‚Unterlaufung’ der Sozialpolitik in westeuropäischen Gesellschaften (vgl. Wacquant 2001), richtet sich dabei vornehmlich auf - bzw. gegen - sozial und kulturell subdominante, zumindest aber auf Gruppen, von denen nennenswerte politisch-symbolische Gegenmobilisierungen nicht zu erwarten sind. ‚Ideologisch’ wird dieser ‚Verdrängungsprozess’ durch eine punitive Haltung gestützt, die vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Spaltungen, sozialer Ungewissheit und Prekarität - gepaart mit einer wachsenden Betonung individueller statt sozialer Verantwortung (vgl. Suhling et al. 2002) – eine deutlich Zunahme erfährt (vgl. Kury 1999, Kury/Ferdinand 1999, Sessar 1997, international: Roberts/Hough 2002). Diese Haltung wird von politisch ‚wichtigen’ gesellschaftlichen Gruppen geteilt: sie findet nicht mehr nur innerhalb des traditionellen und absteigenden Kleinbürgertums sowie Teilen des traditionellen Arbeitermilieus Anhänger, sondern breitet sich auch zunehmend auch in den Reihen der einstigen Träger des ‚sozial-liberalen’ Common Sense’, der liberalen Mittelschicht aus (vgl. Hess 2001: 333, Heitmeyer et al. 2002). Die politische Befriedigung punitiver Bedürfnisse ist zwar mit einem nicht geringen finanziellen Aufwand verbunden, sie gibt aber in Zeiten, in denen eine umfassende, auf Ausgleich gerichtete Sozialpolitik nicht nur als unbezahlbar, sondern als ‚kontraproduktiv’ für die ökonomischen Entwicklungen in einen nationalen Wettbewerbsstaat betrachtet wird den politisch Verantwortlichen eine der wenigen verbleibenden Chancen, auf schnelle und dramatisch sichtbare Weise Stärke, Handlungskompetenz, Wirkmächtig- und Durchsetzungsfähigkeit zu demonstrieren23 (vgl. Beckett 1997, H.-J. Albrecht 2001, Krasmann 2003). Die ‚Politik der Härte’ hat über ihre Wirkung als symbolisches politisches Kapital zu fungieren (vgl. Lange et al. 1998, Hitzler/Peters 1998) hinaus, einen weiteren symbolischen Nutzen, der mit einer ‚neuen Gemeinschaftsorientierung’ und mit jener defensiver Konstruktion kollektiver Identitäten verbunden ist, die Sennett (1998) als ein Merkmal des ‚flexiblen Kapitalismus’ beschreibt. Genauer, sie ist damit verbunden, dass eine gemeinschaftsbezogene kulturell-solidarische Form der ‚Sozialintegration’ zunehmend an die Stelle des Primats einer aktiven sozialstaatlichen Gesellschaftsbzw. ‚Systemintegration’ rückt. 23 Selbst wenn eine rhetorische und durchaus auch faktische Demonstration von Härte einer ‚symbolischen Politik’ (vgl. Lange et al. 1998, Hitzler/Peters 1998) auch in der Bundesrepublik beobachtet werden kann erreicht diese in keiner Weise das Ausmaß und die Rhetorik wie sie bisweilen in den Vereinigten Staaten vorherrscht. Dort hat Newt Gingrich das Programm der US-amerikanischen Republikaner in sechs Worten zusammengefasst: „low taxes and the death penalty“ (zit. nach Sarat 2000) 405 Im Anschluss an Durkheim (1973, 1977) lässt sich Gemeinschaftsorientierung als Moment eines sozialen Sinnzusammenhangs beschreiben, in dem das individuelle Bewusstsein mehr oder weniger mit dem ‚Kollektivbewusstsein’ korrespondiert. Während es ganz offensichtlich völlig ausgeschlossen ist, dieses Merkmal gering arbeitsteiliger, ‚primitiver’ Gesellschaften in ausdifferenzierten fortgeschritten liberalen Gesellschaften tatsächlich in einem ‚objektiven’ Sinne wiederherzustellen, können die aktuellen kommunitaristisch geprägten Aktivierungspolitiken durchaus als Versuche einer symbolisch inszenierten ‚Simulation’ von Gemeinschaft verstanden werden (vgl. Kreissl 1987). Versteht man nun Strafe im Kontext dieser Simulation, so kann ihr eine symbolische Funktion attestiert werden, die erheblich von ihrer technologischen‚ spezialpräventiven Funktion im Strafmodernismus des ‚Straf-Wohlfahrtskomplexes’ (dazu: Garland 1981) divergiert. Folgt man Durkheim (1973), reagiert Strafe im Kontext ‚mechanischer Solidarität’ auf die Gefährdung einer die soziale Kohäsion sichernden moralischen Ordnung, die dem Kollektivbewusstsein zu Grunde liegt. Dabei ist die Strafe nicht nur expressiver Ausdruck dieser Ordnung der Gemeinschaft, sondern auch ein aktives Moment ihrer Erzeugung und Erhaltung. Sofern Strafe diese Funktionen erfüllen soll, ist eine Politik demonstrativer Härte (vgl. Ryan 1999) – man denke etwa an die affektive, moralischen Empörungen unterstreichenden, sichtbaren Strafspektakel, die Foucault (1994) am Beginn seiner Ausführungen in ‚Überwachen und Strafen’ beschreibt – ‚funktionaler’ als jene ‚technologisierten’ Formen der Sanktion, die aus dem Sichtfeld ‚öffentlichen Meinung’ verschwindet und in dem Versuch eines auf Expertenwissen von – scheinbar ‚verständnisvollen’ (vgl. Stenson 2001) - Professionellen mündet Abweichler weniger zu strafen, als zu behandeln, zu besseren, zu erziehen und zu heilen24. Mit Bezug auf eine solche kommunikative Funktion der Strafe geht es jedoch es primär um eine symbolische Darstellung, bzw. wie es Bauman (2000c) formuliert, um die öffentliche Demonstration von ‚Anständigkeit’ - und nicht darum, dass die Härte auch ‚real’ vollzogen wird: „Formen der Vergemeinschaftung über ein geteiltes und verinnerlichtes System von Werten bedürfen zur Stabilisierung der Ordnung eines Mechanismus der expressiven Symbolisierung moralischer Grenzen. […] Wichtig für die Charakterisierung dieser Form der sozialen Kontrolle ist […] zunächst einmal ihr eher unsystematischer, exemplarischer, vor allem auf ein Publikum bezogener, expressiver, symbolischer und affektiver Charakter und weniger die Punitivität im quantitativen Sinne“ (Gronemeyer 2001: 116). Die Demonstration der Härte kann einer veränderten Form der Staatlichkeit und in diesem Zusammenhang veränderten Rationalitäten in den Regulationsstrategien zugeordnet werden25, der eine gesellschaftliche Grundstimmung korrespondiert, in der die in 1970er Jahren dominierenden Zwar kann in der Bundesrepublik keine Rede sein von Strafen, die im Anbringen von öffentlich sichtbaren Kennzeichnung am Rechtbrecher bestehen, wie sie beispielweise Amitai Etzioni verteidigt bzw. fordert (vgl. Weltwoche vom 30.10.1997), oder von der öffentliche Demütigung in ‚Chain Gangs’ ‚gemeinnützige’ Arbeiten zu verrichten bzw. dem ‚Return of the Wheelbarrow Men’, wie ihn John Pratt (2000) beschreibt. Allerdings sind Inszenierungen von Bedrohungen, auf die mit Inszenierungen und medial vermittelten Demonstrationen von Härte reagiert wird auch in der Bundesrepublik zu erkennen. 25 War es die traditionelle Aufgabe des intervenierenden Staates, das legitime Recht und die Mittel für sich zu beanspruchen, nach denen die Angelegenheiten auf einem bestimmten Territorium zu regeln sind um historische Kontinuität zu gewährleisten, die Fluktuation von Angebot und Nachfrage auszubalancieren und nicht nur für die physische Sicherheit, sondern auch für die soziale Absicherung potentiell aller Gesellschaftsmitglieder zu sorgen, so kann für fortgeschritten liberale Gesellschaften davon gesprochen werden, dass sowohl die Herstellung umfassender sozialer Sicherheit gemäß des keynesianischen Regulationsmodus angesichts des national nicht mehr regulierbaren globalen Kapitals zunehmend schwierig wird (vgl. Fitzpatrick 2000) und vor dem Hintergrund der ökonomischen Rationalität eines globalisierten 24 406 Selbstverwirklichungs- und Freiheitsbestrebungen den Bedürfnissen nach Harmonie, Sicherheit, Ordnung und Gemeinschaft Platz machen26 (vgl. Hradil 2003). Vor diesem Hintergrund lässt sich davon sprechen, dass nicht nur die Perspektive des ‚Sozialen’ ihren strukturierenden Charakter im Feld der Kriminalitätskontrolle eingebüßt hat, sondern auch mit Blick auf das spannungsreiche Verhältnis von Moral und formalem Recht im Kontext einer symbolischen Kriminalpolitik und einer stärkeren Beachtung des ‚subjektiven’ Dimension des Sicherheitsdiskurses d.h. jener „empfundenen Unsicherheiten [die sich] auch jenseits kriminalisierungsfähiger Handlungen vermehrt“ haben (Lindenberg/Schmidt-Semisch 1996: 304) - ein Bedeutungsgewinn des ‚moralische Kapitals’ verzeichnet werden kann. Dabei verliert die Feststellung eines Rechtsbruchs nach justiziellen quasi-universellen Regeln ihren zentralen Stellenwert im Feld der Kontrolle. Eine ebenso entscheidende Demarkationslinie stellt die Unterscheidung von vertrauenswürdigen von nicht-vertrauenswürdigen Akteuren dar, wobei die zonalen praxislogischen Ökonomien einzelner sozialer Felder zunehmend die Referenzgrößen markieren, nach den sich diese Unterscheidungen bemessen. Wie es Barbara Hudson (1997: 465 f) formuliert, etabliert sich damit ein neues Kontrollnetz in dem „die Unschuldigen genauso gefangen werden wie die Schuldigen, es operiert genauso stark mit den Unterscheidungen Mitglied/NichtMitglied, ortsansässig/nicht-ortsansässig, kreditwürdig oder nicht kreditwürdig, wie mit der Unterscheidung kriminell/nicht-kriminell“. Standortwettbewerbs zugleich die Erfordernisse der Bearbeitung einer unsicheren (Risiko-)Gesellschaft gegenüber der Bearbeitung einer ungleichen Gesellschaft in den Vordergrund rücken. 26 Dabei hat sich die Prioritätensetzung in Einstellungen der Bevölkerung von der sozialen zur persönlichen Sicherheit verschoben. So beurteilten 1998 knapp drei Fünftel der Westdeutschen und fast 70 % der Ostdeutschen den Schutz vor Kriminalität als ‚sehr wichtig’, wobei dieser im Westen in der Rangfolge der Wichtigkeit der Lebensbereiche noch vor Arbeit und Einkommen steht (vgl. Noll/Weick 2000). Zugleich ist die Zufriedenheit in diesem Bereich bei der Bevölkerung außerordentlich niedrig: „Jeder zweite Westdeutsche sieht Mängel beim Schutz vor Kriminalität […während nur etwa] jeder dritte […] Defizite bei der sozialen Sicherheit [beklagt]. In den neuen Bundesländern meinen sieben von zehn Bürgern, daß die öffentliche Sicherheit“ nicht verwirklicht ist (Buhlmahn 2000: 6). In diesem Kontext ist die Verschiebung der politischen Agenda weg von der Kompensation positionaler sozialer Differenzen zu der Frage der Distribution und effektiven Kontrolle von Risiken (vgl. Ericson/Carriere 1994) politisch und legitimatorisch rational. Die sozialen Relationen, die durch ein globales Laissez-Faire auch vom nationalen und lokalen Staat als Mitbewerber in der Standortkonkurrenz destabilisiert werden, lassen sich auf diese Weise in sublimierter Form um so umfassender restabilisieren, je effektiver und unverzichtbarer sich der Staat als Kontrollarrangeur präsentieren kann. Dabei zeigt sich eine komplexe widersprüchlich aufeinander bezogene Gleichzeitigkeit von Ent- und Verstaatlichung eines (gesellschafts-) regulatorischen Anspruchs. Während Deregulierungserfordernisse und ebenso wie Forderungen nach einem ‚Rückzug des Staats’ in zahlreichen sozialen und politischen Feldern zentralen Bestandteil der polistisch-ideologischen Agenda fortgeschritten liberaler Gesellschaften darstellt, beziehen sich zugleich die ‚zivilgesellschaftlich’ artikulierten wie politisch (zentral-)staatlich induzierten Reflexe auf Bedrohungen der inneren wie der äußeren Sicherheit auf einen archetypischen Staat als deren Garanten. Aus der Perspektive des symbolischen Machterhalts ist es keine politische Irrationalität des Staates, viele der Risiken als diskursiv konstituierte Potentialität zuzulassen oder gar als ‚alternative’ soziale Probleme selbst simulieren. Es ermöglicht ihm in seiner Rolle als die aufrechterhaltende Instanz der Ordnung und Garant für Stabilität aus der Perspektive des Kapitals im Standortwettbewerb attraktiv zu bleiben und sich auch gegenüber den unteren Chargen einer ungleichen Gesellschaft zu legitimieren. Dies ist eine Form der Politik, die wenn man dem Sozialhistoriker Charles Tilly folgt deutliche Paralellen zu mafiösen Schutzkartellen aufweist: „To the extent that the threats against which a given government protects its citizens are imaginary or the consequence of its own activities, the government has organized a protection racket“ (Tilly 1985: 171). In diesem Sinne ist der Staat, der sich zurückzieht nur der makro-interventionistische Staat, der sich gegenüber den als potentielle Bedrohungen für den Anständigen Bürger wie den ökonomischen Standort und die Lebensqualität in den Städten redefinierten Gruppen wie ethnische und kulturelle Minderheiten, Bettler Straßenhändler, Arme und Jugendliche als starker und durchgreifender Staat auf der Mikro-Ebene rematerialisiert: „Nicht länger fähig die basalen Bedürfnisse zu treffen, wendet er sich an die basalen Ängste – oft auftretend als der gleichzeitige Erzeuger und Lösung dieser Ängste“ (Fitzpatrick 2000: 13) 407 In diesem Sinne wird die ordnungsgenerierende Potenz des ‚legalen Kapitals’ sukzessive durch die je feldspezifisch hegemoniale Form des symbolischen Kapitals verdrängt. Sie reflektiert weniger quasiuniversalistische Standards einer „Gleichheit des Dürfens […, die] mit großen Unterschieden in der Lebensführung“ vereinbar ist (vgl. Steinvorth 2003: 168 f) - sondern Standards, die auf (partikular)gesellschaftlichen Wirklichkeitskonstruktionen und Werturteilen über alle möglichen sektoral unästhetischen, unpassenden, dysfunktionalen, nicht-konformen, problematischen, ärgerlichen, irritierenden, riskanten etc. Handlungsweisen beruhen - und mündet in Versuchen einer prä-inzidentalen Identifizierung der diesen Handlungsweisen mutmaßlich zugeneigten Gruppen. Eine solche Verschiebung erfolgt der Tendenz nach zu ungunsten symbolisch subdominanter Akteure, da sie die Schutzfunktionen des Rechts und die legalistischen Einbindungen der Kontrollinstitutionen unterminiert: Reflektierte die „Staats- und Rechtsform […] eher die Auswirkungen von Klassenkonflikt als die Oktroyierung des Willens der herrschenden Klasse“ (Michalowski 1988: 49) und durchbricht ein durch legales Kapital organisierter relativ autonomer Staat im Zweifelsfall die Partikularinteressen der durchsetzungsfähigen Klassen, so werden nun die Partikularinteressen und sozialräumlichen Gestaltungsvorstellungen je feldspezifisch dominanter Gruppen einseitig aufgewertet. Sie verfügen, um es spielerisch zu formulieren, nicht nur über ein überdurchschnittliches Quantum an Spielmitteln im Sinne von Ressourcen, um sich gemäß gegebener Spielregeln profitabel zu bewegen, sondern sie können die Spielregeln selbst, die bisher vom Staat durchgesetzt waren, unmittelbarer denn je selbst geben. Die Annahme, dass die Sicherheitsgewinne sektoral hegemonialer Gruppen in dem Maße wie die ‚subjektive Kriminalitätsfurcht’ zu einem zentraler Faktor in der Betrachtung des Sicherheitsrisikos wird, mit den Freiheitsspielräumen der subdominanten Klassen bezahlt werden (vgl. Frehsee 2000) ist demnach keinesfalls abwegig. IV. 2 GETTING TOUGH - DIE HARTE HAND DES MANAGEMENTS IV. 2.1 NORMALITÄT DES VERBRECHENS, NORMALE VERBRECHER UND SANKTIONSVERZICHT 1995 führt Richard Posner, der vorsitzende Richter des höchsten US- Bundesgerichts, in einem Essay über die Grundmerkmale einer effektiven Kontrollpolitik folgendes aus: „Es ist eine plausible Annahme, wenn nicht mehr als das, dass die Schaffung neuer Rechte für kriminelle Täter in den sechziger Jahren zu einer steigenden Kriminalitätsrate durch nachlassende Abschreckung und ‚incapacitation’ beigetragen hat, während die Erhöhung der Strafen seit 1980, vielleicht auch der konservative Trend der Bundesjustiz infolge der veränderten Besetzungspolitik unter der Reagan- und Busch-Administration, die kriminalitätsfördernden Einflüsse demographischer, sozialer, kultureller und ökonomischer Faktoren, die die Kriminalität in vergleichbaren Ländern haben steigen lassen, und sicherlich auch in den USA wirksam sind, kompensiert haben“ (Posner 1995: 4, zit. nach Sack 1998: 91). Demgegenüber gibt Posner zwei anderen, den fordistischen Strafwohlfahrtskomplex zumindest rhetorisch dominierenden Strategien eine deutliche Absage: dem „erfolglosen Experiment […] Gefängnisinsassen zu rehabilitieren“ und der anderen „Strategie, die sich nicht zu verfolgen lohnt“ nämlich dem Versuch die fundamentalen Ursachen der Kriminalität zu eliminieren (Posner 1995: 3). 408 Was vielleicht besonders überraschen mag ist es, das er trotzdem keinesfalls der Ansicht ist, dass alle Formen des Rechtsbruchs konsequent zu verfolgen und durch Einsperrung zu eliminieren sind. Im Gegenteil er setzt sich mit Nachdruck dafür ein, bestimmte Delikte zu entkriminalisieren und dabei hat er nicht - zumindest nicht nur - die Delikte der Wirtschaftsmächtigen im Blick, sondern eher die ‚normalen’, ‚alltäglichen’ Kriminalitätsphänomene. Zur selben Zeit in der die ‚symbolische Funktion’ des Strafens aufgewertet wird (vgl. H.-J. Albrecht 2001, Kunz 1998) und sich die Gefängnisse stärker den je mit Populationen füllen, die zu arm sind um mit Geldstrafen belegt, oder in einem zu hohen Maße Außenseiter sind, um (re)integriert zu werden (Pilgram 1998), scheint das Gefängnis seine Bedeutung für die ‚gewöhnliche Kriminalität’ der ‚normalen’ Bevölkerungsgruppen zu verlieren. Sebastian Scheerer (1996) argumentiert, dass für diese ein weites ‚Netz’ der Kontrolle innerhalb der Gesellschaft existiert bzw. hergestellt wird, dass über einen differentiellen Grad an Dichte der ‚Maschen’ verfügt. Diese Dichte hängt weniger von ‚sozialen’ Überlegungen ab, sondern wird vor allem durch eine auf der Basis der von Sicherheits- und Effizienzüberlegungen kalkulierende Rationalität gesteuert. In diesem Sinne kann von einem deutlichen Wiederspruch zwischen den symbolischen und im engeren Sinne funktionalen Aspekten des Gefängnisses gesprochen werden27, der sich im Umgang mit Abweichlern in Form eines ‚Gabelungsprozesses’ (vgl. Bottoms 1980) manifestiert: Es finden sich höhere Einsperrungsraten für Teile der Bevölkerung, die - abstrahiert man von ihrer symbolischen Demonstrations- bzw. Kommunikationsfunktion - von einem gleichzeitigen ‚funktionalen’ ‚Bedeutungsverlust’ des Gefängnisses für die normalisierende Organisation der Gesellschaft begleitet werden (vgl. Deleuze 1991, O’Malley 1999a, Scheerer 1996, Sparks 2001a). So spricht etwa Stan Cohen (1994: 72) von einem ‚Ende der Ideologie’ in bezug auf die einst prägende Rolle des Gefängnisses als ein konstitutiver Bestandteil der auf die Verwaltung menschlichen Lebens und seiner Eingliederung in den Produktionsapparat gerichteten ‚Einschließungsmilieus’ der ‚Disziplinargesellschaft’ (vgl. Foucault 1994) und einer „ascendancy of managerial, administrative and technocratic styles“ der Kriminalitätskontrolle an dessen Stelle. Diese Form der ‚Bedeutungslosigkeit’ des Gefängnisses hat ironischerweise damit zu tun, dass auch alltagspraktisch deutlich wird, was Durkheim schon 1895 in den ‚Regeln der soziologischen Methode’ ausführt: ‚Kriminalität ist normal’. „Seit Beginn des vergangenen Jahrhundert“ so Durkheim, „besitzen wir in der Statistik das Mittel, die Entwicklung der Kriminalität zu verfolgen; überall ist sie im Wachsen begriffen […] offenbar ist sie mit den Bedingungen eines jeden Kollektivlebens auf das engste verknüpft“ (Durkheim 1961: 156) Der Clou der These, dass ausgerechnet die Ausweitung des Verbrechens zu einem relativen Bedeutungsverlust der Strafe führt, liegt nun darin, dass wenig ausdifferenzierte Gesellschaften – mit Durkheim Gesellschaften, unterschiedliche die auf Handlungsoptionen mechanischer anbieten Solidarität und mithin beruhen auch - die relativ entsprchend wenige wenige David Garland (2001) vertritt die im Kern nicht unplausible These, dass die punitiv-symbolische Funktion vornehmlich von politischen, die instrumentell-mangerielle vornehmlich von administrativen Akteuren im Feld der Kriminalitätskontrolle getragen wird. 27 409 Lebensäußerungen unter Strafe stellen, es sich erlauben können und zur Sicherstellung der Wertintegration in die ‚conscience collective’ auch erlauben ‚müssen’, möglichst alle Abweichungen zu sanktionieren. Obwohl das Gesamtsystem einer modernen, ausdifferenzierten Gesellschaft nicht mehr auf der Basis eines gemeinsamen ‚Kollektivbewusstseins’ organisiert werden kann und es daher nicht mehr funktional erscheint, ein solches Kollektivbewusstsein qua Strafe für jede Abweichung aufrecht zu erhalten (vgl. Bettmer 2001, Groenemeyer 2001), finden sich auf der Ebene der punitiven Rhetorik - und ihrer ‚materiellen’ Auswirkungen - Tendenzen genau hieran im Sinne einer verstärken Begründung der Strafe als ‚Integrationsprävention’ anzuschließen (vgl. Müller-Tuckfeld 1998, 2000). Eine solche Integrationsprävention impliziert, die den Straf-Wohlfahrtskomplex dominierende Präventionsrationalität einer direkten Handlungs-, und Haltungsnormierung in den Hintergrund treten zu lassen zugunsten einer symbolischen Bestärkung des Rechtsvertrauens bzw. des Vertrauens der (mehr oder weniger rechtstreuen) Allgemeinheit in einen starken, sie beschützenden Staat. In diesem Sinne rückt die durch ein symbolisches Strafrecht aufrechterhaltene Stabilität des Gesellschaftssystems an Stelle des Subjektstatus des Täters (vgl. Albrecht 1999). Um diese symbolische Funktion zu erfüllen, ist es jedoch nicht notwenig möglichst alle Rechtbrüche zu bestrafen, wichtig erscheint eher die demonstrativ-kommunikative Komponente des Strafens. Die Bestrafung von allen Rechtbrüchen ist, wie Heinrich Popitz (1968) in seiner vielzitierten Arbeit über die ‚Präventivwirkung des Nichtwissens’ nachzeichnet, für integrationspräventive Ziele nur dann sinnvoll, wenn die Normbrüche als Ausnahme definiert sind. Ab einem gewissen Ausmaß wird jede weitere Entdeckung und Sanktionierung von Abweichungen für das Ziel der symbolischen Gesellschaftsintegration kontraproduktiv - zumal bei einer faktischen Zunahme an Normverstößen immer breitere Schichten und auch ‚wohlanständige’ Bevölkerungsgruppen von (punitiven) Justizmaßnahmen bedroht wären (vgl. Janssen 1983: 48). In modernen, fortgeschritten liberalen Gesellschaften ist nicht nur dieses Maß erreicht, sondern mehr noch lässt sich davon sprechen, dass Abweichungen – inklusive formeller Rechtbrüche - ein Ausmaß angenommen haben, dass einen umfassenden Sanktionsanspruch, unabhängig von seiner symbolischen Sinnträchtigkeit, rein technisch unmöglich macht: Moderne Gesellschaften sind wie es David Garland (1996, 2000) formuliert ‚Hochkriminalitätsgesellschaften’: Gesellschaften, in denen Kriminalität nicht nur in empirischer, sondern auch zunehmend in normativer Hinsicht eine normale, alltägliche soziale Tatsache ist, „a routine part of modern consciousness, an everyday risk to be assessed and managed […] a standard background feature of our lives“ (Garland 1996: 446). Von unterschiedlich begründeten Schwankungen im einzelnen abgesehen, ist in längeren Zeitreihen betrachtet ein mehr oder weniger permanent steigender Trend der registrierten Kriminalitätsraten in der Tat ein bedeutsames Merkmal moderner Gesellschaften (vgl. Brusten 1999, Haferkamp 1980a, Karstedt 1999a, 2001e): „[C]rimes increased in all social classes in all Western states, and stabilized at relatively high level“ (Wouters 1999: 429). Auch in der Bundesrepublik hat die Rate der jährlich registrierten Kriminalität bereits in den 1960er Jahren eine historisch unbekannte Größenordnung angenommen. Seit 1970 ist diese Rate in Gesamtdeutschland von ca. 2,53 bis 3, 11 Millionen (ungefähr 2,41 Millionen West plus zwischen 410 ungefähr 126000 und etwas unter 700000 in der DDR)28 auf ungefähr 6,75 Millionen im Jahr 1993 gestiegen und hat sich 2001 bei etwas über 6,3 Millionen Delikten (ohne Verkehrs- und Staatsschutzdelikte) eingependelt (vgl. BMI 2002). Die offizielle Kriminalitätsbelastungsziffer liegt im Jahr 1970 bei 3924 Delikten pro 100000 Einwohner29 und hat sich 2001 mit 7736 registrierten Delikten30 nahezu verdoppelt (vgl. BMI 2002). Seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass nicht mehr als ein Zehntel der begangenen Straftaten überhaupt registriert wird (vgl. Kury in Die Welt vom 13.3.2002). Diese Schätzungen werden von den Ergebnissen einer Untersuchung von Karstedt-Henke und Crasmöller (1988) zum Dunkelfeld von Jugendlichen in Münster und Bielefeld bestätigt nach der durchschnittlich nur fünf Prozent aller Delikte der Polizei bekannt werden. Bei diesen fünf Prozent geht es jedoch um Aufklärungsraten während die Polizeiliche Kriminalstatistik Registrierungsraten benennt. Sofern man das Ergebnis dieser Studie jedoch verallgemeinern kann (vgl. dazu Karstedt 2001), in Betracht zieht, dass die Aufklärungsquote der Polizei zum Erhebungszeitpunkt der Studie bei insgesamt bei etwas unter 50 % lag, das Dunkelfeld im Falle von ‚Jugendkriminalität’ in aller Regel geringer, d.h. die polizeiliche Aufklärungsquote hier teilweise erheblich höher ist als im Durchschnitt aller Delikte (vgl. Heinz 2002, Sessar 1997), und darüber hinaus auch bei Dunkelfeldbefragungen nicht alle Delikte zugegeben werden (vgl. Hermann/Weninger 1999) scheint die Zehn-Prozent-Annahme in keiner Weise eine Übertreibung darzustellen. Hinter den 6,36 Millionen Delikten, von denen die Polizeiliche Kriminalstatistik im Jahr 2001 spricht, würde sich dann eine Gesamtzahl in der Größenordnung von etwa 60 Millionen Delikten pro Jahr verbergen31. Dabei hat sich nicht nur die Wahrscheinlichkeit Opfer einer strafrechtlich sanktionierbaren Handlung zu werden drastisch erhöht (vgl. Garland 1997), sondern wie Gabour (1994) nachzeichnet, gibt es auch deutliche Hinweise darauf, dass ‚jeder es tut’ (dazu: auch Frehsee 1991, Garland 1999, Karstedt 1999a, 2001e). Schon alleine ob dieser Zahlen bleibt, wenn auch nicht auf einer normativsymbolischen, so doch auf einer technologisch-strategischen Ebene, zu einem pragmatischen Umgang mit Kriminalität kaum eine Alternative: Die Gesellschaft bzw. genauer der Staat kann es sich aus Gründen der Ideologie, der Ökonomie und der politischen Rationalität nicht mehr erlauben, zu versuchen alle Abweichungen aufzudecken, geschweige denn justiziell zu verhandeln und zu sanktionieren (vgl. Taylor 1997). 28 Die 126000 ergeben sich aus einer eigenen Berechnung einer Kriminalitätsbelastungsziffer von offiziell (und ebenso ideologisch wie illusorisch) ca. 740 pro 100000 und ca. 17 Mio. Einwohner. Die Zahl von etwas unter 700000 (2,41 Mio./61 x 17) ergibt sich aus der (ebenfalls unrichtigen, in diesem Fall viel zu hoch gegriffenen) Annahme einer gleich hohen Kriminalitätsrate in Ost und West 29 die Zahl bezieht sich auf die alten Bundesländer 30 die Zahl bezieht sich auf Gesamtdeutschland 31 Dies deckt sich auch mit Untersuchungen zur persönlichen Viktimisierung, wobei nur ein Bruchteil aller Delikte ein solche Vikimisierung nach sich ziehen. Da es in der Bundesrepublik keine systematischen ‚Crime victim surveys’ gibt, kann die Viktimisierungsrate von ‚privaten’ Einzelpersonen nur geschätzt werden. Führt man sich vor Augen, dass diese Vikimisierungsrate im Jahr 1999 in Frankreich bei 21 %, in den Niederlanden bei 25 % und in England und Wales bei 26 % liegt31 (International Crime Victims Survey 2000, zit. nach: Barclay/Tavares 2002: 17), ist anzunehmen, dass sich auch die Bundesrepublik hiervon nicht wesentlich abweicht, so dass die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit mindestens einmal Opfer irgendeiner Straftat zu werden bei etwa 20 - 25 % pro Jahr liegen dürfte. 411 Diese Zunahme kann als das Resultat gesellschaftlicher Entwicklungen betrachtet werden, in der der langfristige Kriminalitätsanstieg im Wesentlichen im Sinne einer „proportionale[n] Abschöpfungen [verstanden werden kann], die recht exakt der sektoralen Entwicklung des Bruttosozialproduktes im legalen Bereich folgen” (Kerner 1996: 47), aber auch von Entwicklungen im Feld der formellen Kriminalitätskontrolle selbst. Informelle, gemeinschaftliche Formen sozialer Kontrollen können vor allem in auf Konsens, Wechselseitigkeit und physischer Ko-Präsenz basierten Gemeinschaften Wirksamkeit entfalten (vgl. Brint 2001), während Kontrolle in modernen ausdifferenzierten Gesellschaften verrechtlicht formalisiert und institutionalisiert wird (vgl. Black 1984, Christie 1986, Kreissl 1987, Müller-Tuckfeld 2000). Schon alleine daraus folgen vergleichsweise hohe Raten amtlich registrierter Kriminalität in modernen Gesellschaften. Aus dieser Warte kaum überraschend belegt eine jüngere USamerikanische Längsschnittstudie den Zusammenhang von polizeilicher Produktivität und Kriminalitätsrate, nämlich eine deutlich positive Korrelation zwischen einem polizeilich registrierten Kriminalitätsanstieg und einem sowohl technischen als auch personellen Ausbau der Polizei in den Jahren 1973-1992 (vgl. O´Brian 1996). Ein nicht unerheblicher Teil der Kriminalitätsrate ist in diesem Sinne disponibel32 (zusammenfassend: Young 1994). Dieses Phänomen findet sich nicht nur auf der Ebene der Rechtsdurchsetzung, sondern auch im Bereich der Rechtssetzung. Wie Reinhard Kreissl und Fritz Sack (1998: 11) ausführen, ist das Recht in modernen Gesellschaften „zunehmend Instrument zur Verallgemeinerung von Partikularansprüchen […]. Auf durchdringende Verrechtlichung aller gesellschaftlichen Lebensbereiche. Und das Organisiere ich nämlich einen Handlungsbereich nach rechtlichen Gesichtspunkten, Differenz von legal und illegal ein. Es handelt sich um die Ironie des Rechtsstaats, der Bereich des illegalen Handelns ausdehnt“. diese Weise entsteht eine fördert die Kriminalität: so führe ich die zentrale durch sein Wachstum den Bezogen auf das alleine qua juristischem Kapital bestimmte ‚Konzept der Kriminalität’ steigt demnach die Kriminalität analog zum Anwachsen der Gesetze (vgl. Kreissl 1999). Tatsächlich ist die offizielle Kriminalitätsrate im Anschluss an die Entkriminalisierungen im Zuge der großen Strafrechtsreformen Ende der 1960er beträchtlich gesunken (vgl. Brusten 1999). Jedoch endet „die Phase materiellrechtlicher Entkriminalisierung [… etwa ab dem Jahr] 1975 […] . Die 80er und 90er Jahre sind durch eine Zunahme strafbewehrter Verbote gekennzeichnet, durch eine ‚Hypertrophie des Strafrechts’“ (Heinz 2000: 139). Dabei ist es durchaus bemerkenswert, dass diese ‚Hypertrophie’ stärker für die ‚liberalen’ Wohlfahrtsregime zutrifft, als für die angeblich besonders stark rechtlich regulierten Sozialstaaten. So sind etwa in den USA sind „mehr Verhaltensweisen und Handlungen unter Strafe gestellt […] als in den meisten nicht-islamischen Gesellschaften“ (Sack 1998: 88). Hierauf macht auch der ‚Erste Periodische Sicherheitsbereicht’ der Bundesregierung am Beispiel der Gewaltdelikte aufmerksam: „So konnte in den USA gezeigt werden, dass nach den Befunden des seit 1973 kontinuierlich durchgeführten National Crime Victimization Survey (NCVS) die schwere Gewaltkriminalität im Jahre 1999 den niedrigsten Stand seit 1973 erreicht und um 53 % zurückgegangen war. In demselben Zeitraum hatte die polizeilich registrierte schwere Gewaltkriminalität nach den Daten des Uniform Crime Report (UCR) um mehr als das Doppelte zugenommen“ (BMI/BMJ 2001: 73). 32 412 Gleichwohl lassen sich die gestiegenen Kriminalitätsraten nicht alleine auf Veränderungen im Feld der Kriminalitätskontrolle und der Organisation seiner Instanzen zurückführen. Im europäischen ‚Crime Prevention Sourcebook’ (2001) werden als Gründe für die Zunahme von Kriminalität und Unsicherheit vor allem folgende Dimensionen genannt: Auf „urbanisation (and the exodus from rural areas) government policies (,free market’, withdrawal of public service subsidies, collapse of communism in the east) loosening social controls (more mobility, abandonment of religion and other traditional moral codes) prosperity - more things to steal” der Ebene der gesellschaftlichen Formation hängt die Entwicklung hin zu einer ‚Hochkriminalitätsgesellschaft’ nicht zuletzt mit der vergleichsweise banalen Tatsache zusammen, dass sich historisch betrachtet, die Handlungsgelegenheiten, -möglichkeiten und -spielräume vor allem in fortgeschritten kapitalistischen Gesellschaften kontinuierlich ausgeweiteten haben. Davon werden aber nicht nur konforme Handlungen sondern eben auch ihrer abweichender ‚Konterpart‘ berührt (vgl. Field 1996, Spieß 1993, Young 1994). Die ‚Identitätspolitik’ im Sinne einer Freisetzung der sozialen Akteure als selbstverantwortliche ‚Marktsubjekte’ ebenso wie ein Zwang zu Flexibilität und Mobilität (vgl. Hirsch 2001: 206), die an die Stelle einer disziplinierten, ‚nomozentrischen’ Subjektivierung im Fordismus rücken, lassen sich in ihren Auswirkungen nicht auf den gesellschaftlich lizenzierten Bereich beschränken (vgl. Sack 1993). Wenn nämlich Variationen individuellen Verhaltens nicht nur Folgen, sondern selbst einen unhintergehbar notwendigen Teil gesellschaftlicher Evolutionsprozesse darstellen (vgl. Bussmann 2000), stellt auch jeder Versuch das Problem der Abweichung strukturell bzw. im ursächlichen Bezug auf das gesamte gesellschaftliche System zu bekämpfen, ohne dabei den Grad der erwünschten und politisch vorangetriebenen gesellschaftlichen Modernität, Flexibilität und Mobilität zu reduzieren ein unmögliches und logisch paradoxes Unterfangen dar. Sofern es Freiheiten sind, die Abweichung ermöglichen, kann diese weder durch politische noch durch technologische Maßnahmen der Kontrollinstanzen beseitigt werden, ohne die Freiheiten als solche einzuschränken (vgl. Brumlik 1996). In dieser Perspektive sind hohe Raten von Abweichung sowohl ein Komplement als auch ein Teil kapitalistischer Konsumkultur, ökonomischer Entscheidungen, de-regulierter Märkte einerseits und Ausdruck von individueller Freiheit und der liberalen Errungenschaft einer Delegitimation autoritärer Kontroll- und Regulationsstile in weiten gesellschaftlichen Bereichen anderseits und - beide Aspekte verbindend - das Produkt eines gesellschaftlich ausdifferenzierten, modernen und mobilen Lebensstils (vgl. Garland 2001b, siehe auch: Blinkert 1988, Bussmann 2000, Schmidt-Semisch 2002). Mit welchen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen bzw. Prozessen der regulativen Organisation in einzelnen Gesellschaften die unterschiedlichen Grade der Entwicklung hin zu ‚Hochkriminalitätsgesellschaften’ auch verbunden sein mögen, es lässt sich ganz allgemein davon sprechen, dass je mehr Verhaltensweisen und selbst Risikokonstellationen (vgl. Prittwitz 1997) im Kontext des Versuchs der gesellschaftlichen Regulation ausdifferenzierter Gesellschaften unter Strafe gestellt sind, und je höher der gleichzeitige Grad an Verhaltenvariationen ist, den eine moderne Gesellschaft nicht nur zulässt, sondern selbst braucht, Kriminalität den Charakter des Seltenen, des 413 Abnormalen oder eines Vergehens der am Rande der Gesellschaft Stehenden verliert und stattdessen zu etwas Alltäglichem im Gefüge des täglichen Lebens, zu einer normalen sozialen Tatsache in modernen Gesellschaften wird (vgl. Garland 1996, 2001, Young 1999). Ein Verständnis davon, dass moderne Gesellschaften im skizzierten Sinne ‚Hochkriminalitätsgesellschaften’ sind, hat zumindest teilweise Einzug und Anerkennung im politischen, aber mehr noch im praktischen Diskurs der Kriminalitätskontrolle gefunden. Es sind keineswegs nur defätistische ‚kritische’ Sozialwissenschaftler, die darauf verweisen, dass ein ‚Krieg gegen die Kriminalität’ nicht zu gewinnen sei. Es ist mittlerweile auch in Deutschland etablierter Bestandteil von Polizeiführungs-, Partei- sowie justiz-, innen- und sozialministerialen Verlautbarungen, dass die Grenzen der formellen und insbesondere strafjustiziellen Bearbeitungsmöglichkeiten von Kriminalität überschritten seinen und dass weder sie, als politisch Verantwortliche, noch die Polizei, noch die sozialen Dienste noch andere staatliche oder semistaatliche Agenturen alleine Sicherheit garantieren und Kriminalität tatsächlich kontrollieren, geschweige denn aus der Welt schaffen können. Kurz: der ‚Mythos vom souveränen Staat’, der verspricht innerhalb seiner Grenzen Kriminalität zu unterbinden und seinem Monopol auf die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung umfassend gerecht zu werden wird zwar auf der symbolischen Ebene immer wieder aufgekocht und expressiv demonstriert, ist aber faktisch aufgegeben (vgl. Garland 1996, 2000). Sieht man von den politischen Parolen zu Wahlkampfzeiten ab, sind in nahezu allen fortgeschritten liberalen Gesellschaften die staatlichen Ziele – d.h. aber nicht zwangsläufig die Mittel - gegenüber dem Kriminalitätsproblem bescheidener geworden: „Man konzentriert sich auf einen effektiveren Umgang mit Risiken und Ressourcen, auf die Vermeidung der Ängste vor Kriminalität und die Reduzierung der Kosten der Strafjustiz, sowie auf eine bessere Unterstützung der Opfer: allesamt wenig heroische Ziele, die kaum in die klassische Rhetorik des politischen Diskurses passen“ (Garland 2001: 145) Die eigene Logik und Funktionalität der Kriminalpolitik führt demnach, verstärkt durch den Einzug ökonomischen und symbolischen Effizienzdenkens, nicht einfach nur für steigende Haftzahlen und eine ‚Renaissance des Zwangs’ (vgl. Reindl et al. 1999), sondern zu einem spezifischen Verhältnis eines überbordenden Gebrauchs von Punitivität und Repression und einem weitgehenden oder gar völligen Sanktionsverzichts. Das Verhältnis von Milde und Härte folgt in ‚Hochkriminalitätsgesellschaften‘ pointiert formuliert Form einer neuen Trennung der Kriminalpolitik in eine ‚criminology of the self‘ und einer ‚criminology of the ailien other‘ (Garland 1996, 2000, dazu auch Peters 2002). Wenn die Politik der Milde gegenüber Abweichungen darin begründet liegt ist, dass sich die Vielzahl von Handlungsgelegenheiten, -optionen und -variationen auch für die vermeintlich ‚anständige’ Mehrheit keinesfalls auf konformen Bereich beschränken lassen, liegt die Vermutung nicht fern, dass sich die Kriminalpolitik der ‚Härte’ vor allem auf die ‚die Anderen’ als jene Gruppen von Akteuren richtet, denen auch und zunehmend die Teilhabe am lizenzierten Bereich verweigert wird. IV. 2.2 ‚LOCK ’EM UP’ 414 Die Erkenntnis der Normalität des Verbrechens führt demnach zwar zu einem halbierten, oder besser ‚gegabelten’ Sanktionsverzicht (Bottoms 1980, 1995), der insgesamt jedoch, trotz der zunehmenden sozialtechnologischen ‚Bedeutungslosigkeit’ des Gefängnisses als Normierungsanstalt mit Blick die ‚gewöhnliche’ Abweichung ‚gewöhnlicher Krimineller’, keine sinkenden Inhaftierungsraten induziert. Im Gegenteil haben sich nahezu europaweit – mit Ausnahme Finnlands - seit Mitte der 1990er Jahren die Gefangenraten permanent erhöht und zwar in deutlich stärkerem Maße als die Kriminalitätsrate selbst (vgl. Walmsley 2001). Dieser Anstieg steht ironischerweise nicht zuletzt im Zusammenhang mit den ‚bescheidenen’ Zielen der Kriminalpolitik, nicht ‚die Kriminalität’ selbst, sondern vor allem ihre Wirkungen auf ‚die Bevölkerung’ zu bearbeiten. Folgt man Ian Taylor (1999b: 157) ist die deutliche Tendenz zur Strafhärte nur zu verstehen, wenn sie zumindest teilweise „as a reponse on the part of the authorithies“ interpretiert wird „to increased public anxieties auround issues of immigration and public order on the streets“. Die Tendenz zur Einsperrung ist auch in Deutschland kaum zu übersehen33. Wahr es bis vor wenigen Jahrzehnten noch möglich die Entwicklung des Strafrechts, als die Entwicklung seiner sukzessiven Abschaffung zu lesen (vgl. Sack 2000), hat sich dieser Trend zwar im einzelnen nicht völlig umgekehrt, aber in widersprüchliche, gegenläufige Pole ausdifferenziert: Während sich im einzelnen nach wie vor Formen einer Entkriminalisierung und Normalisierung vormals abweichenden Verhaltens finden34, lässt sich gleichzeitig eine zumindest punktuelle ‚Heraufdefinition’ von Devianz (vgl. Krauthammer 1993), eine Reorientierung an scharfen und ‚wirklich vollzogenen Strafen’ (‚truth in sentencing’) (vgl. US Department of Justice 1999, Peters 2002, Sack 2000a, Taylor 1999) sowie eine Rückkehr zu Ideen der Generalprävention durch expressive Punitivität rekonstuieren35 (vgl. Duff 1991, Groenemeyer 2001, Günther 1999‚ Müller-Tuckfeld 2000, Theoretical Criminology’ 3/2002). Diese Verschiebungen werden von einer zunehmenden Demontage der Logiken des normierend normalisierenden Straf-Wohlfahrtskomplexes begleitet. So konstatiert der Pönologe Wolfgang Heinz (1999), dass im Jugendstrafrecht die „Zahl der erzieherischen Maßnahmen seit Anfang der 90er Jahre eine deutlich rückläufige Entwicklung […] zugunsten punitiver Reaktionen“ aufweist, und Joachim Walter (2000: 253) führt aus, dass „wieder häufiger (steiler Anstieg der Belegung) und früher (gesunkenes Alter beim Zugang) zur Jugendstrafe ohne Bewährung gegriffen wird […während] die jahrelang geübte jugendrichterliche Strategie, Jugendstrafen ohne Bewährung wegen der geringen Effizienz tunlichst zu vermeiden und mit ihrer Verhängung so lange wie möglich zuwarten, im Rückgang [begriffen ist]“. Laut Statistischem Bundesamt erreichte die Zahl der Strafgefangen zunächst im Jahr 1997 mit 51642 Gefangenen (1996 waren es 48904) den „vorläufigen Höchststand in der Bundesrepublik Deutschland“ (Statistisches Bundesamt 1998, 2000), obwohl die Fallzahl der offiziellen Kriminalstatistik in der ersten zwei Dritteln der 1990er Jahre leicht rückläufig waren (vgl. BKA 1999) und, wie Pfeiffer/Wetzels Diese Tendenz gilt auch für die Strafrechtentwicklung im engeren Sinne. Zum Verhältnis von Ent- und Neukriminalisierungen vgl. Prittwitz 1991 35 Neben den ‚Sicherheitspaketen’, die nach dem 11. September 2001 verhältnismäßig widerstandsfrei durchzusetzen waren gehören in diesen unter anderem die Veränderungen im Betäubungsmittelgesetz - das in den letzten Jahrzehnten signifikante Strafverschärfungen erfahren hat (vgl. Cornel 2001) -, das Verbrechensbekämpfungsgesetz von 1994 oder das 33 34 415 (2001) konstatieren, - gerade bei Jugendlichen – auch die Deliktschwere teilweise erheblich abgenommen hat. Ein Rückgang der Deliktschwere gilt nicht nur für den Durchschnitt der registrierten Vergehen, sondern beispielsweise auch für die im Jugendstrafvollzug inhaftierten delinquenten Jugendlichen, von denen lediglich etwa ein Viertel schwere Delikte, im Sinne von erheblichen körperlichen Schädigungen ihrer Opfer oder materielle Schäden von über 5000 DM begangen haben (vgl. Dünkel 1992, Walter 2001). Vergegenwärtigt man sich, dass die Anzahl der gerichtlich Verurteilten von 1991 (1091 Verurteilungen je 100000 Personen in der Bevölkerung) zu 1996 (1129 Verurteilungen) um etwa 3,5 % gestiegen ist spricht dies für eine leichte quantitative vor allem aber für eine qualitative Steigerung der Härte der Urteile. Ein solcher Anstieg der Strafhärte ist empirisch unbestritten. Zwischen den Jahren 1990/91 und 1997/98 ist die Zahl der verhängten Freiheits- bzw. Jugendstrafen von zwei Jahren und darüber um etwa 56 Prozent gestiegen (vgl. Ostendorf 2000:5). Die für die Bundesrepublik rekonstruierbare relative Unabhängigkeit der Strafentwicklung von der Kriminalitätsentwicklung gilt spätestens seit den 1990er Jahren in ganz Europa. Das vom Europarat in Auftrag gegebene ,European Sourcebook of Crime and Criminal Justice’ etwa, findet in einer europaweiten Studie schlicht „[n]o relationship […] between the size of the prison population in a country and the level of recorded crime”36. Demgegenüber hat sich jedoch ebenfalls europaweit die „length of sanctions imposed“ als ein „main factor influencing the prison population size” erwiesen (Council of Europe 2000a: 1, vgl. auch Walmsley 2000). Deutlicher noch sind Robert Weiss und Nigel South (1998) in ihrem Vergleich von Inhaftierungsraten und Gefängnislogiken von 14 Ländern zu dem Ergebnis gekommen, dass nicht die Kriminalitätsraten, sondern die ökonomische Ungleichheit und Arbeitslosigkeit, die stärkste Beziehung zu den Inhaftierungsraten in fortgeschritten kapitalistischen Nationen aufweisen (vgl. auch Barlow et al. 1996). Während dieser Befund an die als eigentlich überholt geltende Arbeit von Rusche und Kirchheimer (1981 [1939]) erinnert, erklären Weiss und South diesen Zusammenhang im Rekurs auf die gewachsene Bedeutung symbolischer Politik. Dort, wo die Bereitschaft zur Wohlfahrtsversorgung und zur Verbesserung der Lage der untersten Schichten abnehme, so ihre These, würden politische Führungen, dazu tendieren, die mit gesellschaftlichen Prekarisierungen korrespondierenden Ressentiments gegen wohlfahrtsstaatliche Leistungsempfänger und gegen zu liberale Formen der Strafjustiz und Inhaftierung symbolisch auszubeuten, und damit soziale Ausschließung legitimieren und Institutionalisieren37 (vgl. auch Walmsley 2000). ‚Gesetz über die Unterbringung besonders rückfallgefährdeter Straftäter’, das auch unbegrenzte, nachträgliche Sicherheitsverwahrung erlaubt. 36 Selbst innerhalb eines Strafrechtssystems in der Bundesrepublik kann im Vergleich der Bundesländer kein liberaler Zusammenhang zwischen unterschiedlich Hohen Kriminalitäts- und Inhaftierungsraten der einzelnen Ländern hergestellt werden (vgl. Suhling et al. 2002). 37 Hierfür spricht auch ein Vergleich der Daten von Finnland und den USA. Die registrierte Kriminalitätsrate in den USA lag 2001 bei 4160,51 pro 100 000 Einwohnern, in Finnland deutlich höher, nämlich bei 14 525.74 pro 100 000 Einwohnern (vgl. Interpol 2003). Ganz im Gegensatz zur Inhaftierungsrate, die in den USA 2002 bei 702 pro 100000 Einwohnern liegt (U.S. Census Bureau) und in Finnland (2001) bei 59 (Council of Europe). Dies obwohl die polizeiliche Aufklärungsquote von 19, 6 % in den USA (2001) gegenüber den 72, 0 % der finnischen Polizei (2001) geradezu erbärmlich anmutet (Interpol 2003). 416 Nach den vorläufig letzten Zahlen von 2000 hat sich die Anzahl der Strafgefangenen auf 60 798 erhöht (Statistisches Bundesamt 2002). Dies entspricht - nach eigenen Berechnungen - einer erneuten Steigerung der Strafgefangenen von ca. 17, 7 % gegenüber 1997 und ca. 54 % gegenüber 1992. Die nominale Gesamtgefängnispopulation - inklusive U-Häftlinge - stieg auf 79348 Inhaftierte am Stichtag 2000 an (vgl. ICP 2001) und erhöhte sich bis 2003 auf 81 176 Inhaftierte (vgl. ICP 2003). Dabei weißt die Bundesrepublik im europäischen Vergleich ohnehin eine überdurchschnittlich hohe Gefangenrate auf (vgl. BMI/BMJ 2001: 30). Mit einer Gefangenenrate von 97 pro 100000 im Jahr 2000 (bzw. 98 im Jahr 2003 vgl. ICP 2002, 2003) – gegenüber 71 pro 100000 im Jahr 1992 und 81 im Jahr 1995 (vgl. ICP 2002) – liegt die Bundesrepublik seit 2000 im Einsperrungsranking der EU-Staaten - hinter Portugal (130), Großbritannien (125) und Spanien (110) (Stand 1999) (vgl. Home Office 2000) - an vierter Stelle38. In der Bundesrepublik ist die Zahl der Strafgefangenen zwar in allen Altersgruppen, in allen Arten des Strafvollzugs (d.h. geschlossener und offener Vollzug, Freiheitsstrafe, Jugendstrafe und Sicherheitsverwahrung) und beiden Geschlechts gestiegen, bezogen auf die Jugendstrafe ist diese Steigerung jedoch besonders deutlich. Der Anteil der Jugendlichen bzw. der im Jugendstrafvollzug Einsitzenden an der Gefängnispopulation in Deutschland macht im Jahr 2000 bereits 9,6 % aus (vgl. ICP 2002). Nominal steigt ihre Anzahl von 5253 am Stichtag des Jahres 1996 auf 6483 im Jahr 1998, auf 7396 im Jahr 2000 und schließlich auf 7455 im Jahr 2002 (vgl. Statistisches Bundesamt 2002, 2003). Das entspricht einer prozentualen Steigerung von über 40 % von 1996 bis 2000 und einer Steigerung von über 91 % von 1992 (3898 Insassen am Stichtag) bis 2002, wobei sich insbesondere auch der relative Anteil der 14- bis 18 Jährigen im Jugendstrafvollzug seit den 1980er Jahren nahezu verdoppelt hat (vgl. Dünkel 2002). In diesen Zahlen ist der Jugendarrest - der, obgleich seine Belegung in einzelnen Bundesländern in den 1980er Jahre nahe am Nullpunkt war, mittlerweile „im Jugendstrafrecht eine vergleichsweise hohe praktische Bedeutung [besitzt]“ (BMI/BMJ 2001: 34) und bereits im Jahr 1998 ca. 70 % aller stationären Sanktionen nach dem JGG ausmacht (vgl. Heinz 1998) - gar nicht mitgerechnet, da er als sogenanntes Zuchtmittel nicht als Kriminalstrafe betrachtet wird und damit nicht den Strafvollzug zugerechnet wird. Insbesondere die Erhöhung des Anteils ethnischer Minderheiten in den Jugendstrafanstalten der Bundesrepublik von etwa einem Zehntel auf über ein Drittel – von 1990 auf 1998 – ist bezeichnend (Shaw 2001: 4). Nach Berechnungen von Suhling et al. (2002: 169) beruht der Gesamtgefangenenanstieg in den alten Ländern der Bundesrepublik „zu 85,5 % auf einem Zuwachs inhaftierter Ausländer und Ausländerinnen oder Staatenloser. [… Diese] findet im zahlenmäßigen Anstieg der Tatverdächtigen keine befriedigende Erklärung“. Sofern man sich auf diese Zahlen verlässt, erscheint Chance für einen ertappen Rechtbrecher in den Knast zu wandern, in den USA rein statistisch ungefähr 150 mal (!) so hoch wie in Finnland. 38 Folgt man den – hiervon abweichenden - Zahlen des Bundesministeriums der Justiz über den Bestand der Gefangenen und Sicherheitsverwahrten am Stichtag des Jahres 2000 (31. 5. 2000), so liegt die nominale Gesamtbelegung in den Justizvollzugsanstalten sogar bei 83 083 und die Inhaftierungsrate von 102 in den alten und 95 in den neuen Bundesländern (vgl. Weber 2001: 97f) 417 Während der Ausländeranteil in der Polizeilichen Kriminalstatistik 2000 insgesamt 20 % ohne Berücksichtigung der Verstöße gegen das Ausländer- und Asylverfahrensgesetz bei etwa 14,3 % (BKA 2001: 107) liegt, beträgt nach Zahlen des Europarats (Council of Europe 2000) der Gefangenanteil von Ausländern in Deutschland im Jahr 1999 34, 1%. Pffeifer und Dworschak (1999) sprechen auf der Basis in einer Stichprobenerhebung in Jugendstrafvollzugsanstalten von etwas über 35 %. Geht man davon aus, dass der Anteil auch im Jahr 2000 bei ungefähr 34 % liegt, kommt man bei einer Gesamtzahl von ca. 79 350 Inhaftierten auf eine Gesamtzahl von ungefähr 26980 Gefangene ohne deutschen Pass. Das entspricht bei einer Wohnbevölkerung von 7 266700 (Statistisches Bundesamt) einer Inhaftierungsrate von etwas über 370 pro 100000 gegenüber ungefähr 70 pro 100000 der deutschen Bevölkerung (insgesamt etwa 74 992000). Die Inhaftierungsrate von Personen ohne deutschen Pass ist demnach mehr als fünfmal so hoch wie die Inhaftierungsrate deutscher Staatsangehöriger. Bezieht man Aussiedler und ‚eingebürgerte’ Migranten mit ein, verschärft sich dieses Bild. So liegt beispielsweise im Jugendstrafvollzug in Baden-Württemberg der Anteil von „in Deutschland geborenen Deutschen“ im Jahr 1987 noch bei 77, 5 %, seit 1993 sinkt er konstant auf unter 50 % und zeitweise bei einem Anteil von unter zwei Fünfteln (vgl. Walter 2001a: 175). Dabei ist die ‚ethnische’ Überproportionalität in den Strafanstalten keinesfalls die einzige Überproportionalität. Offizielle Daten zur Schicht- bzw. Klassenzughörigkeit der Inhaftierten gibt es nicht. Die wenigen Untersuchungen zu diesem Thema sprechen allerdings davon, dass sich die Gefängnispopulation insgesamt zu etwa „zwei Drittel[n …] aus dem unteren Zehntel der Gesellschaft ohne Hauptschulabschluss“ rekurriert (vgl. Hradil 1998: 475). Da, wie Jehle (1995: 9) ausführt, bei der Sanktionierung von Jugendlichen „neben strafrechtlichen Kriterien die soziale und persönliche Situation der Verhafteten eine verstärkte Rolle spielt“ kann davon ausgegangen werden, dass dieser ‚Unterschichts-Bias’ hier mindestens ebenso stark ausgeprägt ist. Nach einer aktuellen Studie von Enzmann und Greve (2001) haben von den Insassen im Jugendstrafvollzug über neuen Zehntel höchstens einen Hauptschulabschluss und etwa zwei Drittel, so Geißler (2002: 344), haben die Hauptschule nicht abgeschlossen39, demgegenüber hat „nur etwa jeder Tausendste […] ein Gymnasium besucht“! Nur knapp 21 % der inhaftierten Jugendlichen in der Studie von Enzmann und Greve sind entweder Schüler, Lehrlinge oder Wehr- und Zivildienstleistende, die restlichen entweder arbeitslos oder in irgendwelchen Maßnahmen. Zusammenfassend sprechen sie von einer „extremen sozialen Benachteiligung“ der Inhaftierten Jugendlichen, die sich neben massiven Defiziten in der familiären Situation durch „soziale und wirtschaftliche Randständigkeit der Herkunftsfamilien (geringes Bildungsniveau der Eltern, hohe Raten von Arbeits- und Erwerbslosigkeit, niedriger sozioökonomischer Status), extrem schlechte Schul- und Berufsausbildung der Jugendlichen und Heranwachsenden selbst, eine hohe Arbeits- und Erwerbslosenquote und damit einhergehend ein geringes legales Einkommen […] Bezüglich ihrer sozialen Lage stellen die Inhaftierten also eine extreme Negativauslese dar“ (Enzmann/Greve 2001: 140, vgl. Moll/Reindl 1995). 39 Dabei ist zu beachten, dass der Anteil der unter 18jährigen im Verlauf der 1990er Jahre zwar deutlich angestiegen ist und sich die Insassenstruktur im Jugendknast verjüngt hat, allerdings liegt der Anteil der über 18jährigen auch am Stichtag des Jahres 1999 noch bei über 87 % (1999 bei knapp 93 %). 418 Vor dem Hintergrund, dass - trotz aller prä-strafjustiziellen Selektion (vgl. Cremer-Schäfer 1998) diese Kriterien zumindest in einer solchen Schärfe weder auf die von der Polizei festgenommen zutrifft noch jene Jugendlichen charakterisiert, die einschlägig angeklagt werden, erscheint der Verdacht, dass das Gefängnis selbst ex ante als eine Institution konzipiert ist, die sich weniger auf ‚Kriminelle’ per se als auf besonders deprivierte Akteure unter diesen ‚Kriminellen’ richtet (vgl. Eick 2002, Pilgram 1998, Wacquant 2000, Western et al. 2001, Weiss/South 1998), zumindest nicht unplausibel. In diesem Sinne hebt Michael Walter (1997: 94 f) mit Blick auf den deutschen Strafvollzug „die dauerhaft und überall zu beobachtende Tendenz [hervor], fast ausnahmslos Menschen aus den untersten sozialen Schichten zu inhaftieren. Das Gefängnis war in der Geschichte und ist in der Gegenwart für die sozial schwächsten Gruppen da […] denen anderes als ihre Fortbewegungsfreiheit nicht mehr weggenommen werden kann“. Offensichtlich gibt es von diesen Typus des Kriminellen mehr, als die Institutionen ‚versorgen’ können. Während aufgrund „struktureller Differenzierungen der Haftplätze eine JVA oft schon bei 80 - 90 % Belegung voll ausgelastet ist“ (Suhling et al. 2002: 158) liegt die Belegungsrate im geschlossenen Jugendstrafvollzug der Bundesrepublik inzwischen bei 104,5 %40. Demgegenüber ist der offene Vollzug nicht einmal mehr zu drei Vierteln belegt (72,4 %) (vgl. Dünkel et al. 2002). Auch die Entwicklung der U-Haftzahlen hat in der Bundesrepublik hat im Verlauf der 1990er Jahre gleich mehrere historische Höchststande erreicht. Insbesondere im Jugendstrafrecht ist die U-Haftrate seit Mitte der 1990er Jahre höher als je im statistisch erfassten Zeitraum zuvor (vgl. Heinz 1996: 107). Bereits seit Anfang der 1990er Jahre machen U-Häftlinge am jeweiligen Jahresstichtag etwa ein Drittel der strafrechtlich Verurteilten aus. Aufgrund der in der Regel kurzen Verweildauer sind die nominalen Jahreslängsschnittsdaten allerdings wesentlich höher und entsprechen etwa denen der unbedingten Freiheits- und Jugendstrafe. Nach Jehle und Bossow (2002: 73) waren alleine in den alten Bundesländern im Jahr 1999 39465 Abgeurteilte zuvor in Untersuchungshaft gewesen41. Überproportional von U-Haft betroffen sind Ausländer und Nichterwachsene (vgl. Holthusen 2001). Die U-Haftrate bei Erwachsenen lag am Stichtag des Jahres 2000 bei 22, 2 pro 100000 der Wohnbevölkerung, bei den 14- bis 21-jährigen bei 47, 3 pro 1000000 (vgl. Dünkel et al. 2002) Im Verlauf des Jahres 1998 saßen um die 6800 14- bis 18-jährige in U-Haft ein (vgl. Holthusen 2001). „Zeitweise“, so führt Detlev Frehsee (1995: 9f) aus, „finden sich mehr 14- bis 18-jährige in U-Haft als in Strafhaft. Die Erklärung liegt in einer Zweckentfremdung der U-Haft vom Versicherungsinstrument zu einer sofortigen Freiheitsstrafe [… Dabei] geht es insbesondere den Jugendrichtern offenbar darum, der Straftat die Strafe möglichst auf dem fuß folgen zu lassen, eine Zielsetzung, der das heikle Erziehungsprinzip des Jugendstrafrechts die Legitimation scheinbarer Vernünftigkeit verleiht; es geht um sofortige Krisenintervention; darum zur Therapiebereitschaft weichzukochen; die erwartete Jugendstrafe angesichts der stattgefundenen Inhaftierung aussetzen zu können; oder Angehörigen anderer Ethnien mit Härte entgegenzutreten, weil sie es anders angeblich nicht verstehen […Dabei reißen] auch alle Ketten rechtsstaatlichen Freiheitsschutzes: Die Unschuldsvermutung gerät offenbar in Vergessenheit; das Erkenntnisverfahren braucht man nicht mehr. Immer öfter sperren wir die Leute wegen bloßer Bagatellen ein“. In einzelnen Bundesländern ist die Überbelegungsrate im geschlossenen Jugendstrafvollzug geradezu dramatisch (Sachsen-Anhalt 122, 3 %, Hessen 123,1 %, Rheinland-Pfalz: 127,6 %) (vgl. Dünkel et al. 2002) 41 Am Stichtag 1.1.1998 wurden 933 14- bis 18-jährige in Untersuchungshaft gezählt am 31.12 1998 ‚nur’ 854. Hinter dieser Zahl verbergen sich 6771 Zugänge und 6850 Abgänge (vgl. Holthusen 2001:28). Auch wenn es sich dabei nicht nur um Erstzugänge, sondern auch um Verlegungen handelt, wird von der U-Haft als Sanktionsinstrument offensichtlich exzessiv Gebrauch gemacht. 40 419 Rechtlich ist die Untersuchungshaft als ein Instrument konzipiert, dass nur bei „zu erwartender vollstreckbarer Jugendstrafe […] angeordnet werden kann“ (Jehle 1995: 78 f). Mit der Realität seines Einsatzes haben diese Bestimmungen offenbar wenig zu tun, wenn sich die Straftat tatsächlich nur bei etwas mehr als einem Drittel (vgl. Jehle 1995), jedenfalls deutlich weniger als der Hälfte der Jugendlichen (vgl. Heinz 1998) tatsächlich anschließt. Vielmehr hat sich die U-Haft zum unter der Hand zu einem Instrument der Krisenintervention gewandelt oder wird als Instrument eines Managements von ‚Risikogruppen’ zur Beruhigung der Bevölkerung instrumentalisiert (vgl. Dünkel 1994: 612). Die psychologischen und sozialen Auswirkungen, die (haft)räumlichen und baulichen Bedingungen sowie die personelle Ausstattung sind dabei ungleich schlechter als im Normalvollzug (vgl. Albrecht 2000: 58f). ‚Resozialisierung’ ist im Kontext der Untersuchungshaft konzeptionell nicht vorgesehen, so dass - völlig unberücksichtigt eines generellen Wandlungsprozesse im ‚normalen’ Jugendstrafvollzug, bereits aufgrund dieser Entwicklung ein großer Teil der Verurteilten seinen Freiheitsvollzug faktisch in seiner „resozialisierungsfeindlichsten Form“ (Heinz 1996: 107) erlebt. Alleine diese Zahlen sprechen für eine von Nickolai und Reidel (1999: 8) konstatierte ‚Renaissance’ von Zwang und Kontrolle bei einem politisch-rhetorisch und vollzugspraktisch brüchig werdenden Konzepts der Resozialisierung (vgl. auch Kawamura 2001). Momente des Niedergangs dieses Konzepts – das, wie einige Beobachter meinen, bereits in den 1980er Jahren sein ‚Waterloo’ gefunden haben (vgl. Schünemann 1986, nach Schöch 1993: 364) - finden sich nicht nur auf einer ideologischen Ebene und bezüglich einer gestiegenen strafjustiziellen Punitivität, sondern auch auf der Ebene vollzugspraktischen Möglichkeiten. Heribert Ostendorf (2000: 6) etwa konstatiert, dass sich im Erwachsenen- wie im Jugendstrafvollzug schlicht für immer mehr und ‚schwierigere’ Inhaftierte zunehmend „weniger Arbeits-, Ausbildungs-, weniger Freizeitangebote, Verschärfung des Anstaltsklimas [usw. finden,] so dass […] Resozialisierung vielfach unmöglich geworden ist“42 (vgl. auch Preusker 1998). IV. 2.3. ‚ÖKONOMISCHER ABOLITIONISMUS’ UND ‚ADMINISTRATIVE RATIONALISIERUNG’ DES STRAFRECHTS Während die Bundesrepublik in den ‚Zero Tolerance-‘ Debatten bis Anfang der 1990er Jahre vergleichsweise zurückhaltend geblieben war - sie galt als ein Beispiel dafür, dass es für zu einem ‚getting tough‘ wohlfahrstaatliche Alternativen (vgl. Walklate 1996), ohne negative Auswirkungen auf die Kriminalitätsrate (vgl. Wacquant 2000: 147) gibt und Johannes Feest konnte noch 1991 einem Aufgrund der Überbelegung der Vollzugsanstalten sitzen in etwa 5000 für Einzelunterbringung vorgesehenen Zellen zwei oder mehrere Gefangene (vgl. BMJ 2000a). Darüber hinaus betreut im Bundesdurchschnitt ein Sozialarbeiter bzw. eine Sozialarbeiterin mittlerweile zwischen ca. 80 bis 110 Häftlinge im Erwachsenenvollzug (vgl. Mührel 2001a) und selbst im spezialpräventiven, durch den Erziehungsgedanken beseelten Jugendstrafvollzug kommen im Bundesdurchschnitt (Stichtag 31.3.2001) 35 jugendliche Insassen auf einen Sozialarbeiter (in Thüringen 91 : 1, Nordrhein-Westfalen 58 : 1) und 76 jugendliche Insassen auf einen Psychologen (vgl. Dünkel 2001). Dass der Jugendstrafvollzug primär eine Anstalt sei, in der es in einem sozialpädagogischen Sinne um ‚Erziehung’ und ‚Besserung’ ginge, lässt sich - selbst wenn man von der Massivität der positional-dispositionalen Problemlagen und der Tatsache absieht, dass sich das mit ‚psychosozialen’ Aufgaben betraute Personal auch innerhalb des Gefängnisses auch keinesfalls auf alle Gruppen von Insassen gleich verteilt - entsprechend kaum ernsthaft behaupten. 42 420 internationalen Publikum ‚Lessons from the West German Experience’ zu einer Politik der Reduzierung von Gefängnisstrafen geben – spricht inzwischen vieles dafür, dass ein neuer strafrechtlicher Common Sense (vgl. Wacquant 2000) seinen Weg auch in die Bundesrepublik gefunden hat. Wenn trotz Entwicklungen an der These eines ‚Zwangs zum Sanktionsverzicht‘ (vgl. Taylor 1997) prinzipiell festgehalten wird, so ist damit unterstellt, dass als wesentliches zeitgenössische Merkmal der Strafjustiz weniger das extensive Strafen, sondern die Ambivalenz der Maßnahmen in den Blick genommen werden muss (vgl. Garland 2001). Die Transformationsprozesse im (Jugend)Strafrecht und dessen Vollzug sind durch widersprüchliche Gleichzeitigkeiten gekennzeichnet, in denen zwar bestimmte Tendenzen aber nur wenige klare, widerspruchsfreie und eindeutige Linien zu erkennen sind (vgl. Naucke 1999). Unbestreitbar ist es, dass in Art und Ausmaß der Strafverhängungen eine deutliche Zweispurigkeit bzw. ‚Bifurkations’-Prozesse sichtbar werden (vgl. Bottoms 1980, 1995). Dazu gehört zum einen, dass die steigenden Gefängnisraten in erster Line sozial marginalisierte, ökonomisch deprivierte und kulturell subdominante Bevölkerungsgruppen betreffen, während zugleich eine Informalisierung der Sanktionen, ‚Dekarzerisierungen‘ (vgl. Scull 1980) oder sogar weitgehende Straffreiheit für andere gesellschaftliche Gruppen zu verzeichnen ist. So konstatiert Pilgram, dass auch in Europa die Freiheitsstrafe zunehmend zu einem ‚Fangnetz für Arme‘ werde: „[s]trafvermeidende Handlungsmöglichkeiten [… werden] bei den vom Arbeitsmarkt sowie bei den öffentlichen Sozialleistungen verwaltenden Institutionen weitgehend abgeschnittenen Personenkreisen allem Anschein nach weniger ausgeschöpft als bei anderen Gruppen […] Die Entscheidung für eine Freiheitsstrafe als instrumentelle erscheinen zu lassen und als zweckrationalen Akt der ‚Sozialkontrolle’ zu legitimieren, gelingt bei Marginalisierten leichter als bei anderen Gruppen. Die Strafentscheidung fällt hier konfliktfreier, weil die Sanktion dem Anschein nach nicht kontraproduktiv in andere formale soziale Beziehungen und Netze eingreift [. …] Satisfaktionsfähigkeit, Lernfähigkeit, Verluste anderer infolge der Strafe brauchen gar nicht erst wirklich kalkuliert werden, wenn der Betroffene nicht eingebettet ist in ein Netz regulärer sozialer Arbeitsbeziehungen produktiver und konsumtiver Natur“ (Pilgram 1998: 22f). Ebenfalls gehört es zum gesicherten pönologischen Wissen, dass diese Politik auch deliktspezifisch zu einer Doppelstrategie geführt hat, in der leichte bis mittlere Straftaten zwar keinesfalls materiell entkriminalisiert aber weitgehend entpönalisiert oder ganz eingestellt werden (vgl. Heinz 1996: 117f) während schwerere Delikte oder solche, die in der öffentlich beunruhigend wirken einer deutlichen Strafverschärfung ausgesetzt sind (vgl. Lamnek 1994: 291, JMK 2000, Peters 2002) und in diesem Sinne offensichtlich einen strafjustiziellen Bereich des ‚harten Kern’ oder der ‚eigentlichen Kriminalität’ darstellen (vgl. Driebold 1993: 46), der vom ‚Zwang’ zum Sanktionsverzicht nahezu vollkommen unberührt geblieben ist. Gewandelt hat sich für diese Typen des Kriminellen jedoch der strafwohlfahrtliche Bezug in dem der Kriminelle als ein Akteur rekonstruiert wird, der der Besserung bedarf. Der neue Typus des Krimiellen repräsentiert eher einen riskanten, bzw. bedrohlichen Sozialcharakter für den eine Inhaftierung nicht primär ‚gerecht’, sondern in erster Linie ‚gerechtfertigt’ ist (vgl. Lindenberg/Schmidt-Semisch 2000). In diesem Sinne machen Jehle und Kirchner (2000: 159) eine generelle langfristige Tendenz in der Kriminalpolitik aus: „Während auf der einen Seite für eine bürgernahe Kriminalprävention und Konfliktregulierung plädiert, mithin vermehrt auf außerstrafrechtliche Lösungen gesetzt wird, ist auf der anderen Seite eine Wandlung in den kriminalpolitischen Schwerpunktsetzung hin zu einer stärkeren Betonung der Sicherheitsinteressen der Gesellschaft, vor allem mittels eines verschärften Zugriffs des Strafrechts, unübersehbar“. 421 Aber auch die Entpönalisierungen sind weder alleine Ausdruck einer ‚Humanisierung’ noch kennzeichnen sie per se eine Delegitimation von Strafe und in diesem Sinne auch keinen staatlichen Herrschaftsverlust (so etwa Haferkamp 1984). Eine Dekarzeration folgt auch, wenn nicht hauptsächlich, ökonomischen43, organisatorischen oder kurz, systemimmanenten Gründen. Einer dieser Gründe besteht darin, dass die Gefängnisse schlicht überfüllt sind: Nach den Zahlen des Justizministeriums über den Bestand der Gefangenen und Sicherheitsverwahrten in Deutschland im Jahr 1999, liegt die Überbelegung der Justizvollzuganstalten bei etwa 22 % - Ende 1993 lag noch die Belegungsquote bei 85,6 % (vgl. Statistisches Bundesamt 1998a). Überwiegen Neu- und Rekriminalisierungen die Entkriminalisierung und wird für bestimmte Gruppen eine expressive Demonstration staatlicher Souveränität vollzogen - die ‚volle Härte des Rechtsstaats’ etc. - gibt es kaum eine andere Alternative dazu, für bestimmte Gruppen das bestehende Recht nur noch halbherzig oder gar nicht mehr und wenn, dann möglichst extrajustiziell zu exekutieren. Aus einer politisch-ökonomischen Perspektive führt Stephen Spitzer (1983) bereits mit Blick auf die späten 1970er Jahre aus, dass pro- aber auch vor allem auch reaktive Kriminalitätskontrollen durch informelle, entformalisierte und ‚gemeindenahe’ Ansätze als Rationalisierung der Kriminalitätskontrolle immer dann notwendig erscheinen und ausgebaut werden, wenn dadurch besonders hohe, mit den Grundsätzen einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft unvereinbare Kosten und Nebenkosten einer Einsperrungspolitik vermieden werden können (vgl. auch Taylor 1997). Diese hätten, so argumentiert Scull noch 1980 darüber hinaus den Vorteil, dass sie auch (wohlfahrts-)ideologisch leichter zu rechtfertigen sind. Diese These ist mit Blick auf die fordistische Organisation kapitalistischer Gesellschaftsformationen im Prinzip nicht unplausibel. Dagegen spricht allerdings, dass sich die punitiven ‚wegsperrenden’ Sanktions- und Kontrollformen deutlich ausweitet haben44 und auch die Tatsache etwa, dass eine zwischen 1975 und 1999 im US-Bundesstaat Kalifornien erfolgende Haushalterhöhung für die Strafvollzugsverwaltung um das 22fache, d.h. von 200 Millionen auf 4,3 Milliarden US-Dollar, weder den Kapitalismus geschwächt noch die kalifornische Staatregierung ideologisch in Verruf gebracht hat45 (vgl. Wacquant 2000: 77 f). Die Grundintension der klassischen Argumente von Scull und Spitzer weist gleichwohl in eine richtige Richtung. Für die Bundesrepublik spricht Ludwig-Mayerhofer (1998) von einer Entwicklung hin zu In Hessen etwa werden die Kosten für einen Haftplatz pro Tag aktuell mit rund 83 Euro angegeben (vgl. Deutsche Richterzeitung 9/2003: 328). Andere Bundesländer liegen deutlich darüber: Kury sprach bereits 1998 von bis zu 350 DM pro Tag, dabei sind allgemeinen Kosten des Justiz- und Polizeiapparates, begleitenden sozialen Kosten, wenn beispielsweise Angehörige unterstützt werden müssen, sozialen Folgekosten wie unter anderem die spätere Rentenversorgung oder etwa die dem Staat und den Sozialinstituten entgangenen Mittel-Zufuhren nicht eingerechnet. Auch die Kosten für einen Ausbau der Haftplätze sind enorm: „Die Baukosten von Justizvollzugsanstalten lagen in den letzten Jahren in der Bundesrepublik zwischen 190 und 360 T[ausend] DM pro Haftplatz“ (Stadt Bremen o.J.). 44 Wie Higgs (1999) in einem mathematischen Gedankenexperiment ausführt, würde die Zahl der Gefängnisinsassen in den USA, wenn die proportionalen Wachstumsraten der Gefängnispopulation der 1990er konstant gehalten würden, in den 2080er Jahren deshalb an ihre natürlichen Grenzen stoßen, weil sie die Gesamtbevölkerungszahl der Vereinigten Staaten überschreiten würde. 45 Von einer ‚Wohlfahrtideologie’ kann schon alleine deshalb kaum die Rede sein, weil zur gleichen Zeit die Sozialhilfe um über 40 % gekürzt worden ist (vgl. Wacquant 2000). 43 422 einer ‚informellen Justiz‘. Diese ordnet er vor allem einem Prozess der administrativen Rationalisierung zu, der sich jedoch weniger auf der Ebene des Strafvollzugs, als auf der Ebene der Gerichtsbarkeit findet. Im Kontext einer administrativen Rationalisierung des justiziellen Feldes geht es zwar auch, aber nicht in erster Linie um das Abwenden formeller Sanktionen, sondern vor allem darum, bereits im Vorfeld ein kostspieliges und zeit- und personalaufwendiges formelles Verfahren zu verhindern. So führt etwa der Erste Periodische Sicherheitsbericht der Bundesregierung (2001: 29) aus, dass sich die strafjustiziellen „Erledigungsstrukturen […] sich seit 1981 wesentlich geändert [haben]. Die wachsende Kriminalitätsrate hat die Staatsanwaltschaft durch eine nahezu verdoppelte Opportunitätsrate aufgefangen (1998: 47 %). […] Ein gutes Viertel [aller Ermittlungsverfahren] wird an das Gericht durch Anklage/Strafbefehlsantrag weitergegeben. Der Rest wird auf sonstige Weise erledigt“. Im Kontext zunehmender ökonomischer Restriktionen entwickeln sich formalistisch rechtsstaatliche Strukturen des Strafverfahrens demnach offensichtlich zu einer administrativ-bürokratische Grundstruktur hin. Dabei führt ein gesteigertes Maß an administrativer Entscheidungsfindung zum einen zu einer gesteigerten Diversität der Strafen und zum anderen dazu, dass ein legalistischer Prozess durch administratives Ermessen ersetzt wird bzw. die Logik des Rechts unter die wechselnden Rationalitäten der Politik subordiniert wird (vgl. Albrecht 1994, 1999, Naucke 1999, Pratt 1989): „public policy predominates over individual rights, […and] regulation rather than adjudication become[s] the primary form of dispute management” (Freiberg 1986: 105). In dem Maße, wie justizielle Regulierungen aus der Jurisdiktion im engeren Sinne abgekoppelt und in eine Angelegenheit der Exekutive und Exekutivorgane umformuliert werden - die, wie Detlev Frehsee (1997: 115) sarkastisch bemerkt „durch Recht möglichst wenig behindert werden“ sollen - wird das Strafrecht „zu einem flexiblen Interventionsrecht […]. Aber den Widerspruch zwischen Machtbegrenzung und Effektivitätssteigerung bzw. Machtsteigerung hält das rechtsstaatliche Strafrecht nicht aus. Es verliert seine Eigenständigkeit gegenüber der Macht, seine freiheitssichernde Funktion im Zugriff einer populistischen Politik“ (Schöneburg 1999: 21). Dabei besteht fundamentale Bruch der strafjustiziellen Logik nicht in der Frage, ob die Politik und die Exekutivorgane nun ‚populistisch’ sind oder nicht, wesentlich ist, dass die liberal-demokratische Überzeugung aufgegeben wird, die Prämissen der Exekutive hätten in einem rechtsstaatlichen Strafrecht nichts verloren46. Der ‚Systembruch’ besteht ferner auch nicht primär darin, dass die neuen Logiken des Strafrechts um Begriffe wie „Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege, Entlastung der Strafrechtspflege, schlanke Justiz, effizientes Strafrecht“ kreisen, sondern darin, dass diese Topoi und Rationalitätskriterien an die Stelle der freiheitsverbürgenden Leitbegriffe des klassischen Strafrechts „wie Unschuldsvermutung, materielle Wahrheitserforschung, Subjektqualität des Beschuldigten, fair trial usw.“ getreten sind (Frehsee 1997: 15, vgl. Albrecht 2000). Eine exekutivische Rechtsprechung, ist aus einer liberaldemokratischen Perspektive kaum weniger als das Gegenstück der rechtsstaatlichen Legitimationsbasis staatlichen Strafens einer demokratischen Gesellschaft. So führte Ipsen 1950 in einem Essay über das Grundgesetz aus: „Rechtlich entscheidend für die Rechtstaatlichkeit ist die Bändigung und Schwächung der Exekutive, die Aktualisierung aller Grundrechte im Sinne unmittelbarer Bindung aller Staatsgewalt“ (Ipsen 1968: 22). D.h. solange eine rechtsstaatlich verfasste Demokratie als Maßstab dient, müsste es eigentlich darum gehen, die Exekutive dem Recht zu unterwerfen, und nicht das Recht der Exekutive als ein Mittel der Wahl unterzuordnen. 46 423 Die politisierte Erledigungsstruktur durch die Staatsanwaltschaft - und teilweise sogar nur durch ihr ‚Hilfsorgan’ Polizei - ist keinesfalls nur ein Problem einer abstrakten Rechtsdogmatik, sondern ein sehr konkreter teilweise entscheidender Selektionsfilter im Strafprozess. Dabei kann insbesondere im Kontext von strafrechtlich auffälliger Jugendlicher die These einer administrativen Rationalisierung Gültigkeit für sich reklamieren. Hierfür spricht etwa die Tatsache, dass nicht nur je nach Bundesland (vgl. Deichsel 1997: 219, Pfeiffer 1989), sondern wie Spieß und Storz (1989) aufzeigten, auch innerhalb eines Landes, je nach Gericht, die in verschiedenen Orten variierenden Fallzahlen durch einen uneinheitlichen - genauer der exekutivischen und ökonomischen Willkür folgenden - Gebrauch von Diversionsentscheidungen flexibel an die gerade vorhandenen Ressourcen der Strafjustiz angepasst werden. Insgesamt war bereits 1995 die Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen dreimal so hoch wie die Zahl ihrer Ab-, und fünfmal so hoch wie die Zahl der Verurteilungen (vgl. Kunz 1998: 267). Diese Zahlen sind vor allem das Produkt einer raschen unaufwendigen Routineerledigung in den Verfahren ohne förmliche Verurteilung, die dem „Gesetz der ökonomischen Erledigung [folgen]: Das System der Kriminalitätskontrolle kann aus Kapazitätsgründen nur einen begrenzten Arbeitsaufwand verkraften. Je höher der Input an den zu bearbeitenden Vorgängen, desto höher ist deshalb der Output an simplen und raschen Erledigungsentscheiden“ (Kunz 1998: 271). Aus dieser Perspektive betrachtet, stellen sich die Prozesse der Entpönalisierung und Diversion sowohl als verfahrensökonomische Konsequenz aus der gesellschaftlichen Entwicklung hin zu ‚Hochkriminalitätsgesellschaften’ dar (vgl. Garland 2001) als auch aus der politischen Weigerung materielle Entkriminalisierungen vorzunehmen (vgl. Albrecht 1993a). Die Perspektive einer administrativen Rationalisierung steht in einem gewissen Widerspruch zur ‚klassischen’ Kritik der Diversion, nämlich der These des ‚net-widening’ Effekts (vgl. Cohen 1979), der vor allem in den USA festgestellt worden ist (vgl. Kobrin/Klein 1983, kritisch: McMahon 1990). ‚Netwidening’ meint, dass sich in Folge De-Institutionalisierung, formalen Entpönalisierungen und Diversion der Kontrollanspruch des Staates nicht reduziert habe – ‚Streitregelung im Schatten des Leviathan’ lautet der Titel einer Untersuchung von Gerd Splitter (1985) – sondern im sich Gegenteil als additionale, die alten Formen der Bestrafung im Kern unberührt lassende Maßnahmen (vgl. Hudson 1987: 149) über das Gefängnisses hinaus, mittels einer disziplinierenden, expertokratischen nichtsdestoweniger jedoch ‚weichen’ und vornehmlich sozialpädagogisch angeleiteten Form in die Lebenswelten hinein verlängert habe (vgl. Otto 1995, Ludwig-Mayerhofer 1997, Schmidt-Semisch 2002). Dabei wenden sich die Diversionsentscheidungen fast ausschließlich der minderschweren Kriminalität (vgl. Kaiser 1993: 92) bzw. jenen Akteuren zu, die ohnehin kaum weiter mit dem Gesetz in Konflikt geraten wären (vgl. Albrecht 1983: 39). Diversion (englisch ‚Umleitung’), so der Kern der Kritik, leitet die staatliche Kontrolle weniger um oder ab, sondern weitet sie auf diejenigen aus, die man eigentlich hätte laufen lassen können, bzw. sie wirft als flexibles, niedrigschwelliges Kontrollinstrument das staatliche Kontrollnetz auch noch über jene, die man vorher hat laufen lassen müssen, weil die Waffen des Strafrechts zu gewesen grobschlächtig waren. Durch die Informalisierungsprozsse seien diese Waffen flexibilisiert und zugleich 424 ein Prozess initiiert worden, indem die Befugnisse von pädagogischen, psychologischen und medizinischen Experten weniger alternativ als additiv zum Strafrecht ausgeweitet werden. Vor allem die freiheitssichernden Logiken des Rechts seien dabei, so die Kritik, durch die Logiken und fachlichen Kriterien dieser absorbierten Professionellen mehr als zuvor aufgeweicht worden: in Form einer flexibilisierten Adaption des strafrechtlichen Instrumentariums hätten sich damit staatliche Interventionsbefugnisse erweitert, während die Informalisierung vor allem die Rechte und Schutzgarantien der Betroffenen reduziert habe (im Überblick: Muncie 1999). Diese Kritik hat sich empirisch in so fern als berechtigt erwiesen, wie freiheitsfördernde Wirkungen einer Informalisierung der Justiz nicht festgestellt werden konnten (vgl. Albrecht 2000, Kaiser 1993, Ludwig-Mayerhofer 1998) und auch eine zwischen 1963 und 1991 erfolgte Steigerung der Probanden der Bewährungshilfe um rund 477 % (vgl. Weber 2001) spricht dafür, dass sich die Reichweite strafrechtlicher Kontrolle deutlich erweitert hat. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei möglichen ‚net-widening‘ Effekten der Diversion kaum um das Ergebnis eines ‚Masterplans‘ der intendierten, subtilen Ausweitung von Kontrolle und Macht der beteiligten Kontrollinstanzen handelt, sondern eher um nicht – zumindest ‚nicht so’ - intendierte ‚Betriebsunfälle‘ (vgl. Garland 2001, Saul/Davidson 1983). Es finden zwar ‚net-widening’ Prozesse statt, aber diese lassen sich eher im prä-justiziellen als in dem im engeren Sinne justiziellen Bereich des Feldes der Kriminalitätskontrolle rekonstruieren. In letztgenannten geht es um eher um Rationalisierungen und Effektivierungen und weniger um eine pauschale Erweiterung des Netzes. Im Gegenteil, das Kriminaljustizsystem selbst ist bestrebt institutionalisierte ,net-widening’ Prozesse zu vermeiden und zurückzudrängen: man ist eher bestrebt, die Dichte der Maschen zu verringern als die Breite des Netzes zu vergrößern. Im konservativ regierten Großbritannien etwa, mahnt die ,Audit Commission’ im Jahr 1989 an, dass sich die Bewährungshilfe noch stärker als bisher bemühen sollte, ,net-widening’ Effekte zu vermeiden. Die Bedenken beziehen sich aber weniger darauf, dass mehr Akteure in das strafjustizielle System gezogen werden und sich staatliche und strafrechtliche Kontrollansprüche unterhalb formeller Verfahren erweitern, sondern schlicht darauf, dass eine Verbreiterung des institutionellen Netzes der Kontrolle in fiskalischer Hinsicht verschwenderisch ist (vgl. Garland 1996). Mehr noch als in Großbritannien und in den USA (dazu: Ezell 1995), spricht die empirische Forschung in der Bundesrepublik dafür, dass Prozesse quantitativen der Ausweitung des strafrechtlichen Netzes im engeren Sinne nicht in dem Ausmaß eingetreten sind, wie dies von kritischen und liberalen Kriminologen in den 1980er Jahren befürchtet worden ist (vgl. Heinz 1986, 1995, Plewig 1991). Auch die vorhandenen Tendenzen eines solchen Effekts, sind in der Regel durch einen Verzicht auf formaljustizielle Prozesse strafrechtlicher Kontrolle mehr als kompensiert worden (vgl. Micheel 1995). Demgegenüber bestehen die am stärksten anwachsenden Maßnahmen - die in so fern als ‚Diversion’ betrachtet werden können, wie sie exekutiv, ohne formelles Verfahren angeordnet werden - in jenen administrativ am einfachsten zu handhabenden Formen, die ohne ein aufwendiges Zutun der ‚sanften Kontrolleure’ (vgl. Peters/Cremer Schäfer 1975) wirksam werden: Die Mehrzahl der ‚ambulanten’ Maßnahmen, die ‚divertierbare’ Jugendliche erfahren, bestehen in ‚gemeinnütziger’ Arbeiten (vgl. 425 Ludwig-Mayerhofer 1997), die nur sehr begrenzt als ‚Pädagogisierung’ sanktionierender Kontrollen verstanden werden können (dazu: Otto 1995). Diversion lässt sich in diesem Sinne als ein – wenngleich nicht sonderlich erfolgreicher (Kaiser 1993, Ludwig-Mayerhofer 1997) - Bestandteil einer Strategie der nicht-formalisierten ‚Herunterdefinition von Devianz’ (Moynihan 1992) verstehen. Dabei wird in Form eines dosierten Sanktionsverzichts - dessen nicht ergriffene Alternative eine substanziellen Entkriminalisierung wäre (vgl. Plewig 1995, Albrecht 1999) – zu einem gewissen Grad versucht, bestimmte Delikte möglichst völlig aus dem formellen Strafjustizsystem herauszufiltern. Vor allem geht es aber darum das Maß und den Aufwand zu verringern, in dem Verhaltensweisen formal kriminalisiert und pönalisiert werden. Die Wirkungen auf die dieses ‚Herunterdefinieren’ zielt sind dann aber ziemlich genau das Gegenteil einer Kontrollnetzerweiterung. Vielmehr ist es darauf gerichtet „to let minor offences and offenders fall below the threshold of official notice – to allow them to lip a, net’ that is in danger of bursting at the seams” (Garland 1996: 456f). Statt einer subtilen Ausweitung des strafrechtlichen Herrschaftsbereichs lässt sich aus dieser Perspektive auf Diversionsprozesse eher von einer Art ‚prosaischem’, ‚ökonomischen Abolitionsimus’ sprechen, in dem - im Gegensatz zu einem politischen und bis zu einem gewissen Grad ‚sozialromantischen’, strafrechtssystematischen Abolitionismus – ein Sanktionsverzicht und eine partielle Herunterdefinition der Kriminalität als ein „attractive label [darstellt] to clean up the criminal justice system’ caseload and to transfer petty crime offences to alternative modes of control“ (Lee 2001: 82, Council of Europe 2000). Die Rationalitäten dieser Prozesse folgen keinem sozialreformerischen Eifer, sondern dem kühlen Pragmatismus der ökonomischen Vernunft: „Haben Entdeckungsrisiko und Strafdrohung zu geringe Wirkungen auf eine Tätergruppe, dann muß eine höhere optimale Deliktrate, bei der sich Schäden durch die Delikte und Kosten für die Strafverfolgung die Waage halten ‚in Kauf’ genommen werden: Diversionsmaßnahmen bei Jugendlichen […] ergeben sich folglich als rein ökonomische Maßnahmen“ (Karstedt/Greve 1996: 178). 426 IV. 2. 4 EXKURS: JUGENDHILFE ALS ADMINISTRATIVE RATIONALISIERUNGSHILFE – EIN BEISPIEL Ein ‚ökonomischer Abolitionismus’, der sich in Form von Diversionsbemühungen manifestiert, ist zwar ein beträchtlicher, aber eben nur ein Bestandteil eines größeren Prozesses der ‚administrativen Rationalisierung’ und Informalisierung des institutionellen Umgangs mit Abweichung. Im Gegensatz zum ‚humanistischen’ politisch engagierten Abolitionismus ist der Sanktionsverzicht für den ökonomischen Abolitionismus kein eigenständiges Ziel, sondern lediglich ein Mittel zum Zweck. Für diesen Zweck, einer administrativen Rationalisierungen, stehen neben der Herzunterdefinition von Devianz und einer partiellen Ent-Pönalisierung – im Gegensatz zu der vom politischen Abolitionsmus geforderten ‚Ent-Kriminalisierung’ - noch eine Reihe weiterer Mittel zur Verfügung, wie etwa die Beschleunigungen der Verfahrenszeit oder Versuche der Verringerung des zeitlichen Abstandes zwischen Delikt und ‚Urteil’, bzw. häufiger noch, staatsanwaltschaftlicher oder gar polizeilicher Erledigung – nicht selten im Verbund mit der Jugend(gerichts)hilfe (vgl. Hantzsch 2000). Dabei bestehen Ambitionen diese Rationalisierungsprozesse künftig durch die Anwendung des ‚beschleunigten Verfahrens’ (§ 417 StPO) auch im Jugendstrafverfahren, sowie die Anwendung von § 230 StPO zu forcieren, der eine zwangsweise Vorführungen inklusive eines Haftbefehl bei unentschuldigtem Ausbleiben im Verfahren ermöglicht (vgl. BR Drucksache 549/00/BT Drucksache 14/5014). Einfallstor für Verfahrenbeschleunigungen im Jugendstrafrecht bilden das ‚vereinfachte Jugendverfahren’ (§§ 76 ff JGG) sowie und vor allem die in vielen Gerichtsbezirken ohne formale legislative Änderungen der Verfahrensvorschriften eingeführten ‚vorrangigen Jugendverfahren’. In diesen Kontext gehört etwa auch das ‚Haus des Jugendrechts’, wie es beispielsweise Stuttgart und anderen bundesdeutschen Großstädten als ein Kooperationsprojekt zwischen der Staatsanwaltschaft und – in einer besonders engen räumlichen und strukturellen Verknüpfung (vgl. Gabriel 2000) – der Jugendhilfe und der Polizei erprobt wird. Dabei wird die schnelle und zeitnahe Reaktion auf Delinquenz als explizites Ziel formuliert (vgl. Feuerhelm/Kügler 2001: 104, Gabriel 2000, DJI 2001). Die Etablierung solcher Einrichtungen verdeutlichen zunächst vor allem, dass sich die Prozesse einer administrativen Rationalisierung offensichtlich primär auf Ebene des Verfahrens richten, wobei der Sanktionsverzicht eine mögliche Konsequenz, nicht aber ein per se politisch gewünschtes Ziel darstellt. Im Gegenteil zielt der gegenwärtige Boom der Etablierung sub-strafjustizieller Einrichtungen, gerade nicht auf die Ausweitung der Ent-Pönalisierung, sondern der Eröffnung von Reaktionsmöglichkeiten, die sich – jenseits eines zeitlich, ökonomisch und bezüglich des benötigten ‚Humankapitals’ ungleich aufwendigeren formellen Verfahrens - in erster Line auf geringe und vor allem bereits auf die ersten Verfehlung beziehen (vgl. DJI 2001). Als Vorbild dieser neuen Institutionen kooperativer (prä)justiziell-pädagogischer Interventionen dienen dabei die in den Niederlanden seit den 1980er Jahren47 institutionalisierten – und durch ein Gutachten des van Montfrans Komitees (1994) mit dem bezeichnenden Titel ‚Met de neus op de feiten’ (‚Den Fakten ins Auge sehen’) vorangetriebenen - ‚Halt Büros’ (vgl. van Hees 2001). In den Niederlanden 427 wie in der Bundesrepublik wird der Jugendhilfe in diesen Institutionen eine wesentliche Rolle zugedacht wird. Charakteristisch für die Halt-Büros - wie für ihre deutschen Kopien - sind vor allem drei Merkmale: 1. Die Reaktion soll möglichst schnell nach dem Normbruch erfolgen. 2. Die Reaktion soll sich inhaltlich an den Charakteristika der Tat orientieren. 3. Die Reaktion soll in einer Weise normativ verdeutlichend gestaltet sein, die sich nicht auf die Person des Täters, sondern auf seine Tat bezieht (vgl. van Swaaningen 2002: 264). Obwohl einzelne Elemente dieser durchaus retributiven Philosophie im Umgang mit Jugenddelikten wie eine späte Ankunft der angelsächsischen ‚back to justice’ und ‚just desert’ Initiativen anmuten, wird gerade vom a-techologischen Kerngehalt der neo-klassischen Perspektive, dem ‚due process’ und ‚fair trail’ systematisch abgesehen (dazu: von Hirsch 1976). Entsprechend liegen aus einer rechtsstaatlichen Perspektive (vgl. Meertens 1997) ebenso wie aus der Perspektive einer modernen Kinder- und Jugendhilfe, die möglichen Einwände gegen diese ‚Schnellverfahren’ - die sich ja auf jene ‚weniger schwerwiegenden’ Erst- und Bagatelldelikten von jüngeren Jugendlichen beziehen, die wenn es um das Ziel einer Ent-Pönalisierung gehen würde, eigentlich das bevorzugte Objekt einer ‚diversion to nothing’ wären (vgl. Deichsel 1997) - auf der Hand: eine Schlechterstellung bzw. Nichtexistenz der Verteidigungsseite, ein Verstoß gegen die Gewaltenteilung wie die Unschuldsvermutung, eine Vorverlagerung der Sanktionen ebenso eine Beeinträchtigung des Datenschutz sowie des ‚Freiwilligkeitsgrundsatzes’ in der Kinder- und Jugendhilfe (vgl. Gabriel 2001: 19, Albrecht 2000). Stärker noch als im Bereich der Diversion findet nicht nur eine relative Kompetenzverlagerung zugunsten der Exekutive statt, sondern teilweise eine völlige Abgabe justizieller Zuständigen direkt an die Polizei und partiell an die Jugendhilfe, denen damit ermöglicht wird eigenständig und autonom d.h. ohne Einbeziehung der Staatsanwaltschaft - qua formeller Ermahnung, Arbeitsauflagen und anderen erzieherischen Maßnahmen ein Verfahren abzuschließen (vgl. Ostendorf 2001). Wenn damit wie der ‚pragmatischen’ und ‚präventiven Lösungen’ ansonsten nicht gerade abneigte Strafrechtler Heribert Ostendorf ausführt „die Polizei faktisch das Sagen hat, wenn Ermittlungskompetenz und Sanktionskompetenz in einer Hand liegen, wird tendenziell wieder der Inquisitionsprozess eröffnet. Wenn der Sozialarbeiter als Diversionsmittler erzieherisch gemeinte Sanktionen umsetzen darf, so wird Sozialarbeit nicht nur zum Büttel der Strafjustiz, sondern sie wird Strafjustiz im sozialarbeiterischen Gewande“ (Ostendorf 2001: 7) Auf einer politischen Ebene stellen diese Verfahren die Möglichkeit dar, auf Entkriminalisierung und Ent-Pönalisierung der scheinbar ‚bedrohlich steigenden Kinder- und Jugendkriminalität’ zu verzichten, und zugleich zeit- und vor allem geldsparend auf die kinder- und jugendspezifischen Facetten von ‚Hochkriminalitätsgesellschaften’ ‚öffentlich’ reagieren zu können (vgl. u.a. JMK 2000, BMI 2001). Dieser Blick auf die öffentlichkeitswirksam inszenierte, symbolische Dimension wird von den politischen Protagonisten auch nicht bestritten, sondern vielmehr eigens betont: Durch entsprechende Maßnahmen als „wirksame Denkzettel“ soll auch im „Bereich der Klein- und Bagatellkriminalität [… ] jedem ganz früh gezeigt werden, dass Gesetzesverletzungen nicht akzeptabel sind“ (Däubler-Gmelin 2000.:9). Schnelle, wirksame ‚Denkzettel’ haben dabei gegenüber einer folgenlosen Diversion vor 47 Das erste HALT Büro wurde 1981 in Rotterdam eröffnet 428 allem den symbolischen Effekt, Reaktionsfähigkeit zu demonstrieren und versprechen zugleich in administrativer und ökonomischer Hinsicht effizient zu sein. So ist es offensichtlich, dass schnelle Verfahren – mit dem Verzicht auf Wiedervorlagen, Verfügungen usw. - ökonomischer und effizienter sind als langwierige formalistische Verfahren und es ist ebenfalls erwartbar, dass es einer solchen Justiz – auch wenn nicht die Jurisprudenz, sondern die administrative Exekutive die entscheidende Instanz ist - möglich wird sich von dem Vorwurf ‚langsam mahlender Mühlen’ zu befreien, und sich als Teil der effizienten Verwaltung in einem ‚bürger-’ oder zumindest steuerzahlerfreundlichen Licht darzustellen (vgl. Feuerhelm/Kügler 2001: 103). Mit Bezug auf die zugrunde gelegten Kontrolllogiken schließt eine solche Präventionsstrategie diesmal allerdings primär bezogen auf auffällige Jugendliche - an den Umgang mit Abweichung und Kriminalität vor der großen Strafrechtsreform von 1969 an. Wie Brusten (1999: 535) ausführt waren die Jahre vor der Strafrechtsreform noch eine „Zeitepoche der Abschreckung […]. Der ‚kurze scharfe Schock’ galt als Patentrezept gegen Kriminalität“. Dieser ‚kurze scharfe Schock’ feiert in bezug auf Bagatellen seine fortgeschritten liberale Wiederauferstehung im pädagogischen Gewandt. ‚Jugendgemäß’ und entwicklungsförderlicherweis wird er nicht mehr als ‚kurz’ und ‚scharf’, sondern als „heilsamer Schock“ beschrieben48 - nur an der zu Grunde liegenden Logik ändert dies freilich nichts. In ihrer Stellungnahme zum Sicherheitsbericht spricht sich die Bundesregierung insgesamt für ambulante Maßnahmen aus, bei denen es „in erster Line darum [gehen soll], das derzeitige Sanktionensystem mit dem Ziel zu erweitern, dem Täter die Folgen seines Tuns möglichst spürbar vor Augen zu führen“ (BMI/BMJ 2000: 608). Eine Gesetzesinitiative des Brandenburgischen Justizministeriums sieht hierfür eine Einführung des ‚Warnarrest’ für Jugendliche vor (vgl. BMJE Brandenburg 2000), für den sich insbesondere Konservative – ergänzend zu einer „Einführung des ‚Einstiegsarrests’ zu Beginn einer Bewährungszeit als eine Art ‚Schnupperstrafvollzug’“ (Kreuzer 2002) - bundesweit und flächendeckend aussprechen (vgl. etwa Gais 2002). Dass die Effekte dieser Vorgehensweise der schnellen ‚spürbaren’ Reaktion - im internationalen Diskurs unter den Labeln ‚short sharp shock’, ‚shock probation’ oder ‚shock parol’ verhandelt (zur Vergleichbarkeit siehe Karstedt 1999d, 2001) – in empirischer Hinsicht als wirkungslos gelten und regelmäßig sogar als kontraproduktiv einzuschätzen sind (vgl. Karstedt 2001, Schumann 1999, MacKenzie 1997) ist dabei wenig relevant. Auch die an sich bemerkenswerte Tatsache, dass die Forderung nach schnellen und deutlichen Eingriffe in einem offensichtlichen Widerspruch zur gängigen, außerökonomischen Legitimation der Diversionsstrategien steht - nämlich dass es ob einer krisenverstärkenden Wirkung repressiv oder zwangserzieherisch angeordneter Maßnahmen, angebracht sei, sich diesbezüglich möglichst lange zurückzuhalten und möglicht wenig bzw. gar nicht auf diese Weise zu intervenieren (vgl. Heinz 1993: 56 ff) – ist systematisch betrachtet eher ein Nebenwiderspruch. Der ‚Hauptwiderspruch’ ist ein anderer: Diese Formen der Beschleunigung werden – wenn sie, wie es heißt, mit ‚pädagogischem Sinn’ versehen werden (vgl. JMK 2000: 5, JGT 1998: 6), der den ‚Erziehungsgedanken zum Ausdruck’ bringen soll (vgl. AGJ 2001: 13, DJI 2001) – auch von So zumindest die Justizministerin von Baden-Württemberg in einer Presseerklärung zur Bundesratsinitiative vom 29.04.2003 48 429 Vertretern bzw. Verbänden der Jugendhilfe ausdrücklich mit sozialpädagogischen Argumenten legitimiert. Aus der Perspektive organisationeller Interessen betrachtet ist das durchaus rational. So sorgt ein sozialpädagogisch begründete Beitrag zur ‚administrativen Rationalisierung’ doch zumindest potenziell für eine Erhöhung der Fallzahlen und für eine Ausweitung der justizunabhängigen Gestaltungsmacht sozialpädagogischer Stakeholder im Kontrollgeschäft, indem justizelle Kompetenzen in ihre relativ autonome Verantwortung verlagert werden49. Die Argumentation der Vertreter der Jugendhilfe ist dabei zweigeteilt: zum einen geht es darum, dass ‚rasche und konsequente’ staatliche Reaktionen wesentlich für Jugendliche wären, um die ‚Verwerflichkeit ihres Handelns einsehen’, die Strafe besser begreifen und vor allem ihren Taten direkt zuordnen können. Dadurch könne eine „wirksame Normverdeutlichung und Verhaltensänderung“ (Gabriel 2001: 20) erreicht werden. Das andere Argument lautet schlicht, dass durch die schnelle Reaktion ‚notwendige’ erzieherische Eingriffe und Hilfen schneller greifen können (vgl. Gabriel 2001, Zink 2001). Während der erste Teil der Argumentation im Kern eine mit verschiedenen Restbeständen sozialpädagogischer Rhetorik durchsetzte Mischung aus einer Selbstverantwortungsideologie und Forderungen nach einem schnellerem und härterem Eingreifen darstellt, damit die kriminellen Kinder und Jugendlichen der ‚hilflosen Polizei’, ‚laschen Justiz’ und den ‚weichen’ Sozialen Diensten nicht länger ,auf der Nase herumtanzen’ können, rekurriert der zweite Argumentationsstrang zwar oberflächlich auf die klassische These, das Jugendkriminalität auf einem Erziehungsdefizit beruhe – und deshalb „eine möglichst zeitnahe Reaktion von Polizei und Justiz sowie der Kinder- und Jugendhilfe bei strafbarem Verhalten gefragt [… sei u]m dem im Jugendstrafrecht verankerten Erziehungsgedanken Rechnung zu tragen“ (BMI/BMJ 2001: 61) - sublimiert sie jedoch in entscheidenden Punkten. Um den Bruch deutlich zu machen ist es nicht unwesentlich, dass die ‚kurzen Schocks’ Ende der 1960er Jahre nicht nur wegen ihrer Unwirksamkeit, aufgrund ideologischer Schwierigkeiten im Kontext eines expandierenden Wohlfahrtstaats und aufgrund der viel zu hohen Kosten50 aufgegeben worden waren, sondern vor allem auch weil sich die Repräsentation des ‚Kriminellen’ auf genau jene Weise veränderte die den personenbezogenen sozialen Dienste den vollen, gestaltungsmächtigen Zugang in den fordistischen Strafwohlfahrtskomplex eröffnet hatte: „Nicht mehr der ‚kurze scharfe Schock’ schien ihn [den Delinquent] von weiteren Verbrechen abzuhalten, sondern Sozialisierung, Resozialisierung und therapeutische Behandlung“ (Brusten 1999: 535). Dabei ist an dieser Stelle gar nicht so sehr die Frage, ob der Zugriff selbst – z.B. in seinen therapeutischen Varianten - eher dispositionsorientiert war, oder sich in seinen im engeren Sinne Allerdings ist in diesem Kontext der Preis für diesen Gestaltungsspielraum das fundamentale sozialpädagogische Handlungsrationalitäten hinaus eskamotiert werden. 50 Die hohen Kosten ergeben sich daraus, dass die ‚kurzen, scharfen Schocks’ vor allem in Form von kurzen Haftstrafen wirksam geworden sind, die in der aktuellen Debatte um die schnelle Reaktion – etwa im Kontext der Einführung eines ‚Warnarrests’ – zwar durchaus eine Rolle spielen, aber nicht mehr im Vordergrund stehen (und von den in der Literatur relevanten Vertretern der Jugendhilfe auch in der Regel abgelehnt werden). 49 430 sozialpädagogischen Formen in einer dispositionssensiblen Weise auch auf Fragen der sozialen Positionen, bzw. der ‚schlechten sozialen Bedingungen’ bezogen hat. Wesentlich ist vor allem, dass Abweichung als ein Ausdruck einer positional-dispositional Verortung des Akteurs gefasst worden war, und es den zentralen Gedanken der ‚positiver Spezialprävention’ darstellte, in erster Linie diese Verortung zu bearbeiten. Während der erste, auf eine rasche und konsequente Reaktion gegenüber den Taten der Jugendlichen bezogene, Teil der ‚sozialpädagogischen’ Rechtfertigung ‚schneller Reaktionen’ offensichtlich mit dieser Logik wenig gemein hat, gilt der Bruch mit der straf-wohlfahrtlichen Präventionslogik etwas abgemildert und weniger offensichtlich auch für den ‚sublimierten Erziehungsgedanken’ im zweiten sozialpädagogischen Diskussionsstrang einer schnellen Reaktion. Dabei ist nicht nur wesentlich, dass die Interventionen rein dispositionsorientiert erfolgen, sondern vor allem, dass sie nicht mehr darauf zielen durch sozialpädagogische Interventionen die positional-dispositionale Matrix der Adressaten zu verändern: Devianz ist das Problem und nicht ‚nur’ der Ausdruck eines anderen ‚wirklichen’ Problems auf das sozialpädagogisch zu reagieren ist. Wenn aber der performative Akt selbst das identifizierte Problem, auf dass sich die Interventionen beziehen, verändert sich zugleich die Präventionslogik. Diese Veränderung lässt sich am Beispiel der Debatte um die ‚schnelle Reaktion’ anschaulich verdeutlichen. Gemeinhin gilt die Idee der –v.a. ‚generalpräventiv’ begründeten - ‚Abschreckung’ vor allem auf der ideologischen Ebene als das Gegenstück der ‚positiven Spezialprävention’ insbesondere in ihrer ‚wohlfahrtsstaatlich-pädagogischen’ Form (vgl. Brusten 1999, Zimering/Hawkins 1973). Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, verdichten Cesare Beccaria (1738-1794) und Jeremy Bentham (1748-1832) drei wesentlichen Komponenten einer Reaktion auf Rechtsbrüche zu einer utilitaristischen Theorie der Abschreckung: - die Geschwindigkeit der Sanktion, - die Sicherheit ihres Eintretens und - die Strafhöhe (vgl. Bentham 1962, Beccaria 1963). Beccaria (1963: 58, 55) hebt vor allem die „certainty of punishment“ gegenüber der Strenge der Strafe hervor. Dabei lautet sein Kernargument, dass „the more promptly and the more closely punishment follows upon the commission of a crime, the more just and useful it will be“. Jeremy Bentham betont indes vor allem die ‚Klarheit’ der Strafe. Dass der Rechtsbrecher eine einfache Verbindung zwischen seiner Tat und der Sanktion herstellen kann, ist für ihn die wesentlichste Bedingung der Wirksamkeit der drei Komponenten der Abschreckung. Was nun mit Blick auf die Annahmen und Argumente dieser utilitaristischen Abschreckungstheoretiker verblüfft ist, dass - obwohl weder der Utilitarismus als Begründung einer wohlfahrts- und subjektorientierten Jugendhilfe greift (dazu Brumlik 1992), noch die Abschreckung als ein Präventionsmodus für diese traditionelle ‚soziale’ Form der Jugendhilfe eine prägende Rolle besitzt (vgl. Peters 1995, 2002) - im Kern deckungsgleich mit fortgeschritten liberalen ‚sozialpädagogischen’ Argumenten der ‚neo-realistischen’ Protagonisten einer ‚schnellen Reaktion’ auf Jugenddelinquenz sind. 431 Möglicherweise lässt sich argumentieren, dass ein Unterschied darin besteht, der Strafhöhe sowohl empirisch eine vergleichsweise geringe Bedeutung beigemessen wird (vgl. u.a. Karstedt 1993, Kunz 1998) und ihr auch bei der sozialpädagogischen Hilfe zur administrativen Rationalisierung nicht jene zentrale Rolle zukommt, die ihr in Benthams - und als moderneren Varianten in Wilsons (1975) und Ehrlichs (1972) - ‚einfachen’ oder ‚direkten Abschreckungsmodell’ zugemessen wird (vgl. Zimering/Hawkins 1973). Bedenkt man jedoch, dass es sich um die Implementation Reaktionen gegenüber Akteuren und ihren Delikten handelt, gegenüber denen – so dass Argument – man vorher keine angemessene handhabe gehabt hätte und die häufig ‚einfach so’ davon gekommen wären, und beachtet man ferner, dass es bei diesen ‚schnellen Reaktionen’ sehr wohl um eine ‚wirksame Normverdeutlichung’ und einen ‚spürbaren Denkzettels’ gehen soll, dass auch in diesem Diskurs der Fragen der höheren Strafintensität offensichtlich Bedeutung beigemessen wird. Als zentrale Momente werden jedoch die Reaktionsgeschwindigkeit und die Verbindlichkeit ihres Eintretens hervorgehoben und schließlich wird das Argument der Klarheit, nämlich dass die Tat und die Sanktion in Verbindung gebracht werden müssen, als das zentrale (sozial)pädagogische Moment angeführt (vgl. DJI 2001). Kurz, sowohl in bezug auf die Begründung des Inhalts als auch hinsichtlich der (Reihenfolge Hauptkomponenten Argumente der) einer zumindest Gewichtung, der utilitaristischen bezüglich drei von Straftheorie, ihrer Beccaria und entsprechen erhofften, Bentham die präventiven elaborierten ‚sozialpädagogischen’ Wirkungen einer Argumentationsrationalität, die eine ebenso enge, vielleicht sogar engere Verwandtschaft zu den (neo-)klassischen Strategien der Abschreckung aufweisen, als zu den Logiken des ‚sozial’ strukturierten Straf-Wohlfahrtskomplexes. Dem steht nicht entgegen, dass mit Blick auf den rein empirischen ‚Output’ der Maßnahmen der Jugendhilfe, eine abschreckende Wirkung sozialpädagogischer Interventionen per se nicht unbedingt einen Bruch mit bisherigen Rationalität der Jugendhilfe im Umgang mit jugendlichen Abweichlern darstellt. Wie Susanne Karstadt-Henke (1989) überzeugend rekonstruiert hat, brauchen auch die klassischen Interventionen in Bezug auf die von den Jugendlichen subjektiv empfundene Sanktionsschwere den Vergleich mit formellen Sanktionen keinesfalls zu scheuen. Während die abschreckende Wirkung dort aber eine Art ‚Nebenwirkung’ darstellte, hat sie in den ‚schnellen Reaktionen’ offensichtlich einen anderen strategisch-instrumentellen Stellenwert. Wesentlich ist, dass der abweichende Jugendliche im Vergleich zu den ‚wohlfahrtsorientierten’ Strafen auf eine veränderte Weise ‚subjektiviert’ wird. Beccarias und Benthams ‚klassisch liberaler’ Ansatz der Strafe baut substanziell auf einer spezifischen Form der Anthropologie auf – namentlich der utilitaristischen Sozialphilosophie in der Tradition von Thomas Hobbes (1588-1679) -, die mit der wohlfahrtstaatlichen Subjektrepräsentation der Jugendhilfe kaum vereinbar ist. Insbesondere Benthams Fassung des Akteurs ist die des Rationalegoisten, der den Entscheidungsregeln einer Kalkulation des Sanktionsrisikos folgt (vgl. H.J. Albrecht 1993, Karstedt/Greve 1996, Westmarland 2001). Im Kontext der ‚schnellen Reaktion’ wird diese Anthropologie zwar nicht (immer) expressis verbis geteilt, sondern stärker - bzw. sehr stark - lerntheoretisch argumentiert (vgl. kritisch: Feuerhelm/Kügler 2001), nichtsdestoweniger bleibt diese Form der Anthropologie im Hintergrund 432 bestehen, zumal Lern- und Abschreckungstheorien logisch und praktisch sehr kompatibel sind (vgl. z.B. Korbin 1975, Andeneas 1974, Gibbs 1975). Nicht zufällig stellen sich etwa James, Q. Wilson und Richard J. Herrnstein (1996: 222) – als zentrale Protagonisten des ‚Rechten Realismus’51 in der Kriminologie und Kriminalpolitik - explizit in die Tradition von Burrhus Skinner, Ivan Pavlov und Albert Bandura. Während der sozialpädagogische Beitrag zur schnellen Reaktion demnach sowohl zur administrativen Rationalisierung als auch zur Abschreckungstheorie ‚passt’, ist ein Passungsverhältnis zu den Logiken des ‚traditionellen’ ‚Straf-Wohlfahrtskomplex’ sehr fraglich. Ist die positional-dispositionale Matrix der Adressaten nämlich das Problem, ist es nicht plausibel warum es von so zentraler Wichtigkeit sein soll, dass eine Maßnahme ‚normverdeutlichend’ und ‚konsequent’ als „individuelle und adäquat gestaltete Reaktion […] schnell nach der Tat erfolgt und sich auf die Tat bezieht“ (Haustein/Nithammer 2001: 82). Ebenso wie eine „eng[e] und zeitnah[e] Kooperation mit der Polizei“ (Zink 2001: 49) ist eine solche Gestaltung sozialpädagogischer Interventionen nur notwendig, wenn im Mittelpunkt der Interventionen die Annahme steht, dass „Maßnahmen und Angebote der […] bei Kindern und Jugendlichen um so effizienter wirken können, je näher sie zum Zeitpunkt der Tat erfolgen“ (Gabriel 2001: 13) damit die Jugendlichen eine Verknüpfung zu ihrer Tat herstellen können, den Sinn der Sanktion einsehen (vgl. Feuerhelm/Kügler 2001) und sich auf Basis dieser Einsicht und im Angesicht der Konsequenzen in Zukunft anders entscheiden. Damit geht es nicht um die Veränderung bzw. die ‚Verbesserung’ der positional-dispositionalen Matrix, sondern um die Etablierung einer ‚rationalen’ Haltung gegenüber der Art und Frequenz unangemessener Verhaltensäußerungen. An dieser Stelle weder soll weder verhandelt werden, ob ein solches Umdenken, wie es im Diskurs um die ‚schnelle Reaktion’ zum Ausdruck kommt, eine ‚gute’ oder ‚schlechte’ Idee darstellt, noch ob die Erzeugung einer solchen rationalen Haltung auf Seiten der Jugendlichen sinnträchtig ist oder nicht. Wesentlich ist, dass der Versuch ihrer Erzeugung eines solchen Habitus als Ziel Sozialer Arbeit nicht einfach nur ein ‚neuer’ Ansatz in der ‚alten’ Jugendhilfe ist. Eine solche Form der Begründung und Praxis der Jugendhilfe, so das Argument, folgt einer substanziell anderen Rationalität, als der der Sozialen Arbeit im fordistisch-keynesianischen Wohlfahrtsstaat. Ob und in wie weit sich diese - und andere - veränderten Logiken im justiziellen Bereich des Feldes der Kriminalitätskontrolle durchsetzen, ebenso wie die Frage, in wie fern sich dies auf die Konstitution der Jugendhilfe, ihre ‚Subjektrepräsentationen’ und den ‚fordistischen’ Straf-Wohlfahrtskomplex als solchen auswirken, ist Gegenstand des nächsten Kapitels. Diese Bezeichnung wurde inzwischen auch von Konservativen in der Bundesrepublik adaptiert. So philosophiert etwa Wolfgang Schäuble (1998: 15 ff) in seinem Werk über ‚Die CDU und die Innere Sicherheit’ über eine - ‚falsche’ ‚soziologisierende’ und eine - ‚richtige’ - ‚realistische’ Kriminologie. 51 433 VI. 3 EINE NEUE STRAF-WOHLFAHRTSALLIANZ? VI. 3.1 DIE ABKEHR VON ‚BEHANDLUNGSIDEOLOGIE’ UND DEM ‚IDEAL DER RESOZIALISIERUNG’ Vor allem im Kontext der diskurskonjunkturellen Hochphase des ‚labeling approach’ verbreitet seit den 1970er Jahren verstärkt die Erkenntnis über die Normalität und empirische Ubiquität von Kriminalität sowie über das ebenso massenhafte Phänomen einer interventionslosen Spontanbewährung der meisten ‚Kriminellen’ (vgl. u.a. Sessar 1984, Heinz 1989). Eine ganze Reihe von Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass „im Schnitt über 90 % der mit Befragungen erfassbaren Jungen und jungen Männer [… zugeben] mindestens einmal in ihrem seitherigen Leben, regelmäßig jedoch wiederholt, Handlungen begangen zu haben, die juristisch unter eine Strafnorm des Strafgesetzbuchs oder eines Gesetzes aus dem sog. Nebenstrafrecht [...] subsumiert werden könnten“ (Kerner 1993: 29). Die für die Strafmoderne kennzeichnende Repräsentation des Abweichlers als ‚homo criminalis’ (vgl. Pasquino 1991) lässt sich vor diesem Hintergrund immer weniger mit der empirischen Wirklichkeit der Verhaltensvarianzen sozialer Akteure in modernen Gesellschaften in Einklang bringen. Diese Einsicht bleibt auch mit Blick auf Jugendhilfe keinesfalls nur ‚akademisch’. Die Feststellung, dass Jugendkriminalität ‚normal’ sei, findet sich nicht nur in pädagogischen, soziologisch und kriminologischen Fachbeiträgen, sondern hat sich zu einer unspektakulären Standardweisheit in allerlei Programmen, Strategiepapieren, Verlautbarungen und Informationsschriften entwickelt - unabhängig davon, ob sie aus der Feder strafrechtskritischer Gruppen, der Wohlfahrtsverbände, der politisch Verantwortlichen oder der Polizei stammen. In ‚politischer’ Hinsicht wird auf dieser Basis nicht nur gegen die ‚harten’ Logiken der Bestrafung argumentiert, sondern auch gegen deren vermeintlichen Konterpart, die nach dem Leitmotiv der ‚Schwäche und Fürsorge’ (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 1998) operierenden ‚Defizitmodelle’ (vgl. Otto 1995) der institutionellen Vertreter des Sozialen. Insbesondere seit den 1980er Jahren wird im fachlichen Diskurs die Dominanz der Konzepte spezialpräventiver Behandlung und Resozialisierung durch den Strafvollzug, zumindest in jener Form wie sie im fordistischen ‚Straf-Wohlfahrtskomplex’ ‚ideologisch’ wie ‚faktisch’ vorherrschend sind substanziell erschüttert. In der Bundesrepublik wie „im europäischen Ausland [werden] durchweg Tendenzen sichtbar, spezialpräventive Bedürfnisse als Legitimationsgrundlage für die Verhängung von Jugendstrafe aufzugeben“ (Dünkel 1990: 107). Das ‚neue’ Common-Sense-Wissen über eine klassenübergreifende Normalität, Ubiquität und Episodenhaftigkeit von Rechtsbrüchen wird nicht nur in sozialpädagogischen, soziologischen und kriminologischen Seminaren zu einem basalen Bestandteil des kanonisierten Wissens, sondern verbreitete sich auch zunehmend auch in der strafjustiziellen Praxis selbst und führt sukzessive zu einer „Jugendstrafrechtreform durch die Praxis“ (BMJ 1989). Diese Einsichten sind kaum vereinbar mit der Grundideologie des ‚Straf-Wohlfahrtskomplexes’, nach der ‚Abweichung’ vor allem ein Ausdruck eines tief liegenden Problems der positional-dispositionalen Matrix benachteiligter sozialer Akteure zu verstehen sei, dem durch ‚assimilierende’, bzw. Intervention zu begegnen sei. 434 normierend-normalisierende professionelle Clarence Ray Jeffery hatte bereits 1960 die drei zentralen Annahmen rekonstruiert auf der die Resozialisierungsidee von Beginn an aufbaute (vgl. Ferri 1901): 1. Das individuelle Verhalten der Abweichler ist durch - vor allem psychologische und soziale – Faktoren determiniert, die außerhalb der Kontrolle der handelnden Akteure liegen. 2. Hieraus folgt eine Andersartigkeit, dieser Akteure, die ‚den Kriminellen’ gegenüber ‚dem Konformen’ identifizierbar macht. 3. Diese Andersartigkeit ist nicht bloß eine phänomenologische Differenz, sondern eine qualitative, ‚defizitäre Andersartigkeit’, d.h. eine Pathologie. Während diese Annahmen gerade für die Legitimation eines Straf-Wohlfahrtskomplex zentrale Bedeutung erlangen52, lassen die Einsichten in Verbreitung, Massenhaftigkeit und Episodität von Normbrüche eine solche ‚verallgemeinerte’ Interpretation nicht mehr zu (vgl. Heinz 2000b, Montada 1998). Neben der Erschütterung der ‚ideologischen’ Basis, potenziert sich, vor dem Hintergrund ihrer Massenhaftigkeit von kriminalisierbaren Handlungsphänomenen, auch das ‚praktische’ Problem der finanziellen und logistischen Unmöglichkeit auf alle Normbrüche in der Rationalität des StrafWohlfahrtskomplexes zu reagieren. In dem Maße wie sich faktisch die Erkenntnis durchsetzt, dass Kriminalität und Devianz in entwickelten Gesellschaften ein verallgemeinertes, nicht suspendierbares ‚Modernisierungsrisiko’ darstellt Bekämpfungsvorstellungen“ (Boers (vgl. 1994: Blinkert 17) 1989), entzieht, wird das der sich „sozialsanitären keynesianisch-fordistischen Kontrollrationalität und dem normierend-noralisierenden Modus der präventiven Kontrolle der Jugendhilfe die Basis entzogen (vgl. Sparks/Loader 2002): der wohlfahrtsstaatliche ‚Behandlungsoptimismus’ (vgl. Ludwig-Mayerhofer 2000) verliert zunehmend seine Funktionalität und seine Legitimation. Dieser Legitimationsverlust ist nicht zuletzt einem Effizienzdefizit geschuldet. Da das auf die positionaldispositionale Matrix fokussierte, spezialpräventiv ausgerichtete Jugendstrafrecht als ein ‚präventiver’, sozialtechnologisch ausgerichteter ‚Steuerungsversuch’ verstanden werden muss, speist sich seine Legitimation im Vergleich zu ‚klassisch-liberalen’ (vgl. Groenemeyer 2001) ‚neo-klassischen’ und ‚gerechtigkeitsorientierten’ Begründungen von der Strafe (vgl. Brumlik 1993, Hudson 1987, von Hirsch/Ashworth 1998) viel stärker aus einem empirisch-sozialwissenschaftlichen Anspruch als aus normativen oder philosophisch-rechtsdogmatischen Argumenten. In dem Maße wie es sich von gerechtigkeitstheoretische und moralischen verabschiedet und auf soziale Wirkungen zielt (vgl. Baumann 1984: 34), stellt sich das Strafrecht in einem existenziellen Sinne der empirischen Prüfung seiner eigenen Ansprüche, nach den selbst gesetzten Maßstäben (vgl. Kunz 1998, Sparks 2001). Da ein spezialpräventiv auf die positional-disositionale Matrix seiner Adressaten zielendes Jugendstrafrecht nun behaupten muss, man wisse wer die Abweichler sind, warum sie Abweichler sind Dabei verlagert sich der Fokus mit dem Voranschreiten des Wohlfahrtsstaates zunehmend von biologischen zu psychologischen und vor allem zu sozialen Faktoren. Historisch erfolgt eine solche Verlagerung allerdings nicht gradlinig. Vor allen den 1930er Jahren gab es, besonders, aber nicht nur in Nazi-Deutschland, einen dominanten biologistischen Fokus, der im Nachkriegsfordismus jedoch deutlich an Einfluss verlor. Vor allem in den USA gibt es inzwischen wieder eine deutliche Tendenz zu einer bio- bzw. gentechnologisch inspirierten „bio-criminology“ (vgl. dazu das Journal „Crime Times“ und die Arbeiten US amerikanischen ‚right realists’). 52 435 und wie mit ihnen umzugehen sei, basiert seine - unabhängig von der Frage ob Strafe in einem normativen Sinne sein müsse (vgl. Peters 1993) bestehende - legitimatorische Basis auf den drei empirisch falsifizierbaren Annahmen, dass 1. die von Jugendlichen durchgeführten Normbrüche einem identifizierbaren Sozialisations- bzw. Erziehungs- und/oder einem sozialen Defizit geschuldet seien, dass 2. jugendstrafrechtliche Mittel der Behandlung und Korrektur geeignet wären, dieses zu beseitigen oder zumindest zu kompensieren und dass es 3. einen Zusammenhang zwischen den intensiven (sozial)erzieherischen Interventionen und dem Ausmaß des ‚kriminalpräventiven’ Erfolgs gäbe (vgl. Heinz 1992, Müller 2000, Sparks/Loader 2002). Jede dieser Annahmen ist jedoch empirisch substanziell in Frage gestellt worden (vgl. Müller/Sünker 1995, Kunz 1998, Müller 1999, Schumann 1999): Vor dem Hintergrund einer Normalität und Ubiquität von Rechtsbrüchen, lässt sich zunächst eine prinzipielle Unterstellung individueller, ‚kriminogener’ Defizite alleine logisch nicht mehr aufrecht erhalten, geschweige denn empirisch stichhaltig bestimmen (vgl. Greenwood/Turner 1987, Hudson 1996, Sampson 2000, Sampson/Laub 1993). Wie Schumann (2001: 435) die empirischen Forschungen zur Frage der ‚Eignung’ gängiger Maßnahmen zusammenfasst, bestehen „die spezialpräventiven Strafzwecke der Abschreckung und der Resozialisierung […] in aller Regel den experimentellen Test nicht“. Stattdessen kann davon gesprochen werden, dass strafrechtliche (und andere) Interventionen eher ein eigenes Moment der Problemverschärfung, als Teil dessen Lösung darstellen (vgl. Ehret et al. 2000, Matt et al. 1998, Panter et al. 2001, Böttger 2000), und dass es die meisten der ‚sozialpädagogischen’ wie therapeutischen Behandlungskonzepte häufig kaum vermögen, die durch die Einsperrung in geschlossenen Einrichtungen selbst erst produzierten Problemlagen zu kompensieren (vgl. Albrecht 2000, Scherr 2001), während sich das ‚Lernen’ der Insassen primär auf das zum physischen, psychischen und sozialen Überleben in der Strafvollzugslogik Notwendige reduziert (vgl. Girtler 1996, optimistischer: Sutter et al. 1998). Kurz: an seinem legitimatorischen Versprechen einen Beitrag zu leisten, der die Verurteilten systematisch in die Lage versetzt „künftig einen rechtschaffenen und verantwortungsbewussten Lebenswandel zu führen“ (§ 91 Abs. 1 JGG) scheitert der Vollzug der Jugendstrafe notorisch (vgl. Walper 2002). Schließlich gibt es in empirischer Hinsicht deutliche Hinweise dafür, dass die Resozialisierungserfolgsquoten des stationären Vollzugs von Strafen den nicht freiheitsentziehenden Maßnahmen keinesfalls überlegen sind53 (vgl. Mührel 2001, Pogarsky/Piquero 2003): „From the early 1970s, a wave of evaluation studies purported to show that community corrections were not more or less effective than custodial sentences, and that expensive treatment programmes were no more successful than simple incarceration or non-therapeutic sentences such as fines” (Hudson 1987: 29). Darüber hinaus meint eine ganze Reihe von Beobachtern im Strafvollzug selbst die ‚Hauptursache’ für das Scheitern straffälligen Menschen identifizieren zu können (vgl. Maelicke 1988). 53 436 Dabei sprechen auch in der Bundesrepublik zahlreiche Untersuchungen für die These, dass verschiedene Sanktionsformen - auch über den Vergleich zum formalen ‚Sanktionsverzichts’ bzw. der Informalisierung im Rahmen von Diversionsmaßnahmen hinaus - in Bezug auf die ‚spezialpräventiven’ Effekte der Sanktionen im Großen und Ganzen ‚austauschbar’, d.h. ziemlich genau gleich erfolgreich bzw. erfolglos, sind (vgl. u.a. Kerner 1996, Schumann 1999, zur Diversion: Albrecht 1995, Heinz 1995). Von all den Erkenntnissen die die Kernbestände des Straf-Wohlfahrtskomplexes erschüttern ist vor allem dieser letztgenannte Befund theoretisch und empirisch umstritten. Während einige neuere Untersuchungen - jenseits des unbestritten Befunds, dass die spezialpräventiven Effekte des Strafvollzug insgesamt, vor allem langfristig betrachtet, sehr moderat sind (vgl. Hutton 1999) - die plausible These bestätigen konnten, dass „zumindest für manche Täter“ bestimmte Maßnahmen im, und bestimmte Formen des Strafvollzugs erfolgreicher sind als andere (vgl McKencie 1997: 9, McGuire 1995, Kury 1999), finden neuere, experimentelle Studien zu den derzeit existierenden Formen des ‚Behandlungsvollzugs’ mehrheitlich „keine Unterschiede zwischen Behandlungs- und Kontrollgruppen“ (Schumann 2000: 54) bzw., wie es das EU-offizielle ‚European Sourcebook of Crime and Criminal Justice’ formuliert, „no simple relationship between the type of sentence and the reconviction rate“ (Council of Europe 2000, 4A: 2). Unabhängig von der empirischen (Un-)Haltbarkeit der These, dass die Behandlung Straffälligen völlig erfolglos sei (vgl. Raynor 2002, Martinson 1979), ist durch den Befund der ‚Normalität’ jener, die man zu Normalisieren gedachte, sowie durch die schlagwortartig verbreitete Botschaft, ‚Nothing works!’ (vgl. Martinson 1974) den normierend-normalisierenden Strategien des fordistischen Straf-WohlfahrtsKomplexes die Basis entzogen worden: „[Although] Martinson later greatly modified his position, this 1974 article symbolized the end of the enthusiastically embraced social-work vision in crime policy analysis […] Rather suddenly, social workers and traditional (i.e. structural) criminologists were out of fashion and out of favor” (Feeley 2003: 120f). Diese Delegitimation des Kernstücks des Straf-Wohlfahrtskomplexes auf einer ‚symbolischen’ Ebene setzt zwar zunächst und am deutlichsten in den USA ein - in der auch der Fundus entsprechender Wirkungsforschungen am ausgeprägtesten ist - allerdings „fand die ‚Abkehr von der Behandlungsideologie […] schließlich auch hierzulande Annklang, noch bevor durch Evaluationsstudien belegte Aussagen zur Wirksamkeit der deutschen Behandlungsmodelle vorhanden waren“ (Dünkel/Rehn 2001: 302). Für die bis dahin zentralen Felder der Jugendhilfe im Strafvollzug - den Bereichen der Resozialisierung, Besserung, Erziehung und Wiedereingliederung - kann in diesem Zusammenhang von einem von einem weit verbreiteten Pessimismus auf kriminalpolitischer Ebene sowie von einem ‚Bewusstsein des Scheiterns’ in Bezug auf die Professionellen gesprochen werden (vgl. Andrews/Wormith 1989, Cullen/Gendreau 1989, Gilling 1999, Harris/Kirk 2000, Nikolai/Reindl 2001). Wie Anthony Bottoms (1980: 9f) den ‚Post-Martinson-Konsensus’ zusammenfasst: „No one seriously pretends (as once they used to) that ,rehabilitation’ has any utilitarian value in the general reduction of crime rates, or in the prevention of the recruitment of recidivists. Important ethical and other questions remain about the residual role of ,treatment’; but for our purpose of the general planning of the penal system, it would seem that the rehabilitative ideal cannot be effectively revived”. 437 Auf einer politischen Ebene wird dieser Pessimismus von konservativer Seite mit Forderungen nach ‚echter Strafe’ und mehr Strafhärte (‚Lock’em up’ vgl. Wilson 1975 im Überblick: Weitekamp 1998), wie von einer liberalen Kritik an den mangelnden rechtsstaatlichen Begrenzung ausufernder Eingriffe in persönliche Freiheiten durch gescheitetere sozialtechologische Versuche (vgl. Müller/Otto 1986a, Sachße 1986, Dünkel 1990) aufgegriffen und vorangetrieben (dazu Harris/Kirk 2000). Im Ergebnis hatte der wohlfahrtsstaatliche Interventionismus und der auf dem Ideal der individuellen Besserung und Resozialisierung basierende Straf-Wohlfahrtskomplex die Mehrheit seiner akademischen Verteidiger verloren (vgl. Andrews/Wormith 1989) und gerät in ein eine ökonomische (vgl. Taylor 1997) wie poltisch-ideologische Krise (vgl. Bottoms 1980), die nahezu europaweit54 konstatiert wird (vgl. Walmsley 2000). Obwohl diese Krise in ‚liberalen’ Wohlfahrtsregimes früher einsetzte und dramatischer verlief als in ‚konservativen’ und ‚sozialdemokratischen’, sind Auswirkungen auch in der Bundesrepublik übersehbar. Bereits seit Beginn der 1980er Jahre führt die Erkenntnis, dass der Strafvollzug „das normativ vorgegebene Ziel später Straffreiheit nicht erreicht“ zu einer zunehmend forcierten ‚präventiven Wende’, im Sinne einer Verlagerung des kriminalpolitische Fokus „vom ‚tertiären’ Bereich der ‚Resozialisierung’ der Anstaltsinsassen auf den ‚primären’ Bereich der Auslösefaktoren“, die von einem „fiskalische[n] und kontrollpolitische[n] Interesse an mehr Effizienz von Strategien sozialer Kontrolle“ begleitet wird (vgl. Albrecht 1983a: 111). Auf einer akademischen Ebene äußert sich diese Perspektivenwechsel international in einem - relativ zu anderen Bereichen deutlich reduzierten Maß an „scholarly interest in what goes on in prisons, or more generally in the lives and fates of offenders beyond a merely supervisory concern with risk management and case processing“ (Sparks 2001: 207, vgl. Sparks/Loader 2002). Im politischen und fachlichen Diskurs ebenso wie in der (jugend)strafjustiziellen Praxis selbst treten Bemühungen um ‚Diversion’ und andere ‚Alternativen zur Strafe’ (vgl. Cohen 1985) an die Stelle der Versuche einer Ersetzung der ‚Haft als Strafe’ durch ‚Haft als Behandlung und Erziehung’ (vgl. Walter 1999), wie sie die Diskurse im Kontext einer ‚Behandlungseuphorie’ auf Basis pädagogischer und psychologischer Konzepte (Ludwig-Mayerhofer 2000) vor allem seit den späten 1960er Jahren dominiert hatten (vgl. Müller/Otto 1986, Müller/Sünker 1995). Während im fachlichen Diskurs Sozialer Arbeit verstärkt dem ‚Subsidiaritätsprinzip’ als Konsequenz aus der Einsicht in die ‚Ubiquität’ und ‚Normalität’ von Abweichung bestanden wird (Heinz 1989, Heinz 1998, Trenczek 1993, Müller/Trenczek 2001), stützen sich die Bemühungen um Diversion zugleich auch auf das argumentative Arsenal einer Betonung der ‚Krise des Strafmodernismus’ (vgl. Garland 1990), die sich primär aus Verweisen auf das materielle und funktionale Scheitern oder gar auf die Kontraproduktivität spezialpräventiver Behandlungen speist (vgl. Lab/Whitehead 1988, Lipton et al. 1975, Albrecht 1995). Im Ergebnis wurde der im Kontext sozialtechnologischer Gesellschaftsprojekte des Fordismus dominante Diskurs um ‚Erziehung statt Strafe’, ‚Erziehung durch Strafe’ (vgl. Lange 1964) oder ‚strafende Erziehung’ (kritisch: Müller/Sünker 1995), sukzessive durch die Betonung der Informalität und eine diskursive Aufwertung sub- und extra-strafjustizieller Maßnahmen gegenüber formellen 54 Eine gewisse Ausnahme stellen dabei die skandinavischen Länder dar. 438 Strafen abgelöst (vgl. Walter 1999): 1998 erreicht die Diversionsrate im Jugendstrafrecht 69 %, wobei eine ‚exekutivische’ Form der Diversion jenseits richterlicher Beschlüsse über 50 % ausmacht55 (vgl. Heinz 1998). Trotz eines theoretischen Rekurses auf die - im Umfeld des labeling approach entwickelte - Forderung nach ‚Non-Intervention’ (vgl. Schnur 1973) konnte die bundesdeutsche Form der Diversion Anfang der 1980er Jahre kaum als Implementation dieses - auch von kritischer Seite heftig umstrittenen (vgl. Brumlik 1989, Cohen 1985, Klein 1979, Krause/McShane 1994, Ludwig 1989, Voß 1983) Theorieprogramms in die Praxis verstanden werden. In Bezug auf das Jugendstrafrecht stellten die Diversionsprogramme vor allem den Versuch einer ‚inneren Reform’ dar (vgl. Plewig 1990, 1995), in der sich die Protagonisten einer ‚gemäßigten’ Form der Diversion mit dem Versuch durchsetzen, Diversion als eine Modifikation und Konsequenz aus dem Leitprinzip des ‚Erziehungsgedankens im Jugendstrafrecht’ zu konstituieren (vgl. z.B. Beulke 1990, Bundestag Drucksache 11/5829, Busch 1990, Heinz 1989, Rössner 1989). Diese ‚gemäßigte’ und, bezogen auf ihre theoretische Basis, einigermaßen diffuse Form der Diversion hat zur Konsequenz, dass die Logik des fordistischen Straf-Wohlfahrtskomplexes durch die Reform zwar in Frage gestellt und zunehmend hinaus eskamotiert wird, zugleich aber der Erziehungsgedanke als Legitimation des Jugendstrafrechts - d.h. nicht unbedingt im Vollzug von Strafen gegenüber Jugendlichen – eher noch gestärkt als abgeschwächt wird. In diesem Sinne wird, trotz des ‚Erfolgs’ der Implemention der Diversion, weder die von radikaleren Vertretern der Reform kritisierte ‚sozialtechnologische’ Täterorientierung aufgegeben, noch die mangelnde Rechtsstaatlichkeit und die benachteiligende ‚Pädagogisierungsfalle’ (vgl. Bettmer 1991) substanziell überwunden56 (vgl. Albrecht 1993, Dünkel 1990, Frehsee 1995, Müller/Otto 1986, Plewig 1995, Voss 1984, 1995). Die von den ‚Radikalen’ vorgebrachte Kritik der strafjustiziellen Benachteiligung Jugendlicher aufgrund des Erziehungsgedankens (vgl. Voss 1984) wurde von seinen ‚reformorientierten’ Verteidigern vor allem mit dem Argument zurückgewiesen, dass es alleine dieser Erziehungsgedanken im Jugendstrafrecht sei, der sowohl die - im Vergleich zum allgemeinen Strafrecht - deutlich gesteigerten Möglichkeiten als auch das stärkere Gebot zur Anwendung informeller Maßnahmen legitimiere und zugleich die maximale Strafhöhe limitiere (vgl. Blau 1992, Beulke 1992, Heinz 1992, kritisch: Dünkel 1990 Frehsee 1995). Diese Sichtweise kann das empirische Argument für sich reklamieren, dass nicht nur die de jure gegebene Möglichkeit zu Diversionsmaßnahmen zu greifen, sondern auch die faktische Auch im Falle von Verurteilungen dominieren 2001, die von den Folgen einer ‚diversion into something’ häufig kaum unterscheidbaren Anordnungen von so genannten Erziehungsmaßregeln und vor allem Zuchtmittel (davon fast ein Fünftel in Form von Jugendarrest, der sich wesentlich häufiger findet als die Erziehungsmaßregel). Diese Sanktionsformen unterhalb der Jugendstrafe mit und ohne Bewährung finden bei insgesamt etwa 82 % aller verurteilten Jugendlichen Anwendung. Bei Erwachsenen finden sich allerdings korrespondierende Sanktionsformen, hier dominiert die Geldstrafe mit etwa 80 % (vgl. Jehle 2003a). 56 Entsprechend ambivalent ist die Implementation von Diversionsmaßnahmen von strafrechtskritischen Beobachtern eingeschätzt worden. Bereits früh wird kritisiert, dass die als ‚Alternativen’ konzipierten Ansätze häufig ohne besondere ‚Ideologieprobleme’ zu bereiten in die Logiken der Sanktionsspirale des strafrechtlicher Kontrolle ‚eingebaut’ werden. So leitet Diversion zwar im Einzelfall von zumindest formellen Strafmaßnahmen weg, ab und um, verstärkt aber dabei aber zugleich das strukturell im Hintergrund wirkende (Erziehungs-) Konzept, dass ‚Strafe sein muss’ (vgl. Deichsel 1993: 171) 55 439 Diversionsrate in Jugendstrafverfahren in der Tat erheblich höher ist als im Erwachsenenstrafrecht (vgl. Heinz 1999, Ostendorf 2000). Einem solchen Argumentation steht jedoch - neben dem Verweis auf die massive Strafbeschränkung und Rate des Sanktionsverzichts in Ländern mit legalistischen Jugendrechtssystemen (vgl. Dünkel 1990) - unter anderem der Einwand gegenüber, dass Erwachsene im Vergleich zu Jugendlichen ceteris paribus in der Masse der Delikte häufiger völlig straffrei ausgehen (vgl. Albrecht 2000), während nach dem JGG abgeurteilte Jugendliche und Heranwachsende, aufgrund des Vorstellung einer ‚Erforderlichkeit’ erzieherischer, spezialpräventiver Maßnahmen - die sich an die Person selbst und ihre Lebensumstände richten - vergleichsweise häufiger und länger mit nicht-ambulanten bzw. Freiheitsstrafen belegt werden (vgl. Dünkel 1990, 1992, Frehsee 1995, Heinz 1992, Voss 1995, Ostendorf 2000). Das scheinbare Paradox einer größeren ‚Härte’ durch den Erziehungsgedanke hängt vor allen damit zusammen, dass das JGG aufgrund dieser Interventionslegitimation wesentlich stärker nach dem „Prinzip des ‚Strengerwerdens’“ (vgl. Pfeiffer 1981: 41) auf ‚mehrfach Auffällige’ reagiert. Im Ergebnis können die Sanktionen nach dem Jugendstrafrecht in bestimmten Fällen drei- bis viermal so hoch sein, wie sie nach dem Erwachsenenstrafrecht wären (vgl. Pfeiffer 1991, Voss 1995). Dabei wird die Mehrzahl der Jugendstrafen mit Rekurs auf jene ‚schädlichen Neigungen’ verhängt, die aus wiederholten Auffälligkeiten geschlossen werden, was dazu führt, dass die Art und Schwere eines Delikts im Falle eines wiederholten Rechtsbruch an Bedeutung für die Sanktion verliert. Das rechtsstaatlich bedenkliche Moment dieser Konstellation besteht darin, dass bei dieser Mehrheit der Jugendstrafen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit ausgehebelt wird und Ahndungen gerechtfertigt werden, die im Vergleich zum Erwachsenstrafrecht als ‚unangemessen’ erscheinen (vgl. Heinz 1992, Viehmann 1989). In einer risikosoziologischen Sprache formuliert, bedeutet dies kaum weniger, als dass „die Verhängung von Haft und die Bestimmung der Haftdauer [weitgehend] unabhängig von der Schwere der Schuld, vorwiegend auf der Grundlage der Zuordnung des Verurteilten zu bestimmten Rückfallrisikokategorien“ (Savelsberg 1996: 51) - etwa der ‚schädlichen Neigungen’ - erfolgt. Dabei ist gerade die Betonung dieser im wesentlichen risikobezogenen Gesichtpunkte gegenüber den ‚legalistischen’ Momenten der Strafzuweisung mit Rekurs auf einen post-strafmodernistisch reformulierten ‚Erziehungsgedanken’ eine anschlussfähige Basis für eine fortgeschritten liberale Straflogik, die sich weniger auf individuelle ‚Resozialisierung’ richtet, als auf den Versuch, Straftäter in Gruppen einzuteilen und ihren Behandlungs- bzw. Bestrafungsbedarf anhand von Risikoprofilen zu ermitteln. In Bezug auf alternative Sanktionen lässt sich diese Logik etwa dem effektivitäts- und effizienzorientierten ‚Community-Punishment’ Programm des Oregon Department of Corrections (2002: 3) verdeutlichen. „[C]ommunity-based sanctions”, heißt es dort, „especially those that involve an appropriate treatment component […are] more effective at reducing recidivism than jail sanctions. [Even i]n the absence of treatment services, alternative sanctions would likely result in no worse recidivism than jail for many offenders. Selection and assignment of appropriate offenders to appropriate sanctions, however, is the key” (Herv. H.Z.). Nichtsdestoweniger kann aber der Verweiß auf die Beibehaltung des Erziehungsgedankens, gerade nicht als Beleg für die These angeführt werden, dass sich die Bestrafungslogiken in fortgeschritten liberalen Regulationsstaaten geändert hätten. Im Gegenteil: Der ‚Erziehungsgedanke’, als eine 440 Feststellung einer Interventionsnotwendigkeit aufgrund ‚defizitärer’ sozialer und persönlicher Charakteristika der betroffenen Akteure (vgl. Müller 1999), ist eine Legitimation der Verhängung von Strafe und der Feststellung der Strafhöhe, die vor allem zu den Regelmäßigkeiten und Logiken der Legitimation wie des Vollzugs von Strafe bzw. Interventionen, des fordistischen Straf-WohlfahrtsKomplexes ‚passt’ (vgl. Garland 1983, 2001). Das hier vertretene Argument lautet demgegenüber, dass der ‚Erziehungsgedanke’ per se nicht zwangsläufig deckungsgleich ist mit dem pönologischen Modell des, auf die positional-dispositionale Matrix der Akteure gerichteten, Straf-Wohlfahrts-Komplexes, sondern vielmehr neu kontextuiert und damit re-konfiguriert wird. D.h. aus einem Insistieren auf einen ‚Bedarf’ an Merkmalsdifferenzierten Interventionen alleine, kann nicht auf einen Fortbestand der Dominanz eines ‚fordistischwohlfahrtsstaatlichen’ Modells der Strafe geschlossen werden (vgl. Hannah-Moffat 2002, HannahMoffat/Shaw 2001). Der Bezug auf diesen ‚Bedarf’ ist ein anderer als im keynesianischen Wohlfahrtsstaat. In einer sich etablierenden ‚neuen’ Logik des Strafens ist es kein Widerspruch, wenn im Kontext administrativer Rationalisierung und Diversion eine Täterorientierung im Jugendstrafrecht eher an Bedeutung gewinnt (vgl. Ludwig-Mayerhofer/Rzepka 1998, Luskin 2001), während die Logiken der straf-wohlfahrtsstaatlichen Ansätze zugleich an Bedeutung verlieren (vgl. LudwigMayerhofer 2000c, Allen 1981, Japp 1985). Aus dieser Perspektive lässt sich argumentieren, dass die skizzierten Bifurkationsprozesse als Ergebnis einer administrativen Rationalisierungen auch in den dominanten Diversionskonzepten ihre Wirkungen zeitigen und durch eine vergleichsweise deutliche Konzentration auf spezifische Tätercharakteristika in den Diversionsprozessen (vgl. LudwigMayerhofer/Rzepka 1998) noch zusätzlich vorantrieben werden können. Die Ermittlung und Dokumentation von Persönlichkeitscharakteristika straffälliger Jugendlicher, bleibt dabei auch im Kontext verstärkter Diversionsbemühungen eine Aufgabe, für die zuvorderst die Jugendgerichtshilfe verantwortlich zeichnet (vgl. Plewig 1996). Jedoch ist selbst diese institutionelle Zuständigkeit der Jugendhilfe, weder ein Indikator noch ein Garant für ‚wohlfahrtsstaatliche’ bzw. primär auf ‚Hilfe’ gerichtete Logiken im jugendstrafjustiziellen Feld. So beschreibt etwa Siegfried Müller die Berichtsweise der Jugendgerichtshilfe als „bis auf wenige Ausnahmen kurz, lapidar, pädagogisch nichtssagend, unausgewogen, diagnostisch wertlos und nicht selten kompetenzanmaßend und stigmatisierend“ (Müller 1999: 91). Im Ergebnis entsprechen die Vorschläge der Jugendgerichtshilfe „in einem hohen Maße dem justiziellen Sanktionsbedürfnis“ (Müller 1999: 96), wobei sich die Professionellen selbst – so eine Untersuchung von Drewniak et al. (1997, vgl. auch: Emig 2002, Heinz/Hügel 1986) - vorrangig an Kriterien des Strafrechts orientieren, die Lebenssituation der betroffenen Akteure nur sehr unzureichend berücksichtigen und sich einem sehr hohen Maße für freiheitsentziehende Sanktionsformen aussprechen. Genauso wenig wie die bloße institutionelle Zuständigkeit demnach etwas über den Stellenwert sozialstaatlicher bzw. sozialpädagogischer Handlungslogiken und Interventionsrationalitäten aussagt, kann aus den Interventions- und Diversionslegitmationen des Jugendstrafrechts durch den Erziehungsgedanken auf den Grad der ‚pädagogischen Aufladung’ der Diversionsidee geschlossen werden. So lässt sich empirisch bestreiten, dass die Konjunktur der Diversion einer ‚Pädagogisierung’ 441 der Strafe gleichkommt: Insbesondere seit den 1990er Jahren haben sich Arbeitsauflagen – im Sinne von unbezahlten, kommunalen, gemeinnützigen Tätigkeiten – faktisch zur Hauptsanktion im Jugendstrafrecht entwickelt (vgl. Dünkel et al. 1998). Mit ‚Erziehung’ haben diese Sanktionen wenig zu tun. Sie sind im Wesentlichen als ein Substitut zur Geldstrafe für Jugendliche ohne eigenes Einkommen zu verstehen (vgl. Ludwig 1989) während „den jugendhilferechtlichen Ansätzen nach § 12 JGG [… dabei eine] sehr geringfügige Bedeutung“ zukommt (H.-J. Albrecht 2002b: 2) In etwas geringerem Maße (vgl. Heinz 2001) haben sich die mit ‚sozialpädagogischen’ Interventionen stärker verbundenen ‚Sozialen Trainingskurse’ verbreitet57, wobei vor allem seit Anfang der 1990er Jahre der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) an Bedeutung gewinnt. Aber gerade der TOA hat mit den spezialpräventiven Ansätzen im fordistischen Straf-Wohlfahrtskomplex nur wenig Gemeinsamkeiten: Die Logiken des TOA sind explizit restitutiv oder restorativ (vgl. Ashworth 1986, Barnett 1977, Braithwaite 1989), nicht rehabilitativ ausgerichtet. Auf einer fachlichen Ebene sind sie eher das Produkt der Skepsis gegenüber einer Behandlung von Tätern, wie sie im Straf-Wohlfahrtskomplex vorherrschte, sowie Ausdruck einer, im Strafmodernismus ebenfalls weitgehend unbekannten, viktimologischen Ausrichtung der Strafrationalitäten (vgl. Walter 1999). Programmatisch wird der TOA nicht durch einen Rekurs auf positionale oder dispositionale Defizite des Täters begründet, denen mit ‚Hilfe’ zu begegnen sei, sondern durch die Annahme, dass der (jugendliche) Täter motiviert werde „durch die aktive Beteiligung an der Konfliktlösung zu seiner Verantwortung zu stehen und sich und seiner Umgebung zu beweisen, dass er kriminelle Betätigung als Ausdruck bzw. Ursache der Störung des sozialen Friedens zu meiden suchen wird“ (BT-Dr. 11/5829: 17). In der restitutiven bzw. restorativen Logik des TOA wird der Normbruch weniger als Abweichung von einer staatlich geschützten, gesellschaftlichen Ordnung repräsentiert, in die es den Abweichler zu reintegrieren gilt, sondern primär als ein gemeinschaftsbezogener oder - noch stärker disagreggiert – als ein Zwei-Personen-Konflikt, der geschlichtet bzw. reguliert werden soll. An die Stelle des Bezug auf individuelle Defizite oder soziale ‚Deprivation’, als die primär unterstellten Kriminalitätsursachen und wesentlicher Gegenstand der Interventionen im Straf-Wohlfahrtskomplex, tritt dabei der Rekurs auf ein anderes, individuell-moralisches Defizit: Eine Ignoranz oder zumindest ein mangelndes Verständnis des Täters gegenüber den Opferbedürfnissen und Gemeinschaftserwartungen. Die Idee des Täter-Opfer-Ausgleichs wurde zunächst als eine Alternative zum Strafrecht, von Professionellen und Vertretern einer kritischen, ‚täterabgewandten’ Kriminologie (vgl. Schmidt-Semisch 2002: 62) im Umfeld einer abolitionistischen Bewegung der 1970er und 1980er Jahren vorangetrieben. Als ein auf Reparation zielender Ansatz (vgl. M. Summer 2001) war er in einer gewissen - neo-hegelianischen - Analogie zu vor-präventiven ‚Straftheorien’ auf einen versöhnenden und vermittelnde Ausgleich von Konflikt- oder Schädigungssituation jenseits der Justiz gerichtet58. Vor Laut Statistischem Bundesamt (2001) lag im Jahr 2000 das Verhältnis von ‚Zuchtmitteln’ (hauptsächlich Arbeitsauflagen und Geldauflagen) zu diesen Erziehungsmaßregeln bei nominal 69 900 zu 6 200 verurteilten Jugendlichen. 58 Nicht von ungefähr finden sich die spannendsten akademischen Grundsatzdebatten in der Pönologie nicht mehr zwischen den Verstretern von spezialpräventiven Erziehungs- und Resozialisierungsansätzen und den Vertretern einer ‚gerechten Strafe’, sondern in einem ‚Dreieck’ zwischen den Vertretern jener pönalen Logik die Simon und Feeley ‚New Penology’ 57 442 allem stellte er aber ein Konzept dar, dass die Persönlichkeit des Täters aus dem Fokus sozialtechnologischer Interventionen nehmen sollte (vgl. Christie 1977, Schmidt-Semisch 2002). Allerdings hat sich der Täter-Opfer-Ausgleich in der Praxis nicht nur „zu einer ‚Auflage’ für Täter“ entwickelt, sondern er bietet sich vor allem auch als eine an die post-wohlfahrtsstaatlichen Logiken der Governance fortgeschritten liberaler Gesellschaften anschlussfähige „Technik der Erziehung zur persönlichen Verantwortung“ an59 (Cremer-Schäfer 1997: 160, vgl. Bröckling 2002). In diesem Kontext stellt die Popularität der verschiedenen Facetten der Diversion zugleich einen Ausdruck und ein Ergebnis einer umfassenden ‚Ernüchterung’ in Bezug auf die wohlfahrtsstaatlichen Zielsetzungen des Strafrechts dar (vgl. Ludwig-Mayerhofer 2000). Retrospektiv betrachtet, lässt der Diversionsdiskurs vor allem als ein ‚Übergangsphänomen’ interpretieren, dass „als Zwischenstufe auf dem Weg fort von einem wohlfahrtsstaatlichen Strafrecht zu charakterisieren ist [. Dies] liegt daran, daß Diversion sich parallel zu einem wieder repressiver werdenen Strafrecht entwickelte: Die Diversionsmaßnahmen wurden faktisch hauptsächlich für erstmals auffällige, sozial integrierte Straftäter vorgehalten, während die mehrfach auffälligen Straftäter aus benachteiligten sozialen Lagen wieder von einem Strafrecht betroffen waren welches sich jeglichen Anspruchs auf ‚Hilfe’ entledigte“ (Ludwig-Mayerhofer 2000: 335). Dabei hat sich die Kritik an der Zwangsbehandlung, vor allem um die Erprobung flexibler, ambulanter, extra-justizieller und entsprechend günstige Möglichkeiten einer abgestuften Reaktion auf die ‚herunterdefinierten’, ubiquitären Formen der Devianz erweitert und zu Art ‚Verbundstrategie’ entwickelt (vgl. Cornel 2001), deren Kehrseite darin besteht, dass zunehmend aus ethnischen Minoritäten60, bildungsfernen und stark deprivierten Gruppen rekrutierte Insassen der Vollzugsanstalten sowie Haftentlassene „nur noch als Negativselektion aufgefasst werden, die man möglicht sicher und lang aufbewahrt. Werden sie dann wiederum (fast könnte man sagen erwartungsgemäß) rückfällig, dann gibt es ‚gute Argumente’ für weitere Strafverschärfungen“ (Cornel 2001: 92, vgl. Simon/Feeley 1992). Deutliche Hinweise hierfür zeigen sich auch in einer Untersuchung von Suhling und Schott (2001), nach der zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass ‚Nichtdeutsche’, im Fall des Verdachts einer Straftat nicht divertiert, sondern zu Freiheitsentzug ohne Bewährung verurteilt zu werden in einem deutlichen Maße höher ist als bei Deutschen unter denselben Umständen. So ist die Tatverdächtigenbelastungsziffer von Nichtdeutschen in den alten Bundesländern im Zeitraum von 1990 bis 1998 um zwei Prozent gefallen, ihre Verurteilungsziffer um jedoch um 22 %, ihre Gefangenenziffer um 73 % gestiegen. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen können die Diversionsdiskurse seit den 1980 Jahren kaum als ein Indiz für einen unverminderten Fortbestand oder gar eine Weiterentwicklung der wohlfahrtsstaatliche Orientierung von Strafe und Strafvollzug gewertet werden, sondern eher dafür, nennen, den Vertretern von restorativen und den Vertretern ‚neo-klassischer’ Ansätze, wobei zwischen den letztgenannten Strömungen in den letzten Jahren eher die Gemeinsamkeiten als die Differenzen hervorgehoben werden. 59 Dem steht allerdings nicht entgegen, dass diese Maßnahmen - wie auch immer sie motiviert mögen seien - im Ergebnis für den je davon berührten, individuellen Täter oft einen Fortschritt und Freiheitsgewinn gegenüber den stationären strafwohlfahrtstaatlichen Behandlungen darstellen und auch von den einzelnen Akteuren in der Regel bevorzugt werden (vgl. Peters 1992). Dies gilt nicht in Bezug auf die Täter, sondern auch mit Blick auf die Situation und die Interessen des zuvor weitgehend ignorierten Opfers, stellen die restorativen Element der Diversion - vor allem in Form des TOA - häufig nicht nur eine rhetorisch-programmatische sondern auch eine faktische Verbesserung dar (vgl. Dölling et al. 1998). 60 So kommen Diversionsmaßnahmen sowie ambulante Sanktionen (§§ 9 bis 15 JGG) jugendrichterliche Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel mit Ausnahme des Jugendarrestes etwa bei den jugendlichen Aussiedlern ceteris paribus deutlich seltener zur Anwendung als bei deutschen Jugendlichen (vgl. Grübl/Walter 1999). 443 dass - wie Ludwig-Mayerhofer (1996: 171) vermutet - die ‚Hauptfunktion’ der Entformalisierungsprozesse „heute im genauen Gegenteil [besteht]: Im Verbergen dessen, dass die Zeit des interventionistischen Wohlfahrtsstaates vorbei ist“. Die diskursive wie handlungspraktische Aufwertung ambulanter und prä-justizieller Maßnahmen, die den ‚Erziehungsgedanken’ modifizierend forciert haben – und damit eine Selektion nach extrajustiziellen Kriterien vorantreiben –, führt indes zu einer Konstellation in der die am stärksten ‚wohlfahrtsstaatlich’ ausgeprägten Interventionen den am wenigsten ‚risikobelasteten’ Gruppen zu teil werden. In Bezug auf die vergleichsweise hoch ‚risikobelasteten’ Gruppen – die durch Interventionen der Sozialen Dienste scheinbar nicht mehr zu erreichen sind (vgl. BMFSFJ 2002) -, als die von Cornel beschriebene ‚Negativauslese’, stellt dies ein ‚wohlfahrtsstaatliches Paradox’ dar: „Der Wohlfahrtsstaat hat sich dort am erfolgreichsten gegen das Strafrecht durchsetzen können, wo er am wenigsten benötigt wird, nämlich bei der Masse jugendlicher Bagatelltäter, während im Kernbereich des Strafrechts, wo soziales Elend am größten [ist] und Hilfe am notwendigsten [… wäre] , vom Wohlfahrtsstaat wenig zu spüren ist“ (LudwigMayerhofer 2000: 345). Vor diesem Hintergrund ist die Kritik der Diversionslogiken als Erweiterung des Netzes pädagogisierender Kontrollen, das immer neue Populationen in das Kriminaljustizsystem zieht, in theoretischer Hinsicht zu relativieren61. Ein ‚Net-widening’-Prozess - im Sinne einer quantitativen Erweiterung des Zugriffs des Kriminaljustizsystem - ist, wie Garland (1996: 456) ausführt, nicht systematisch in den Informalisierungsprozessen angelegt, sondern im Gegenteil „generally the unplanned corollary of attempts to scale down or informalize penalty structures. Where it occurs, it is usually understood as the covert achievement of the various professional groups who have a stake in the control business”. Auch wenn die Diversionsansätze vor allem die Reaktionen auf Kriminalisierungen substituieren und damit von einem substanziellen Entkriminalisierungsbedarf ablenken (vgl. Albrecht 1993), sind Kontrollnetzerweiterungen durch Diversionsprozesse eher als ein organisationelles ‚Missgeschick’ zu interpretieren, denn als das Produkt einer intentionalen Zugriffserweiterung durch einen machtbesessen Leviatan. Auch das empirische Ausmaß dieser Erweiterung ist überschätzt worden. Im Vergleich zur ‚Netzerweiterung im engeren Sinne sind der kritischen bundesdeutschen Diversionsdebatte andere Aspekte der Diversion theoretisch vergleichsweise unterbeleuchtet und empirisch marginal bearbeitet worden. Hierzu gehören beispielsweise folgende Phänomene und Probleme : - ‚mesh thinning‘: Einerseits wird der formalisierte Zugriff reduziert, andererseits kann vermutet werden, dass der Grad Interferenzen in den Leben der Beteiligten durch Diversionsmaßnahmen im Vergleich zum formalen Prozess durchaus erhöht werden können. - ‚penal inflation‘. Dies verweist darauf, dass der Grad an Punitivität der eher ‚informellen’ Interventionen zum Teil subjektiv als schwerwiegender betrachtet werden kann als die formellen (vgl. hierzu Karstedt 2001), und „die ‚Behandlungen’, die man den Jugendlichen in bester Resozialisierungsabsicht zuteil werden [… lässt], in Wirklichkeit oft schlimmer […sind] als die Bestrafung, die sie substituieren sollten“ (Harris/Kirk 2000: 120, vgl. Albrecht 1993). So belegt eine Studie von Schumann et. al. (1987: 40f), dass Jugendliche die Strafschwere von Sanktionen durchaus anders gewichten als das JGG und beispielsweise Erziehungsmaßregeln der Tendenz nach schwerer eingeschätzt als Zuchtmittel. - ‚institutional blurring‘. Dies verweist darauf dass die Grenzen von ‚innerhalb’ und ‚außerhalb’ des Kriminaljustizsystems immer mehr verwischt werden. Schließlich ist auf das Phänomen der -‚transcarcerization‘ verwiesen worden. Transcarcerization (dazu Lowman et al. 1987) macht darauf aufmerksam, dass die Diversions- und Haftvermeidungsprozesse zum teil dazu führen, dass die bisher in der einer Institution inhaftierten schlicht in einer anderen stationär ungebracht werden. Beispielweise in den Debatten um geschlossene Heime im Rahmen einer Vermeidung von (der für Jugendliche ohnehin juristisch äußerst fragwürdigen Praxis der) U-Haft ist dies durchaus virulent (vgl. Hudson 1993, Nelken 1985) 61 444 Dem steht nicht entgegen, dass Diversionsprojekte eher zu einer Reduktion ambulanter Zuchtmittel, als zu einem Abbau der Jugendstrafe und stationärer Sanktionen im engeren Sinne geführt haben (vgl. Kaiser 1993, Ludwig-Mayerhofer 1992) Aktuelle Daten und Entwicklungen (vgl. Heinz 1999) sprechen sogar - über einen in den 1980er Jahren konstatierten, empirischen ‚Nulleffekt‘ hinaus – für die Befürchtung eines die Diversionsprozesse begleitenden Ausbaus punitiv-stationärer Reaktionen (vgl. Voss 1983). Die Zahlen des Council of Europe (1994) verdeutlichen, dass unabhängig von der Kriminalitätsentwicklung hohe Einsperrungsraten in nahezu ganz Europa von hohen Raten nichtstationärer Strafen begleitet werden. Das Verhältnis von Inkarzeration und Diversion stellt in empirischer Hinsicht unbestreitbar kein ‚Nullsummenspiel’ im Sinne eines Bedeutungsverlusts stationärer Maßnahmen zugunsten informeller Reaktionen (bzw. eines ‚Herunterdefinierens von Devianz’ vgl. Moynihan 1993, kritisch: Karmen 1994) dar. Als ebenso zweischneidig und trügerisch hat sich die im Kontext der Informalisierung des Strafrechts erhoffte Vermeidung von Stigmatisierungen erwiesen62 (vgl. Brumlik 1989). So wird darauf verwiesen, dass „sich die meisten Programme lediglich mit Fällen leichter Kriminalität befassen [, …während] eine besondere ‚Abstempelung’ der nicht divertierten Personen [droht]“ (Kaiser 1993: 92). Die ‚Erfindung’ des ‚Nicht-Divertierbaren’ lässt sich dabei als Produkt einer justiziellen Informalisierung verstehen, die sich vom Alternativprojekt einer Ent-Kriminalisierung verabschiedet hat (vgl. van den Boogaart 1989). Dieser Nicht-Divertierbare ist nun mehr als nur eine Residualkategorie einer ansonsten ‚humanisierenden Reform’. Er fungiert vielmehr als eine wichtige, diskursive Figur, der in einer sich abzeichnenden Veränderung der Rationalitäten des Straf-Wohlfahrts-Komplexes eine hohe institutionelle, politische sowie wissenschaftliche Aufmerksamkeit zukommt. Jonathan Simon (1996) spricht davon, dass der wesentlichste Beitrag, den die empirische Pönologie für das Strafrecht in den 1990er Jahren geleistet habe, darin bestanden habe, Forschungen vorzulegen, die auf eine Identifikation nicht-divertierbarer ‚persitent Krimineller’ zielen (so etwa Farrington/West 1993, Moffitt 1993). Im Mittelpunkt steht die Entdeckung straffälliger Jugendlicher mit einer extensiven Zahl festgestellter Normbrüche, auf deren Basis argumentiert wird, dass eine kleine Gruppe von Tätern gegenüber denen extra-justizielle Maßnahmen nichts ausrichten können -, für ein Großteil der Delikte verantwortlich sei (kritisch: Hudson 2001). Diese Gruppe repräsentiert eine Art risikogesellschaftlicher Renaissance des ‚Gewohnheitsverbrechers’, und stellt einen Teil eines politischen Diskurses dar, in dem die „meisten Bereiche gesellschaftlicher Wirklichkeit zunehmend über Sicherheit und Risiken interpretiert werden“ (Groenemeyer 2001: 161 vgl. Lionos/Douglas 2000) und in dem inzwischen auch Damit ist nicht gemeint, dass der spezialpräventive Einfluss von Diversionsmaßnahmen auf die ‚Rückfallquote‘ im Vergleich zu formellen Sanktionen ungefähr gleichermaßen gering ist (,was sowohl aus ökonomischen Gründen, als auch mit Blick auf eine ganze Reihe negativer persönlicher und sozialer Folgen der Inhaftierung sowie mit Blick auf das Subsidiaritätsgebots keinesfalls gegen sondern für die Diversion und ihren Ausbau sprechen würde) (vgl. Schumann 1999). Es hat sich vielmehr gezeigt, dass die Skepsis gegenüber dem theoriearchitektonisch fragwürdigen Argument, dass eine Informalisierung der strafrechtlichen Prozesse zu einer Verringerung von ‚Stigmatisierung‘ führen würde angebracht war. Dieses – nach wie vor vorgebrachte – Argument impliziert, dass gerade förmliche Verfahren für Prozesse der Stigmatisierung ausschlaggebend seien. Empirisch ist eine solche Wirkung eher behautet als belegt (vgl. Karstedt 2000, Akers 1997, Schumann et al. 1987) zumal neuere Ansätze außergerichtliche Sanktionen gerade wegen ihres vergleichsweise hohen, nichtsdestoweniger ‚brauchbaren’ Stigmaeffekts würdigen (vgl. Braithwaite 1989, Winkler 1999). 445 in der Bundesrepublik „Sicherheit als gleichwertiges Vollzugsziel deklariert wird, dem im Zweifel sogar Vorrang einzuräumen ist“ (Dünkel/Geng 2003: 1). Neben der diskursiven Wiederentdeckung der Konjunktur Gefährlichkeit des in Kriminalitätsfurcht-Opfer-Komplexes der Thematisierung von sind ‚Karrierekriminellen’ „die und ‚Serientätern’“ bzw. von ‚Mehrfach-’ und ‚Intensivtätern’ wesentliche Themenkomplexe dieses Diskurses (Groenemeyer 2001: 161). Paradigmatisch hierfür sind die Ausführungen im 11. Kinder- und Jugendbericht, in dem „mit Sorge“ von 9,6 % der delinquenten Jugendlichen „mit zwanzig und mehr“ Straftaten gesprochen wird: „[Das] heißt, dass über die Hälfte der Jugendlichen zur Last gelegten Delikte [dieser] Gruppe zugeordnet werden müssen [… bei denen sich] die vorhandenen Angebote und Maßnahmen bzw. die Regelpraxis der Kinder- und Jugendhilfe – aus je unterschiedlichen Gründen – als unzureichend erweisen […und] entsprechende Ansätze fehlen“(BMFSFJ 2002: 236). Zwar können diese Ausführungen auch als eine ‚reflektierte’ Auseinandersetzung mit den professionellen Grenzen der Sozialen Arbeit verstanden werden, aber sie verweisen auch auf das strukturelle Grundproblem, dass vor allem jene Akteure durch Diversionsprozesse und ‚wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen’ begünstigt werden, die bisher wenig negative Kontakte mit den Akteuren des formellen Kontrollsystems hatten (vgl. Albrecht 1995: 213), d.h. das „,atypisch’ wohlintegrierte Klientel der Strafjustiz [… insbesondere] nicht-randgruppenzugehörige und inländische Personen“ (Karazman-Morawetz et al. 2000: 61). Der Risikodiskurs über die ‚nicht-divertierbaren’ und die ‚sozialpädagogischen Maßnahmen nicht zugänglichen’, als ebenso depriviert wie ‚gefährlich’ rekonstruierten Jugendlichen verweist demnach auf einen - von der Jugendhilfe selbst mitgetragenen -, fundamentalen Widerspruch ‚post-straf-wohlfahrtlicher’ Sanktionsrationalitäten: „- Dort, wo es im Hinblick auf die strafrechtlichen Minimalanlässe kaum etwas zu ‚erziehen’ gibt, stellen sich ambulante Sanktionen – auch wenn sie informell verhängt werden – tendenziell als ‚erzieherische’ Überreaktion dar. - Dort wo materielle, psychologische und soziale Hilfen massiv angezeigt sind, reagiert das Strafsystem tendenziell mit gedankenloser und schädigender Einsperrung“ (Albrecht 2000: 22) Wenn die ‚Nicht-Divertierbaren’ lediglich eine ‚Restkategorie’ darstellen würden, für die ‚business as usual’ das Mittel der Wahl wäre, würde dies implizieren, dass sich für die eher ‚unproblematischen’ Jugendlichen die Lage verbessern und für die risikoträchtigen und deprivierten Gruppen zumindest nicht verschlechtert würde. Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen der punitiven Reaktionen wird aber deutlich, dass dies nicht der Fall ist. Es lässt sich eher von einer selektiven ‚punitive Gabelung’ (vgl. Bottoms 1980) sprechen: Auch bei Bezugnahme auf alle, d.h. formell und informell Sanktionierte im Jugendstrafrecht, ist der Anteil der Freiheitsstrafen von 12 Monaten und mehr deutlich gestiegen (vgl. Heinz 1999: 2). Insbesondere seit den letzten Jahren geht „die Ausdehnung der Strafaussetzung […] einher mit einer deutlichen Erhöhung des Anteils der besonders risikobelasteten Probandengruppe und mit einem deutlichen Anstieg der Straferlassquote, namentlich bei den als besonders risikobelastet geltenden Gruppen“. Unterstellt man, dass das Strafsystem nicht völlig zufällig agiert, sondern einer rekonstruierbaren Rationalität folgt, lässt sich das, was sich aus einer auf Ausgleich gerichteten sozialpolitischen Perspektive als Widerspruch darstellt, als ein strafjustizieller Teil eines allgemeineren Wandlungsprozesses im Feld der Kriminalitätskontrolle beschreiben: Ideen der Resozialisierung, der 446 Besserung und der Behandlung verlieren an Gewicht, während Konzepte der Sicherheit und des Risiko- bzw. Risikogruppenmanagements an Bedeutung gewinnen63 (vgl. Lindenberg/Schmidt-Semisch 1995). Eine parteiübergreifende, programmatische Anlehnung an die ‚neo-konservative Kriminologie’ ökonomischer Straftheorien (dazu: Tzannetakis 2001) – „wirksame Strafen: Verbrechen darf sich nicht lohnen“, verkünden etwa die Programme von SPD wie CDU gleichermaßen – stellt eine Basis für die sich ausbreitenden politische Bereitschaft dar, der Überzeugung Glauben zu schenken, dass ‚das Gefängnis funktioniert’ (vgl. Sack 2003, Sparks/Leacock 2002). In empirischer Hinsicht spricht auch die Tatsache steigender Inhaftierungszahlen bei sinkenden Deliktraten für die Konjunktur dieser Perspektive. Zwar gibt es in der Bundesrepublik kaum relevante, offizielle Stimmen, die sich gegen das verfassungsmäßig geronnene Gebot der ‚Resozialisierung‘ als solches aussprechen, allerdings sind die in diesem ‚Verzicht’ angelegten praktischen Implikationen, alleine deshalb vergleichsweise gering, weil es für ‚Resozialisierung’ weder Mindeststandards und noch verbindliche Konzepte gibt. In der empirischen Wirklichkeit des Strafvollzugs haben die Haftbedingungen - insbesondere im Kontext der Überbelegungen64 – teilweise Formen angenommen, in denen von einer systematischen Ausrichtung des Vollzugs auf Resozialisierung kaum die Rede sein kann. Folgt man den Pönologen Dünkel und Kunkat (vgl. 1997: 24 ff, siehe auch Böhm 2002), steht – abhängig von Bundesland und Anstalt - die Praxis des Vollzugs den gesetzlichen ‚Erziehungs-’ bzw. Resozialisierungsintention in wachsendem Maße offen entgegen65 und „[i]nsbesondere im Jugendstrafvollzug wird es […] schwieriger, dem In politischer Hinsicht ist eine solche Gewichtsverlagerung in genereller Hinsicht wenig umstritten: So erklärt der ehemalige Justizminister von NRW den bisherigen therapeutisch ausgerichteten Strafvollzug für gescheitert (vgl. ‚Die Welt‘ vom 22.2.1994). Der CDU Rechtexperte Norbert Gas (1998: 18) verlangt den „Zeitgeist der siebziger Jahre“, der durch ein „[v]erfehltes Menschenbild“ die „Verantwortung für Verbrechen mehr der Gesellschaft als dem Täter zur Last“ legte, zu überwinden und „nüchtern und realistisch die Grenzen der Resozialisierung [zu] akzeptieren und […sich] von diesbezüglichen Illusionen [zu] verabschieden“. Dies gelte zumal die mit hohen Kosten verbundenen Umsetzung der auf der Basis dieser Illusion verabschiedeten Gesetze faktisch bereits seit „Mitte der achtziger Jahre ganz aufgegeben“ worden seien. Auch Seitens der Sozialdemokraten wird ‚Resozialisierung‘ eher beiläufig verhandelt. Erhöhte Aufmerksamkeit wird stattdessen dem Argument geschenkt, dass ‚Freiheit und Demokratie’ der ‚inneren Sicherheit für alle’ bedarf. „Natürlich“ so konkretisiert der Innenminister Schily (2000) diese Perspektive „sind Resozialisierung, Therapie und Ähnliches notwendig. Aber in einem Punkt gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel: Die Sicherheit potenzieller Opfer hat absoluten Vorrang“. Weil es zu „einem demokratischen und sozialen Rechtsstaat gehört, das Bürgerrecht auf Schutz vor Verbrechen und Gewalt“ durchzusetzen, geht es – zumindest wahlkampfrhetorisch - auch den Sozialdemokraten primär darum „mit allen politischen und rechtsstaatlichen Mitteln für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger sorgen“ (Wahlprogramm der SPD 1998). Die entsprechende Strategie lautet: „[W]irksame Strafen: Verbrechen darf sich nicht lohnen“. 64 Dünkel und Geng (2003: 4) machen darauf aufmerksam, dass die offiziellen Überbelegungsraten täuschen könnten: „Abgesehen von den offenkundigen Zahlen zur Überbelegung gibt es noch eine Art ‚verdeckte’ zusätzliche Überbelegung, wenn man die Anteile gemeinschaftlicher Unterbringung von Gefangenen bedenkt. So waren am 31.3.2003 in Gesamtdeutschland 49 % der Gefangenen im geschlossenen Vollzug entgegen § 18 Abs. 1 StVollzG gemeinschaftlich untergebracht“. 65 Ron Walmsley (2000: 4f) führt zur Frage der Überbelegung von Gefängnissen und ihrer Auswirkung die Realität und Ideologie des Vollzugs folgendes aus: „Overcrowded prisons are a flagrant breach of international standards. The United Nations Standard Minimum Rules and the European Prison Rules are the most frequently quoted yardsticks for the minimum conditions that are acceptable for the management of prisons and the treatment of prisoners, in accordance with internationally accepted human rights standards. Overcrowding in prisons implies that such standards are not regarded as very important […]High prison populations and growth in numbers do not only bring overcrowding. They usually bring with them a host of other major problems. Not only restricted living space, but also poorer conditions of hygiene and poorer sanitation arrangements and less time for outdoor exercise. […]. There is more tension, with more violence between prisoners, more violence against staff. Risks of self-injury and suicide also increase. […]When there is growth in prison 63 447 besonderen Erziehungsanspruch gerecht zu werden“ (Suhling 2002: 159). Der real existierende Strafvollzug stellt in dieser Form bestenfalls eine ‚humane Verwahrung’ sicher66. Auch im Sicherheitsbericht der Bundesregierung (BMI &BMJ 2001: 433) wird darauf verwiesen, dass es selbst „in wirtschaftlich allgemein günstigen Zeiten [….] schwer[fällt], die Möglichkeiten [des Resozialisierungsvollzuges] für mehr als eine Minderheit der Gefangenen voll umzusetzen. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten schlagen die Mängel entweder ganz direkt in den Vollzug durch […] oder machen sich alsbald mittelbar bemerkbar“. Während ein Großteil dieser Defizite auf ‚infrastrukturelle’ Probleme zurückgeführt werden kann, verschiebt sich parallel dazu auch der politisch-programmatische Diskurs über den Strafvollzug kaum übersehbar von dem Ideal der ‚Resozialisierung’ zu einer stärker sicherheits-manageriellen Logik. So führt die damalige Justizministerin Däubler-Gmelin (2000: 8) aus: „Es ist falsch, überflüssig und zu teuer, so viele Haftplätze wie heute durch so große Zahlen von sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen zu blockieren. Im Strafvollzug muss Platz sein für Straftäter mit schweren Straftaten vor denen die Bevölkerung geschützt sein muss“. In den politischen Programmen der großen Parteien kündet sich insgesamt eine grundlegende Neubestimmung des Verhältnisses zwischen den strafjustiziellen Versuchen der ‚Besserung’ und Rehabilitation und den Gefängnissen als risikomanagerielle Mittel an. Die Gewichte haben sich hin zu einer Priorität von Sicherheitserwägungen bzw. ‚den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung’ (vgl. Jehle 2003) verschoben, während das straf-wohlfahrtliche ‚Ideal der Rehabilitation’ (vgl. Allen 1981) zunehmend von einem straflegitmatorischen Selbstzweck zu einem Mittel der Sicherheitserzeugung moduliert wird67. numbers the staff-prisoner ratio invariably falls. Staff are rarely recruited speedily enough to maintain that ratio at a satisfactory level. Reduced staff-prisoner ratios are likely to mean less effective supervision by staff and less time for them to organise activities to ensure that the institution is run in a positive way which maximises the chances of successful reintegration into the community on release. Treatment programmes, including pre-release courses, are likely to be negatively affected”. Für die Bundesrepublik zeichnen Dünkel und Geng (2003:1) folgendes Bild: „Der Personalbestand wird trotz steigender Gefangenenzahlen eher ab- denn ausgebaut, die Überbelegung führt zum Abbau von Resozialisierungsangeboten (Freizeiträume werden zu Hafträumen umgewidmet etc.) und einer erheblichen Arbeitslosigkeit. Die Mehrfachbelegung von Einzelhafträumen hat zu menschenunwürdigen, verfassungswidrigen Zuständen geführt (vgl. BVerfG EuGRZ 2002, S. 196, 198). Kurz: der Verwahrvollzug der 60er Jahre droht – wenngleich sicherlich auf höherem Lebensstandard“. 66 Diese Defizite im Resozialisierungsvollzug zeigen sich nicht nur für das von der Sozialen Arbeit, Therapie sowie durch Bildungs- und Gesundheitspolitik geprägte ‚Ideal der Rehabilitation’ (vgl. Allen 1981), im engeren Sinne einer Betonung des ‚Sozialen’ in der Kriminalpolitik basierend auf Ideen der Rehabilitation, Behandlung und Erziehung in Bezug auf die Akteure und ‚Armutsbekämpfung’ und soziale Bedingungsveränderungen in Bezug auf ihre sozialen politischen Positionen. Vielmehr schlagen sich diese Defizite bereits in einer Weise bis auf die sittlich-zivilisatorische Minimalanforderung einer ‚humane Verwahrung’ nieder, die bereits das Bundesverfassungsgericht zu einer Reaktion gezwungen hat. In einem Urteil vom 27.2.2002 sah man sich auch von höchstrichterlicher Seite veranlasst eine mangelnde Beachtung der Menschenwürde und des Rechts auf Rechtsschutz der Strafgefangene in bundesdeutschen Anstalten zu rügen und grundlegende Verbesserungen einzufordern. 67 Seit Ende der 1990er Jahren verkünden Sozialdemokraten in ihren Programmen und Regierungserklärungen, Innere Sicherheit sei ein ‚Bürgerrecht’ (SPD 2002) und versichern dass „dem Grundsatz ‚Sicherheit vor Resozialisierung’ umfassend Rechnung getragen“ werde (SPD Brandenburg 2001): „Oberstes Ziel im Strafvollzug und im Maßregelvollzug ist es, Wiederholungstaten auszuschließen. Hieran orientieren sich alle Maßnahmen: das Lockerungssystem, die baulichen Sicherungsmaßnahmen, die Organisation der inneren Abläufe in den Anstalten und Kliniken, ständige Kontrollen und alle Maßnahmen der Resozialisierung. Bei Lockerungen genauso wie bei der Entlassung aus Sicherungsverwahrung oder Maßregelvollzug überwiegt grundsätzlich das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung gegenüber dem Freiheitsanspruch des Täters“ (SPD Mecklenburg-Vorpommern 2002). „Natürlich“ so führt der Bundesinnenminister Schily (2000) „sind Resozialisierung, Therapie und Ähnliches notwendig. Aber in einem Punkt gibt es […] keinen Zweifel: Die Sicherheit potenzieller Opfer hat absoluten Vorrang“. Noch weiter gehen die 448 VI. 3.2 AUF DEM WEG ZU EINEM NEUEN STRAFMANAGEMENT: ‚SYMBOLISCHER EXPRESSIONISMUS’ ‚VERSICHERUNGSKALKULATION’ UND MANAGERIELLE SOZIALVERTEIDIGUNG In einem gewissen Sinne kann dieser Verschiebungsprozess als eine Art fortgeschritten liberale Reformulierung einer bereits von Franz von Liszt vertretenen Idee verstanden werden. Fasst man den Liszt’schen (1905: 163f) Grundgedanken der „Selektion des sozial untauglichen Individuums“ aus einer sicherheitsorientierten Management Perspektive, die sich an Kriterien der Ökonomie, Effizienz und Effektivität bemisst, so erscheint seine Forderung, Besserungsfähige zu bessern, Abschreckungsfähige abzuschrecken und Unverbesserliche unschädlich zu machen, als anschlussfähig an den justiziellen Risikodiskurs. Auch aus der Perspektive eines Sicherheitsmanagements ist es ‚rational’, den Resozialisierungsgedanken nicht einfach zu eskamotieren, sondern ihn eher als ein differenziell, flexibel und ‚unideologisch’ verwendbares Werkzeug zu reformulieren. Selbst (vermeintlich) ‚progressive’ Neuerungen und Reformimpulse - wie etwa die Etablierung gemeinnütziger Arbeit als Haupt- und Hauptersatzstrafe im Jugend- und Erwachsenenstrafrecht (vgl. BMJ 2000, kritisch: Lindenberg/Schmidt-Semisch 2000) – sind mit einer sicherheitsmanageriellen Strafrationalität durchaus vereinbar: Sie geschehen „nicht mehr aus einer humanistisch-rechtstaatlichen Tradition, sondern aus von Sparzwängen geprägten Überlegungen einer Verschlankung und Effizienzsteigerung des Vollzugsmanagements“ (Dünkel/Kunkat 1997: 24, vgl. Karstedt/Greve 1996, Entorf 2000). Diese alternativen Reaktion zur Freiheitsstrafe gehen zwar häufig mit einer ‚Umdefinition’ inkrimierter Verhaltenweisen zu minder schweren Straftatbeständen einher (vgl. Heinz 2000), aber die Prozesse eines ‚defining deviance down’ (Moynihan 1993) kennzeichnen eher eine selektive, als eine generelle Tendenz zeitgenössischer Verurteilungs- und Strafpraxen. Sie finden ihr Gegenstück in einem zeitgleichen Anwachsen in punitiven Reaktionen, die auf der Ebene der Deliktdefinitionen von einem ebenso selektiven Prozess des ‚defining deviance up’ (Krauthammer 1993) begleitet werden. In einem wachsenden Maße richten sich die ‚harten’, punitiven Reaktionen auf die Restgruppen, die auf der Rückseite der „Diversions- Filterprogramme“ verbleiben (vgl. Albrecht 1999: 57). Dabei ist in so fern eine sicherheits-managerialistische Rationalität rekonstruierbar, wie es in wachsendem Maße darum geht, „auf der Basis von Risikoprofilen gefährliche Typen auszumachen [dazu Dembo/Schmeidler 2003] und Widerholungstäter, die als unverbesserlich identifiziert werden, auszusondern und wegzuschließen“ (Krasmann 2000a: 197, vgl. Feeley/Simon 1994). CDU/CSU Bundestagsfraktion und die von den Unionsparteien geführten Innen- und Justizressorts der Länder, die in einem Papier für eine ‚moderne Verbrechensbekämpfung’, ein generelles Spannungsverhältnis zwischen einem „Wiedereingliederungsanspruch des Straftäters“ und dem „Sicherheitsanspruch der Gesellschaft“ konstatieren und einfordern dass „die Sicherheit der Bürger […] im Umgang mit Straftätern […] an erster Stelle stehen […muss :] In den offenen Vollzug dürfen nur Gefangene, die keine Gefahr für die Sicherheit der Bevölkerung darstellen. […] Bei der Entscheidung über die Gewährung von Ausgang, Urlaub und Freigang muss der Sicherheit eindeutige Priorität eingeräumt werden. Wir dürfen keine unkontrollierbaren Risiken eingehen“(CDU/CSU 2000: 20). „Strafvollzug“, so heißt es im CDU Zukunftsprogramm, „muß die Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung ernst nehmen. Strafe muß auch als solche empfunden werden und dem Gedanken der Spezial- und Generalprävention, also der Abschreckung des Täters und der Allgemeinheit vor der Begehung von Straftaten Rechnung tragen. Resozialisierung ist nur dort möglich, wo der Täter resozialisierungswillig und -fähig ist. Wo Resozialisierung nicht möglich erscheint oder der Gefangene die Chancen des Resozialisierungsvollzugs nicht wahrnimmt, ist die Unterbringung in einem besonderen Sicherheitsvollzug notwendig (CDU 1998). 449 Im Kontext einer Verknüpfung einer inhaltlichen Orientierung an Sicherheit mit einer Strategie des Managements von Risikopopulation durch abgestufte Kontrollformen nach Grad ihres Rückfallrisikos bzw. ihrer Gefährlichkeit, kann nicht nur von einem ‚punitivem Gabelungsprozess‘ (vgl. Sparks 1996: 202, Bottoms 1980) gesprochen werden, sondern, wie der Bundesverfassungsrichter Winfried Hassemer (2000a) ausführt, von der Entwicklung eines „neuen Verhältnisses zum Strafrecht […] zum Staat und zu den Grundrechten […:] Nicht der Schutz unserer Freiheit vor staatlichen Eingriffen liegt uns am staatsbürgerlichen Herzen, sondern der Schutz unserer Sicherheit vor den Lebensrisiken, denen wir uns heute ausgesetzt sehen“. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung wird das ‚alte’ Spannungsverhältnis zwischen einer im ‚wohlfahrtsstaatlichen’ Sinne ‚sinnvollen’ (dazu: Plewig 2001) und einer ‚gerechten Strafe‘ (vgl. von Hirsch 1996, Brumlik 1993) der Tendenz nach durch das versicherungskalkulatorische Element „einer ‚gerechtfertigten Inhaftierung‘ abgelöst. Die Rückfälligkeit ist dann auch nicht mehr ein Indikator für die auf die Person bezogene gut verlaufene oder fehlgeschlagene Entwicklung und schon gar nicht für die Qualität der betreuenden Einrichtung, sondern ausschließlich ein Indikator für die Risikoklassifikation, der zusammen mit anderen Faktoren über den Grad der zukünftigen Einsperrung oder Überwachung entscheidet“ (Lindenberg/Schmidt-Semisch 1998: 381). Mit Blick auf diese Entwicklung lässt sich von einer paradigmatischen Veränderung der Strafrationalität moderner Gesellschaften sprechen. Betrachtet man die Geschichte der Gegenwart über das ‚Disziplinierens und Strafens‘68 moderner Gesellschaften, wie sie etwa Michel Foucault (1994) vorgelegt hat, so lässt sich davon sprechen, dass der Zweck des ‚Kerkernetzes’ in der Etablierung eines über das Gefängnis weit hinaus und in den Gesellschaftskörper hineinreichenden Systems der Disziplinierung und Normalisierung bestanden hat69. Vor allem im ‚sozialdemokratischen Interventionsstaat’ stellt der Einschluss zwar eine vorrübergehende Aussonderung dar, die Ziele des Kriminaljustizsystems sind aber gerade nicht exkludierend. Im Gegenteil: zumindest dem Anspruch nach sollen Strafen primär ein Medium darstellen, das auf eine Inklusion in die Gesellschaft bzw. die Inkorporierung der Regelmäßigkeiten und Geltungsansprüche des Sozialvertrags zielt (vgl. Melossi 2000: 152, Bottoms 1983, Hudson 1996), in dem es als eine Art subsidiäre ultima ratio (vgl. Sack 1998, 2003) - im Verbund mit ‚ideologischen Staatsapparaten’ (Althusser 1973) - auf eine spezifische Form einer holistischen Habitusgenerierung gerichtet ist (vgl. Matza 1969). Die Devianten, so der Kern dieser Straflogik, „are there to be absorbed. Criminals are rehabilitated, madmen and drug addicts cured, immigrants assimilated, teenagers ,adjusted’, dysfunctional families counselled into normality. The difficult, obdurate parts of the population are almost a welcome challenge to the Welfare State and its functionaries […] It was not difficulty which threatened modernity, but diversity. A whole barrage of experts - psychiatrists, social workers, criminologists - were in the business of explaining away diversity; a positivist social science was evolved which sought to explain the ,remarkable’, why differences in values, attitudes and behaviour could possibly occur in a world which was both economically and socially so successful” (Young 1999a: 390). 68 ‚Discipline and Punishment’ lautet die weitaus treffendere englische Übersetzung von Foucaults ‚Überwachen und Strafen’. 69 Mit Blick auf die Geburt des Gefängniswesens und vor allem auch mit Blick auf die Rationalitäten des keynesianischen Fordismus ist diese Annahme durchaus plausibel. Ein solcher Zusammenhang ist nicht nur von Foucault sondern auch von seinen Kritikern rekonstruiert worden- auch wenn sie die ‚Ursachenkette’ teilweise genau anderes herum argumentierten (vgl. etwa Melossi/Patarini 1981, Treiber/ Steinert 1980) 450 Eine solche transformative bzw. ‚assimilative’ Qualität des Gefängnissystems wird jedoch inzwischen nicht nur mit Blick auf den empirischen Erfolg seiner Zweckformulierung bestritten (vgl. Steinert/Cremer-Schäfer 1998), sondern auch in einem teleologisch-programmatischen Sinne in Frage gestellt. Der US-amerikanische Kriminologe Jonathan Simon spricht etwa davon, dass die Gefängnisse die Funktion eines ‚Abfallentsorgungs-Modells’ (Simon 1993: 259) angenommen hätten, in dem es nicht mehr um die Integration oder Absorption einer, ohnehin als überflüssig erachteten, Population in die Gesellschaft geht (vgl. auch Wacquant 2000). Das neue Strafrecht habe sich zu einer „Power without Narrative“ (Simon 1993: 230) entwickelt, dass ohne den rhetorischen Aufwand auskomme, sich im Sinne einer integrierenden Spezialprävention zu legitimieren (zur kritischen Würdigung: Sparks/Leacock 2002, O’Malley 1999a, Sack 1998, Moffat 2002, Groenemeyer 2001). Im Zusammenhang mit dieser - vor allem für die USA rekonstruierbaren - Entwicklung verändert sich die sowohl die Population in den Gefängnissen, als auch und allem deren symbolische Repräsentation (vgl. Melossi 2000). Herrmann Korndörfer, der leitende Ministerialrat des bayrischen Staatsministeriums, beschreibt sie beispielsweise für den bundesdeutschen Strafvollzug wie folgt: „Die Gefangenenpopulation hat sich in unseren Anstalten in den letzten Jahren wesentlich verändert. Mit dem zahlenmäßigen Anstieg geht insbesondere eine qualitative Veränderung einher. Der Justizvollzug ist zunehmend befasst mit gefährlichen, jederzeit gewaltbereiten, behandlungsunwilligen, mehr als früher sozialisationsgeschädigten, durch erheblichen Drogenkonsum vorgeschädigten und der organisierten Kriminalität zugehörigen Personen […] Es ist […deshalb ] notwendig auch innerhalb der Anstalten nach Gefährlichkeit zu differenzieren und entsprechende Freiräume nur in überschaubaren Einheiten vorzusehen“ (Korndörfer 2001: 163). Diese Forderungen sind mehr als ein einfacher Ausdruck einer ‚Ratlosigkeit‘ vor dem Hintergrund ‚objektiver’ demographischer Veränderungen der Insassenpopulation. Sie stehen vielmehr im Kontext einer veränderten Ökonomie des Strafens, in der die Kriterien der Resozialisierung und Wiedereingliederung – d.h. die zentrale Erfolgskriterien eines zweckgerichteten Strafrechts (vgl. Kunz 1998) - gegenüber den Effizienzkriterien einer sicherheitsbezogenen Form des Managerialismus gestützt durch die Implementation output- und ergebnisorientierter Neuer Steuerungsmodelle sowie entsprechender Effizienzkontrollen im Strafvollzug (vgl. Ohle 2001, Herbst/Wegner 2001) – relativiert werden. Dieser Strafmanagerialismus reduziert sich jedoch nicht auf managerielle bzw. pragmatischkalkulatorische Technologien, sondern amalgamiert diese mit ‚moralischen’ und symbolischexpressiven Souveränitätsansprüchen (vgl. Garland 1996), die in juridische wie exekutive Bereiche der Strafjustiz hineinwirken (vgl. O’Malley 1999a). Beide Aspekte wurzeln in einer ‚politischen Ambivalenz’ „that results from a complex state machine confronted by its own limitations“(Garland 2001: 138). Dem klassischen Versprechen und der symbolischen Legitimation des souveränen Staates, Sicherheit und ‚Recht und Ordnung‘ zunächst für die Untertanen, dann für die Bürger zu gewährleisten - und zu demonstrieren - ist das Versprechen an die Seite getreten, den Prozess der Bestrafung in einem effizienten und kosteneffektiven Sinn zu vollziehen. Mit Blick auf die im einzelnen antagonistischen Elemente dieses Versprechens, erscheint die aktuell rekonstruierbare Gleichzeitigkeit einer gestiegenen, expressiven Strafhärte und eines mangerialistischen Pragmatismus nur so solange als ‚schizophren’ (vgl. Sullivan 2001), wie ausgeblendet bleibt, dass die widersprüchlichen Elemente der 451 fortgeschritten liberalen Straflandschaft auf unterscheidbare ‚instrumentelle’ und ‚symbolische’ Wirkungen zielen (vgl. O’Malley 1999a, Garland 2001, Groenemeyer 2001, Peters 2002). Sofern es zutrifft, dass in der wohlfahrtsstaatlich-interventionistischen Phase des Kapitalismus ein im weitesten Sinne ‚sozialdemokratisch’ strukturierter Diskurs dominant war (vgl. Dahrendorf 1987), der im Verlauf des krisenhaften Niedergangs des Nachkriegs-Fordismus durch die diskursive Konjunktur ebenso spannungsreicher und wie unsteter Mischungen neo-konservativer und neo-liberaler Elemente abgelöst wird, kann davon gesprochen werden, dass die expressiv-symbolische Dimension des Strafens vor allem den neo-konservativen Part dieser ‚brüchigen Allianz’ repräsentiert (vgl. O’Malley 1999a, 2001, Gronemeyer 2001). Aus der, vor allem auf symbolisch-expressive Dimensionen staatlichen Strafens70 rekurrierenden ‚neokonservativen’ Perspektive, können weder Verweise der empirischen Pönologie auf das notorische Scheitern der Strafe als ein im präventiven Sinne zweckgebundenes Steuerungsmedium (vgl. Albrecht 1999, 2000) noch die Einsicht, dass eine verschärfte Sanktionspraxis keine Anhaltspunkte einer erhöhten präventiven Effektivität liefert (vgl. Eisenberg 1995) und auch die präventive Ansprechbarkeit der Bevölkerung durch Veränderungen des Sanktionsniveaus nicht zu steigern ist (vgl. Schöch 1985), überzeugende Belege für ein ‚Scheitern’ einer punitiven Strafpolitik sein. Selbst wenn die Strafhärte keinem, im unmittelbar instrumentellen Sinne effektiven Zweck dienlich ist und auch wenn sie im Sinne der Optimierung einer manageriellen Kosten-Nutzen-Bilanz nicht das Mittel Wahl darstellt (vgl. Karstedt/Greve 1996), ist sie keinesfalls nur ein ‚irrationaler’ Anachronismus. Im Sinne einer Verdeutlichung der Stärke des ‚souveränen Staates’ (vgl. Gamble 1988, Scruton 1980, 1985), zeitigen harte Strafen symbolisch-expressive Wirkungen71 (Garland 2001, Garland/Young 1983, Kunz 1998, siehe auch Durkheim 1973, 1977). Diese Wirkungen dienen einer bestimmten, ‚konservativen’ politischen Rationalität und sind aus einer solchen Perspektive durchaus ‚vernünftig’ auch wenn sich diese Vernunftkriterien sowohl von denen des sozialen Interventionsstaats, als auch von der Vernunft eines ‚neo-liberalen’ Mangerialismus unterscheiden (vgl. Sullivan 2001, Simon 2001, Matthews/Young 1992). Die ‚expressiv-symbolische’ Logik zeichnet sich gegenüber einer mangerialistischen Logik nicht dadurch aus, dass Aspekte der Sicherheit im Mittelpunkt stehen. Der Unterschied besteht vor allem in der Art und Weise wie der Sicherheitsaspekt thematisiert wird und in den Konsequenzen, die aus dieser Thematisierung gezogen werden. In diesem Sinne macht Jock Young (1999a: 405) darauf aufmerksam, dass ein pragmatischer und sicherheitsorientierter Strafmanagerialismus „and such demonization are, of course, both forms of exclusion”, die jedoch einen je unterschiedlichen Fokus auf unterschiedliche Bezugspunkte legen, bzw. in den Worten Youngs „the cool and the hot aspects of our culture” repräsentierten. Entscheidend dafür, ob eher expressive Aspekte symbolischer Dämonisierungen oder versicherungskalkulatorische Rationalitäten eines Risikomanagerialismus in den Heinz Steinert (1997) hat die symbolisch demonstrative Ebene als ihre eigentliche als die ‚eigentliche’ Funktion rekonstruiert. Erhellende Ausführungen zum Bedeutungswandel der ‚Sicherheit’ zu einem normativ-symbolischen Begriff finden sich bei Michael Voß (1997: 45 f). 71 So kann etwa argumentiert werden, dass das Strafrecht zwar „die objektive Sicherheit nicht empirisch belegbar zu steigern vermag“ sich dafür aber positiv auf das subjektive Sicherheitsgefühl auswirkt (Niggli 1995:117). 70 452 Vordergrund rücken, ist das Verhältnis zwischen diesen ‚cool’ und ‚hot aspects of culture’ im politischen Diskurs. Die Frage der symbolischen Effektivität, auf die die ‚konservative’ Perspektive primär rekurriert, überwiegt etwa dann über die Frage nach einer im sicherheits-manageriellen Sinne ‚objektiven’ und messbaren Effektivität und Effizienz des Strafens, wenn sich die „Kriminalpolitik international für die Betonung der subjektiven Seite der Sicherheit entschieden hat und zwar mit einer Politik und Gesetzgebung, die den Einzelnen hart treffen, die aber an dem Problem, das gelöst werden soll, nicht Entscheidendes verändern kann“ (Albrecht 2001: 64, vgl. Weatherburn/Devery 1991). Wenn die instrumentelle Erfolglosigkeit einer ‚Strategie’, bezogen auf das Problem Kriminalität als solches, durch einen Zugewinn an symbolischer Macht bzw. ‚politischem Kapital’ (vgl. Bourdieu 1998, 2001) ‚kompensiert’ werden kann, lässt sich auch diese ‚erfolglose’ Strategie eine ‚effiziente‘ Antwort interpretieren, die sich allerdings nicht auf das ‚Kriminalitätsproblem’ als solches, sondern auf politisch-symbolische Probleme in einem weiter gefassten Sinne bezieht (vgl. Hafendehl 2000, Kunz 1998, Sarre 1992): Eine „Umorientierung des Strafrechts von der Nützlichkeit auf die Eindrücklichkeit zahlt sich [demnach] für seine Agenten aus. Wenn nicht die Effizienz sondern die Symbolik des Strafrechts gefragt ist, resultiert daraus für das Kriminaljustizsystem ein Gewinn an Würde und Prestige. […] Ein auf die Eindrücklichkeit seiner Symbolik setzendes Strafrecht kann sich […] der Auszeichnung gewiss sein, im Dienste der Gemeinschaft zu stehen. Die Bestrafung wird so zu einer wertvollen und respektablen Angelegenheit, zu der man sich bekennen kann und muss, auch wenn der Nachweis ihrer Nützlichkeit nicht zu führen sein sollte“ (Kunz 1998: 367). Auch wenn demnach zwei unterschiedliche Felder fokussiert werden, bleibt ein prinzipielles Spannungsverhältnis bestehen zwischen der - in Bezug auf die normative Wertung einzelner Akteure ent-moralisierenden, moralisierenden ‚instrumentellen’ ‚symbolischen’ Logik Logik eines einer Sicherheitsmanagerialismus Demonstration von und Handlungs- der und Durchsetzungsfähigkeit72: Ein auf Emotionen zielender Diskurs, der auf strafende Härte gegen bösartige Akteure besteht (vgl. Bennett et al. 1996), ist mit dem ‚kühlen’ Pragmatismus eines rational kalkulierenden Risikomanagements nicht wiederspruchsfrei vereinbar73 (vgl. Garland 1999, Peters 2002). Allerdings lässt sich die zeitgenössische, diskursiv und empirisch widersprüchliche Struktur der pönalen Landschaft nicht alleine auf ein Spannungsverhältnis ‚neo-liberaler’ und ‚neo-konservativer’ Paradigmen reduzieren - sie zeichnet sich eher durch Gleichzeitigkeiten heterogener, wechselhafter und widersprüchlicher Orientierungen aus (vgl. Albrecht 2001, Groenemeyer 2001, O’Malley 1999a, Sparks/Loader 2002, Sparks/Leacock 2002). Darüber hinaus stehen gerade in der Bundesrepublik sowohl den ‚neo-liberalen’ als auch den ‚neokonservativen’ resozialisierungsskeptischen Rationalitäten „mächtige Interesseverbände der Verteidigung des ‚Rehabilitationsideals’ gegenüber“ (Groenemeyer 2001: 132), die besonders im Bereich der Jugenddelinquenz – vor allem wenn im Kontext der Forderungen nach schärferen Sanktionen eine Eskamotierung der Jugendhilfe und ihrer professionellen Interessen droht - auf den In diesem Kontext kann eingewendet werden, dass beide Logiken insofern in einem Komplementaritätsverhältnis stehen, dass sich ein vor allem auf ‚ständig steigende’ Zahlen und besondere Einzelfälle konzentrierender Diskurs um große und ‚kleine Monster’ (vgl. Der Spiegel 15/1998) ‚moralisch‘ bzw. ‚moralpanisch‘ sei, während der Umgang mit ihnen – Simon (1998) spricht vom ‚Management des Abscheulichen’ - manageriell und nach Kriterien der Gefährlichkeit verläuft. 73 Insofern hat Hans-Jörg Albrecht (in: Walter et al. 2002: 35) in analytischer Hinsicht nicht unrecht, wenn er fordert die Punitivität von Strafpolitik und Strafpraxis alleine deshalb getrennt zu betrachten, weil „die Implementation von Gesetzen im hohen Maße ökonomischen Zwängen und Brauchbarkeitskriterien unterlieg[t]“. 72 453 ‚Erziehungsgedanken’74 und ein ‚jugendgemäßes Strafverfahren’ bestehen (vgl. bspw. AGJ 2001). Von einem umfassenden Rückzug der Vertreter der Jugendhilfe aus dem jugendstrafjustiziellen Feld kann auch empirisch keine Rede sein: Rein quantitativ haben Fälle mit ihrer Beteiligung sogar deutlich zugenommen (vgl. Münder 2001). Nichtsdestoweniger verweisen die zeitgenössischen Entwicklungsdynamiken im justizellen Feld der Kriminalitätskontrolle auf eine generellen Verschiebung, die trotz unterschiedlicher Orientierungen und Schwerpunktsetzungen innerhalb dieser Dynamiken, auf eine sukzessive Unterordnung des einst unumstritten dominierenden Ideals der Resozialisierung unter ein risiko-managerielles Sicherheitsdispositiv verweisen. In einem formal-juristischen Sinn ist diese Entwicklung nirgendwo deutlicher rekonstruierbar als im Kontext des seit 1998 gültigen „Gesetz zur Bekämpfung zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten“. Im Rahmen einer in BadenWürttemberg 2001 erfolgten Spezifizierung dieses Gesetzes lautete die offizielle Begründung des Innenministeriums, dass das Gesetz darauf zielt, „die bestehende Sicherheitslücke zum Schutz der Gesellschaft“ dadurch zu schließen, dass „Gefangene die sich im Strafvollzug allen Resozialisierungsbemühungen widersetzen und denen zwei unabhängige Sachverständige eine hohe Rückfallgefahr bescheinigen […] in Zukunft auch nach Verbüßung ihrer Freiheitsstrafe nicht aus der Haft entlassen [werden]“ (IM Baden-Württemberg 2001). In dem neuen Straftäter-Unterbringungsgesetz (StrUBG) wird explizit verfügt, dass sich die Dauer Inhaftierung nicht primär an der verübten Tat zurichten ist, sondern an der prognostische festgesellten Rückfallrisikowahrscheinlichkeit der Täter. Die Haft ist in diesem Sinne logisch unabhängig von der Schwere der vergangenen Tat, d.h. sie kann unterschiedlich lange, gegebenenfalls auch unbeschränkt andauern75. Die wesentliche risiko-managerielle Verschiebung besteht darin, dass das rechtsstaatslogische Moment einer ‚gerechten Strafe’ weniger - wie im Strafwohlfahrtskomplex durch Orientierungen wie ‚Therapie statt Strafe’ oder ‚Hilfe statt Strafe’ - relativiert, sondern vor allem durch das Moment einer ‚gerechtfertigten Einsperrung’ zum Zweck der Unschädlichmachung suspendiert wird. Dabei erlauben die prognostizierte Tatwiederholungswahrscheinlichkeit und die erwartbare Gefährlichkeit eine Ausrichtung der Einsperrung auf unbestimmte Dauer an noch gar nicht begangenen Straftaten. Zwar wendet sich dieses Gesetz an die „besonders gefährlichen Straftäter“ (vor allem ‚Sexual- und Gewaltverbrecher’), aber es soll explizit auch als Hinweis für einen allgemeineren Wandel in der Politik und Rationalität des Strafens verstanden werden: „Mit dem Gesetz“, so verkündet das Innenministerium Baden-Württemberg (2001) „geben wir den Bürgern und Bürgerinnen das wichtige 74 Dass der Erziehungsgedanke für die Jugendlichen besonders hilfreich wäre kann bestritten werden, er zeichnet sich aber – in einem ganz ähnlichen Sinne wie Peters (1969) den ‚Nutzen’ einer ‚pathologischen’ Definition der Adressaten beschrieben hat – durch seine (vermeintliche) ‚Professionsadäquatheit’ aus. 75 So heißt es im §2 Abs.1 StrUBG: „Ist zu erwarten, dass die von den Betroffenen ausgehende Gefahr nach einer bestimmten Zeit nicht mehr besteht, wird die Unterbringung befristet angeordnet“, und §2 Abs.2 ergänzt: „Andernfalls wird sie unbefristet angeordnet“ (vgl. Landtag Baden- Württemberg 2001: 1). 454 Signal, dass die baden-württembergische Rechtspolitik alles Erdenkliche und Verantwortbare tut, damit wir das sicherste Bundesland bleiben“76. Trotz einer symbolischen Reformulierung der ‚Ordnung des Diskurses’ (vgl. Foucault 1997) im strafjustiziellen Feld kann in Bezug auf die empirische Strafrechtspraxis (vgl. Walter et al. 2002) angesichts zwar steigender aber nach wie vor verhältnismäßig kleiner Zahlen der tatsächlich Sicherheitsverwahrter77, davon gesprochen werden, dass eine solche ‚Reinform’ der Risikomanagementperspektive - als zentrales Element einer ‚neue Pönologie’ (vgl. Feeley/Simon 1992) - in der Bundesrepublik und anderen westeuropäischen Staates eher eine Diskursverschiebung und Tendenz als eine faktisch hegemoniale Strategie darstellt (vgl. Groenemeyer 2001, Garland 2001, Hannah-Moffat 2002), die die Institutionen des Sozialen - bzw. deren Denk- und Handlungsrationalitäten - aus dem Feld der strafrechtlichen Kontrolle hinaus eskamotiert. Die Tatsache, dass soziale Dienste offensichtlich auch weiterhin in diesem Feld agieren ist jedoch ebenfalls nicht einem unveränderten Fortbestehen wohlfahrtsstaatlicher Logiken gleichzusetzen. Es findet sich zwar keine Abschaffung, aber eine relative Zurückdrängung der relativ autonomen Gestaltungsmacht jener Experten – d.h. nicht der Experten selbst -, die den fordistischen StrafWohlfahrtskomplex beherrscht hatten. Vor allem aber verlängern sich die neuen managerialistischen Rationalitäten auch in die Perspektiven und Strategien der institutionalisierten Vertreter des Sozialen hinein78. Dabei gewinnt auch in der Sozialen Arbeit eine neue Logik des Strafens an Gewicht, in der das Opfer - als symbolischer Stellvertreter für ‚jeden’ (anständigen) Bürger und Antipode des Täters in den Mittelpunkt rückt. Ein zentrales Merkmal dieser Logik besteht in einem widersprüchliches Amalgam aus Versuchen zum Schutz der Öffentlichkeit, der Befriedigung ihrer Emotionen und einem effizienzbasierten Management von Risiken (vgl. Garland 2000: 350 ff). Dies Logik repräsentiert zugleich das Ende einer verächtlich als ‚bleeding hart’ (vgl. Stenson 2001: 17) beschriebenen Haltung der justiznahen personenbezogenen sozialen Dienste, die sich darin geäußert hatte, der Tendenz nach ‚auf der Seite des Täters’ zu stehen, der als individuell, psychologisch und emotional depriviertes Opfer von ungerechten und ungleichen gesellschaftlichen Verhältnissen repräsentiert worden ist (vgl. Groenemeyer 2001, Melossi 2000, Stenson 2001). Kriminelle Jugendliche, so fassen Traube/Wohlfahrt (2000: 11) den sich stattdessen abzeichnenden, neuen Konsens der Sozialen Arbeit zusammen, „sollen nicht länger zwischen den helfenden Institutionen in ‚Nischen der Verantwortungslosigkeit’ verschwinden. Wiederholungstäter sollen nicht länger in ‚Maßnahme-Karrieren’ orientierungslos zwischen einzelnen Projekten hinund hergeschickt werden. Sozialarbeiterische Betreuer benötigen Sanktionsmöglichkeiten (geschlossene Heime), um Wiederholungstätern, die über pädagogische Angebote nur lachen, wirksam entgegentreten zu können79 usw.“ „In anderen Bundesländern“ (allen voran Hessen aber auch NRW), so heißt es weiter, „besteht bereits heute Interesse an einer Übernahme unserer Vorschriften zum Schutz vor besonders gefährlichen Straftätern“ (IM Baden-Württemberg 2001) 77 Das Bundesamt für Statistik spricht von 206 Sicherheitsverwahrten für 1999, 219 für 2000 und 257 für 2002 78 „The human and social professions, whose judgement was once thought to be being displaced by technologies of risk”, so führt etwa Pat O’Malley (2000a: 458) aus, „have been required to adapt their expertise to the estimation of risks”. 79 Mit Blick auf diesen neuen Konsens ist es kaum mehr als eine Randnotiz, dass die Debatte um den sozialpädagogischen Sinn, dieser Einrichtungen (vgl. etwa Woltersdorff/Sprau-Kuhlen 1990) an den Rand gedrängt, wenn nicht bereits aufgegeben worden ist. Der ‚neue Konsens’ wird eher von einen umfassenderen ‚Paradigmenwechsel’ begleitet, bei dem der Diskurs um geschlossene Heime nur einen Aspekt unter vielen darstellt 76 455 Das Selbstverständnis der Jugendhilfe im Straf-Wohlfahrtskomplex wird dabei einem grundlegenden Wandel unterzogen und die wohlfahrtsstaatlichen Logiken geraten von Seiten seiner eigenen professionellen Träger in Bedrängnis. Die Skepsis gegenüber wohlfahrtsorientierten Rationalitäten entspringt nicht mehr einer gesellschaftskritischen Zurückweisung einer strafenden Wohlfahrt, die den Erziehungs- und Sozialisationsanspruch totaler Institutionen als reaktionäre Ideologie brandmarkt, sich gegen die Therapeutisierung der sozialen Kontrolle stellt und weniger eine ‚Heilung‘ und funktionale Eingliederung in die gesellschaftlichen (Macht)Verhältnisse, als die (Wieder)Herstellung (politischer) Identität als Ziel anvisiert hatte, sondern ihrem (scheinbar) ‚ideologiefreien‘ Gegenstück. Während in einem beträchtlichen Teil des Fachdiskurses – mit einem erheblichen Ausmaß an Ausnahmen – in der Regel zumindest rhetorisch noch hergehoben wird, dass weder geschlossene Heime noch andere ‚schärfere‘ formalisierte Sanktionsmaßnahmen im allgemeinen notwendig seien (dazu: Lindenberg 2002), hat in der Praxis „diese Verschärfung längst stattgefunden. Es gibt […] eine deutliche Tendenz, immer schneller, immer härtere Maßnahmen zu ergreifen“ (Guder 2000: 9). Dem korrespondiert seit spätestens den 1990er Jahren ein Perspektivenwechsel im Umgang mit Devianten und der Frage, wem mit ‚Hilfe’ und integrativen Maßnahmen begegnet werden soll. Dieser Perspektivenwechsel betrifft vor allem das „Bild vom Straftäter als bloßem Opfer widriger gesellschaftlicher Umstände“, an dessen Stelle Repräsentation des Abweichlers als einem „Straftäter“ tritt, der sich „nicht mehr so leicht aus seiner Verantwortung stehlen kann“ (Kipp 1997: 3). Auf einer professionspolitischen Ebene wendet sich etwa der 11. Kinder- und Jugendbericht (2002: 239) expressis verbis gegen eine den jugendlichen Delinquenten entschuldigende Repräsentation des Abweichlers, dessen Vergehen nur das Ergebnis und der sichtbare Ausdruck des ‚wirklichen’ ‚sozialen’ Problems ungerechter gesellschaftlicher Verhältnisse sei. Stattdessen wird betont, dass „Delinquenz von Kindern und Jugendlichen […] nicht damit gelöst wird, indem man die Täterin bzw. den Täter zum Opfer der Verhältnisse macht“ (Herv. H.Z.). In Übereinstimmung hierzu, beklagt auch das nordrheinwestfälische Landesjugendamt (1999: 55) „in der Kinder- und Jugendhilfe Tendenzen, Straftäter vorwiegend als ‚Opfer’ ihrer Verhältnisse zu betrachten und ihre Verantwortlichkeit zu vernachlässigen, [statt] jugendliche Täter heraus[zufordern], die Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen“. Die dabei zum Ausdruck kommenden Veränderungen der symbolischen Repräsentation des Abweichlers sind in ihrer politischen wie professionsbezogenen Relevanz kaum zu überschätzen: „Jede Politik sozialer Probleme funktioniert und legitimiert sich auf der Grundlage jeweils bestimmter Auffassungen, Interpretationen oder Konstruktionen über das zugrunde liegende Problem. In diesen Konstruktionen sind insbesondere Annahmen über Ursachen oder Erklärungsprinzipien und zumindest indirekt auch über Sympathie und Solidarität mit Tätern und Opfern enthalten. Dabei ist eines der zentralen Unterscheidungsmerkmale zwischen diesen Zuschreibungstypen sozialer Probleme die Dimension der Verantwortlichkeit und Schuld. So kann beispielsweise jemand, von dem angenommen wird, dass er das abweichende Verhalten aus ‚Böswilligkeit’ begangen hat, kaum mit der gleichen Sympathie oder Solidarität rechnen wie jemand, dem keine individuelle Schuld für das Verhalten zugeschrieben wird, weil er aus deprivierten Verhältnissen kommt“ (Groenemeyer 2001: 114) Im Kontext der Veränderungen der Repräsentation Adressaten der Soziale Arbeit zeichnet sich dabei ab, dass sich jenes hegemoniale Bild eines selbstverantwortlichen Akteurs, das sich im Kotau des Kundenbegriffs durchgesetzt hat auch auf jene Jugendlichen Anwendung findet, auf die die Jugendhilfe deshalb reagiert, weil sie die normativen symbolischen gesellschaftlichen Grenzen 456 unterboten haben. Wenn bei den jugendlichen Täter aber eher die eigene Verantwortung als ‚unverschuldete’, äußere und innere Bedingungen im Vordergrund stehen, muss sich die Frage nach Schuld sowie die Frage nach der ‚angemessen’ Reaktion anders stellen, als im Kontext der Annahme, dass schlechte gesellschaftliche Verhältnisse schlechte Folgen hätten (vgl. Peters 1995, 1998). Albert Scherr (1998a) konstatiert in diesem Zusammenhang eine Dominanz eines ‚neuen Realismus’80 in der Jugendhilfe, d.h. eines für wohlfahrtsstaatliche Experten und Eliten vergleichsweise neuen, bis zu Beginn der 1970er Jahre praktisch nicht vorkommenden Phänomens, dessen auftauchen Platt und Takagi (1977) in ihrem Essay über ‚Intellectuals for Law and Order’ beschreiben. Exemplarisch hierfür kann auf die Empfehlungen der 14. Shell-Jugendstudie zum Umgang mit einer als ‚Materialisten’ bezeichneten Gruppe von Jugendlichen verwiesen werden, in der sich „viele potenzielle Verlierer […] der gesellschaftlichen Entwicklung“ und „vermehrt soziale ‚Underdogs’“ (Deutsche Shell 2002: 21) befänden. Auf einen ‚neuer Realismus’ verweist dabei die Konsequenz, die aus dem Problem gezogen wird, dass diese Jugendlichen dazu neigen würden „die gesellschaftliche und politische Agenda mit einer diffusen Unzufriedenheit“ zu betrachten: „Bei einem Teil der Materialisten, vor allem bei den zu Aggressivität oder politischen Radikalität neigenden, geht es zuallererst um eine strenge Setzung von Grenzen weil diese (auch besonders gewalterfahrene) Gruppe keine andere Sprache versteht oder verstehen will. Erst wenn aggressive oder radikale Jugendliche wieder das Regelwerk der Gesellschaft akzeptieren, können ‚weichere’ Maßnahmen der Förderung und Integration einsetzen“. „Erinnert werden muss daran“, so argumentiert auch der 11. Kinder- und Jugendbericht (2002: 239) in eine vergleichbare Richtung, „dass Delinquenz von Kindern und Jugendlichen […] ein pädagogisches Problem [… ist, das] pädagogische Antworten provoziert, die eher etwas mit Erziehung, sozialer Kontrolle, Intervention bzw. Eingriff, Grenzsetzung und Normverdeutlichung zu tun haben”. Gerade weil Shell-Studie wie Kinder- und Jugendbericht über einen Konservatismusverdacht erhaben sind, verdeutlichen sie paradigmatisch die zeitgenössischen Verschiebung von einem Bezug auf die ‚positional-dispositionale Matrix’ der Akteure zu einem deutlicheren Dispositions- bzw. Verhaltensbezug - wobei es mit Blick Kinder- und Jugendbericht alleine sprachlich bezeichnend ist, dass das Präfix ‚sozial’ vor dem Begriff ‚pädagogisch’ wegfällt. Der Realismus als paradigmatische Richtung in der Kriminologie zeichnet sich nicht dadurch aus dass es besonders ‚realistisch’ ist. Er meint vielmehr eine affirmative Haltung zur gegebenen Ordnung und eine neo-positivistischen Perspektive auf den Abweichler (‚wicked people exist’ Wilson 1975) sowie die „rejection of utopian solutions to crime and the advocacy to persue crime reduction. […Also they are] concerned with devoloping resonses to a perceived intensity in the public’s fear of crime” (Muncie 2001: 336, vgl. Walklate 1996). Zu den theoretischen Ansätzen, die im weiteren Umfeld des ‚right realism’ und der Ansätze und der ‚staatsnahen’ ‚administrative criminology’ adaptiert worden sind gehören u.a.: Sozio-biologische Perspektiven, die (Selbst-)Kontrolltheorie sowie ‚rational choice’- und ‚routine activity’- Ansätze. An dem ‚rechten Realismus’ wurden seine eher ‚a-theoretische’ Perspektive und seine Verlängerung von moralischem ‚Common Sense’ Annahmen – bis hin zum Konzept der Sünde in die Analyse von Abweichung und bei der Herauspräparierung entsprechender Interventionsansätze kritisiert. In Anlehnung an Jock Young (1981) charakterisiert Groombridge (1998) den rechten Realismus im wesentlichen durch vier Elemente: a) the priority of order over law - the ,rights’ of society over those of the offender ; b) respect for tradition - as defined by the powerful; c) an emphasis on lack of morality as a cause of crime and the retrenching of morality as a cure for it; d) its atheoreticism, having no organised discourse or codified body of work (Von dem rechten Realismus zu unterscheiden ist der ‚Linke Realismus’ [vgl. Matthews/Young 1992, etwa vergleichbar: Hess/Scheerer 1997] der mit der hier skizzierten ‚Wende’ jedoch wenig zu tun hat, sondern sich eher kritisch von einigen Annahmen des ‚labeling approach’ abgrenzt). 80 457 Der ‚neue Realismus’ in der Sozialen Arbeit steht in einem deutlichen Analogieverhältnis zu Ausführungen, die in Großbritannien als Beispiele dafür geltend gemacht werden, dass sich New Labour auch in der Kriminalpolitik wohlfahrtsstaatlichen Traditionen verabschiedet habe (vgl. Muncie 2000, Sparks/Leacock 2002). Als ‚Kronzeuge’ hierfür wird in der Regel folgende Kernaussage eines White Papers mit den bezeichnenden Titel ‚No More Excuses: New Approaches to Tackling Youth Crime’ zitiert: „[T]he youth justice system”, so heißt es dort, „too often excuses the young offender before it, implying that they cannot help their behaviour because of their social circumstances. Rarely are they confronted with their behaviour and helped to take more personal responsibility for their actions”(Home Office 1997 nach: Sparks/Leacock 2002: 214). Was dieses umstrittene New Labour-Papier zum Ausdruck bringt - der Kriminologe John Muncie (2000) spricht von einem Manifest ‚institutionalisierter Intoleranz’ - unterscheidet sich vom hegemoniale Diskurs in der Jugendhilfe der Bundesrepublik rhetorisch und inhaltlich nur unwesentlich. Die eingenommene Perspektive kann als ‚neo-sozialer Pragmatismus’ beschrieben werden. Gegenüber der Härte der ‚rechten Realisten’ (vgl. Wilson 1975, Murray 1996, Bennett et al. 1996), bleiben in diesem neo-sozialen Pragmatismus Teile der ‚alten’ wohlfahrtsstaatlichen Rhetorik des ‚Helfens’ bestehen, und selbst der Verweis auf ‚soziale Umstände’ wird aufrechterhalten81. Gegenüber dem ‚alten’ Diskurs des Sozialen, werden sie aber im ‚neo-sozialen’ Diskurs neu kontextuiert: Entsprach es der bisherigen Betrachtungsweise der Jugendhilfe Abweichung, im Rekurs auf die postionaldisositionale Matrix der Akteure, „als Ausdruck und Folge beschädigter Subjektivität” (Scherr 1998a: 64) – und Seitens kritischer Gruppen „as innovative, sometimes as a challenge to unjust institutions, weather these were political or economic institutions“ (Melossi 2000: 170) - aufzufassen, ist es Ausdruck eines neo-sozialen „pragmatischen Realismus“ (Muncie 2000: 14), dass „auch in den Sozialwissenschaften und der Sozialen Arbeit erneut ein Deutungsmuster an Einfluss gewinnt, das den moralisch verwerflichen und verantwortlich zu machenden Täter in den Vordergrund stellt” (Scherr 1998a: 65). Überspitzt formuliert ist die doxische Regelmäßigkeit der Wahrnehmung und Repräsentation des Abweichlers, die auf einer ‚evil-causes-evil’ Annahme basierte (zuerst: Davis 1938, vgl. Lindesmith 1968, Cohen 1968, Matza 1973), der Tendenz nach von einer anderen expliziten oder impliziten Annahme abgelöst worden: „bad people making bad choices“. (Gilling 2001: 368, vgl. Melossi 2000). In diesem Kontext wird auch von Professionellen und selbst von einst strafrechtskritischen Gruppen und Verbänden gefordert, dem (jugendlichen) Straftäter nicht mehr alles durchgehen zu lassen und auch mit schärferen Maßnahmen Grenzen zu setzten: „Die Hilfebedürftigkeit des Straftäters per se wird hinterfragt, und es gerät ein anderes Problem in den Blick: die Hilfe für Opfer von Straftaten“ (Kipp 1997: 3). Im Kotau einer Kriminalpolitik, die sich durch eine Verstärkung der „Politisierung […], Emotionalisierung (Betonung der ‚verdienten’ Strafe) und den Rückgriff auf vereinfachte CommonSense Konzepte (Verfolgen-Anklagen-Strafen) aus[zeichnet]“ (Albrecht 2002: 22) zeigen sich die professionell mit Abweichung Befassten - ebenso breite Teile der Öffentlichkeit (vgl. Cesaroni/Doob Zumindest wird, wie es Bourdieu formuliert hat, eine ‚opportunistische Instrumentalisierung einer medienwirksam aufbereiteten Sozialsymbolik’ aufrechterhalten. 81 458 2003, Hess 2001, Garland/Sparks 2000, Kury/Ferdinand 1999) - immer weniger willig sich ‚auf die Seite des Täters’ (dazu: H. S. Becker 1967) zu stellen und eine als gescheitert betrachtete (‚lasche’) resozialisierende bzw. therapierende Strafpolitik hinzunehmen (vgl. Melossi 2000). Auf einen solchen Wandel im Habitus der Professionellen verweist etwa eine Untersuchung von Lösel (2002), die auf der Basis in einer Expertenbefragungen verschiedener psychosozialer Berufgruppen im Strafvollzug zu dem Ergebnis kommt, dass sich ein ‚Generationswechsel’ bei den Professionellen abzeichnet, nach dem „ältere Befragte, die ‚kalte, deprimierende Gesellschaft’ als weit bedeutsamer für die Kriminalitätsentwicklung einstuften als jüngere“ (nach Walter et al. 2002: 32). Gegenüber dem ‚benachteiligten’ Täter nimmt die Identifikation mit dem konkreten wie verallgemeinerten Opfer zu: „Das Postulat des ‚Verstehens’ des Täters war schon immer eine herausfordernde und schwierige Einstellung, die im Wesentlichen von liberalen Eliten, die von Kriminalität unberührt waren und von professionellen Gruppen, die damit ihr Geld verdienten, geteilt wurde. Dieses Postulat wird im wachsenden Maße zu Gunsten einer Verurteilung der Kriminellen und Forderungen nach ihrer Bestrafung und Kontrolle aufgegeben. Die Perspektive einer Reintegration des Täters wird mehr und mehr als unrealistisch betrachtet und erscheint mit der Zeit auch moralisch weniger erforderlich. Die neuen Kriminologien nehmen dieses Echo auf und verstärken diese Befürchtungen - sie betonen verstärkte soziale Kontrolle und situationsbezogene Prävention, rational choice und den Abbau von Anreizen, Incapacitation und punitiven Ausschluss“ (Garland/Sparks 2000: 17) Während die Forderungen nach diesen Maßnahmen selbst durch eine Art ‚neo-konservative’ Moral normativ unterfüttert sind, gibt es zahlreiche Hinweise dafür, dass die Art und Weise ihrer Umsetzung einen ‚manageriellen’ Wandel einleiten, der sich weniger an moralischen Werten als an ökonomischen Effizienzkriterien orientiert. So empfehlen etwa die Jugendminister (nicht Justizminister) der Länder durch einen verstärkten Rückgriff auf Möglichkeiten der Diversion und Verfahrensbeschleunigung die „knappen Ressourcen effizient [einzusetzen und…] justizielle Reaktionen auf bestimmte Täter(-gruppen) [sic!] zu konzentrieren. Dies kann dadurch geschehen, dass Verfahren gegen besonders auffällige Jugendliche vorrangig oder konzentriert bearbeitet werden […]. Ebenso kann eine Konzentration der Ressourcen zur Verfahrensbeschleunigung bei in der Öffentlichkeit besonders beachteten, Deliktgruppen führen“ (JMK 2000: 18) In einem gewissen Sinne können diese Forderungen als Ausdruck einer sich etablierenden Kriminalbzw. Strafpolitik verstanden werden, die sich, wie es Thomas Lemke (1997: 251) formuliert, „auf eine Intervention auf dem Markt des Verbrechens [beschränkt], die das Angebot des Verbrechens durch eine negative Nachfrage begrenzt, wobei deren Kosten niemals die Kosten des Verbrechens übersteigen sollen“. Die Pointe dieser Strafpolitik besteht darin, dass sie weder auf alle Formen der Abweichung reagiert, noch eine möglichst umfassende ‚Auslöschung’ des Verbrechens anstrebt „sondern ein vorübergehendes und immer fragiles Gleichgewicht zwischen einer positiven Angebotskurve des Verbrechens und einer negativen Nachfragekurve der Sanktionen“. Ein solches Gleichgewicht des Effizienzverhältnisses von Non-Intervention und Punitivität steht etwa im Mittelpunkt der ökometrischen Analysen des neo-klassischen Ökonomen Gary S. Becker (1988). Dabei geht es im wesentlichen um die Frage, wie viele Delikte ignoriert - d.h. der Entdeckung entzogen - und wie viele Delikte nicht formell bestraft werden sollten, wenn die Kriminalpolitik alleine dem ökonomisch rationalen Ziel folgen würde, den durch die Delikte entstanden Schaden zu minimieren82 (vgl. auch Fass/Pi 2002, Maenning 2002). Pointiert formuliert war das Ergebnis dieser Eine ähnliche Überlegung stellte jüngst auch der Hamburger Ökonom Wolfgang Maenning in der ‚Zeit’ (3.1. 2002: 18) unter dem bezeichnenden Titel „Die optimale Kriminalität“ an. Aus seiner „Kosten-Nutzen-Gegenüberstellung folgt eine erste 82 459 Analyse, die auf der Verbindung von Annahmen über individuelles Marktverhalten mit einer (ökonomischen) Kosten-Nutzen-Rechnung staatlichen Strafens basiert, dass der ‚optimale’ Output, jene Form der Ausweitung einer ‚gegabelten’ Diversionspraxis nahe legt, wie sie etwa die Jugendministerkonferenz empfiehlt (dazu: Karstedt 1993: 64 f, Karstedt/Greve 1996). Nicht nur aus einer ökometrischen Perspektive, sondern auch aus einer supervisorischen Gesamtperspektive lässt sich dabei die These vertreten werden, dass die Diversionslogiken vor dem Hintergrund enormer Kosten und einer unzureichenden Zweckeffizienz des Gefängnissystems eher einer Ökonomisierungsund Rationalisierungslogik als einer ‚Humanisierungstendenz’ folgen, zumal von einer generellen Tendenz zur Humanisierung staatlichen Strafens zumindest seit den 1990er Jahren kaum die Rede sein kann (vgl. Bauer 1997: 42 ff, Dünkel/Kunkat 1997). Die Verschiebungen in der Legitimation und die Logik der Praxis in der zeitgenössischen strafjustiziellen Landschaft, weist dabei durchaus eine eine Verwandtschaft zu jener fortgeschritten liberalen Rationalität des Verurteilens und Strafens auf, die vor allem von den US-amerikanischen Kriminologen Jonathan Simon und Malcolm Feeley als eine auf dem konzentrierten und zielgerichteten Einsatz beschränkter Mittel basierende ‚New Penology‘ rekonstruiert worden ist. Unter der ‚New Penology’ verstehen Feeley und Simon zunächst eine Straflogik, die darin besteht, die Mittel der Kriminalitätsbekämpfung als beschränkte Ressource zu handhaben, die es möglichst kostensparend und effektiv einzusetzen gilt. Dies wird am effizientesten dann erreicht, wenn der vergangene - von der ‚klassisch-liberalen’ Straflehre fokussierte - Bruch des Sozialvertrags selbst, per se keine besondere Aufmerksamkeit erfährt, und auch der auch der individualisierte Täter als fehlerhaftes Individuum jene Bedeutung verliert, die im Straf-Wohlfahrtskomplex systematisch aufgebaut wurde (vgl. auch Beck 1988). Das Kernstück der ‚New Penology’ ist die Identifikation der wenigen ‚hoch kriminalitätsbelasteten’ und riskanten Tätergruppen. Hatte Herbert Packer (1964, 1969) in den 1960 Jahren auf die Differenz eines ‚due process’ Modells‚ dass sich juridische Behandlung der Tat bezieht und eines im wesentlichen disziplinierenden ‚crime control’ Modells mit einer technologischen Zwecksetzung aufmerksam gemacht, so haben sich in der ‚New Penology’ nicht nur die Gewichte zugunsten des ‚crime control’ Modells verschoben, sondern auch innerhalb dieses Modells hat sich ein verändertes Paradigma etabliert. Die disziplinierende Bearbeitung des einzelnen Individuums hat zugunsten einer risikobearbeitenden ‚governmental power’ an Gewicht verloren, die auf Reduzierung der Kriminalitätsrate durch die Reduzierung der kriminellen Frequenz gerichtet ist, die von einer bestimmten - etwa besonders auffälligen, besonders ‚gefährlichen’ oder einer im besonderen Maße die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehenden - Population ausgeht (vgl. Tadros 1998). Für die ‚neue Pönologie’, so die These von Feeley und Simon (1992, 1996, vgl. Lindenberg 1997), sind weniger Fragen von Schuld, Verantwortung und moralischer Haltungen und auch nicht in erster Linie Interventionen und Behandlungen individueller Täter zentral. Im Mittelpunkt des Interesses stehen ökonomische Empfehlung: Die zusätzlichen Kosten einer verstärkten Kriminalitätsbekämpfung dürfen deren zusätzlichen Nutzen nicht übersteigen. Hieraus ergibt sich ein eindeutiges Optimum an Kriminalität, das in der Regel nicht bei Null liegt – dafür fallen im Allgemeinen [zu] hohe Kosten der Vermeidung und Bestrafung an. Aus ökonomischer Sicht ist ein bestimmtes Maß an Kriminalität effizient – oder tolerierbar“. 460 vielmehr jene Techniken und Technologien, die es ermöglichen Gruppen, sortiert nach ihrer Gefährlichkeit, zu identifizieren, zu klassifizieren und zu managen. Eine solche Form der Strafjustiz basiert auf einer ‚versicherungskalkulatorischen’ Form der Risikofeststellung (‚actuarial risk assessment’), auf deren Basis dem Strafrecht und der Strafe selbst die Rolle einer Art manageriellem ‚Großsteuerungsmittel’ von Risiken (vgl. Prittwitz 1993, Hassemer 1989), auf dem von Lemke benannten ‚Markt des Verbrechens’ zukommt. Innerhalb einer solchen Logik erlaubt die Identifikation der wenigen ‚hoch kriminalitätsbelasteten’, riskanten Tätergruppen eine informelle bzw. „community punishment and control of the many low-rate offenders“ (Hudson 2001: 155, dazu auch: JMK 2000, BMFSFJ 2002) „whilst persistent offender profiling has provided a prime tactic for tackling high crime rates“ (Hudson 2001: 151). Diese Taktik besteht etwa darin, dass identifizierte Risikoträger dadurch unschädlich gemacht werden, dass auf die ein oder andere Weise (in Heimen, Strafvollzug, Psychiatrie etc.) festgesetzt oder (z.B. durch Abschiebung ‚krimineller Ausländer’) ‚ausgesetzt’ werden. Die Logik des Risikomanagements der ‚New Penology’, hat seine Wurzeln im Versicherungsgewerbe83. Es basiert auf Techniken der statistischen Wahrscheinlichkeitskalkulation von Risiken, die sich numerisch ausdrücken lassen. Mit Rekurs auf bestimmte soziale und persönliche Faktoren, sowie auf bestimmte Kriminalitätsformen lassen sich verschiedene Gruppen ‚clustern’ und beispielsweise Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls mittels einer aggregierten statistischen Analyse von ähnlichen Verhaltensmustern unter ähnlichen Umständen mathematisch relativ genau bestimmen. Ob bei einer Clustergruppe die Rückfallwahrscheinlichkeit im Falle einer (vorzeitigen) Entlassung beispielsweise bei 30 %, bei 55 % oder bei 70 % liegt, ist auf dieser Datenbasis in einem populationsstatistischen Sinn84 ‚vorhersagbar’ und entsprechend lassen sich die ‚knappen Ressourcen’ des ‚Risikomarkts’ am effektivsten, effizientesten und ökonomischsten einsetzen (vgl. Kemshall 2002a, 2002, SchmidtSemisch 2002). Das primäre Ziel einer versicherungskalkulatorischen Strafjustiz im Sinne von Feeley und Simon ist weniger die Veränderung der Täter, sondern ihre optimale Verwaltung: „This means that the traditional parens patriae orientation of juvenile justice, as well as punishment, have been supplanted by the goal of efficient processing. Mathematical models, […] establish profiles that are used to streamline the processing of juvenile cases and offenders. Attributes of actuarial justice markedly change the justice process for youths, as […] the emphasis becomes one of cost-efficient warehousing” (Kempf-Leonard/Peterson 2000: 66). Vor allem richtet sich die ‚New Penologie’ auf ein möglichst effizientes und effektives Management der ‚Gefährlichen’ (vgl. Pratt 1997) auf der Basis einer Kalkulation ihres kriminellen Potentials, der Wahrscheinlichkeit, dass dieses Potential zur Anwendung kommt und dem Aufwand der notwendig ist, um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren (vgl. Hannah-Moffat 1999, Simon 1996). Auf einer politisch- Feeley und Simon sprechen von einer ,actuarial justice’. In den im deutschen Sprachraum noch eher spärlichen – und im Bereich der Sozialen Arbeit mehr oder weniger nicht existenten – Auseinandersetzungen mit diesem Ansatz wird dies häufig mit ‚versicherungsmathematischer Gerechtigkeit’ übersetzt. Diese Übersetzung ist insofern hilfreich wie sie auf das mathematische Moment in diesem Ansatz und darauf verweist, dass sich die Form der Gerechtigkeit – weg von der sozialen Gerechtigkeit – verändert. Beide Momente sind in diesem auf Stan Cohen zurückgehenden Wortspiel – ‚justice’ bedeutet ‚Justiz’ und ‚Gerechtigkeit’ impliziert. In dieser Arbeit wird von dieser durchaus geistreichen Übersetzung deshalb abgewichen, weil die engere Zusammenhang dessen was Cohen, Simon und Feeley beschreiben, treffender mit der anderen Seite dieses Wortspiels gefasst werden kann: Es geht um eine Form der Strafjustiz die auf versicherungskalkulatorische Techniken zurückgreift. 84 Dies ist etwa vergleichbar mit den verschiedenen Einstufungen in der KFZ Versicherung. 83 461 diskursiven Ebene dabei besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Aufstieg der Viktimologie bzw. der Figur des Opfers und dem Aufstieg einer risikomanageriellen Form der Strafjustiz. Das Risiko, das reduziert werden soll, bemisst sich weniger an dem „offender (as in correctionalist phase) or the system (as in the legitimation phase), but the community of potential victims“ (Hudson 1996: 154). In diesem Kontext erscheint für bestimmte Risikogruppen die Unschädlich- bzw. Unfähigmachung (‚incapacitation’) als das geeignete Mittel (so etwa die Logik des StrUBG). Das Unschädlichmachen durch Wegsperren geschieht jedoch weniger aus der normativen Überzeugung heraus, dass diese Täter (oder ihre Taten) besonders hart bestraft werden müssten, sondern weil dies für diese Gruppen der sicherste und in einem gewissen Sinne auch der ‚rationalste’ und pragmatischste Weg sein kann, ein nicht-tolerierbares Risiko für die Gemeinschaft der potentiellen Opfer zu reduzieren, dessen wahrscheinliche Träger in diesen Gruppen zu finden sind „[Thus t]he new penology is neither about punishing nor about rehabilitating individuals. It is about identifying and managing unruly groups. It is concerned with the rationality not of the individual behaviour or even community organisation, but of managerial processes. Its goal is not to eliminate crime but to make it tolerable through systematic coordination”(Feeley/Simon 1996: 368). Die ‚New Penology’ richtet sich demnach weniger darauf, gegenüber individuellen Abweichlern zu reagieren, um ihre weiteren individuellen Abweichungen zu verhindern, sondern zielt auf die Regulierung der Prävalenzraten von Devianz. Die veränderte Rationalität, die sich aus einem Fokus auf die überindividuelle Prävalenz- statt die individuelle Inzidenzrate ergibt, lässt sich am anschaulichsten mit Blick auf die unterschiedlichen Ziel- und Erfolgsprämissen erläutern85. Nach dem fordistischen Resozialisierungsideal musste es als ein ‚Misserfolg’ betrachtet werden, wenn ein Täter z.B. nach sieben Jahren ‚rehabilitierenden’ Strafvollzug sofort wieder ‚rückfällig’ wird. Das Ziel des Vollzugs, das Individuum zu verbessern und seine künftige Abweichung zu verhindern, ist gescheitert. Empirisch steht der ‚rehabilitierende’ Strafvollzug ferner vor dem Problem, dass die Wahrscheinlichkeit seines Scheiterns mit steigender Länge der Inhaftierung oft nicht verbessert, sondern verschlechtert. Aus der Perspektive der ‚New Penology’ stellt sich dieses Problem nicht. Sie impliziert eine Sanktionslogik, „[which] attempts to manipulate the public as a demographic mass or aggregate, bypassing the res cognitans of the individuals […]. The aim is not to induce altered behaviour […] but the management-through-varying-levels-of-custody of that segment of the population that is dangerous” (Feeley/Simon 1994: 175). Im Mittelpunkt versicherungskalkulatorischer Justizpraktiken steht der Versuch „to maximize the efficiency of the population as it stands. Rather than seeking to change people (‚normalize them’, in Foucault’s apt phrase) an actuarial regime seeks to manage them in place“ (Simon 1988: 773). Geht man etwa, stark vereinfacht86, davon aus, dass der Täter, auf den sich eine versicherungskalkulatorische Form der Strafjustiz bezieht, ein Akteur ist, von dem 25 Delikte François Ewald (1993: 214f) verdeutlicht den Unterschied von individueller Inzidenz- und kollektiver Prävalenzrate am Beispiel des Unfalls: „Der Unfall, der individuell genommen [Inzidenz…] als zufällig […] erscheint, stellt sich auf eine Population bezogen [Prävalenzrate], als kalkulierbar und vorhersagbar dar. Man kann vorhersagen, dass es im kommenden Jahr so und so viele Unfälle geben wird; die einzige verbleibende Unbekannte ist die [individuelle Inzidenz]: Wer wird verunglücken? Wen wird dieser unglückliche Zufall treffen?“ 86 Diese viel zu statischen Beispiele sind vornehmlich statistische Artefakten und in keiner Weise realitätsgerecht. Es geht es um die Darstellung der Rationalitäten einer ‚New Penology’ im Sinne von Simon und Feeley . 85 462 im Jahr erwartet werden können, dann sinkt die statistische Devianzrate (Prävalenzrate) bei einem Jahr Inhaftierung um 25 Delikte, bei zwei Jahren um 50, bei drei um 75 usw.. Der präventive Erfolg ergibt sich für diesen Typus des Täters - pointiert formuliert - aus der maximalen Ausdehnung der Haft selbst. Nach sieben Jahren wird die Prävalenzrate um 175 Delikte reduziert, unabhängig davon ob der einzelne Täter rückfällig wird oder nicht87. Wird der Täter wieder ‚rückfällig’ ist dies im Gegensatz zur Resozialisierungslogik kein Indiz für das Scheitern der Strafe, sondern ein Indikator dafür, dass möglichst lange Haftzeit die richtige Strategie ist, der im Falle eines Rückfalls nachzukommen ist88 (zur empirischen Effektivität: Sherman et al. 1997, skeptisch: Lippke 2002, Killias 1999). Obwohl die - für den klassenspezifischen Bias des Straf-Wohlfahrtskomplexes mit verantwortlich gemachte - ‚evil causes evil’ Annahme in der Logik einer ‚actuarial justice’ keine exponierte Rolle mehr spielt, hat sich durch den manageriellen Rekurs auf das ‚Risiko’, die klassenstrukturelle Selektivität des ‚fordistischen’ Kriminaljustizsystems in keiner Weise geschmälert. Wie Barbara Hudson (1996: 154 f) zusammenfasst, sind die Gefahren und Selektionsprozesse „posed by the actuarial regime […], in fact similar to those of normalizing regime: that the constraints imposed be justice should be overridden by the gains promised by the technologies; and that the new techniques will continue to be directed against the same population, the disadvantaged, who will lose even such limited protection as is offered by a commitment to justice”. Zugleich wird einem politischen Widerstand gegen versicherungskalkulatorische Kriminaljustizregime im Vergleich ‚fordistischen’ Normalisierungsregimes schon alleine wegen der in den risikomageriellen Techniken angelegten Allianz zum hegemonialen Opferdiskurs wenig Aussicht bescheinigt: „Who could argue against politics and practices designed to help people avoid suffering from criminal victimization?“ (Hudson 1996: 154, vgl. Simon 1988) – und wer ‚auf Seiten’ gefährlicher und ‚Trieb’und ‚Gewohnheitsverbrecher’? In einem gewissen Sinne zielt hierauf auch die Kernaussage in der bekannt gewordenen Rede des damaligen britischen Innenministers Michael Howard: „Well shall no longer judge the success of our system of justice by a fall in our prison population […]. Let us be clear: Prison works. It ensures that we are protected from murders, muggers and rapists – and it makes many who are attempted to commit crime think twice” (zit. nach Newburn 2002: 556) 88 Ein weiteres Moment der Logik der ‚New Penology’ lässt sich treffend wie folgt darstellen: Gegeben sei die Richtigkeit und Sinnträchtigkeit der Annahme dass 50 % der registrierten Kriminalität von etwa zehn Prozent der Täter verübt wird (vgl. dazu BMFSFJ 2002: 236, Bezogen auf Geburtskohorten sprechen Tracy et al. (1990) für die USA davon, dass etwa sechs Prozent einer Geburtskohorte für 53% aller polizeilich registrierten Delikte verantwortlich seien), während umgekehrt 50% der Täter für zehn Prozent der Delikte verantwortlich zeichnen. Der kalkulatorischen Logik der ‚New Penology’ würde es in diesem Falle entsprechen, die letztgenannten 50% mehr oder weniger zu ignorieren, jedenfalls nicht allzu viel Anstrengung auf sie zu verwenden. Sie einzusperren wäre gemäß dieser Logik vergleichsweise irrational. Optimal wäre es hingegen jene zehn Prozent der Täter zu ermitteln die für 50% der Delikte verantwortlich sind - oder je nach Rechnung 5% die für ca. 30% der Delikte verantwortlich zeichnen - um sie, vornehmlich durch die Einsperrung selbst, unschädlich, bzw. zur Begehung weiterer Delikte ‚unfähig’ zu machen (engl. ‚to incapacitate’). Für die Senkung der Prävalenzrate von Abweichungen, hat die ‚selective incapacitation’ jener verhältnismäßig kleinen Gruppe, die über die statistisch ungünstigste Kombination von Risikound protektiven Faktoren verfügt eine bessere ‚Erfolgsaussicht’, und vor allem verspricht er effektiver, effizienter und ökonomischer zu sein, als der ceteris paribus unsichere und aufwendige Versuch eine große, vergleichsweise oft wenig ‚riskante’ Gruppe zu ‚resozialisieren’. Bleibt man bei diesem fiktiven Rechenbeispiel, könnte man argumentieren, dass wenn es gelänge nur ein Fünftel der genannten ‚10%-Gruppe’ dauerhaft unschädlich machen, es hinsichtlich der Senkung der Prävalenzrate genauso erfolgreich sei, wie eine völlige erfolgreiche Resozialisierung der gesamten ‚50%-Gruppe’. (Das Problem besteht jedoch darin, dass diese ‚10%-Gruppe’ im Kern ein statistisches Artefakt darstellt [vgl.. dazu Sampson 2000, Sampson/Laub 2001]). 87 463 Die Tendenz auf ‚aktuarialistische’ Techniken im Kriminaljustizsystem zurückzugreifen ist in den letzten zehn Jahren in unterschiedlichem Maße vor allem in den USA aber auch in Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und Kontinentaleuropa identifiziert und rekonstruiert worden (vgl. O’Malley 2002). Die Techniken einer versicherungskalkulatorischen Strafjustiz reduzieren sich dabei nicht auf Prozesse der ‚selective incapacitation’, die in zumindest ihrer idealtypischen ‚Reinform’ auch in den USA keinesfalls flächendeckend etabliert worden sind. Zu dem versicherungskalkulatorischen Diskurs gehören auch Strategien, die von einer - auch in der Bundesrepublik kaum zu übersehenden Konjunktur der Untersuchungshaft, über die Etablierung von Techniken des ‚Profiling’, bis zu präventiven Drogentests und der ‚Rasterfahndung’ - die ebenfalls auf der Grundlage von Risikoprofilen basiert - reichen sowie und vor allem der Siegeszug der ‚situationalen’ Techniken der Kriminalprävention (vgl. Groenemeyer 2001, Feeley/Simon 1992, 1994). Allerdings kann weder für die anglophonen Länder und erst recht nicht für die Bundesrepublik davon gesprochen werden, dass diese versicherungskalkulatorischen Prinzipien folgenden Straftechnologien, andere vorgängige Relationalitäten, Technologien und Ansätze - seien diese ausgleichend, abschreckend, klinisch-therapeutisch oder auf sozialarbeiterischen Interventionen basierend substanziell in Frage gestellt oder gar völlig verdrängt hätten (vgl. Groenemeyer 2001, Peters 2002, Sparks 2000, Simon/Feeley 1995). In den Gefängnissen (kontinental)europäischer Gesellschaften kann von einem Verschwinden von Ansätzen, die auf individuelle Täter zielen, kaum eine Rede sein und auch die Betonung der individuellen Verantwortung nimmt eher zu als ab. In diesem Sinne lässt sich sagen, dass ein risiko-managerialistische Einfluss in der Strafpolitik zwar rekonstruierbar ist, aber insgesamt weniger den Prinzipien der ‚New Penology’ im engeren Sinne von Simon und Feeley folgt. Der ‚Neue Pönologie’ in der Bundesrepublik, so die These, lässt sich als ein (Wieder)Erstarken von manageriell reformulierten Prämissen eines älteren, in Europa durchaus verbreiteten Konzepts interpretieren: Der Idee des ‚Défense Sociale’89 (vgl. Groenemeyer 2001, Schmidt-Semisch 2002). In Bezug auf Kontinentaleuropa weisen die Ausführungen von Simon und Feeley in so fern in eine richtige Richtung wie sie darauf verweisen, dass eine neue ‚post-straf-wohlfahrtstaatliche’ Form der Pönologie Einzug in die Programmatik und Praxis des Strafens gefunden hat. Diese stellt eine veränderte Form der Rationalität - bzw. des ‚Nachdenkens’ über Abweichung (vgl. Garland 1999a) dar, in der den Fragen der Verwaltung von Risiken ebenso wie den ökonomischen Prämissen des ‚Managerialismus’ eine vergleichsweise prominente Bedeutung zukommt. Das bedeutet jedoch nicht, dass es sich bei allen Aspekten, die in der zerklüfteten Landschaft des fortgeschritten liberalen Strafkomplexes auf eine solche Rationalität verweisen um substanzielle ‚Neuproduktionen’ der Technologien, Strategien und Teleologien handelt. Häufiger noch geht es um neuen Konfigurationen im Sinne eines Re-Arrangements (und manchmal auch nur einer Umbenennung) existierender oder gar eines ‚Recyclings’ älterer Praxisformen (vgl. Leacock/Sparks 2002, O’ Malley 1999). Ein nicht unerhebliches Indiz dafür, ist auch die zeitgenössische Ausweitung des Spektrums unterschiedlicher Sanktionsarten - z.B. gemeinnützige Arbeit statt oder neben Freiheitsstrafe und Geldstrafe, dem Verbot der Ausübung von diversen Rechten ( etwa der Fahrerlaubnis) etc. - eine klassische Perspektive des ‚Défense Sociale’ Konzepts. 89 464 Eine Gemeinsamkeit der ‚Neuerfindungen’ und der ‚Neuanordnungen’ der Prämissen, Techniken und Ansätze besteht darin, dass sie sich zunehmend von jenem System von Regelmäßigkeiten der fordistischen Wohlfahrtslogik entfernen, die auf eine Kompensation und Verbesserung der Defizite in der positional-dispositionalen Matrix der Akteure zielt, ohne dass dabei zwangsläufig eine völlige Neugestaltung des bisherigen strafjustziellen Systems – das sich in seiner präventiven Ausrichtung auch bisher schon mit Fragen des Risikos und des ‚Risikomanagements’ beschäftigt hatte – impliziert sein muss. Es lässt sich eher von einer ‚schleichenden’ Adaptation ‚risiko-managerieller’ Ansätze und Techniken in das bestehende System sprechen. Im Zuge dieser Adaptation werden Fragen der Effektivität, Effizienz und Sicherheit sowie Fragen des Risikos und der Risikokalkulation zwar keinesfalls völlig neu aufgeworfen, sie werden aber in einem wesentlich stärken Maße als bisher zu zentralen Parametern der Strafrationalität (vgl. Rehn et al. 2001). Zumindest in Westeuropa lässt sich diese Entwicklung weniger als eine Ersetzung der ‚alten Pönologie’ des Straf-Wohlfahrtskomplexes durch eine versicherungskalkulatorischen Rationalitäten folgende ‚New Penology’ zu verstehen, sondern als eine relative Stärkung mehr oder weniger ausgeprägter risiko-managerieller Aspekte des strafjustizellen Komplexes. Diese Stärkung zeigt sich auch mit Blick auf die normative bzw. moralische Struktur der pönalen Logiken. Da Normativität - und darüber vermittelt Fragen der Ethik - ein unsupendierbares Moment der Konstitution von und des Umgangs mit Abweichung darstellt, ist ein Blick auf den ‚strafmoralischen’ Gehalt des Risiko-Managerialismus alleine deshalb notwendig, weil sich seine Adaptation nicht nur auf die ‚technische’ sondern auch auf die ‚moralische’ Qualität des Strafkomplexes auswirkt. Die risiko-manageriellen Strategien werden häufig als ein ‚kühler’, technischer, auf statistischen Kalkülen basierender Prozess interpretiert, der auf die ‚unproduktiven’ Fragen der Moral weitgehend verzichtet (vgl. O’ Malley 1999, Garland 1999, 2001, Lindenberg/Schmidt-Semisch 1995). Diese Interpretation ist jedoch – selbst mit Blick auf eine idealtypische ‚Reinform’ der ‚New Penology’ - kaum überzeugend. Von einer Ent-Moralisierung kann nur gesprochen werden, wenn klassisch liberale oder republikanische Ethikformen - basierend auf deontologischen Moraltheorien des kantianischen Typs oder Ethiken des aristotelischen Typs - als Maßstab herangezogen werden (vgl. Brumlik 1992: 242). Den risiko-manageriellen Ansätzen korrespondiert demgegenüber eine andere Form der Ethik: Ein konsequentialistischer Utilitarismus. Ethiken eines konsequentialistisch-utilitaristischen Typs sind keinesfalls per se weniger ‚moralisch’, aber sie weisen eine zentrale moraltheoretische ‚Blindstelle’ auf, die mit dem Gerechtigkeitspostulat des Rechts auf gleiche Rücksicht und Achtung aller (vgl. Dworkin 1984, Rawls 1971) unvereinbar ist. Sie unterscheiden sich nämlich von den anderen Ethikformen dadurch, dass sie „über kein vernünftiges Kriterium [verfügen], das individuelles Leiden - auch einer erheblichen Anzahl von Menschen - verbietet, sofern es einer noch größeren Anzahl zuträglich ist und somit den Gesamtnutzen einer gegebenen Population hebt“ (Brumlik 1992: 242, vgl. Koller 2001). So sind Opfer eine vergleichsweise große - in fortgeschritten liberalen ‚Beute-’ (vgl. Karstedt 1999a) oder ‚Hochkriminalitäts-Gesellschaften’ (vgl. Garland 2001), potentiell jeden Bürger umfassende - 465 Gruppe (vgl. Stanko 2000). Allen Mitgliedern dieser großen Gruppe kann geholfen werden, wenn eine kleine, besonders in intensiv abweichende Gruppe von Tätern ‚leidet’. In diesen Kontext ist die implizite Moral eines risikokalkulationsbasierter Managerialismus einzuordnen. In seinem Moralsystem geht es weder um jede Tugenden, die etwa im Sinne (neo-)aristotelischer Ethiken, die bei den ‚untugendhaften’ Abweichlern zu erzeugen wären, noch geht es um Verbesserungen ihres moralischen Urteils(vermögens) (vgl. Sutter et al. 1999) wie es deontischen Ethiken des kantianischen Typs nahe legen. Das Moralsystem des risikokalkulierenden Managerialismus folgt einer konsequentialistisch-utilitaristischen Ethik. Dies ist sowohl die Moral des Neo-Liberalismus - mit seiner impliziten Anthropologie vom Einzelnen als optimalem Nutzenmaximierer - als auch der ‚New Penology’ und es ist im Kern auch die Moral der ‚Défense Sociale’. Das von Beobachtern des Strafkomplexes international festgestellte verstärkte Aufkommen einer utilitaristischen Form der ‚Strafmoral’ (vgl. Morris 1998) ‚passt’ zwar zu der ‚Ethik’ der ‚actuarial justice’ der ‚New Penology’, aber dies muss keinesfalls bedeuten, dass diese Strafmoral dazu geführt hätte, dass ‚sozialarbeiterische’ und ‚rehabilitative’ (Trainings-)Programme aus den Gefängnissen verschwunden wären oder im Verschwinden begriffen sind. Steller et al. (1994) sprechen sogar von einer ‚Revitalisierung’ der Straftäterbehandlung. Vor allem die europäische Variante der ‚neuen Pönlogie’ greift weiterhin auf die Techniken der Experten des fordistischen ‚Staf-Wohlfahrtskomplexes’ zurück, wobei sich allerdings auf der Ebene der Logiken und Rationalitäten Verschiebungen finden, die sich eher als eine durch managerialistische Elemente und fortgeschritten liberale ‚Subjektrepräsentationen’ (vgl. Kemshall/Maguire 2001) erweiterte Neuauflage des ‚Défense Sociale’ Konzepts beschreiben lassen: „Die Frage, ob Behandlung im Strafvollzug möglich und sinnvoll ist“, so führen etwa Rehn und Wischka (2001: V) implizit einem Kerngedanken der Défense Sociale folgend aus, „ist nicht mehr aktuell. Es geht um die Frage, wie bei wem Behandlung einsetzen muss […und es geht darum] den Erfolg von Behandlungsmaßnahmen abzuschätzen und taugliche Behandlungskonzepte zu entwickeln“. In einer solchen ‚revitalisierten’ Fassung rehabilitativer Straftäterbehandlung werden die ‚versicherungskalkulatorischen’ Strategien und Prognosen um Momente einer ‚klinischen Prognose’ ergänzt, bei der es um tatbezogene Aspekte ebenso geht wie um Fragen der Persönlichkeit, „des Verhaltens während der Unterbringung und der Perspektive nach der Entlassung“ (Nowara 2001: 105). Vor allem Hannah-Moffat (2002: 1) hebt einen zentralen Unterschied zwischen einer versicherungskalkulatorischen Form der Strafjustiz und einer fortgeschritten liberalen Form der Revitalisierung von Behandlungsprogrammen hervor: Während die ‚actuarial justice’ auf eine Strategie der ‚reinen’ Verwahrung auf der Basis unterschiedlicher Risikograde verweist, schiebt sich im Kontext einer fortgeschritten liberalen Form der Behandlung eine Strategie in den Mittelpunkt, die sie als ‚Governing Through Need’ bezeichnet. In dieser Strategie geht es um die Etablierung jener spezifischen Handlungsprogramme, die je auf spezifische Gefangenenpopulationen abgestimmt sind und für die auch im bundesdeutschen Strafvollzug eine drastisch gestiegene Nachfrage konstatiert wird (vgl. Dünkel/Drenkhan 2001: 404f). Bei diesen Handlungsprogrammen stehen vor allem die 466 verhaltenstherapeutischen Maßnahmen - insbesondere kognitiv-behaviouristische Anätze - im Vordergrund (vgl. auch MacKenzie 1997, Schneider 2001, mit Blick auf die Soziale Arbeit: Robinson 2002). Im Wesentlichen stellen diese Programme ‚Rückfallverhütungstrainings’ dar (vgl. Schneider 2001: 380). Dünkel und Drenkhan (2001: 398, vgl. MacKenzie 1997, Robinson 2001) fassen die wesentlich „Prinzipien erfolgreicher Behandlungsstrategien“, dieser Programme wie folgt zusammen: „risk classification: Risikoeinschätzung und Intervention entsprechend unterschiedlicher Risikogruppen […] targeting criminogenic needs: Orientierung an direkt die Straftatbegehung begünstigenden Faktoren […sowie] responsivity: Ansprechbarkeit [und Bereitschaft] der Straftäter“ Diese Behandlungskonzepte unterscheiden sich erheblich von der Resozialisierungs- bzw. ErziehungsRationalität im Straf-Wohlfahrtskomplexes, die weniger nur auf die Reduzierung künftiger abweichender Akte, sondern vor allem auf eine allgemeiner formulierte normalisierende Assimilierung von ‚andersartiger’ Akteure gezielt hatte (vgl. Young 1999a). Die aktuellen Behandlungs- bzw. Trainingsprogramme haben sich demgegenüber genau umgekehrt „die Verhaltenskontrolle, nicht aber die Heilung der abnormen Persönlichkeit [sic!] des Täters zum Ziel gesetzt“ (Schneider 2001: 379). Sie stellen Behandlungsprogramme dar, die selbst als Ausdruck einer Kriminalpolitik betrachtet werden können, die sich von einem strafmodernistischen Resozialisierungsideal ab- „und den SicherheitsInteressen der Gesellschaft zu[wendet]“ (Schneider 2001: 379, vgl. Bernhardt 1999, Böhm 2002, Jehle 2003). Ihre Besonderheit besteht im wesentlichen darin, dass eine hybride, strategische Verbindung von einer Identifizierung von Risikofaktoren und einer Identifizierung von eng definierten und vor allem Interventionen zugänglichen Bedürfnissen, so genannten ‚intervenable needs’ (HannahMoffat 2002), verweisen90. Eine solche Ausrichtung von Behandlungskonzepten stellt keine ‚Beibehaltung’ bzw. ‚Wiedereinführung’ des fordistischen Wohlfahrtssubjekts im Strafvollzug dar. Ihre Basis ist vielmehr die Repräsentation ihrer Adressaten als ein „transformative risk subject, who unlike ‚fixed or statistic risk subjects’ [of the ‚new penology’] is amenable to targeted therapeutic interventions“ (Hannah-Moffat 2002: 1). Diede Repräsentation des ‚Kriminellen’ als transformierbares Risikosubjekt stellt die ‚passende’ ‚Subjektivierungsweise’ für eine modifizierte Behandlungsrationalität dar, die sich als eine managerialistische ‚Wiederentdeckung’ Défense Sociale Idee (vgl. Ancel 1956, Gramatica 1965, Pasquino 1991) analysieren lässt. Während die Gemeinsamkeit der Défense Sociale und der ‚new penology’ darin besteht dem Schutz der Gesellschaft die höchste Priorität einzuräumen (vgl. Garland 2000: 350), wird im Gegensatz zur ‚actuarial justice’ durch das Sozialverteidigungskonzept ein Bezug auf den einzelnen Täter gerade nicht aus der Bestrafungslogik hinaus eskamotiert. Im Gegenteil: Für das Défense Sociale Konzept ist der Bezug auf den individuellen Täter von besonderer Bedeutung. Die auf diesem Konzept basierenden Interventionen tragen dabei deutlichen Züge dessen, was Strasser (1984) als ‚therapeutische Kriminologie’ rekonstruiert. Allerdings unterscheidet sich die mit der Défense Sociale implizierte Form der Behandlung und Rehabilitation in wesentlichen Punkten von der Logik des StrafWohlfahrtskomplexes. Von besonderer Bedeutung ist zunächst, dass auch in Bezug auf die Eine solche Verbindung stellt eine ‚versicherungskalkulatorische’ Repräsentation des Gefangenen keinesfalls grundsätzlich in Frage, sondern stellt Re-Modifizierung dieser Repräsentation dar. 90 467 Rehabilitation selbst, der Schutz der Gesellschaft im Vordergrund steht. Dieser Gesellschaftsschutz soll durch Behandlung und/oder die Neutralisierung von Tätern geschehen, wobei die Reaktionen nicht auf fixierten Strafen basieren, sondern auf einer ‚Individualisierung der Bestrafung’ bzw. einer zum Täter passenden Formen der Behandlung (vgl. Walters 2001, Pratt 1997). Die Idee des ‚Défense sociale’ ist zunächst keinesfalls neu. Im Gegensatz zu den USA und Großbritannien (vgl. Hudson 1993) gewinnt die Idee der Sozialverteidigung vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg in Lateinamerika und in Ost- wie Westeuropa - vor allem Italien, Frankreich, Belgien und Deutschland - an Einfluss. Vor allem die Strafgesetzbücher der Sowjetunion und Kubas orientieren sich eng an den Prinzipien der Sozialverteidigung (vgl. Groenemeyer 2001) aber auch die traditionelle Kopplung von Gesellschaftsschutz und Verbesserung des Täters im bundesdeutschen (Erwachsenen)Strafrecht trägt zumindest implizite Züge dieser Idee. In diesem Sinne gehört in der Bundesrepublik91 die ‚Défense Sociale’ bereits im fordistischen Straf-Wohlfahrtskomplex zur Hintergrundgrammatik der Strafrationalität. Die Sozialverteidigung mit ihrer inhärenten Täter- und Behandlungsorientierung aber auch mit ihrem ‚humanistischen’ Ziel einer ‚Verbesserung des Menschen’ (vgl. Ancel 1956) lässt sich zwar in die Tradition sozialhygienischer Ansätze einordnen (vgl. Radzinowicz 1999), steht aber damit in einem offensichtlichen Gegensatz zur ‚actuarial justice’. Nichtsdestoweniger weißt die radikale Variante der Défense Sociale, wie sie vor allem von Filippo Gramatica (1965) vertreten wird, in wesentlichen Bereichen Korrespondenzen zu den versicherungskalkulatorischen Strategien der Strafjustiz auf. Zu den Gemeinsamkeiten gehört neben der primäre Betonung des Schutzes und der Sicherheit der Gesellschaft vor allem die Forderung nach einer Differenzierung von Risikogruppen, die je nach - künftiger - Gefährlichkeit und Risikopersistenz in ‚Wiederanpassungshäusern’ verschieden lange ‚untergebracht’ werden sollen. Eine weitere Gemeinsamkeit mit der ‚actuarial justice’ ist ein radikales Absehen von ‚moralischen’ Kategorien des Unrechts, im Sinne eines Fokus auf die in der Vergangenheit erfolgte Schuld und deren Vergeltung. Die Zurückweisung eines Schuld-Sühne-Nexus erfolgt zugunsten einer im wesentlichen ‚technischen’ Fragen nach der Angemessenheit von Interventionen zur Minimierung künftiger Schädigungen. Vergleichbar mit der ‚neuen Pönologie’ im Sinne von Feeley und Simon soll die Länge und Intensität der Interventionen nicht von der ‚Schuld’ des Täters abhängig sein. Im Mittelpunkt steht alleine der Aspekt „der sozialen Gefährlichkeit des Täters vor der die Gesellschaft und deren Mitglieder zu schützen sind“ (Kerner 1991: 311). Statt auf jede Straftat eine Strafe folgen zu lassen, spricht sich Gramatica (1965: 22) für differenzielle Maßnahmen aus, die je auf die (Risiko-)Charakteristika des individuellen Akteurs zugeschnitten sind: „Die Anpassung muss verstanden werden in ihrer breitesten Konzeption: Der Kranke muss geheilt werden; der Unwissende oder Unangepasste muss zum Leben in der Gesellschaft erzogen werden, weil in ihm das egoistische Bedürfnis über die Einschränkungen des Gesetzes obsiegt; der Halsstarrige muss aus der Gesellschaft herausgenommen werden, immer jedoch nur um die Gesellschaft zu schützen“. 91 Ganz explizit gilt dies auch für Frankreich in dem seit dem 19. Jahrhundert aber insbesondere seit Mitte der 20. Jahrhunderts zunächst die Resozialisierung des Täters sowie die Einführung unterschiedlicher Sanktionsarten als ‚Individualisation de la Peine’ wesentlich durch die Bewegung der Défense Sociale Nouvelle vorangetrieben wurde (vgl. Ottenhof 2001). 468 Vor dem Hintergrund des formulierten Ziels geht es nur um die sinnvollste Technik. Es dürfe, so Gramatica an gleicher Stelle „niemals“ der Zweck strafjustizieller Interventionen sein, dem Täter „Übel zuzufügen“. Eine Reihe der Vorschläge des Sicherheitsberichts der Bundesregierung zu Fragen der Jugendkriminalität entsprechen dieser Vorstellung nahezu wörtlich92. So wird etwa ein „gezieltes und auf die Individualität des jeweiligen Täters zugeschnittenes Vorgehen“ gefordert und es wird betont dass „in geeigneten Fällen […] auch erzieherische Maßnahmen außerhalb des förmlichen Verfahrens als angemessene Reaktion genügen“, da sich diese im „Hinblick auf die Rückfallvermeidung […] nicht als weniger effektiv erwiesen [hätten] und […] dabei auch kostengünstiger“ zu gestalten seien. Diese Überlegungen werden - und genau diese Kontextuierung entspricht der Logik der Défense Sociale durch die von der bisherigen ‚Philosophie’ des ‚spezialpräventiven’ JGG deutlich abweichende Feststellung gerahmt, „dass es auch jugendliche und heranwachsende Straftäter gibt, die gefährlich sind und vor denen die Allgemeinheit geschützt werden muss“ (BMI/BMJ 2001: 60). Eine diskursive Kontextuierung hat auch durchaus Einzug in die Jurisdiktion erhalten. Nach dem 1998 novellierten § 57 StGB werden etwa Reststrafen generell nur noch dann zur Bewährung ausgesetzt, wenn dies dem ‚Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit’ nicht zuwiderläuft. Mit dieser Formel, so kommentiert der Sicherheitsbericht der Bundesregierung (2001: 434), wolle „der Gesetzgeber deutlicher als mit der vorherigen Formel den hinter dieser Risikoprognose stehenden Gedanken hervorheben, dass Belange der öffentlichen Sicherheit, insbesondere des Opferschutzes, gegenüber den wohl verstandenen objektiven Interessen des Gefangenen auf Resozialisierung abgewogen werden müssen. Eine ‚Verantwortbarkeit’ ist stets bereits dann zu verneinen, wenn substanzielle Zweifel am Ausschluss der Gefahr schwerer neuer Straftaten nicht ausgeräumt werden können.“ Im Falle einer Jugendstrafe, so wird mit Blick auf Jugendliche und Heranwachsende präzisiert, stellt „die Prognoseformel ausdrücklich auf den Stand der Persönlichkeitsentwicklung ab“.Gleichwohl wird auch hier der Strafrecht nur noch ausgesetzt, wenn dies, gemäß der Neufassung des JGG (§ 88 Abs. 1), „unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit, verantwortet werden kann“ (BMI/BMJ 2001: 434). Trotz dieser expliziten Verlagerung der Gewichte hin zur Sicherheit und dem Schutz der Allgemeinheit bzw. des potentiellen ‚Opfers’, werden - auch dies entspricht der Idee der Sozialverteidigung - die Fragen von Risikokalkulation und individualisierte Behandlungsmaßnahmen nicht getrennt sondern ausdrücklich zusammen verhandelt: „Resozialisierung und Sicherheit“, so der generelle Grundtenor des Sicherheitsberichts seinen „keine Gegensätze, sondern einander ergänzende Perspektiven eines modernen Behandlungsvollzugs“ (BMI/BMJ 2001: 431, Herv. H.Z.). Dabei unterscheidet sich Fokus der Resozialisierungsrationalität von dem rehabilitativen Ideal des Straf-Wohlfahrtskomplexes durch eine ‚risikokalkulatorische’ Referenz auf die Schwere, Frequenz und Intensität des abweichenden Verhaltens, statt einer Konzentration auf eine andersartige positional-dispositionale Matrix der Akteure als dem vorgängigen ‚eigentlichem’ Problem, deren sichtbares Symptom (unter anderem) Straftaten 92 Der Rekurs auf dieses Konzept geschieht keinesfalls nur implizit. In der Begründung ihres „Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes der Menschenwürde“ (vom 01.12.2000) hat sich beispielsweise die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns – mit explizitem Bezug auf Jugendliche und Heranwachsende – expressiv verbis auf die Défense Sociale bezogen. 469 sind. Mit Blick auf den Bestrafungsdiskurs in der Bundesrepublik lässt sich die These vertreten, dass risikokalkulatorische Bezug an Bedeutung gewinnt, während ein Bezug auf die allgemeinere positionaldispositionale Matrix der Akteure als Bearbeitungsgrundlage und Legitimation der Resozialisierung an Bedeutung verliert. Die zunächst auch als Versuch Humanisierung ‚irrationaler’ Strafen konzipierten (vgl. Ancel 1956) Prämissen der Défense Sociale vertragen sich ebenso sehr mit managerialistischen Grundsätzen, wie sie hinsichtlich dem Schutz der Gemeinschaft - ihrem zentrales Ziel - mit dem neo-sozialen Diskursstrang fortgeschritten liberaler Rationalitäten kompatibel sind: dem Kommunitarismus. Die „schützende und strafende Hand des Staates“, so fordert etwa Amitai Etzioni (1998: 224 f) in deutlicher, wenngleich unausgewiesener Übereinstimmung mit Filippo Gramatica, soll dann zum Einsatz kommen, wenn es darum geht, die Gemeinschaft vor dem „harten Kern von Psychopathen und Kriminellen“ zu schützen, „den auch die engagiertesten Eltern, die besten Schulen und fürsorglichsten Nachbarn nicht erreichen können“. Während auch in den pönologischen Entwicklungen in der Bundesrepublik durchaus ‚versicherungskalkulatorische’ und entsprechend ‚resozialisierungsfeindliche’ Tendenzen vorzufinden sind (vgl. Sack 1995, 2003, Nicolai/Reindl 2001, Jehle 2003) deutet alles darauf hin, dass die deutsche Form eines Strafmanagerialismus weniger als eine gemäßigte Adaptation der ‚new penology’ zu interpretieren ist, sondern versicherungskalkulatorisch als wie eine durch kommunitär ‚fortgeschritten beeinflusste liberale’ Elemente Logiken, erweiterte Form bzw. der Sozialverteidigung93. IV. 3.3 NEO-REALISTISCHE REHABILITATIONSRATIONALITÄTEN Eine solche Interpretation vermag es zu erklären, warum im Gegensatz zu den Ausführungen von Feeley und Simon von einem Abschmelzen der Relevanz ganz zu Schweigen von einem Verschwinden der sozialen und vor allem der ‚Psy’-Disziplinen und ihrer Technologien zumindest für die deutschen Strafanstalten keine Rede sein kann. Im Gegenteil: Im Sinne von auf die ‚sichtbare’ Oberfläche von Fehlverhalten konzentrierten Programmen des Antrainieren sozial erwünschter Handlungsweisen und des Abtrainieren von sexueller, verbaler und körperlicher Aggressivität, Drogenabhängigkeit und anderer ‚antisozialen Tendenzen‘ (vgl. Böhnisch 1999, Brand/Saasmann 1999, DJI 1998, Hansen/Römhild 1998, Weidner et al. 1997), ebenso wie im Sinne von ‚kognitiv-behavioralen’ bzw. ‚sozialkognitiven Einzeltrainings’, die möglichst effektiv und zielgerichtet auf spezifische Kombinationen identifizierbarer individueller - d.h. nicht auf gesellschaftliche Bedingungen bezogener - Risikofaktoren und Bedürfnisse zielen haben rehabilitative Programme seit Mitte der 1990er Jahre eine erstaunliche Dennoch kann nicht davon gesprochen werden, dass sich dieses Konzept in einer ‚Reinform’ durchgesetzt hätte. So kann entgegen den Prämissen der ‚Défense Sociale’-Idee - aber auch entgegen dem Konzept der ‚actuarial justice’ - nicht davon gesprochen werden, dass die symbolische Demonstrationsfunktion der Strafe als abgenommen hätte. 93 470 Konjunktur94 (vgl. Körner et al. 2002, Müller-Isberner/Gretenkord 2002, Nuhn-Naber et al. 2002, Pfaff 2001, Schneider 2001). Die unübersehbare Verbreitung dieser Strategien, die sich in der Regel auf einer psychologischen Ebene aus neueren Varianten der Lerntheorie (vgl. Bandura 1986) und auf einer kriminologischen Ebene aus den Perspektiven im Umfeld der ‚right realists’ (vgl. Wilson/Hernstein 1985, Gottfredson/Hirschi 1990) speisen, kann als deutlicher Hinweis für die Durchsetzung einer ‚fortgeschritten liberalen Agenda’ von ‚responsibilisierend rehabilitativen Strategien’ im Strafvollzug verstanden werden(vgl. Hannah-Moffat 2001: 4). Diese Formen rehabilitativer Strategien sind insofern ‚responsibilisierend’, wie sie im Gegensatz zur Resozialisierungslogik des Straf-Wohlfahrtskomplexes kein individual- oder sozialpathologisches Modell präsuppositionieren, dass die individuelle Verantwortung und damit die Schuld des Einzelnen relativiert: „Vielmehr muss der Strafgefangene für seine Tat verantwortlich gemacht werden, damit das kognitive Verhaltenstraining überhaupt seine Wirkungen zu entfalten vermag“ (Schneider 2001: 379, vgl. Hedderman/Sugg 1997, MacKenzie 1997). Die responsibilisierend-rehabilitativen Strategien finden sich nicht nur verstärkt in den Jugendgefängnissen und den Interventionen der justiznahen sozialen Dienste, sondern auch in den Erbringungen von Hilfen zur Erziehung in der ‚allgemeinen’ Jugendhilfe95. Als eine an die Interventionen sozialer Dienste anschlussfähige Neuauflage einer punitiven Täterorientierung (vgl. Krasmann 2000b) sind sie unter anderem Ausdruck einer ‚neo-realistischen’ Form der Jugendhilfe, die eine Notwendigkeit eines ‚Behandelns unter Zwang“ (Sozialmagazin 1997, vgl. JMK 2000) wiederentdeckt hat. Bemerkenswerterweise werden innerhalb des neo-realistischen Appells an die Notwendigkeit des Zwangs Elemente aufgegriffen, die ursprünglich gerade von entschiedenen ‚republikanischen’ und ‚abolitionistischen’ Kritikern96 expertokratischer Zwangsanwendung hervorgebracht worden sind. Allerdings sind die dabei adaptierten Elemente dessen, was diese Kritiker des Strafrechts an dessen Stelle setzen wollten, zu einem zusätzlichen Teil der Behandlungsstrategie von Experten im Stravollzug selbst geworden. Dies gilt etwa für einen Fokus auf die interpersonale Schädigung und Fragen der Gemeinschaft und nicht auf den abstrakten Rechtsbruch, für die Konfrontation mit der Opferperspektive, für die Zuweisung persönlicher Verantwortung (vgl. Schneider 2001) und schließlich für eine gezielte Moralisierung und ‚Beschämung’ (so etwa Winkler 1999, Schanzenbächer 2001, von Wolffersdorff 2000). All dies sind - in der Regel sozialpädagogisch vollzogene - Antworten auf abweichende Verhaltensweisen, die in einem scharfen Kontrast zur professionalisierten, In diesen Trainings geht u.a. darum, dass Verhalten eingeübt und vor allem auf Kontrolle, Rückmeldung und Verstärkung wert gelegt. Normen und Regeln werde aufgestellt, in bestimmten Phasen in einer Weise besprochen und geklärt, dass der betroffen Akteur einsieht, dass nicht nur die Konformität sondern das aktive und verantwortliche Mittragen für ihn Vorteilhaft ist und vor allem werden sie mit verschiedenen Formen der Belohnungen und Bestrafung durchgesetzt 95 Dort erfolgen sie ebenso im Sinne eines Hilfeangebot nach dem SGB VIII wie als Form der Sanktion nach dem JGG. 96 Diese ‚adaptierten’ Kritiker sind in erster Linie Vertreter einer ‚restorative justice’ wie Howard Zehr (1990) und besonders John Braithwaite (1989, 2000) - mit seiner ‚republikanischen’ Theorie einer ‚reintegrativen Beschämung’ - sowie die Vertreter der nordeuropäischen Formen des Abolitionismus, wie etwa Willem de Haan (1990) und Niels Christie (1977). (Zur Korrespondenz zwischen Braithwaites’ ‚republikanischer’ Straftheorie und dem skandinavischen Abolitionismus siehe Hughes 1998) 94 471 individualisierenden und tendenziell ‚entmoralisierenden’ Sozialtechnologie des Straf- Wohlfahrtskomplexes stehen (vgl. Groenemeyer 2001, Garland 2001, Stenson 2001). Durch die Implementierungen dieser als Alternativen zur Strafe, Exklusion und unilinearer Herrschaftsausübung durch Experten gedachten Konzepte (vgl. Sullivan et al. 1998), in die ‚real existierende’ Strafvollzugvollzugslogik geht nicht nur deren strafrechtskritischer und ‚anti-repressiver’ Impetus verloren sondern Extraktion einiger Elemente dieser Alternativen zur staatlichen Strafe hat sich als ebenso passend wie nützlich für den dominanten Strafrechtsdiskurs erwiesen97. Demgegenüber bleibt das, was Kritiker diesen Alternativen vorwerfen in potenzierter Form enthalten. Die gilt insbesondere bezüglich einer moralisierenden Rückkehr zu vormodernen Kontrollformen, die sich auf nicht strafrelevante Momente ausweiten (vgl. Albrecht 1995, Brumlik 1993, Karstedt 1996), der Abstraktion von den sozialen Bedingungen und Zwängen denen Abweichler unterworfen sind, der privatisierenden Verkürzung von Abweichung auf einen gruppenbezogenen bzw. – wie im Falle bestimmter Formen des Täter-Opfer-Ausgleichs – auf einen Zwei-Personen-Konflikt einhergehend mit der Repräsentation des einzelnen Akteurs als autonomes rationales Individuum, das frei seine moralischen (Fehl)Entscheidungen trifft (vgl. Bröckling 2002). Im Zusammenhand dieser, so selektiv wie oberflächlich an die Forderungen kritischer Strafrechtsreformer anschließenden Entwicklung hat die ‚alte Lehrmeinung’ einer sozialpolitisch aufgeklärten Sozialen Arbeit, nach der Zwang und Repression die Unterdrückung der deprivierter Gruppen noch zusätzlich fortsetze, sukzessive ihren für die Professionellen habitusgenerierenden Charakter verloren. An ihre Stelle rückt eine ‚neue Entschiedenheit’ (vgl. Wendt 1997), die sich unter anderem aus der These speist, dass die „verhinderten Revolutionäre im Staatsdienst“ (Rensmann 1999: 190) mit ihrer Betonung gesellschaftlicher Ursachen gescheitert seien. An ihrer Stelle bildet sich ein neuer Common sense heraus, nachdem eine system- und kapitalismuskritische Haltung ebenso wie die ‚Trivialisierung von Verbrechen‘ und die larmoyante ‚Ideologisierung der Justiz‘ ein gewaltiger Irrweg war (vgl. Klug 2000), dem mit einem konsequenten „Eingreifen statt Lamentieren“98 (Lamnek 2000: 261, vgl. Scholz 1998) und einer ‚Kundenorientierung‘ nach Maßgabe von Effizienz- und Effektivitätskriterien zu begegnen sei (kritisch: Cremer-Schäfer 1998). „Die Zeiten träumerischer, völlig zwangfreier und einer nur auf Selbstbestimmung setzenden Pädagogik“, so der Bundesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe (VPK 2003: 36) in einer Stellungnahme zur geschlossenen Unterbringung in der Jugendhilfe, „waren lange in Mode [sic!], sind aber vorbei: Charisma, Glaubwürdigkeit und Persönlichkeit von Erzieherinnen und Erziehern und Pädagoginnen und Pädagogen muss wieder ein deutlich größeres Augenmerk im Rahmen von Ausund Fortbildungen wie auch bei der Auswahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendhilfe geschenkt werden, da gelingende Erziehung eben mehr als nur technische Fertigkeiten und Fähigkeiten voraussetzt. Praktiker in Betrachtet man diesen Diskurs als strukturierende Hintergrundgrammatik, so kann es nicht überraschen, dass beispielsweise Elemente, die sich bei Niels Christie finden - dessen Modell Schmidt-Semisch (2002: 119) mit einigem Recht als „partizipatorische Variante der Défense Sociale mit neoklassischem Rest“ charakterisiert - auch in den derzeit an Dominanz gewinnenden Strategien und Techniken des Strafvollzugs anzutreffen sind. Nur sind sie dann eben kein Teil einer ‚partizipatrorischen Variante’ sondern, einer fortgeschritten liberalen, manageriellen Form der ‚Défense sociale’ mit repressivem Rest. 98 Eine solche Umorientierung reicht bis in die Reihen der traditionell strafrechtkritischen DVJJ, deren Sprecher es sich nicht nehmen lässt - in einer Expertenrunde der CDU/CSU Bundestagfraktion - „eine nicht abwartende, sondern - im wohlverstandenen Sinne - zupackende Jugendhilfe“ (Scholz 1998) einzufordern 97 472 der Jugendhilfe benötigen die Sicherheit und Souveränität, dass sie das Recht und Pflicht haben, deutlich und energisch bei Normverstößen von Kindern und Jugendlichen zu reagieren und zu intervenieren“. Der neue „nicht abwartende, sondern - im wohlverstandenen Sinne - zupackende“ (Scholz 1998) Charakter der Jugendhilfe besteht dann etwa darin die ‚Neutralisierungstechniken‘99 der Jugendlichen als ‚Tatlegenden‘, Ablehnung von Verantwortung und ‚verharmlosende Statements‘100 nicht auch noch durch ihr - zur Ideologie mutiertes - ‚Verständnis‘ zu fördern, sondern diese ‚gezielt aufzubrechen’ und die Jugendlichen mit der ‚Beschämung erzeugenden’ ‚Wahrheit‘ zu konfrontieren (vgl. u.a. Weidner 2001, Pilz 2001, Bannenberg/Rössner 2002, Schanzenbächer 2001, Redl 1987, Prim 1999). Die Interventionen der Sozialen Dienste sollen entsprechend dazu dienen die Jugendlichen zu bewegen „die Leugnung ihrer Tat aufgeben und Verantwortung für sie übernehmen“ (Schneider 2001: 281, vgl. Prisma 2001) und die Professionellen sind aufgefordert „auch hart sein [zu] können“, die „Diskreditierung“ von Praktiken „aktiver Konfrontation, bestimmtem Auftreten, Durchsetzung von Maßregeln, Ausüben von Macht“ aufzugeben und den „Typus des weichen Mitleiders, dessen Sicht teils durch Fürsorglichkeit, teils durch ideologische Vorurteile getrübt ist“ zugunsten einer „neuen Entschiedenheit“ und strikter Verbindlichkeit „[g]egenüber der Härte der Fakten“ zu überwinden (Wendt 1997: 14f). Dieser Fokus ist nicht nur im wissenschaftlichen Diskurs festzustellen, sondern auch überaus Praxisrelevant. Wird etwa in einer aktuellen Studie von Stelly und Thomas (2002: 11) explizit darauf hingewiesen dass inzwischen „Jugendgerichtshelfer wie auch Bewährungshelfer […] sehr großen Wert darauf legen Rationalisierungen im Sinne der Verantwortungsabwälzung aufzubrechen“. Sofern es tatsächlich ein signifikantes Unterscheidungsmerkmal der Soziale Arbeit von anderen Instanzen sozialer Kontrolle war, dass sie – sei es aufgrund ihr Professionalisierungsinteressen oder aufgrund der Moral ihrer Professionellen – versucht „mit einem Minimum an Repressivität auszukommen […und] im Einvernehmen mit ihren Adressatinnen und Adressaten [zu] handeln“ (Peters 2002: 179) und es dabei nicht nur ablehnt als Zwangs- oder Strafmaßnahme verstanden zu werden, sondern auch aktiv versucht staatliche Zwangsmaßnahmen zu hinterfragen (vgl. VBSA o.J.), so hat dieses Unterscheidungsmerkmal deutlich an Signifikanz verloren, während sich die Forderung danach ‚Grenzen zu setzen’ ‚Entschiedenheit’ oder ‚Konsequenzen zu zeigen’ ebenso wie überwunden Im Sinne von Sykes/Matza (1968) sind ‚Neutralisierungstechniken’ gerade ein Beleg dafür, das Straffällige das gängige Wertesystem durchaus internalisiert haben 100 Das Kardinalproblem beim ‚Durchbrechen’ von Neutralisierungstechniken ist, dass moralisch ‚normale’ Personen üblicherweise durch ‚Rechtfertigung’, ‚Entschuldigung’ oder ‚Abstreitung’ auf Beschämungen reagieren (vgl. Borg 2000). Neutralisierungstechniken sind insofern ‚normal’ und überaus sinnvoll: „[D]elinquents often voice a sense of guilt and/or shame about their actions [and] frequently convey respect for law-abiding citizens […]. Delinquents are not immune to the demands of the dominant social order; are not delinquent all of the time and do not necessarily conceive of themselves as criminals. Because they are intimately connected to a normative value system that is flexible and provides ‘qualified guides for action’ delinquents can develop a set of techniques or rationalizations to neutralize and temporally suspend commitment to these values […] to retain their self esteem and non-criminal self-image” (McLaughlin 2001: 186). Das Problem liegt also weniger darin, dass abweichende Jugendliche ‚Neutralisierungstechniken’ benutzen. Problematisch ist eher, wenn sie, wie Jack Katz (1987) scharfsinnig und materialreich aufzeigt, Neutralisierungen nicht verwenden, weil sie die Normen und Werte, deren Bruch sie in ein moralisches Dilemma in ihrer Selbstrepräsentation führen könnte, wenn sie sie inkorporiert hätten, schlicht nicht akzeptieren. Auch rein funktionalistisch betrachtet ist dass ‚Durchbrechen von Neutralisierungstechniken’ – was pointiert heißt dem Jugendlichen aufzuzeigen was für ein ‚Schwein’ er ‚in Wirklichkeit’ ist und ihm zugleich die Möglichkeiten zur ‚Verteidigung’ seines ‚moralischen Selbst’ zu entziehen – nicht unbedingt die Klügste aller Strategien. 99 473 geglaubte Elemente wie offener Druck und Abschreckung auch in der Sozialen Arbeit selbst einer außerordentlichen Konjunktur erfreuen (vgl. Dahme/Wohlfahrt 2001, Drewniak et al. 1997). Nickolai und Reindl (1999) sprechen von einer ‚Renaissance des Zwangs’, der zumindest von einigen Vertretern der Sozialen Arbeit auch als immanenter Teil der Sozialen Arbeit konstatiert (vgl. Böhnisch 1999) oder gar expressis verbis eingefordert wird101 (vgl. Sozialmagazin 1/1997). Demgegenüber wird der ‚traditionellen’, ‚verständnisvollen’ Arbeit Naivität unterstellt, die im Kern auf einem „unprofessionelle[n] Deal“ (Weidner 1997b: 18) beruhen würde: „Vertauen zum aggressiven Jugendlichen zum Preis einer freundlichen Weichspülerbehandlung, die die kritischen Tat- und Opferfragen ausklammert. Im Umgang mit aggressiven Jugendlichen ist dies eindeutig der falsche Weg“ (Weidner 1997b: 18). Die neuen ‚richtigen‘ erzieherischen, therapierenden und disziplinierenden Maßnahmen sollen sich demgegenüber dadurch auszeichnen, dass sie die Perspektive der Opfer und sie Sicherheitsinteressen der Bevölkerung ebenso so ernst wie die persönliche Verantwortung – d.h. die Schuld - der Täter. Interventionslogisch lässt sich zugleich davon sprechen, dass sie weniger ‚resozialisierend’ in dem Sinne sind, dass sie auf eine soziale Gestaltung und Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe (nach einem temporären Ausschluss) gerichtet sind als ‚rehabilitierend’, in dem Sinne, dass sie darauf zielen ein isoliertes Individuum durch kognitiv-behavioristische Maßnahmen mit positiven und negativen Verstärkern zum ‚pädagogischen’ Ziel Legalbewährung zu konditionieren sowie die richtigen und rationalen Formen der Lebensführung, der Perspektiven und der Haltung zu sich selbst und anderen in den Einzelnen ‚einzumassieren‘ (vgl. Weidner 2000). Der Täter soll Verantwortung für sein Handeln übernehmen und dazu bewegt werden den Blick für den Anderen, d.h. das Opfer und zukünftige potentielle Opfer, zu schärfen. In diesem Sinne wird implizit davon ausgegangen, dass es individuelle Haltungen und Akte der freien Entscheidung sind die den verbrecherischen und anti-sozialen Verhaltensweisen zu Grunde liegen. Die ‚rehabilitativen’ Strategien bedienen sich im wesentlichen Trainings- und Lernprogrammen, die auf eine gezielte Stimulation und Hervorbringung einer ‚rationalen’, einsichtigen Haltung der Akteure – gegenüber ihrem eigenen Leben und ihrem Opfer - und Selbstverantwortung zielen (vgl. HannahMoffat 2002, Garland 1996, 1999). Die Aufgabe der Bediensteten, Pädagogen und ‚Trainer’ im fortgeschritten liberalen ‚Resozialisierungsvollzug’ ist es zum einen, die „Ansprechbarkeit, Veränderungs- und Mitarbeitsbereitschaft von Gefangenen“ (M. Otto 2001: 219) zu verbessern und zum anderen, Angebote für ‚effektive’ Maßnahmen zu unterbreiten. Dieser Gebrauch von therapeutischen Strategien der Besserung impliziert eine neue, an die Rationalitäten fortgeschritten liberaler Gesellschaften adaptierte Form der Behandlung „to acquire self-governance, to learn to Die Redaktion des Sozialmagazins führt in der Einleitung zu ihrem Heft Nr. 1, 1997 folgenden scheinbaren fachlichen Common Sense aus: „Soziale Arbeit basiert auf Freiwilligkeit und dies nicht nur in Beratungsprozessen. Was ist aber mit Menschen, die sich nicht helfen oder kontrollieren lassen wollen? Hier wird deutlich: Sozialarbeit hat es auch mit Zwang zu tun“ (Sozialmagazin 1997: 13). Mit Blick auf Kinder- und Jugendkriminalität unterstellt ein Kommentator in „Die Welt“ vom 8. Juli 2002 einen noch wesentlich schärferen fachlichen Konsens: „Sieht man einmal von ein paar populistischen Scharfmachern aus dem rechten und dem linken Spektrum ab, so gibt es unter Fachleuten kaum mehr ernsthaften Streit. Im Grundsatz sind sich alle darüber einig, dass beides notwendig ist. Die Jugendlichen hinter Schloss und Riegel zu bringen und sie intensiv pädagogisch zu betreuen“ (Schirg 2002). 101 474 manage feelings, […] and to focus on choice […in terms of] costs and benefits […]. Instead of inducing change through discipline and habit, these approaches focus on insight and choice“ (Merry 2001: 19, vgl. Both et al. 1999). Im Mittelpunkt der responsibilisierenden Rehabilitation steht die Selbstverantwortlichkeit des Täters sowohl für seine Tat als auch für die Formen seiner Behandlung bzw. Verwahrung. Damit verbunden ist die - auch mit Blick auf die Reuformulierung des Wohlfahrtssubjekts im Feld des Sozialen rekonstruierbare - Betonung, dass der Gefangene nicht „einfach ‚bedient’ werden, sondern an sich selber arbeiten soll und für seine Resozialisierung mit verantwortlich ist” (BMI/BMJ 2001: 433). In diesem Sinne macht der Kerngedanke des ‚neoliberalen’ Projekts, dass jeder sein eigener Erzieher, Polizist, Antreiber oder eben auch Gefängniswärter sei, auch vor dem Strafkomplex, als dem klassisches Symbol einer ‚staatsfixierten’ Exekution von Herrschaft (vgl. Steinert 1997) nicht halt. Während es in Bezug auf den Straf-Wohlfahrtskomplex das Argument war, dass sich dieser auf eine um die Normallohnarbeitsbiographie konstituierte fordistische Normalität bezogen hat, auf die auch die anderen Institutionen rekurrieren, ist diese gemeinsame Bezugsgröße – die ja nicht nur das ‚Subjekt’ des Gefängnisses und anderer institutionalisierter ‚Einschließungsmilieus’, sondern vor allem auch der Fabrik repräsentiert (vgl. Deleuze 1993, Melossi/Pavarini 1981, Steinert 1993) - nicht verschwunden, aber sie hat sich in fortgeschritten liberaler Form ‚moduliert’. Zur Erläuterung dieser These erscheint es sinnvoll die folgenden Ausführung der Bundesanstalt für Arbeit und der ‚HarzKommission’ über Arbeitslose, mit der zeitgenössischen Refiguration des Gefangenen zu vergleichen: Im Umgang mit Arbeitslosen so ist in einer Veröffentlichung der Bundesanstalt für Arbeit et al. (2003: 183) zu lesen, sei „eine Klassifizierung von Arbeitssuchenden nach bestimmten Gruppen [wesentlich], die sich typisch durch den Abstand der Betroffenen vom Arbeitsmarkt unterscheidet. Funktion der Bedarfsgruppeneinteilung ist eine erleichterte und effizientere […] Bereitstellung geeigneter Dienstleistungen“. „Auf Basis des Tiefenprofiling“, so führt die Hartz-Kommission (2002: 100), die von der Bundesanstalt für Arbeit bemühte Klassifikationsrationalität logisch fort „wird eine schriftliche, verbindliche und gerichtsfeste Eingliederungsvereinbarung mit dem Arbeitssuchenden geschlossen. In ihr verständigen sich beide Seiten auf realistische Arbeitsmarktperspektiven. Durch eine differenzierte und flexibel handhabbare Sperrzeitenregelung kann die Ernsthaftigkeit der eigenen Integrationsanstrengungen verstärkt werden. Die Beweislast für erbrachte Eigenbemühungen soll künftig beim Arbeitslosen liegen“. Das selbe Leitbild einer ‚Ich-AG’ bzw. eines eigenverantwortlichen Selbstunternehmers wird auch in den zeitgenössischen Sanktionsrationalitäten in Form einer diskursiven ‚Schlüsselfigur’ adaptiert, die O’Malley (2001c: 21) als ‚enterprise prisoner’ bezeichnet, der sich selbst willig, selbstverantwortlich und aktiv an seiner eigenen Resozialisierung zu beteiligen hat (dazu auch: Lindenberg/SchmidtSemisch 1994). Innerhalb des Rehabilitationsprozesses rückt dabei – kaum anderes als in den Rationalitäten der neosozialen Arbeitsmarktintegrationspolitiken - das ‚ko-operative’ bzw. ‚ko-produktive’ Verhalten der Gefangenen während der Unterbringung in den Mittelpunkt des Interesses (vgl. M. Otto 2001, Nowara 2001). Das Argument ist, dass 475 „nicht Straftaten ‚gefährlich’ [seien], sondern Menschen, die Straftaten […] begehen und wahrscheinlich weiter begehen werden. ‚Gefährlich’ sind diese Gefangenen auch, wenn sie nicht oder nicht erfolgreich behandelt werden können [… Dabei geht es nicht zuletzt um] nicht-mitarbeitsbereite Gefangene [,…die] es sich – häufig unter Ausnutzung vordergründiger Anpassungsleistungen – bequem machen“ (M. Otto 2001: 218, vgl. Bartol/Bartol 1994). An dem Scheitern der Resozialisierungsbemühungen ist der ‚unverantwortliche’ Gefangene, der die Angebote nicht, oder nur halbherzig wahrnimmt selber schuld, und für die Konsequenzen dann auch selbst verantwortlich. Verwahrung als Exklusionsmanagement tritt als eine Strategie neben die Behandlung und Resozialisierung, falls des den Akteuren an der notwendigen Bereitschaft und guter Besserungswahrscheinlichkeit fehlt. Das sächsische Justizministerium zelebriert diese neue Ideologie in zumindest rhetorischer Reinform: „Angesichts der zunehmend knapper werdenden Ressourcen ist es aber auch wichtig, die zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten des Justizvollzuges gezielt bei denjenigen Gefangenen einzusetzen, die wirklich bereit sind, nach der Haftentlassung ein Leben in sozialer Verantwortung ohne Straftaten zu führen. Diesen Gefangenen muss […] die Chance gegeben werden, dieses Ziel auch erreichen zu können. Bei denjenigen Gefangenen, die jedoch nicht bereit sind, im Justizvollzug mitzuarbeiten und die Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung zu nutzen, dürfen keine Mittel sinnlos verschwendet werden. Hier muss sich der Justizvollzug auf die sichere Verwahrung und die gesetzlich garantierte Grundversorgung beschränken“. (http://www.mj.sachsen-anhalt.de/jv/i_start.htm, Herv. H.Z) Dieser Richtungswechsel gilt prinzipiell auch in Bezug auf Jugendliche. So ist es etwa in ‚sozialtherapeutischen Anstalten’ für besonders ‚riskante’ Erwachsense und Jugendliche in Niedersachsen eine zentrale Ausnahmevoraussetzung dass sie „erkennen lassen, dass sie sich um eine Änderung ihrer Einstellungen und Verhaltensweisen bemühen wollen“ (Niedersächsischen Justizministerium 2001: 1). Der Leiter einer solchen Anstalt in Hameln führt dazu aus: Wir halten „den jungen Gefangenen für sein Verhalten und für seine mögliche Veränderung für selbst verantwortlich. Er trägt prinzipiell Verantwortung für sich und für andere. Trotz aller vorliegenden Behinderungen, Störungen und Entwicklungseinschränkungen ist er verpflichtet, alle entwicklungsförderlichen Ressourcen für seine Veränderung und Persönlichkeitsentwicklung zu aktivieren. Er soll bereit sein, offen über sich zu informieren, eindeutig zu kommunizieren und nachweislich an konkreten Therapiezielen mitzuarbeiten. Aktive Mitarbeit und Kommunikation […] sind verpflichtende und auch verhaltensregulierende Normen, für deren Einhaltung der junge Gefangene mitverantwortlich ist und bei deren Übertretung er die natürlichen oder auch vorher vereinbarten Konsequenzen zu tragen hat“ (Weiß 2001: 236). Dies gilt nicht nur Gefangene, sondern insbesondere auch für die ‚Divertierten’, die die Wahrscheinlichkeit Gefangene zu werden, ‚selbstverschuldet’ dadurch erheblich vergrößern, dass sie ihre Mitarbeit in den Angeboten im Rahmen von Weisungsprogrammen nicht oder nicht richtig ausfüllen. Die Repräsentation des individuellen Täter als ein Akteur dem es an den selbstunternehmerischen Fähigkeiten mangelt um sich angemessen in seinem zugewiesenen Platz in den Logiken einer fortgeschritten liberalen Gesellschaft zu bewegen stellt auch die Basis Schemata des gezielten ‚Abtrainierens’ bestimmter ‚Verhaltensweisen’ dar (vgl. Eucker 1998). Ein wesentlicher Teil der Trainings zielt darauf ab, mittels der „Technik der Konfrontation als einer ‚harten’ Variante der Responsibilisierungsstrategien“ (Krasmann 2000: 212f, vgl. May 2002) die Jugendlichen in die Lage zu versetzen seine ‚eigene Kosten-Nutzen-Analyse aufzustellen’ (Both et al. 1999, vgl. CladderMicus/Kohaus 1995, Weidner 1997, Schatz 2001). Die Tat wird dabei nicht als Symptom einer Disposition oder sozialen Relationen betrachtet (vgl. auch Scherr 2002a), deren Bearbeitung das vorrangige Ziel der sozialen Maßnahmen ist, sondern die 476 abweichende, performative Äußerung selbst steht im Vordergrund von Behandlungen, die darauf zielen relativ klar umrissene Verhaltensweisen und bestimmte mehr oder weniger psychometrisch ermittelte individuelle Risikodispositionen ‚an der Oberfläche’ abzutrainieren (vgl. Krasmann 2000). Damit gerät die ‚wohlfahrtsstaatliche’ an einer umfassenden ‚Normalisierung’ des abweichenden Akteurs orientierte Bearbeitung seiner ‚positional-dispositionale Matix’ - teilweise wird sogar eigens betont, dass diese so bleiben darf wie sie ist - zugunsten einer Substitution, Kanalisierung oder bloße Verschiebungen perfomativer Verhaltensäußerungen in den Hintergrund. So führen etwa die Protagonisten eines Anti-Aggressivitätstrainings in Bezug auf rechtsradikale Jugendliche aus, dass „der Täter seine Vorurteile und Feindbilder weiter pflegen [könne], aber er muss sich andere Wege suchen, um seine Hassgefühle anders zu kompensieren als mit Gewalt. Pointiert formuliert ist das realistische Trainingsziel: Aus gewalttätigen Skins nichtgewalttätige CSU Rechtaußen zu machen“ (Geretshauser et al. 1993: 274). Dies soll unter anderem durch ‚harte Auseinandersetzung’, persönlicher Verantwortungsübernahnme für die Tat gekoppelt mit konfrontativen ‚Beschämungen’ auf dem heißen Stuhl geschehen, durch die – im Sinne eines ‚knallharten Opferschutzes’ (Pötzsch 1999) - die Opferperspektive ‚einmassieren’ werden soll (vgl. Weidner 2001, Schanzenbächer 2001). Unbenommen erheblicher empirischer Bedenken hinsichtlich der ‚kriminalpräventiven’ Wirksamkeit solcher Methoden102 findet bei den Vertretern der sozialen Dienste, als professionelle Garanten des ‚rehabilitativen Ideals’ eine Undefinition dessen statt, was unter ‚Resozialisierung’ bzw. ‚Rehabilitation’ verstanden werden soll: Dort wo einst die ‚Persönlichkeit’ des Individuums und seine soziale Einbindung und Integration das Objekt transformativer Anstrengungen war, das ist zentrale Objekt, auf das die Maßnahmen zielen nun das Tatverhalten selbst, und „the habits most closely associated with it. The immediate point is no longer to improve the offender’s self-esteem, develop insight, or deliver client centred services, but instead to impose restrictions, reduce crime and protect the public. These shifts in practice, together with the recent revival of less-eligibility concerns, prompt treatment programmes to hold themselves out as being for the benefit of future victims rather than for the benefit of the offender” (Garland 2001: 176). An die Stelle der Wiederherstellung gesellschaftlicher Teilhabe nach einem zeitlich limitierten Ausschluss durch Strafe, tritt demnach ein Behandlungsansatz, der nicht nur auf eine andere Ziele anvisiert, sondern auch auf qualitativ unterscheidbare Subjektivierungsweise der Täter verweist. Im Zentrum steht die individuierte Herstellung eines eher ‚selbstkontrollierten’, als im fordistischen Sinn ‚normierten’ Individuums, das als eigenverantwortliches und selbstständiges ‚Subjekt’ rekonstruiert wird. Die ‚Produktion’ eines transformierbaren, responsibilisierten Risikosubjekt im Strafvollzug weist eine deutliche Analogie zu den Re-Subjektivierungprozessen der Hilfebezieher im aktivierenden Regulationsstaat auf. Vergleichbar mit der Repräsentation des Hilfeempfängers als (moralisch) selbstverantwortlicher Akteur und der damit legitimierten Beschränkung direkter sozialer Unterstützungsleistungen im Feld des Sozialen sind auch die Repräsentation des ‚Kriminellen’ 102 Von einer Überlegenheit dieses Ansatzes gegenüber den angeblichen ‚Weichspüler-Methoden’ der Sozialen Arbeit kann keine Rede sein. Ohlemacher et al. (2001) stellten in einem einen Rückfallratenvergleich einen Nulleffekt des AAT fest, während der ‚Sherman-Bericht’ des US-amerikanischen National Institute of Justice (1997) auf der Basis experimenteller Verfahren sogar eher höhere einschlägige Rückfallraten bzw. einen „aggressives Verhalten verstärkenden Effekt“ (Karstedt 2001: 178) bei vergleichbaren Anti-Gewalt-Trainings feststellt 477 selbstverantwortliches Subjekt und eine stärkere Punitivität im Feld der Kriminalitätskontrolle zwei Seiten einer Medaille: Wird nämlich Kriminalität als ein persönlicher Mangel an Eigenverantwortung verstanden und damit zugleich als moralisches und ethisches Defizit individualisiert (vgl. Bode/Lutz 2001: 205), kann der Delinquent auch bei der bei der gleichen oder gar einer weniger schweren Form der Abweichung kaum in dem Maße mit Verständnis oder gar Sympathie und Solidarität rechnen, wie der nicht individuell zugeschriebenen, armseligen inneren und äußeren Bedingungen unterworfene Täter (vgl. Groenemeyer 2001: 115). Dario Melossi hat in diesem Sinne ein Modell grundlegender diskursiven Typiken der Repräsentation des Kriminellen in verschiedenen Phasen gesellschaftlicher Formationen rekonstruiert. In Zeiten in denen ein exkludierdender Charakter gesellschaftlicher Formationen dominant wird, so sein Argument, wäre vor allem die Gesellschaft zu schützen, während die Täter ‚moralisch verwerfliche Individuen’ darstellen würden (vgl. Melossi 2000: 174). Falls im Kontext einer solchen Täterrepräsentation, die Gründe seiner Immoralität und Verantwortungslosigkeit überhaupt relevant seien, wären sie vor allem bei ihm selbst und nicht in ‚gesellschaftlichen Verhältnissen’ zu finden. Dies gilt zumindest insofern unter ‚gesellschaftlichen Verhältnissen’ Phänomene wie soziale Deprivation, Ungleichheit und Ungerechtigkeit verstanden werden und nicht ein gesellschaftlicher Zerfall von Autorität, Moral und Familie, die selbst vor allem auch einen Indikator für mangelnde Moralität, Boshaftigkeit und charakterliche Schwäche der einzelnen Individuen darstellen (vgl. Melossi 2000: 174, Stenson 2001: 17). Die Frage der Kriminalität wird in diesen gesellschaftlichen Phasen der Tendenz nach ihrer Einbettung in komplexe gesellschaftliche Verhältnisse enthoben und zur schlichten Frage moralischer Erziehung (vgl. Melossi 2000: 169). Melossis Argument wäre missverstanden, wenn unter diesen Typiken die Zusammenfassung des Unterschieds kriminalpolitischer Positionen von ‚Konservativen’ und ‚Linken’ impliziert wäre. Seine These ist vielmehr, dass das genannte Deutungsmuster in eher exkludierenden Phasen der Entwicklung gesellschaftlicher Formationen der Tendenz nach den Charakter eines allgemeineren gesellschaftlichen Grundmusters annimmt103. Dieses Grundmuster findet sich sowohl in der Bevölkerung – für die derzeit allgemeine, erhebliche Verhärtungen punitiver Einstellungen nachzeichnet werden (vgl. Kury 2001, Ostendorf 2000) - bei den bei den für solche Positionen vermeintlich besonders disponierten Institutionen, wie der Strafjustiz104, aber auch bei jenen Akteuren und Institutionen, die - wie etwa die Soziale Arbeit - traditionellerweise wohlfahrtstaatliche Inklusionsagenten darstellen: „Die Zeiten träumerischer, zwangsfreier, nur auf Selbstbestimmung setzender Pädagogik“ so resümiert etwa der Jugendstrafrechtler Arthur Kreuzer (2002) den aktuellen Diskurs der Sozialen Dienste „dürften überwunden sein“. In dieser ‚Hintergrundgrammatik der Härte’ (vgl. Veyne 1992, Fach 2000, Lindenberg 2000) stellen die Programme zum bloßen Abtrainieren verwerflicher Verhaltensweisen nur eine Ausformung der veränderten Logik der Repräsentation des Delinquenten dar, die die Basis eines substanziellen Wandel des als ‚angemessenen’ erachteten Zugriffs der Institutionen ist (vgl. Groenemeyer 2001, Wacquant 103 Für diese ergänzende Ausführung und Erläuterungen seiner These in Bezug auf wohlfahrtsstaatliche Institutionen danke ich Prof. Dario Melossi. 104 Der Bundesverfassungsrichter Winfried Hassemer (2000a) spricht davon, er habe „nie soviel selbstverständliche Strafbereitschaft, ja Straffreude wahrgenommen wie heute“ (zit. nach Weber 2001: 93). 478 2001, Cremer-Schäfer/Steinert 1998). Die von Melossi konstatierten Verschiebung der diskursiven Fassung von Kriminalität von einer Frage gesellschaftlicher Relationen zu einer Frage moralischer Erziehung findet sich fast wörtlich im 11. Kinder- und Jugendbericht (2002: 239), wenn dieser darauf besteht, Täter nicht als Opfer ihrer sozialen Verhältnisse zu verstehen, bzw. dazu „zu machen“, sondern einzusehen dass Delinquenz ein pädagogisches Problem darstellt, dass vor allem „pädagogische Antworten provoziert“ und nach Erziehung, Kontrolle, Grenzsetzung und Normverdeutlichung verlangt. Die Jugendministerkonferenz (2000: 15) fordert auf der Basis dieser Repräsentation des Täters, dass nicht nur die formellen Sanktionen sondern auch andere, sozialpädagogische „Reaktionsformen […] darauf abzielen [müssen], in dem Sinne auf den Jugendlichen in dem Sinne einzuwirken, dass er in Zukunft nicht wieder straffällig wird“ und verlangt von der Sozialen Arbeit „erzieherische Maßnahmen […die] eine tatnahe und individuelle Reaktion auf Jugendliche erlauben […] verstärkt zu nutzen“. Schließlich teilen auch die Experten des ‚Ersten Periodischen Sicherheitsberichts’ (BMI/BMJ 2001: 63) diese Täterrepräsentation und ihre Konsequenzen für die Interventionen und heben die Notwenigkeit für „ein gezieltes und auf die Individualität des jeweiligen [jugendlichen] Täters zugeschnittenes Vorgehen“ hervor, dass sich dadurch auszeichnen soll „dem Täter Hintergründe und Folgen der Tat unmittelbar vor Augen zu führen und diese intensiv aufzuarbeiten“. Eine solche, das ‚selbstverantwortliche’ Subjekt ‚konfrontierende’ Form der Pädagogik (vgl. Colla et al. 2001) ist nicht im engeren Sinne des Wortes ‚sozial‘. Auf die Gesellschaft bzw. auf ‚das Soziale’ (im Sinne von Deleuze 1980, Donzelot 1994) wird nur in sofern Bezug genommen, wie ihre hegemonialen Verhaltensstandards das Referenzsystem bilden, dass der Einzelne in der Performation seiner Dispositionen unterboten hat. Dabei folgen die Institutionen des Sozialen auch im strafjustiziellen Feld jenen ‚neo-sozialen’ Logiken und Regelmäßigkeitsmustern, die fortgeschritten liberalen Gesellschaftsformationen dominant geworden sind. Das Wegschließen und andere Formen der ‚Strafe ohne rhetorischen Firlefanz’ (vgl. Sack 1998) beziehen sich nur auf jenen Teil der Straffälligen, die die neue, ‚spezialpräventive’ Moral der Selbstverantwortung ablehnen oder sie nicht adäquat auszufüllen in der Lage sind. Praktisch bedeutsamer als ein gezielter ‚Ausschluss durch Einschluss’ (vgl. Nickolai/Reindl 2001) ist jedoch eine allgemeinere Neudefinition des Delinquenten: Er ist weniger das juristische Subjekt des Rechtsstaats, aber auch nicht das soziale und psychologische Subjekt der Kriminologie sondern vor allem ein Individuum, das nicht Willens oder in der Lage ist seine Verantwortungen als Subjekt einer moralischen Gemeinschaft zu akzeptieren (vgl. Rose 2000a: 337). Dieses (moralisch) selbstverantwortliche Individuum auf der Ebene der Subjektivierungsweise wird von einer ‚funktionalen’ Ebene von einer Verschiebung des Fokus von der vergangenen Abweichung105 Zumindest für die Hinauseskamotierung des ‚Subjekts der (sozialwissenschaftlichen) Kriminologie’ war eine halbierte Rezension der Ideen des ‚labeling approach’ in ideologischer Hinsicht durchaus hilfreich. Es waren die Devianzsoziologie im allgemeinen und der labeling approach im besonderen, die darauf hingewiesen haben, dass Kriminalität weniger auf die Qualität sozialer Akte selbst, sondern immer auf die Qualität bestimmter Definitionen und Etikettierungen reflektiert, die nach den Konstitutionsregeln einer bestimmten – als ungerecht kritisierten – sozialen Ordnung (des Kapitalismus) an ein Verhalten herangetragen werden. Pragmatisch wurde das Argument des ‚nicht-ontologischen’ Charakters der Devianz und 105 479 des Akteurs - als einem Verstoß gegen verallgemeinerte Imperative, die in Bezug auf ein bestimmtes Verhalten mit einer relativen Konstanz in widerkehrenden Situationen gefordert wird (vgl. Lamnek 1996: 17) - hin zu einer Regulation von Risiken, im Sinne der Wahrscheinlichkeiten eines negativen ‚Outcomes’ (vgl. Lutz 1999). Die beiden Ebenen harmonieren in ideologischen wie theoretischsystematischer Hinsicht durch den gemeinsamen konstitutiven Bezug auf das Wahlhandeln der Akteure. Der Begriff des Risikos, bezieht sich, wie Klaus Japp (1992: 94) ausführt, auf einen „possible disadvantage (or benefit), resulting from a decision. This implies choice. […Risk is not] a possible disadvantage resulting from externally imposed circumstances [… which] implies that there is no choice”. Während der Begriff der Abweichung den Begriff der Norm, bzw. der Normalität als sein Gegenstück immer beinhaltet (vgl. Bettmer 2001, Sack 1993a), stellt ‚Sicherheit’ das begriffliches Gegenstück zum ‚Risiko’ dar. In diesem Sinne ist ‚Sicherheit’ eher als ‚Normalität’ sich entscheidenden Dispositiv der politischen Rationalität einer fortgeschritten liberalen ‚Risikogesellschaft‘ avanciert (vgl. Lemke 1997). Während eine Abweichung von der Normalität Strategien der ‚Normalisierung’ impliziert, verweist ‚Risiken’ auf Strategien die die Wahrscheinlichkeit von Schädigungen reduzieren: während ‚Abweichler’ diszipliniert werden, wird das ‚Risikosubjekt’ nach dem kalkulatorisch antizipierten Schädlichkeitsgrad ‚gemanaged’. Da für diese Form der Interventionslogik andere Wissensbestände notwendig sind, als im ‚Strafwohlfahrtskomplex’ verändert sich auch der Bezug auf die Leitwissenschaften die als Generatoren der praktische Theorien der beteiligten Kontroll- und Besserungsinstitutionen herangezogen werden: Es ist weniger das Wissen über das Soziale, als das Wissen über den Einzelnen das - vornehmlich in Form von Psycho-Wissenschaften und ökonomischen Handlungsmodellen106 maßgeblich erscheint. Die wichtigste Veränderung, findet sich jedoch, in einer Verschiebung der Gewichte der „balance of power in the struggle to define what punishment should mean“ (Garland 1995: 198). In dieser Gewichtsverschiebung verlieren rehabilitative Pogramme zunehmend ihre ‚Selbstzweckhaftigkeit’ in so fern, dass sie zu einem für bestimmte Gruppen mehr oder weniger probatem Mittel zu einem anderen Zweck werden. Der dominante Zweck besteht im ‚Schutz der Bevölkerung’, dem ‚oberste Priorität’ eingeräumt wird (vgl. IM Baden-Württemberg 2001). Die in dieser verschobenen Machtbalance angelegte Umorientierung in der Technologie und Teleologie der Reaktion auf Kriminalität, die sich „in zunehmendem Maße von der einseitigen Täter-Behandlungs- Kriminalität dadurch durchbrochen, dass der scheinbar weniger stigmatisierende Begriff ‚Risiko’ an seine Stelle gesetzt wurde, der durch die Rede von der ‚Risikogesellschaft’ zugleich auch einen sozialtheoretisch überzeugenden Charakter bekommen konnte. Dem zentralen Problem, auf das das nicht zu trennende Begriffspaar Abweichung und Ordnung verwies, nämlich dass die materiellen Konstitutions- und symbolischen Verkehrsregeln der Ordnung reflektiert werden müssen um gehaltvoll über ‚Kriminalität’ ‚Devianz’ ‚Delinquenz’ etc. sprechen zu können, geht die Rede von ‚Risiken’ und ‚Risikoverhalten’ systematisch aus dem Weg (vgl. Groenemeyer 2001: 32). Da ‚Risiko’ im Gegensatz zu ‚Abweichung’ begrifflich widerspruchsfrei ohne einen Bezug auf die Konstitution des ‚Normalen’ einer gesellschaftlichen Ordnung aufbauen kann, und es zugleich gelingt allerlei ‚Fehlentwicklungen’ unter den Risikobegriff adäquat zu subsumieren (vgl. Schulz/Wambach 1983), kann der Risikobegriff „auf alltagsweltliche Evidenz als Bezugspunkte [bauen]; schließlich weiß man, wie Probleme und Risiken zu bewerten sind“ (Groenemeyer 2001: 32). 106 Die gilt in einem erkennbaren Maß auch für die Bio-Wissenschaften. 480 Ideologie ab und den Wiedergutmachungs-Interessen des Opfers und den Sicherheits-Interessen der Gesellschaft zu[wendet]“ (Schneider 2001: 379) kann nicht einfach als Produkt eines neokonservativ/neo-liberalen Diskurses (vgl. O’Malley 1999a, 2001, Groenemeyer 2001) betrachtet werden, das exogen an die Jugendhilfe herangetragen wird. Diese Umorientierung findet sich auch bei den Vertretern der Jugendhilfe selbst: „Gingen jahrzehntelang die Bemühungen in die Richtung, dem Straftäter durch soziale Arbeit möglichst optimale Lebensverhältnisse ermöglichen und so seine Rückfälligkeit verhindern zu wollen, hat inzwischen ein Umdenken eingesetzt […]. Das grobe Ziel dieser Handlungsstrategien in der Straffälligenhilfe lässt sich mit Wiederherstellung sozialen Friedens beschreiben“ (Stiels-Glenn 1997). In so fern erscheint es analytisch unzureichend, die ‚neuen’ Ansätze und Techniken mit Blick auf die Frage zu zu fokussieren, in wie fern sie im Einzelnen effiziente und effektive Modifikationen bzw. ‚Verbesserungen’ der bisher praktizierten Methoden implizieren, ohne zu beachten, dass sie in ihrer Gesamtheit auf eine fundamentale Veränderung der ‚straf-wohlfahrtsstaatlichen’ Rationalitäten des justiziellen Feldes der Kriminalitätskontrolle verweisen. Ein bezeichnendes Beispiel für diese struktursystematische Verschiebung stellt etwa die Undefinition der Standards in der Bewährungshilfe dar: 1994 hat sich die Berufgruppe der Bewährungshelfer und -helferinnen Standards im Sinne von Grundsätzen gegeben, die sich an einem internationalen ‚Code of Ethics’ für die Soziale Arbeit orientieren, der 1977 in Puerto Rico verabschiedet worden ist (vgl. Bewährungshilfe 1994: 155 ff). In diesen Grundsätzen wird unter Punkt 7 das Thema Öffentlichkeit/ Gesellschaft verhandelt. Auf diese wird ausschließlich eine Ursache für den Problemkomplex Abweichung verwiesen, die zwei zentrale Aufforderungen an die Bewährungshilfe impliziert. Erstens mache sie es notwendig, dass die Bewährungshilfe eine „kriminal- und sozialpolitische Lobby für ihre Klientel sein [muss]“ und zweitens, dass der Bewährungshilfe eine Arbeitsweise entspricht, „die auf Missstände innerhalb der Gesellschaft hinweist und deren Beseitigung fordert“ (vgl. auch Arbeitsgemeinschaft Deutscher Bewährungshelfer [ADB] 1996). Die Bewährungshilfe versteht sich hier, in der Tradition des ‚penal-welfarism’, der bis in die 1970er Jahre soziale Benachteilung und ihre individuellen Auswirkungen in den Mittelpunkt gestellt hatte (vgl. Garland 2001), als Repräsentant und Garant des wohlfahrtsstaatlichen Versprechens gegenüber ihrem Nutzer. Fünf Jahre später, hat der Rekurs auf ‚Gesellschaft’ im „Aufgaben- und Leistungskatalog“ der „Qualitätsstandards der Bewährungshilfe“ vom 14.07. 1999 (ADB 1999) eine deutlich andere Bedeutung: Gesellschaft erscheint als ‚Kunde’. Die „drei wichtigsten Kundengruppen der Bewährungshilfe“ so lautet der Bezug auf in diesem Aufgaben- und Leistungskatalog sind: „Probanden, Richter, Gesellschaft“. Entsprechend der differenziellen Kundeninteressen werden drei zentrale „Zielsetzung der Bewährungshilfe“ formuliert: „Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen“, „Rückfallreduzierung und -vermeidung“ und als drittes Ziel, das Produkt für die Gesellschaft: „Innere Sicherheit“. In den Qualitätsstandards der ‚professionellen’ Vorgehensweise, führt der Katalog zwei Punkte an, in denen der Begriff ‚Gesellschaft’ weder vorkommt, noch implizit gemeint ist. Es geht um: - „Ist-Situation - Soll-Situation . 481 - Hintergrund der Tat, Motivation, Opferperspektive, Täterarbeit, Antigewalttraining“ (ADB 1999, vgl. Maelicke 1998, zur ‚Qualitätsdiskussion‘ vgl. die Zeitschrift ‚Bewährungshilfe‘). Damit reflektiert auch die deutsche Bewährungshilfe das ‚Klima’ einer fortgeschritten liberalen Strafrationalität die im wesentlichen durch folgende Zielparameter bestimmt ist: Die Etablierung von Maßnahmen die auf die spezifischen Risiko- und protektiven Faktoren zielen, die unmittelbar auf das Verhalten des Täters wirken, das Ziel der Kriminalitätsreduzierung, der Schutz der Öffentlichkeit, die Unterstützung der Opfer und die Berücksichtung der Sicherheitsinteressen der Gemeinschaft „und als sekundäre Technik eben auch noch […] Resozialisierung, falls dass ‚risk-assessment’ dies zulässt und eine Besserungswahrscheinlichkeit diagnostiziert wird“ (Groenemeyer 2001: 166). Diese Parameter divergieren offensichtlich von der Rationalität des fordistischen ‚Straf- Wohlfahrtskomplexes’. Hier war das Ideal der Resozialisierung (Erziehung, Behandlung etc.), als ‚tertiäre Prävention’, nicht nur ein Element unter anderen, sondern als das dominierende und feldstrukturierende Konzept, ein axiomatisch grundgelegtes Organisationsprinzip, das alle Aktivitäten im strafjustiziellen Bereich des Feldes der Kriminalitätskontrolle abdeckt und in den Habitus der Praktiker und Professionellen eingeschrieben ist (vgl. Garland 2001: 34 ff, Thim-Schrader 1989, Schneider 2001). Demgegenüber wird der tertiären Prävention, im Sinne einer ‚positiven Spezialprävention’ als Selbstzweck in einem zeitgenössischen, ‚re-coded penal-welfarism’ (Garland 2001), deutlich weniger Aufmerksamkeit geschenkt: Bettmer (1992) spricht von der Spezialprävention als einem ‚obsoleten Konzeption’. Dem steht jedoch nicht entgegen, dass es dort, es rehabilitative Ansätze gibt, ein gestiegenes Interesse an ihrer Effizienz und Effektivität besteht, die in einem deutlichen Kontrast zum Optimismus gegenüber der Resozialisierungseuphorie und dem Vertrauen in das Wissen und die Fähigkeiten der damit betrauten Professionellen steht, was sich unter anderem dadurch dokumentieren lässt, dass es bis Mitte der 1970er Jahre in der Bundesrepublik kaum Wirkungsforschungen in diesem Bereich gegeben und auch ein nur eingeschränktes Interesse an ihrer Implementation bestanden hatte (vgl. Dünkel/Rehn 2001, zum Wandel des Forschungsinteresses im Strafvollzug: Sparks 2001). Während das grundlegende Vertrauen in die Überlegenheit des professionellen Wissens und der Techniken der Professionellen durch einen ebensolchen ‚Nothing-Works-’Pessimismus abgelöst worden ist, kann inzwischen von einem Übergang „vom nothing works zum something works“ als Grundhaltung in der Behandlungsforschung gesprochen werden (vgl. Kury 1999a, Schneider 2001). Im Gegensatz zu den Resozialisierungsrationalitäten im Straf-Wohlfahrtskomplex, wird die Bestimmung dessen was ‚wirksam’ ist wird jedoch vor allem durch einen möglichst effektiven und effizienten Schutz vor Risiken bestimmt, die es auch in Bezug auf rehabilitative Ansätze verlangen „to define and scale negative outcomes (hazards, losses, ‚bads’) and to attach probabilities to their future occurrence“ (Sparks 2001: 160). Auch wenn die Behandlungsansätze selbst zielgerichtet auf das Individuum ausgerichtet sind, bleibt die Bestimmung und Skalierung dieser Risiken für den einzelnen Täter als Einzelnem nach dem derzeitigen Stand der Pönologie unmöglich (vgl. Albrecht 2000, McKenzie 1997, Sampson 2000). In diesem Sinne wird ein Individualbezug zwar forciert (Kury 1999, 1999a), das Individuum als 482 ‚holistisches Subjekt’ wird aber in so fern durch ein Individuum als ein spezifisches Cluster von Risikound Schutzfaktoren substituiert, dass seine Bestimmung als transformierbares Risikosubjekt nicht auf einem individuellen Nachweis von Kausalitäten beruht, sondern auf einer populationsstatistischen Berechnung der Wahrscheinlichkeiten einer Korrelation von Risikofaktoren – die mit „geeignete[n] Verfahren und Methoden der sozialen Diagnostik“ (BMFSFJ 2002: 25) zu ermittelt werden - und dem Auftreten problematischer Verhaltensweisen (vgl. Groenemeyer 2001: 34). Eine solche Form der ‚Berechnung’ hat nicht nur ‚technische’ sondern auch ökonomische Vorzüge. So ist die je spezifische Ermittlung und Verhinderung von je besonderen Handlungen eines Einzelnen, als einem in komplexen sozialen Beziehungen und Verortung agierenden sozialen Akteurs nicht nur eine schwierige, sondern auch eine wenig effiziente und kostspielige Angelegenheit. Insbesondere vor dem Hintergrund der finanziellen Restriktionen des Wohlfahrtsstaats ist es daher trotz eines individualisierten Behandlungsansatzes ‚rational’, den Fokus bei der Risikobestimmung und Skalierung von einzelnen Individuen zu Aggregaten von Individuen zu verschieben: „[F]rom specific cases to population flows and from individualized justice to the management of resources“ (Garland 1997: 190). Dabei diktiert das Ziel des Schutzes vor Risiken, bezogen auf eine durch vorabdefinierte Merkmale konstituierte Population „an evidence-based practice orientated towards allocating probability to cases [, in which …] some more mundane risks could only be reduced to a degree compatible with certain determinate limits of expandure and affords (such as the availability of costly prison space)“ (Sparks 2001: 160, vgl. europaweit: Council of Europe 2000). Eine an Effizienz und Effektivität ausgerichtete Strafrationalität (Dünkel/Drenkhan 2001, Kury 1999a, Rehn et al. 2001, Schneider 2001) unter dem Dispositiv der Sicherheit, beinhaltet unter andern Fragen nach dem ‚optimalen’ Quantum an Personen, die in das Sanktionssystem eintreten, der Dauer ihrs Aufenthalts und der relativen Kosten der unterschiedlichen Interventionen (vgl. Sparks 2001: 160). Sie verweist auf eine Kombination, aus temporärer oder dauerhafter Unschädlichmachung durch Einsperrung für ‚Intensiv-’, Mehrfach-’ und vor allem die ‚gefährlichen Straftäter’ und non-kustodialen Strafen mit variierenden Formen und Intensitätsgraden von Überwachungen und Auflagen für die Mehrheit der Täter sowie unterschiedliche Formen korrigierender ‚Spezialprävention’. Dabei bleibt das rehabilitative Ideal zwar als ein Ziel und zumindest auf der Ebene der Rhetorik sogar als ein Hauptziel bestehen aber es haben vor dem Hintergrund von materiellen und ideologischen Grenzen der Resozialisierung haben sich andere Elemente und andere Logiken an seine Seite gestellt: „while the agency (and its field agents) still espouse the validity of normalization and reformative goals in this arm of corrections, the resources and commitment to carry out those aims are in short supply. Consequently, agency actors appear to have constructed the [prisoner and the] parolee subject as one who is dispositionally flawed, and who is ultimately responsible for his own improvement” (Lynch 2000: 40). In einem eher instrumentellen Sinne werden Behandlung, Therapie, Besserung, ‚Erziehung’ etc. primär als Mittel begründet, dass es den gesellschaftlichen Schutz- und Sicherheitsinteressen dient, wenn die Täter mit einem veränderten Risikoverhalten aus den Maßnahmen entlassen werden. Entsprechend dieser Rehabilitierungsbegründung wird auch in den Behandlungsansätzen selbst statt der ‚Täterorientierung’ der fordistischen Erziehungs- und Resozialisierungsrationalität ein neues „opferorientiertes Professionsverständnis“ der justiznahen Soziale Arbeit gefordert: „Der Strafvollzug 483 hat Verantwortung für alle tatsächlichen oder potentiellen Opfer, denn jeder Täter wird entlassen. Die begrenzte Verweildauer des Täters im Strafvollzug muss Tag für Tag intensiv genutzt werden um dem Sicherheitsinteresse der Opfer zu entsprechen“ (Heilemann 1997: 51). Dabei geht es dann weniger um eine Humanisierung des Strafvollzugs durch ‚Erziehung statt‘ oder ‚Erziehung als Strafe‘, oder um ein Bestreben dem Sanktionierten zu helfen gesellschaftliche Teilhaberechte nach dem Ende eines temporären Ausschlusses zu verwirklichen, als um die Suche nach „Sanktionsformen, die die Einsicht fördern und nicht den Absturz“ (Wienholtz 1997: 35), sowie um kostengünstige und schnelle Möglichkeiten der Bewältigung von Jugendkriminalität und eine „höhere[…] Effizienz für die Rückfallvermeidung“ (Sonnen 1997: 27) bieten. In diesem Sinne wird, das „auf individuelle Erziehung ausgerichtete Jugendstrafrecht“ mit dem Argument verteidigt, dass es „sichere und schnelle Reaktionen uneingeschränkt zu[lässt:] Je effektiver das anzuwendende Recht dann in Hinsicht auf den betroffenen jungen Menschen wirkt, desto besser wird im Endergebnis auch die Sicherheit der Allgemeinheit gewährleistet“ (Kerner/Weitekamp 1997: 497). Kurz: Resozialisierung, Behandlung und Erziehung wird selbst zu einem Mittel unter anderen zum Zweck der Herstellung innerer Sicherheit (vgl. Korndörfer 2001: 163) und der Befriedigung der Bedürfnisse aktueller und potentieller Opfer reformuliert und dabei selbst eher in ein ‚framework of risk’, als in ein ‚framework of welfare’ eingebunden (vgl. Garland 2001: 176, O´Malley 1999): „Instead of extending compassion, help and support to offenders, it offers protection to public“ (Garland 2000: 14). Obgleich die zeitgenössische, politisch wie ideologisch zerklüftete Landschaft der Organisation und des Managements von Ordnung, Sicherheit und Kontrolle keiner eindeutig identifizierbaren Theorie oder Philosophie folgt, sondern sich eher als ein hybride Formierung ebenso sehr konkurrierender wie kompromisshaft amalgamierter Strategien, Technologien, Teleologien und selbst Paradigmen beschreiben lässt (vgl. Lindenberg/Schmidt-Semisch 2000, Loader/Sparks 2002, O’Malley 2000, Sparks 2001), kann in der Gesamtschau eine Art ‚Risiko-Straf-Wohlfahrts-Management-Konsens’ ausgemacht werden, der das Ergebnis der in allen fortgeschritten liberalen Gesellschaften rekonstruierbaren „confusion about the purposes of the youth justice system and principles that should govern the way in which young people are dealt with by youth justice agencies“ darstellt. Der Kern dieses Konsens lautet schlicht: „Concerns about the welfare of young people have too often been seen as in conflict with the aims of protecting the public, punishing offences and preventing offending” (New Labour: ‚No More Excuses’ zit. nach Newburn 2002: 560) Die ‚persönlichen’ und ‚sozialen Faktoren’, auf die ein entsprechend reformulierter Erziehungsgedanke zielt, haben demnach im Vergleich zum fordistischen Straf-Wohlfahrtskomplex weniger an Bedeutung verloren, als sich in ihrer Bedeutung verändert. Die sozialen Bedingungen und der sozioökonomische Hintergrund der Akteure verlieren ihren Status als Teil des ‚wirklichen’ Problems, das es zu bearbeiten gilt und auf das die Abweichung von Kindern und Jugendlichen als performativer Ausdruck verweist, sondern werden selbst als ein Indikator und potentieller Nährboden für die zu bearbeitenden Risiken verhandelt. D.h. die in den Blick geratenen Ursachen sind nicht die Strukturen des und Probleme im ‚Sozialen’, die sich auf die positional-dispositionale Matrix der Akteure niederschlagen, sondern der - 484 zwar in direkten interpersonalen Beziehungsgeflechten und je situativ kontextuierte, aber dennoch als Träger des Problems identifizierbare einzelne Akteur selbst. Das bisher proklamierte Resozialisierungs- bzw. ‚Erziehungsziel’ der justiznahen Jugendhilfe, als eine Form der Normalisierung gesellschaftliche Teilhabe für ihre Adressaten zu eröffnen (vgl. Bittscheidt-Peters 1998: 182) hat seine uneingeschränkte Dominanz für die Konstitution von Maßnahmen eingebüßt. Auch wenn das einzelne Individuum der Bezugpunkt der Intervention bleibt wird das Ziel der ‚positiven Spezialprävention’ zu einem Teil einer verallgemeinerten Generalprävention aufgelöst (vgl. Naucke 1999): Wo „der Mensch den Subjektstatus innehat, ist nunmehr das Gesellschaftssystem an seine Stelle gerückt“ (Albrecht 1994: 194). Dieser ‚Subjektstatus des Gesellschaftssystems’, der insbesondere in Form der (Identifikation)Figur des ‚Opfers’ personalisiert und greifbar gemacht wird (vgl. Stanko 2000) und die Reformulierung des ‚Tätersubjekts’ als Sicherheitsrisiko (vgl. Wambach 1983) besteht nicht ‚nur’ auf einer symbolischdiskursiven Ebene, sondern hat sich bereits erkennbar in strafrechtlichen Änderungen materialisiert. Exemplarisch hierfür steht etwa die Neuformulierung des § 454 der Strafprozessordnung nach der es in bestimmten Fällen nicht mehr der Maßstab von Prognosen ist, ob eine realistische Chance auf Bewährungserfolg, sondern ob ‚keine Gefahr mehr besteht‘ (vgl. Feuerhelm 1999: 474). Dabei muss das Gericht nach neuem Recht bei in „allen Aussetzungsverfahren, denen ein Verbrechen oder eine der in § 66 Abs. 3 STGB bezeichneten Taten […] zugrunde lag […] einen Sachverständigen heranziehen, der Einschätzungen zur Prognose vorzunehmen hat“. Die bedeutendste Änderung ist jedoch die Neufassung von § 57 Abs. 1 S.1 Nr. 2 StGB vom Januar 1998 nach der eine Aussetzung des Strafrestes nur „unter der Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden kann“ (Feuerhelm 1999: 474). Der Sinn dieser Veränderung besteht darin, in einer formalisierten, auf dass gesamte Strafgesetzbuch rückwirkenden Form das „Sicherheitsinteresse der Bevölkerung ausdrücklich hervor[zuheben]“ (BMI/BMJ 2001: 40). In Bezug auf die gewählte Semantik stellt der Rekurs auf den Begriff des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit - im Gegensatz zur alten Begriff der Sicherung - eine neue, bisher unbekannte Terminologie im Strafrecht dar: „[W]ährend die Allgemeinheit nur dort ein Sicherungsinteresse geltend machen kann, wo überwiegend öffentliche Interessen [der Schutz von Rechtsgütern] vorliegen, besteht ein Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit jederzeit und zunächst einmal ohne Interessenabwägung. Das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit erfordert auch bei der Feststellung seines Vorliegens keine Orientierung an der konkreten Person“ (Feuerhelm 1999: 473) Diese „Abkopplung der Justiz von rechtstaatlichen Topi“ (Albrecht 1999: 268) äußert sich im Jugendgerichtsgesetz, als im Vergleich zum allgemeinen Strafrecht noch signifikantere Verschiebung. Im Rahmen einer Änderung des § 88 Abs.2 JGG ist auch hier die „Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit“ als Voraussetzung der Strafaussetzung zur Bewährung aufgenommen wurde. Diese Verschiebung ist alleine darum beachtlich, weil es in dem rechtssystematisch bisher rein spezialpräventiv -‚erzieherisch‘ - ausgerichteten JGG bisher nicht einmal eine Berücksichtigung eines Sicherungsinteresses gab. Da weder im StGB noch im JGG Maßstäbe für die Erfolgswahrscheinlichkeit einer individuellen Prognose angegeben sind – und diese aus wissenschaftlich empirischen Gründen auch realistischerweise nicht angegeben werden können (vgl. 485 Spieß 1993, Feltes 2000c) – ist „das inhaltlich diffuse Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit […] zum dominierenden Faktor geworden107“ (Feuerhelm 1999: 475). Auch in den sogenannten Rosenburg-Papieren (No. 2 /1999: 21) der Bundesakademie für Sicherheitspolitik wird die deutliche Tendenz kritisiert dass „das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit […zunehmend] die Prognoseentscheidung des Richters dominier[t]. Diese Entwicklung […induziert eine] Art Umkehr der Beweislast, denn nunmehr m[uss] der betroffene Straftäter belegen, dass er in Zukunft nicht mehr für die Allgemeinheit gefährlich werde“. In fortgeschritten liberalen ‚Hochkriminalitätsgesellschaften’ so lässt sich zu zusammenfassen ist dem Strafmodernismus des Straf-Wohlfahrtskomplexes die materielle, logistische und ideologische Basis zunehmend entzogen worden. Auch die in den Diversionsprozessen zum Ausdruck kommenden Sanktionsverlagerungen bzw. Momente eines bedingten Sanktionsverzichts sind eng mit den Rationalisierungslogiken des Kriminaljustizsystems verhaftet, und beziehen sich im Sinne eines ‚ökonomischer Abolitionismus’ vor allem auf jene Delikte „which have a low likehood of detection and a low likehood of detection and a low priority for the public in order to conserve resources for those crimes which can be targeted and investigated effectively” (Garland 1996, vgl. JMK 2000). Zugleich werden diese Prozesse durch einen Legitimationsdruck auf die staatlichen Kontrollinstanzen forciert, die sich - um es zu Vermeiden in der Öffentlichkeit als ineffektiv gebrandmarkt zu werden (vgl. Hoffmann-Riem 2000) - im verstärkten Maße entlang den Konjunkturen öffentlicher Aufmerksamkeit über die Kontrollintensität und Verfolgungswürdigkeit von Normbrüchen und Normbrechern entscheiden (vgl. Hoffmann-Riem 2000). Während der Aspekt der Sicherheit dabei an Bedeutung gewinnt aber immer weniger über Integration im Rahmen der wohlfahrtsstaatlichen Mittel hergestellt werden kann oder soll, findet sich eine Tendenz gefährliche, elende und störende Gruppen von ‚NichtDiverierbaren’ auf eine punitive Weise zu ‚sichern’ bzw. ‚auszugrenzen’ (vgl. Lindenberg/SchmidtSemisch 2000: 307), die der Logik nach als das komplementäre Gegenstück der Diversion verstanden werden kann (vgl. Albrecht 1994, 2000). Die hinter diesen Prozessen rekonstruierbare fortgeschritten liberale Kontrollform stellt sich als eine teilweise widersprüchliche, teilweise ‚komplementäre Konkurrenz’ (Lindenberg/Schmidt-Semsich 2000) rechts- und wohlfahrtsstaatlicher Bestände, manageriellen Effizienzkalküle und einem wachsenden populären Autoritarismus auf der symbolischen Ebene dar. Dabei lassen sich steigende Haftraten und eine verstärkte soziale Selektion bei den Inhaftierten nachzeichnen. Der deutlichste ‚Systembruch’ im Feld der Kriminalitätskontrolle besteht aber darin, dass in „‚Hochkriminalitätsgesellschaften’ […] der Mythos vom souveränen Staat, der die Sicherheit eines jeden Bürgers jederzeit zu garantieren vermag, durch die Herausbildung eines vielgestaltigen Kriminalitätsmanagement konterkariert [wird]“ (Beste 2000a). Sukzessive werden in diesem Kontext auch die erzieherischen und therapeutischen Maßnahmen selbst in zu einem Mittel eines auf die effiziente und effektive und Regulation von Risiken und auf die Schutzbedürfnissen der Opfer bzw. ‚der Gesellschaft’ (‚Défense Sociale’) zielenden Diese Rationalität ist durchaus praxisrelevant geworden. So hat z.B. dass Oberlandesgerichts Konstanz ein drastisches Urteil der Basis der „deutliche[n] Verschärfung der Aussetzungsvoraussetzungen“ damit begründete, dass es „in jedem Falle wahrscheinlich sein muss, dass der Verurteilte in Freiheit keine neuen Straftaten mehr begeht“ (in NStZ 1998: 591, Herv. H.Z.) 107 486 Managements reformuliert, während die Repräsentation ‚Täter’ die eines zwar änderungsbedürftigen aber mit Bezug auf seine Tat wie mit Bezug auf seine eigene Besserung selbstverantwortlichen und rationalen - und damit im normativen Sinne auch ‚schuldigen’ - Subjekts ist. Während es der Logik des Straf-Wohlfahrts-Komplexes entspricht auf Standardabweichungen und Defizite der positionaldispositionalen Matrix der Akteure zu reagieren, zielen die Intervention der fortgeschritten liberalen Strafrationalität im Sinne einer ‚hybridization of risk [and] need’ (Hannah-Moffat 2002) darauf, möglichst effektiv unmittelbar tatbezogene Risikofaktoren zu bearbeiten, die sich vermeintlich oder tatsächlich direkt auf die Dispositionen und Verhaltensweisen niederschlagen. Während in Bezug auf die ‚tertiäre Prävention’ kann nach einer Phase des überschießenden Behandlungsoptimismus (vgl. Ludwig-Mayerhofer 2000), die von einer weitverbreiteten Behandlungsskepsis und einem Bewusstsein des Scheiterns abgelöst worden ist (Hughes 2002, Lösel 1993) zwar von einer sicherheitsbezogenen, ‚neo-realistischen’ ‚Revitalisierung’ von Behandlungsansätze gesprochen werden (vgl. Rehn/Wischka 2001, Schneider 2001, Steller et al. 1994), nichtsdestoweniger hat der ‚tertiäre’ Bereich - genauer die strafrechtlichen Bearbeitung von Non-Konformität durch den ‚souveränen Staat’ (vgl. Garland 1996) - im Vergleich zum wohlfahrtsstaatlichen Strafmodernismus gegenüber dem deutlich erstarkten Interesse 108 vorgelagerten prä- und außerjustiziellen Formen der Kontrolle an Bedeutung verloren an (vgl. Albrecht 1983, Sparks 2001, Loader/Sparks 2002, Gilling 1999, Sonderforschungsbereich 227 1994). Der Bedeutungsgewinn dieser Kontrollformen verweist es weniger auf eine Vorverlagerung strafrechtlichen Kontrollrationalitäten. Vielmehr zeichnet sich mit dem gewachsenen Interesse an den Kontrollformen jenseits des formellen, strafjustiziellen Bereichs die Konjunktur veränderter Rationalitäten und ‚Stile’ sozialer Kontrolle ab (vgl. Cohen 1993): „Ist strafrechtliche Kontrolle begrifflich personenbezogen, so sind die neuen Kontrollstile sachlich oder räumlich flächendeckend. Nicht mehr der einzelne Verdächtige ist das Erkenntnis- oder Interventionsobjekt, sondern die Gesamtheit aller x-beliebigen Unbeteiligten innerhalb des überwachten Verkehrsbereichs“ (Frehsee 1999: 17). In Anlehnung an Gilles Deleuze (1993) lässt davon sprechen, dass die Kontrollformen zunehmend weniger auf bestimmte Anlässe bezogen, diskontinuierlich und individualisierend gestaltet sind sondern kontinuierliche, immanente und ‚kybernetische’ Formen angenommen haben. Dabei vollziehen sich die Entwicklungen im Feld der Kriminalitätskontrolle und im Feld des Sozialen in einer relativen Analogie. Für die sozialen Dienste, deren ‚traditionelle’ strafmodernistische Leistungserbringungs- und Subjektrepräsentationsweise im justiziellen Bereich des Feldes der Kriminalitätskontrolle sowohl an Substanz als auch an diskursiver Anschlussfähigkeit verloren haben, finden sich im prä-justizellen Bereich dieses Feldes neue ‚hybride’ Koalitionen von kriminalpräventiven und ‚neo-sozialen’ Strategien, die es in ihrer Gesamtschau erlauben von einer fortgeschritten liberalen Neukalibrierung der ‚Jugendhilfe als Kriminalprävention’ zu sprechen. Diese finden innerhalb einer epochalen Neugestaltung des Feldes der Kriminalitätskontrolle statt „which redresses its prescriptions for action beyond the criminal justice state agencies and to actors and agencies of civil society […]. It reconfigures crime control policy as partnership between the state and the private sector, the state and its citizens, rather than as a state monopoly. It is oriented towards self starting non-state solutions; to 108 Diese Verschiebung dokumentiert auch ein Blick auf die Arbeiten aus dem SFB 227 der Universität Bielefeld. 487 activating citizens and communities; to encouraging private individuals and organizations to take responsibility for crime control” (Garland 2000: 13). Um diese im ‚primären’ und ‚sekundären’ Bereich der Kriminalitätskotrolle mit Blick auf die Jugendhilfe angemessen zu analysieren, bietet es sich an drei faktisch interdependenten Bereiche, die in ihrer Gesamtschau den Kern der ‚neuen‘ Kriminalprävention darstellen (vgl. Hughes 1998) getrennt zu verhandeln: Zunächst findet sich in den pro-aktiven Bereichen des Feldes der Kriminalitätskontrolle ein deutlich erstarktes Interesse an symptom-manageriellen ‚situationalen‘ Präventionsformen in denen der Jugendhilfe jedoch lediglich eine mittelbare, eher untergeordnete Position zukommt (vgl. von Hirsch et al. 2000). ‚Zurück’ ins Zentrum des ‚Kontrollgeschäfts’ kommt die Jugendhilfe im Kontext ‚ressortübergreifender‘ Präventionsstrategien, die vor allem auf lokaler Ebene angesiedelt sind (vgl. Gilling 1999). Schließlich lässt sich eine Konjunktur lokaler bzw. ‚sozialräumlich orientierter’ Formen der ‚Governance’ von Sicherheit und Ordnung feststellen, die sich als eine ‚neo-soziale‘ Kriminalprävention rekonstruieren lässt, in der der Jugendhilfe eine tragende, wenn nicht dominante Rolle zukommt. 488