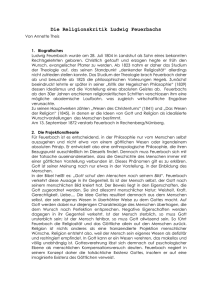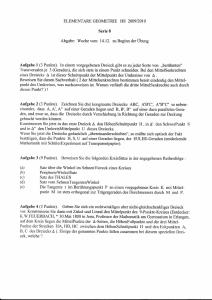Bestrafung
Werbung

Historische und philosophische Grundlagen des Strafrechts Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Pawlik LL.M. WS 2014/15 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Historische und philosophische Grundlagen des Strafrechts § 4: Die negative Generalprävention 2 A. Grundgedanke Anthropologische Grundannahme: Individuen sind zuallererst an ihrem eigenen Nutzen interessiert und verfolgen diesen in rationaler Weise Harscher von Almendingen: „Wäre jeder Staatsbürger ein verkörperter Teufel, existirte in keinem einzigen auch nur das Bewußtseyn übersinnlicher Pflichten […] – so würden dennoch alle Mitglieder dieser Gesellschaft zu coexistiren vermögen.“ Pufendorf: Strafen müssen folglich „so eingerichtet werden, daß sie in ihrer Härte schwerer wiegen als Gewinn und Genuß, den man aus der vom Gesetz verbotenen Tat ziehen könnte“. 3 B. Strafverhängung als Abschreckungsmittel Legitimierbarkeit aus einem Zweck-Mittel-Argument? Zweck: Senkung der Kriminalität als Interesse eines jeden Gesellschaftsmitglieds auch wer seinen Lebensunterhalt durch Straftaten bestreitet, will deren Früchte in Ruhe und Frieden genießen Mittel: Abschreckung als taugliche Strategie der Verbrechensbekämpfung hinreichend große Wahrscheinlichkeit einer Bestrafung wirkt auf tatgeneigte Individuen demotivierend Schlussfolgerung: Wer den Zweck will, muss auch das zu seiner Erreichung taugliche Mittel der Strafe akzeptieren 4 B. Strafverhängung als Abschreckungsmittel Aber: Für den konkreten Täter wäre am günstigsten, wenn lediglich die Normbrüche der übrigen Gesellschaftsmitglieder bestraft würden Strafzufügung im Einzelfall lässt sich nicht auf den Gesichtspunkt des klugen Individualinteresses stützen Dilemma: Wollte man am Topos des klugen Eigeninteresses festhalten, müsste man sich auf die Interessenlage sämtlicher Gesellschaftsmitglieder mit Ausnahme des Verurteilten selbst beschränken Welcker: Täter wird verwendet „wie unbrauchbare Stoffe zur Vogelscheuche“ 5 B. Strafverhängung als Abschreckungsmittel Täter wird also zu einem „sozialhygienischen Präventionsmittel“ degradiert P : Auf diesem Wege lässt sich nur ein Akt der Exklusion begründen, aber keine Rechtsstrafe – denn zu dieser gehört, dass der Täter „nicht zum bloßen Objekt der Verbrechensbekämpfung gemacht werden“ darf (BVerfGE 50, 205 [215]) u. „nicht für vermutete kriminelle Neigungen Dritter büßen muß, sondern nach seiner Tat und seiner Schuld bestraft wird“. (BVerfGE 28, 386 [391]) 6 C. Feuerbachs Variante der Abschreckungstheorie I. Androhungsgeneralprävention Beschränkung des Geltungsanspr. der Präventionslogik auf Bereich der Strafandrohung Rechtsgrund für Strafvollstreckung = konkludente Einwilligung: Jeder, der das Recht hat, Unterlassung bestimmter Handlungen zu fordern, hat auch das Recht, Begehung dieser Handlungen unter eine ihm genehme Bedingung zu stellen Bürger muss sich entw. der Bedingung unterwerfen od. die Handlung unterlassen; begeht er trd. die bedingte Tat, berechtigt er den Staat zur Vollstreckung der angedrohten Strafe 7 C. Feuerbachs Variante der Abschreckungstheorie Aber: Grolman: Allein der Umstand, dass der andere vorab um meine Entschlossenheit weiß, unter bestimmten Bedingungen Zwang anzuwenden, macht meine Reaktion, so sie denn erfolgt, noch nicht zu einer legitimen; entscheidend ist vielmehr die Legitimität der von mir aufgestellten Bedingungen Auch Feuerbach erkennt nicht alle Androhungen an, sondern leitet deren Voraussetzungen aus seiner Abschreckungslehre ab 8 C. Feuerbachs Variante der Abschreckungstheorie II. Feuerbachs Zurechnungslehre 1. Ausgangspunkt Gründe für die Bestrafung müssen sich „aus der Natur des Strafgesetzes und der Strafe ergeben“ Zweck eines Strafgesetzes = Abschreckung von Tatbegehung Gesetzgeber würde dem Begriff des Strafgesetzes widersprechen, wenn er „ein Subject abschrecken wollte, wo keine Abschreckung durch das Recht gedacht werden kann“ 9 C. Feuerbachs Variante der Abschreckungstheorie Vorbild: Kants Karneades-Fall: „die Bedrohung mit einem Übel, was noch ungewiß ist (dem Tode durch den richterlichen Ausspruch) kann die Furcht vor dem Übel, was gewiß ist ([…]Ersaufen), nicht überwiegen“ Zurechnung nach Feuerbach = „Urtheil, daß die Person durch ihren Willen […] Ursache des rechtswidrigen Factums sey und daß die psychologischen Bedingungen vorhanden waren, unter welchen die mögliche Abschreckung durch das Strafgesetz begründet war“ 10 C. Feuerbachs Variante der Abschreckungstheorie Hintergrund: Freihaltung des Strafrechts von philosophischen „Anmaßungen“ Aber: Dass das Strafgesetz seiner Natur nach ein Instrument der Abschreckung sei, stellt selbst eine philosophische Prämisse dar Warum sollte dies keine „Anmaßung“ sein? 11 C. Feuerbachs Variante der Abschreckungstheorie Feuerbach will dem Begriff der Willensfreiheit jegliche Relevanz für die strafrechtl. Zurechnung absprechen Nicht der freie, sondern der bestimmbare, der Natur unterworfene Mensch sei es, auf den sich die Strafgewalt beziehe, „auf den sie wirken, den sie bestrafen will, auf den sie wirken, den sie bürgerlich bestrafen kann“ Gründe ausgeschlossener Zurechenbarkeit = Fälle ausgeschlossener Abschreckbarkeit Wirksamkeitsgrenzen der Abschreckung = Geltungsgrenzen der Strafgesetze 12 C. Feuerbachs Variante der Abschreckungstheorie 2. Voraussetzungen für die Abschreckungswirkung Betreffende Person muss sich über die Strafbarkeit der von ihr ins Auge gefassten Tat im Klaren sein wer nicht weiß, dass sein Verhalten verboten ist, wird sich bei seinem Handlungsentschlusses durch die Strafdrohung nicht beeinflussen lassen Betreffende Person muss sich in einer äußeren und inneren Lage befinden, in der es ihr möglich ist, dieses Wissen handlungswirksam werden zu lassen Zurechnungsausschluss nur bei strikt psychologisierend verstandenem Unvermögen 13 C. Feuerbachs Variante der Abschreckungstheorie a) Aufhebung der Möglichkeit des Bewusstseins der Strafbarkeit Jugendliches Alter Unwissenheit über rechtl. Beschaffenheit menschl. Handlungen (zB Taubstummheit, Aufwachsen außerhalb menschl. Gesellsch.) Blödsinnigkeit Geistes-/Gemütskrankheiten (zB Raserei, Melancholie,Wahnsinn) Unverschuldeter vorübergehender Zustand des gänzlich aufgehobenen Verstandesgebrauchs (zB gerechter höchster Zorn, unverschuldete höchste Trunkenheit, Nachtwandeln) Unüberwindlicher Irrtum über Rechtswidrigkeit od. Gefährlichkeit der Handlung 14 C. Feuerbachs Variante der Abschreckungstheorie Bedenklichkeit von Feuerbachs Ansatz Zustimmungswürdig: Zurechnungsausschluss dort, wo Defizite des Täters so groß sind, dass er Verbotenheit seines Handelns nicht erkennen konnte P : Folge für Täter, deren geistige Fähigkeit zu dieser Erkenntnis gerade noch ausreichend war? Wenn Strafe = Vorwurf: geringere Strafe als für Täter mit normalen intellektuellen Fähigkeiten Feuerbach: „natürliche Schwäche und Stumpfheit der höhern Geisteskräfte“ steigern die Gefährlichkeit höhere Strafe 15 C. Feuerbachs Variante der Abschreckungstheorie Ernst Ferdinand Klein: Nach Feuerbach ist also „die Zuchtruthe um so größer [zu binden], je kleiner das Kind ist, welches gezüchtigt werden soll“ Fazit: Feuerbachs Willensfreiheitspostulat ist unvereinbar mit dem Schuldprinzip Abschreckungsstrafrecht = reines Disziplinierungsinstrument 16 C. Feuerbachs Variante der Abschreckungstheorie b) Aufhebung der Wirksamkeit der Strafdrohung auf das Begehren Übertretung „ohne alles Zuthun des Willens“ (zB vis absoluta) andere Gründe: • „vorhandene[r] Qualen, welchen gewöhnliche menschliche Standhaftigkeit nicht gewachsen ist“, wenn Tat = einziges Mittel zur Qualbeseitigung (zB Diebstahl von Esswaren in rechter Hungersnot) • „bei gegenwärtiger dringender Gefahr für das Leben oder für ein anderes, unersetzliches persönliches Gut“, wenn Tat = „einziges Mittel der Rettung“ 17 C. Feuerbachs Variante der Abschreckungstheorie Begründungsthese: rechtmäßiges Verhalten wäre in solchen Situationen jedermann od. jedenfalls diesem konkreten Täterindividuum psychisch unmöglich P :Folgebehauptung, dass den Menschen generell eine unwiderstehliche psychische Disposition eigen sei, sich um jeden Preis vor der Gefahr des eigenen Unterganges zu retten = empirisch unhaltbar Behauptung, dass zumindest dieser konkrete Täter dem Druck der Notlage nicht gewachsen sei, lässt sich nur auf die von ihm begangene Tat stützen ist aber bei jedem bewusst rechtswidrigen Verhalten der Fall! Folge: Zurechenbarkeit generell (-) 18 C. Feuerbachs Variante der Abschreckungstheorie Dies lässt sich nur vermeiden durch normativ begründete Abstufungen, wonach nicht die psychische Unmöglichkeit der Normbefolgung, sondern ihre Unzumutbarkeit die Zurechnungsunterbrechung legitimiert Derart ansetzende Differenzierungen haben in Feuerbachs streng psychologisch ausgerichteten System aber keinen Platz 19 C. Feuerbachs Variante der Abschreckungstheorie III. Konsequenzen des Abschreckungsgedankens für die Strafzumessung Ausmaß des drohenden Schadens spielt in einem auf die Neutralisierung der verbrecherischen Neigungen der Bürger zugeschnitten System keine Rolle Thibaut: „Eine Handlung sey daher noch so gemeinschädlich und verderblich, als sie wolle, wenn geringe Antriebe zu derselben reitzen, so ist sie nicht härter zu strafen, als nöthig ist um diesen Reitz zu heben.“ 20 D. Johann Gottlieb Fichte – Exklusion und Abbüßung I. Die mechanische Notwendigkeit des Strafzwanges Strikte Beschränkung des Rechts auf die Sphäre äußerer Freiheit [„Nur durch Handlungen, Äußerungen ihrer Freiheit, in der Sinnenwelt, kommen vernünftige Wesen in Wechselwirkung miteinander: der Begriff des Rechts bezieht sich sonach nur auf das, was in der Sinnenwelt sich äußert“] Ausgangsfrage: Wie ist eine Gemeinschaft freier Wesen, ein beständiges „Beisammenstehen der Freiheit mehrerer“ möglich? 21 D. Johann Gottlieb Fichte – Exklusion und Abbüßung „[J]edes freie Wesen [müsse] es sich zum Gesetz mache[n], seine Freiheit durch den Begriff der Freiheit aller übrigen einzuschränken“ Folglich habe jeder „das Recht zu wollen, daß von der Seite des anderen nur diejenigen Handlungen erfolgen, welche erfolgen würden, wenn derselbe einen durchgängig guten Willen hätte“ zwar kein rechtl. Anspr. auf Moralität des anderen, aber Forderung an den Staat, Vorkehrungen zu treffen, die den Willen des anderen dazu nötigten, „nichts zu wollen, als was mit der gesetzmäßigen Freiheit bestehen kann“ 22 D. Johann Gottlieb Fichte – Exklusion und Abbüßung Wg. Selbstliebe des Bürgers kann der Staat ein Rechtszwangsregime einrichten, das kraft seiner Sanktionsdrohungen bewirkt, dass jeder „die Rechte anderer ungekränkt lasse, indem jeder, was er dem anderen übles zufügt, sich selbst zufügt“ guter Wille = entbehrlich für Verwirklichung des Rechts Strafe ≠ absoluter Zweck (anders als bei Kant) , sondern bloßes „Mittel für den Endzweck des Staats, die öffentliche Sicherheit“ Funktionsprinzip: Strafandrohung = hinreichend starkes Gegenmotiv zum ungerechten Willen Folge: Abstandnahme von Straftaten 23 D. Johann Gottlieb Fichte – Exklusion und Abbüßung II. Die Strafe als Rechtswohltat Begangene Straftat = Beleg für das Versagen des Abschreckungskonzepts (zumindest im konkreten Fall) Behandlung von Verbrechern? Fichte: Bürger schließen untereinander u. mit dem Staat einen Vertrag, der ihr „Eigentum“ unter rechtl. Schutz stellt wer diesen Bürgervertrag verletzt (willentlich od. aus Unachtsamkeit), verliert „seine Rechte als Bürger, und als Mensch, und wird völlig rechtlos“ („erklärt für eine Sache, ein Stück Vieh“) Vogelfreiheit 24 D. Johann Gottlieb Fichte – Exklusion und Abbüßung Argumentation Fichtes: Bedingung der Rechtsfähigkeit: der einzelne muss in eine Gemeinschaft vernünftiger Wesen passen, dh sich das Recht zum unverbrüchlichen Gesetz aller seiner Handlungen gemacht haben Zuwiderhandlung gegen das Gesetz = Verstoß gegen diese Bedingung Folge: Wegfall des Bedingten: der Rechtsfähigkeit Konsequenz der Argumentation: Wenn jede Rechtsverletzung Bürgervertragsbruch darstellt, müsste dies auch für zivilrechtl. Vertragsbrüche gelten Vogelfreiheit wäre alltägl. Zustand/Massenschicksal 25 D. Johann Gottlieb Fichte – Exklusion und Abbüßung Fichtes Abmilderung seiner Exklusionsthese: Für Staat u. Bürger zweckmäßig, dass nicht jeder um jedes Vergehens willen für rechtlos erklärt wird Rückgriff auf milderes Mittel Rechtliche Verbindlichkeit erst durch Vertrag aller mit allen („Abbüßungsvertrag“) Umdeutung der Strafe vom Übel zur „Rechtswohltat“ Abbüßungsvertrag nutzt nicht nur Staatsganzem, sondern auch Einzelnem („Verlust des Ganzen“ wird durch „Verlust eines Teiles“ ersetzt) Daher: „freie Unterwerfung“unter die Strafe keine Instrumentalisierung: volenti non fit iniuria 26 D. Johann Gottlieb Fichte – Exklusion und Abbüßung Fazit: Fichtes Argumentation hängt daran, dass Vollzug der bei Nichtzustimmung in Aussicht gestellten Exklusion philosophisch gerechtfertigt wäre Exklusion wäre aber Überreaktion, würde also Leiden des Betroffenen über das Maß des Erforderlichen hinaus vermehren Drohung mit ihr = unzulässige Nötigung (unterstellte) Zustimmung = unwirksam Nichtgreifen des volenti-Grds. kantischer Instrumentalisierungsvorwurf 27 E. Arthur Schopenhauer – Abschreckung zwischen Fichte und Feuerbach I. Strafandrohung als Gegenmotiv zu verbrecherischen Neigungen Ausgangspunkt: Akteure = kluge Egoisten Da jeder von ihnen zu befürchten habe, dass ihm im außerstaatl. Zustand „viel seltener der Genuß des gelegentlichen Unrechtthuns, als der Schmerz des Unrechtleidens zu Theil werden würde“, einigen sie sich darauf, durch Staatsgründung „Allen den Schmerz des Unrechtleidens zu ersparen, dadurch, daß auch Alle dem durch das Unrechtthun zu erlangenden Genuß entsagen“ 28 E. Arthur Schopenhauer – Abschreckung zwischen Fichte und Feuerbach Staatl. Instanzen beabsichtigen nicht, „die böse Gesinnung zu vertilgen, sondern bloß jedem möglichen Motiv zu Ausübung eines Unrechts immer ein überwiegendes Motiv zur Unterlassung desselben, in der unausbleiblichen Strafe, an die Seite zu stellen“ StGB = „möglichst vollständiges Register von Gegenmotiven zu sämmtlichen, als möglich präsumirten, verbrecherischen Handlungen“ alleiniger Zweck des StGB = Abschreckung deliktsgeneigter Bürger 29 E. Arthur Schopenhauer – Abschreckung zwischen Fichte und Feuerbach II. Staatsvertragliche Legitimation der Strafverhängung? Folge einer Straftatbegehung? strikte Vollziehung des Gesetzes (ansonsten würde es beabsichtige Abschreckungswirkung auch in zukünftigen Fällen verfehlen) Dadurch Instrumentalisierung des Verbrechers? Verbrecher sei tatsächlich „bloß der Stoff, an dem die Tat gestraft wird“, allerdings aus gutem Grunde: 30 E. Arthur Schopenhauer – Abschreckung zwischen Fichte und Feuerbach „Denn die öffentliche Sicherheit, der Hauptzweck des Staats, ist durch ihn gestört, ja sie ist aufgehoben, wenn das Gesetz unerfüllt bleibt: er, sein Leben, seine Person, muß jetzt das Mittel zur Erfüllung des Gesetzes und dadurch zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit seyn, und wird zu solchem gemacht mit allem Recht, zur Vollziehung des Staatsvertrages, der auch von ihm, sofern er Staatsbürger war, eingegangen war, und demzufolge er, um Sicherheit für sein Leben, seine Freiheit und sein Eigenthum zu genießen, auch der Sicherheit Aller sein Leben, seine Freiheit und sein Eigenthum zum Pfande gesetzt hatte, welches Pfand jetzt verfallen ist.“ 31 E. Arthur Schopenhauer – Abschreckung zwischen Fichte und Feuerbach P : Sind kluge Egoisten intellektuell u. motivational fähig, Verpflichtungen auch für den Fall zu übernehmen, dass diese sich für sie als schlechtes Geschäft entpuppen? Thomas Hobbes: einerseits: außerordentl. weitreichende gesellschaftsvertragl. Bindung, andererseits: Naturzustandsbewohner = kluge Wahrer ihres individuellen Selbsterhaltungsinteresses bzgl. Todesstrafe (= Konflikt zw. staatl. Maßnahmen u. Selbsterhaltungsinteresse): Verurteilter befindet sich im Naturzustand alle Mittel zur Lebensrettung erlaubt 32 E. Arthur Schopenhauer – Abschreckung zwischen Fichte und Feuerbach Kluger Eigennutz = prägendes Moment der gesamten Motivationsstruktur des Menschen Befangenheit in Nützlichkeitsdenken Unfähigkeit zu einschränkungslosen Selbstbindungen Spinoza: Fällt die Nützlichkeit weg, „so wird auch der Vertrag hinfällig und verliert seine Gültigkeit“. Genereller Vorbehalt bei Verträgen: Vertragsbruch im Einzelfall nicht lohnender als Vertragsbefolgung Je härter die verhängten Strafen, desto schwieriger ist Vertragsbegründung aufrechtzuerhalten Legitimationschancen umgekehrt proportional zum Legitimationsbedarf 33