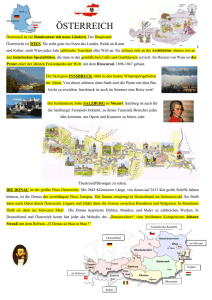GK100010 Zentralzone Donau [DBJ]
Werbung
![GK100010 Zentralzone Donau [DBJ]](http://s1.studylibde.com/store/data/005942641_1-97db50aff973a6aa58b054d7466ef74b-768x994.png)
Donau (inkl. Elbe) / Donau bis Jochenstein / Grundwasser Hydrogeologische Charakterisierung 579859962 GK100010 ZENTRALZONE DONAU [DBJ] 1 KLUFTGRUNDWASSERKÖRPER Die Kluftgrundwasserkörper der Zentralzone sind geologisch sehr heterogen aufgebaut und umfassen tektonisch alle alpinen Bauelemente vom Penninikum über das Unter- und Mittelostalpin bis in das Oberostalpin. Zentralzone Donau, westlicher Tiroler Anteil (obere Abb.), östlicher Tiroler Anteil (untere Abb.): Es handelt sich in Nordtirol um die Zone südlich des Stanzer Tales und des Inntales, östlich von etwa Wörgl südlich des Kaisergebirges und seiner Ostfortsetzung. Rot: Kluftgrundwasserleiter der Zentralzone (Gneise, Granite, etc.) Blau: gering durchlässige Kluftaquifere der Zentralzone (Glimmerschiefer, etc.) Ocker: paläozoische und mesozoische Karstgrundwasserkörper der Zentralzone. Abbildung nicht maßstäblich. Im Einzelnen handelt es sich um: Altkristallin des Tauernfensters (Penninikum): paläozoische Ortho- und Parakristallingesteine. Gesteine der Unteren und Oberen Schieferhülle, sowie des Engadiner Fensters: Abfolge der Bündner Schiefer (im Wesentlichen mesozoische Sedimentgesteine). paläozoisches Altkristallin der Ötz-Silvretta-Masse einschließlich Patscherkofel-GlungezerAltkristallin, sowie des Defreggen-Schober-Altkristallins einschließlich des Rensengranits und des Rieserferner Tonalits (Tertiär); weiters Altkristallin des Kellerjochgneises und der Phyllitgneisdecke. Alle diese Kluftgrundwasserkörper gehören dem Mittelostalpin an. Der Osttiroler Anteil wird bei der Zentralzone Drau (DRA) – Tiroler Anteil näher beschrieben (siehe dort). Seite 1 von 6 Donau (inkl. Elbe) / Donau bis Jochenstein / Grundwasser Hydrogeologische Charakterisierung 579859962 paläozoische unterostalpine Quarzphyllitareale des Innsbrucker sowie Landecker Quarzphyllits einschließlich seiner phyllonitischen Serien, sowie der oberostalpine Steinacher Quarzphyllit. paläozoische Wildschönauer Schiefer der oberostalpinen Grauwackenzone. Wichtige Quellen: 1.1 Brunauquelle Haiming: Ötz-Silvretta-Kristallin Ochsenbrunnquelle St. Leonhard im Pitztal: Ötz-Silvretta-Kristallin Quellen im Bereich der Lareinalm (Lareintalquellen):Ötz-Silvretta-Kristallin. Kurzbeschreibung der einzelnen Kluftgrundwasserkörper Die Kristallingesteine (Granite, Gneise, etc.) weisen überwiegend eher weitständige Trennflächen auf, die teilweise das Gebirge tiefgründig und großflächig zerlegen. Teilweise ist damit zu rechnen, dass die Trennflächen mehrere Kilometer in die Tiefe reichen. Vereinzelt wurden aus derartigen Tiefen bereits höher mineralisierte Thermalwässer erbohrt (z.B. Längenfeld). Ähnlich dem Engadiner Lineament finden sich auch entlang der so genannten Brenner-Überschiebung (fälschlich auch als Abschiebung gedeutet), Quellen aus größerer Tiefe der Erdkruste, deren Herkunft vermutlich die Kluftgrundwässer des Kristallins des Tauernfensters sind (z.B. radioaktive Felperquelle). Auch die radonhältigen Kluftgrundwässer im Raum Umhausen/Ötztal stammen aus großer Tiefe. Sie sind einerseits an bestimmte Gesteine (Augengneise) gebunden, andererseits an tiefgreifende Trennflächen im Kristallingestein. Im Falle von stärkerer Verschieferung (z.B. Gneisige Glimmerschiefer) überwiegen die Schieferungsflächen als Trennflächen im Gebirge – somit ist eine schlechtere Wasserwegigkeit gegeben, teilweise werden derartige Gesteinsserien zu Wasserstauern. Die Gesteinsabfolgen der Bündner Schiefer sind, so weit es sich nicht um überwiegend karbonatische Serien handelt, durch ihren Reichtum an tonig-schiefrigen bis phyllitisch-gneisigen Gesteinen zu den Kluftgrundwasserleitern zu zählen. Zum Teil reiche Gipsführung führt gebietsweise zu teils relativ deutlicher Sulfatführung von Grundwässern. Viele Quellen in den Bündner Schiefern halten sich an fossile Talniveaus, weiters an die Ausstrichlinien von zum Teil tiefgründigen bis seichten Massenbewegungen, sowie an den Wechsel von wasserstauenden und wasserwegigen Gesteinsabfolgen. Die Quarzphyllitareale bestehen aus einer reichhaltigen Abfolge von überwiegend metamorphen Sedimentgesteinen, in die allerdings auch magmatische Gesteine eingelagert sind. Die im Allgemeinen sehr glimmerreichen Gesteinsserien weisen phyllitischen bis schiefrigen Habitus auf und stellen so im Wesentlichen keine sehr ausgeprägten Kluftgesteinsaquifere dar. Die Hauptwasserwege und die meisten Quellhorizonte in den Quarzphyllitarealen halten sich an die Ausstrichlinien von Bewegungsbahnen von mehr oder weniger ausgedehnten und seichten bis tiefgründigen Massenbewegungen. Im Bereich von Nösslach finden sich Ablagerungen karbonen Alters mit Kohleflözen. Seite 2 von 6 Donau (inkl. Elbe) / Donau bis Jochenstein / Grundwasser Hydrogeologische Charakterisierung 579859962 Die paläozoischen Gesteine der Wildschönauer Schiefer bestehen überwiegend aus Tonschiefer- bzw. Mergelabfolgen, in die auch teils gneisige magmatische Abfolgen eingelagert sein können. Die Grundwasserverhältnisse ähneln in etwa jenen der Quarzphyllitareale. 1.2 Zusätzliche Anmerkungen: Auf Grund der Gesteinszusammensetzung und der damit einhergehenden Art und Weise der Zerlegung des Festgesteinsverbandes durch Trennflächen ist davon auszugehen, dass einheitliche und ausgedehnte Grundwasserkörper vorwiegend in den magmatischen Gesteinsserien mit gneisigem bis granitischem Habitus anzunehmen sind. Großteils dürfte im Rest der Gesteine davon auszugehen sein, dass schwebende Grundwasserkörper lokaler Ausdehnung vorherrschen, bzw. dass die Grundwässer nur seicht unter Geländeoberkante liegen, vor allem wenn sie an Massenbewegungen gebunden sind. In den Gesteinsserien, die nicht gneisig oder granitisch sind, muss weiters davon ausgegangen werden, dass große Untergrundsbereiche von trockenen Gebirgsbereichen gekennzeichnet sind. 2 GRUPPE DER PALÄOZOISCHEN UND DER MESOZOISCHEN KARSTGRUNDWASSERKÖRPER (TE100002): Die Karstgrundwasserkörper der Zentralzone sind geologisch ebenfalls heterogen aufgebaut und umfassen tektonisch alle alpinen Bauelemente vom Penninikum über das Unter- und Mittelostalpin bis in das Oberostalpin. Im Einzelnen handelt es sich um: (permo)mesozoische Sedimentgesteine des Unterostalpins der Tarntaler Zone und der Matreier Schuppenzone und deren Äquivalente (z.B. Kalkstein-Trias) (permo)mesozoische Sedimentgesteine des Mittelostalpins des Brenner-Mesozoikums einschließlich der Nockspitz-Triasabfolgen (untergeordnet fragliches Oberostalpin) sowie oberostalpine mesozoische Deckschollen der Blaser-Decke. mesozoische Abfolgen des Oberostalpins (Gaisberg-Trias) und Trias südlich des Inn (permo)mesozoische Sedimentgesteine fraglicher tektonischer Einstufung (Unter- Mittel- und/oder Oberostalpin) im Bereich des penninischen Engadiner Fensters und unweit nördlich davon. paläozoische karbonatischen Sedimentgesteine der oberostalpinen Grauwackenzone (Schwazer Dolomit und Spielbergdolomit). (permo)mesozoische Sedimentgesteine der penninischen Schieferhülle und des penninischen Engadiner Fensters, sowie des Randes des Tauernfensters (dort fraglich Unterostalpin). mehr oder weniger mächtige karbonatische Einschaltungen im Innsbrucker Quarzphyllit paläozoischen oder jüngeren (=mesozoischen) Alters. Wichtige Quellen: Schreiender Brunnen (Spielbergdolomit) Seite 3 von 6 Donau (inkl. Elbe) / Donau bis Jochenstein / Grundwasser Hydrogeologische Charakterisierung 579859962 2.1 Reintalquellen (St. Johann) (Spielbergdolomit) Klaushofquellen (Gemeinde Mieders) (mittelostalpines Brenner-Mesozoikum) Kurzbeschreibung der einzelnen Karstgrundwasserkörper: Die paläozoischen Karbonatgesteine sind vielfach durch ausgeprägte Verkarstung gekennzeichnet. Dabei handelt es sich großteils um sehr alte Verkarstungssysteme (Paläokarst), an die sich die Wasserwege der Karstgrundwässer halten. Beispiel für Quellen aus derartigen Karstgrundwasservorkommen ist der „Schreiende Brunnen“. Die Reintalquellen, die der Gemeinde St. Johann in Tirol als Trinkwasserversorgung dienen, entspringen aus einem Karstgrundwasserkörper, dessen Verkarstung wesentlich jünger ist. Die unterostalpinen, mittel- und oberostalpinen (permo)mesozoischen Sedimentgesteinsabfolgen sind durch zum Teil mächtige Karbonatgesteinsserien mit dazwischen geschalteten Tonschiefern gekennzeichnet. Soferne nicht tektonische Trennflächen derartige Tonschiefer- und Mergellagen durchschlagen, können diese als wasserstauend angesehen werden. Die Karbonate sind – abgesehen von den oberostalpinen Karbonaten – allesamt mehr oder weniger deutlich metamorph und daher mehr oder weniger deutlich marmorisiert. Dies begünstigt die Verkarstungsprozesse. Vor allem die mittelostalpinen Karbonatgesteine des Brenner-Mesozoikums weisen überwiegend flache Schichtlagerung auf, was zusätzlich Verkarstungsprozesse fördert. Quellen treten entweder entlang von meist karstartig erweiterten Wasserwegen oder am Übergang wasserdurchlässiger Gesteine zu den gering durchlässigen (stauenden) Gesteinen oder im Bereich alter, also fossiler Talniveaus auf. Innerhalb der penninischen mesozoischen Bündner Schiefer treten auch Gesteinsabfolgen reich an Karbonaten auf, die als Karstwasserleiter angesehen werden können. Eine eindeutige Abgrenzung von den Kluftgrundwasserleitern der Bündner Schiefer dürfte nicht in jedem Fall gelingen. Vor allem erwähnenswert sind die zum Teil mächtigen Gips-Anhydritvorkommen permomesozoischen Alters im Bereich des Engadiner Fensters und im Bereich seines Rahmens, in deren Bereichen es zu deutlichen Verkarstungsprozessen kommen kann. Anzeichen von Gipskarst finden sich immer wieder im Gelände (z.B. Pingen). Relativ zahlreich finden sich Sulfatquellen und auch höher temperierte Grund- und Quellwässer an derartige Gesteinsvorkommen, zum Teil in Verbindung mit tiefgreifenden tektonischen Trennflächen (z.B. Engadiner Lineament) gebunden. Auch im Bereich des Rahmens des Tauernfensters gibt es teils mächtige Gips- Anhydritvorkommen unterostalpiner oder penninischer Herkunft. Auch hier finden sich sulfathältige Quellwässer, wie der Bereich Matrei am Brenner-Navistal zeigt. Die zum Teil mächtigen und vielfach stark marmorisierten Karbonate innerhalb des Innsbrucker Quarzphyllits können lokal Karstgrundwässer beherbergen. 2.2 Zusätzliche Anmerkungen: Auf Grund der relativ großen horizontalen und vertikalen Ausdehnung der Karbonatgesteinsvorkommen des Brenner-Mesozoikums stellt dieses sicherlich innerhalb der Karstgrundwasserkörper der Gruppe von Grundwasserkörpern der Zentralzone ein bedeutendes Karstgrundwasservorkommen dar. Begünstigt wird die hydrogeologische Bedeutung dieser Karbonatgesteine auch durch deren flache Lagerung und durch die überwiegend flach muldenförmig gebogene Auflage auf dem geringer durchlässigen Gesteinsuntergrund Seite 4 von 6 Donau (inkl. Elbe) / Donau bis Jochenstein / Grundwasser Hydrogeologische Charakterisierung 579859962 des Ötz-Silvretta-Kristallins, das im Verhältnis zu den Karbonatgesteinen einen relativen Wasserstauer darstellt. Eine der bedeutendsten Quellen ist die Klaushofquelle in der Gemeinde Mieders im Stubaital. Den zweiten bedeutenden Karstgrundwasserbereich der Zentralzone stellen die paläozoischen Dolomite Schwazer Dolomit und Spielbergdolomit dar. Quellen wie die „Schreienden Brunnen“ und die Reintalquellen sind sichtbarer Ausdruck dieser Bedeutung. Insgesamt sind die Karstgrundwasservorkommen innerhalb der Zentralzone zwar flächenmäßig wesentlich geringer als die Kluftgrundwasservorkommen, ihre wasserwirtschaftliche Bedeutung liegt jedoch weit über der der Kluftgrundwasservorkommen. Auf Grund der meist relativ ausgeprägten Verkarstung sind die Verweilzeiten der Wässer im Untergrund als relativ gering anzunehmen. 2.3 Grundwassererschließungen durch Stollen und Tunnel (gilt für 1. Kluftgrundwasserkörper und 2. Gruppe der paläozoischen und der mesozoischen Karstgrundwasserkörper): Im Tauernfenster, seinen Hüllschiefern, sowie im Engadiner Fenster und den Kristallingebieten der ÖtzStubaier Masse wurden seit dem 2. Weltkrieg zahlreiche Kraftwerksstollen vorgetrieben, die immer wieder deutlich Grundwasserzutritte aufweisen. Dies gilt in etwas geringerer Intensität auch bei dem Stollen für die Standseilbahn (Pitz-Express) und beim Landecker Tunnel, sowie dem Tunnel der ÖBB-Umfahrung Innsbruck. Die Drainagewirkung des derzeit im Bau befindlichen Strenger Tunnels der ArlbergSchnellstraße, sowie die beiden Verkehrstunnel durch den Arlberg sind vergleichsweise gering, was zeigt, dass das Gebirge vor allem im Bereich des Landecker Quarzphyllits relativ dicht ist. Vor allem die Bergbautätigkeit in den paläozoischen Dolomitgesteinsvorkommen hat seit Jahrhunderten große Gebirgsbereiche drainiert. Beispiel hierfür ist vor allem der Schwazer Bergbau – aus dem Wilhelm Erb-Stollen tritt eine vergleichsweise große Menge an Berg- bzw. Karstgrundwässern aus. Im Brenner Mesozoikum wurde der Stollen des ÖBB-Kraftwerkes bei Fulpmes in Karbonate des BrennerMesozoikums vorgetrieben. Er zieht Karstgrundwässer in beträchtlicher Menge ein. Zur Stabilisierung von Hangbereichen entlang der A-13 Brenner-Autobahn wurden in die dortigen GipsAnhydritabfolgen Entwässerungsstollen vorgetrieben. Im Engadiner Fenster bei Prutz gibt es Stollen der TIWAG, die den karbonatreichen und gipsführenden Bündner Schiefern Grundwasser entziehen. Die oberostalpine Zone der Trias südlich des Inn ist vor allem durch die Tunnelvortriebe des Rattenberger Umfahrungstunnels und des Sondierstollens der Brenner-Eisenbahngesellschaft (Stollen Radfeld-Brixlegg) hinsichtlich der Ausleitung von Grundwässern aus den karbonatischen Festgesteinen gekennzeichnet. 3 PORENGRUNDWASSERKÖRPER: Innerhalb der Zentralzone finden sich vergleichsweise wenige Porengrundwasservorkommen. Sie sind im Wesentlichen auf die Täler beschränkt. Seite 5 von 6 Donau (inkl. Elbe) / Donau bis Jochenstein / Grundwasser Hydrogeologische Charakterisierung 579859962 Oberes Oberinntal, Stanzertal, Paznauntal, Kaunertal, Pitztal und das innere Ötztal verfügen über keine nennenswerten Porengrundwässer. Im Ötztal ist eine gewisse Porengrundwasserführung in den Becken von Längenfeld, Umhausen und Ötz bekannt. Im äußeren Ötztal nördlich des Bergsturzes von Köfels-Umhausen ist ein bis über 100 m mächtiger Grundwasserkörper in gut bis sehr gut durchlässigen Lockersedimenten ohne dichtende Deckschichten. Das Stubaital weist keine nennenswerten Porengrundwässer auf. Dies gilt auch für das Sill- bzw. Wipptal und seine Seitentäler, sowie für das Brixental. Ein weiterer größerer Porengrundwasserkörper in Tirol bzw. in der Zentralzone Donau (DBJ) ist das Zillertal (TE100001 – Beschreibung siehe Datenblatt). Dieser Porengrundwasser-körper weist keine große Ergiebigkeit auf, Deckschichten sind teilweise vorhandenen. Die Mächtigkeit des Grundwasserleiters ist nicht bekannt. Dies gilt auch für das Tal der Großache, so weit es in der Zentralzone liegt. Dieses Vorkommen wird gesondert beschrieben (siehe Großache (DBJ)). 3.1 Zusätzliche Anmerkung: Die Porengrundwasservorkommen innerhalb der Zentralzone sind nur von lokaler Bedeutung. Seite 6 von 6