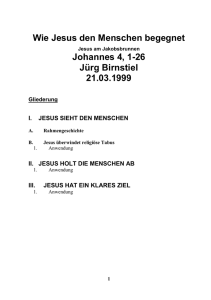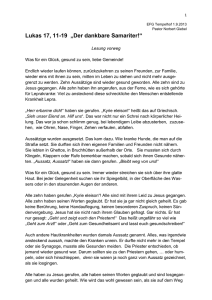Klaus Koch
Werbung
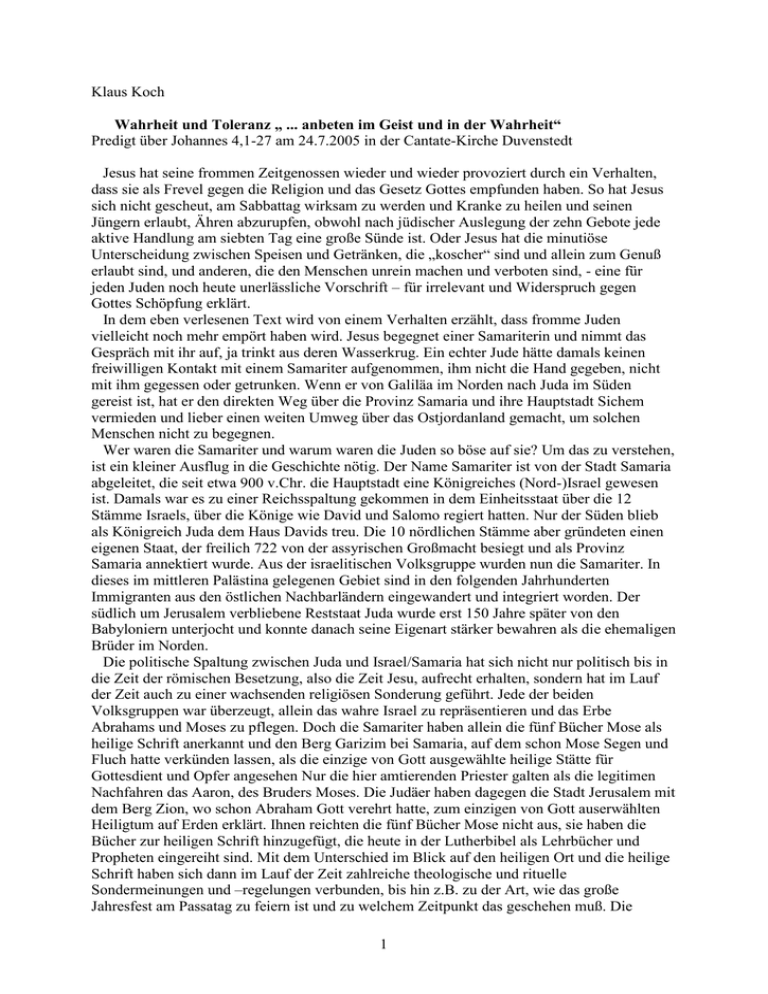
Klaus Koch Wahrheit und Toleranz „ ... anbeten im Geist und in der Wahrheit“ Predigt über Johannes 4,1-27 am 24.7.2005 in der Cantate-Kirche Duvenstedt Jesus hat seine frommen Zeitgenossen wieder und wieder provoziert durch ein Verhalten, dass sie als Frevel gegen die Religion und das Gesetz Gottes empfunden haben. So hat Jesus sich nicht gescheut, am Sabbattag wirksam zu werden und Kranke zu heilen und seinen Jüngern erlaubt, Ähren abzurupfen, obwohl nach jüdischer Auslegung der zehn Gebote jede aktive Handlung am siebten Tag eine große Sünde ist. Oder Jesus hat die minutiöse Unterscheidung zwischen Speisen und Getränken, die „koscher“ sind und allein zum Genuß erlaubt sind, und anderen, die den Menschen unrein machen und verboten sind, - eine für jeden Juden noch heute unerlässliche Vorschrift – für irrelevant und Widerspruch gegen Gottes Schöpfung erklärt. In dem eben verlesenen Text wird von einem Verhalten erzählt, dass fromme Juden vielleicht noch mehr empört haben wird. Jesus begegnet einer Samariterin und nimmt das Gespräch mit ihr auf, ja trinkt aus deren Wasserkrug. Ein echter Jude hätte damals keinen freiwilligen Kontakt mit einem Samariter aufgenommen, ihm nicht die Hand gegeben, nicht mit ihm gegessen oder getrunken. Wenn er von Galiläa im Norden nach Juda im Süden gereist ist, hat er den direkten Weg über die Provinz Samaria und ihre Hauptstadt Sichem vermieden und lieber einen weiten Umweg über das Ostjordanland gemacht, um solchen Menschen nicht zu begegnen. Wer waren die Samariter und warum waren die Juden so böse auf sie? Um das zu verstehen, ist ein kleiner Ausflug in die Geschichte nötig. Der Name Samariter ist von der Stadt Samaria abgeleitet, die seit etwa 900 v.Chr. die Hauptstadt eine Königreiches (Nord-)Israel gewesen ist. Damals war es zu einer Reichsspaltung gekommen in dem Einheitsstaat über die 12 Stämme Israels, über die Könige wie David und Salomo regiert hatten. Nur der Süden blieb als Königreich Juda dem Haus Davids treu. Die 10 nördlichen Stämme aber gründeten einen eigenen Staat, der freilich 722 von der assyrischen Großmacht besiegt und als Provinz Samaria annektiert wurde. Aus der israelitischen Volksgruppe wurden nun die Samariter. In dieses im mittleren Palästina gelegenen Gebiet sind in den folgenden Jahrhunderten Immigranten aus den östlichen Nachbarländern eingewandert und integriert worden. Der südlich um Jerusalem verbliebene Reststaat Juda wurde erst 150 Jahre später von den Babyloniern unterjocht und konnte danach seine Eigenart stärker bewahren als die ehemaligen Brüder im Norden. Die politische Spaltung zwischen Juda und Israel/Samaria hat sich nicht nur politisch bis in die Zeit der römischen Besetzung, also die Zeit Jesu, aufrecht erhalten, sondern hat im Lauf der Zeit auch zu einer wachsenden religiösen Sonderung geführt. Jede der beiden Volksgruppen war überzeugt, allein das wahre Israel zu repräsentieren und das Erbe Abrahams und Moses zu pflegen. Doch die Samariter haben allein die fünf Bücher Mose als heilige Schrift anerkannt und den Berg Garizim bei Samaria, auf dem schon Mose Segen und Fluch hatte verkünden lassen, als die einzige von Gott ausgewählte heilige Stätte für Gottesdient und Opfer angesehen Nur die hier amtierenden Priester galten als die legitimen Nachfahren das Aaron, des Bruders Moses. Die Judäer haben dagegen die Stadt Jerusalem mit dem Berg Zion, wo schon Abraham Gott verehrt hatte, zum einzigen von Gott auserwählten Heiligtum auf Erden erklärt. Ihnen reichten die fünf Bücher Mose nicht aus, sie haben die Bücher zur heiligen Schrift hinzugefügt, die heute in der Lutherbibel als Lehrbücher und Propheten eingereiht sind. Mit dem Unterschied im Blick auf den heiligen Ort und die heilige Schrift haben sich dann im Lauf der Zeit zahlreiche theologische und rituelle Sondermeinungen und –regelungen verbunden, bis hin z.B. zu der Art, wie das große Jahresfest am Passatag zu feiern ist und zu welchem Zeitpunkt das geschehen muß. Die 1 Abweichungen der Gegenseite wurden als schlimmer Aberglaube verurteilt. Zugleich wuchs der Haß der einen Hälfte des alten Israel auf die andere immer mehr an. Das war die Situation, die Jesus vorgefunden hat und unser Text ausdrucksvoll veranschaulicht. Die Samariterin ist ungemein erstaunt, dass ein Judäer zu ihr redet. Sie spricht ihn gleich auf den religiösen Zwist an. „Unsere Väter haben auf dem Berg Garizim angebetet (und wir tun es jetzt wie sie), ihr aber sagt, Jerusalem sei (allein) die Stätte, wo man anbeten soll.“ Jesus antwortet ihr so, dass es ihm gelingt, eine dritte Position über den Parteien einzunehmen, von den jede einen Alleinvertretungsanspruch für den rechten Gottesglauben erhebt und beansprucht, allein das Erbe der Religion Abrahams oder Moses zu bewahren. Was aber Jesus sagt, läuft nicht auf einen faulen Kompromiß oder eine simple Verdrängung: „das ist doch egal..“ hinaus. Das jüdische Gebot, jeden Kontakt mit diesen abgefallenen Leuten aus Sichem zu unterlassen, hat ihn nicht gehindert, ohne jedes Bedenken seinen Weg durch das Land der Samariter zu nehmen, sich an einem ihrer Brunnen niederzulassen; er lässt seine Jünger das Essen bei ihnen einkaufen, trinkt aus einem Gefäß, das vorher eine Samariterin benutzt hatte, und hat keine Scheu, sich mit ihr in ein ernsthaftes Gespräch einzulassen, und das mit einer Frau! Noch dazu mit einer, die einen ziemlich anrüchigen Lebenswandel hinter sich hatte. Jesus versucht nicht, sie zum Judentum zu bekehren. Doch er macht ihr klar, dass es sich bei dem tiefen Riß zwischen Nord- und Südstämmen um eine zeitbedingte Beschränktheit des religiösen Bewusstseins und der religiösen Praxis handelt. Das kann zwar infolge einer den Menschen angeborenen Engstirnigkeit und nationalem Eigensinn nicht einfach für irrelevant erklärt werden kann. Der Geist Gottes ist aber am Werk, solche Absolutheitsansprüche zu überwinden: „Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater – den göttlichen Vater – anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, ie müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.“ Jesus zeigt der Frau und seinen Jüngern, die dabeistehen, was Toleranz zwischen unterschiedlichen religiösen Überzeugungen bedeutet. Er weiß, dass die Samariter des festen Glaubens sind, dass die Bücher des Mose nur von ihnen richtig ausgelegt werden. Er greift sie nicht an: Ihr seid Ketzer, ihr seid Ungläubige, ihr verdreht die Wahrheit der Schrift! Dennoch hält er an seinem eigenen Glauben fest: Ihr Samariter wisst nicht, was ihr anbetet; wir aber wissen, was wir anbeten; denn das Heil kommt von den Juden.“ Die Frau antwortet nicht: jetzt werde ich eine Jüdin! Aber sie ist überwältig von der Freiheit des Geistes, die Jesus erkennen lässt. Und so erkennt sie seine Person als außergewöhnlich an: Du mußt der Messias sein. In Jesus kommt in der Tat das Heil von den Juden, denn er ist jüdischer Herkunft. Das Bekenntnis zu seiner Botschaft bedeutet aber, dass man über das Judentum ebenso hinausgewiesen wird wie über das Samaritertum. Was aber bedeutet diese Erzählung von der Begegnung am Jakobsbrunnen für unsere Gegenwart? Ich denke, was Jesus damals getan und geredet hat, liefert ein bedenkenswertes Beispiel für den weltweiten Gegensatz, der sich heute zwischen Christen und Moslems, zwischen Kirche und Islam aufgetan hat. Er kennzeichnet die religiöse Gegenwartslage unserer europäischen oder auch amerikanischen Gesellschaft und wirkt sich bis in die alltägliche Lebensführung aus, etwa was die Eheschließung betrifft oder den Sportunterricht in der Schule oder das Tragen des Kopftuchs bei den Frauen. Dennoch wage ich zu behaupten: Das Verhältnis zwischen den beiden großen Weltreligionen unserer Tage ähnelt in vieler Hinsicht dem Verhältnis zwischen Juden und Samariter zur Zeit Jesus. Die harten Auseinandersetzungen, die es gegenwärtig mit islamistischen Terroristen gibt, entspringen zwar einer anderen Moral als die einer christlichen Ethik. Der abgrundtiefe Haß dieser Fanatiker gegen den als christlich betrachteten Westen übertrifft die damalige Feindschaft zwischen Juden und Samariter bei weitem. Auf die meisten Zeitgenossen wirkt deshalb der Islam und seine heilige Schrift, der Qoran, fremdartig und zutiefst erschreckend, als das 2 abschreckende Gegenbild zu Jesus Christus und der Botschaft der Bergpredigt. Die Nachrichten im Fernsehen bestätigen das scheinbar jeden Abend aufs neue. Dennoch nötigt uns die Toleranz, die Jesus damals gegen eine andersartige Religionsform geübt hat, den Islam nicht zu verteufeln, sondern zu versuchen, ihn zu verstehen und sein Verhältnis zu dem Gott, den wir Christen verehren, zu seinem Geist und seiner Wahrheit, und womöglich den Dialog mit seinen Vertretern aufzunehmen, denn die überwiegende Mehrheit der Moslem sind keine Terroristen. Wer einmal den Qoran in einer guten Übersetzung zu lesen beginnt, wird bald gewahr, wie sehr die biblischen Überlieferungen die Lehre Mohammeds geprägt, ja hervorgerufen haben. In einer arabischen Umgebung, die damals noch durch eine polytheistische Vielfalt von Göttern und Mythen gekennzeichnet war, unternimmt es dieser Prophet, den Glauben an den einen und einzigen Gott, den schon Abraham erkannt und geglaubt hatte, bekannt zu machen und zum Sieg zu führen. Denn dieser Urgrund aller Wirklichkeit ist „der Barmherzige und Erbarmende“, wie es zu Beginn jeder der 150 Suren – das ist eine Art von prophetischen Gebeten – zu hören ist. Wieder und wieder beruft sich Mohammed auf die Tora, das alttestamentliche Gesetz, und das Evangelium, freilich fügt er hinzu, dass Juden wie Christen ihre heilige Schrift nicht richtig verstanden haben. Mohammed argumentiert mit der Schöpfung der Welt durch den göttlichen Willen, verweist auf Adam und Eva, Kain und Abel, Abraham und Josef, Mose und Aaron, David und Salomo sowie die Profeten, auch auf Hiob als beispielhafte Moslems. Am Ende der früheren Gottesoffenbarungen steht nach Johannes dem Täufer Jesus, Sohn der Maria, als größter Profet der Vergangenheit. Jesus hat nach dem Evangelium verheißen, dass ein Tröster nach ihm kommen wird, er ist mit Mohammed erschienen, dem der Engel Gabriel die Suren des Koran eingegeben hat. Was noch aussteht, ist das Ende der Welt mit einem Jüngsten Gericht über Gerechte und Ungerechte. Das alles aber, was die biblischen Gestalten erlebten und verkündeten, ist geschehen, um die allumfassende hintergründige Wirklichkeit des einen Gottes zu erfassen, den Mohammed Allah nennt, ein Wort, das der hebräischen Bezeichnung äloah für Gott im Alten Testament entspricht. Mohammed weiß also über die biblischen Gestalten und Geschichten weit besser Bescheid als die meisten Christen damals und heute. Und das, obwohl er vielleicht gar nicht lesen konnte und das alles von Juden oder Christen gehört zu haben scheint, die durch Mekka gereist kamen. Allerdings waren es wohl zumeist Juden, denn über die alttestamentlichen Überlieferungen weiß er weit besser Bescheid als über die neutestamentlichen. Über die Bergpredigt hat er anscheinend nichts vernommen oder es nicht für wichtig gehalten. Seine Ethik richtet sich vor allem am Alten Testament auf, verurteilt deshalb nicht die Rache am menschlichen Feind, obwohl er ihr Ausmaß einschränkt, und gebietet, das Schwert in die Hand zu nehmen, wenn es gegen die Feinde des Glaubens geht. Aufs Ganze gesehen gibt es also einen breiten Grundstock an Gemeinsamkeiten in Bibel und Qoran. Das verbietet es, im Islam eine heidnische Religion zu sehen und seinem Glauben jede Wahrheit abzusprechen. Daneben gibt es auch beträchtliche Unterschiede, die auf beiden Seiten absolut genommen werden und zur Verdammung der andern Seite führen. Insofern ist die Sachlage ähnlich wie die zwischen Juden und Samaritern zur Zeit Jesu. Zahlreiche Moslems wohnen heute unter uns. Es ist anzunehmen, dass es in Zukunft noch mehr sein werden. Wir verbieten es uns zwar nicht, zu Türken in das Restaurant zu gehen und ihre Speise und ihren Wein zu genießen, aber wir halten es in der Regel für überflüssig, nach ihrer Religion und ihrem Glauben zu fragen, und weisen im Geheimen diese Kultur weit von uns und unsere Kultur. Wir sollten uns fragen, ob das Beispiel, das Jesus in dieser Geschichte gibt, und nicht eines Besseren belehrt und uns auf eine Zukunft Ausschau halten lässt, in der der Geist Gottes unsere beiden Religionen eine tiefere Wahrheit führt, als wir heute zu ahnen in der Lage sind. 3 Jesus will Toleranz, die dem natürlichen Menschen schwer fällt. Toleranz heißt nämlich nicht, dass jede religiöse Meinung so viel wert ist wie eine andere. Toleranz heißt, mit dem eigenen Denken auf den andern zugehen, ihn aus seiner Geschichte heraus zu begreifen, aber nicht einfach gutzuheißen, was er tut und denkt. Zu christlicher Toleranz gegenüber dem Islam gehört deshalb durchaus die Frage an einen Imam, warum er seine Gebetsrezitation beginnt: „Im Namen Gottes, des barmherzigen und allerbarmenden“ und danach in seiner Predigt die Hörer nicht zu entsprechender Barmherzigkeit aufrufen will, sondern zum heiligen Krieg. Für Jesus ist Liebe nicht eine Privatangelegenheit Gottes, sondern eine Verpflichtung für jeden Menschen, der um diesen Gott weiß. Echte Toleranz gedeiht nur dort, wo der eigene Glaube und die Wahrheit nicht unter den Scheffel gestellt wird, und dennoch der Glaube des andern respektiert und nach der gemeinsamen Grundlage und der gemeinsamen Zukunft gesucht wird. Wir Christen haben allen Grund, gerade heute zu bekennen: Das Heil kommt von dem Juden Jesus. Gott gebe uns die Fähigkeit, ihn im Geist und in der Wahrheit anzubeten und damit unserer Gesellschaft ein Zeichen zu geben. Amen. 4