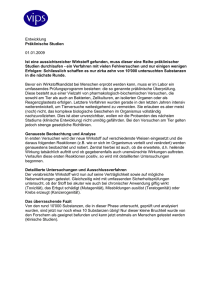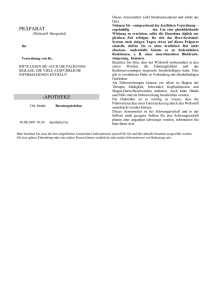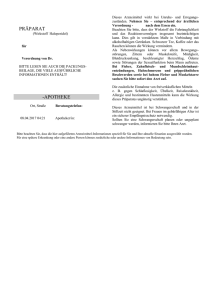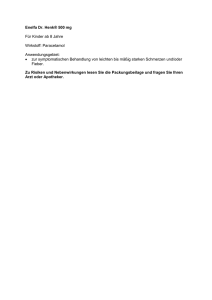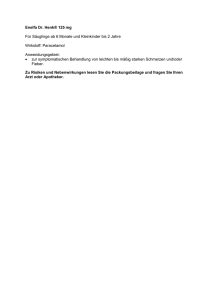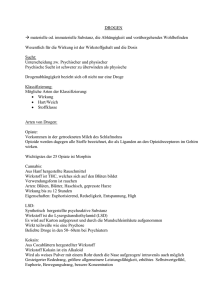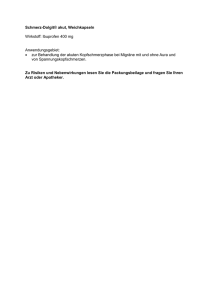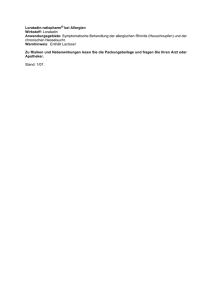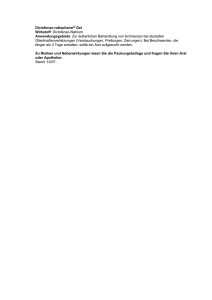Erfolgreiche Simulations-Modelle reduzieren Nebenwirkungen
Werbung

Junge Ärzte der niedergelassene arzt 12/2013 Forschung am Computer für eine bessere Schmerztherapie Erfolgreiche Simulations-Modelle reduzieren Nebenwirkungen Die Forschung nach neuen Wirkstoffen oder Wirkstoff-Modifikationen kann ­zeitintensiv und teuer sein. Modellgestützte Computer­simulationen könnten eine zeitaufwendige Wirkstofffahndung mit Labor­langfristig ersetzen. Der Arbeitsgruppe von PD Dr. Marcus Weber vom Computational Molecular Design Zuse Institute Berlin (ZIB) ist es gelungen, mit dieser Methode in kurzer Zeit ein Opioid zu kreieren, dass nur lokal im entzündetem Gewebe s­eine Wirkung entfaltet und somit im übrigen Organismus keine (Neben)-Wirkungen erzeugt. Bisherige präklinische Untersuchungen im Labor bestätigen die errechneten Eigenschaften des Moleküls. W ebers Forschungstätigkeit im Bereich der Wirkstoffforschung ist im DFGForschungsprojekt MATHEON angesiedelt. MATHEON entwickelt Mathematik für Schlüsseltechnologien und unterstützt Partner in Industrie und Wissenschaft. Für das Schmerzmittel-Projekt kam es zu einer Kooperation zwischen der C ­ harité und den MATHEON-Wissenschaftlern. Hier beginnt die Erfolgs­geschichte, die durch die Expertise von M ­ edizinern und Mathematikern eine Wirkstoff-Modifi­ k ation am Computer ­ermöglichte. Geteilte Expertise zwischen ­Medizinern und Mathematikern Christoph Stein, Anästhesiologe am Campus Benjamin Franklin der Berliner ­Charité schilderte den Mathematikern vom ZIB im Vorfeld die Wirkungsweise von Opioiden. Opioidrezeptoren sind nahezu überall im Organismus vertreten, unter anderem auch im Zentralen Nervensystem. Bei der Therapie von starken Schmerzen können Opioide eine effektive Hilfe darstellen. Sie können bekanntlich aber auch starke Nebenwirkungen hervorrufen wie Abhängigkeit, Verdauungsstörungen oder Atem- © lightpoet / Fotolia 26 depression. Ideal wäre es, wenn diese Schmerzmittel ein geringeres Nebenwirkungspotenzial h ­ ätten, so Stein. Simulations-Model für den ­Opioid-Rezeptor gesucht Die Mathematiker nahmen sich dieser Herausforderung an. Zu Beginn ihrer Forschung gab es aber kein originalgetreues Simulations-Model von dem OpioidRezeptor für den Computer. Etwa ein halbes Jahr lang suchten Weber und seine Kollegen nach einem passenden Äquivalent und entschieden sich für einen RhodopsinRezeptor-Modell. Die Mathematiker vermuteten, dass das Rhodopsin-Modell dem Opioid-Rezeptor an den relevanten Bindungsstellen ähnelt. Erst nachdem die Modelluntersuchungen am Rechner schon stattgefunden hatten, wurde im Jahr 2012 eine Röntgenstrukturanalyse zu dem ­ Opioid-Rezeptor veröffentlicht. „Wir mussten zwar am Anfang eine Vorhersage treffen, wie diese Struktur aussehen könnte. Jetzt wissen wir, dass wir mit unseren mathematischen Vorhersagen und der Röntgenstrukturanalyse aus dem Labor sehr gut übereinstimmen“, so Weber. Was wie ein Glückstreffer klingt, lässt sich einfach erklären: Die Aktivierung des Opioid-Rezeptors ist eine lokale Angelegenheit. „Für unser Mathematisches Modell war es nicht wichtig zu wissen, wie das ­gesamte Rezeptor-Protein im Detail aussieht. Uns interessierte einzig und allein die Bindungs­stelle des Rezeptors. Diese lokale Stelle, wo der Wirkstoff bindet, sollte in der ­Simulation allerdings so exakt wie möglich dargestellt sein und dabei hatten wir Glück“, führt Weber aus. Andere pH-Werte in gesundem und krankem Gewebe Eine Begebenheit aus der Umgebung des Rezeptors war jedoch innerhalb der Modellrechnungen wichtig: Entzündetes, Schmerz verursachendes Gewebe hat einen niedrigeren pH-Wert als die „gesunde“ Umgebung. Sie suchten deshalb innerhalb der Simulationen nach einen Wirkstoff, der pH-Wert abhängig seine Aktivität einstellen oder aktivieren kann. Bei einem pH-Wert von circa 5,5 sollte der Wirkstoffkandidat an Junge Ärzte dem Rezeptor binden können, bei einem pH-Wert von 7,0 dagegen nicht. Als all ­diese Voraussetzungen im Modell implementiert waren, konnte die Simulation beginnen. Die reinen Simulationsberechnungen nahmen nicht viel Zeit in Anspruch. Innerhalb von einer Woche entschied sich Webers Mitarbeiterin, Frau Olga Scharkoi, für einen Wirkstoffkandidaten: das Fluor-Fentanyl. „Laut unserem Modell setzt sich der neue Stoff nur an die Rezeptoren, die sich in einem peripheren entzündeten Gewebe befinden. Alle anderen Rezeptoren ignoriert es“, sagt Marcus Weber. Gedacht ist der neue Wirkstoff für ­Entzündungsschmerzen, so zum Beispiel bei Entzündungen, nach operativen Eingriffen, Verletzungen, Tumoren oder Arthritis. In der Theorie war alles soweit perfekt, nun fehlte noch der Praxistest. Wirkstoffkandidat gelangt aus dem Rechner ins Labor Dazu musste der neue Kandidat zuerst synthetisiert werden. Was nicht einfach war und deshalb mehr Zeit in Anspruch nahm als vermutet. Denn die angesprochenen Synthesefirmen empfanden den Auftrag als ungewöhnlich. Weber wollte nur eine ganz bestimmte Abwandlung eines Moleküls und kein einziges seiner Derivate. „Da mussten wir etwas Überzeugungsarbeit leisten“, sagt Weber. Es zeigte sich, dass eine Synthetisierung von Fluor-Fentanyl letztendlich mit geringem Aufwand und Kosten möglich war. So gelangte der Wirkstoffkandidat aus dem Rechner des ZIB ins Labor der Charité: Die ersten Tierversuche in der präklinischen Phase haben gezeigt, dass der Wirkstoff als Schmerzmittel Wirkung zeigt und alle Versuchstiere die Wirkstoffgabe überlebt haben, ohne schädliche Nebeneffekte. Auch eine 400-fache Dosis wurde vertragen, die bei den bekannten Schmerzmitteln bereits den Tod der Tiere bedeutet hätte. Nach der Gabe bestimmter Antimittel konnte die normale Schmerzempfindlichkeit bei den Tieren fast vollkommen wieder hergestellt werden. „Es fehlen aber noch viele andere pharmakologisch wichtige Parameter, zum Beispiel wie der Wirkstoff verstoffwechselt wird oder ob es uns noch unbekannte Nebenwirkungen hat“, gibt Weber zu bedenken. Die der niedergelassene arzt 12/2013 © fox17 / Fotolia 28 vorläufigen Labortests reichten den Wissenschaftlern aber aus, um ein weltweites Patent anzustreben. „Zunächst haben wir den Wirkstoff in Europa zur Patentierung gemeldet, uns dann aber entschlossen, ein internationales Patent anzustreben. Das wird noch etwa eineinhalb Jahre dauern. In dieser Zeit wollen wir das nötige Geld auftreiben, um diese sehr teure Patentierung bezahlen zu können“, erzählt Marcus Weber. Im Prinzip geht es um zwei Patente, einmal um den neuen Wirkstoff, das Fluor-Fentanyl, und um das Simulations-Modell, welches für die Berechnungen am Computer verwendet wurde. Bekannte Moleküle – ein w ­ enig ­modifiziert Weber und seine Arbeitskollegen forschen derzeit an neuen Wirkstoff­kandidaten, um ihnen den letzten Schliff zu verpassen. Sie wollen durch Statistik und Simulation bekannte Moleküle so „designen“, dass sie ihre Wirkungen ohne schädliche Neben­ effekte auslösen. Die computerbasierte Optimierung von bivalenten und tetravalenten Wirkstoffverbindungen am Rezeptor, wie es zum Beispiel für Diabetes-Präparate der Fall sein kann, ist bereits auf diese Art und Weise erfolgreich gewesen. Diese Herangehensweise ist im Prinzip für ein breites Spektrum von Wirkstoffklassen interessant: „Dieser rationale Wirkstoff­ entwurf gewinnt auch für die Forschung an antiviralen Mitteln, Membran-Transpor- tern oder Nanopartikeln immer mehr an Bedeutung “, sagt Weber. Ein weiters interessantes Forschungsfeld für die Zukunft ist die Optimierung des so genannten Re-Binding-Effekts. „Wenn ein Wirkstoff seinen Rezeptor verlässt, wäre es gut, wenn es erneut binden kann. Der Mensch ist aber kein gut geschütteltes ­Reagenzglas in dem chemische Verbindungen kontrolliert ablaufen, sondern sehr viel komplexer“ sagt Weber. Verschiedene Wechselwirkungen können den Re-Binding-Effekt verhindern, dieses gilt es zu optimieren. Zielgerichtetere und effektivere Forschung möglich In der Wirkstoffentwicklung werden neue Wege gegangen. B ­ isher war es üblich, neue Medikamente durch Ausprobieren im Labor herauszufiltern. Dieser Weg erscheint aber nicht mehr zeitgemäß, wie das Beispiel vom Fluor-Fentanyl zeigt. Etwa 80 Prozent der Fortschritte, wenn es darum geht die Schnelligkeit und Leist­ungsfähigkeit eines Wirkstoffs zu optimieren, sind mittlerweile mit solchen Simulationen und neuen Algorithmen erreicht worden. Mit der ­ Computer-Methode kann man sehr zielgerichtet und effektiv Forschung betreiben, ohne dabei die Forschungs­kosten wesentlich in die Höhe zu t­ reiben. Dr. Christine Willen Quelle: DFG Forschungszentrum MATHEON, Mathematik für Schlüsseltechnologien