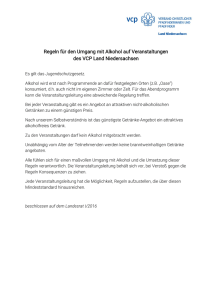08 jugend und alkoholvulnerabilität
Werbung

Alkohol und erhöhte Vulnerabilität in Kindheit und Jugend? Alfred Uhl, Alfred Springer, Ulrike Kobrna, Bettina Matt Expertise des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Suchtforschung über die „Auswirkung von Alkohol auf Kinder und Jugendliche“ im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, Familie und Jugend, Abteilung Jugendpolitik 1 Alkohol und erhöhte Vulnerabilität in Kindheit und Jugend? Expertise des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Suchtforschung über die „Auswirkung von Alkohol auf Kinder und Jugendliche“ Alfred Uhl, Alfred Springer, Ulrike Kobrna, Bettina Matt Ludwig-Boltzmann-Institut für Suchtforschung (LBISucht) Wien, Februar 2008 (korrigierte Fassung Dezember 2010) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, Familie und Jugend, Abteilung Jugendpolitik 2 Korrespondenzadresse: Dr. Alfred Uhl Ludwig-Boltzmann-Institut für Suchtforschung (LBISucht) und AlkoholKoordinations- und InformationsStelle (AKIS) des Anton-Proksch-Instituts (API) Mackgasse 7-11, A-1230 Wien Tel.: +43-(0)1-88010-950, Fax: +43-(0)1-88010-956 E-Mail: [email protected], Internet: http://www.api.or.at/lbi und http://www.api.or.at/akis Download der vorliegenden Publikation unter: http://www.api.or.at/lbi/download.htm Uhl, A.; Springer, A.; Kobrna, U.; Matt, B., (2008): Alkohol und erhöhte Vulnerabilität in Kindheit und Jugend?, Expertise des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Suchtforschung über die „Auswirkung von Alkohol auf Kinder und Jugendliche“ Wien 3 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung .......................................................................................................... 6 2 Wichtige Konzepte und Begriffe ............................................................................ 7 2.1 Absolute vs. äquivalente Alkoholmengen ......................................................... 7 2.2 Alkoholresilienz vs. Alkoholvulnerabilität .......................................................... 8 2.2.1 Unterschiedliche Formen der Resilienz........................................................ 8 2.2.2 Resilienz als kontinuierliche Dimension ....................................................... 9 2.2.3 Resilienz als heterogenes Konstrukt .......................................................... 10 2.3 Geschlechtsspezifische Alkoholvulnerabilität .................................................... 10 2.3.1 Körperwasserbedingte Unterschiede in Alkoholtoleranz/-vulnerabilität........... 11 2.3.2 Trinkmengenbedingte Unterschiede in Alkoholtoleranz/-vulnerabilität ........... 11 2.3.3 Direkt geschlechtsspezifische Unterschiede in Alkoholresilienz/vulnerabilität ......................................................................................... 12 2.4 Genetische Disposition zur Sucht ................................................................... 13 2.5 Primärer vs. sekundärer Alkoholismus ............................................................ 14 2.6 Die Aussagekraft von epidemiologisch gewonnen Korrelationsbefunden .............. 15 3 Kinder und Jugendliche: entwicklungsspezifische Alkoholvulnerabilität ..................... 16 3.1 Körperwasserbedingte Unterschiede in Alkoholtoleranz/-vulnerabilität: ............... 16 3.2 Trinkmengenbedingte Unterschiede in Alkoholtoleranz/-vulnerabilität ................. 17 3.3 Direkt entwicklungsspezifische Unterschiede in Alkoholtoleranz/-vulnerabilität..... 18 3.3.1 Hypothese: Höhere Alkoholtoxizität und geringerer Alkoholabbau bei Kleinkindern .......................................................................................... 18 3.3.2 Hypothese: Alkoholkonsum behindert die soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen besonders ungünstig ..................................................... 19 3.3.2.1 Früher Einstieg – große Probleme? ..................................................... 20 3.3.2.2 „Problem Behaviour Theory“ vs. „jugendlicher Alkoholkonsum verursacht Folgeprobleme“ ................................................................ 21 3.3.2.3 Lernen eines adäquaten Umgangs mit Alkohol und Drogen als Entwicklungsaufgabe in der Jugend .................................................... 22 3.3.3 Hypothese: Alkohol schädigt das in Entwicklung befindliche Gehirn besonders stark ..................................................................................... 23 3.3.3.1 Tierversuch als Beleg für eine höhere Alkoholvulnerabilität bei Kindern und Jugendlichen ................................................................. 24 3.3.3.2 Tierversuch als Beleg für eine stärkere Schädigung des Gehirns bei adoleszenten Ratten ......................................................................... 25 4 4 Der Einfluss des elterlichen Alkoholkonsums auf die Nachkommenschaft .................. 26 4.1 Fetales Alkoholsyndrom (FAS), Fetale Alkoholeffekte (FAE) und Alkoholembryopathie (AE)............................................................................. 26 4.2 Stillen und Alkoholkonsum – die doppelte Verdünnung ..................................... 28 4.3 Soziale und psychische Auswirkungen des elterlichen Alkoholkonsums ............... 31 5 Altersgrenzen im Jugendschutz und Sanktionen .................................................... 32 6 Zusammenfassung/Schlusskapitel ....................................................................... 35 7 Literatur ........................................................................................................... 37 5 1 Einleitung Bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts hatte die Problematisierung des Umgangs mit psychoaktiven Substanzen, wie sie in der Wissenschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts betrieben wurde und sich unter anderem auch in der Entwicklung von Abstinenzbewegungen niederschlug, auf die Politik und auf die Privatsphäre und in bestimmter Weise auch auf die medizinische Praxis nur wenig Einfluss. Heroin wurde rezeptfrei als Morphintropfen, Hustenmittel gegen für akute Kinder verordnet, Zahnschmerzen zahnende wurden Kinder Kokaintropfen erhielten empfohlen, österreichische Bauern gaben Säuglingen und Kleinkindern opiumhaltige Mohnsauger, kranken Kindern wurden zur Stärkung wein- und bierhaltige Speisen verabreicht und Schulkinder erhielten von den Eltern Rotwein, weil man die alkoholbedingt geröteten Wangen als Zeichen guter Gesundheit interpretierte. Einen guten Einblick in die damals verbreitete Haltung gewinnt man z.B. bei Burgerstein (1918), der ohne kritische Untertöne ein Experiment beschrieb, bei dem 25 Kinder im Alter zwischen 6 und 15 Jahren Wein verabreicht erhielten, um den Einfluss des Alkohols auf Verhalten und Leistungsfähigkeit messen zu können – ein Experiment, das heute spätestens am Einspruch der Ethikkommission scheitern würde. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts änderten sich die gesellschaftlichen Perspektiven grundlegend. Opiate, Kokain und Cannabis wurden illegalisiert und dass man Kindern den Konsum von Alkohol und Nikotin konsequent verbieten sollte, wurde zusehends zum Dogma des gesunden Menschenverstandes. Die These, dass Kinder und Jugendliche psychoaktiven Substanzen gegenüber besonders empfindlich (vulnerabel) seien, wurde zur Selbstverständlichkeit, die keiner näheren Begründung bedurfte. Auch die sich seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelnde professionelle Suchtprävention übernahm diese Auffassung unhinterfragt und verfolgte in ihren Anfängen eine primär auf Abschreckung und einseitige Information setzende Drogenpolitik. Zunehmender Widerstand einer kritischen Jugend gegen Doppelmoral und Bevormundung einerseits, sowie der aufkommende Trend, die Angemessenheit und Wirksamkeit von drogenspezifischen bzw. suchtpräventiven Maßnahmen – unter dem Schlagwort „evidenzbasierte Politik“ – wissenschaftlich zu begründen, erzeugten in den letzten Jahren Druck, die lange Zeit als Selbstverständlichkeiten abgehandelten Aussagen wissenschaftlich zu begründen. 6 Die vorliegende Arbeit untersucht die These, dass Alkoholkonsum für Kinder und Jugendliche besonders gefährlich sei; dass diese also in deutlich höherem Ausmaß alkoholvulnerabel seien als Erwachsene und dementsprechend Alkoholgebrauch bei ihnen mehr körperliche, psychische und soziale Folgeschäden auslösen würde. Um die Zielsetzung des Textes unmissverständlich klar zu machen: Es geht nicht darum, zu untersuchen, ob auch Kinder und Jugendliche durch bestimmte Formen des Alkoholkonsums körperlich, psychisch und sozial gefährdet sind – davon gehen wir angesichts der Fülle der empirischen Befunde über negative Auswirklungen übermäßigen Alkoholkonsums aus –, sondern es wird hier ausschließlich die Frage behandelt, ob man bei Kindern und Jugendlichen mit deutlich stärkeren negativen Auswirkungen des Alkoholkonsums rechnen muss als beim Erwachsenen. 2 Wichtige Konzepte und Begriffe Im Vorfeld der Behandlung der Frage, ob Kinder und Jugendliche in bestimmten Aspekten durch Alkohol mehr gefährdet seien als Erwachsene, ist es zweckmäßig, in diesem Zusammenhang relevante Begriffe und Konzepte zu präzisieren. Der folgende theoretische Abschnitt stellt den Versuch dar, einige in diesem Zusammenhang relevante, in der Fachliteratur vertretene Begriffe und Konzepte als Voraussetzung für das Verständnis der nachfolgenden inhaltlichen Diskussion sprachlich möglichst konsistent und präzise zu fassen. Aus Gründen der Einfachheit unterlassen wir es hier, auf die Fülle der unterschiedlichen Konzepte in der Literatur einzugehen bzw. diese aufzuzählen. Zentrale formal-logische und methodologische Überlegungen sind so grundsätzlicher Natur und keinem bestimmten Autor sinnvoll zuordenbar, dass wir auf das in weiten Kreisen übliche „Name Dropping“, um dem Text mehr wissenschaftliche Autorität zu verleihen, bewusst verzichtet haben. Literaturzitate finden sich daher ausschließlich in den inhaltlichen Kapiteln, wo es notwendig ist, die empirischen Quellen zu kennen, um die Schlüssigkeit unserer Ausführungen kritisch nachprüfen zu können. 2.1 Absolute vs. äquivalente Alkoholmengen Wenn einer Maus mit 25 Gramm Körpergewicht und einem Menschen mit 75 Kilogramm Körpergewicht die gleiche „absolute Alkoholmenge“, z.B. 1 Milliliter Wein, verabreicht wird, so erzielt die Maus eine rund 3000fach höhere Blutalkoholkonzentration als der Mensch. Man könnte der Maus und dem Menschen allerdings auch „äquivalente Alkoholmengen“ verabreichen, d.h. Mengen, die nach dem Körpergewicht bemessen sind und identische Blutalkoholkonzentrationen hervorrufen. 1 Milliliter Wein bei der Maus ist in diesem Sinne 3 Litern Wein beim Menschen äquivalent. 7 In diesem Extrembeispiel wird unmittelbar klar, dass die Frage, ob die Maus oder der Mensch Alkohol besser vertragen, nicht sinnvoll auf der Grundlage absoluter Alkoholmengen gestellt werden kann. Will man die Auswirkungen eines Stoffes wie z. B. Alkohol auf Mäuse und Menschen sinnvoll vergleichen, so muss man identische Blutalkoholkonzentrationen erzeugen, d.h. äquivalente Alkoholmengen applizieren. Was hier am Vergleich Maus mit Mensch ganz unmittelbar einleuchtet, trifft natürlich auch auf den Vergleich Frauen vs. Männer, kräftig gebaute vs. zarte Menschen oder Kinder vs. Erwachsene zu. 2.2 Alkoholresilienz vs. Alkoholvulnerabilität Da es im gegenständlichen Aufsatz um die Frage geht, ob Kinder und Jugendliche in Bezug auf Alkohol vulnerabler sind als Erwachsene, wird in Kap. 3.2 einerseits das Konzept „Resilienz vs. Vulnerabilität“ erklärt und andererseits auf einige konzeptuelle Aspekte eingegangen, die im Umgang mit diesen Begrifflichkeiten unbedingt beachtet werden sollten. Oft wird der Komplexität im Diskurs nicht adäquat Rechnung getragen, was gravierenden logischen Fehlschlüssen Vorschub leistet. 2.2.1 Unterschiedliche Formen der Resilienz „Resilienz“ bedeutet Widerstandsfähigkeit, wobei im Zusammenhang mit Alkohol mehrere Formen der Widerstandsfähigkeit zu unterscheiden sind. In diesem Kapitel unterscheiden wir Resilienz gegen die akute Alkoholwirkung, Resilienz gegen Alkoholmissbrauch und Resilienz gegen die körperlichen Folgen des Alkoholmissbrauchs. Das Gegenteil von Resilienz ist "Vulnerabilität“ im Sinne von Anfälligkeit bzw. Verletzlichkeit. „Resilienz gegen die akute Alkoholwirkung“ (Alkoholtoleranz): Manche Menschen können große Mengen Alkohol trinken, ohne dass man ihnen eine Beeinträchtigung anmerkt. Je mehr Alkohol man trinken kann, ohne deutlich beeinträchtigt zu werden, desto resilienter (widerstandsfähiger) ist man gegen die akuten Alkoholeffekte. Diese Resilienz gegen akute Alkoholeffekte wird traditionellerweise als Alkoholtoleranz bezeichnet, wobei man hier zwischen initialer und erworbener Alkoholtoleranz unterscheiden kann. Mangelnde Alkoholtoleranz ist mit „Vulnerabilität (Anfälligkeit) gegen akute Alkoholeffekte“ umschreibbar. Die initiale Alkoholtoleranz ist primär genetisch bedingt und liegt damit bereits vor dem ersten Alkoholkonsum vor. Die erworbene Alkoholtoleranz nimmt mit Intensität und Dauer des Alkoholkonsums laufend zu, bis es, nach sehr häufigem und starkem Alkoholkonsum über einen langen Zeitraum 8 zu gravierenden Organschäden kommt, die dann eine reduzierte Alkoholabbaukapazität sowie verringerte Kompensationsmöglichkeiten bewirken und so die Alkoholtoleranz plötzlich dramatisch senken (Toleranzbruch). Die Quantifizierung der Alkoholtoleranz ist nur relativ zur Blutalkoholkonzentration, d.h. basierend auf äquivalenten Alkoholmengen, zweckmäßig. Dass kleine und zarte Menschen bloß geringere absolute Alkoholmengen vertragen, kann man, wie in Kap. 2.1 ausgeführt wurde, nicht sinnvoll als „geringere Alkoholtoleranz“ bezeichnen. Resilienz gegen Alkoholmissbrauch: Manche Menschen trinken ihr Leben lang moderat Alkohol, ohne Gefahr zu laufen, diesen zu missbrauchen bzw. davon abhängig zu werden. Diese Personen sind resilient gegen die Gefahr des Alkoholmissbrauchs / der Alkoholabhängigkeit. Ein Hauptziel der modernen Primärprävention ist es, die Resilienz von Menschen dahingehend zu stärken, dass das Risiko Problemverhaltensweisen zu entwickeln sinkt – und Alkoholmissbrauch ist eine solche Problemverhaltensweise. Besonders groß ist die Gefahr, Alkohol zu missbrauchen und in der Folge von diesem abhängig zu werden (Vulnerabilität), bei Personen, die unter bestimmten psychische Erkrankungen, wie Angstzustände oder Depressionen leiden und diese im Sinne einer „Selbstmedikation“ mit Alkohol zu behandeln suchen (Selbstmedikationshypothese, vgl. Khantzian, 1985), sowie bei Personen, die in ihrem beruflichen oder sozialen Umfeld mit exzessivem Alkoholkonsumverhalten konfrontiert werden. Resilienz gegen die körperlichen Folgen des Alkoholmissbrauchs: Manche Menschen erkranken bereits bei relativ geringen Alkoholmengen an alkoholbedingten Krankheiten und andere überstehen selbst jahrelangen exzessiven Alkoholmissbrauch ohne nennenswerte Gesundheitsschäden. In diesen Fällen kann man von Anfälligkeit (Vulnerabilität) für alkoholbedingte Krankheiten bzw. Widerstandsfähigkeit (Resilienz) diesen gegenüber sprechen. 2.2.2 Resilienz als kontinuierliche Dimension Die drei erwähnten Arten von Resilienz sind keine qualitativen Kategorien (wie z.B. männlich vs. weiblich) sondern jeweils Pole von kontinuierlichen Dimensionen (wie z.B. die Körpergröße), die zwischen den Extremen „maximale Vulnerabilität“ und „maximale Resilienz“ variieren. Im Lichte dieses Umstandes ist es wenig zweckmäßig zu fragen, welcher Anteil der Menschen in einer Gesellschaft als alkoholvulnerabel bzw. -resilient zu bezeichnen ist, bzw. wieviele Prozent im Bereich dazwischen liegen. Es gibt keine natürlichen Grenzen, ab wann man von Vulnerabilität bzw. Resilienz sprechen könnte, da jede Grenzziehung grundsätzlich konventionell-willkürlich getroffen wird. Damit ist z.B. 9 die Frage „Wieviele Personen sind durch Alkohol gefährdet?“ ohne Präzisierung der CutOff-Scores sinnlos. 2.2.3 Resilienz als heterogenes Konstrukt Das Begriffspaar Alkoholresilienz vs. -vulnerabilität suggeriert, dass es sich dabei um eine homogene Dimension handle. Es wird über eine Reihe recht unterschiedlicher Konsummuster sowie Konsumfolgen generalisiert. Abgesehen vom Umstand, dass soeben drei völlig unterschiedliche Formen der Resilienz beschrieben wurden, gibt es auch innerhalb der jeweiligen Kategorien noch viele Unterschiede. Präziser müsste man daher von „Resilienz in Bezug auf ein bestimmtes Konsummuster sowie in Bezug auf bestimmte unerwünschte Folgen“ sprechen. So sind z.B. Personen, die südeuropäischen Konsumsitten folgend, regelmäßig Alkohol konsumieren, aber Räusche eher meiden, weniger anfällig für Unfälle aber anfälliger für Alkoholfolgeerkrankungen; Personen, die nordeuropäischen Konsumsitten folgend zwar seltener Alkohol konsumieren, aber wenn sie trinken, übermäßig viel trinken, sind dafür stärker unfallgefährdet und gleichzeitig weniger gefährdet, Alkoholfolgeerkrankungen zu entwickeln. 2.3 Geschlechtsspezifische Alkoholvulnerabilität Auch wenn es im gegenständigen Aufsatz darum geht, ob und in welchem Zusammenhang man von einer erhöhten Gefährdung von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Alkohol sprechen kann, wird nun kurz auf geschlechtsspezifische Unterschiede den Alkoholkonsum betreffend eingegangen. Der Vergleich der alkoholbedingten Gefährdung von Kindern mit Erwachsenen und jener von Frauen mit Männern weist in vielerlei Hinsicht große strukturelle Ähnlichkeiten auf. Eine wissenschaftlich neutrale Abwägung ist in Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum von Frauen erheblich sachlicher möglich, als in Zusammenhang mit jenem von Kindern und Jugendlichen. Die geschlechtsspezifische Alkoholtoleranz/-vulnerabilität ergibt sich im Wesentlichen aus drei Faktoren: (1) körperwasserbedingte Unterschiede (2) verhaltensbedingte Unterschiede (3) andere geschlechtsspezifische Unterschiede 10 2.3.1 Körperwasserbedingte Unterschiede in Alkoholtoleranz und -vulnerabilität Wie in Kap. 2.1 ausgeführt wurde, machen Vergleiche die Auswirkungen des Alkoholkonsums betreffend in der Regel nur Sinn, wenn man Personen mit identischen Blutalkoholkonzentrationen vergleicht (die durch den Konsum von äquivalenten Alkoholmengen erreicht werden), und nicht Personen, die identische Alkoholmengen getrunken haben. Frauen weisen durchschnittlich nur 2/3 des Körperwasservolumens von Männern auf – teilweise erklärbar durch ein geringeres Gewicht und teilweise wegen eines höheren Fettanteils. Beim Konsum identischer Alkoholmengen erzielen sie im Durchschnitt eine um 50% höhere Blutalkoholkonzentration als Männer. Das ist aber praktisch irrelevant, weil Frauen durchschnittlich erheblich weniger Alkohol trinken als Männer; und zwar um so viel weniger, dass sie nicht nur ihr niedrigeres Körperwasservolumen ausgleichen, sondern Blutalkoholkonzentrationen erzielen, die deutlich unter dem Durchschnitt der Männer liegen (vgl. Kap. 2.3.2). Dass viele diese Überlegungen nicht anstellen bzw. nicht nachvollziehen und mit dem Argument, dass Frauen bei identischen Alkoholmengen höhere Blutalkoholkonzentrationen erzielen, eine höhere Gefährdung von Frauen durch Alkohol behaupten, ist sachlich nicht zu rechtfertigen. Diese Meinung ist wohl nur vor dem Hintergrund eines antiquierten Geschlechterrollenverständnisses zu erklären, dass Frauen auch heute noch vieles nicht zugesteht, das für Männer als selbstverständlich gilt. 2.3.2 Trinkmengenbedingte Unterschiede in Alkoholtoleranz und -vulnerabilität Vergleicht man – z.B. anhand von Daten aus Bevölkerungsbefragungen (Uhl et al. 2005) – die Konsummengen von Frauen und Männern, so stellt sich heraus, dass Frauen im Durchschnitt tatsächlich bloß ein Drittel der absoluten Alkoholmenge bzw. die Hälfte der äquivalenten Alkoholmenge von Männern trinken (14g vs. 42g Reinalkohol pro Tag, vgl. Tab. 1). Dieser Umstand ist aus einer gesundheitspolitischen Perspektive positiv zu beurteilen. Wer weniger und seltener Alkohol trinkt, ist weniger gefährdet, problematische Konsummengen zu entwickeln und vom Alkohol abhängig zu werden (höhere Resilienz von Frauen gegen Alkoholmissbrauch). Tatsächlich kommen derzeit auf vier AlkoholikerInnen 3 Männer und nur eine Frau (Uhl & Kobrna, 2003). Wer weniger und 11 seltener Alkohol trinkt, entwickelt allerdings nur eine geringere Alkoholtoleranz, d.h. er/sie ist bereits bei einer geringeren Blutalkoholkonzentrationen beeinträchtigt und dadurch z.B. unfallgefährdet als eine Person mit regelmäßigen und stärkerem Alkoholkonsum. Es ist aber völlig fehl am Platz, aus diesem Umstand einen Risikofaktor zu konstruieren. Aus dieser Perspektive wären jene, die ihr ganzes Leben überhaupt keinen Alkohol trinken, den Alkohol betreffend die stärkste Risikogruppe – das Gegenteil ist aber der Fall. Jene, die oft und viel Alkohol trinken, sind zwar bei geringen Alkoholmengen weniger unfallgefährdet, aber, da sie öfter Alkohol trinken und die erhöhte Alkoholtoleranz durch Mehrkonsum ausgleichen, sind sie insgesamt öfter und stärker beeinträchtigt und unfallgefährdeter als moderate AlkoholkonsumentInnen. Tab. 1: Durchschnittlicher Alkoholkonsum bezogen auf Geschlecht und Alter Frauen und Männer 14-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 Insg. durchschnittliche Gramm Alkohol pro Tag 17 29 32 27 28 29 17 27 durchschnittliche Liter Alkohol pro Jahr 7,7 13,6 15,0 12,5 12,8 13,3 7,7 12,7 Stichprobenumfang 421 919 910 749 608 700 247 4.554 Männer 14-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 Insg. durchschnittliche Gramm Alkohol pro Tag 16 43 48 44 46 44 27 42 durchschnittliche Liter Alkohol pro Jahr 7,4 20,0 22,4 20,1 21,4 20,4 12,4 19,3 Stichprobenumfang 192 459 447 378 259 349 105 2.190 Frauen 14-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 Insg. durchschnittliche Gramm Alkohol pro Tag 17 16 17 10 14 14 9 14 durchschnittliche Liter Alkohol pro Jahr 7,9 7,2 7,9 4,6 6,3 6,3 4,3 6,6 Quelle: „Repräsentativerhebung 2004“, Uhl et al. (2005); weitere Berechnungen Kommentar: 20g reiner Alkohol entsprechen ca. 1/4 Liter Wein oder 1/2 Liter Bier 2.3.3 Direkt geschlechtsspezifische Unterschiede in Alkoholresilienz und -vulnerabilität Dass Frauen aufgrund von geringerem Gewicht und höherem Fettanteil über weniger Körperwasser verfügen als Männer und nur soviel trinken, dass sie durchschnittlich bloß 50% des Blutalkoholspiegels von Männern erreichen (also 50% der äquivalente Alkoholmenge Geschlechtern. trinken), Als erklärt „direkt eine Reihe von geschlechtsspezifische Unterschieden Unterschiede“ zwischen den werden im gegenständlichen Aufsatz ausschließlich solche verstanden, die über die Faktoren „Körperwasservolumen“ und „Alkoholerfahrung“ hinausgehen; d.h. die auch dann zu beobachten sind, wenn man Körperwasservolumen und Alkoholkonsumgewohnheiten 12 konstant hält. Solche Differenzen werden in der Literatur immer wieder in Bezug auf Unterschiede im Hormonhaushalt, auf die psychische Konstellation etc. postuliert. Wie Uhl & Kobrna (2003) zeigen konnten, sind diese Unterschiede jedoch bei adäquater Berücksichtigung von Körperwasservolumen und Alkoholkonsumgewohnheiten als marginal einzustufen. Der Alkoholabbau, ausgedrückt als Verringerung der Blutalkoholkonzentration pro Stunde, ist bei Männern und Frauen annähernd gleich. Das Prädikat „annähernd“ zielt auf den Umstand, dass aus der verfügbaren Fachliteratur abgeleitet werden kann, dass geringfügige enzym- bzw. hormonbedingte Unterschiede in den Eliminationsraten zwischen Männern und Frauen derzeit nicht ganz ausgeschlossen werden können. So vertritt Mader (2001) in diesem Zusammenhang, dass die Eliminationsrate bei Frauen geringfügig niedriger sei, weil die weibliche Leber weniger des für den Alkoholabbau benötigten Enzyms Alkoholdehydrogenase (ADH) aufweise, während Rommelspacher (2003) vertritt, dass die Eliminationsrate bei Frauen geringfügig höher sei, weil das männliche Sexualhormon Testosteron ebenso wie Ethylalkohol vom Enzym ADH abgebaut werde, wodurch sich der Abbau der beiden Stoffe wechselseitig behindere. Konsumieren Frauen und Männer längerfristig äquivalente Alkoholmengen, so sind langfristig die Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit weitgehend identisch. Da im öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs Aussagen über geschlechtsbezogene Unterschiede bezüglich Alkoholvulnerabilität oft dazu dienen, den Alkoholkonsum von Frauen in ein problematisches Licht zu rücken bzw. Frauen besondere Mäßigung nahe zu legen, sei noch einmal ausdrücklich betont, • dass die körperwasserbedingt verringerte Alkoholtoleranz überkompensiert wird, weil Frauen im Durchschnitt nicht identische absolute Alkoholmengen wie Männer trinken, sondern bloß die Hälfte der äquivalenten Alkoholmengen, • dass die geringere Alkoholtoleranz wegen des deutlich geringeren Alkoholdurchschnittskonsums die Unfallgefahr generell nicht erhöht, sondern diese infolge des selteneren und mäßigeren Alkoholkonsums von Frauen stark verringert ist, und • dass es keine nennenswerten, darüber hinausgehenden geschlechtsspezifischen Unterschiede die Alkoholvulnerabilität betreffend zu geben scheint. 2.4 Genetische Disposition zur Sucht Wie Menschen auf bestimmte psychoaktive Substanzen reagieren hängt zu einem nicht unerheblichen Teil von genetischen Faktoren ab. Besonders bekannt ist in diesem Zusammenhang die genetisch bedingte Alkoholunverträglichkeit, die bei bestimmten asiatischen Volksgruppen in 80% der Fälle und bei Europäern nur in 5% der Fälle 13 vorliegt. Bei den betroffenen Menschen ist das Enzym ALDH-II genetisch bedingt inaktiv, wodurch sich beim Alkoholabbau ein Acetaldehydstau ergibt, der sich als Alkoholunverträglichkeit (Flush-Reaktion) manifestiert (Agarwal & Agarwal-Kozlowski, 1999). Nora Volkow (2005), die Leiterin des US-amerikanischen „Nationalen Institut on Drug Abuse (NIDA)“ vertrat basierend auf einer Literaturübersicht, dass 40%–60% der Variabilität des Risikos an einer Suchterkrankung zu erkranken mit genetischen Faktoren zusammenhängt, wobei Volkow in diesem Zusammenhang dem Neurotransmitter Dopamin eine zentrale Funktion einräumt. Aus dieser Perspektive kann man Sucht nicht eindimensional als Folge übermäßigen Substanzkonsums sehen, sondern ist Sucht in erheblichem Ausmaß ein Ergebnis von genetischen Variationen. 2.5 Primärer vs. sekundärer Alkoholismus Da viele psychiatrische Erkrankungen bei Verwandten gehäuft auftreten, also zu einem erheblichen Anteil genetisch bedingt sind, sind Überlegungen zur genetischen Disposition zur Sucht nicht unabhängig von Überlegungen zur Selbstmedikationshypothese mit psychoaktiven Substanzen (Khantzian, 1985) zu diskutieren. Dabei ergibt sich in Zusammenhang mit dem gegenständlichen Thema die Unterscheidung in primären und sekundären Alkoholismus (Schuckit, 1979). • Primärer Alkoholismus entwickelt sich infolge übermäßigen Alkoholkonsums (Primärproblematik) – meist vergleichsweise langsam –, wobei in der Folge psychische, körperliche und soziale Probleme (Sekundärproblematik) auftreten. • Sekundärer Alkoholismus entsteht, wenn Personen infolge psychischer, körperlicher und/oder sozialer Auffälligkeiten (Primärproblematik) beginnen, in großem Umfang Alkohol zur Selbstmedikation einzusetzen (Selbstmedikationshypothese, Khantzian, 1985) und dann – meist recht rasch – vom Alkohol abhängig werden (Sekundärproblematik). Es gibt nun immer mehr Indizien dafür, dass Alkoholismus in einer Vielzahl der Fälle sekundärer Natur ist. So konnte z.B. Springer (2004) mittels umfassender Interviews feststellen, dass rund die Hälfte der im Anton-Proksch-Institut stationär behandelten männlichen Alkoholiker und 94% der der im Anton-Proksch-Institut stationär behandelten Alkoholikerinnen bereits vor Beginn des problematischen Alkoholkonsums an gravierenden psychiatrischen Erkrankungen gelitten hatten, was sie eindeutig als sekundäre AlkoholikerInnen ausweist (vgl. Tab. 2). 14 Tab. 2: Primärer vs. sekundärer Alkoholismus bei stationären PatientInnen des Anton-Proksch-Instituts primärer Alkoholismus sekundärer Alkoholismus Frauen 6% 94% Männer 51% 49% Quelle: (Springer, 2004) Im Lichte der vorliegenden Befunde spricht vieles dafür, auf Hintergrundsprobleme und manifesten Alkoholmissbrauch zu fokussieren und den moderaten Alkoholkonsum nicht übermäßig zu problematisieren. 2.6 Die Aussagekraft von epidemiologisch gewonnen Korrelationsbefunden Aus epidemiologischen gleichzeitig auftretenden beobachten. unzulässig Daten 1 Der Schluss bzw. von können wir zwischen korrelative Zusammenhänge hintereinander auftretenden Korrelationen auf Kausalität ist zwischen Ereignissen forschungslogisch (Uhl & Kraus, 2006). Korrelationen erlauben uns bloß, basierend auf Vorwissen, Plausibilität und theoretischen Überlegungen, zu spekulieren, wie die korrelierenden Faktoren ursächlich zusammenhängen könnten. Die eindeutige experimentelle Bestätigung derartiger Hypothesen – in einem gewissen Sinn der Königsweg in der empirischen Forschung – scheitert meist an ethischen, praktischen und ökonomischen Grenzen. So ist es z.B. undenkbar, eine große Zahl von Kindern zufällig in Versuchs- und Kontrollgruppe einzuteilen, die Experimentalgruppe zu zwingen, über viele Jahrzehnte gesundheitsgefährdende Kontrollgruppe völlige Alkoholmengen Alkoholabstinenz zu aufzuzwingen, sich zu nehmen, sicherzustellen, dass der sich Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen in Kontrollgruppe und Versuchsgruppe langfristig nicht unterscheiden, und die Auswirkungen Jahrzehnte später zu erfassen und zu bewerten. Die derzeit in der empirischen Forschung übliche Vorgangsweise mit Korrelationsdaten ist, auf diese aufbauend Hypothesen in der Möglichkeitsform zu formulieren, bei Interpretationen der Ergebnisse anzudeuten, dass es sich um spekulative Vermutungen handle und darauf zu vertrauen, dass den Forschungsbericht lesende ForscherInnen, 1 Wird aus dem Zusammenhang gleichzeitig auftretenden Faktoren auf Kausalität geschlossen, so wird das in der Forschungsmethodologie als Cum-Hoc-Fehlschluss (cum hoc ergo propter hoc) bezeichnet, und der analoge Schluss aus hintereinander auftretenden Faktoren wird Sequenzfehlschluss oder Post-Hoc-Fehlschluss (post hoc ergo propter hoc) genannt. 15 PraktikerInnen sowie die Öffentlichkeit die spekulativen Interpretationen als wissenschaftlich gesicherte Sachverhalte aufnehmen und weiterverwenden (Uhl, 2007). Begünstigt wird diese fragwürdige Vorgangsweise dadurch, dass, wie Demmel (2004) kritisierte, viele AutorInnen von Übersichtsartikeln und im Zuge der einleitenden Begründungen ihrer eigener Forschungsansätze bloß Zitate aus anderen Arbeiten wiedergeben, ohne die zitierten Artikel profund zu kennen oder sie gar kritisch zu bewerten. Praktische Relevanz erzielen Zusammenhangshypothesen nur dann, wenn sie uns erlauben, Interventionen abzuleiten, um die Wahrscheinlichkeit für erwünschte Ausgänge zu erhöhen und für unerwünschte Ausgänge zu verringern. Im Sinne Poppers (1934) kann man diese Hypothesen zwar nicht beweisen, aber wenn die aus der Theorie abgeleiteten Auswirkungen von Interventionen nicht eintreten, sind die Hypothesen widerlegt (dogmatischer Falsifikationismus) – und nach neueren wissenschaftstheoretischen Überlegungen (z.B. Lakatos, 1978) – zumindest belastet (methodischer Falsifikationismus). Allerdings scheitert auch die Durchführung derart praxisnaher Forschungszugänge zur Evaluation präventionsrelevanter Interventionseffekten und zur indirekten Prüfung von dahinter liegenden Hypothesen ebenfalls häufig an unterschiedlichen Forschungsproblemen (Uhl, 2000). 3 Kinder und Jugendliche: entwicklungsspezifische Alkoholvulnerabilität Analog zu den vorangestellten Betrachtungen über geschlechtsspezifische Unterschiede kann man auch entwicklungsspezifische Unterschiede in Bezug auf die Alkoholwirkung unterteilen in: (1) körperwasserbedingte Unterschiede (2) trinkmengenbedingte Unterschiede (3) direkt entwicklungsspezifischen Unterschieden. 3.1 Körperwasserbedingte Unterschiede in Alkoholtoleranz und -vulnerabilität Wie im Kap. 2.1 ausgeführt, machen Vergleiche, die Auswirkungen des Alkoholkonsums betreffend, in der Regel nur Sinn, wenn man auf Blutalkoholkonzentrationen bzw. auf äquivalente Alkoholmengen abzielt, weil Unterschiede in der körperlichen Konstitution in der Regel durch entsprechenden Minderkonsum ausgeglichen werden. Weder bei Frauen, noch bei Kindern und Jugendlichen, ist die generelle Konstruktion einer höheren Gefährdung infolge des geringeren Körperwasservolumens gerechtfertigt. Jugendliche, 16 bei denen der Gewichtsabstand zu Erwachsenen vielfach nur mehr gering ist, trinken durchschnittlich erheblich weniger Alkohol als Erwachsene (vgl. Tab. 1). Die nach Geschlechtern getrennte Beurteilung ist hier allerdings insofern etwas komplizierter, weil sich das Alkoholkonsumverhalten junger Frauen und Männer in den letzten Jahren systematisch annähert. So liegt der Durchschnittskonsums von 14- bis 19-jährigen Frauen (17g Reinalkohol pro Tag) geringfügig über dem Durchschnittskonsum aller Frauen (14g Reinalkohol pro Tag), während bei Männern, infolge dieses Angleichungstrends, dieser Unterschied besonders stark ausfällt (16g vs. 42g Reinalkohol pro Tag). Über beide Geschlechter hinweg betrachtet, trinken 14- bis 19-Jährige deutlich weniger als die Gesamtstichprobe (17 g vs. 27g Reinalkohol pro Tag, vgl. Tab. 1). Wenn über den Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen gesprochen wird, bezieht sich dies im Allgemeinen auf ein Verhalten Heranwachsender, die Alkohol ausprobieren bzw. beginnen, ihn regelmäßig zu trinken, und nicht auf etwaiges (unbeabsichtigtes) Konsumieren von Alkohol durch Kleinkinder. Nichtsdestotrotz soll auch letztere Möglichkeit hier kurz Erwähnung finden, da es immer wieder zu Unfällen kommt, in denen auch – für einen Erwachsenen – kleine absolute Trinkmengen aufgrund des geringen Gewichtes von Kleinkindern erhebliche Effekte zeitigen. Wenn z.B. ein Kleinkind mit 6 kg Körpergewicht in einem unbeobachteten Augenblick einen Achtel Liter Eierlikör mit 20 Vol.-% Alkohol trinkt, was angesichts des süßen Geschmacks nicht auszuschließen ist, so entspricht das einer Situation, in der ein 70 kg schwerer Erwachsener ohne abzusetzen zwei 0,7-Literflaschen Eierlikör leertrinkt – also einer Alkoholmenge, die mit Sicherheit zu einer schweren, unter Umständen lebensbedrohlichen Alkoholvergiftung führt. Anders verhält es sich bei der Frage, ob man Kleinkindern geringe Mengen Alkohol verabreichen darf, etwa in Zusammenhang mit der Verschreibung von Medikamenten, die als alkoholische Lösung angeboten werden. Da hier, anders als beim Eierlikörbeispiel, die Medikamentendosis an das Körpergewicht des Kindes angepasst wird, geht es hier eindeutig um Effekte äquivalenter Alkoholmengen. (zu diskutierten entwicklungsspezifischen Auswirkungen siehe Kap. 3.3.1) 3.2 Trinkmengenbedingte Unterschiede in Alkoholtoleranz und -vulnerabilität Kinder und Jugendliche trinken in der Regel keinen oder erheblich weniger Alkohol als Erwachsene, daher ist ihre Alkoholtoleranz (noch) nicht sehr ausgeprägt. Die Gefahr, bei geringen Alkoholmengen in einem Ausmaß beeinträchtigt zu sein, dass das Unfallrisiko erheblich steigt, ist dadurch durchaus relevant. Es ist daher zweckmäßig, wenig 17 alkoholerfahrene Kinder und Jugendlichen (ebenso wie solche Erwachsene) auf diese Gefahr aufmerksam zu machen und ihnen im Umgang mit Alkohol zu Vorsicht zu raten. Bei Kindern und Jugendlichen ist daher in Erwägung zu ziehen, wie z.B. Zingerle (2005) betonte, „die Entwicklung zur Alkoholmündigkeit zu fördern, im Sinne individuellen und kollektiven Handelns, durch das Menschen in die Lage versetzt werden, unproblematische, sozial integrierte und genussorientierte Formen des Konsums von Alkohol zu entwickeln und zeitstabil beizubehalten“. Wie schon unter Kap. 2.3.2 ausgeführt wäre es paradox, aus dem Umstand, dass jemand wenig Alkohol trinkt, einen Risikofaktor zu konstruieren. Wenn man mangelnde Alkoholerfahrung bei Jugendlichen als Risikofaktor präsentiert, um damit Alkoholkontrollmaßnahmen für diese Altersgruppe zu rechtfertigen, so sagt man indirekt, dass Alkoholtoleranz, also „Trinkfestigkeit“, als protektive Eigenschaft anzustreben sei. Da man diese durch regelmäßigen stärkeren Alkoholkonsum erwirbt, wird dieses Verhalten implizit positiv bewertet. Das ist nicht nur logisch fragwürdig sondern auch pädagogisch bedenklich. Die taktische Verwendung des Arguments, dass Kinder und Jugendliche wegen ihrer Alkoholunerfahrenheit keinen Alkohol trinken dürfen, kann sich so in paradoxer Weise als kontraproduktiv erweisen, weil man damit implizit die in weiten Kreisen der Bevölkerung ohnehin als positiv erachtete „Trinkfestigkeit“ zum „Schutzfaktor“ bzw. zur „Tugend“ aufwertet. 3.3 Direkt entwicklungsspezifische Unterschiede in Alkoholtoleranz und -vulnerabilität Wie schon in Kap. 2.3.3 betont, geht es in Zusammenhang mit spezifischen Unterschieden um Thesen, die nicht mit den Faktoren „Körperwasservolumen“ und „Alkoholerfahrung“ erklärbar sind, also – in diesem Kapitel – um Unterschiede zwischen Kindern bzw. jungen Menschen und Erwachsenen, die auch dann auftreten, wenn man Blutalkoholkonzentration und Alkoholerfahrung konstant hält. 3.3.1 Hypothese: Höhere Alkoholtoxizität und geringerer Alkoholabbau bei Kleinkindern In der Fachliteratur wird ziemlich einheitlich vertreten, dass die äquivalente tödliche Dosis Alkohol für Kinder und Jugendliche erheblich geringer sei als für Erwachsene, weil Kinder viel empfindlicher auf Alkohol reagierten; so soll bei Kleinkindern bereits ein Alkoholspiegel von 0,5 Promille tödlich sein können (z.B. BZgA, 2004). Auch wurde immer wieder angeführt, z.B. bei Feuerlein (1979), dass das für den Alkoholabbau primär verantwortliche ADH-System bei Kleinkindern noch in Entwicklung begriffen und erst 18 beim fünfjährigen Menschen vollständig ausgebaut sei, weswegen der Alkoholabbau bei Kleinkindern erheblich langsamer von Statten gehe. Weder die These, dass die tödliche Alkoholdosis bei Kleinkindern erheblich niedriger anzusetzen sei als beim Erwachsenen, noch jene, dass der Alkoholabbau bei Kleinkindern erheblich langsamer vor sich gehe, wird allerdings bislang durch empirische Untersuchungen belegt. Es liegen nur minimale Forschungsaktivitäten vor, was sich einerseits damit erklären lässt, dass es bis dato wenig Interesse gab, die dem gesellschaftlichen Grundkonsens entsprechende These einer höheren Alkoholvulnerabilität von Kindern und Jugendlichen zu hinterfragen und kritisch zu prüfen, und dass andererseits diesbezügliche Daten nicht mittels kontrolliertem Experiment zu gewinnen sind, sondern nur aus der Dokumentation vereinzelter klinischer Fälle. Die einzige uns bekannte empirische Untersuchung zu diesem Thema stammt von Ragan et al. (1979), die den beiden Fragen, nach der tödlichen Dosis sowie nach dem Alkoholabbau, nachgingen. Ihre Befunde widersprechen der allgemeinen Erwartung diametral. Ragan et al. haben Krankengeschichten von allen mit Alkoholvergiftung in ihrer Klinik eingelieferten jungen PatientInnen (insgesamt 9 Kinder zwischen 0 und 12 Jahren) analysiert, dabei Blutalkoholkonzentrationen zwischen 2,5 und 5,75 Promille gefunden und festgehalten, dass alle Kinder diese Vergiftungen ausnahmslos überlebten. Im Fall eines 18 Monate alten Säuglings wurde die Alkoholabbaugeschwindigkeit gemessen, und diese war mit knapp 0,3 Promille pro Stunde doppelt so hoch wie beim durchschnittlichen Erwachsenen. Die These, dass Kleinkinder durch äquivalente Alkoholmengen erheblich gefährdeter seien als Erwachsene, wird dementsprechend durch diesen empirischen Befund nicht bestätigt sondern dieser widerspricht dieser. Da ein einzelner Befund nicht ausreicht, um sich ein einigermaßen verlässliches Bild zumachen, sind hier weitere empirische Untersuchungen notwendig. Solange allerdings keine Befunde vorliegen, die diese These bestätigen, ist deren Berechtigung grundsätzlich infrage zu stellen. 3.3.2 Hypothese: Alkoholkonsum behindert die soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen besonders ungünstig Wer in kritischen Lebensphasen durch unangemessenen oder übermäßigen Alkoholkonsum negative Konsequenzen provoziert, kann Weichen stellen, die den gesamten weiteren Lebensweg negativ beeinflussen. Das trifft sowohl auf Kinder und Jugendliche zu, die aus einer Schule ausgeschlossen werden, als auch auf junge Erwachsene, deren Karriereentwicklung an Alkoholmissbrauch 19 scheitert, oder auf Erwachsene, die alkoholbedingt ihren Arbeitsplatz verlieren bzw. ihre Beziehungen gefährden. Die Frage im gegenständlichen Aufsatz ist daher nicht, ob Alkoholkonsum ein Risikofaktor für den weiteren Lebensweg von Menschen darstellen kann – das steht außer Frage –, sondern (1) ob die Auswirkungen bei Kindern und Jugendlichen gravierender ausfallen als bei Erwachsenen, und (2) ob bei Kindern und Jugendlichen auch relativ moderater Alkoholkonsum, der bei Erwachsenen kaum mit Folgeproblemen assoziiert wird, einen relevanten negativen Effekt auf die weitere Zukunft der betreffenden Personen auszuüben vermag. 3.3.2.1 Früher Einstieg – große Probleme? Im Rahmen von epidemiologischen Studien wird immer wieder behauptet, dass früher Einstieg in den Alkoholkonsum deutlich mit negativen Entwicklungen in der Zukunft korreliert. Lege artis kann man auf der Basis dieser Aussage frühen Einstieg als Indikator dafür werten, dass die Betreffenden später mehr Probleme haben werden. Man kann aber keinen Kausalzusammenhang in dem Sinne ableiten, dass eine Verschiebung des Einstiegsalters die zukünftige Entwicklung positiv beeinflussen würde (vgl. Kap. 2.6). Wenn man diesen Sachverhalt inhaltlich adäquat und vorsichtig interpretiert, wie das z.B. die Schweizer SFA (2008) tat – „Je früher Heranwachsende regelmäßig Alkohol trinken und je häufiger sie Rauschzustände erleben, desto größer ist ihr Risiko, später Alkoholprobleme zu entwickeln.“ –, kann man davon ausgehen, dass das von jenen, die an praktischen Implikationen der Forschung interessiert sind, spontan als Kausalzusammenhang überinterpretiert wird. Dass diese Überinterpretation die Regel ist, geht aus der Ausführung der europäischen Drogenbehörde EMCDDA (2007) hervor: „The main objective in prevention is usually preventing or delaying the initiation with legal drugs“. In Kap. 3.3.2.2 wurde die Unterscheidung zwischen primärem und sekundären Alkoholismus getroffen, und betont, dass sich primärer Alkoholismus vergleichsweise langsam und sekundärer Alkoholismus vergleichsweise rasch entwickelt (Uhl et al., 2008). Das folgt aus dem Umstand, dass Personen, die Alkohol infolge der Primärproblematik zur Verringerung ihres Leidensdrucks einsetzen, die Dosis rasch steigern müssen, um trotz fortschreitender Toleranzentwicklung noch relevante Alkoholeffekte zu verspüren, während Personen, die bloß gewohnheitsmäßig größere Alkoholmengen konsumieren, keinen starken großen Druck zur Dosissteigerung verspüren. Für letztere sind die Alkoholeffekte nicht von essenzieller Bedeutung. Sekundäre Alkoholiker sind psychopathologisch erheblich auffälliger, weil hier die 20 psychiatrische Primärproblematik besteht, und sich zu ihr ein sekundäres Alkoholproblem addiert. Verknüpft man das eben Gesagte modellhaft, so wird klar, dass junge Alkoholkranke fast ausschließlich sekundäre AlkoholikerInnen sein müssen – schon wegen der geringen Zeitspanne, die zwischen dem Beginn des problematischen Alkoholkonsums und der Manifestation der Alkoholkrankheit zur Verfügung stand – und dass sie, als überwiegend sekundäre AlkoholikerInnen, psychopathologische Auffälligkeiten aufweisen. Wer die eben genannten Zusammenhänge nicht kennt, der kann das leicht so missverstehen, dass junge Menschen besonders anfällig seien, an Alkoholismus zu erkranken, und dass es bei diesen zu weit schweren Verläufen kommt. Bei einer konsequenten Unterteilung nach primärem und sekundärem Alkoholismus und wenn man die Verläufe aus einer Lebenszeitperspektive analysiert, erweist sich diese Schlussfolgerung rasch als haltlos. Auf einem ähnlichen Fehlschluss beruht auch der Mythos, dass Frauen besonders „alkoholvulnerabel“ seien, wie im Kap. 2.3 bereits dargelegt wurde. Gegen die These, dass früherer Einstieg in den Alkoholkonsum zwangsläufig dazu führt, dass später mehr getrunken wird und mehr Alkoholprobleme auftreten, spricht auch die Beobachtung, dass Jugendliche in Österreich immer früher körperlich reif werden, akzelerationsbedingt immer früher beginnen gleichwertig am Leben der Erwachsenen – und damit auch an deren Alkoholkonsumgewohnheiten – teilzunehmen und dass gleichzeitig der Durchschnittsalkoholkonsum in Österreich sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch bei jungen Erwachsenen sinkt (Uhl, 2003). Würde der Zusammenhang zwischen früherem Einstieg und späterem Problemkonsum in der behaupteten Form zutreffen, müsste gegen diesen beobachtbaren Trend der durchschnittliche Alkoholkonsum bei jungen Erwachsenen konsequent ansteigen. Es ist sicherlich zweckmäßig, Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung von Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit zu setzen – und zwar bei jungen und alten Menschen. Die Vorstellung allerdings, dass man in der Prävention vor allem den frühen Einstieg radikal bekämpfen müsste, um erfolgreich sein zu können, lässt sich angesichts der eben angestellten Überlegungen als „Early Onset Mythos“ bezeichnen. 3.3.2.2 „Problem Behaviour Theory“ vs. „jugendlicher Alkoholkonsum verursacht Folgeprobleme“ Wie soeben Jugendlichen dargelegt, korrelieren miteinander: „Früher Problemverhaltensweisen Alkoholkonsum“ und bei „starker Kindern und Alkoholkonsum“ korrelieren, wie immer wieder empirisch festgestellt werden konnte, mit einer Fülle von anderen gleichzeitig und später auftretenden 21 Problemverhaltensweisen, wie Aggressivität, frühe Sexualität, Kriminalität, Suchtgefahr und vielem mehr. Jessor (1987) führt das im Rahmen seiner „Problem Behaviour Theory“ primär auf dahinter liegende Hintergrundfaktoren zurück, während andere Autoren (z.B. Aarons et al., 1999) die später auftretenden Probleme weit stärker ursächlich mit initialen Alkoholkonsumverhalten assoziieren – also auch im moderaten Alkoholkonsum einen wichtigen Risikofaktor für späteren Problemkonsum verorten. Berücksichtigt man bei diesen Betrachtungen die in Kap. 2.5 dargestellten unterschiedlichen Verläufe des primären und des sekundären Alkoholismus, so kann man feststellen, dass die „Problem Behaviour Theory“ mit dem Konzept des „sekundären Alkoholismus“ gut harmoniert. 3.3.2.3 Lernen eines adäquaten Umgangs mit Alkohol und Drogen als Entwicklungsaufgabe in der Jugend Auch wenn die Forderung, dass Jugendliche bis zu ihrem 16. Geburtstag weitgehend alkoholfrei aufwachsen sollen, vernünftig ist, ist es in einer Kultur, in der keine Alkoholprohibition besteht und in der Alkoholkonsum vielmehr integraler Bestandteil des gesellschaftlichen Erwachsenenlebens ist, recht unwahrscheinlich, dass nicht bereits vor Erreichen des legalen Trinkalters erste Experimente mit Alkohol gemacht werden. Die Entwicklung der von Zingerle (2005) geforderten Alkoholmündigkeit erfordert nicht nur eine adäquate elterliche Vorbildwirkung, sondern auch, dass im Übergang vom Jugendalter zum Erwachsenwerden eine Einführung in unproblematische, sozial integrierte und genussorientierte Formen des Konsums von Alkohol gelernt werden können. Sofern sich das jugendliche Experimentierverhalten in Bezug auf Alkoholkonsum in Grenzen hält, gibt es keinen Grund, dieses Verhalten übermäßig zu dramatisieren. Selbst die Schweizer SFA (2008), die im Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen ein großes Problem sieht, stellt sich der gesellschaftlichen Realität, indem sie einräumt: „Bei Jugendlichen ab ca. 14 Jahren ist es für Erziehungsberechtigte oft schwierig, einen völligen Verzicht durchzusetzen. Sicher aber muss der Alkoholkonsum in diesem Alter eine Ausnahme darstellen.“ Hurrelmann et al. (1985) betonen in diesem Zusammenhang, dass die Entwicklung der Nutzung des Konsumwarenmarktes und des kulturellen Freizeitmarktes (einschließlich Medien und Genussmitteln) eine pädagogisch wichtige Entwicklungsaufgabe darstellt, um einen eigenen Lebensstil zu entwickeln und zu einem autonom gesteuerten und bedürfnisorientierten Umgang mit den entsprechenden Angeboten zu kommen. Aus diesem Grund ist es weder möglich noch zweckmäßig, Kinder und Jugendliche kategorisch von Alkohol fernzuhalten. Wenn Kinder elterlichen Alkoholkonsum beobachten und dann selbst kosten wollen, erscheint es sinnvoller, sie einen Schluck probieren zu lassen, als ihnen das kategorisch zu verweigern. In der Regel schmeckt den 22 Kindern der Alkohol ohnehin nicht und ist ihre Neugierde durch das Kostendürfen für eine Zeit gestillt. Hingegen ist es durchaus vorstellbar, dass kategorisches Verweigern des Kostens zu Folgeproblemen führt, weil Alkohol zum unerreichbaren und verbotenen Gut aufgewertet wird, wodurch der erste Alkoholkonsum verstärkt den Charakter eines Initiationsritus ins Erwachsenensein erhält. Darüber hinaus kann durch kategorische Verbote und rigide Verhaltensregeln die Eltern-Kind-Beziehung stark belastet werden (Uhl et al., 2003). 3.3.3 Hypothese: Alkohol schädigt das in Entwicklung befindliche Gehirn besonders stark Die Überzeugung, dass Kinder und Jugendliche deswegen keinen Alkohol trinken sollten, weil der sich noch in Entwicklung befindliche Organismus und besonders das Gehirn gegen die Effekte des Alkohols besonders anfällig erweisen, findet sich in zahlreichen Publikationen (z.B. Tapert et al., 2005 oder SFA, 2008). Zur Unterstützung der ad hoc durchaus plausiblen These, dass ein sich noch in Entwicklung befindliches Organ, wie das Gehirn, durch die Einwirkung von Substanzen besonders stark und nachhaltig geschädigt wird, gibt es allerdings derzeit noch keine wirklich schlüssigen empirischen Belege. Auch in der aktuellsten Entwicklung der biologischen Suchtforschung, bei Volkow (2005), die dem organischen Substrat eine Schlüsselfunktion in der Suchtentwicklung zuerkennt, indem sie Sucht als eine Erkrankung versteht, die auf der Basis von Adaptationsvorgängen in bestimmten Hirnarealen zunehmend auf zwanghaften und triebhaften Komponenten aufbaut, wird dieses Wissensdefizit indirekt ausgeführt. Volkow beschreibt, dass die Entwicklung der Suchtprozesse nicht nur in jenen Hirnarealen verankert ist, die mit dem Belohnungszentrum und dem „Suchtgedächtnis“ korrespondieren, sondern in spezieller Weise auch in der orbitofrontalen Rindenregion. Chronischer bzw. starker Drogengebrauch bewirken nach dieser Theorie über die Einwirkung in den dopaminergen Regionen des Belohnungszentrums auch Veränderungen in der orbitofrontalen Rindenregion, die wiederum der Steuerung von Antrieb und perseverativem Verhalten dient, woraus sich der zwanghafte Charakter der Sucht ergibt. Allerdings findet dieser Mechanismus unabhängig vom Alter des Gehirns statt und ist von der Intensität des Gebrauchs abhängig. Und so verwendet Volkow bezüglich der Frage, ob das heranreifende Gehirn durch Drogengebrauch besonders geschädigt werde, konsequent die Möglichkeitsform: „... may be particularly harmful to the still developing brain.“. Es besteht nun einmal das Grundproblem, dass, in psychologischen Tests festgestellte, kognitive oder, mittels bildgebender Verfahren erfasste, hirnorganische Unterschiede 23 zwischen exzessiv Alkoholkonsumierenden und Vergleichspersonen eine Folge des Alkoholkonsums sein können, genau so gut aber auch schon vorher bestanden haben können und eventuell auch das unterschiedliche Alkoholkonsumverhalten bewirkt haben. Ein Humanexperiment zur schlüssigen Klärung dieser Frage ist aus ethischen und praktischen Gründen auszuschließen. Hiller-Sturmhöfel & Swartzwelder (2005) betonen, dass zur empirische Klärung dieser Frage eigentlich nur das Tierexperiment bleibt. Obwohl ausreichend bekannt ist, dass Effekte in Tierexperimenten nur bedingt auf Menschen übertragbar sind, weil der tierische Organismus sich in vielerlei Hinsicht vom menschlichen Organismus unterscheidet, behaupten Hiller-Sturmhöfel & Swartzwelder auf der Grundlage der ihnen zur Verfügung stehenden tierexperimentellen Daten, dass Alkoholkonsum in der menschlichen Adoleszenzperiode besonders anhaltende negative Auswirkungen auf Organismus und Gehirn haben könne. Unser Hauptargument gegen das Heranziehen von Tierexperimenten in Zusammenhang mit den gegenständlichen Fragestellung geht allerdings über die oben genannte bedingte Vergleichbarkeit hinaus und ist gravierender methodologischer Art. Tierexperimente sind teuer und aufwändig, und aus diesem Grund wird häufig versucht, langfristige Auswirkungen von moderaten Dosen durch die kurzfristige Applikation von Extremdosen zu approximieren – was angesichts des Umstandes, dass auch völlig harmlose Stoffe in Extremdosierungen hoch toxisch sind, sehr fragwürdig ist. Dazu kommt, dass viele relevante Effekte nur mit sehr großen Stichproben zufallskritisch abzusichern sind. Will man aus finanziellen Gründen mit wenigen Versuchstieren signifikante Effekte produzieren, muss man besonders extreme Dosierungen verwenden, was die ganze Versuchsanordnung noch fragwürdiger macht. Bevor man auf Tierexperimenten basierende Interpretationen als bare Münze nimmt, sollte man sich daher das Prozedere genau ansehen und die verwendeten Dosierungen auf Humanäquivalenzen umrechnen. Die Bereitschaft die Interpretationen einfach anzunehmen, wird bei dieser Vorgangsweise mit Sicherheit erheblich abnehmen. 3.3.3.1 Tierversuch als Beleg für eine höhere Alkoholvulnerabilität bei Kindern und Jugendlichen Diese methodologischen Probleme können am Tierexperiment, von White et al. (2000) anschaulich dargestellt werden. Dieses Projekt diente der Untermauerung der These, dass Jugendliche durch Alkohol langfristig stärker beeinträchtigt werden als Erwachsene. In der Studie wurden zwei Gruppen bestehend aus jeweils sieben adoleszenten und zwei Gruppen bestehend aus jeweils sieben erwachsenen Ratten (insgesamt 28 Tiere), nach einer gewissen Periode unter Alkoholeinfluss einem Gedächtnistest unterzogen. In der Versuchsanordnung wurde der Versuchsgruppe mit adoleszenten und der Versuchs24 gruppe mit erwachsenen Ratten 11-mal im Abstand von 2 Tagen eine wässrige Alkohollösung (17 Vol.-% Alkohol) in den Bauchraum gespritzt. Jeder Ratte wurden so 5 Gramm Reinalkohol pro Kilogramm Körpergewicht bzw. 30 Gramm wässrige Alkohollösung pro Kilogramm Körpergewicht verabreicht. Die beiden Kontrollgruppen erhielten auf die gleiche Weise eine identische Menge einer physiologischen Kochsalzlösung zugeführt. Das entspricht bei einem 70 Kilogramm schweren Menschen 350 Gramm Reinalkohol bzw. 2 Liter wässrige Alkohollösung bzw. physiologische Kochsalzlösung in den Bauchraum gespritzt. 350 Gramm Reinalkohol sind ungefähr jene Menge, die in 8 Litern Bier, in 4 Litern Wein bzw. in einem Liter Whisky enthalten ist. Diese Alkoholmenge ist so groß, dass sie in kurzer Zeit appliziert, bei einem alkoholunerfahrenen 70kg schweren Menschen eine tödliche Alkoholvergiftung hervorrufen kann. Die Injektion einer so großen Menge einer relativ hochprozentigen alkoholischen Lösung in die Bauchhöhle ist vermutlich weit schmerzhafter als die Injektion einer identischen Menge physiologischer Kochsalzlösung, ein Umstand, der leicht unterschiedliche Auswirkungen auf das Verhalten der Ratten erklären könnte, die nicht mit der eigentlichen Alkoholwirkung zusammenhängen. Drei der sieben erwachsenen Ratten der Versuchsgruppe waren 20 Tage nach Abschluss der Alkoholbelastung, noch immer so beeinträchtigt, dass sie am geplanten Gedächtnisexperiment im Labyrinth nicht mehr teilnehmen konnten. Das Ergebnis, dass alle adoleszenten Ratten der Versuchsgruppe aber nur die Hälfte der erwachsenen Ratten aus der Versuchsgruppe die Tortur mit den extremen Alkoholdosen weitgehend unbeschadet überstehen konnten, müsste eigentlich dafür sprechen, dass die adoleszenten Ratten sich der Belastung gegenüber resilienter erwiesen. Die Autoren kamen aber zum entgegengesetzten Ergebnis, indem sie die drei besonders beeinträchtigten erwachsenen Ratten einfach aus der Auswertung ausschlossen – eine Strategie, die wenig wissenschaftlich aber dafür ziemlich grotesk anmutet. 3.3.3.2 Tierversuch als Beleg für eine stärkere Schädigung des Gehirns bei adoleszenten Ratten Ein weiteres Experiment, das den Effekt von Alkohol auf die Gehirne von jugendlichen und erwachsenen Ratten untersuchen sollte, wurde von Crews et al. (2000) realisiert. Die dabei applizierte Alkoholdosis war mit 9 bis 10 Gramm Reinalkohol pro Kilogramm Körpergewicht rund doppelt so hoch wie bei White et al., wurde aber über einen ganzen Tag verteilt in den Magen appliziert. Das entspricht bei einem 70 Kilogramm schweren Menschen 630 bis 700 Gramm Reinalkohol. 700 Gramm Reinalkohol sind ungefähr jene Menge, die in 16 Litern Bier, in 8 Litern Wein bzw. in zwei Liter Whisky enthalten ist. Um 25 den Alkohol über den ganzen Tag kontinuierlich in den Magen pumpen zu können, war ein operativer Eingriff zur Applikation eines Magenkatheders und tagelanges Fasten danach notwendig. Es gab ein komplexes Design mit neun Gruppen á fünf Tieren. Die Tiere wurden zu verschiedenen Zeitpunkten, beginnend unmittelbar nach der Alkoholapplikation bis zu acht Tage danach, getötet und die Gehirne nach Schäden untersucht. In allen Gehirnen konnten Veränderungen festgestellt werden, bei den adoleszenten Ratten waren diese signifikant stärker. Auch hier ist die praktische Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Menschen angesichts der extrem hohen Alkoholmengen, der Magenoperation inklusive tagelanges Fasten davor und der geringen Stichprobengrößen pro Versuchsbedingung mehr als fraglich. 4 Der Einfluss des elterlichen Alkoholkonsums auf die Nachkommenschaft 4.1 Fetales Alkoholsyndrom (FAS), Fetale Alkoholeffekte (FAE) und Alkoholembryopathie (AE) Vom Anfang des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts herrschte in der Psychiatrie die Überzeugung, dass ein falscher Lebenswandel (wie etwa Alkoholismus) zu fortschreitender Degeneration des Erbgutes und damit zu Erbkrankheiten in der Nachkommenschaft führt. Diese im Wesentlichen auf den französischen Arzt Morel zurückgehende Lehre gilt inzwischen als widerlegt (Goddemeier, 2007). Alkohol hat nach dem aktuellen Stand der Forschung keinen mutagenen (Erbgut verändernden) Einfluss auf den Menschen, aber exzessiver Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft hat einen erheblich teratogenen (fruchtschädigenden) Einfluss auf die embryonale Entwicklung (Alkoholembryopathie). Väterlicher Alkoholkonsum spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Das Syndrom der Alkoholembryopathie wurde 1968 erstmals durch Lemoine in Frankreich beschrieben (Löser, 1999). Im englischsprachigen und zunehmend auch im deutschsprachigen Raum setzen sich dafür die Begriffe “fetales Alkoholsyndrom" (FAS) bzw. für leichtere Formen FAE (fetaler Alkoholeffekt) (Warren & Foudin, 2001) durch. Als Überbegriff für FAS und FAE haben Streissguth and O'Malley (2000) den Begriff FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) geprägt (Kopera-Frye et al., 2000). Da Alkohol die Plazentaschranke ungehindert überwindet, kann er direkten Einfluss auf die Entwicklung der Föten nehmen. Darüber hinaus können sich noch indirekte Effekte über alkoholbedingte Organkrankheiten (Lebererkrankungen, Störungen des Sexualhormonhaushalts etc.) sowie alkoholismusassoziierte Lebenszustände (ungesunder 26 Lebenswandel, Mangelernährung) der Mutter problematisch auf die Entwicklung von Ungeborenen auswirken. Für letzteres spricht nach Löser (1999) unter anderem, dass die FAS-Inzidenz in Gesellschaftsschichten mit niedrigem sozioökonomischem Status erheblich höher ist. Die Facetten des klinischen Bildes des FAS reichen von der leichten Normabweichung bis zur schweren intrauterinen Schädigung: zu kleiner Kopf (Mikrozephalie), körperliche Schmächtigkeit (postnatale Dystrophie), deutliche muskuläre Schwäche (Hypotonie), Entwicklungsverzögerung (mentale Retardierung), Herzfehler und kleinere Auffälligkeiten im Gesicht (kranofaziale Dysmorphie). Nach der Schwere der Schädigung unterscheidet man leichtes (FAS I), mäßig ausgeprägtes (FAS II) oder schweres fetales Alkoholsyndrom (FAS III). Eine gründliche Analyse aller bis zum Jahr 1987 durchgeführten internationalen Studien zur Häufigkeit des Syndroms ergab laut Spohr (1997) eine durchschnittliche Häufigkeit von 0,1% FAS-Geburten in der westlichen Welt. Laut Merzenich & Lang (2002) werden in Deutschland pro Jahr 2.200 Säuglinge geboren, die stark durch Alkohol geschädigt sind. Das sind 0,3% aller Geburten und grob geschätzt rund ein Viertel der Kinder, die von alkoholkranken Frauen zur Welt gebracht werden. Die Langzeitentwicklung der Kinder verläuft ungünstiger, als noch in den siebziger Jahren angenommen wurde. Obwohl sich die klinischen Auffälligkeiten im Gesicht mit der Zeit zurückbilden, bleiben die kognitiven Defizite bis in das Jugendalter ohne eine Tendenz zur erkennbaren intellektuellen Besserung bestehen. FAS gilt als die dritthäufigste Ursache für Entwicklungsstörungen. Es gibt keine sichere Alkoholgrenze, bis zu der eine Frau während der Schwangerschaft Alkohol zu sich nehmen kann, ohne den Embryo zu schädigen. Die vom amerikanischen Bundesgesundheitsamt Anfang der 80er Jahre ausgesprochene Empfehlung, während der Schwangerschaft überhaupt keinen Alkohol zu trinken, führte in den USA zu einer erheblichen Beunruhigung der Bevölkerung. Seither haben zahlreiche Studien ergeben, dass bei gesunden Frauen geringe Mengen Alkohol während der Schwangerschaft keine nachweisbaren Schäden beim Neugeborenen verursachen. Erst ab einem Alkoholkonsum von mehr als 120g reinen Alkohols pro Woche (das entspricht ungefähr einem Krügel Bier pro Tag) konnte eine signifikante Gewichts- und Längenminderung bei ansonsten gesunden Neugeborenen festgestellt werden (Spohr, 1997). Angesichts des Umstands, dass viele Frauen, zumindest bis sie erkennen, dass sie schwanger sind, Alkohol trinken, und angesichts des Umstands, dass es keine empirischen Hinweise dafür gibt, dass moderater 27 Alkoholkonsum während der Schwangerschaft die Gesundheit des Ungeborenen merklich schädigen kann, ist es nicht angezeigt, moderaten Alkoholkonsum während der Schwangerschaft über Gebühr zu dramatisieren und werdende Mütter sowie Frauen, die bereits Kinder geboren haben, zu verunsichern. Diese Ansicht vertritt auch das Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (2006). Es rät aber gleichzeitig, während der Schwangerschaft auf Alkohol weitgehend zu verzichten, da man geringfügige negative Effekte auf die ungeborenen Kinder zwar nicht nachweisen, aber auch nicht ausschließen kann. 4.2 Stillen und Alkoholkonsum – die doppelte Verdünnung Häufig wird nicht nur der Alkoholkonsum während der Schwangerschaft, sondern auch jeglicher Alkoholkonsum oberflächlicher während Betrachtung eine des Stillens Analogie problematisiert. zwischen Auch Alkoholkonsum wenn bei während der Schwangerschaft und während der Stillzeit plausibel erscheint, erweist sich sowohl diese Analogie als auch die Warnung, während der Stillzeit keinen Alkohol zu konsumieren, als unhaltbar. Den Unterschied macht, dass der im Getränk enthaltene Alkohol im Blut des Ungeborenen im Mutterleib bloß einfach, aufgenommen über die Muttermilch aber doppelt verdünnt wird. Dies bewirkt im ersten Fall eine durchaus relevante, in letzterem Fall aber eine vernachlässigbare Blutalkoholkonzentration, wie Uhl (2005a) mit einem Rechenbeispiel belegte: Wenn eine durchschnittlich schwere Frau einen Liter Bier mit 5 Vol.-% Alkohol trinkt, so erzielt sie maximal eine Blutalkoholkonzentration von 0,1 Vol.-% Alkohol oder 0,8 Promille 2. Der Alkoholgehalt im Blut eines ungeborenen Kindes und in der Muttermilch entspricht dann ziemlich genau dem Alkoholgehalt des mütterlichen Blutes. Berechnet man aus dem Alkoholgehalt von Bier (5 Vol.-% oder 40 Promille) den Alkoholgehalt im mütterlichen Blut, in der Muttermilch bzw. im ungeborenen Kind, so ergibt sich eine Verdünnung im Verhältnis 1:50 2 3 = 1:2500 (Tab. 3). Promille Blutalkoholkonzentration bedeutet in Österreich Gramm Alkohol pro Liter Blut und in Deutschland Gramm Alkohol pro Kilogramm Blut. Da 0,8 g Alkohol ca. 1 ml Alkohol entsprechen, entspricht 1 Vol.-% ziemlich genau 8 Promille. 3 Details zur Rechnung: Der Rechnung wurde eine schlanke Frau mit 70kg Körpergewicht zugrunde gelegt, bei der eine Körperwasserkonzentration von 57% realistisch ist. Ein Liter Bier entspricht in diesem Fall fast exakt 1,5% des Körpergewichtes – also jener relativen Menge Flüssigkeit, die auch ein Säugling bei einer Malzeit zu sich nimmt. 28 Tab. 3: Die doppelte Verdünnung des Alkoholgehalts beim Stillen g Alkohol pro Liter Vol.-% Alkohol Bier (Promille) 5 40 erste Verdünnung durch Trinkakt der Mutter 1:50 mütterliches Blut Blut des ungeborenen Kindes Muttermilch 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 zweite Verdünnung durch Trinkakt des Säugling 1:50 Blut des gestillten Säuglings 0,002 0,016 Quelle: (Uhl, 2005a) Trinkt ein Säugling bei einer Mahlzeit etwa 15 ml/kg oder 1,5% seines Körpergewichts Muttermilch (0,1 Vol.-% Alkohol), so ergibt sich bei ihm eine Zunahme des Blutalkoholspiegels um 0,002 Vol.-% oder 0,016 Promille. (Tab. 3). Vergleicht man nun den Alkoholgehalt von Bier mit dem Blutalkoholgehalt des Säuglings, so ergibt sich hier infolge der „doppelten Verdünnung“ (zweimal im Verhältnis von 1:50) eine Gesamtverdünnung von 1:2500. Die errechnete Zunahme der Blutalkoholkonzentration im Blut des gestillten Säuglings von 0,016 Promille entspricht der Hälfte des natürlichen Alkoholspiegels im menschlichen Blut von 0,03 Promille, der ohne externe Alkoholzufuhr durch natürliche Gärung als Stoffwechselnebenprodukt entsteht (Pfannhauser, 2004). Diese Menge wäre selbst dann vernachlässigbar gering, wenn jene ExpertInnen recht hätten, die postulieren, dass der Alkoholabbau bei kleinen Kindern erheblich verringert sei, was wir in Kap 3.3.1 anhand vorhandener empirischen Forschungsergebnisse bereits stark relativierten. Die oben ausgeführten Berechnungen basieren auf dem theoretisch maximal möglichen Blutalkoholspiegel, der aber tatsächlich nie erreicht werden kann, weil ein Teil des Alkohols bereits vor dem Erreichen des maximalen Alkoholspiegels metabolisiert wird. Besonders stark überschätzt wird der tatsächliche Alkoholspiegelgipfel mit den oben angestellten Berechnungen, wenn zeitgleich Speisen konsumiert werden und/oder wenn der Alkoholkonsum über einen längeren Zeitraum erfolgt. Das Problem lässt sich aber auch noch über einen Vergleich der Muttermilch mit anderen Getränken und Speisen relativieren. Ein Alkoholgehalt von 0,8g pro Liter Muttermilch ist erheblich weniger als jener in vielen alltäglichen Lebensmitteln. So enthält z.B. ein Liter frisch gepresster Apfelsaft 2g Alkohol, frisch gepresster Apfelsaft 6 Stunden nach der Pressung 6g Alkohol, ein kg Mischbrot 2g bis 4g Alkohol, reife Bananen 8 Tage nach dem 29 Einkauf 5g Alkohol, ein kg Sauerkraut 5g Alkohol oder Kefir 5g Alkohol (Pfannhauser, 2004). Tab. 4: Alkoholgehalt in Speisen und Getränken Gramm Alkohol (Promille) Vol.-% Alkohol pro Liter Flüssigkeit bzw. Kilogramm Speise Muttermilch, wenn Mutter 0,8 Promille 0,1 Blutalkoholkonzentration hat Traubensüßmost 0,8 0,8 6,4 (max. laut Gesetz) Kefir 0,63 5 Sauerkraut 0,63 5 0,25 – 0,5 2–4 Mischbrot alkoholfreies Bier 0,5 4 (max. laut Gesetz) Apfelsaft frisch gepresst Apfelsaft frisch gepresst nach 6 Stunden Reife Bananen nach 8 Tagen 0,25 2 0,75 6 0,63 5 Quelle: Pfannhauser, 2004 Nach einer weiteren Argumentationslinie ist stillenden Müttern vom Alkoholkonsum abzuraten: Mennella & Beauchamp (1991) fanden, dass Kinder, deren Mütter ein alkoholhältiges Getränk konsumiert hatten, weniger Muttermilch zu sich nahmen, als wenn die Mütter vor dem Stillen Fruchtsaft getrunken haben. Da es sich hier um einen einmaligen Versuch mit 12 Versuchsmüttern handelte, da die Muttermilch bloß 0,3 Promille Alkohol aufwies, da man ähnliche Effekte auch nach dem Konsum anderer Speisen vermuten kann, und da Kinder einen einmaligen Minderkonsum bei den Folgemahlzeiten leicht ausgleichen können, ist die praktische Relevanz dieser Ergebnisse sehr fraglich. Eine adäquate Versuchsanordnung müsste auch den Einfluss anderer Nahrungs- und Genussmittel vergleichen und mittels einer längerfristigen Versuchsanordnung prüfen, inwieweit eine durch die Ernährungsgewohnheiten der Mutter kurzfristig verringerte Nahrungsaufnahme bei späteren Mahlzeiten kompensiert wird. Eine weitere Hypothese, dass Alkoholgeschmack in der Muttermilch bewirke, dass Kinder später eher Alkohol konsumieren, ist ebenso wenig gesichert wie die Hypothese, dass ein erhöhter Alkoholspiegel die Milchproduktion verringere (Mennella, 2001). Es gibt keinen vernünftigen Grund, stillenden Müttern, die Alkohol getrunken haben, zu raten ihre Milch vor dem Alkoholkonsum abzupumpen und die Kinder später mit der Flasche zu füttern. 30 Das wichtigste Argument freilich, stillenden Müttern von regelmäßigem stärkerem Alkoholkonsum abzuraten, ist deren eigene Gesundheit. 4.3 Soziale und psychische Auswirkungen des elterlichen Alkoholkonsums Eine der zentralsten Fragen im Zuge der Auseinandersetzung mit der gegenständlichen Thematik ist jene nach möglichen Auswirkungen einer elterlichen Alkoholerkrankung auf die Nachkommen. Eine einfache Antwort – wie oft erwünscht – ist allerdings nicht möglich, die Annäherung an die Thematik macht schnell deren Komplexität deutlich. Zahlreiche Studien belegen ein erhöhtes Risiko von Kindern alkoholkranker Eltern für eigene Suchterkrankungen bzw. andere psychische Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen oder externalisierende Probleme (Klein, 2001, 2005, Reviews von Lachner & Wittchen, 1995, Sher, 1991, West & Prinz, 1987, Zobel, 2006). Das höhere Entwicklungsrisiko von Kindern aus alkoholbelasteten Familien ist empirisch gut belegt, trotzdem ist die oft vereinfachte Darstellung der Situation Betroffener aus verschiedenen Gründen als problematisch zu erachten: So entsteht fälschlicherweise der Eindruck, dass einerseits die elterliche Alkoholerkrankung die alleinige Ursache für eventuelle Probleme der Kinder bzw. Jugendlichen ist und andererseits alle Kinder bzw. Jugendlichen (gleichermaßen) von einer elterlichen Alkoholerkrankung betroffen sind. Viele Publikationen nehmen einseitige Zuschreibungen vor, d.h. beobachtete Outcomes der Kinder werden voreilig und meist auch ausschließlich der elterlichen Abhängigkeitserkrankung zugeschrieben; begünstigt werden diese Interpretationen u.a. durch methodische Mängel. Werden zusätzliche Einflussfaktoren (z.B. Disharmonie der Elternbeziehung oder sozioökonomische Nachteile) berücksichtigt, so sind die Zusammenhänge zwischen elterlicher Alkoholerkrankung und den Outcomes der Kinder nicht mehr so eindeutig. Des Weiteren zeigen Vergleiche mit Kindern depressiver Eltern Ähnlichkeiten der beiden Gruppen. Diese Ergebnisse machen deutlich, dass weniger die elterliche Erkrankung als solches, sondern die damit oft verbundenen ungünstigen psychosozialen Entwicklungsbedingungen bzw. deren Interaktion miteinander für die möglichen Beeinträchtigungen bei den Kindern verantwortlich sind. Bekannt ist, dass nicht das Vorhandensein einzelner Risikofaktoren (wie eben eine elterliche Abhängigkeitserkrankung), sondern die Kumulation verschiedener Risikofaktoren eine besondere Belastung darstellt (Lösel & Bender, 2007, Niebank & Petermann, 2002, Oerter, 1999), da diese einander wechselseitig verstärken (Mattejat et al., 2000). Kinder alkoholkranker Eltern sind im Vergleich zu Kindern aus nicht-alkoholbelasteten Familien 31 einer größeren Anzahl an bekannten, allgemeinen Risikofaktoren wie z.B. elterlicher Disharmonie, gestörtem Bindungsverhalten, inadäquater sozialer Unterstützung und sozialer Isolation ausgesetzt (Chassin et al. 1993, Klein, 2002, Zobel, 2006, Frank 2002). Zentrale Feststellung bei der Frage nach möglichen Auswirkungen einer elterlichen Alkoholerkrankung ist, dass nicht die elterliche Alkoholerkrankung per se für die Probleme der Kinder verantwortlich gemacht werden kann, sondern das Vorhandensein mehrerer, mit einer Alkoholerkrankung häufig assoziierter, psychosozialer Risikofaktoren bei der Interpretation von Ergebnissen berücksichtigt werden muss. Die Auswirkungen einer elterlichen Alkoholerkrankung sind sehr heterogen: Das Spektrum reicht von Kindern, die eine unauffällige Entwicklung durchlaufen bis hin zu Kindern mit schwerwiegenden psychischen, physischen und sozialen Problemen. Eine elterliche Suchterkrankung wird meist mit Problemen bei den Nachkommen assoziiert, es gilt aber zu berücksichtigen, dass – so u.a. die Ergebnisse einer Längsschnittsuntersuchung von Werner (1986) – auch Kinder, die einer Vielzahl von Risikofaktoren ausgesetzt sind, nicht zwangsläufig in ihrer Entwicklung relevant beeinträchtigt sind. Ein Großteil der von ihr untersuchten Kinder konnte sich trotz zahlreicher Risikofaktoren gesund entwickeln, ein Phänomen das unter dem Begriff der Resilienz zusammengefasst wird (vgl. Kap. 2.2). 5 Altersgrenzen im Jugendschutz und Sanktionen Häufig wird die Frage gestellt, ab welchem Alter Jugendliche in bestimmten Ländern Alkohol trinken dürfen. Diese Frage ist insofern schwer zu beantworten, als es hier eine Fülle von Aspekten zu unterscheiden gibt. Das Phänomen kann auf der Seite des Jugendlichen (Trinkverbot sowie Kaufverbot), auf der Seite des Erwachsenen (Abgabeverbot), auf der Seite des Handels (Verkaufsverbot) und auf der Seite der Gastronomie (Ausschankverbot) geregelt sein, wobei ein explizites Konsumverbot in der Regel ein Abgabeverbot, Verkaufsverbot und Ausschankverbot impliziert, auch wenn dieses gesetzlich nicht explizit vorgeschrieben ist. Es kann Verbote geben, die ausschließlich den öffentlichen Raum betreffen oder generelle Verbote, die auch den privaten Raum einschließen. Es kann unterschiedliche Altersgrenzen für Bier, Wein und Spirituosen oder ein einheitliches Schutzalter geben. Es kann darüber hinaus noch eine Fülle von Zusatzregeln geben, wie dass Personen in einem bestimmten Altersbereich (z.B. zwischen 16 und 18 Jahren) nicht mehr als 0,5 Promille Blutalkoholkonzentration erreichen dürfen (Bestimmung im Kärntner Jugendschutzgesetz) etc.; dazu kommt noch, dass in manchen Staaten, wie in Österreich die Bestimmungen regional stark variieren. 32 Basierend auf einer Übersichtsarbeit von Uhl & Kobrna (2007), in die die 27 EU-Staaten plus Norwegen und Schweiz einbezogen wurden, kann man folgendes festhalten: • In 25 Staaten ist der alkoholspezifische Jugendschutz im gesamten Land gleich geregelt – nur in Österreich, Schweiz, Italien und Spanien gibt es regionale Unterschiede. • In 28 Staaten gibt es ein gesetzliches Schutzalter für Alkoholkonsum in der Gastronomie, nur in Griechenland unterliegt der Konsum von Bier und Wein in der Gastronomie keiner altersmäßigen Beschränkung. • In 28 Staaten gibt es ein gesetzliches Schutzalter für Alkoholerwerb im Handel, nur in Italien (außer Südtirol) unterliegt der Erwerb von alkoholischen Getränken im Handel keiner altersmäßigen Einschränkung. • In 18 Staaten werden alle alkoholischen Getränke gleich behandelt, in 7 (Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Niederlande, Norwegen) ist das Schutzalter für gebrannte Getränke (Spirituosen) höher und in 4 Staaten (Schweiz, Spanien, Italien und Österreich) gibt es diesbezüglich regionale Unterschiede. • in 3 Staaten gibt es unter manchen Umständen „gar kein Schutzalter“ (Belgien, Italien und Griechenland), in 10 Staaten beträgt das niedrigste Schutzalter „16 Jahre“, in einem Staat „17 Jahre“ und in 16 Staaten „18 Jahre“. • in 4 Staaten ist das höchste Schutzalter „16 Jahre“ (Luxemburg, Italien, Portugal und Malta), in 2 Staaten „17 Jahre“ (Griechenland, Zypern) in 20 Staaten „18 Jahre“ und in 3 Staaten „20 Jahre“ (Finnland, Norwegen, Schweden). • Der Alkoholkonsum im Privatbereich ist 26 Staaten nicht geregelt. In 2 Staaten (Estland und Zypern) unter dem Schutzalter verboten und in Österreich kommt je nach Region beides vor. In den drei Staaten, die den Privatbereich (teilweise) regeln, sind im Falle des Zuwiderhandelns auch Strafen für Jugendliche vorgesehen. • In 22 Staaten sieht der Jugendschutz Strafen für Erwachsene vor, die jungen Menschen unter dem Schutzalter in Gastronomie und Handel alkoholische Getränke ausschenken oder verkaufen aber keine Strafen für die Jugendlichen selbst. Strafen für Jugendliche, die in der Öffentlichkeit Alkohol konsumieren oder erwerben sind nur in 7 Staaten (Österreich, Malta, Zypern, Tschechische Republik, Estland, Großbritannien, Irland) vorgesehen. Darüber, wie der alkoholspezifische Jugendschutz geregelt werden sollte, gibt es in Österreich recht unterschiedliche Auffassungen, die in den jeweiligen Jugendschutzbestimmungen festgelegt sind. Orientiert man sich an EU-Normen, so ist klar, dass der alkoholspezifische Jugendschutz primär auf den öffentlichen Raum zielen sollte und dass Sanktionen keinesfalls die Jugendlichen selbst treffen sollten. 33 Angesichts des Umstandes dass derzeit in Österreich fast niemand die alkoholspezifische Jugendschutzbestimmungen präzise kennt, deren Kenntnis aber eine Voraussetzung dafür ist, dass sie eingehalten werden können, wären bundesweit einheitliche Altersgrenzen und möglichst einfache Bestimmungen zweckmäßig. Im Sinne dieser Einfachheit sollten spezielle Zusatzregelungen und unterschiedliche Schutzalter für unterschiedliche Getränke wegfallen. Angesichts des Umstandes, dass Alkoholkonsum ein integraler Bestandteil des kulturellen und sozialen Lebens in Österreich ist und dass 16Jährige akzelerationsbedingt sich heute in den meisten Bereichen recht autonom und erwachsen verhalten – diesem Umstand wurde u.a. in einigen Bundesländern durch die Herabsetzung des Wahlalters Rechnung getragen – erscheint die Festlegung eines generellen Schutzalters von 16 Jahren den österreichischen Verhältnissen angemessener als eine generelle Anhebung auf 18 Jahre. Ausdrücklich zu betonen ist, dass eine Festlegung, wie ein Mindestalter für den Alkoholkonsum, einer normativ-ethischen Entscheidung bedarf und dass eine solche („Was sein soll“) nie alleine aus dem Faktischen („Was ist“) ableitbar ist. Allerdings kann man festhalten, dass, wie oben ausgeführt, 16-Jährige heute in einem Ausmaß selbständig und erwachsen sind, dass Verbote von Verhaltensweisen, die für Erwachsene selbstverständlich sind, schwer zu rechtfertigen und schwer durchzusetzen sind. Außerdem finden in einer modernen Gesellschaft willkürliche Verbote ohne sachliche Begründung zunehmend weniger Akzeptanz. Der Versuch, mit empirischen Daten eine stark erhöhte Alkoholvulnerabilität für Jugendliche zu untermauern, steht, wie wir im gegenständlichen Aufsatz zeigen konnten, bis dato auf sehr tönernen Füßen. Hier ist auch noch die Frage relevant, wieweit unterschiedliche Grenzen für Bier und Wein auf der einen Seite und Spirituosen bzw. spirituosenhältige Getränke auf der anderen Seite sachlich rechtfertigbar sind. Grundsätzlich macht es keinen Unterschied, ob Alkohol in natürlicher Form in einem Getränk enthalten ist, oder ob man diesen daraus destilliert und einem anderen Getränk zufügt. Im Zuge der Destillation besteht die Möglichkeit, schädliche Alkoholanteile gesundheitlich ein Vorteil (Methylalkohol wäre, aber und da Fuselstoffe) Spirituosen oft zu aus entfernen, was minderwertigen Ausgangsstoffen erzeugt werden, kommt auch das Gegenteil vor. Ob man einen süßen Ribiselwein oder einen bezüglich Alkoholgehalt und Zucker vergleichbaren Alkopop trinkt, ist aus dieser Perspektive irrelevant. Überschätzt wird der Anteil schädlicher Zusatzstoffe in Spirituosen oft dadurch, dass deren Menge im Getränk (z.B. Whisky, Wein, Bier) und nicht die Menge pro Gramm Reinalkohol verglichen wird. Es geht ja um die Menge Methylalkohol und Fuselstoffe, die in einem Zeitraum tatsächlich konsumiert werden – und im Normalfall trinken Menschen z.B. erheblich größere Mengen Bier als Whisky. Ein höheres Risiko geht von Spirituosen 34 im Vergleich zu Bier und Wein ausschließlich dadurch aus, dass man sich – wenn man pure Spirituosen rasch trinkt – leichter in kurzer Zeit betrinken kann, weil der höhere Wassergehalt in Bier und Wein angesichts der Begrenztheit des Magens hier physiologische Grenzen setzt. 6 Zusammenfassung/Schlusskapitel Es steht außer Frage, dass exzessiver Alkoholkonsum häufig nachhaltige negative Effekte auf Gesundheit, Psyche und soziale Aspekte hat und zwar betrifft das Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass moderater Alkoholkonsum beim gesunden Erwachsenen relativ unbedenklich ist. Angesichts des breiten gesellschaftlichen Konsenses darüber, dass Kindern und Jugendlichen bis zu einem gewissen Schutzalter relevanter Alkoholkonsum kategorisch untersagt werden sollte, stellt sich die Frage, wie es um die weitgehende Unbedenklichkeit moderaten Alkoholkonsums bei Kindern und Jugendlichen steht. Könnte man eine erhebliche Gefährdung von Kindern und Jugendlichen bereits durch geringe Alkoholmengen belegen, so wäre es viel leichter das Alkoholverbot für Kinder und Jugendliche diesen gegenüber zu rechtfertigen. Frei nach Christian Morgensterns Palmströmliedern „Also schloss er messerscharf, das nicht kann sein, was nicht sein darf.“ ist unter solchen Rahmenbedingungen die Versuchung groß, empirische Befunde einseitig so zu deuten, dass das herauskommt, was einem in Zusammenhang mit der Begründung des alkoholspezifischen Jugendschutzes argumentativ nützlich erscheint. Es ist allerdings ein Gebot wissenschaftlicher Sachlichkeit, Fakten möglichst unabhängig von gewünschten Ergebnissen zu bewerten und zu interpretieren. Wenn man das tut, gibt es, wie im gegenständlichen Artikel aufgezeigt werden konnte, wenig Evidenz dafür, die Gefahren des moderaten Alkoholkonsums bei Kindern und Jugendlichen stark zu dramatisieren. Es kann im Lichte der gegenwärtigen wissenschaftlichen Befunde kein sachlicher Beleg gefunden werden, die adäquate Anwendung alkoholhältiger Medikamente auf Kinder zu problematisieren. Es gibt keinen sachlichen Grund, kategorisch darauf zu bestehen, dass Kinder und Jugendliche unter keinen Umständen Alkohol kosten dürfen, was in einer Kultur, wo Alkohol zentraler Bestandteil des sozialen und kulturellen Lebens der Erwachsenen ist, ohnehin kaum durchsetzbar ist. Und es gibt auch keinen sachlichen Grund, den bei Jugendlichen kaum zu verhindernden moderaten Alkoholkonsum über Gebühr zu dramatisieren. Aussagen, die immer wieder zur Unterstützung der gegenteiligen These herangezogen werden, basieren entweder (1) auf der theoretischen, empirisch aber nicht untermauerten Überlegung, dass noch in Entwicklung befindliche Organsysteme besonders leicht nachhaltig geschädigt werden können, 35 (2) auf inadäquat interpretierten epidemiologischen Korrelationsbefunden oder (3) auf Tierexperimenten mit Extremdosierungen, die nicht seriös auf realistische Humansituationen übertragbar sind. Diese kritischen Ausführungen bezüglich wissenschaftlicher Befunde, die die besondere Gefährlichkeit von Alkohol für Kinder und Jugendliche nicht beweisen können, sollen jedoch nicht zu Missinterpretationen führen: Dass exzessiver Alkoholkonsum bei Kindern und Jugendlichen – wie auch bei Erwachsenen – ein großes Problem darstellt, welches präventive und therapeutische Interventionen erfordert, steht genauso wenig in Widerspruch zu dem Gesagten – wie das Festhalten an Jugendschutzbestimmungen, die jungen Menschen bis zum 16. Lebensjahr den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit verbieten. Bei Kinder und Jugendlichen haben die Eltern einen umfassenden Erziehungsauftrag. Sie sollen Fähigkeiten vermitteln, lenken und gegebenenfalls Grenzen setzen. In Bereichen, wo die Eltern dieser Aufgabe nicht nachkommen können, weil sie nicht anwesend sind, übernimmt diese Aufgabe teilweise die Gesellschaft, z.B. durch Schulgesetze und Jugendschutzbestimmungen. Wo die Eltern die Aufgabe grob vernachlässigen ist die Jugendwohlfahrt gefordert. Zum demokratischen Gesellschaftsverständnis gehört, dass diese Erziehungsaufgabe bei Kindern und Jugendlichen bis zum Erwachsenenalter schrittweise in Eigenverantwortung übergeht, und dass die Gesellschaft bei Erwachsenen nur mehr in Extremfällen intervenieren darf. So gibt es z.B. nur dann eine legale Möglichkeit, bei erwachsenen Alkoholmissbrauchern zu intervenieren, wenn diese sich selbst oder andere massiv gefährden. Bei Jugendlichen sollten jedenfalls überschießende Kontrollansprüche vermieden werden, die eventuell paradoxe Auswirkung im Sinne von Bumerangeffekten bewirken könnten. 36 7 Literatur Agarwal, D.P.; Agarwal-Kozlowski, K. (1999): Genetische Aspekte von Alkoholismus und alkoholassoziierten Organschäden. in: Singer, M.V.; Teyssen, S. (Hrsg.): Alkohol und Alkoholfolgekrankheiten. Springer, Berlin Babor, T.; Caetano R.; Casswell, S.; Edwards, G.; Giesbrecht, N.; Graham, K.; Grube, J.; Gruenewald, P.; Hill, L.; Holder, H.; Homel, R.; Österberg, E.; Rehm, J.; Room, R.; Rossow, I. (2003): Alcohol: No Ordinary Commodity - Research and Public Policy. Oxford University Press, New York Burgerstein, L. (1918): Alkohol und Schule, Vortrag gehalten in der österreichischen Gesellschaft für Schulhygiene, Sonderabdruck aus der Zeitschrift: Das österreichische Sanitätswesen, Jg. 29, Nr. 9-26 Alfred Hölder Verlag, 1918, Wien. Reprint in Wiener Zeitschrift für Suchtforschung, 24, 3/4, 85-101, 2001 Chassin, L., Pillow, D.R., Curran, P.J., Molina, B.S.G., Barrera, M. (1993): Relation of Parental Alcoholism to Early Adolescent Substance Use: A Test of Three Mediating Mechanisms. Journal of Abnormal Psychology, Vol. 102, 1, 3-19 Crews F.T, Braun C.J, Hoplight B, et al. Binge ethanol consumption causes differential brain damage in young adolescent rats compared with adult rats. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 24:1712-1723; 2000. Demmel, R. (2004): Potemkinsche Wissenschaft: Lesen Sie noch bevor sie zitieren?. Sucht, 50, 40, 224-225 EMCDDA (2007): The overall framework of prevention strategies. http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index1568EN.html (31.12.2007) SFA (2008) Alkohol und Gesundheit, Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme, Lausanne Frank, H. (2002): Risikokinder. Wiener Zeitschrift für Suchtforschung, 25, 1/2, 83-92 Goddemeier, C. (2007): Medizingeschichte: Zu den Deutsches Ärzteblatt; 104, 40, A-2714-2716 Gruber, Wurzeln „entarteter“ Kunst. Ch.; Kobrna, U.; Uhl, A.; Springer, A. (2004): Evaluation des niederösterreichischen Pilotprojekts "Jugend-OK-Partnerbetrieb" Alkoholprävention und Jugendschutz im Bereich der Gastronomie. Forschungsbericht des LBISucht, Wien www.api.or.at/lbi/download.htm Hiller-Sturmhöfel,S. Swartzwelder, H.S, (2005) Alcohol’s Effects on the Adolescent Brain - What Can Be Learned From Animal Models. Alcohol Research & Health Vol. 28, No. 4, 2004/2005 Hurrelmann, K., Rosewitz, B., Wolf, H.K. (1985) Lebensphase Jugend – eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung. Juventa Verlag. Weinheim und München ICAP (1998): Drinking Age Limits. ICAP Reports 4, International Center for Alcohol Policies, Washington D.C. Jessor, R. (1987): Problem-Behavior Theory, Psychosocial Development, and Adolescent Problem Drinking. British Journal of Addiction, 82, 331-342 37 Khantzian, E.J. (1997): The Self-Medication Hypothesis of Substance Use Disorders: A Reconsideration and Recent Applications. Havard Rev Psychiatry, 4, 5, 231244 Klein, M. (2001): Kinder aus alkoholbelasteten Familien – Ein Überblick zu Forschungsergebnissen und Handlungsperspektiven. Suchttherapie 2, 118 – 124 Klein, M. (2002): Die besondere Gefährdung für Kinder aus Suchtfamilien – Präventive Ansätze. In: Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk der EKD (Hrsg.): Handbuch für die Suchtkrankenhilfe, 1-6. Wuppertal: Blaukreuz Klein, M. (2005): Kinder und Jugendliche aus alkoholbelasteten Familien. Stand der Forschung, Situations- und Merkmalsanalyse, Konsequenzen. Regensburg: Roderer Kopera-Frye, K.; Connor, P.D.; Streissguth, A.P. (2000): Neue Erkenntnisse zum fötalen Alkoholsyndrom - Implikationen für Diagnostik, Behandlung und Prävention, Washington D.C. www.agsp.de/UB_Veroffentlichungen/Aufsatze/Aufsatz_12/ hauptteil_aufsatz_12.html (Stand 1.3.2007) Kraus, L.; Uhl, A. (2006): Wie nahe kommt die Forschungsrealität dem Wunsch, kausale Beziehungen zwischen Substanzkonsum und Tod herzustellen? (Editorial). Suchttherapie, 7, 4, 141-142 <www.api.or.at/lbi/download.htm> Lachner, G., Wittchen, H.-U. (1995): Familiär übertragene Vulnerabilitätsmerkmale für Alkoholmissbrauch und –abhängigkeit. Zeitschrift für Klinische Psychologie, 24 (2), 118-146 Lakatos, I. (1978): Die Geschichte der Wissenschaft und ihre rationale Rekonstruktion. In: Diederich, W. (Hrsg.): Theorien der Wissenschaftsgeschichte - Beiträge zur diachronischen Wissenschaftstheorie. Suhrkamp, Frankfurt a.M. Lösel, F., Bender, D. (2007): Von generellen Schutzfaktoren zu spezifischen protektiven Prozessen: Konzeptuelle Grundlagen und Ergebnisse der Resilienzforschung. In: Opp, G., Fingerle, M.: Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz. München: Verlag Ernst Reinhardt Löser, H. (1999): Alkohol und Schwangerschaft - Alkoholeffekte bei Embryonen, Kindern und Jugendlichen. In: Singer, M.V.; Teyssen, S. (Hrsg.): Alkohol und Alkoholfolgekrankheiten. Springer, Berlin Mader, P. (2001): Alkohol Basisinformation. Suchtgefahren e.V. , Hamm Deutsche Hauptstelle gegen die Mattejat, F., Wüthrich, C., Remschmidt, H. (2000): Kinder psychisch kranker Eltern. Forschungsperspektiven am Beispiel depressiver Eltern. Der Nervenarzt, Jg.71, 164-172 Mennella, J. (2001): Alcohol's Effect on Lactation. Alcohol Research & Health, 25, 3, 230234 Mennella, J.; Beauchamp, G. (1991): The Transfer of Alcohol to Human Milk Effects on Flavour and the Infant's Behaviour. The New England Journal of Medicine, 325, 14, 981-985 38 Merzenich, H.; Lang, P. (2002): Alkohol in der Schwangerschaft – Ein kritisches Resümee. Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, Bd. 17, BzGA, Köln Niebank, K., Petermann, F. (2002): Grundlagen und Ergebnisse der Entwicklungspsychopathologie. In: Petermann, F. (Hrsg.): Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie und –psychotherapie, 5. korr. Auflage, 57-94. Göttingen: Hogrefe Oerter, R. (1999): Klinische Entwicklungspsychologie: zur notwendigen Integration zweier Fächer. In: Oerter, R., von Hagen, C., Röper, G., Noam, G. (Hrsg.): Klinische Entwicklungspsychologie. Ein Lehrbuch, 1-10. Weinheim: Psychologie Verlags Union Pfannhauser, W. (2004): Alkohol: Freund oder Feind? Aspekte der Lebensmittelchemie, Vortrag am ÖGE - Symposium "Alkoholprävention" am 19. September. Technische Universität Graz, Institut für Lebensmittelchemie und technologie, Graz Popper, K.R. (1934): Logik der Forschung, sechste verbesserte Auflage (1976) . J.C.B.Mohr, Tübingen Ragan, F.A.; Samuels, M.S.; Hite, S.A. (1979): Ethanol Ingestion in Children. A Five-Year Review. The Journal of the American Medical Association, 242, 25, 2787-2788 Rommelspacher, H. (2003): Substanzeigenschaften. in: Schmidt, L.; Konrad, N.; Rommelspacher, H.; Schmidt, K.; Singer, M.; Teyssen, S.: Alkoholabhängigkeit. Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren e.V., Hamm Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (2006): Alcohol Consumption and the Outcomes of Pregnancy . RCOG Statement No. 5, Sheffield Schuckit, M.A. (1979): Treatment of Alcoholism in Office and Outpatient Settings. In: Mendelson, J.H. & Mello. N.K. (Eds.): Diagnosis and Treatment of Alcoholism. McGraw-Hill, New York. Sher, K.J. (1991): Children of alcoholics: a critical appraisal of theory and research. Chicago: The University of Chicago Press Spohr, H.L. (1997): Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft und die Folgen für das Kind: aus Mitteilung der Deutschen Liga für das Kind. http://www.mosesonline.de/web/212/251/ (21.1.2007) Springer, N. (2004): Konfliktlösungsstrategien und Beziehungsstrukturen bei primären und sekundären Alkoholikern, Diplomarbeit an der Fakultät der Psychologie. Universität Wien, Wien Tapert, S.F., Caldwell, L.; Burke, C. (2005): Alcohol and the Adolescent Brain Human Studies. Alcohol Research & Health, 28, 4, 205-212 Uhl, A. (2000): The Limits of Evaluation. In: Neaman, R.; Nilson, M.; Solberg, U.: Evaluation - A Key Tool for Improving Drug Prevention. EMCDDA Scientific Monograph Series, No 5, Lisbon www.api.or.at/lbi/download.htm Uhl, A. (2003): Jugend und Alkohol - mit besonderer Berücksichtigung des rauschhaften Trinkens. praev.doc, 1, 3-10 www.api.or.at/lbi/download.htm 39 Uhl, A. (2007): How to Camouflage Ethical Questions in Addiction Research. In: Fountain, J.; Korf, D.J. (eds.): Drugs in Society European Perspectives. Drugs in Society European Perspectives, Oxford Uhl, A.; Bachmayer, S.; Kobrna, U.; Springer, A.; Kopf, N.; Beiglböck, W.; EisenbachStangl, I.; Preinsperger, W.; Musalek, M. (2008): Handbuch: Alkohol Österreich: Zahlen, Daten, Fakten, Trends 2008. dritte überarbeitete und ergänzte Auflage. BMGFJ, Wien www.api.or.at/lbi/download.htm Uhl, A.; Kobrna, U. (2003): Epidemiologie des geschlechtsspezifischen Alkoholgebrauchs. Wiener Zeitschrift für Suchtforschung, 26, 3/4, 5-19 www.api.or.at/lbi/download.htm Uhl, A.; Kobrna, U. (2007): Alkoholspezifischer Jugendschutz in Europa. Wiener Zeitschrift für Suchtforschung, 1/2 www.api.or.at/lbi/download.htm Uhl, A.; Springer, A.; Kobrna, U.; Bachmayer, S. (2003): Expertise über alkohol- und nikotinspezifische Jugendschutzbestimmungen in Österreich und International. Forschungsbericht des LBISucht, Wien www.api.or.at/lbi/download.htm Uhl, A.; Springer, A.; Kobrna, U.; Gnambs, T.; Pfarrhofer, D. (2005b): Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch - Erhebung 2004, Band 1: Forschungsbericht. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, Wien, www.api.or.at/lbi/download.htm Volkow, N.D. (2005): Editorial: What do we know about drug addiction? American Journal of Psychiatry, 162, 8, 1401–1402 Warren, K.R.; Foudin, L.L. (2001): Alcohol-Related Birth Defects, The Past, Present and Future. Alcohol Research & Health, 25, 3, 153-158 Werner (1986): Resilient Offspring of Alcoholics: A Longitudinal Study from Birth to Age 18. Journal of Studies on Alcohol, 47, 34-40 West, M.O., Prinz, R.J. (1987): Parental alcoholism and childhood psychopathology. Psychological Bulletin, 102, 204-218 White, A.M.; Ghia, A.J.; Levin, E.D.; Swartzwelder, H.S. (2000): Binge Pattern Ethanol Exposure in Adolescent and Adult Rats: Differential Impact on Subsequent Responsiveness to Ethanol. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24, 8, 1251-1256 Zingerle, H. (2005): Das Konzept der Rauschmündigkeit. Wiener Zeitschrift für Suchtforschung, 28, 3/4, 59-62. http://www.api.or.at/wzfs/ Zobel, M. (2006): Kinder aus alkoholbelasteten Familien. Entwicklungsrisken und chancen. 2., überarbeitete Auflage. Göttingen: Hogrefe 40