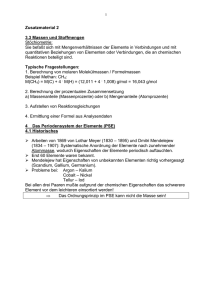Vorlesung PC I (Einführung in die Physikalische Chemie)
Werbung

Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Vorlesung PC I (Einführung in die Physikalische Chemie) für Studierende der Bachelor-Studiengänge „Chemie" und „Water Science“ C. Mayer Wintersemester 2012 / 2013 Vorlesung: Übungen: Mittwoch, 08:00 bis 10:00, S04 T01 A02 Dienstag, 09:00 bis 10:00, S05 T00 B32 Beginn der Vorlesung: Ende der Vorlesung: Mittwoch, den 17. Oktober 2012, 08:15 Uhr Mittwoch, den 06. Februar 2013 1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Chemie: die Physik der Elektronen in Atomen und Molekülen Das Elektron als Elementarteilchen Die Ladung des Elektrons Der Radius des Elektrons Die Doppelnatur des Elektrons Das Wasserstoffatom Atome mit mehreren Elektronen Moleküle 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Die Elektronenspektroskopie an Atomen und Molekülen Grundlagen der Spektroskopie Elektronenspektroskopie am eindimensionalen Potentialtopf Elektronenspektroskopie am Wasserstoffatom Elektronenspektroskopie an Atomen mit mehreren Elektronen Elektronenspektroskopie an Molekülen 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Das Zusammenwirken von Atomen und Molekülen Der makroskopische Zustand von Materie Zustandsgleichung für Gase: die ideale Gasgleichung Das kinetische Gasmodell Die korrigierte Gasgleichung nach van der Waals Andere Zustandsgleichungen für reale Gase Beschreibung von Flüssigkeiten Beschreibung von Festkörpern Das Phasendiagramm 1 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer 1 Chemie: die Physik der Elektronen in Atomen und Molekülen 1.1 Das Elektron als Elementarteilchen Das zentrale Elementarteilchen, das alle Vorgänge in der Chemie dominiert, ist eindeutig das Elektron. Die chemischen Eigenschaften jedes Elements und jeder Verbindung, der Ablauf chemischer Reaktionen und alle Phänomene, die mit chemischen Reaktionen verbunden sind werden nahezu ausschließlich durch Vorgänge im Bereich der Elektronenhüllen bestimmt. Kurz: das Elektron ist der Schlüssel zum Verständnis der Chemie. Tatsächlich könnte man mit einiger Berechtigung sagen, die Chemie sei die Wissenschaft über das Verhalten von Elektronen zwischen Atomen und Molekülen. Daher besteht der erste notwendige Schritt zum tieferen Verständnis chemischer Vorgänge in dem Erfassen aller Eigenschaften und Phänomene dieses Elementarteilchens. Das Elektron (häufig mit dem Symbol e- bezeichnet) ist neben seinem Antiteilchen, dem Positron, nach heutigem Kenntnisstand das leichteste elektrisch geladene Elementarteilchen. Es besitzt keine bekannte Unterstruktur, gehört zu den Leptonen (s. Abb. 1) und ist damit – wie die so genannten Quarks – ein „echtes“ Elementarteilchen. Es gilt als absolut stabil, besitzt jedoch mindestens eine Lebensdauer von 1024 Jahren. Abb. 1: Das Elektron als Schlüsselteilchen in der Chemie und seine Rolle unter den Elementarteilchen. Im Folgenden werden nun einzelne, wichtige Eigenschaften des Elektrons betrachtet, die für chemische Belange von Bedeutung sind. 1.2 Die Ladung des Elektrons Die Ladung des Elektrons wurde im Jahr 1911 von dem Physiker Millikan gemessen, wofür er 1923 den Nobelpreis erhielt. Bei dem Versuch werden Öltropfen in eine evakuierte Kammer zwischen zwei Elektroden gesprüht und durch ionisierende Strahlung elektrisch aufgeladen (Abb. 2). Die Ladung von einzelnen Tropfen resultiert dabei aus mehreren, im Idealfall nur aus einem einzelnen Überschusselektron. Die Bewegungen der Tropfen werden anschließend mit einem Mikroskop beobachtet. Durch Einstellung der Spannung zwischen den Elektroden kann das Absinken der Tröpfchen gestoppt werden. Über das dann vorhandene Kräftegleichgewicht zwischen elektrostatischer Kraft und Gravitationskraft erhält man schließlich die Ladung der Elektronen. Sie beträgt nach heutiger Kenntnis e = -1,602176565·10-19 C. 2 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Dabei steht „C“ für die Einheit der Ladung, das „Coulomb“, und entspricht der Ladung, die bei einem Strom von einem Ampère in einer Sekunde bewegt wird. Abb. 2: Millikan-Versuch zur Bestimmung der Elektronenladung Video unter http://www.youtube.com/watch?v=XMfYHag7Liw 1.3 Robert Millikan 1891 Die Masse des Elektrons Die Masse des Elektrons lässt sich bei bekannter Ladung durch die Beschleunigung des Elektrons in einem elektrischen Feld bestimmen. So kann man in einer Vakuumröhre einen Elektronenstrahl erzeugen, der auf einem gegenüberliegenden Fluoreszenzschirm einen hellen Fleck hervorruft. Der Strahl kann nun durch das Anlegen von elektrischen Feldern abgelenkt werden, wodurch zum Beispiel ein bewegtes Bild entstehen kann (Braunsche Röhre). Aus der Geschwindigkeit der Elektronen und der Ablenkung des Elektronenstrahls bei einer gegebenen elektrischen Ladung kann man so die Masse des Elektrons ermitteln. Die so genannte Ruhemasse des Elektrons (Masse bei v = 0) beträgt me = 9,10938291·10-31 kg. Video unter http://www.youtube.com/watch?v=nRRwHjRrAjo 1.4 Der Radius des Elektrons Der Radius des Elektrons ist eine eher hypothetische Größe. Er leitet sich aus dem Radius eines gedachten, kugelförmigen Kondensators ab, der bei einer Aufladung mit der oben genannten Elementarladung genau diejenige Energie besitzt, die nach Einstein („E = mc²“) der Ruhemasse des Elektrons zukommt. Mittels dieser Betrachtung kommt man für das Elektron auf einen Radius von re = 2,817940·10-15 m. 1.5 Die Doppelnatur des Elektrons Bis zu diesem Punkt kann man also Elektronen als kugelförmige Teilchen mit einer Ladung e, einer Masse me und einem Radius re betrachten. Tatsächlich gibt es Experimente, bei denen sich ein Elektron genau wie solch ein klassisches Teilchen verhält. Finden zum Beispiel elastische Stöße zwischen Elektronen statt, so verhalten sie sich in guter Näherung wie Billardkugeln: die Gesamtenergie der beiden Teilchen bleibt über den Stoßvorgang hinweg konstant, der Vorgang lässt sich wie ein mechanischer Stoß zwischen zwei Teilchen beschreiben (Abb. 3 links). Solche Vorgänge laufen zum Beispiel ab, wenn Materie in einem Elektronenmikroskop untersucht wird. Dabei treten so genannte Sekundärelektronen auf, die aus elastischen Stößen resultieren. Es gibt jedoch auch ein ganz anderes Phänomen, das allen Vorstellungen von teilchenartigen Elektronen zu widersprechen scheint: das der Elektronenbeugung. Schickt man einen Strahl von Elektronen durch einen engen Spalt, so findet man auf einem dahinter montierten Fluoreszenzschirm nicht, wie man erwarten sollte, eine einzelne helle Linie, sondern ein ganzes Linienmuster (Abb. 3 rechts). Dieses besteht aus einer zentralen Linie, die von einer 3 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Reihe benachbarter, paralleler Linien mit abnehmender Intensität begleitet wird. Ein solches Beugungsmuster beobachtet man gewöhnlich bei sich wellenartig ausbreitenden Energieformen (z.B. bei Licht), nicht aber bei festen Partikeln. Louis de Broglie (1924) Abb. 3: a) Elastischer Stoß zwischen Elektronen b) Beugung von Elektronen an einem Spalt Der erste, der aus dieser Beobachtung die Hypothese der Doppelnatur der Elektronen ableitete, war der Physiker Louis de Broglie. Er postulierte, dass ein Elektron sich so verhält, als wäre es ein Partikel und gleichzeitig (!) eine Welle. Dabei kann für sich allein weder die Vorstellung eines Elektrons als Partikel, noch die Vorstellung als Welle das Verhalten des Elektrons vollständig beschreiben. Erst beide Modelle gemeinsam vermögen das Bild des Elektrons sinnvoll wiederzugeben. Dies sei an einem Beispiel dargestellt: ein Elektron halte sich in einem eindimensionalen Bereich zwischen zwei reflektierenden Flächen auf. Betrachtet man es als Teilchen, so kann man es sich als kleine Kugel vorstellen, die zwischen zwei Flächen ruht (Abb. 4a). Betrachtet man es als Welle, so gleicht es einem Lichtstrahl zwischen zwei Spiegeln (Abb. 4b). Für sich gesehen könnte das Elektron nach beiden Modellen beliebige Energien besitzen, die jeweils zeitlich konstant sind. Abb. 4: Eindimensional bewegliches Elektron zwischen zwei reflektierenden Wänden, a) Vorstellung als Teilchen (links), b) Vorstellung als Welle (rechts). Dieser Zustand wird als eindimensionaler Potentialtopf oder als „Particle-in-a-box“ bezeichnet. Beide Vorstellungen, die einigermaßen gegensätzlich sind, müssen nun unter einen Hut gebracht werden: das Elektron muss sie gleichzeitig (!) erfüllen. Mathematisch gesehen formuliert man damit eine Gleichung, bei der auf der einen Seite die Eigenschaft des Teilchens, auf der anderen Seite die der Welle steht. Angewandt auf die Eigenschaft Energie lautet sie damit in etwa: Energie des Elektrons als Teilchen = Energie des Elektrons als Welle Sollen beide Modelle gleichzeitig gelten, so kann das Elektron nur noch solche Zustände einnehmen, bei der diese Gleichung exakt erfüllt ist. Diese „zulässigen“ Zustände kann man sich bei dem genannten Beispiel als „stehende Wellen“ zwischen den beiden reflektierenden Wänden vorstellen. Dies wäre etwa vergleichbar mit einer Gitarrensaite, die zwischen den 4 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer beiden Wänden gespannt ist und zum Schwingen gebracht wird. Es sind dann nur bestimmte Schwingungen möglich, deren Geometrie (d.h. die Zahl der Wellenberge, Wellentäler und Knotenpunkte) sowie Energie (d.h. die Schwingungsfrequenz) genau definierte, von einer gewissen Regelmäßigkeit gekennzeichnete Werte aufweisen müssen (Abb. 5). Die in Abbildung 5 gezeigten Diagramme markieren drei der Wellenfunktionen Ψ(x), die Lösungen der obigen Gleichung darstellen. Der Wert Ψ(x) kann dabei positiv, negativ oder null (d.h. oberhalb, unterhalb oder auf der gestrichelten Linie) sein. Im letzteren Fall spricht man von den bereits erwähnten Knotenpunkten der Funktion. Die Wahrscheinlichkeit, das Elektron als Teilchen am Ort x aufzufinden, ist proportional zur Wellenfunktion im Quadrat: p(x) ~ Ψ²(x). Eine wichtige Randbedingung ist dabei die Forderung, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons an den beiden Wänden null ist, dort müssen also zwangsläufig Knotenpunkte liegen. Für den Fall des eindimensionalen Elektrons in einem stationären (d.h. zeitlich nicht veränderlichen) Zustand ergeben sich dann die in Abbildung 5 angedeuteten Lösungen des Problems. Energie Der Wert n benennt die einzelnen Lösungen (Lösung 1, Lösung 2, … Lösung n) und wird auch als Quantenzahl bezeichnet. Abb. 5 zeigt nur die drei Zustände mit der niedrigsten Energie und den Quantenzahlen n = 1, 2 und 3, es gibt aber prinzipiell unendlich viele Lösungen. Die Wellenfunktionen besitzen abseits der reflektierenden Wände jeweils (n-1) Knotenpunkte und eine mit dem Wert n ansteigende Energie. Alle Eigenschaften des Elektrons können nun aus der jeweils gültigen Wellenfunktion Ψn(x) ermittelt werden. etc. n=3 n=2 n=1 Abb. 5: Eindimensional bewegliches Elektron zwischen zwei reflektierenden Wänden: Mögliche Zustände unter Ansatz des Welle-Teilchen-Modells. Gezeigt sind die drei Zustände mit niedrigster Energie. Weitere Zustände mit n > 3 besitzen entsprechend höhere Zahlen an Knotenpunkten und höhere Energie. Die bislang anschaulich formulierte Gleichung Energie des Elektrons als Teilchen = Energie des Elektrons als Welle lässt sich für die Wellenfunktion Ψ(x) auch mathematisch darstellen und lautet dann nach Erwin Schrödinger (ohne Herleitung und weitere Erklärung): − h² d ² & Ψ = i hΨ 2m dx ² Erwin Schrödinger Diese sehr wichtige Gleichung wird als Schrödinger-Gleichung bezeichnet und besitzt die in Abbildung 5 gezeigten Lösungen Ψn(x) mit n = 1, 2, 3 … Diesen Zuständen zugeordnet sind die Energieniveaus 1, 2, 3 …, zwischen denen keine weiteren Zustände möglich sind. Man sagt, die Energie des Elektrons ist „gequantelt“. 5 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Der noch recht einfache Fall des eindimensional beweglichen Elektrons hat durchaus eine realistische Entsprechung in der Chemie: er beschreibt in sehr guter Näherung das Verhalten der Elektronen in Molekülen mit alternierenden einfach- und Doppelbindungen, z.B. in Butadien CH2=CH-CH=CH2. 1.6 Das Wasserstoffatom In den meisten Fällen ist das Problem, ein Elektron in einem Atom oder Molekül zu beschreiben, wesentlich komplizierter. Dazu gehört schon der allereinfachste Fall, der bei einem Atom gegeben ist: die Beschreibung des einzelnen Elektrons in einem Wasserstoffatom. Die im Wasserstoffatom gegebene Situation wird durch die Gegenwart des positiv geladenen Kerns (eines einzelnen Protons) bestimmt. Das Elektron wird mit seiner negativen Ladung durch den Kern angezogen und das umso stärker, je näher es ihm kommt. Das Elektron befindet sich damit in einem zentrosymmetrischen elektrischen Feld, in dem es eine umso höhere potentielle Energie besitzt, je weiter es sich vom Kern entfernt. Die Situation ist ein wenig vergleichbar mit der eines Planeten, der sich um die Sonne bewegt. Hätte das Elektron nur eine Teilchennatur, so könnte es einfach zum Kern stürzen und dort auf dem Zustand niedrigster Energie verharren. Dies allerdings wird durch die Wellennatur des Elektrons „verboten“, die es sozusagen zwingt, eine Art stehende Welle um den Kern herum aufzubauen. Für diese „stehende Welle um den Kern herum“ gibt es verschiedene Lösungen, die als Orbitale bezeichnet werden. Deren Berechnung folgt wieder der Gleichung Energie des Elektrons als Teilchen = Energie des Elektrons als Welle die mathematisch als Schrödinger-Gleichung des dreidimensionalen Raums folgende Form besitzt: − h² ∂² ∂² ∂² & Ψ + V (r ) = ihΨ + + 2m ∂x ² ∂y ² ∂z ² Auch hier soll nicht auf die Details der Gleichung eingegangen werden. Wichtig ist nur, dass nun alle drei Raumrichtungen x, y und z eine Rolle spielen. Darüber hinaus kommt auch die potentielle Energie im elektrischen Feld des Kerns mit ins Spiel, die als V(r) eingeführt wird und kontinuierlich mit größer werdendem r ansteigt. Dadurch werden auch die Lösungen dieser Gleichung, die nun Ψn(x,y,z) heißen, wesentlich komplizierter und vielfältiger. Im Gegensatz zu den Lösungen Ψn(x) für ein eindimensional bewegliches Elektron gibt es nun mitunter für eine einzelne Quantenzahl n mehrere Lösungen. Um alle dieser Lösungen zu benennen, werden neben der (Haupt-)Quantenzahl n weitere Quantenzahlen eingeführt. Der vollständige Satz Quantenzahlen, der zur Benennung eines elektronischen Zustands nötig ist, lautet nun: Hauptquantenzahl n mit n = 1, 2, 3, 4, … Nebenquantenzahl l mit l = 0, 1, 2, … , (n-1) Magnetische Quantenzahl m mit m = - l, … , 0, …+ l Spinquantenzahl s mit s = -1/2 und s = +1/2 Die zehn ersten möglichen Kombinationen von Quantenzahlen (n, l, m, s) des Wasserstoffelektrons lauten damit (1,0,0,-1/2), (1,0,0,+1/2), (2,0,0,-1/2), (2,0,0,+1/2), (2,1,-1,-1/2), (2,1,6 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer 1,+1/2), (2,1,0,-1/2), (2,1,0,+1/2), (2,1,+1,-1/2), (2,1,+1,+1/2). Für höhere Hauptquantenzahlen n > 2 werden die möglichen Kombinationen von Quantenzahlen immer zahlreicher. Jedem Satz von Quantenzahlen ist genau ein elektronischer Zustand und genau ein Energieniveau zugeordnet. Die Energie jedes Zustands wird (im feldfreien Raum) allein durch die Hauptquantenzahl bestimmt, wobei der Wert in der Folge n = 1, 2, 3, 4… kontinuierlich, aber mit sinkender Schrittweite wächst. Die Energie ist unabhängig von den weiteren Quantenzahlen, obwohl die Wellenfunktionen unterschiedlich sein mögen. Man nennt solche Zustände mit unterschiedlicher Wellenfunktion aber gleicher Energie entartet. Ein Beispiel für entartete Zustände wären also die Wellenfunktionen mit den Quantenzahlsätzen (2,0,0,-1/2) und (2,1,-1,-1/2). Wie lassen sich die verschiedenen Zustände nun anschaulich darstellen? Am besten gelingt das, indem man die Bereiche, innerhalb derer die Wellenfunktion einen bestimmten Betrag besitzt, räumlich abbildet. In Abbildung 6 ist dies für die Wellenfunktionen mit den Quantenzahlen n = 1 bis 7, für l = 0 bis 2 und für m = 0 bis 2 zeichnerisch umgesetzt worden. 0 Abb. 6: Darstellung der elektronischen Wellenfunktionen des Wasserstoffatoms für die Quantenzahlen n = 1 bis 7, für l = 0 bis 2 und für m = 0 bis 2. Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind alle Orbitale in gleicher Größe dargestellt (ansonsten müsste die Größe mit der Quantenzahl n ansteigen). Der Atomkern befindet sich jeweils im Schwerpunkt jeder Orbitalstruktur. Die Farbe Orange bedeutet ein positives, die Farbe Blau ein negatives Vorzeichen der Wellenfunktion. 7 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Die räumlichen Strukturen, die durch die Quantenzahlen n, l und m festgelegt werden, heißen Orbitale. Grob zusammenfassend kann man sagen, dass im Wasserstoffatom die Hauptquantenzahl n die Größe, die Nebenquantenzahl l die Form und die magnetische Quantenzahl m die Ausrichtung der Orbitale bestimmt. Da die Quantenzahl s dann noch jeweils zwei Einstellungen besitzt, die im Übrigen keinen Einfluss auf die Gestalt der Orbitale nehmen, kann jedes dieser Orbitale zwei mögliche elektronische Zustände enthalten (mit s = +1/2 und s = -1/2). Alle in Abbildung 6 dargestellten Strukturen repräsentieren damit mögliche Aufenthaltsbereiche für je zwei verschiedene Zustände, die das Elektron in Wasserstoff einnehmen kann. Die Orbitale mit der Nebenquantenzahl l = 0 heißen s-Orbitale. Sie besitzen grundsätzlich eine kugelsymmetrische Gestalt, eine von n abhängige Größe und keine Ausrichtung. Die Orbitale mit der Nebenquantenzahl l = 1 heißen p-Orbitale. Sie besitzen grundsätzlich die Gestalt einer Hantel und ebenfalls eine von n abhängige Größe. Ihre Ausrichtung folgt der x-, der y- und der z-Achse verbunden mit den magnetischen Quantenzahlen m = -1, 0 oder +1. Die Orbitale mit der Nebenquantenzahl l = 2 heißen d-Orbitale und besitzen abhängig von der magnetischen Quantenzahl m kompliziertere Formen und Richtungen. Anschaulich sollte man von der Vorstellung Abstand nehmen, das Orbital sei ein Volumen, innerhalb dessen sich das Elektron als Teilchen bewege. Vielmehr sollte man das Orbital als eine Art Schwingungsfigur betrachten, ähnlich wie das Vibrationsbild einer schwingenden Saite. Dann macht auch die Tatsache einen Sinn, dass die Wellenfunktion einen positiven und einen negativen Wert besitzen kann: dieser deutet dann auf die Richtung einer Auslenkung hin, entsprechend einer Gitarrensaite, die man ebenfalls in zwei verschiedene Richtungen auslenken könnte. Erst das Quadrat der Wellenfunktion macht dann eine Aussage über den möglichen Aufenthaltsort des Elektrons als Teilchen. Möchte man wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Elektron als Teilchen innerhalb eines bestimmten Teilvolumens auftritt, so muss man alle Ψ²-Werte innerhalb dieses Teilvolumens aufaddieren (integrieren). Integriert man Ψ² über das gesamte Volumen des Atoms, so resultiert der Wert eins, da das Elektron zwangsläufig irgendwo sein muss. Diese Voraussetzung stellt die Normierungsbedingung dar, die jede der Wellenfunktionen des Wasserstoffatoms erfüllen muss. 1.7 Atome mit mehreren Elektronen Im Falle von Mehrelektronensystemen wie Helium-, Lithium- oder Beryllium- sowie allen weiteren Atomen sind die Verhältnisse ungleich komplizierter. Hier müssten in der Schrödingergleichung auch die elektrostatischen Wechselwirkungen der Elektronen untereinander berücksichtigt werden. Da aber der Ort aller Elektronen (anders als der des als ruhend angenommenen Kerns) nur über Wellenfunktionen beschrieben werden kann, würde die dazugehörige Schrödingergleichung schon für ein Zweielektronensystem übermäßig kompliziert. Deshalb verwendet man folgende, vereinfachende Näherung: man fasst in Gedanken den Atomkern mit allen übrigen Elektronen (also allen Elektronen bis auf das eine, dessen Wellenfunktion man gerade ermitteln möchte) zusammen und erhält so ein neues, fiktives Teilchen, dessen Ladung (bei neutralen Atomen) stets den Wert plus eins besitzt. Der Ort dieses fiktiven Teilchens ist aufgrund der Symmetrie der Elektronenverteilung zum Kern stets identisch mit dem Ort des Kerns. Damit verwandelt sich jedes Atom bei der Betrachtung eines einzelnen Elektrons in ein fiktives Wasserstoffatom und man kann alle Orbitale des Mehrelektronenatoms auf die Wasserstofforbitale zurückführen. 8 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Diese Näherungslösung ist sehr praktisch, hat allerdings ihre Grenzen. So können viele Gesetzmäßigkeiten, die für das Wasserstoffatom noch gelten, nicht beibehalten werden. So hängt bei Mehrelektronensystemen beispielsweise die Energie eines Orbitals nicht mehr nur von der Quantenzahl n, sondern auch von der Nebenquantenzahl l ab, da hier der Einfluss der übrigen Elektronen des Atoms zum Tragen kommt. Mit der oben beschriebenen Näherung ist diese Beobachtung nicht mehr vorhersagbar, da die Wechselwirkung zwischen den Elektronen ignoriert wird. Bei der Besetzung eines Mehrelektronensystems ist zunächst einmal das Pauli-Prinzip zu beachten. Dieses Gesetz wird auch Ausschlussprinzip genannt und bedeutet, dass zwei Elektronen, die sich im gleichen Raum aufhalten, niemals Wellenfunktionen mit identischen Quantenzahlen belegen dürfen. Anders gesagt: alle Wellenfunktionen, die von den in einem gemeinsamen Volumen (also z.B. in einem Atom) vorhandenen Elektronen besetzt werden, müssen sich in wenigstens einer Quantenzahl unterscheiden. In erster Konsequenz bedeutet dies, dass Materie nicht von anderer Materie durchdrungen werden kann (sonst würden sich zum Beispiel notwendigerweise irgendwo zwei Elektronen mit den Quantenzahlsätzen (1,0,0,1/2) im selben Volumen begegnen). Dies hat aber auch zur Folge, dass ein Orbital mit den drei Quantenzahlen n, l und m nur genau zwei Elektronen (mit s = +1/2 und -1/2) beherbergen darf. Friedrich Hund Wolfgang Pauli Abb. 7: Darstellung der Besetzungsreihenfolge bezüglich der Haupt- und Nebenquantenzahlen bei Mehrelektronensystemen. Nacheinander wird dabei den von oben nach unten versetzten Pfeilen in der angegebenen Richtung gefolgt. Man erhält somit das Besetzungsschema 1s – 2s- 2p – 3s – 3p – 4s – 3d – 4p – 5s - … usw. 9 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Die Reihenfolge, mit der die Haupt- und Nebenquantenzahlen besetzt werden, ist durch die so genannte Aufbauregel festgelegt. Diese bestimmt die Belegung der Orbitale so, wie sie durch die Folge der untereinander versetzten Pfeile in Abbildung 7 dargestellt ist (s. oben). Bezüglich der übrigen Quantenzahlen m und s gilt es, den drei Hundschen Regeln zu folgen (Anmerkung: in der Literatur ist auch manchmal von vier Hundschen Regeln die Rede, wobei sich dann aber die vierte aus den anderen drei ergibt). Die erste Hundsche Regel nennt man in der angelsächsischen Literatur auch bildhaft die „Busseat-rule“. Ähnlich wie unabhängige Reisende die Zweierreihen eines Busses zunächst alle jeweils einzeln belegen, so versuchen auch die Elektronen, zunächst alle Varianten der magnetischen Quantenzahl m einfach zu besetzen. Alle diese ungepaarten Elektronen weisen dann dieselbe Spinquantenzahl (s = 1/2) auf. So werden beispielsweise bei den p-Orbitalen immer erst alle drei Orbitale mit m = 1, 0 und -1 (jeweils mit s = 1/2) einfach besetzt. Die zweite Hundsche Regel besagt, dass das Orbital mit dem größten Wert für m (unter Beachtung der ersten Hundschen Regel) immer zuerst besetzt wird. Die einfache Besetzung nach der ersten Hundschen Regel beginnt also stets mit m = l, danach folgt m = (l - 1), usw. Die weitere Besetzung der Orbitale mit einem jeweils zweiten Elektron mit umgekehrtem Spin (s = -1/2) findet danach in derselben Reihenfolge statt. Die dritte Hundsche Regel beschreibt lediglich das Verhalten eines Mehrelektronensystems im Magnetfeld, hat aber auf die Reihenfolge der Besetzung der Orbitale keinen Einfluss und braucht daher an dieser Stelle noch nicht berücksichtigt zu werden. Das insgesamt resultierende Besetzungsschema wird in der Chemie häufig in der so genannten Kästchenschreibweise dargestellt. Für die Nebenquantenzahlen von 0 bis 2 besitzt es unter Beachtung der Hundschen Regeln die folgende Struktur: Abb. 8: Darstellung der Besetzungsreihenfolge bezüglich der magnetischen Quantenzahl und der Spinquantenzahl bei Mehrelektronensystemen. Jeder aufwärts gerichtete Pfeil steht für eine Elektronenfunktion mit s = +1/2, jeder abwärts gerichtete Pfeil für eine Elektronenfunktion mit s = -1/2, 10 Vorlesung Physikalische Chemie I 1.8 Christian Mayer Moleküle Mit den Lösungen der Schrödingergleichung des Wasserstoffatoms, mit der Einführung der Orbitale und mit der Berücksichtigung der Besetzungsregeln haben wir nun ein relativ umfassendes Bild von den Grundbausteinen der Chemie, den Atomen. Damit ergibt sich nun die Frage, wie zwei oder mehr Atome miteinander wechselwirken können. Zunächst ist zu klären, was eigentlich passiert, wenn zwei Atome (Atom a und Atom b) immer näher zusammenrücken. Eigentlich sollte man annehmen, dass in diesem Fall die abstoßenden Wechselwirkungen dominieren: da sich bei dem direkten Kontakt zwischen den Atomen zunächst nur die Elektronenhüllen berühren, sollte es zu einer starken elektrostatischen Abstoßung kommen. Zunächst scheint die Bildung einer chemischen Bindung physikalisch wenig plausibel. Trotzdem existieren in der Natur drei mögliche Lösungen des Problems: a) Die Ionenbindung. Hierbei geht ein oder mehrere Elektronen vollständig vom Atom a zum Atom b über. Dadurch wird das Atom a zum positiv geladenen Kation, das Atom b zum negativ geladenen Anion. Die anziehende elektrostatische Kraft bewirkt eine stabile Bindung. b) Die kovalente Bindung. Es bilden sich zwischen zwei Atomen a und b gemeinsame Elektronenorbitale, auf denen Elektronen sozusagen unter den beiden Bindungspartnern aufgeteilt werden. c) Die metallische Bindung. Es bildet sich ein Kontinuum aus sehr großen, gemeinsamen Elektronenorbitalen, die sich über ein atomares Gitter erstrecken. Eine Vielzahl von Elektronen (das so genannte Elektronengas) wird dabei unter einer Vielzahl von Atomen aufgeteilt. Im Folgenden soll vor allem die Lösung b, also die kovalente Bindung betrachtet werden, da die anderen Bindungsformen auch als Grenzfälle dieser Lösung gelten können. Das bedeutet, wir betrachten nun eine Situation, bei der gemeinsame Orbitale zwischen (im einfachsten Fall) zwei Atomkernen existieren. Um dafür die Schrödingergleichung zu lösen, ist erneut eine Vereinfachung nötig, die als Born-Oppenheimer-Näherung gilt. Dabei nimmt man an, dass der Ort der beiden Atomkerne festgelegt ist, obwohl die dazwischen befindlichen Elektronen durch Wellenfunktionen beschrieben werden. Dadurch erspart man sich die Komplikation eines möglicherweise zeitlich variablen Kernabstands. Gerechtfertigt wird diese Näherung dadurch, dass die Atomkerne um ein Vielfaches schwerer sind als die Elektronen. Mit dieser Näherung führen wir nun folgendes Gedankenexperiment durch: wir betrachten zwei Wasserstoffatome mit unendlichem Abstand zueinander. Ihre Elektronen befinden sich beide im energetischen Grundzustand, besitzen aber unterschiedlichen Spin, so dass ihnen die beiden Quantenzahlsätze (1,0,0,+1/2) und (1,0,0,-1/2) zukommen. Damit wird dem PauliPrinzip Genüge getan, so dass die beiden Atome nun zusammengerückt werden dürfen. Je näher die beiden Atome einander kommen, umso mehr „fühlt“ das Elektron des einen Atoms den Kern des anderen, so dass die Wellenfunktionen des ungestörten Wasserstoffatoms nun keine gültigen Lösungen mehr darstellen. Es müssen also neue, molekulare Wellenfunktionen gefunden werden. Diese Molekülorbitale bildet man am einfachsten, indem man Kombinationen aus den zuvor gültigen Atomorbitalen bildet. Im Fall des Wasserstoffatoms im Grundzustand sind zwei solcher Kombinationen möglich. Vereinfachend kann man das eine entstehende Molekülorbital als additive Kombination aus den beiden einzelnen s-Atomorbitalen betrachten (Abb. 9 oben links). Es wird als bindendes σ-Molekülorbital bezeichnet, besitzt eine niedrigere Energie als das s-Atomorbital und weist zwischen den beiden Atomkernen eine hohe Elektronendichte (ein hohes Ψ²) auf. Sein Gegenstück wird entsprechend aus einer Art subtraktiver Kombination der beiden ursprünglichen s-Orbitale gebildet (Abb. 9 11 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer oben rechts). Es wird als antibindendes σ*-Molekülorbital bezeichnet, besitzt eine höhere Energie als das s-Atomorbital und weist zwischen den beiden Atomkernen eine niedrige Elektronendichte (ein kleines Ψ²) auf. An einer Stelle besitzt letztere sogar den Wert Null. Die bisher vorhandenen Atomorbitale existieren nun nicht mehr. Abb. 9: Darstellung von bindenden (links oben) und antibindenden Molekülorbitalen (rechts oben) im Wasserstoffmolekül H2. Das Energiediagramm links unten veranschaulicht die Bildung eines bindenden σMolekülorbitals im Fall von Wasserstoff H2. Das Diagramm rechts unten verdeutlicht die Situation in einem fiktiven Helium-Molekül He2, bei dem neben dem bindenden σ-Molekülorbital auch das antibindende σ*Molekülorbital besetzt würde. Zweiatomiges Helium ist demzufolge nicht stabil. Die hohe Elektronendichte des bindenden σ-Orbitals im Bereich zwischen den Kernen bewirkt, dass sich anziehende elektrostatische Wechselwirkungen Kern-Elektron-Kern ausbilden können, es hält also das Molekül zusammen (deswegen „bindend“). Da das bindende σ-Orbital die niedrigere Energie besitzt, wandern die zwei Elektronen des Wasserstoffmoleküls beide (mit unterschiedlichen Spins) in diese Position. Damit verbunden ist ein Energiegewinn, der den gebundenen Zustand begünstigt. Zur Trennung des Moleküls muss Energie aufgebracht werden. Das antibindende σ*-Orbital weist am Ort zwischen den Kernen die Elektronendichte Null auf. Damit dominiert hier die abstoßende elektrostatische Wechselwirkung Kern-Kern, dazuhin ist es energetisch ungünstiger. Bei einem fiktiven Helium-Molekül (Abb. 9 unten rechts) muss, wegen der Zahl von vier Elektronen, auch dieses σ*-Orbital doppelt besetzt sein. Dadurch wird sowohl der Energiegewinn als auch die anziehende Wechselwirkung des bindenden σ-Orbitals kompensiert, so dass dieses Molekül insgesamt nicht stabil ist. 12 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Grundsätzlich sind alle ursprünglichen Atomorbitale nach der Bildung des Moleküls verschwunden, alle insgesamt vorhandenen Elektronen werden auf die neu gebildeten Molekülorbitale verteilt. Ist das Niveau der Atomorbitale vor der Bildung eines gemeinsamen Molekülorbitals sehr unterschiedlich, so erhält man eine polare kovalente Bindung, bei der der Schwerpunkt der Elektronendichte auf der Seite des ursprünglich energieärmeren Orbitals liegt. Im Grenzfall extremer Polarität erhält man eine Ionenbindung (s. oben). Sind sehr viele gleichartige Orbitale an der Bildung des Molekülorbitals beteiligt, so können sich große Delokalisationsgebiete ausbilden. Im Extremfall eines Delokalisationsgebiets, das sich über ein ganzes Kristallgitter erstreckt, spricht man von einer metallischen Bindung (s. oben). Die Molekülorbitaltheorie (kurz: MO-Theorie) ist also in der Lage, sämtliche Bindungsarten zu beschreiben. Energiediagramme wie in Abb. 9 unten werden als MO-Schemata bezeichnet. Für zweiatomige Moleküle mögen sie noch recht übersichtlich aussehen, bei vielatomigen Molekülen sind sie dagegen meistens unüberschaubar. Mit Hilfe leistungsfähiger Computer lassen sich solche Molekülorbitale noch rechnerisch erfassen, allerdings steigt der Rechenaufwand (und damit die Rechenzeit und die Kosten) mit steigender Molekülgröße sehr rasch an. In diesem Fall kann man auf eine vereinfachende Betrachtung ausweichen, die so genannte ValenceBond-Theorie (VB-Theorie, Valenzbindungstheorie). Sie wurde in Konkurrenz zur MOTheorie entwickelt und beinhaltet eine wesentliche, zusätzliche Näherung. Sie ist dadurch deutlich weniger genau, allerdings auch wesentlich leichter anwendbar und in der Praxis die beste Methode, um rasch und anschaulich Molekülgeometrien erklären zu können. Im Gegensatz zur MO-Theorie geht man bei der VB-Theorie im Grundsatz davon aus, dass auch im Molekül noch die ursprünglichen Atomorbitale existieren. Der VB-Theorie nach entsteht die chemische Bindung dadurch, dass zwei halb besetzte Atomorbitale der beiden benachbarten Atome A und B überlappen. Das „Überlappungsorbital“ wird dann in der Regel durch die beiden resultierenden Elektronen (eines von A und eines von B) besetzt, wobei das wiederum voraussetzt, dass sie einen unterschiedlichen Spin aufweisen. Jedes durch solche „Überlappung“ gebildete Orbital entspricht einer Bindung. Der Einfachheit halber nimmt man an, dass die anderen Atomorbitale nicht an der Bindung teilnehmen und somit unverändert bleiben. Aufgrund dieser doch recht groben Näherung kommt es bei der VB-Betrachtung von einfachen Molekülen wie Wasser, Methan oder Ammoniak sehr schnell zu Problemen. Zunächst einmal sind die erhaltenen Bindungswinkel unrealistisch: aufgrund der Tatsache, dass in allen genannten Fällen p-Orbitale beteiligt sind, resultiert aus dem VB-Modell immer wieder ein Bindungswinkel von 90°, wohingegen die tatsächlichen Bindungswinkel deutlich größer sind (Wasser: 104,5°, Methan: 109°). Ein noch größeres Problem stellen die Bindungsverhältnisse des Kohlenstoffs dar: eigentlich sollte man nach der VB-Theorie für eine Verbindung zwischen Kohlenstoff und Wasserstoff ein „CH2“ mit einem Bindungswinkel von 90° erwarten, wobei die zwei jeweils halbbesetzten p-Orbitale des Kohlenstoffs Bindungsanzahl und –winkel vorgeben. Dieser Mangel der VB-Theorie kann weitgehend repariert werden, indem man die Schritte der Promotion und der Hybridisierung einführt. Beide Vorgänge sind dabei nicht als natürliche Prozesse, sonder eher als hypothetische Hilfskonstruktionen zu verstehen, die lediglich dazu dienen, die Mängel der VB-Theorie auszuheilen. Sie dienen letztlich dazu, mit Hilfe von Linearkombinationen aus Atomorbitalen den tatsächlich vorliegenden Molekülorbitalen näherzukommen. Der erste dazu notwendige Schritt, die Promotion, dient dazu, die für die gegebene Zahl an Bindungen notwendige Zahl an ungepaarten Elektronen zu schaffen. Dazu werden dann 13 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer einfach Orbitale höherer Energie besetzt. Im Fall des vierbindigen Kohlenstoffs bedeutet das beispielsweise, dass ein s-Elektron an den bereits halbbesetzten px- und py-Orbitalen vorbei auf das energiereichere pz-Orbital gehoben wird. Aus der Elektronenkonfiguration wird somit 1s 2s 2p . Dieser hypothetische Vorgang kommt einer gewissen Energieerhöhung gleich, die allerdings dadurch abgemildert wird, dass ein nach der ersten Hundschen Regel günstigerer Zustand mit ungepaarten Spins entsteht. Die vier nunmehr halbbesetzten Orbitale sind in Abbildung 10 dargestellt. Abb. 10: Darstellung der vier an der sp3-Hybridisierung des Kohlenstoffs beteiligten Orbitale 2s, 2px, 2py und 2pz (Quelle: Chemgapedia). Anschließend erfolgt nun die Hybridisierung, eine Art Vermischung (oder mathematisch korrekter: die Bildung von Linearkombinationen) des s- mit den drei p-Orbitalen. Dadurch entstehen Orbitale in gleicher Anzahl, aber mit völlig neuer Form, Symmetrie und Orientierung im Raum: Abb. 11: Darstellung der vier aus der sp3-Hybridisierung des Kohlenstoffs resultierenden Hybridorbitale. Die Ausrichtung der sp3-Hybridorbitale folgt den vier Raumdiagonalen eines Würfels oder – wenn man nur die größeren Segmente der Orbitale betrachtet – den Ecken eines Tetraeders (Quelle: Chemgapedia). Die vier neuen, wiederum jeweils halbbesetzten Orbitale zeigen vom Kern aus zu den Ecken eines Tetraeders. Mit ihrer Hilfe lässt sich nun zwanglos die Bildung des bekannten MethanMoleküls CH4 erklären: jedes einzelne sp3-Hybridorbital überlappt mit jeweils einem s-Orbital eines Wasserstoffatoms, wodurch eine tetraedrische Molekülgeometrie mit vier völlig gleichberechtigten Bindungen entsteht. Das Ergebnis kommt den tatsächlich vorhandenen Molekülorbitalen, die sich gemäß dem MO-Modell formulieren lassen, sehr nahe. Festzuhalten ist dabei, dass es sich sowohl bei der Promotion als auch bei der Hybridisierung um rein fiktive Prozesse handelt, die lediglich postuliert werden, um den VB-Ansatz zu „retten“. Der grundsätzliche Mangel, dass das VB-Modell überwiegend auf den Atomorbitalen beharrt, die eigentlich nicht mehr existieren, bleibt bestehen. Viele Molekülgeometrien lassen sich in der VB-Theorie nur mit Hilfe einer passenden Hybridisierung erklären. Dennoch: das VBModell ist für die meisten Anwendungen in der Chemie nach wie vor der am häufigsten gewählte Ansatz: er ist einfach, bequem und vielseitig einsetzbar, solange man die richtige 14 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Form der Hybridisierung wählt. Letzteres geschieht auf der Grundlage einer bekannten Molekülgeometrie oder unter Berücksichtigung von vorhandenen Mehrfachbindungen. In der folgenden Tabelle sind die häufigsten Hybridisierungsvarianten zusammengefasst und verschiedenen Molekülgeometrien zugeordnet. Bei gegebener Geometrie des Moleküls (z. B. die trigonal-planare Anordnung um jedes Kohlenstoffatom im Ethylen) kann man so auf die passende Hybridisierung schließen (im gegebenen Fall das sp2-Hybrid). Tabelle 1: Wichtige Hybridisierungszustände nach dem VB-Modell Hybridisierung Promotion Koordinationszahl Geometrie Beispiele sp ↑↑ s↑ p↑ 2 linear Acetylen, Propadien sp2 ↑↑↑ s↑ p↑↑ 3 trigonal-planar Ethylen, Benzol sp3 ↑↑↑↑ s↑ p↑↑↑ 4 tetraedrisch Methan, Ammoniak sp3d ↑↑↑↑↑ s↑ p↑↑↑ d↑ 5 trigonalbipyramidal Phosphorpentachlorid s↑ p↑↑↑ d↑↑ 6 oktaedrisch Schwefelhexafluorid sp3d2 ↑↑↑↑↑↑ 2 Die Elektronenspektroskopie an Atomen und Molekülen 2.1 Grundlagen der Spektroskopie Elektronen in Atomen und Molekülen können – soweit die Erkenntnis aus Kapitel 1 – durch Wellenfunktionen beschrieben werden. Aus diesen kann man nicht nur die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an verschiedenen Positionen im Raum, sondern auch die Energie des Elektrons ableiten. Eine Folge der Beschränkung der Elektronen auf bestimmte Wellenfunktionen mit jeweils bestimmter Energie ist, dass sie auch nur in bestimmten Schritten Energie aufnehmen und abgeben können. Jede Aufnahme bzw. Abgabe von Energie entlang dieses Schrittes ist generell mit der Aufnahme bzw. Abgabe von elektromagnetischer Strahlung verbunden. Diese Tatsache bildet die Grundlage der Spektroskopie, im gegebenen Fall der Elektronenspektroskopie. Allgemein gesprochen befasst sich die Spektroskopie mit der Wechselwirkung zwischen Strahlung und Materie. Etwas genauer lässt sich aussagen, dass die Spektroskopie untersucht, mit welcher elektromagnetischen Strahlung sich welcher energetische Übergang anregen lässt. Zwischen der elektromagnetischen Strahlung und dem dabei bewirkten energetischen Übergang gilt dann grundsätzlich folgende Beziehung: ∆E = h·ν mit ∆E als der Energiedifferenz zwischen den beiden Zuständen (in Joule), ν (gesprochen „nü“) als Frequenz der verwendeten elektromagnetischen Strahlung (in 1/s oder Hertz, Hz) und h als dem so genannten Planckschen Wirkungsquantum (mit h = 6,626·10-34 Js). Somit ist jeder Frequenz ν im elektromagnetischen Spektrum (Abb. 12) genau ein Energiewert ∆ E zugeordnet. Die dazugehörige Wellenlänge im Vakuum (in m) errechnet sich nach λ = c / ν mit c als Lichtgeschwindigkeit (im Vakuum: c = 299 792 458 m/s). 15 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Abb. 12: Elektromagnetisches Spektrum (Quelle: Chemgapedia). Für die genaue Messung, welche Frequenz der elektromagnetischen Strahlung einem gegebenen Übergang anzuregen vermag, gibt es experimentell zwei verschiedene Ansätze. Entweder man strahlt Energie auf das System ein und beobachtet den Verlust an Strahlungsintensität, der dann beobachtet wird, wenn die Strahlung einen Übergang zu einem höheren Energieniveau bewirkt (Absorption), oder man führt dem System Energie zu (zum Beispiel thermisch) und beobachtet dann die Freisetzung von Energie als Strahlung (Emission). Im einen Fall erfüllt die Frequenz der absorbierten Strahlung, im anderen Fall die der emittierten Strahlung die Frequenzbedingung ∆E = h · ν. Mit beiden Methoden kann man so exakt den Energieunterschied zwischen zwei Energieniveaus ausmessen. Die Bestimmung der Werte für die charakteristischen Energieschritte ∆E eines Systems ist die Hauptaufgabe der Spektroskopie. Sie eignet sich insbesondere, um elektronische Wellenfunktionen eines Systems zu erkunden. 2.2 Elektronenspektroskopie am eindimensionalen Potentialtopf Das denkbar einfachste elektronische System ist der eindimensionale Potentialtopf. Dennoch kann auch dieses Modell schon in grober Näherung auf Moleküle angewandt werden, speziell auf solche mit annähernd linearen Delokalisationssystemen (s. Kapitel 1.4). Ein Beispiel ist die Reihe Butadien, Hexatrien, Oktatetraen, usw.. Bildet man mit Hilfe der Lösungen der Schrödingergleichung für das eindimensionale Potentialtopfmodell einen Ausdruck für den elektronischen Übergang zwischen dem höchsten besetzten Orbital (HOO) und dem niedrigsten unbesetzten Orbital (LUO), so erhält man für die damit verbundene Energiedifferenz (ohne Herleitung): ∆E = h · ν = (n²LUO-n²HOO) · h² / (8 me L²) 16 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Mit wachsender Länge L und wachsender Elektronenzahl (jedes Kohlenstoffatom im Delokalisationsgebiet trägt ein Elektron bei) steigen einerseits die Werte der Quantenzahlen n für das höchste besetzte Orbital (HOO) und das niedrigste unbesetzte Orbital (LUO) an, andererseits steigt aber auch die Länge L, die quadratisch im Nenner der Gleichung steht. Da letzteres insgesamt überwiegt, sinkt der Wert für ∆E und damit für die Frequenz ν schrittweise mit Anstieg der Kettenlänge. Liegt die absorbierte Lichtfrequenz anfänglich im UV-Bereich, so verschiebt sie sich beispielsweise für das Carotin mit 11 Doppelbindungen schon in den sichtbaren, blauen Bereich. Weil daher Carotin blaues Licht absorbiert, erscheint es im Durchlicht betrachtet in der Komplementärfarbe gelb. Nach diesem Prinzip lassen sich viele organische Farbstoffe interpretieren. Ändert sich die Länge bzw. die Elektronenzahl (und damit n²LUO und n²HOO) durch die Protonierung des Moleküls, so hat man es mit einem Farbstoff zu tun, der mit dem pH-Wert seine Farbe ändert – dies ist die Grundlage vieler pHIndikatoren. 2.3 Elektronenspektroskopie am Wasserstoffatom Die wissenschaftliche Spektralanalyse wurde in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts gemeinsam durch G.R. Kirchhoff und R.W. Bunsen entwickelt. Sie entdeckten, dass alle Elemente beim Erhitzen Licht aussenden. Nach Zerlegung des Lichts mit einem Glasprisma erhält man ein für jedes Element charakteristisches Linienmuster, das so genannte Spektrum (s. auch UTube-Video „spectral lines demo“, http://www.youtube.com/watch?v=2ZlhRChr_Bw). Dieses Spektrum reflektiert die Gesamtheit der dem gegebenen Element eigenen elektronischen Übergänge und ist damit ein unverwechselbarer Fingerabdruck. Elemente können damit sowohl in der Emissionsspektroskopie als auch in der Absorptionsspektroskopie eindeutig und mit hoher Empfindlichkeit identifiziert werden. 0 Brackett- Paschenserie serie Balmerserie Lymanserie n=5 n=4 10 n=3 20 n=2 Wellenzahl [1000 cm-1] 30 40 50 Gustav Robert Kirchhoff 60 70 80 90 100 n=1 110 Grundzustand Robert Wilhelm Bunsen Abb. 13: Wichtige elektronische Übergänge im Wasserstoffatom 17 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Die Elektronenspektroskopie kann jedoch noch deutlich mehr: sie erlaubt die exakte Überprüfung der durch die Lösung der Schrödingergleichung gefundenen elektronischen Wellenfunktionen. Dies wurde zunächst am Wasserstoffatom mit hoher Präzision betrieben. Historisch gesehen ist die erste wichtige Lichtquelle für spektroskopische Analysen unsere Sonne. Dies gilt insbesondere für das Spektrum des Wasserstoffs. Da die Energie der elektronischen Zustände dort einzig und allein von der Hauptquantenzahl n abhängt (s. Kapitel 1.5) werden lediglich solche Spektrallinien beobachtet, die sich genau einem gegebenen ∆E = E(n2) - E(n1) zuordnen lassen. Zuerst wurde mit der Balmer-Serie der sichtbare Anteil des Spektrums entdeckt, der mit allen Übergängen von oder zu dem Niveau n = 2 verbunden ist (Abb. 13). Es folgten im UV-Bereich die Lyman-Serie mit n = 1 und im IR-Bereich die Paschen-Serie mit n = 3, die Brackett-Serie mit n = 4, sowie die Pfundt- und die Humphreys-Serie mit n = 5 und n = 6 (letztere sind in Abb. 13 nicht mehr eingezeichnet). Weitere Serien mit höheren Quantenzahlen existieren, tragen aber keine Namen mehr. Abbildung 14 zeigt das gesamte Wasserstoffspektrum, die Kürzel benennen die entsprechenden Serien (Ly = Lyman, Ba = Balmer etc.). Abb. 14: Spektrum des Wasserstoffatoms. Die Achse für die Wellenlänge ist logarithmisch aufgetragen. Eine genaue Analyse ergibt, dass sich das Schema der Energiedifferenzen nach Abb. 13 fast genau mit den in Kapitel 1.5 besprochenen Lösungen der Schrödingergleichung deckt. Die äußerst kleinen Abweichungen, die man dennoch detektieren konnte, ließen sich auf den Beitrag des Kerns (trotz seiner hohen Masse kann er sich minimal mit dem Elektron mitbewegen) und des Isotopeneffekts zurückführen: der schwerere Deuteriumkern, der aus einem Proton und einem Neutron besteht, bewegt sich weniger leicht mit dem Elektron mit als das einsame Proton des „normalen“ Wasserstoffs. Daneben zeigen sich bei sehr hoher Auflösung des Spektrums auch relativistische Effekte, die zu weiteren Aufspaltungen führen. 2.4 Elektronenspektroskopie an Atomen mit mehreren Elektronen Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den Elektronen ist die beim Wasserstoff gegebene Entartung bezüglich der Quantenzahlen l und m aufgehoben. Damit wird das Energiediagramm bereits für ein einfaches Atom wie zum Beispiel Lithium schon deutlich komplizierter (Abb. 15). Neben den Übergängen zwischen verschiedenen Werten für n treten nun auch Übergänge zwischen s und p, p und d, d und f auf. Manche Übergänge (zum Beispiel solche zwischen s- und d-Niveaus) werden allerdings gewöhnlich nicht beobachtet, man nennt sie „verboten“. Als weitere Folge der Wechselwirkungen zwischen den Elektronen besitzt jedes höhere Atom ein eigenes und von Wasserstoff verschiedenes Energiediagramm. Damit besitzt aber auch jedes Atom ein unverwechselbares Muster von Energieübergängen, die es eindeutig 18 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer kennzeichnet. Dies lässt sich bereits in einfachen Versuchen anhand von Flammenfärbungen zeigen. Diejenigen Übergänge, deren ∆E den Wellenlängen im sichtbaren Spektrum entspricht (in Abb. 15 sind dies die kürzeren unter den eingezeichneten blauen Pfeilen), sorgen bei vielen Elementen für ein charakteristisches farbiges Leuchten (Abb. 15 rechts). 5 4 5s 5p 4p 5d 4d 3p 3d 4s 3 3s 2 Energie 2p 2s n=1 1s Wasserstoff Lithium Abb. 15: Termschema von Lithium mit wichtigen elektronischen Übergängen (links). Durch Lithium verursachte Flammenfärbung (rechts, Quelle: http://www.itp.uni-hannover.de/~zawischa/ITP/atoms.html). Letztlich ist auch bei allen höheren Atomen die Elektronenspektroskopie eine ideale Methode, um das Energieniveauschema experimentell zugänglich zu machen. Sie eignet sich darüber hinaus perfekt zur schnellen und empfindlichen Identifikation von Elementen. Diese Tatsache macht man sich sowohl in der Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) als auch in der Atomemissionsspektroskopie (AES) zunutze. 2.5 Elektronenspektroskopie an Molekülen Genau wie die Atomorbitale sind auch Molekülorbitale der Elektronenspektroskopie zugänglich. Durch die systematische Analyse aller elektronischen Übergänge lassen sich die Energieniveaus in einem MO-Schema schrittweise ausmessen. Besonders interessant wird dieser Ansatz bei der Untersuchung von einzelnen chemischen Bindungen. Im Allgemeinen beobachtet man Übergänge zwischen bindenden und nicht bindenden Orbitalen einerseits und den üblicherweise unbesetzten antibindenden Orbitalen andererseits. In Abb. 16 ist dies am 19 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Beispiel einer C-O-Bindung in Formaldehyd gezeigt. Im Mittelpunkt stehen dabei das bindende und das antibindende σ-Orbital C-O, das bindende und das antibindende π-Orbital C-O sowie das nicht bindende freie Elektronenpaar des Sauerstoffs (ein weiteres freies Elektronenpaar bleibt unbeteiligt). π* CO n-π* Übergang nO π H π-π* Übergang σ-σ* Übergang Energie σ* CO C σ O n H π CO σ CO Abb. 16: Termschema der CO-Gruppe in Formaldehyd (links). Die beteiligten Bindungen und das im betrachteten Energiefenster liegende freie Elektronenpaar des Sauerstoffs sind rechts skizziert. Die drei wichtigsten Übergänge, die an der C-O-Gruppe beobachtet werden, sind der σ-σ*Übergang, der π-π*-Übergang und der n-π*-Übergang. Letzterer ist in einer C-O-Gruppe stets am energieärmsten und kann bereits mit UV-Licht einer Wellenlänge um 280 nm angeregt werden (schwarzer Pfeil in Abb. 16). Energiereicher und intensiver ist bei der CO-Gruppe der π-π*-Übergang, der bei Wellenlängen um 170 nm angeregt wird (roter Pfeil in Abb. 16). Darüber hinaus zeigt das Spektrum, dass die beiden freien Elektronenpaare des Sauerstoffs stark unterschiedlichen Charakter besitzen (nur eines ist an dem n-π*-Übergang beteiligt, das andere tritt im gegebenen Spektralbereich nicht in Erscheinung). Auf ähnliche Weise lassen sich alle MO-Schemata komplizierter Moleküle analysieren. Liegen die Anregungsfrequenzen der Übergänge im sichtbaren Bereich, so haben die Moleküle die Funktion von Farbstoffen. Häufig besitzen sie dann längere lineare Delokalisationsgebiete, deren Elektronenspektren man dann auch in grober Näherung mit dem eindimensionalen Potentialtopfmodell beschreiben kann (s. Kapitel 2.2). Das Elektronenspektrum eines Moleküls wird wegen der dazu verwendeten Frequenzbereiche im UV- und im sichtbaren („visible“) Spektrum auch UV-vis-Spektroskopie genannt. Die UV-vis-Spektroskopie dient neben der Aufklärung der MO-Struktur auch der schnellen und bequemen Identifikation von chemischen Verbindungen. Aufgrund ihrer im Absorptionsverfahren sehr einfachen und preisgünstigen Messtechnik wird sie auch häufig in Kombination mit anderen analytischen Verfahren (z.B. der Chromatographie) verwendet. Über eine Bestimmung der Intensität der Anregung kann auch eine quantitative Analyse einzelner Verbindungen erfolgen. 20 Vorlesung Physikalische Chemie I 3 Christian Mayer Das Zusammenwirken von Atomen und Molekülen 3.1 Der makroskopische Zustand von Materie Bisher sind nur einzelne Bausteine der Materie, also Atome und Moleküle betrachtet worden. Nun soll das makroskopische Erscheinungsbild von Materie untersucht werden, die aus einer Vielzahl von Atomen oder Molekülen besteht. Um den Zustand dieser Materie als Gesamtheit zu beschreiben, benötigt man so genannte Zustandsparameter oder Zustandsgrößen. Die wichtigsten Vertreter dieser Kenngrößen für makroskopische Materie sind die Stoffmenge n, das Volumen V, der Druck P und die Temperatur T. n Stoffmenge: Die Stoffmenge wird über die Teilchenzahl definiert: Einheit der Teilchenzahl: 1 Mol Definition: Ein Mol eines Stoffes enthält dieselbe Anzahl an Teilchen wie 0,012 kg reiner Kohlenstoff des Isotops 12C (1 Mol ≈ 6.022.1023 Teilchen) Dabei muss eindeutig festgelegt sein, was unter einem Teilchen des Stoffes jeweils zu verstehen ist. Ist die Stoffmenge konstant, so spricht man von einem geschlossenen System. V Volumen: Die Definition des Volumens erfolgt über die festgelegte Längeneinheit und den geometrischen Volumenbegriff: Einheit des Volumens: 1 m³ Definition: Ein m³ ist das Volumen eines würfelförmigen Raums mit einer Kantenlänge von einem Meter. Ist das Volumen konstant, so spricht man von einem isochoren Vorgang. P Druck: Die Definition erfolgt über die Kraft, die ein Stoff auf jede Flächeneinheit eines ihn einschließenden Behälters ausübt. Einheit des Drucks: 1 Pascal = 1 Pa = 1 N/m² = 10-5 bar Definition: Ein Pascal ist der Druck, bei dem auf jeden Quadratmeter der Behälterwände eine Kraft von 1 Newton ausgeübt wird. Ist der Druck konstant, so spricht man von einem isobaren Vorgang. T Temperatur: Der sicherlich am schwierigsten fassbare Zustandsparameter makroskopischer Materie ist die Temperatur. Zwar ist sie direkt mit der menschlichen Wahrnehmung verknüpft (kalt, warm, heiß…), physikalisch jedoch zunächst sehr undefiniert, da sie nicht ohne Weiteres auf andere physikalische Größen zurückführbar ist. Am ehesten lässt sie sich im ersten Ansatz als diejenige Eigenschaft von Materie beschreiben, die von einem Thermometer gemessen wird. Zur Verwendung als Thermometer eignet sich prinzipiell jeder physikalische oder chemische 21 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Vorgang, der reproduzierbar mit einer Temperaturänderung verknüpft ist. Klassisch sind dies insbesondere die Ausdehnungsvorgänge von Gasen, Flüssigkeiten und Festkörpern (Abb. 17). Festkörperthermometer werden gewöhnlich nach dem Prinzip des Bimetall-Thermometers ausgelegt (ganz links). Dabei werden zwei verschiedene Festkörper (z.B. zwei Bleche aus verschiedenen Metallen) flächig miteinander in Kontakt gebracht. Bedingt durch die unterschiedliche thermische Ausdehnung der Materialien krümmt sich das Bimetall-Blech abhängig von der Temperatur mehr oder weniger stark zu einer Spirale. Gas Flüssigkeitsthermometer (Mitte) und Gasthermometer (rechts) nutzen die Volumenänderung eines fluiden Mediums mit der Temperatur. Die Genauigkeit kann erhöht werden, indem einem großvolumigen Vorratsbehälter ein relativ kleinvolumiger Ausdehnungs- und Ablesebereich gegenübergestellt wird. Hg Abb. 17: Thermometer, die auf der Grundlage der temperaturbedingten Ausdehnung von Materie beruhen. In der Praxis kommen mehr und mehr die elektronischen Varianten der Temperaturmessung zum Zug, die zumeist auf der Messung der Thermospannung basieren. Neben der Messmethode ist die Festlegung einer Temperaturskala wichtig. Dazu dienten zunächst einige Fixpunkte, die heute teilweise noch historische Bedeutung haben: 1) Die tiefste Temperatur des Winters 1708/1709 in Danzig: - 17,8 °C 2) Die Temperatur von schmelzendem Eis bei 760 Torr (760 Torr = 1 atm = 101 325 Pa): 0 °C 3) Koexistenztemperatur von Eis, Wasser und Wasserdampf: 0,01 °C (exakt) 4) Die durchschnittliche Körpertemperatur eines gesunden Menschen: 37,8 °C 5) Die Siedetemperatur des Wassers bei 760 Torr (1 atm = 101 325 Pa): 100 °C Die Punkte 1 und 4 bildeten die Grundlage des Fahrenheit-Systems, die Punkte 2 und 5 die der Celsius-Skala. Bei beiden Systemen wurde der definierte Bereich zunächst in 100 gleiche Teile (Grade) aufgeteilt, dann extrapoliert. Beide Definitionen wurden später verfeinert (Celsius: 99,99 Grade C zwischen den Fixpunkten 3 und 5, Fahrenheit: 180 Grade F zwischen den Fixpunkten 1 und 5). Trotzdem mangelt es außer Punkt 3 allen genannten Fixpunkten an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das zweite Problem, nach der Unvollkommenheit der Fixpunkte, besteht in der Festlegung einer systemunabhängigen linearen Teilung. Gewöhnlich ist der Verlauf der Skala vom gewählten Medium abhängig: Eine lineare Teilung auf der Skala eines Quecksilberthermometers entspricht daher nicht einer linearen Teilung auf der Skala eines Alkoholthermometers, da die Ausdehnung bei jedem Medium in unterschiedlicher Weise von der Temperatur abhängt. 22 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Beide Probleme, sowohl die Wahl der passenden Fixpunkte als auch die Definition einer sinnvollen linearen Teilung werden heute durch die Festlegung der so genannten absoluten Temperaturskala gelöst. Grundlage hierfür sind übereinstimmende Beobachtungen an Gasthermometern: V -273,15°C -300 -200 -100 0 100 200 T Bei wiederholten Messungen mit verschiedenen Gasthermometern, verschiedenen Gasen und Gasvolumina und bei verschiedenen Drucken stellt man fest, dass sich die Verlängerungen aller in den jeweiligen Diagrammen erhaltenen Linien in einem Punkt schneiden. Dieser Punkt entspricht auf der Volumenachse dem Wert V = 0 und auf der Temperaturachse dem Wert T = -273,15 °C. Abb. 18: Ausdehnungskurven verschiedener Gase. Die Temperaturskala ist zunächst noch in Celsius aufgetragen. Aus dieser Beobachtung wurde geschlossen, dass der Temperatur am gemeinsamen Schnittpunkt aller Ausdehnungskurven eine besondere physikalische Bedeutung zukommt und sie sich daher als Fixpunkt einer neuen Temperaturskala eignet. Weiterhin wurde festgestellt, dass zwar alle Gase in ihrem Ausdehnungsverhalten von dem linearen Verlauf abweichen, dass aber unter bestimmten Umständen (z.B. niedriger Druck) ein gemeinsamer Verlauf angestrebt wird, den man auch als idealen Verlauf bezeichnen könnte. Am besten funktioniert das bei Helium unter schrittweise absinkenden Drucken, dessen Verhalten sich für P → 0 zum idealen Verhalten extrapolieren lässt. Diese Erkenntnis diente zur Definition einer absoluten Temperaturskala in Kelvin: 1) Unterer Fixpunkt: Schnittpunkt der Volumenexpansionskurven „idealer“ Gase (z.B. Helium für den Grenzfall P→0): 0 Kelvin 2) Oberer Fixpunkt: Koexistenztemperatur von Eis, Wasser und Wasserdampf 273,16 Kelvin 3) Das Volumen eines „idealen“ Gases (z.B. Helium für den Grenzfall P→0) ist bei konstantem Druck proportional zur Temperatur und definiert die lineare Teilung der Temperaturskala Gemäß dieser Definition ist jede beliebige Temperatur unter Nutzung eines „idealen“ Gasthermometers auf der absoluten Kelvin-Skala eindeutig festgelegt. Die Verwendung der KelvinSkala ist gegenüber der Nutzung klassischer Temperatursysteme bei der Beschreibung physikalischer Vorgänge eindeutig von Vorteil. Vorgänge, bei denen die Temperatur konstant ist, nennt man isotherm. Mit der Definition der wichtigsten Zustandsparameter Teilchenzahl n, Volumen V, Druck P und Temperatur T besteht nun die Möglichkeit, das Verhalten makroskopischer Materie zu beschreiben. Am einfachsten gelingt das im Fall von Gasen. 3.2 Zustandsgleichung für Gase: die ideale Gasgleichung Untersucht man bei Gasen systematisch den Zusammenhang zwischen n, V, P und T, so stellt man fest, dass für alle Gase in mehr oder weniger guter Näherung folgende einfache Gleichung erfüllt ist: P·V = n·R·T 23 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Wobei R für die so genannte ideale Gaskonstante steht (R = 8,314 J K-1 Mol-1). Diese Gleichung, auch „ideale Gasgleichung“ genannt, ist ein so genanntes Grenzgesetz: kein real existierendes Gas erfüllt es genau, aber alle Gase kommen ihm recht nahe, insbesondere bei hohen Temperaturen und niedrigen Drücken. Eine Gleichung dieser Form nennt man auch Zustandsgleichung, da sie Zustandsparameter miteinander verbindet. Grafisch lässt sich diese Verknüpfung in einem einfachen Diagramm darstellen, bei dem jede Kombination von T und V genau einem Wert für P zugeordnet ist (Abb. 19): P T V Abb. 19: Auftragung von P gegen T und V nach der idealen Gasgleichung. Wir wissen nun, dass die Gase aus einer Vielzahl von Teilchen (Atomen oder Molekülen) bestehen. Wie lässt sich das durch die ideale Gasgleichung beschriebene Verhalten nun mit dieser Tatsache in Einklang bringen? Was bedeuten eigentlich die Parameter Druck und Temperatur für ein Gas, das sich aus vielen einzelnen Atomen und Molekülen zusammensetzt? Um makroskopische Zustandsparameter überhaupt mit der Teilchenwelt verknüpfen zu können, benötigen wir eine Modellvorstellung für das mechanische Zusammenwirken der Teilchen, das kinetische Gasmodell. 3.3 Das kinetische Gasmodell Bei den im vorhergehenden Kapitel aufgeführten Gasgesetzen handelt es sich um mathematische Beschreibungen von makroskopisch beobachtbaren Vorgängen. Zur Interpretation der Gasgesetze auf molekularer Ebene wurden verschiedene Modelle vorgeschlagen. Das erfolgreichste unter ihnen war das sogenannte kinetische Gasmodell. Es beruht auf der Vorstellung, dass ein Gas aus einer Vielzahl von Teilchen besteht, die folgende Bedingungen erfüllen: 1) Sie besitzen eine Atom- oder Molmasse M, einen endlichen Durchmesser d und befinden sich in ständiger und ungeregelter Bewegung. 2) Die Größe der Teilchen ist im Verhältnis zum freien Volumen vernachlässigbar. 3) Zwischen den Teilchen finden elastische Stöße statt. Ansonsten existieren keine weiteren Wechselwirkungen unter den Teilchen. Nach der kinetischen Gastheorie besteht der Druck eines Gases aus der Summe aller Kräfte (pro Flächeneinheit), die durch auf eine Fläche aufprallende Gasteilchen (bzw. durch deren Impulsänderung) ausgeübt werden(Abb. 20). 24 Vorlesung Physikalische Chemie I Vx Christian Mayer -Vx Vx Vx Vx Vx Vx ∆t Abb. 20: Links: schematische Darstellung der Impulsänderung bei dem Auftreffen eines Gasteilchens auf der Gefäßwand. Viele solche Stöße führen in der Summe zum Entstehen einer messbaren, dem Gasdruck zugeordneten Kraft. Rechts: Die Geschwindigkeitskomponente vx der Teilchen bestimmt nicht nur die Größe der Impulsänderung, sondern auch die Zahl der Teilchen, die pro Zeiteinheit auf die Wand stoßen. Daher geht die Geschwindigkeit der Teilchen bei der Berechnung des Drucks insgesamt quadratisch ein. Dabei wird zunächst davon ausgegangen, dass alle Teilchen die gleiche Geschwindigkeitskomponente vx aufweisen. Diese Geschwindigkeitskomponente bestimmt zum einen die Heftigkeit der Stöße, zum anderen, wie viele Gasteilchen pro Zeiteinheit auf die Wand prallen. Insgesamt hängt der Druck damit vom Quadrat der Geschwindigkeitskomponente vx ab. Führt man nun ein mittleres Geschwindigkeitsquadrat c² ein, (mit vx² = 1/3 c²) so erhält man für den an dem beweglichen Kolben spürbaren Druck die Gleichung: P = 1/3 M c² (n/V) oder, in der Schreibweise der idealen Gasgleichung: PV = 1/3 n M c² Der Druck ist nach dem kinetischen Gasmodell also die Folge einer Vielzahl von Stößen, welche die Teilchen gegen die Behälterwände ausführen. Er ist folglich proportional zur Masse der Teilchen (je schwerer die Teilchen, desto heftiger die Stöße), zum mittleren Geschwindigkeitsquadrat (die Geschwindigkeit der Teilchen bestimmt zum einen die Häufigkeit, zum anderen die Heftigkeit der Stöße) und zur Zahl der Teilchen pro Volumeneinheit (womit, wie nach der idealen Gasgleichung zu erwarten, P umgekehrt proportional zu V ist). Die Bedeutung der Temperatur im kinetischen Gasmodell ist dagegen zunächst unklar. Mit der idealen Gasgleichung P V = n R T ergibt sich aber durch Koeffizientenvergleich: oder: nRT = 1/3 n M c² RT 1/3 M c². = Man kann unter Nutzung beider Gasmodelle so zu einem neuen, teilchenbezogenen Verständnis des Phänomens Temperatur kommen. Die Temperatur eines Gases ist demnach direkt proportional zum mittleren Geschwindigkeitsquadrat der Gasteilchen oder, in anderen Worten, zu deren kinetischer Energie 1/2 M c². Dies ist für das Verständnis des Phänomens Temperatur von großer Bedeutung. Man kann die Temperatur eines Gases also messen, indem man (bei bekannter Masse der Teilchen) die Geschwindigkeit der Gasteilchen bestimmt. Die Wurzel aus dem mittleren Geschwindigkeitsquadrat, also die Größe c, liegt üblicherweise in der Größenordnung der Schallgeschwindigkeit (zum Beispiel für Stickstoff bei Raumtemperatur: c = 516 m/s) und steht zu ihr in einer festen Beziehung. Tatsächlich lässt sich die Temperatur auch über eine Messung der Schallgeschwindigkeit ermitteln. 25 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Nachdem das mittlere Geschwindigkeitsquadrat der Teilchen bekannt ist, stellt sich die Frage nach der Geschwindigkeitsverteilung der Teilchen. Teilt man den Bereich der auftretenden Geschwindigkeiten in Intervalle auf, und zählt man die Teilchen, die gemäß ihrer Geschwindigkeit zu den einzelnen Intervallen zugeordnet werden können, so ergibt sich für die Geschwindigkeitsverteilung in vx und v folgendes Bild (Abb. 21): n(vx) n(vx) Temperaturerhöhung - 0 + vx-Intervall - n(v) 0 + vx-Intervall n(v) Temperaturerhöhung 0 v-Intervall + 0 + v-Intervall Abb. 21: Verteilungsfunktionen einer eindimensionalen Geschwindigkeitskomponente (oben) und der Gesamtgeschwindigkeit (unten). Der Mittelwert von vx (oder jeder anderen eindimensionalen Geschwindigkeitskomponente) ist grundsätzlich Null. Dagegen besitzt der Mittelwert von v stets eine endliche, von Null verschiedene Größe. Bei einer Erhöhung der Temperatur werden alle Verteilungsfunktionen breiter, der Mittelwert von v vergrößert sich. Die Verteilungsfunktionen in vx und v lauten (ohne Herleitung): f(vx) = [M/(2πRT)]1/2 exp [-Mvx²/(2RT)] f(v) = 4π [M/(2πRT)]3/2 v² exp [-Mv²/(2RT)] Die Temperatur eines Gases äußert sich also nicht nur im mittleren Geschwindigkeitsquadrat, sondern auch in der Form der Geschwindigkeitsverteilungsfunktion. Bei der Mischung von Gasen unterschiedlicher Temperatur muss, um die oben genannte Forderung zu erfüllen, aus der einfachen Summe von zwei Verteilungsfunktionen eine neue, der Mischtemperatur entsprechende Verteilungsfunktion entstehen. Dies ist nur unter der Annahme möglich, dass ein Austausch kinetischer Energie unter den Teilchen erfolgen kann. Diese Tatsache bedingt die eingangs gestellte Forderung nach Teilchenstößen, also Wechselwirkungen zwischen den Teilchen. Damit müssen die Gasteilchen aber auch ein gewisses Volumen besitzen, den Teilchen ohne Eigenvolumen können prinzipiell nicht zusammenstoßen. Darin besteht der wesentliche Unterschied zwischen einem Gas nach dem kinetischen Gasmodell und dem idealen Gas. Das ideale Gas könnte man theoretisch auf ein beliebig kleines Volumen komprimieren, bei einem kinetischen Gas ist dies aufgrund des Eigenvolumens nicht möglich. Ansonsten erlaubt das kinetische Gasmodell die vollständige Interpretation der idealen Gasgleichung. 26 Vorlesung Physikalische Chemie I 3.4 Christian Mayer Die korrigierte Gasgleichung nach van der Waals J.D. van der Waals Mithilfe des kinetischen Gasmodells lässt sich die Zustandsgleichung für Gase weiter verfeinern. Zunächst soll berücksichtigt werden, dass die Teilchen ein eigenes Volumen besitzen. In erster Näherung geschieht dies, indem man ein vom Eigenvolumen der Gasteilchen abgeleitetes minimales Volumen des Gases (das so genannte Covolumen) definiert. Das Covolumen beschreibt dasjenige Volumen des Gases, das bei ständigem mechanischem Kontakt zwischen jeweils zwei Teilchen eingenommen wird, wenn man den Teilchenpaaren jeweils den sie umschreibenden kugelförmigen Raum zuordnet (wegen der geringen Wahrscheinlichkeit von Dreierstößen kann die Bildung von Dreiergruppen ausgeschlossen werden). Das molare Covolumen b entspricht, wenn man eine einfache geometrische Überlegung ansetzt, dem vierfachen Eigenvolumen eines Mols der Gasteilchen. Um das tatsächliche freie Volumen zu erhalten, muss das n-fache Covolumen vom gegebenen Volumen abgezogen werden. Damit wird aus der idealen Gasgleichung: PV = nRT die erste korrigierte Version P (V - n b) = nRT Im zweiten Schritt soll nun, über das kinetische Gasmodell hinausgehend, auch die anziehende Wechselwirkung zwischen den Teilchen berücksichtigt werden. Die Anziehung zwischen den Teilchen sorgt nach van der Waals für einen zusätzlichen, nach außen nicht messbaren „Binnendruck“. Dieser Binnendruck ist proportional zum Quadrat der Teilchendichte (n/V)². Der zwischen den Teilchen tatsächlich wirkende, nach außen ebenfalls unmessbare Gesamtdruck ist dann gegeben als: Pgesamt (unmessbar) = P (messbar) + a (n/V)² mit einer für die anziehende Wechselwirkung charakteristischen Konstante a. Die danach korrigierte Version der Gasgleichung, die van-der-Waals-Gleichung für reale Gase, lautet [P + a (n/V)²] (V - nb) = nRT Die Konstanten b und a besitzen für jedes reale Gas charakteristische Werte, die dessen Eigenvolumen (die Größe der Elektronenhülle) und die Stärke der intermolekularen Wechselwirkungen reflektieren. Beispiele: Gas Argon Kohlendioxid Helium Stickstoff a 0,1345 0,3592 0,0034 0,1390 b Pa m6/Mol² Pa m6/Mol² Pa m6/Mol² Pa m6/Mol² 27 3,22·10-5 4,267·10-5 2,37·10-5 3,913·10-5 m³/Mol m³/Mol m³/Mol m³/Mol Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Ein guter Test für die korrigierte Zustandsgleichung ist die Berechnung eines Diagramms von P gegen V für verschiedene Temperaturen, das so genannte P-V-Diagramm, und die Gegenüberstellung mit dem entsprechenden experimentellen P-V-Diagramm eines realen Gases. Gemäß der van-der-Waals’schen Gleichung existieren abhängig von der betrachteten Temperatur drei Typen von Isothermen (Abb. 22 links): solche, die einer Hyperbel ähneln (1), eine einzelne Isotherme, die einen Wendepunkt mit waagrechter Tangente besitzt (2) und solche, die ein Minimum, ein Maximum und einen Wendepunkt aufweisen (3). Das experimentell beobachtete Verhalten stimmt in den ersten beiden Fällen recht gut überein, weicht aber bei Isothermen des dritten Typs deutlich vom berechneten Verlauf ab (Abb. 22 rechts): 1 P 2 PV-Diagramm nach van-der-Waals-Gleichung experimentell bestimmtes PV-Diagramm f. reales Gas P 3 3 V V Abb. 22: PV-Diagramme für reale Gase, berechnet nach van der Waals (links) und experimentell bestimmt (rechts). Die drei typischen Formen der Isothermen (1, 2 und 3) sind im Text beschrieben. Offensichtlich beschreibt die van-der-Waals-Gleichung das Verhalten eines realen Gases in der Umgebung des Wendepunkts weniger gut. Experimentell stellt man allerdings fest, dass in diesem Bereich tatsächlich auch kein reines Gas, sondern vielmehr eine Mischung aus einem Gas und einer kondensierten Flüssigkeit, also ein Zweiphasenzustand vorliegt. Dieser Zweiphasenbereich beginnt am Wendepunkt der Isothermen des Typs 2 und schließt alle Minima, Maxima und Wendepunkte der Isothermen des Typs 3 ein (Abb. 23 links): P P MaxwellKorrektur A2 A1 Zweiphasengebiet Zweiphasengebiet ZweiphasenGebiet ZweiphasenGebiet V V Abb. 23: PV-Diagramme für reale Gase mit eingezeichnetem Zweiphasengebiet. Der in diesem Bereich bei der Beschreibung nach van der Waals gegebene Fehler kann in guter Näherung durch die Maxwell-Korrektur kompensiert werden. 28 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Eine einfache Korrektur der van-der-Waals-Gleichung ermöglicht eine realistische Beschreibung des Zweiphasengebiets: Eine horizontale Gerade wird so in der Nähe des Wendepunktes gelegt, dass die oberhalb und unterhalb der Geraden im Zweiphasenbereich gebildeten Teilflächen A1 und A2 die gleiche Größe besitzen (sog. Maxwell-Korrektur, s. Abbildung 23 rechts). Dies sieht zwar nach einer etwas willkürlichen Hilfskonstruktion aus, trotzdem lässt sich damit das Verhalten eines realen Gases im Zweiphasengebiet sehr gut nachvollziehen und vorhersagen. Eine besonders ausgewiesene Position im PV-Diagramm eines realen Gases ist der Scheitelpunkt des Zweiphasengebiets, der durch den Wendepunkt der Isotherme des Typs 2 gebildet wird (Abb. 24). kritischer Punkt P Pc Zweiphasengebiet Vc Tc V Jedes reale Gas besitzt einen sogenannten kritischen Punkt, der durch die kritischen Zustandsgrößen Tc, Pc und Vc beschrieben wird. Die kritische Temperatur Tc ist diejenige Temperatur, bei der sich ein Gas unter Druck gerade noch verflüssigen läßt. Oberhalb der kritischen Temperatur existiert kein flüssiger Zustand. Der entsprechende Druck Pc wird als kritischer Druck bezeichnet. Die Isotherme, die der kritischen Temperatur zugeordnet ist, besitzt als einzige einen Wendepunkt mit horizontaler Tangente, der gleichzeitig den kritischen Punkt markiert. Abb. 24: PV-Diagramm für ein reales Gas mit kritischem Punkt. Dieser sogenannte kritische Punkt wird durch die kritische Temperatur Tc, den kritischen Druck Pc und das kritische Molvolumen Vc festgelegt. Zustände oberhalb des kritischen Punkts nennt man überkritisch. Überkritisches Kohlendioxid besitzt in der Technik große Bedeutung für das Lösen und Ausfällen von pharmazeutischen Wirkstoffen (z.B. Aspirin für Brausetabletten), für die Extraktion (z.B. bei der Entkoffeinierung von Kaffee) oder zur chemischen Reinigung von Textilien. 3.5 Andere Zustandsgleichungen für reale Gase Neben der van-der-Waals-Gleichung existieren weitere Ansätze zur Beschreibung realer Gase, die zwar eine genauere Anpassung an die gemessenen Werte ermöglichen, aber auch komplizierter sind oder mehr Arbeit bei der Bestimmung der charakteristischen Parameter erfordern. Im Folgenden seien als Beispiele die Berthelot-Gleichung und die Virialgleichung erwähnt: a. Berthelot-Gleichung: (P + (An²)/(TV²) ) (V - nB) = n R T Berthelot führte damit als Besonderheit einen temperaturabhängigen Binnendruck ein. Dies ist insoweit physikalisch gerechtfertigt, als die vermehrte thermische Bewegung der Ausbildung von Wechselwirkungen zwischen den Molekülen entgegenwirken kann. b. Virialgleichung: P Vm = A + B P + C P² + D P³ + ....... Mit Vm = V/n. Die Virialgleichung nutzt die Tatsache, dass sich fast alle physikalischen Zusammenhänge über einen Potenzreihenansatz a + bx + cx² + dx³ + …. beliebig genau annähern lassen. Je nach Anzahl der anpassbaren Parameter ist zwar eine beliebig genaue 29 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Beschreibung des realen Gases möglich, allerdings steigt auch der Aufwand für die Bestimmung aller Koeffizienten. 3.6 Beschreibung von Flüssigkeiten Im PV-Diagramm der realen Gase schließt sich links vom Zweiphasengebiet der Bereich der flüssigen Phase an. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass mit sinkendem Volumen der Druck extrem steil ansteigt. Das bedeutet, dass bereits eine geringfügige Volumenzunahme mit einem äußerst großen Druckanstieg verbunden ist. In der Praxis hat das zur Folge, dass Flüssigkeiten im Gegensatz zu Gasen kaum komprimierbar sind. Auch ist die Ausdehnung der Flüssigkeiten bei steigender Temperatur und bei konstantem Druck (der thermische Ausdehnungskoeffizient) sehr viel kleiner als bei Gasen. Eine einfache allgemeine Zustandsgleichung für die flüssige Phase in Analogie zur idealen oder zur van-der-Waals-Gleichung existiert nicht. Stattdessen findet man bei der experimentellen Bestimmung des Zusammenhangs zwischen P, V und T für jede Flüssigkeit ein sehr charakteristisches Verhalten. Vergleicht man die Messergebnisse verschiedener Flüssigkeiten untereinander, so sind kaum Ähnlichkeiten auszumachen. Darüber hinaus sind bestimmte Messungen (z.B. die Messung der Abhängigkeit des Drucks vom Volumen bei konstanter Teilchenzahl und Temperatur) technisch sehr schwer zu realisieren. Das Fehlen einer einheitlichen Zustandsgleichung V(T,P,n) für Flüssigkeiten liegt auch in deren komplexer Struktur begründet. Betrachtet man ein einzelnes Teilchen in der Flüssigkeit, so liegt es bezüglich der Abstände zu seinen nächsten Nachbarn stets in der Nähe des Minimums einer Potentialkurve Epot(r), die einen sehr steilen Verlauf besitzt. Die Abstände zu den benachbarten Teilchen sind damit nahezu fixiert, folglich ist eine unabhängige Translationsbewegung einzelner Teilchen praktisch unmöglich. Stattdessen verlaufen alle Bewegungsprozesse mehr oder weniger kollektiv, also unter gleichzeitiger Verschiebung mehrerer Teilchen. Darüber hinaus gibt es keine nennenswerten freien Volumina, so dass der mittlere Abstand der Teilchen nur unwesentlich verringert werden kann, ein Umstand, der sich in der bereits erwähnten geringen Kompressibilität äußert. Ein Modell für eine allgemeine Flüssigkeit lässt sich im Rahmen einer Computersimulation einführen. Man betrachtet dabei einen würfelförmigen Raum, der einen Ausschnitt aus dem Flüssigkeitsvolumen darstellen soll und eine endliche Anzahl n von Flüssigkeitsteilchen (z.B. n = 1000) enthält. Um die Zahl der Teilchen konstant zu halten und dabei trotzdem deren Beweglichkeit zu wahren, wird eine Kontinuitätsbedingung eingeführt: Jedes Teilchen, das im Rahmen der Bewegungsprozesse den Würfel an einer gegebenen Stelle verlässt, tritt automatisch an der genau gegenüberliegenden Position des Würfels wieder ein. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die Zahl der Teilchen im Würfel konstant bleibt (Abb. 25). Abb. 25: Simulation von Bewegungsvorgängen in einem Flüssigkeitsvolumen unter Wahrung einer konstanten Partikelanzahl. Jedes Teilchen, das im Rahmen der Bewegungsprozesse den Würfel an einer gegebenen Stelle verlässt, tritt automatisch an der genau gegenüberliegenden Position des Würfels wieder ein. An diesem System führt man nun eine so genannte "Monte-Carlo"-Simulation durch. Dabei setzt ein Zufallsgenerator eine geringfügige Verschiebung eines beliebigen einzelnen Teil30 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer chens in Gang. Anschließend wird unter Verwendung des bekannten Potentialverlaufs Epot(r) berechnet, wie sich nach der Verschiebung die potentielle Energie des Systems verändert hat. Danach entscheidet das Simulationsprogramm zwischen zwei Möglichkeiten: - Hat sich die gesamte potentielle Energie des Systems durch die Verschiebung verringert oder blieb sie konstant, so wird die Verschiebung akzeptiert und der nächste Schritt berechnet. - Hat sich die gesamte potentielle Energie durch die Verschiebung um den positiven Wert ∆E erhöht, so wird die Verschiebung mit einer Wahrscheinlichkeit, die von ∆E abhängt, akzeptiert und ansonsten verworfen. Danach wird der nächste Schritt berechnet. Auf diese Weise kann man für beliebige Flüssigkeiten sowohl die typischen Bewegungsprozesse als auch die einflussbedingten Veränderung von Zustandsgrößen (z.B. P in Abhängigkeit von V) berechnen. Allerdings sind die Rechnungen bei den für eine realistische Beschreibung eines Flüssigkeitsvolumens notwendigen großen Teilchenzahlen sehr aufwändig und zeitintensiv. 3.7 Beschreibung von Festkörpern Prüfkörper Auslenkung Begibt man sich im P-V-Diagramm vom flüssigen Zustand ausgehend noch weiter nach links (zu kleineren Volumina, höheren Drucken und niedrigeren Temperaturen), so erreicht man den festen Zustand. Die Problematik der Zustandsgleichung V(T,P,n) von Festkörpern ähnelt jener der Flüssigkeiten. Auch hier sind die Kompressibilitäten und die thermischen Ausdehnungskoeffizienten üblicherweise sehr viel geringer als bei Gasen. Ebenso wie bei Flüssigkeiten sind dabei die Unterschiede zwischen einzelnen Vertretern der Festkörper recht groß, so dass keine gemeinsame Zustandsgleichung wie bei Gasen formuliert werden kann. Im Vergleich mit den Werten der Flüssigkeiten sind die Kompressibilitäten und die thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Festkörper durchschnittlich nochmals um etwa zwei Größenordnungen geringer. t Drehmomentverlauf Flüssigkeiten: t Drehmomentverlauf Festkörper: t Abb. 26: Torsionsexperiment zur Unterscheidung zwischen Flüssigkeiten und Festkörpern (s. Text). 31 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Der wesentliche Unterschied zwischen Festkörpern und Flüssigkeiten besteht allerdings in ihrem gegensätzlichen Verhalten bezüglich Verformung: während Flüssigkeiten einer gegebenen Verformung durch ihre Zähigkeit (Viskosität) Widerstand leisten, reagiert ein Festkörper auf eine Verformung durch eine elastische Deformation. Dieses Verhalten wird in einem Torsionsrheometer deutlich, wobei eine feste oder flüssige Probe periodisch mit einer torsionsartigen Verformung beaufschlagt wird (Abb. 26). Während der Drehmomentverlauf des Festkörpers exakt gleichphasig zur periodischen Auslenkung erfolgt (elastische Verformung), ist der Drehmomentverlauf der Flüssigkeit dazu um ein Viertel einer Wellenlänge phasenverschoben (viskose Reaktion). Bei Flüssigkeiten ist der Widerstand dann maximal, wenn die Deformationsgeschwindigkeit maximal ist (blaue Linie in Abb. 26). Bei Festkörpern ist die Kraft dann maximal, wenn der Deformationszustand maximal ist (rote Linie in Abb. 26). Viele Festkörper stellen Übergänge zwischen diesen beiden Extremfällen dar und werden dann als viskoelastisch bezeichnet. Aus der Betrachtung von Messergebnissen an einer Vielzahl von Materialien geht hervor, dass eine eindeutige Abgrenzung zwischen dem flüssigen und dem festen Zustand selten möglich ist. Entsprechend gibt es auch unterschiedliche Strukturmodelle, die teilweise das elastische Verhalten, teilweise das plastische Verhalten von "Festkörpern" erklären. Dem elastischen Festkörper mit nahezu verschwindender Phasenverschiebung wird am ehesten das Modell eines idealen Kristalls gerecht. Man geht dabei davon aus, dass jedes Atom bzw. Molekül, aus dem der Festkörper zusammengesetzt ist, sich an einem geometrisch festgelegten Gitterpunkt befindet, von dem es sich nicht entfernen kann. Als Bewegungsprozess ist dabei lediglich eine Schwingung mit begrenzter Amplitude möglich. Die denkbaren Geometrien der Gitterstrukturen reichen von primitiv-kubischen Gittern (z.B. Natriumchlorid) über kubisch-dichteste (z.B. Silber, Kupfer) und hexagonaldichteste Kugelpackungen (z.B. Magnesium, Zink) bis zur kubisch-raumzentrierten Struktur (z.B. Eisen, Molybdän). Häufig findet man leichte Abweichungen von der idealen Gitterstruktur, die durch lokale Störungen hervorgerufen werden. Akzeptiert man gewisse Anteile an viskosem Verhalten (d.h. eine leichte Phasenverschiebung) so begibt man sich in den Grenzbereich zwischen Festkörpern und Flüssigkeiten. In einem Material wie Glas ist die regelmäßige Anordnung eines Gitters nicht gegeben, die Atome sind unregelmäßig positioniert und können unter Belastung auch fließen. Solche nicht-kristallinen Festkörper bezeichnet man als amorph. Typische Vertreter amorpher Feststoffe sind Fensterglas, viele transparente Kunststoffe (z.B. Plexiglas, Polyester in Getränkeflaschen), Wachs und Ähnliches. Amorphe Festkörper besitzen keinen Schmelzpunkt, sondern erweichen bei steigender Temperatur allmählich. Amorphe Festkörper können nachträglich kristallisieren, wobei sich häufig das äußere Erscheinungsbild und die physikalischen Eigenschaften drastisch ändern (z.B. Plastikfolie unter Zug). Ein weiterer Grenzfall zwischen Festkörpern und Flüssigkeiten wird durch die so genannten Flüssigkristalle repräsentiert. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass eine hohe Nahordnung, jedoch eine geringe Fernordnung vorliegt. Man findet sie häufig bei länglich geformten Molekülen, die eine bestimmte Vorzugsrichtung aufweisen (nematische Flüssigkristalle) oder darüber hinaus auch noch in ebenen Schichten angeordnet sind (smektische Flüssigkristalle). Weiterhin ist es möglich, dass innerhalb der Ebenen ein Neigungswinkel auftritt, dessen Orientierung sich von Schicht zu Schicht schrittweise ändert (cholesterische Flüssigkristalle). 32 Vorlesung Physikalische Chemie I 3.8 Christian Mayer Das Phasendiagramm Die drei wichtigsten Phasenzustände, zu denen sich eine makroskopische Gesamtheit von Atomen oder Molekülen zusammenfinden können, sind also Gase, Flüssigkeiten und Festkörper. Die Frage ist nun, unter welchen Bedingungen sich ein System für den ersten, den zweiten oder den dritten Zustand entscheidet. Erfahrungsgemäß hängt der gegebene Phasenzustand von den in Kapitel 3.1 eingeführten Zustandsparametern n, V, P und T ab. Legt man die Stoffmenge n auf einen Wert fest (z.B. auf ein Mol Teilchen) und berücksichtigt man, dass nach den gegebenen Zustandsgleichungen die Größen n, V, P und T miteinander verknüpft sind, so genügen zwei Parameter um den jeweils günstigsten Phasenzustand eindeutig festzulegen. Ein Diagramm, bei dem einer der Parameter V, P und T gegen einen anderen aufgetragen wird, eignet sich also prinzipiell, um bei einer gegebenen Teilchenart den unter diesen Bedingungen jeweils angestrebten Phasenzustand zu markieren. So kann man gemäß den Abbildungen 22 bis 24 in einem Diagramm, bei dem P gegen V aufgetragen wird, schon den jeweils gegebenen Phasenzustand eintragen und ablesen. In der Praxis eignen sich solche PV-Diagramme allerdings wenig, um Phasenzustände zu markieren: der gasförmige Zustand nimmt einen sehr breiten Raum ein, während der flüssige und der feste Zustand in dem sehr engen Bereich links neben dem Zweiphasengebiet „eingequetscht“ wäre. Vor allem in diesem Umfeld wäre das Diagramm schwer ablesbar. Wesentlich günstiger ist dagegen die Auftragung vom Druck P gegen die Temperatur T. In diesem PT-Diagramm, das auch als Phasendiagramm bezeichnet wird, lassen sich alle Phasenzustände übersichtlich zuordnen. Dabei bezeichnen Flächenanteile im PT-Diagramm die unter den gegebenen Druck- und Temperaturbedingungen angestrebte Phase (z.B. fest, flüssig, gasförmig), während Linien die dazwischen vorliegenden Gleichgewichte markieren und Phasengrenzlinien genannt werden (Abb. 27). Tripelpunkt si g kritischer Punkt flüs fest P s a g m r fö Phasengrenzlinie ig T Abb. 27: Phasendiagramm mit Auftragung des Drucks (P) gegen die Temperatur (T). 33 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Außerdem enthält ein Phasendiagramm gewöhnlich mindestens zwei besonders ausgezeichnete Punkte: den Tripelpunkt, an dem die drei im Allgemeinen wichtigsten Phasenzustände fest, flüssig und gasförmig miteinander im Gleichgewicht stehen, und den bereits aus dem PV-Diagramm bekannten kritischen Punkt, der das Ende eines definierten Übergangs zwischen flüssiger und gasförmiger Phase markiert. Beispiele für Phasendiagramme: Kohlendioxid und Wasser sind in Abbildung 28 und 29 wiedergegeben. CO2 P fest 72,8 bar flü ss ig kritischer Punkt Tripelpunkt ig örm f s ga 5,11 bar 216,8 K 304,2 K T Abb. 28: Phasendiagramm für Kohlendioxid. H2O Eis 6 P Eis 5 Eis 2 kritischer Punkt Eis 3 218 bar Eis 1 flüs sig Eis 1 m för gas 6 mbar 273,16 K ig 647,3 K T Tripelpunkt Abb. 28: Phasendiagramm für Wasser. Der Bereich oberhalb von 200 bar ist aus Gründen der Übersichtlichkeit entlang der P-Achse komprimiert dargestellt. 34 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Eine wichtige Besonderheit des Phasenverhaltens von Wasser ist die Tatsache, dass die Phasengrenzlinie zwischen flüssigem Wasser und Eis 1 eine negative Steigung aufweist. Dies hat zur Folge, dass gewöhnliches Eis durch Erhöhung des Drucks zum Schmelzen gebracht werden kann. Dieser Umstand ist eine der Ursachen dafür, dass eine Kufe auf Eis gleitet, da der durch das Schmelzen entstehende Wasserfilm die Reibung vermindert (allerdings spielt hier auch die Reibungswärme eine Rolle). Der Grund für dieses Verhalten steht in direkter Verbindung mit der strukturbedingten Volumenabnahme beim Schmelzen von Eis (s. Video unter http://www.youtube.com/watch?v=6s0b_keOiOU) Wählt man in einem Phasendiagramm eine Kombination von Druck und Temperatur, so kann man direkt denjenigen Phasenzustand ablesen, den die gegebene Teilchenart unter diesen Bedingungen anstrebt. Das heißt jedoch nicht, dass dieser Zustand dann auch in jedem Fall und zu jeder Zeit vorliegt. Häufig beobachtet man eine so genannte kinetische Hemmung einer Phasenumwandlung. So gibt es unterkühlte Flüssigkeiten (z.B. Regentropfen bei -3°C) genauso wie unterkühlte Dampfphasen (z.B. übersättigten Wasserdampf in Gewitterwolken) oder überhitzte Flüssigkeiten (z.B. überhitztes Wasser bei einem Siedeverzug). Kristallisationskeime wie Staubkörner können Phasenumwandlungen beschleunigen (z.B. durch Staub verursachter „Industrieschnee“). Bisher wurden lediglich Phasendiagramme von reinen Stoffen betrachtet, die nur aus einer einzelnen Sorte Atomen oder Molekülen bestehen. Mischt man einem gegebenen Stoff eine weitere Komponente hinzu, so ändert sich das Phasendiagramm erheblich. Als Beispiel betrachten wir ein System, in dessen flüssiger Phase ein Fremdstoff A gelöst wird, der weder im Festkörper noch im der Gasphase löslich ist (z.B. Kochsalz in Wasser). In diesem Fall dehnt sich der flüssige Bereich des Phasendiagramms mit steigender Konzentration von A in alle Richtungen aus, so dass gleichzeitig der Schmelzpunkt erniedrigt, der Siedepunkt erhöht und der Dampfdruck verringert wird (Abb. 29). In erster Näherung sind alle genannten Änderungen proportional zu cA. flüs si g fest P ga rm ö sf ig T Abb. 29: Phasendiagramm für ein System, in dessen flüssiger Phase ein Fremdstoff mit steigender Konzentration cA gelöst wird. Der Bereich der flüssigen Phase dehnt sich daraufhin in alle Richtungen aus. 35 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Bei weiter steigender Konzentration von A kann ein Punkt erreicht werden, an dem die Mischung in zwei getrennte Bereiche zerfällt, die ebenfalls als Phasen bezeichnet werden (z.B. Olivenöl und Wasser). Eine dieser Phasen besitzt dann einen hohen Lösemittelanteil bei geringer Konzentration von A, die andere besteht aus einem hohen Anteil an A mit einem geringen Gehalt an Lösemittel. Dieser Vorgang der Phasenseparation binärer (aus zwei Komponenten bestehender) Systeme wird durch eine andere Art von Phasendiagramm beschrieben, dem so genannten Mischphasendiagramm (Abb. 30). Hierbei wird die Temperatur dem relativen Anteil einer Komponente gegenübergestellt, der Druck wird als konstant angenommen. T2 obere kritische Temperatur Beispiel: xA = 0,4 kritischer Punkt Zum gezeigten Beispiel: Temperatur Tk‘ Einphasengebiet s2 s1 T1 Eine Mischung mit dem Molenbruch xA = 0,4 wird von T2 nach T1 abgekühlt. Dabei zerfällt die Mischung bei Tk‘ in zwei Phasen, deren Zusammensetzung bei T1 auf der x-Achse an den Punkten 1 und 2 ablesbar ist. Zweiphasengebiet 1 0 2 Molenbruch xA der Komponente A 1 Abb. 30: Allgemeine Darstellung eines Mischphasendiagramms Grundsätzlich gibt die linke Flanke der Phasentrennlinie (links des kritischen Punkts) die Zusammensetzung der „A-armen“ Phase an, während die rechte Flanke (rechts des kritischen Punkts) die Zusammensetzung der A-reichen Phase beschreibt. Die Mengen der dabei gebildeten Phasen können nach dem so genannten Hebelgesetz berechnet werden. Demnach gilt zwischen dem Anteil n1 der A-armen Phase 1, dem Anteil n2 der A-reichen Phase 2 und den Längen der Pfeile s1 und s2 in der vorhergehenden Abbildung folgender Zusammenhang: n1 s 1 = n2 s 2 Für das gezeigte Beispiel würde das bedeuten, dass der Anteil der Phase 1 etwa doppelt so groß wäre wie der Anteil der Phase 2. In der Nähe der beiden Ränder des Diagramms, also für xA ≈ 0 (sehr wenig A im Lösemittel) oder xA ≈ 1 (sehr wenig Lösemittel in A) liegen in den meisten Fällen einphasige, homogene Mischungen vor. Das besagt, dass auch bei niedrigen Temperaturen ein wenig von dem Stoff A im Lösemittel bzw. ein wenig Lösemittel im Stoff A löslich ist. Der im Diagramm eingezeichnete kritische Punkt bedeutet, dass oberhalb der dazugehörigen kritischen Temperatur keine Entmischung mehr erfolgt, d.h., hier sind die beiden Komponenten vollständig und in jedem Verhältnis miteinander mischbar. Neben solchen oberen kritischen Punkten gibt es auch untere kritische Punkte. Im zweiten Fall gilt, dass die beiden Komponenten unterhalb einer bestimmten Temperatur in jedem Verhältnis miteinander mischbar sind. Im Allgemeinen können die drei verschiedenen Fälle auftreten, die in Abbildung 31 dargestellt sind. 36 Vorlesung Physikalische Chemie I System mit oberem kritischen Punkt Christian Mayer System mit oberem und unterem kritischen Punkt System mit unterem kritischen Punkt 0 1 xA Temperatur Temperatur Temperatur kritischer Punkt kritischer Punkt 0 0 1 xA kritische kritischer Punkte Punkt xA 1 Abb. 31: Mögliche Varianten von kritischen Punkten bei Systemen aus zwei Komponenten Obere kritische Punkte findet man dann, wenn sich die molekulare thermische Bewegung gegen die Tendenz der Moleküle, sich mit gleichartigen Molekülen zusammenzulagern, durchsetzt. Dieses Phänomen ist sehr verbreitet, so dass ein oberer kritischer Punkt bei sehr vielen Mischphasen beobachtet wird. Untere kritische Punkte sind sehr viel seltener. Sie treten beispielsweise dann auf, wenn die beiden Komponenten miteinander bei tiefen Temperaturen einen Komplex bilden, der bei höheren Temperaturen wieder zerfällt und dann zu einer Phasenseparation führt. Ein Beispiel dafür ist die Mischung aus Wasser und Triethylamin. Häufig sind zwei Stoffe A und B im flüssigen Zustand vollständig miteinander mischbar, während sie im festen Zustand durchgehend zwei getrennte Phasen bilden. Ein Beispiel dafür ist die Mischung aus den beiden Metallen Antimon (das hier der Komponente A entspricht) und Wismut, deren Phasendiagramm sich etwa folgendermaßen darstellen lässt: a Temperatur Flüssigkeit c1 Mischphase Festkörper b b2 c c2 d d2 e e2 Mischphase d1 Festkörper e1 0 Eutektikum xA Festkörper 1 Abb. 32: Phasendiagramm einer Mischung aus zwei Stoffen, die im flüssigen Zustand mischbar sind, aber zwei verschiedene feste Phasen bilden. 37 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Bewegt man sich in dem Phasendiagramm entlang der gestrichelten Linie vom Punkt a zum Punkt e, so durchläuft man nacheinander folgende Zustände: a Das System ist vollständig flüssig, die beiden Komponenten A und B sind vollständig gemischt und bilden eine einzelne Phase. b Die höher schmelzende Komponente A beginnt in fast reiner Form zu kristallisieren. Die Zusammensetzung der ersten Kristalle wird durch den Punkt b2 charakterisiert. c Bedingt durch die zunehmende Kristallisation der Komponente A gewinnt die flüssige Phase zunehmend an Komponente B, während sich ihr Gehalt an A allmählich verringert. Ihre Zusammensetzung wird an dieser Stelle durch den Punkt c1 charakterisiert. Die kristalline Phase, die hauptsächlich aus A besteht, besitzt nun die Zusammensetzung c2. d An dieser Stelle steht die flüssige Phase kurz vor der vollständigen Kristallisation, wobei ihre Zusammensetzung d1 fast der des Eutektikums, d.h. der am niedrigsten schmelzenden Mischung der beiden Komponenten entspricht. Darunter befindet sich jetzt schon eine größere Menge kristalline Komponente A mit der Zusammensetzung d2 . e Die flüssige Phase ist nunmehr vollständig verschwunden, das System ist durchgehend fest. Es besteht aus zwei nebeneinander vorliegenden kristallinen Phasen mit den Zusammensetzungen e1 (fast reine Komponente B) und e2 (fast reine Komponente A). Alle Mengenrelationen der Phasen 1 und 2 lassen sich gemäß dem Hebelgesetz berechnen. Ein interessanter und für jede Mischung charakteristischer Punkt eines solchen Phasendiagramms ist der eutektische Punkt, d.h. diejenige Zusammensetzung beider Komponenten, die den niedrigsten Schmelzpunkt aufweist. Ein typisches Beispiel für ein Eutektikum ist Lötzinn, das aus einer Mischung aus 67% Zinn und 33% Blei besteht. Die Existenz des Eutektikums kann dazu genutzt werden, um Materialien (insbesondere Metalle) zu reinigen. Das Prinzip dieser Reinigungsverfahren, die zum Beispiel bei dem so genannten Zonenschmelzen technische Anwendung finden, besteht darin, dass die Zusammensetzung der ersten sich bildenden Schmelze häufig in der Nähe des Eutektikums liegt. Wird diese Schmelze z.B. durch Abtropfen der flüssigen Phase entfernt, so entfernt man gleichzeitig auch einen großen Teil der Verunreinigungen. Mischphasendiagramme zweier elementarer Metalle werden häufig dadurch verkompliziert, dass sich neben den eigentlichen Mischphasen auch Verbindungen mit definierter Zusammensetzung bilden. Ein Beispiel hierfür ist das Mischphasendiagramm von Natrium und Kalium (Na / K): 38 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer Temperatur Flüssigkeit Flüssigkeit + festes Na Flüssigk. + festes Na2 K Flüssigkeit + festes K festes K festes Na festes Na 2K + Na festes K + Na2K 0 Eutektikum xNa 1 Abb. 33: Phasendiagramm für eine Mischung aus Natrium und Kalium. 0,8 0,4 mpo Ko 0,2 0 ,8 0,8 x x2 0,2 0 ,6 B nte e n 0,4 mpo Ko 0 ,6 B nte ne 0,8 0 ,2 0,4 Ko mp on 0,6 en te C 0 ,4 Ko mp o ne 0,6 nte C B 1,0 0,0 0 ,0 0,2 C 1,0 Für Mischphasen aus drei Komponenten, so genannte ternäre Mischungen, sind die bisher gezeigten Darstellungen ungeeignet. Hierfür haben sich Dreiecksdiagramme ("Gibbssches Phasendreieck") durchgesetzt, die das Phasenverhalten unter Variation der Mengenbeiträge aller drei Komponenten aufzeigen. Das Diagramm ist so geartet, dass die Summe aller drei Mengenanteile xA, xB und xC in jedem Fall den Wert 1 ergibt. Damit besitzt die Zusammensetzung des ternären Gemisches zwei Freiheitsgrade. Jede Linie, die durch eine Ecke des Diagramms führt, verbindet diejenigen Punkte, bei denen das Verhältnis zweier Komponenten gleich ist. Jede Linie, die parallel zu einer der drei Seiten verläuft, entspricht Gemischen, bei denen der relative Anteil einer Komponente gleich bleibt. 0,0 0 ,0 0,2 0,4 0,6 Komponente A 0,8 1,0 1 ,0 A 0,0 x1 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 Komponente A 0,8 1,0 Abb. 34: Prinzip eines ternären Phasendiagramms nach Gibbs (Dreiecksdiagramm). In solche ternären Mischphasendiagramme lassen sich nun, entsprechend den binären Mischphasendiagrammen, die Ein- und Zweiphasengebiete einzeichnen. Das folgende Diagramm gilt z.B. für eine ternäre Mischung aus A, B und C, bei der die Komponenten A 39 Vorlesung Physikalische Chemie I Christian Mayer und B sowie B und C jeweils paarweise in jedem Verhältnis miteinander mischbar sind. Die Komponenten A und C sollen dagegen nur begrenzt mischbar sein. Als Konsequenz daraus ergibt sich ein Dreiecksdiagramm, das an der unteren Achse, die dem Anteil 0 der Komponente B entspricht, ein Zweiphasengebiet aufweist. Die Hilfslinien im Zweiphasengebiet markieren die Zusammensetzung der entstehenden Einzelphasen. So würde beispielsweise eine Mischung, deren Zusammensetzung im Diagramm durch den Punkt x markiert ist, in die beiden Phasen x1 und x2 zerfallen. Die Mengenanteile der beiden Phasen könnten dabei wieder über das Hebelgesetz berechnet werden. Um zusätzlich den Einfluss der Temperatur wiederzugeben, muss eine weitere Koordinate eingeführt werden. Man erhält dabei ein dreidimensionales Dreiecksdiagramm, das häufig unter Verwendung von "Höhenlinien" nach der Art einer topographischen Landkarte dargestellt wird. Jede Höhenlinie des Zweiphasengebiets umschreibt dann seine Ausdehnung bei einer gegebenen Temperatur. Fragt man bei einem System mit bestehenden Randbedingungen nach der Zahl der frei variierbaren Zustandsgrößen, also nach der Zahl der Freiheitsgrade, so hängt die Antwort zunächst davon ab, in welchem Phasenzustand sich das System befindet. So kann man beispielsweise in der Gasphase (bei festgelegter Stoffmenge) Temperatur und Druck frei wählen, wodurch dann automatisch das Volumen festgelegt wird. Gleiches gilt für die feste und die flüssige Phase. Das System hat innerhalb eines Phasenzustands also zwei Freiheitsgrade. Setz man allerdings voraus, dass sich das System in einem Gleichgewicht zwischen zwei Phasen befindet (z.B. auf der Verdampfungslinie), so besitzt es nur einen Freiheitsgrad. Am Tripelpunkt schließlich, bei einem Gleichgewicht zwischen drei Phasen, sind keine Freiheitsgrade mehr vorhanden. Zwischen der Zahl der Phasen P und der Zahl der Freiheitsgrade F gibt es also folgende einfache Beziehung: F = 3-P Berücksichtigt man weiter, dass auch mehr als eine Komponente auftreten kann (Zahl der Komponenten C > 1), so erhöht sich die Zahl der Freiheitsgrade um jede zusätzliche Komponente, deren Konzentration ja frei wählbar ist, um den Wert eins. Man erhält damit: oder F F = = 3 - P + (C - 1) C-P+2 Nach dieser allgemeingültigen Formel, der so genannten Gibbs’schen Phasenregel, lässt sich die Zahl der Freiheitsgrade in jedem beliebigen System bestimmen. Sie erlaubt insbesondere bei sehr komplizierten Mischungen mit einer unbekannten Anzahl an Phasenzuständen über eine einfache Betrachtung Rückschlüsse auf deren Phasenverhalten. 40