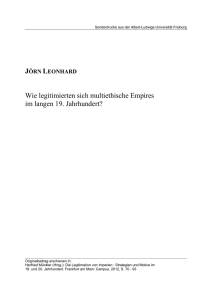International Conference „Rule and Conflict, Representation and
Werbung

International Conference „Rule and Conflict, Representation and Crisis: Multiethnic Empires since the 19th Century“ Veranstalter: Jörn Leonhard (Freiburg) und Ulrike von Hirschhausen (Hamburg/Bielefeld) Finanzierung: Fritz-Thyssen-Stiftung (Konferenz), Gerda Henkel Stiftung (Forschungsprojekt) Ort/Datum: Universität Freiburg, 4.-6.10. 2007 Bericht von: Sonja Levsen, Historisches Seminar der Universität Freiburg [email protected] Was ist ein Empire? Dieser grundlegenden Frage ebenso wie konkreten Problemen imperialer Herrschaft und Gesellschaft im 19. Jahrhundert ging die Tagung zum Thema „Rule and Conflict, Representation and Crisis: Multiethnic Empires since the 19th Century“ vom 4. bis 6. Oktober 2007 in Freiburg nach. Die von JÖRN LEONHARD (Freiburg) und ULRIKE VON HIRSCHHAUSEN (Hamburg/Bielefeld) im Rahmen des Forschungsprojektes „Empires. Chancen und Krisen multiethnischer Großreiche im 19. und 20. Jahrhundert“ konzipierte Veranstaltung schloss inhaltlich an einen ersten Workshop im Januar 2007 an. Die Konferenz zeichnete sich ebenso wie das Projekt selbst durch eine konsequent vergleichende Perspektive aus: Jede der fünf Sektionen vereinte Vorträge zum Britischen Empire, der Habsburgermonarchie, dem Russischen Reich und dem Osmanischen Reich. Inhaltlich stand mit der Epoche zwischen dem frühen 19. Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg das Jahrhundert der anwachsenden Nationalbewegungen im Mittelpunkt, deren Einfluss auf die imperialen Herrschaftsstrukturen und die damit verbundenen Konflikte von einem Großteil der Vorträge thematisiert wurden. Anknüpfend an neuere Forschungsperspektiven plädierten die Veranstalter für eine Abkehr von einer Historiographie des „rise and fall“, welche die Imperien als failures, als dem Nationalstaat unterlegenes Modell bewerte. Es sei an der Zeit, die historischen Alternativen des Nationalstaates ernst zu nehmen und an die Stelle einer Geschichte von Aufstieg und Niedergang die Frage nach Potenzialen und Grenzen multiethnischer Imperien zu setzen. Auf der Grundlage der vorausgegangenen Tagung stellte Jörn Leonhard eine Reihe von Kriterien und Annahmen vor, die einem systematischen Empirevergleich zugrunde gelegt werden könnten. So sei es wichtig, dem Charakter des imperialen Raums Aufmerksamkeit zu widmen, da seine Beschaffenheit die Handlungsoptionen und damit auch die Politik der Empires entscheidend geprägt habe. Ebenfalls im Blick zu behalten seien die Rahmenbedingungen, die durch Regierungsformen und politische Systeme sowohl dem Regierungshandeln als auch den gesellschaftlichen Entwicklungen in den untersuchten Imperien gesetzt waren. Als weiteres wichtiges Ziel skizzierten die Organisatoren eine Problematisierung der Unterschiede zwischen Empire und Nationalstaat sowie die Überwindung von begrifflichen Dichotomien, etwa des Gegensatzes von metropolis und colony und von imperial und colonial. Die in diesen Begriffspaaren sprachlich vermittelte Gegensätzlichkeit entspreche nicht der Erfahrungsebene der Akteure auf allen Ebenen der Empires. Jene sei vielmehr von in stetigem Wandel begriffenen, situativen Selbstbildern gekennzeichnet gewesen. Die erste Sektion der Konferenz befasste sich unter dem Titel „Conquering and Classifying – Surveying Composite States and Multi-ethnic Populations“ mit Strategien der Erfassung des imperialen Territoriums und seiner Bevölkerung. Ulrike von Hirschhausen eröffnete die Sektion mit einer Untersuchung von Volkszählungen in der Habsburgermonarchie und im russischen Zarenreich, die sie im Hinblick auf Motive der Regierungen, Implementation, Funktionen sowie die Reaktionen der Bevölkerung analysierte. Gerade im Vergleich mit dem All-India-Zensus des Britischen Empire würde deutlich, so Hirschhausen, dass das Instrument der Volkszählung keine imperiale Maßnahme des Staates bleibe. Seine vielfältige Funktionalisierung durch die autochthonen Bevölkerungen zeige vielmehr, wie imperiale Praktiken „von oben“ für die Interessen „von unten“ nutzbar gemacht würden und wie sich der vermeintlich scharfe Gegensatz „between imperial and colonised agency“ dadurch situativ auflöse. CLAUDIA WEISS (Hamburg) skizzierte am Beispiel der Russian Geographical Society (RGO), wie sich die Geographie im Russland des späten 19. Jahrhunderts zu einer zentralen Hilfswissenschaft imperialer Herrschaft entwickelte und sich das Image einer „queen of imperial sciences“ erwarb. Die RGO, so Weiss, definierte ihre wissenschaftlichen Ziele im Einklang mit den Bedürfnissen des Russischen Reichs, kooperierte in ihren Aktivitäten eng mit der Regierung und trug damit entscheidend sowohl zur wirtschaftlichen Erschließung des sibirischen Raumes als auch zu seiner Eingliederung in die mental maps der Zeitgenossen bei. GUY THOMAS (Basel) untersuchte am Beispiel der britischen Herrschaft in Afrika die Macht der Karten und Kartographen in der Definition und Projektion imperialer Räume. Die bekannte Darstellung des britischen Empires auf Weltkarten als einheitlich ‚pink’ eingefärbtem Raum etwa projiziere die Illusion eines homogenen Herrschaftsgebietes und suggeriere damit eine viel weitergehende Hegemonie der Briten im Empire als sie jemals tatsächlich existierte. MEHMET HACISALIHOĞLU (Istanbul) hingegen betonte in seiner Diskussion der Rolle von Karten und Statistiken in den Zentralisierungsversuchen des Osmanischen Reiches die Unzuverlässigkeit dieser Hilfsmittel, die sie angreifbar und zum politischen Streitpunkt machte. Als Grundlage für Regierungshandeln eigneten sie sich damit nur begrenzt. UTE SCHNEIDER (Bochum) arbeitete in ihrem Kommentar geschickt verbindende Charakteristika der in den Vorträgen thematisierten Erfassungsbemühungen heraus. Das 19. Jahrhundert, so ihr Fazit, sei von einem neuen Interesse an der „Visualisierung des Sozialen“ gekennzeichnet gewesen, das sich in Darstellungsarten wie etwa thematischen Karten (z.B. Sprachkarten, Karten ethnischer Gruppen) äußerte. Sie warf die Frage auf, ob bzw. inwiefern solche kartographischen oder statistischen Wirklichkeitskonstruktionen Folgen für die Selbstwahrnehmung der dargestellten Gruppen hatten – „had different ethnicities already a notion of their difference, or was this constructed through these maps and statistics?“ In der Diskussion wurde die Frage nach Formen und Mechanismen des „making ethnicity“ vielfach aufgegriffen und mit verschiedenen Schwerpunkten beantwortet. JOACHIM VON PUTTKAMER (Jena) etwa postulierte, dass die Ethnographen der Mitte des 19. Jahrhunderts einerseits eine klare Idee davon gehabt hätten, dass ethnicity ein komplexes Konzept sei, andererseits aber versucht hätten, diese Komplexität zu reduzieren, und ein singuläres Kriterium für die Zugehörigkeit zu einer Ethnie zu bestimmen. Die zweite Sektion verglich unter dem Motto „Ruling and Bargaining“ Akteurskonstellationen und Lösungs- bzw. Eindämmungsstrategien in verschiedenen Konfliktszenarien innerhalb der Imperien. ALEXEI MILLER (Budapest) wandte sich in seinem Vortrag über Strategien der Integration und Russifizierung lokaler Eliten im Romanow-Reich gegen die Darstellung nationaler Konflikte als „play for two actors with the russifying state versus those resisting russification“ und betonte die Vielzahl involvierter Akteure ebenso wie die Komplexität der Verhandlungen von nationaler Identität. Joachim von Puttkamer (Jena) thematisierte Gemeinsamkeiten (‚somewhat parallel crises’) und Unterschiede (‚radically different solutions’) zwischen dem russisch-polnischen Konflikt nach 1863 und dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867. Der Vergleich deute, so Puttkamer, auf einen Strukturwandel imperialer Politik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hin: Traditionelle Kompromissstrategien, die auf einen Ausgleich ausschließlich mit dem Landadel zielten, hätten sich angesichts neuer, konkurrierender Akteure auch im zunächst erfolgreichen österreichischen Fall letztlich als Auslaufmodelle erwiesen; neue Deeskalations- und Kompromissstrategien seien noch nicht in Sicht gewesen. Was das britische Empire erfolgreicher in der Konfliktbewältigung als seine kontinentalen Konkurrenten? Jörn Leonhard (Freiburg) verneinte diese Frage weitgehend in seinem Vergleich der britischen Konfliktstrategien während der Indian Mutiny (1857) und dem Burenkrieg (1899-1902). In beiden Fällen sei dem kurzfristigen militärischen Erfolg keine zielstrebige Politik der Integration und Stabilisierung des Empires gefolgt. Vielmehr sei es zu ad-hoc-Lösungen gekommen, welche die drängendsten Probleme nur lösten, indem sie andere ignorierten bzw. in das 20. Jahrhundert aufschoben. Zwar sei in beiden Fällen mit dem militärischen Erfolg vorübergehend die Macht und Reputation des Empires gestärkt worden, die langfristig entscheidenden Fragen der Integration und der politischen Partizipation jedoch nicht gelöst worden, wie zumal der Ausschluss der schwarzen Bevölkerung Südafrikas von der Verfassung und vom Wahlrecht nach dem Burenkrieg zeigte. MAURUS REINKOWKSI (Freiburg) ergänzte die Thematik des „Ruling and Bargaining“ mit Überlegungen zu Reformpolitik und Nationalismus im Osmanischen Reich. Die Osmanische Regierung in der Tanzimat-Epoche habe sich zum Ziel gesetzt, Ottomen zu schaffen – sie habe versucht, einen Staatspatriotismus an die Stelle nationaler Identitäten zu setzen. Die Macht des Nationalismus sei von der Zentralregierung fortwährend unterschätzt worden, „the Ottomans did not want to understand the nationalist movements“. Reinkowskis Formulierung, das 19. Jahrhundert habe für die Osmanische Regierung ein „loss of imperial routine“ bedeutet, wurde als anregendes Stichwort in der Diskussion vielfach aufgegriffen. JÜRGEN OSTERHAMMEL (Konstanz) frage in seinem Kommentar kritisch, ob es den Vorträgen der Sektion tatsächlich gelungen sei, Werturteile über Erfolg und Misserfolg von Empires zu vermeiden und beleuchtete die Problematik solcher Urteile. Es stelle sich die Frage, woran man den Erfolg eines Empires messe; welchen Zeitraum man für ein solches Urteil zugrunde lege, und von welcher Perspektive man ausgehe. Nehme man etwa Konflikt und Krise als Ausgangspunkt, ergebe sich eine andere Bewertung, als wenn man Stabilität und Erfolg als Normalzustand definiere. Auch Integrationserfolge zu messen, sei problematisch, da Integration auf verschiedenen Ebenen und Feldern sowie mit verschiedenen Mechanismen stattfinde, der Zusammenhang von Integration und Stabilität zu hinterfragen sei und schließlich auch verschiedene Formen der Stabilität diskutiert werden könnten. In der anschließenden Diskussion wurde die Frage nach dem Verhältnis von Konflikt und Stabilität in Imperien von verschiedenen Seiten beleuchtet. Am Freitag morgen rückte mit der Sektion „Identifying and Representing – The Role of Monarchy and Dynasty for the Mediation of Imperial Images“ zum einen die kulturgeschichtliche Perspektive und innerhalb dieser die Frage nach dem Integrationspotenzial der Monarchien in den Mittelpunkt. FRITHJOF BENJAMIN SCHENK (München) eröffnete die Sektion mit einer Untersuchung der Zarenreisen im russischen Reich des 19. Jahrhunderts. Vergleiche man die Reisetätigkeit der verschiedenen Zaren des 19. Jahrhunderts, ergebe sich der erstaunliche Befund, dass die Mobilität russischer Herrscher in diesem Zeitraum nicht zu- sondern abgenommen habe. Verstehe man Herrscherreisen als eine Form des „marking the country’s external and internal borders“ und als Strategie der Popularisierung des Herrschers, lese sich die Geschichte der Zarenreisen als eine der verpassten Möglichkeiten und Misserfolge. LAURENCE COLE (Norwich) zog für das integrative Potenzial des Monarchen im Habsburgerreich eine andere Schlussfolgerung: Am Beispiel der Veteranenorganisationen im Trentino – 1890 gab es im ganzen Habsburgerreich rund 1700 solcher Vereine – diskutierte er „mechanisms of loyalty“ bzw. die Entstehung von „communities of loyalty“. Veteranen, so Cole, wurden zu Vermittlern der „Österreichischen Idee“ und zu Vorbildern dynastischer Loyalität, für deren Wirkmacht die Person Franz Josephs eine wichtige Rolle gespielt habe. MILES TAYLOR (York) diskutierte den Stellenwert Indiens in der Politik und der imperialen Selbstdarstellung Queen Victorias in der von der Forschung bisher vernachlässigten Frühphase ihrer Regierungszeit. Seit den 1840er Jahren habe Indien eine zunehmend wichtige Rolle in Viktorias Politik gespielt, sie habe sich in Indien das Image einer ‚Warrior Queen’ erworben und aktiv in indische Politik eingegriffen. HAKAN KARATEKE (Cambridge/Mass.) ergänzte die Sektion um eine Untersuchung zu Idealbildern des Sultans im Osmanischen Reich. In seinem Kommentar unterstrich PETER HASLINGER (Marburg/Gießen) die Bedeutung des imperialen Raumes bzw. der imperialen Geographie in monarchischen Repräsentationsstrategien und skizzierte verschiedene Problemstellungen, denen noch genauer nachzugehen sei, wie etwa der Chronologie monarchischer Repräsentationsmechanismen, der Vielfältigkeit der „languages of loyalty“ oder der Begriffsgeschichte dynastischer Titel. Auch die Rolle der Medien sowie die verschiedenen Formen, in denen Monarchen vom imperialen Raum symbolisch Besitz nahmen, müssten noch differenzierter untersucht werden. In der Diskussion stand die Frage nach dem Spektrum der Idealbilder und Realtypen imperialer Herrschermacht und den Möglichkeiten einer Typologisierung der ‚models of imperial kingship’ im Mittelpunkt. Die vierte Sektion der Tagung wandte sich unter dem Titel „Believing and Integrating – Religion and Confession as Media for Imperial Self-Images“ den Integrations- und Konfliktpotenzialen der Religion in Imperien zu. MARTIN SCHULZE WESSEL (München) ging dem Verhältnis von Religion und imperialer Herrschaft unter den Habsburgern und den Romanows nach – eine Beziehung, die, so Schulze Wessel, komplexer gewesen sei als es die Metapher der Staatsreligion als „Pfeiler“ imperialer Macht nahe lege. Reformbewegungen innerhalb der römisch-katholischen und der russischen orthodoxen Kirche hätten sich von der hierarchie-orientierten Theologie der Traditionalisten abgewandt und sich im Habsburgerreich auf die Seite der Nationalbewegungen geschlagen. Der multikonfessionelle Charakter beider Imperien habe darüber hinaus staatliche Religionspolitik vor komplexe Herausforderungen gestellt. AZMI ÖZCAN (Sakarya) diskutierte die Entwicklung und die Auswirkungen des Konzeptes eines „universalen Kaliphats“ im Osmanischen Reich. BENEDIKT STUCHTEY (London) betonte im letzten Vortrag der Sektion, dass protestantische Missionare in den britischen Kolonien nicht einfach einen verlängerten Arm der Kolonialmacht bildeten. Zwar trugen sie auf der einen Seite zur Aufrechterhaltung der Kontrolle und Hegemonie über die Kolonien bei, „and yet at the same time [they] underlined its diversity and the great challenges it faced in its metropolitan centre and at the periphery as regards the formation of a religious self-image.“ FIKRET ADANIR (Bochum) charakterisierte in seinem Kommentar die Rolle der Religionen in Empires als stets ambivalent, mit legitimisierenden, integrationsfördernden ebenso wie desintegrierenden und konflikthaften Elementen. Die fünfte und letzte Sektion widmete sich am Samstag vormittag dem „Defending and Fighting“, und damit den Empires im Ersten Weltkrieg. ERIC LOHR (Washington) argumentierte, das russische Empire habe in der Mobilisierung seiner Ressourcen und Bevölkerung für den totalen Krieg auf das Konzept eines „core nationalism“ gesetzt. DAN UNOWSKY (Memphis) griff die bereits in dem Vortrag von Laurence Cole angesprochene Frage nach dem Integrationspotenzial der Habsburgermonarchie auf und argumentierte, dass das am Ende des 19. Jahrhunderts geschaffene, in den Medien, in Festen und Ritualen transportierte Image Franz Josephs in Friedenszeiten ein gewisses Integrationspotenzial für das Habsburgerreich besaß, im Krieg jedoch keine Bindekraft mehr entwickeln konnte. SANTANU DAS (London) stellte als einer der wenigen Referenten in seinem Vortrag zu indischen Kriegserfahrungen im Ersten Weltkrieg die Perspektive der „colonised“ in den Mittelpunkt, wandte sich jedoch zugleich gegen eine scharfe Gegenüberstellung von „coloniser vs. colonised“ sowie von „imperialism vs. nationalism“. An die Stelle solcher Kategorien müsse eine Untersuchung der „complex psychological structures“ der Kriegserfahrungen und Selbstbilder im „tangled web of Empire“ treten – ein Plädoyer, das in der Diskussion mehrfach aufgegriffen wurde. Im letzten Vortrag der Tagung befasste sich ERIK-JAN ZÜRCHER (Leiden) mit der osmanischen Politik ethnischer Säuberungen und der Eskalation dieser Politik im Ersten Weltkrieg. Seine besondere Aufmerksamkeit galt dabei der Kette von Ursachen und Folgen, welche die Epoche zwischen dem Russisch-Türkischen Krieg 1877/8 und dem TürkischGriechischen Bevölkerungsaustausch Anfang der 1920er Jahre als Ära des osmanischen „demographic engineering“ zusammenband. In seinem Kommentar betonte Jörn Leonhard die für alle Fallbeispiele signifikanten Folgen des radikalisierten Kriegsnationalismus, den er als Folge des Weltkrieges als langem Krieg interpretierte. Der Krieg habe radikalisierte Kriterien politischer und wirtschaftlicher Effizienz sowie neue Akteure, Politikfelder und Handlungsmöglichkeiten hervorgebracht und damit die untersuchten Empires vor komplexe Herausforderungen gestellt. Die in den Vorträgen dargestellten Reaktionen ließen sich in ähnlicher Form allerdings auch in anderen Gesellschaften finden – etwa in Frankreich, Deutschland und Italien – so dass sich erneut die Frage nach dem Spezifischen der Empires stelle. Die Frage nach den Folgen des Ersten Weltkrieges für die Bindekraft der Empires prägte die anschließende Diskussion. Ausmaß und Gründe des ‚loss of legitimacy’, den der Erste Weltkrieg in den Empires bewirkte, blieben dabei umstritten – differenziert werden müsse, so argumentierten verschiedene Teilnehmer, zwischen Eliten und ‚Massen’, zwischen agrarisch und industriell geprägten Gesellschaften, sowie zwischen verschiedenen Regionen innerhalb der Empires. In ihren abschließenden Bemerkungen skizzierten Ulrike von Hirschhausen und Jörn Leonhard Ergebnisse, offene Fragen und noch zu lösende Probleme. Unter letzteren hob Leonhard vor allem die sprachliche Herausforderung einer vergleichenden Empire-Geschichte hervor: Begriffe wie Empire und Reich, Rasse und race, sowie etwa die jeweiligen Übersetzungen von citizenship, nation, federalism, patriotism etc. stellen in verschiedenen Sprachen keine deckungsgleichen Begriffe dar – ein Problem, dem sich in einer vergleichenden historischen Untersuchung imperialer Semantiken nachzugehen lohne. Er systematisierte darüber hinaus die Vergleichsperspektiven, die in der Tagung gewählt wurden, in vier Kategorien: Symptomatische und systematische Vergleiche, symmetrische und asymmetrische Vergleiche, synchrone und diachrone Vergleiche, sowie Vergleiche aus verschiedenen Perspektiven – von ‚oben’ und ‚unten’, horizontale und vertikale Phänomene beobachtend. Ulrike von Hirschhausen griff die in den Diskussionen immer wieder gestreifte Frage nach dem Unterschied zwischen Nationalstaaten und Empires auf – im Umgang etwa mit Minderheiten hätten die Vorträge eher Ähnlichkeiten als Unterschiede zwischen Imperien und Nationalstaaten herausgestellt. Zudem verfolgten Nationalstaaten imperiale Ambitionen und Empires versuchten, ihre Bevölkerung zu ‚nationalisieren’, so dass sich die Frage stelle, wo sich „nationalizing Empires“ und „imperializing nation“ träfen? Daraus folge schließlich die Frage nach den Unterschieden zwischen dem Begriff des „composite state“ und jenem des Empires. Die Schlussdiskussion widmete sich erneut diesen grundlegenden Definitionsfragen. Nachdem die Vorträge und Diskussionen die Schwierigkeit deutlich gemacht hatten, ‚harte’ Unterscheidungskriterien zu finden, wurden eine Reihe von ‚weichen’ Kriterien vorgeschlagen, die zu einer Abgrenzung der Konzepte beitragen könnten. So könne man etwa Empires ein höheres Bewusstsein für die „artificial composite structure“ des Staates zuschreiben als Nationalstaaten. Auch die größere Vielfältigkeit der Akteure, der Politik- und Erfahrungsebenen ebenso wie der Räume und der Konfliktlagen sei eine zentrale Eigenschaft von Imperien. Sie stelle Historiker vor die Herausforderung, hochkomplexe Probleme zu untersuchen und darzustellen, ohne deren Komplexität zu reduzieren. Das 19. Jahrhundert, lautete ein inhaltliches Fazit der Diskussion, habe für alle behandelten Empires einen Verlust an Flexibilität und Handlungsfreiheit bedeutet. Es stieg die Zahl der Akteure, die konkurrierende Vorstellungen ethnischer, nationaler und staatlicher Organisation in die Öffentlichkeit brachten; die Entwicklung einer Medienöffentlichkeit insbesondere seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schuf neue Rahmenbedingungen für politisches Handeln sowohl von ‚oben’ als auch von ‚unten’. In einer kritischen Bestandsaufnahme der behandelten Themen konstatierten Organisatoren und Teilnehmer schließlich den relativen Mangel an Vorträgen zur Erfahrungsebene und eine weitgehende Absenz von gender-Fragen. Befördert wurden die lebhaften, aber fairen Diskussionen von der Tatsache, dass die Tagung Historiker miteinander ins Gespräch brachte, die nicht nur aus verschiedenen nationalen Wissenschaftskulturen stammten, sondern auch aus Forschungsfeldern, die sonst wenig Kontakt miteinander haben. Die Teilnehmer scheuten sich nicht, auch grundlegende Fragen wie die Erkenntnismöglichkeiten und Potenziale einer vergleichenden Empiregeschichte zu debattieren. Sie nahmen die Anregungen der kontrastierenden und parallelisierenden Vergleichsperspektiven auf und machten damit die Konferenz zu einem Ort gelungener wissenschaftlicher Kommunikation.