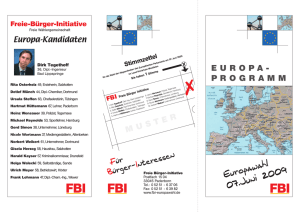Auf der Suche nach einem neuen Wachstumsmodell
Werbung

Das Progressive Zentrum Wir denken weiter. http://www.progressives-zentrum.org Auf der Suche nach einem neuen Wachstumsmodell Ein eher missglückter Versuch war die so genannte Lissabon-Strategie aus dem Jahr 2000, die das Ziel hatte, die Europäische Union binnen zehn Jahren zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen“. Dass Europa die Ziele von Lissabon nicht erreichen konnte, führen viele auch auf den Beitritt der zehn postkommunistischen Länder zurück. Denn in der EU-27 hat das Wohlstandsgefälle extrem zugenommen, was Reform- und Erneuerungsprozesse zusätzlich verkompliziert. Insbesondere die neuen Mitgliedsländer haben die ursprünglich nur für die EU-15 formulierten Lissaboner Ziele nicht annähernd erreichen können. Aus Sicht vieler Osteuropäer war das Scheitern allerdings programmiert, handelte es sich doch in erster Linie um eine Strategie von Westeuropäern für Westeuropa. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen hat die Europäische Union – nun selbstverständlich unter Beteiligung aller neuen Mitgliedsländer – die Lissabon-Strategie im Jahr 2010 weiterentwickelt und eine „Europäische Strategie für ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (kurz: „Europa 2020“) verabschiedet. Im Rahmen der neuen Strategie setzt die EU drei Prioritäten: die Entwicklung der Wissensgesellschaft, einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und den sozialen Zusammenhalt bei geringer Arbeitslosigkeit. Diese übergeordneten Prioritäten hat die EU mit konkreten Zielen untersetzt: Beispielsweise sollen die Nationalstaaten ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis zum Jahr 2020 auf mindestens 3 Prozent des nationalen Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Die Beschäftigungsquote soll von derzeit rund 65 auf durchschnittlich 75 Prozent steigen. Und die Treibhausgasemissionen sollen gegenüber 1990 um mindestens 20 Prozent gesenkt werden. Wird diese Strategie erfolgreicher sein als ihre Vorgängerin? Und gelingt es diesmal besser, die Belange und Interessenslagen der neuen Mitgliedsländer bei diesem wichtigen Reformprojekt mit einzubeziehen? Viel spricht dafür, dass die Ziele von Europa 2020 nur schwer zu erreichen sein werden. Denn zum einen findet die Implementierung der Strategie vor dem Hintergrund der immer noch andauernden Wirtschafts- und Schuldenkrise und einer damit einhergehenden politischen Krise Europas statt. Zum anderen fehlen der Europäischen Kommission – wie schon im Fall der Lissabon-Strategie – sowohl eigene Kompetenzen, um die ambitionierten Ziele zu erreichen, als auch die entsprechenden Druckmittel, um von den Mitgliedsstaaten die notwendigen Reformen einzufordern. Ob die gemeinsamen Ziele erreicht werden können, hängt von der freiwilligen Kooperationsbereitschaft der Mitgliedsländer ab. Dementsprechend spiegelt sich EU 2020 auch nicht im EU Haushalt wieder, dessen Mittel noch immer zu 70 Prozent in die Kohäsions- und Agrarpolitik fließen – Geld, das für den konsequenten Aufbau einer wissensintensiven Wirtschaft und Gesellschaft fehlt. Diese Situation ist vor allem für die neuen Mitgliedsländer ein Dilemma: Von den strukturkonservativen Fördermitteln der EU profitieren sie am meisten; im Wettbewerb um die europäischen Förderprogramme zur Stärkung der Innovationsfähigkeit hingegen unterliegen sie regelmäßig den westlichen Mitgliedsländern. Daher werden sie sich bei den im zweiten Halbjahr 2011 anstehenden Verhandlungen über den finanziellen Rahmen für die Jahre 2014 bis 2020 unter 1/4 Das Progressive Zentrum Wir denken weiter. http://www.progressives-zentrum.org der polnischen EU-Ratspräsidentschaft voraussichtlich gegen eine Neuordnung des EUBudgets wehren und für eine Aufrechterhaltung des Status quo stark machen. Dies mag aus der Perspektive der mittel- und osteuropäischen Staaten auf kurze Sicht rational erscheinen, wirkt aber langfristig selbstschädigend. Denn auf diese Weise verhindern die betroffenen Staaten, dass wichtige Modernisierungsdiskurse und -prozesse vorangetrieben werden – und zwar sowohl auf Ebene der EU, als auch in den einzelnen Ländern selbst. Dabei ist die Notwendigkeit einer Transformation in Richtung einer Wissensgesellschaft auch in Ländern wie Polen, Ungarn oder Tschechien mittlerweile weitgehend unstrittig. Diese Erkenntnis hat weniger mit den Postulaten der Europäischen Union zu tun, als mit globalen Trends: Weltweit entwickelt sich zunehmend eine wissensbasierte Wirtschaft, in der nicht mehr Material, Arbeitskraft, Land und Kapital die wichtigsten Produktionsfaktoren darstellen, sondern Wissen und Expertise. Jene Unternehmen werden in Zukunft die Nase vorn haben, die über mehr Wissen verfügen als ihre Konkurrenten: Unternehmen, die gute Ideen produzieren, innovative Dienstleistungen entwickeln oder ihre Produkte pfiffig vermarkten. Jedoch ist das mittel- und osteuropäische Wachstumsmodell der vergangenen zwanzig Jahre kaum auf die Stärkung der wissensbasierten Wirtschaft ausgerichtet gewesen. In erster Linie ging es den Ländern darum, mit Hilfe niedriger Steuern und Löhne internationale Direktinvestitionen (FDI) anzulocken – und so für mehr Beschäftigung zu sorgen. Jahrelang waren viele mittel- und osteuropäische Länder als verlängerte Werkbänke westlicher Unternehmen erfolgreich. Als dramatischer Einschnitt für diesen Entwicklungspfad erwies sich dann allerdings die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise: Seit dem Jahr 2009 verschlechterte sich die Auftragslage der osteuropäischen Unternehmen zunehmend; die ausländischen Direktinvestitionen gingen zwischenzeitlich auf Null zurück; westliche Banken zogen ihr Kapital ab, so dass die nationalen Währungen gegenüber dem Euro an Wert verloren. Damit hat Mittelund Osteuropa unter der Krise sehr viel stärker gelitten als alle übrigen emerging markets weltweit*. Zwar ist seit Ende des Jahres 2010 eine wirtschaftliche Erholung zu beobachten, maßgeblich vorangetrieben von der hohen Nachfrage aus Deutschland. Diese fällt allerdings langsamer aus als erwartet. Viele Ökonomen befürchten, dass der enorme Kapitalfluss der vergangenen Jahre in die Region auf Dauer versiegen wird – und damit der bisherige Wachstumsmotor schlechthin wegfällt. Wollen die Länder Mittel- und Osteuropas verhindern, dass sie mittelfristig in die ökonomische Peripherie abdriften, müssen sie grundsätzlich über ein neues Wachstumsmodell nachdenken: Der Weg in Richtung einer wissensintensiven Ökonomie erfordert vor allem, die Innovationsfähigkeit ihrer Volkswirtschaften zu stärken. Zum einen geht es um mehr Investitionen in Humankapital. Dringend notwendig sind zum Beispiel eine bessere finanzielle Ausstattung der Universitäten sowie die Verbesserung der Lehrqualität. Noch immer tauchen mittel- und osteuropäische Universitäten in internationalen Universitätsrankings kaum auf. Obwohl die Zahl der Studierenden seit dem Systemumbruch exorbitant zugenommen hat, werden Fachbereiche wie Ingenieurs- und Naturwissenschaften zu wenig nachgefragt. Gut ausgebildete Absolventen, die für innovative Unternehmen interessant wären, sind in dieser Region daher Mangelware. 2/4 Das Progressive Zentrum Wir denken weiter. http://www.progressives-zentrum.org Zum anderen müssen auch die Unternehmen der Region mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Zwar produzieren sie als Zulieferer zunehmend auch für mittel- und hochtechnologische Industriezweige. Die Entwicklungs- und Forschungsabteilungen dieser Unternehmen sind aber überwiegend in Westeuropa angesiedelt. Ein positives Gegenbeispiel ist der tschechische Automobilhersteller Skoda, ein 100- prozentiges Tochterunternehmen der Volkswagen AG, das enorm viel in die eigene Entwicklung investiert hat. Insgesamt fehlt den meisten neuen Mitgliedsländern eine eigene wirtschaftspolitische Strategie zur Stärkung ihrer Innovationsfähigkeit. Sie verfahren auf diesem Gebiet noch zu sehr nach dem Prinzip copy and paste: Statt sich bei der Entwicklung innovativer Wirtschaftszweige an den jeweiligen nationalen Rahmenbedingungen und Stärken zu orientieren, übertragen sie europäische Innovationsstrategien eins zu eins auf ihre nationalen Innovationsprogramme. In den Ländern Mittel- und Osteuropas mangelt es aber nicht nur an strategischen Kenntnissen, sondern auch an strukturellen Voraussetzungen: Erstens erweisen sich die öffentlichen Institutionen in den neuen Mitgliedsländern häufig als dysfunktional und damit unfähig, ein innovationsfreundliches Klima zu schaffen. Zweitens fehlt aufgrund millionenfacher Abwanderung der eigenen Talente qualifiziertes Personal. Und drittens wird das vorhandene ausländische Kapital zu selten dazu eingesetzt, um Innovationen nachhaltig zu fördern. Zumindest hat sich die simple Vorstellung in der Praxis nicht bewahrheitet, möglichst hohe Foreign Direct Investments würden automatisch mehr Know-how, mehr Wissenstransfer sowie Innovationen generieren. Diese Herausforderungen sind gewaltig. Ein neues Wachstumsmodell, das auf eine wissensintensive Wirtschaft zielt, ist vor allem auch auf einen handlungsfähigen und effektiven Staat zwingend angewiesen. Nur der Staat kann Kooperationen und Netzwerke aus Forschungsinstitutionen, Universitäten, Think Tanks und innovativen Unternehmen intensiv ausbauen. Nur er kann Anreize schaffen für Arbeitsmigranten, in ihre Heimat zurückzukehren, etwa indem er die Neugründung von kleineren und mittleren Unternehmen fördert (auf diese Weise ließe sich der brain drain der vergangenen Jahre sogar nutzen). Nur der Staat kann strategisch darauf hinwirken, besonders zukunftsträchtige FDIs ins Land zu holen. Doch ein solcher aktiver, funktionsfähiger, strategisch vorausschauender und – in diesem Sinne – „planender“ Staat existiert in keinem der neuen Mitgliedsländer. Die Vorstellung davon löst in den postkommunistischen Gesellschaften eher Unbehagen aus. An dieser Stelle zeigt sich, dass die Ausgangsbedingungen zur Verwirklichung einer wissensintensiven Wirtschaft von alten und neuen Mitgliedsländern sehr unterschiedlich sind. Nicht nur was die jeweiligen Entwicklungsstufen, sondern auch was das Bildungssystem, die industrielle Basis, die wirtschaftspolitische Strategiefähigkeit oder eben die Qualität von Staatlichkeit betrifft. Es ist zu befürchten, dass die mittel- und osteuropäischen Länder an den konkreten Zielvorgaben von Europa 2020 erneut scheitern werden. Denn ähnlich wie ihre Vorgängerin, die Lissabon-Strategie, orientiert sich auch diese Strategie zu starr an dem Prinzip one size fi ts all. Andererseits stehen neue und alte Mitgliedsländer vor vielen durchaus vergleichbaren ökonomischen und sozialen Herausforderungen, wie das Progressive Zentrum in seiner Studie 3/4 Das Progressive Zentrum Wir denken weiter. http://www.progressives-zentrum.org „Die Zukunft des Europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells“aus dem Jahr 2008 herausgearbeitet hat. So gesehen kann die Europa-2020-Strategie eine wichtige Funktion als Leitbild ausfüllen, als Orientierungspunkt in einer gesamteuropäischen Debatte über mögliche Lösungsstrategien und Reformkonzepte – solange die Unterschiede zwischen den westlichen und östlichen Wachstumsmodellen hinreichend mit bedacht werden. 4/4 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)