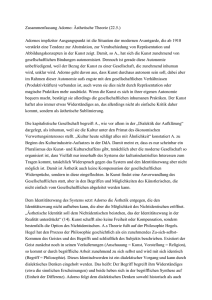Widerspruch - Münchner Zeitschrift für Philosophie
Werbung

MÜNCHNER ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE Anstoß Adorno Stellungnahmen zu Theodor W. Adorno Hauke Brunkhorst, Gerhard Schweppenhäuser, Alfons Söllner, Christoph Türcke Roger Behrens Antisystem. Drei Stichpunkte zur kritischen Theorie der Gesellschaft Michaela Homolka Nach Adorno. Zum Aspekt des Räumlichen Alexander von Pechmann Zwischen kritischer Moderne und Kritik der Moderne Wolfgang Langer Im Inneren des Empire: Staat und Gesellschaft bei Hegel und Hardt/Negri EUR Eberhard Simons Die „Neue Oikonomia“. Ein Gespräch 6.-- Widerspruch 41 Anstoß Adorno WIDER SPRUCH Heft 41 Widerspruch Anstoß Adorno Nur am Widerspruch des Seienden zu dem, was zu sein es behauptet, läßt Wesen sich erkennen. Negative Dialektik, S. 169 Zum Thema Anstoß Adorno Umfrage Vier Fragen zu Theodor W. Adorno 11 Hauke Brunkhorst Ästhetik als Gesellschaftskritik 12 Gerhard Schweppenhäuser Vom Zwang, den wir uns selbst antun 17 Alfons Söllner „Mut zur Urteilskraft“ 21 Christoph Türcke „... gründlicher als von Adorno selbst befürchtet“ 23 Roger Behrens Antisystem. Drei Stichpunkte zur kritischen Theorie der Gesellschaft 27 Michaela Homolka Nach Adorno. Zum Aspekt des Räumlichen 39 Artikel 9 Alexander von Pechmann Zwischen kritischer Moderne und Kritik der Moderne. Zur Internationalen Adorno-Konferenz 2003 in Frankfurt/Main 49 Bücher zum Thema Percy Turtur Notizen zur Internationalen Adorno-Konferenz 57 Theodor W. Adorno: Dialektik und Ontologie Vorlesungen über Negative Dialektik Roger Behrens 61 Theodor W. Adorno / Thomas Mann Briefwechsel 1943-1955 Ignaz Knips 63 Bücher zum Thema Dirk Auer, Lars Rensmann und Julia Schulze Wessel (Hg.) Arendt und Adorno Marianne Rosenfelder 66 Roger Behrens: Kritische Theorie Maria Markantonatou 68 Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt Jadwiga Adamiak 70 Alex Demirovic (Hg): Modelle kritischer Gesellschaftstheorie Percy Turtur 71 Lars Rensmann Kritische Theorie über den Antisemitismus Georg Koch 73 Heinz Steinert: Die Entdeckung der Kulturindustrie; Adorno in Wien; Kulturindustrie Olaf Sanders 76 Udo Tietz: Ontologie und Dialektik Alexander von Pechmann 78 Wolfgang Langer Im Inneren des Empire: Staat und Gesellschaft bei Hegel und Hardt/Negri 81 Münchner Philosophie Eberhard Simons Die „Neue Oikonomia“. Ein Gespräch 97 Neuerscheinungen Armin Adam, Franz Kohut, Peter K. Merk, Hans-Martin Schönherr-Mann (Hrsg.) Perspektiven der Politischen Ökologie Wolfgang Melchior 111 Norbert Bolz: Das konsumistische Manifest Franco Zotta 113 Sonderthema Neuerscheinungen Anhang Erhard Eppler: Vom Gewaltmonopol zum Gewaltmarkt? Bernd M. Malunat 115 Angelika Krebs: Arbeit und Liebe Manuel Knoll 118 Albert Kümmel / Petra Löffler (Hg) Medientheorie 1888-1933 Thomas Wimmer 120 Ludger Lütkehaus: Schwarze Ontologie Konrad Paul Liessmann: Günther Anders Lothar Butzke 123 Manfred Niehaus: In und nach Cages 4’ 33’’ Konrad Lotter 126 Werner Rügemer: arm und reich Reinhard Jellen 127 Kersten Schüßler: Helmuth Plessner Karsten Bammel 130 Ulrich Sieg: Jüdische Intellektuelle im 1. Weltkrieg Marianne Rosenfelder 133 Bernhard Waldenfels: Spiegel, Spur und Blick Konrad Lotter 135 Immanuel Wallerstein: Utopistik Bernd M. Malunat 137 Jutta Weber: Umkämpfte Bedeutungen Volker Schürmann 138 Kurt Wuchterl Handbuch der analytischen Philosophie Wolfgang Melchior 143 AutorInnen Impressum 146 147 Anzeige WIDERSPRUCH Münchner Zeitschrift für Philosophie Nr.38 Ökologische Ästhetik Konrad Lotter: Traditionelle und ökologische Naturästhetik Jost Hermand: Ökologiebewußte Ästhetik Norbert Walz: Die Erlösung der Natur Wolfgang Thorwart: Der moderne Künstler Manuel Knoll: Zu Michel Foucaults Genealogie des modernen Subjekts Wolfgang Habermeyer: Für einen Lehrer ... und viele Rezensionen philosophischer Neuerscheinungen erhältlich in allen uni-nahen Buchhandlungen Preis: 6.- EUR Thema Anstoß Adorno Wie gehen wir heute mit Theodor W. Adorno um? Die Kongresse, Konferenzen und Tagungen, die zum Anlass seines 100. Geburtstags stattgefunden haben, ließen augenscheinlich die berühmten zwei Fraktionen im „Revisionismusstreit“ wieder auferstehen: Die Fraktion derer, für die Adorno sich erledigt hat. Sie finden sich heute in einem Diskurs wieder, der – sprachphilosophisch und dekonstruktivistisch aufgeklärt – nicht mehr von einem „Ganzen“ sprechen möchte, sondern weiß, dass er sich je schon in ihm bewegt. Freilich schließe diese Kluft nicht aus, sich des Theoriepotentials, das Adorno hinterlassen hat, zu vergewissern, es auf seine „anschlussfähigen“ Elemente und nutzbringenden Einsichten abzuklopfen und auch fündig zu werden. Für die anderen – und nicht nur seine treuesten Schüler – ist die Kritische Theorie als „unerledigte Aufgabe“ offen geblieben. Sie artikulieren mit Adorno das Unbehagen an jenem Diskurs und erkennen, verschieden gewichtet, in der Begrifflichkeit, die Adornos Werk zur Verfügung stellt, die Ansätze zu einer tragfähigen Kritik und Analyse der Gegenwart als Ganzer. – Beide „Adorno-Fraktionen“ tragen, so scheint es, in neuen Gewändern das alte Problem zwischen Realos und Fundis über das aus, „was not tut“: kritische Moderne contra Kritik der Moderne. 10 Zum Thema Einen erhellenden Überblick und konkrete Einblicke in die geistige Situation im „Adorno-Jahr“ gibt die interdisziplinäre Umfrage des Widerspruch zur „Aktualität Adornos“, zu der der Soziologe Hauke Brunkhorst, der politische Theoretiker Alfons Söllner sowie die beiden Philosophen Gerhard Schweppenhäuser und Christoph Türcke beigetragen haben. In seinem Artikel „Antisystem. Drei Stichpunkte zur kritischen Theorie der Gesellschaft“ hebt Roger Behrens auf die Einheit im kritischen Denken Adornos ab. Er will zeigen, was an theoretischer Kraft verloren ginge, würde das Ganze des Werks aufgelöst, und würden Philosophie und Ästhetik, Ökonomie und Soziologie als getrennte Teile behandelt. Michaela Homolka konstatiert einen ästhetischen Wandel vom Zeit- und Raumdenken. Sie geht in ihrem Beitrag „Nach Adorno“ dem bislang weitgehend unbeachtet gebliebenen Räumlichen im Denken Adornos nach, das für eine zeitgemäße Rezeption erst noch fruchtbar zu machen wäre. Über die „Internationale Theodor W. Adorno-Konferenz“, die vom Institut für Sozialforschung vom 25. bis 27.9.2003 in Frankfurt ausgerichtet wurde, berichten aus unterschiedlicher Perspektive und Fragestellung Alexander von Pechmann und Percy Turtur. Ihnen schließt sich der Rezensionsteil von Büchern zum Thema an. Das Sonderthema dieses Heftes knüpft an die Thematik „Globalisierung“ der vorangegangenen Nummern an. In seinem Artikel „Im Inneren des Empire“ stellt Wolfgang Langer die Evidenz der These vom „Verlust des Politischen“ in Frage. Er will anhand der Rechts- und Staatsphilosophie Hegels zeigen, dass deren Kategorien weiterhin ihre Relevanz besitzen. In unserer Reihe „Münchner Philosophie“ stellt Eberhard Simons im Gespräch seinen intellektuellen Werdegang sowie die Kernelemente seines philosophischen Konzepts einer „Neuen Ökonomia“ vor und nennt verschiedene theoretische wie praktische Perspektiven, die sich mit diesem Gesamtkonzept eröffnen. Rezensionen aktueller Neuerscheinungen beschließen das Heft. Die Redaktion Umfrage zu Theodor W. Adorno 1. Zu seinem 100. Geburtstag ist Adorno wiederentdeckt worden. Es fanden weltweit Adorno-Kongresse statt, Buch- und Zeitschriftenveröffentlichungen zu Adorno hatten Hochkonjunktur. Die Stadt Frankfurt erinnerte sich ihres einst „verlorenen Sohnes“. Dient dieses Interesse an Adorno Ihrer Meinung nach in erster Linie der Erinnerung an einen der großen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts, oder enthält sein Werk ein begriffliches Instrumentarium und theoretische Potentiale, die auch unter den veränderten Diskurs-Bedingungen dieses Jahrhunderts fruchtbar gemacht werden können oder müssen? Und wenn ja, worin bestehen sie? 2. In ihrem geschichtsphilosophischen Hauptwerk konstatieren Adorno und Horkheimer eine Dialektik der Aufklärung, wonach der Fortschritt der Vernunft in Mythos, die Emanzipation des Menschen von der Natur in totalitäre Herrschaft über die Natur umschlage. Sehen Sie in der Beschreibung solcher Dialektik den zeitbedingten Versuch, die faschistische Barbarei in ihren Wurzeln, Ursachen und Gründen zu begreifen, oder ist sie auch heute noch ein Modell, das gegenwärtige Prozesse adäquat beschreiben kann? 3. Es scheint, als lasse sich der Philosoph Adorno nur als Denker der radikalen Negation begreifen. Diese geht so weit, dass in der von ihm diagnostizierten „Krise der Praxis“ jede politische Praxis nur regressiv sein kann. Lassen sich demgegenüber in Adornos Werk auch Ansätze zu einer positiven Praxis finden? 4. Mit der Globalisierung haben neoliberale Modelle an Einfluss gewonnen, die weltweit zum Abbau sozialstaatlicher Garantien und demokratischsolidarischer Strukturen geführt haben. Kann der Sozialphilosoph Adorno in dem Streit um den Charakter der Globalisierung als Verfechter und ‚Ahnherr’ der Zivilgesellschaft in Anspruch genommen werden, oder verfällt solche Inanspruchnahme seinem Verdikt, dass es im Falschen kein wahres Leben gebe? 12 Umfrage Hauke Brunkhorst Ästhetik als Gesellschaftskritik ad 1: Ja, ich denke, es gibt schon einiges an innovativer Begrifflichkeit und Theoriepotential in Adornos Werk, was über seine Lebzeiten und die nachgeschobenen Feierlichkeiten hinausweist und standhält. Zunächst, und das werden Sie überall hören, ist es die Theorie des Ästhetischen, die noch nie zuvor in so dichter Nähe zur fortgeschrittensten Kunstproduktion entwickelt worden ist und sich ganz auf der Höhe der ästhetischen Reflexion seit Kants „Kritik der Urteilskraft“ und den Geniestreichen der Frühromantiker befindet. Adornos ästhetisches Werk kann man, wie Rüdiger Bubner einmal treffend bemerkte, als die philosophische Ästhetik des 20. Jahrhunderts bezeichnen. Sie erschöpft sich aber weder in Philosophie noch in reiner Ästhetik, sondern enthält überdies, da sie die Kunst nicht nur immanent als autonome, sondern mit Durkheim als fait sociale versteht, einen wesentlichen Beitrag zur Theorie der modernen Gesellschaft. Das sieht man schon an der – inzwischen (etwa von den Wellmer-Schülern Menke und Seel) auch wahrgenommenen – verblüffenden Nähe von Adornos „Ästhetischer Theorie“ zur „Kunst der Gesellschaft“ Luhmanns, die dieser selbst noch geahnt, dann aber, in falschem Abgrenzungsbedürfnis, verdrängt hat. Schon als Ästhetik ist Adornos Werk Gesellschaftstheorie und als solche von der Gegenwartssoziologie nach wie vor viel zu wenig beachtet. Der Versuch mancher Feuilletonredakteure, Adorno als gesellschaftsfernen, soziologisch irrelevanten und zutiefst konservativen Ästhetiker des Bürgertums darzustellen und für die Nostalgieecke der neoliberalen Betriebswirtschaft zu vereinnahmen, ist ebenso reaktionär wie absurd. Auch wenn man Adornos negativistischen Utopismus nicht mehr teilt, erschließt sich die Bedeutung seiner Ästhetik überhaupt erst als Gesellschaftstheorie. Das gerade zeigt der Vergleich mit Luhmann, auf den ich bei Ihrer letzten Frage zurückkommen möchte. Wie sehr Adorno über den engeren Horizont der Frankfurter Schule hinausgreift, erkennt man auch an der gleichzeitigen Nähe und Ferne zum postmodernen Dekonstruktionismus, besonders zu Derrida. Wie dieser zu Theodor W. Adorno 13 treibt Adorno mit der Begrifflichkeit und den Metaphern der klassischen Philosophie, die für ihn immer wieder in Hegel kulminiert, ein hintersinniges Spiel. Die negative Dialektik, die auf eindrucksvolle Weise das ganze Spektrum philosophischen Denkens zwischen Theorie, Geschichte und Praxis über den Gegenbegriff des Nichtidentischen aufrollt, ist zugleich (in ihrer Gesellschaftstheorie) kritisch, (in ihrer Geschichtsphilosophie) negativistisch und (in ihrer Methode) dekonstruktiv. Bei dieser Trias ist die Geschichtsphilosophie, worauf Herbert Schnädelbach jüngst noch einmal hingewiesen hat, sicher das schwächste Glied. Aber da Adorno methodisch schon ganz so wie Derrida verfährt, gelingt es ihm, die Metaphysik nicht nur ideologiekritisch zu entlarven, sondern von innen her zu demolieren. Anders als Derrida und die Postmodernisten hält er jedoch am „Projekt der Moderne“ (Habermas) fest; und dabei kann er sich auf den ungeheuren Reichtum und das argumentative Potential seiner ästhetischen Theorie stützen. Adornos Theorie des Nichtidentischen müsste heute als Versuch neu gelesen werden, die disjecta membra von Dekonstruktion und kommunikativer Vernunft wieder zusammenzufügen.1 ad 2: Nur bedingt ist die Dialektik der Aufklärung ein heute adäquates Modell. Natürlich ist sie nicht nur, wie Richard Rorty sofort gesehen hat, in ihrem ersten Kapitel eine grandiose Beschreibung des selbstkritischen Geistes der Aufklärung, die sich zu sich selbst rückhaltlos revolutionär verhält und „alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen ... auflöst, alle neugebildeten veralten (läßt), ehe sie verknöchern können.“2 Es wird oft übersehen, dass Adorno an der marxistischen These vom emanzipatorischen Potential der Produktivkräfte und der Technik immer festgehalten hat: „Wider den Willen ihrer Lenker hat die Technik die Menschen aus Kindern zu Personen gemacht.“3 Aber selbst wenn Adorno immer wieder betont, dass es ihm um die Fortsetzung, gar Radikalisierung des Selbstüberbietungsprojekts der Aufklärung geht, so kann man doch nicht übersehen, dass die ebenso radikale wie einseitige Kritik an der instrumentellen Vernunft Züge einer „totalisierenden Vernunftkritik“ (K.O. Apel) annimmt, die sich ihrer eigenen 1 Vgl. dazu vor allem: A. Wellmer, Endspiele: Die unversöhnliche Moderne (Frankfurt/Main 1993) und Chr. Menke, Die Souveränität der Kunst (Frankfurt/Main 2000). 2 K. Marx/F. Engels, Kommunistisches Manifest, Abschnitt I. 3 M. Horkheimer/Th.W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt 1997, 178. 14 Umfrage Prämissen nicht mehr vergewissern kann. Deshalb kommt sie auch kaum über die schon von Max Weber höchst aporetisch, aber doch viel differenzierter analysierte Dialektik der Rationalisierung hinaus. Trotzdem war ich – wenn mir eine persönliche Bemerkung erlaubt ist erstaunt, als ich dieses Jahr aus Anlass eines Aufsatzes das Kapitel über die Kulturindustrie, das mir als das schwächste in Erinnerung war, noch einmal lesen musste, um festzustellen, wie neu der Text plötzlich wieder war, wie wenig abgestanden selbst in den immer wieder überraschenden Details, wie komplex und vielfältig in seiner begrifflichen und argumentativen Gestalt. Adorno gelingt es, eine ganze Theorie des Faschismus in einen Satz zu packen: Im Faschismus „wird das Radio zum universalen Maul des Führers.“4 So einseitig und unhaltbar viele Urteile (wie die über den Jazz) heute erscheinen mögen, dadurch, dass man Adornos Kulturkritik noch wie neu lesen kann, zeigt sich seine Differenz zur Dutzendware eines Jahrhunderts konservativen Verfallslamentos. Aber warum? Weil auch die Theorie der Kulturindustrie nicht nur zwei klare und immer noch gültige Kriterien der Kritik entwickelt, das Kriterium der Manipulation und das der Entdifferenzierung, die sie nur manchmal falsch und oft viel zu pauschal anwendet, sondern vor allem, weil Adorno die Kulturindustrie als Kunst der Gesellschaft so ernst nimmt, dass er an einer Stelle fast verblüfft und mit kaum verhohlener Bewunderung feststellen muss, dass manche Revuefilme das technisch ausdifferenzierte Niveau von Werken der Avantgarde erreicht hätten. Diesen Blick für die Sache lässt Adorno sich auch von der eigenen Geschichtsphilosophie nie verstellen, und das macht seine Größe aus. ad 3: Ja, es lassen sich Ansätze zu einer positiven Praxis finden; aber das ist immer ein mühsames Geschäft interpretativer Nachhilfe. Positive Praxis – die er so natürlich nie genannt hätte – gibt es bei Adorno eigentlich nur in der Kunst. Das ist ersichtlich zuwenig, und es unterbietet das Niveau der geschichtlichen Möglichkeiten, die zumindest demokratische Verfassungsregime dem marxistischen Projekt weltverändernder Praxis heute bieten. In der „Dialektik der Aufklärung“ werden alle Unterschiede zwischen der westlichen Demokratie und dem Faschismus verwischt. Deshalb fehlt bei Adorno leider jeder Ansatz zu dem, was der junge Habermas in den späten 60er Jahren radikalen Reformismus genannt hat. Das schwächt die kritische, unter4 ebd., 182. zu Theodor W. Adorno 15 scheidende Kraft der Theorie. Denn es macht, um – da hier ja von Praxis die Rede ist – gleich ein ganz aktuelles Beispiel zu nehmen, einen Unterschied fast schon ums Adorno’sche Ganze, ob – wie es jetzt bei der Suche nach einem Steuerkompromiss zwischen Bund und Ländern im geheimen Vermittlungsausschuss geschieht – Gesetze, die nicht der Zustimmung der Länderkammer bedürfen und die das Parlament bereits verabschiedet hat, von der großen Koalition aus Regierung und Opposition der Verhandlungsmasse im Vermittlungsausschuss zum Verhökern zugeschlagen werden, oder ob das nicht geschieht und die Weisung, die das Volk dem Parlament gegeben hat, ausgeführt und beschlossene Parlamentsgesetze umgesetzt und nicht nachverhandelt werden.5 Wenn die Degradierung des Parlaments zur Schülermitverwaltung die Regel wird, und wir sind auf dem besten Weg dazu, dann ist mit der Demokratie Schluss, und das Ganze, das dann übrig bliebe, wäre wirklich das Unwahre. Das eigentlich Beklemmende und im Adorno’schen Sinn fast schon vollendet Negative dieses Vorgangs ist, dass ein so massiver Verfassungsbruch, wie ihn Schröder und die anderen Parteichefs gerade begangen haben, völlig unbemerkt an der Sabine-Christiansen-Welt unserer vermachteten Öffentlichkeit (und jenseits jeder Organklage, die sonst nicht schnell genug aus der Tasche gezogen werden kann) vorbeirauscht. Aufklärung als Massenbetrug. Aber nicht im Allgemeinen, sondern an den konkreten, institutionell präzise bestimmbaren Fällen muss das demonstriert werden. Hier ließen sich die Adorno’schen Kategorien der Kulturindustrie scharf machen, ohne die Unterscheidung von Verfassungsbruch und Verfassungstreue, von Demokratie und Totalitarismus im Grau in Grau eines immer schon unwahren Ganzen zerfließen zu lassen. Konkret, als gegen Hegel gerichtete, ideologiekritische Polemik oder als sachbezogener, wohlbestimmter Grenzfall, aber nicht als totalisierende Behauptung über den Zustand der modernen Welt oder des Spätkapitalismus macht der berühmte Aphorismus der „Minima Moralia“ Sinn. ad 4: Nein, Adorno war kein Theoretiker der Zivilgesellschaft. Für deren wichtige, demokratische Funktion hatte er kein wirkliches Gespür. Ihm fehlte, anders als Hannah Arendt, der eigentliche Sinn fürs Politische. Die 5 siehe: Christoph Möllers, „Der lange Schatten der Fürstenkammer“, Frankfurter Rundschau, 19.11.03. 16 Umfrage öffentlichen Angelegenheiten waren ihm so fremd wie den Christen des Kirchenvaters Tertullian im alten Rom. Aber anders als Arendt fehlte ihm nicht der Sinn fürs Gesellschaftliche, und das ist eine der großen Stärken seines Denkens, die bei der Ausdünnung der kritischen Theorie zu einer Theorie der civil society verlorengegangen ist. Adorno hat noch die Systemfrage gestellt und die Gesellschaft als ein sich selbst reproduzierendes, soziales System verstanden. Das war bei ihm das Erbe des orthodoxen Marxismus. Darin war aber die richtige Einsicht enthalten, dass die soziale Realität immer auch etwas Objektives, den praktischen Intentionen sozialer Akteure Unverfügbares ist, das sich dann zu übermächtigen Herrschaftsverhältnissen verdinglicht. Diese Einsicht verbindet Adorno mit der Systemtheorie, deren affirmative Züge er aber dadurch überwindet, dass er die Frage nach der „Herrschaft des Systems“ nicht ausblendet. Freilich hatte Adorno den Systembegriff noch monistisch und nicht, wie Parsons und Luhmann, pluralistisch verstanden. Außer in der Kunst kennt Adorno eigentlich keine funktionale Differenzierung von Wertsphären oder Subsystemen. Dadurch hat er sich selbst die Möglichkeit verstellt, eine immanente Kritik der Gesellschaft, die er immer wieder postuliert, auch durchzuführen. Die – wie immer einseitig negative – Prominenz des Systembegriffs in Adornos Denken war jedoch richtig, und ich denke, sie wird heute auch von denen etwas voreilig zu den Akten gelegt, die Adornos kritische Motive nicht nur in der Ästhetik, sondern gerade auch in der Gesellschaftstheorie wiederaufnehmen wollen. Habermas hatte das Problem spätestens seit den 70er Jahren übrigens klar erkannt und gesehen, dass man den Marxismus nicht nur normativ (mit Kant und praktischen Diskursen) stark machen, sondern auch funktionalistisch als (explanative) Systemtheorie des Spätkapitalismus erneuern muss. Das geht aber nicht, wenn man, wie Adorno, die Fortschritte der Soziologie sozialer Systeme seit Parsons einfach ignoriert. Den Marxismus als gleichzeitig normative und erklärende Theorie der Gesellschaft an die aktuelle Theoriebildung in der praktischen Philosophie und in der Soziologie anzuschließen, das war dann die Grundidee hinter der Vernetzung von System und Lebenswelt in der „Theorie des kommunikativen Handelns“. Habermas selbst hat dieses Programm mit großer Konsequenz in seiner Rechtstheorie weiterverfolgt. Aber bei den Schülern ist der Zusammenhang, den Adorno in der Verbindung von kritischer Subjektivität und Systemzwang zu Theodor W. Adorno 17 und Habermas in der Verschränkung von System und Lebenswelt im Auge hatten, seit den 80er Jahren weitgehend verlorengegangen und in zwei Lager zerfallen: In eine handlungstheoretische Praxisphilosophie einerseits, die – und das ist ihre Stärke – immerhin noch Herrschaftsfragen thematisiert und vom Kapitalismus spricht, aber in Gefahr ist, institutionelle und systemische Probleme auf Entfremdungs- und Anerkennungsfragen zu reduzieren; und in einen diskursethischen Spätkantianismus, der immer wieder neue, immer gerechtere Gesellschaftsverträge und Diskurswelten konstruiert und jeden Kontakt zu Marx, Luhmann und der systemischen Realität der Gesellschaft verloren hat. Systemkritik im Sinne Adornos aber ist nur möglich, wenn man einen Begriff sozialer Systeme hat. Gerhard Schweppenhäuser Vom Zwang, den wir uns selbst antun ad 1: Die Kanonisierung Adornos, die im vergangenen Jahr von den Überbleibseln bürgerlicher Repräsentations- und Erinnerungskultur betrieben wurde, halte ich zunächst einmal für begrüßenswert. Offizielle Würdigungen, Tag für Tag Zeitungsartikel über Adorno – das kann zwar manchmal auf die Nerven gehen, weil Vieles schief zu Sach- und Wahrheitsgehalten steht, aber es war nützlich. Denn so entsteht doch die Möglichkeit, Distinktionsgewinne zu erzielen, wenn man vor interessierten Auditorien die eigene Adorno-Interpretation von dem Rummel abgrenzen kann! In der 18 Umfrage Struktur erinnert mich das ein bisschen an die „ostzonale“ Kanonisierung von Marx: Als kritischer Theoretiker konnte ich meine Marx-Lektüre immer gut von ihren autoritären Lesarten abheben. Nachdem der Kasernensozialismus zusammengebrochen war, interessierte sich erst einmal niemand mehr für Marx, hinter dem offenbar keine gesellschaftliche Macht mehr stand... Also dann doch lieber die Flut der Zeitungsartikel. Und da zeigt sich dann auch, dass es mit der Kanonisierung doch noch hapert. Im Spiegel vom 18. August 2003 z. B. wurde Adorno als ein geltungssüchtiger, opportunistischer Schwindler dargestellt, der klug daher redete, in Saus und Braus lebte (Omelett und Weinschorle zum Frühstück!), der sich an den Früchten anderer Leute Arbeit bereicherte, sexuell ausschweifend war und junge Frankfurterinnen auf offener Straße mit Blicken belästigte. Hinter solchen krankhaften Projektionen dürfte antisemitisches Ressentiment stecken. Kokainkonsum konnte in diesem Fall offenbar nicht nachgewiesen werden – aber: „Bordellbesuche sind belegt“, schreibt der Spiegel im Polizeijargon. ad 2: Die dialektische Theorie der inneren und äußeren Naturbeherrschung in der Dialektik der Aufklärung halte ich für ein überzeugendes Modell zur Beschreibung des gesellschaftlichen Naturverhältnisses und der Konstitution von Subjektivität in der Moderne. Nicht zuletzt die Selbstdestruktion des Subjektbegriffs durch die postmoderne Philosophie ist ja ein Beleg für die innere Widersprüchlichkeit des modernen Subjekt-Konzepts, die Adorno und Horkheimer mit Nietzsche und Freud diagnostiziert haben. Ihre Darstellung der Aporien des Prinzips der Selbsterhaltung, der das Selbst verloren geht, kann man sozialphilosophisch mit gegenwärtigen Erfahrungen verbinden. Und die Globalisierungsdebatte zeigt, wie eine selbstgemachte Gestalt weltmarktförmiger Vergesellschaftung den Schein eines Naturverhältnisses erhält – dabei kann man in jeder Zeitung nachlesen, dass nicht ökonomische Naturgesetze zum globalen Kapitalismus führen, sondern eine Reihe von politischen Entscheidungen. Natürlich sind die wiederum auch Ausdruck von Zwang, aber von einem Zwang, den wir uns selbst antun. Für meine eigene Arbeit waren die Überlegungen zur Moralphilosophie fruchtbar, wie sie Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung angestellt hat und Adorno in seinen Schriften und Vorlesungen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Für Kant war moralisches Handeln freie Selbstbe- zu Theodor W. Adorno 19 stimmung, und Nietzsche hat gezeigt, dass jede Moral im Wesentlichen ein langer Zwang ist. Beide hatten Recht, aber in unterschiedlicher Hinsicht! Gerade weil sich die Aussagen widersprechen, beschreiben sie jeweils die gegensätzlichen Bestimmungen, die in der Sache selbst liegen. Die normativ-kritische Kraft des Diskurses der Moralphilosophie kann sich nur dann entfalten, wenn seine Widersprüche nicht mehr ausgeblendet werden: der Antagonismus zwischen individuellem Freiheits- und Glücksanspruch und gesellschaftlichem Zwang, zwischen Autonomie und Fremdbestimmung, zwischen befreiender Kraft der Moral und ihrer sozialen Stabilisierungsfunktion. Ich versuche vor diesem Hintergrund, eine kritische Theorie des moralphilosophischen Universalismus zu entwickeln, die uns helfen könnte, mit seiner Antinomie besser umzugehen. Wenn z.B. in universalistisch begründeten Interventionen gegen Menschenrechtsverletzungen auch partikulare Interessen stecken, dürfen wir das nicht ausblenden; aber die Reflexion auf ihre Genesis entbindet uns nicht von den Geltungsansprüchen, die sie mit guten Gründen erheben können. Allenfalls eine Moralbegründung kann da weiterhelfen, die normativ und universalistisch ist, aber auch den Einsprüchen der Kritik am Universalismus gerecht wird, die also Moral als wechselseitige Anerkennung fasst, die wir uns als je besondere Subjekte schulden, und sie von Moral als Zwangs- und Herrschaftsideologie unterscheidet. ad 3: In seinen posthum veröffentlichten Vorlesungen zur Moralphilosophie hat Adorno über Möglichkeiten nachgedacht, ein „stellvertretendes Leben“ zu führen, das heißt, so zu leben, wie wir es tun sollten und könnten, wenn wir schon wären, was wir doch noch nicht sind: mündige, selbstbestimmte Subjekte. In Verbindung mit der Reflexion moralischer Antinomien und gesellschaftlicher Selbst-Blockaden sollte dies die unverzichtbare Voraussetzung für das Nachdenken über politisches Handeln sein. Adornos Rede vom „Verblendungszusammenhang“ und von der Totalität des falschen Lebens muss man nicht als lähmend verstehen. Ich finde, solche Makro-Überlegungen machen uns als Handelnde, die ja nie ganz an die Ziele unseres Handelns heranreichen, nur frustrationsresistenter. Die Systemtheorie hat das handelnde Subjekt aus ihrem deskriptiven Instrumentarium verabschiedet. Adorno sprach zwar schon in den 40er Jahren davon, dass sich „das Subjekt“ im Prozess der Zersetzung, des Zerfalls befände, aber er versuchte, dagegen anzugehen. Heute sollten wir die Optik der 20 Umfrage Systemtheorie sehr ernst nehmen, weil sie selbstregulierende soziale und ökonomische Abläufe klarer erkennen lässt als heroische oder tragische Theorien sozialen Handelns. Aber ihre Hermetik ist falsch, weil sie auf der einen Seite die Akteure ausblendet, die die autopoietischen Abläufe anschieben und mitbestimmen, und auf der anderen Seite Differenzbestimmungen nur noch als rein immanente erfassen kann. Das ist real und Schein zugleich. Luhmann hat Gesellschaft als System analog zu biologischen Systemen konstruiert; Adorno hat ein negatives handlungstheoretisches Erklärungsmodell zugrunde gelegt. Subjektivität, die gesellschaftlich autonom werden kann, ist demzufolge vorerst verschwunden, und statt dessen dominiert die tauschwertförmige Vergesellschaftung der Individuen als sozialer Gesamt-Akteur. Diese Analyse trifft es vielleicht besser. ad 4: Als „Verfechter und ‚Ahnherr‘ der Zivilgesellschaft“ würde ich Adorno aus methodischen Gründen nicht bezeichnen, denn die Zivilgesellschaft ist ja einerseits ein soziales Phänomen und andererseits eine begriffliche Konstruktion, die Antonio Gramsci zur Beschreibung dieses Phänomens eingeführt hat. Aber eine Verbindung lässt sich hier durchaus herstellen. Alex Demirovic hat in seiner Studie Der nonkonformistische Intellektuelle gezeigt, dass sich die wissenschaftspolitische Praxis des Frankfurter Instituts sehr gut mithilfe von Gramscis Begriff der „Zivilgesellschaft“ beschreiben lässt. Wenn man, wie Gramsci es tat, unter Zivilgesellschaft all jene öffentlichen Diskursräume der Publizistik und der wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen versteht, in denen eine soziale Gruppe ihre gesellschaftliche Vorherrschaft etabliert, dann kann man durchaus sagen, dass sich Adorno als Akteur in diesem Bereich verstanden hat, der in den beständigen Kampf um kulturelle und soziale Hegemonie die Reflexionsebene der Kritischen Theorie einziehen wollte. Vorherrschaft also nicht um ihrer selbst und ihrer Privilegien willen, sondern um der nicht eingehaltenen sozialen Versprechen willen, sozusagen auf Grund der uneingelösten Schecks, die die bürgerliche Kultur immerfort ausgestellt hat. Kritische, autonome Intellektuelle, die den Diskurs der bürgerlichen Gesellschaft mitbestimmen, ihn zu einem Begriff der eigenen Widersprüche führen, und damit zumindest die Chance zur Selbstaufklärung und verändernden Praxis bewahren – das war das leitende Konzept intellektueller Praxis, dem sich Adorno verpflichtet fühlte. zu Theodor W. Adorno Alfons Söllner 21 „Mut zur Urteilskraft“ Gerne beantworte ich die Fragen des Widerspruch, muss aber darauf hinweisen, dass in einer so knappen Stellungnahme natürlich eine Menge von Fußangeln (auch für den Autor) versteckt ist: ad 1: Adorno musste kaum wiederentdeckt werden, denn es gibt seit seinem Tod eine breite und kontinuierliche Rezeption. Für mich besteht die offensichtlichste Herausforderung, die heute in seinem Werk steckt, in der geradezu unglaublichen Souveränität, mit der er sich über die konventionellen Grenzen der Fächer und kulturellen Diskurse hinweggesetzt hat und in seiner Person vorlebte, was heute etwas hilflos „Interdisziplinarität“ heißt. Sie macht Mut zur Urteilskraft über den akademischen Gartenzaun hinaus, ohne sich in einer trügerischen „Ganzheitlichkeit“ zu verlieren. Zum Zweck der differenzierenden Multiplikation erfand Adorno so etwas wie eine eigene Schreib- und Sprechweise: die „kleine Form“ (Notizen, Fragmente, Essays), die noch seinen „großen“ Werken wie der Negativen Dialektik und der Ästhetische Theorie zugrunde liegt. ad 2: Die Dialektik der Aufklärung ist für mich nicht so sehr ein historischer Erklärungsversuch des Faschismus, sondern das wuchtigste philosophische Dokument, das von der Ahnung des (zeitgleichen) Holocaust diktiert ist und das Entsetzen darüber auf die Universalgeschichte projiziert. Daher die atemberaubende Dynamik der Argumentation, daher auch die verzweifelte Abstraktionslage. Daraus ein „Modell“ abzuleiten, das auf gegenwärtige Entwicklungen – und seien es die schlimmsten – „anzuwenden“ wäre, käme einer Verharmlosung sowohl der damaligen Erfahrungen als auch der gegenwärtigen Bedrohungen gleich; denn die letzteren sind ja gerade deswegen so „unheimlich“, weil sie geschichtsphilosophisch nicht deduzierbar 22 Umfrage sind. Die grundbegrifflichen Gleichungen der „Dialektik der Aufklärung“ sind keine Erklärungen, sondern Warnungen – vor der Geschichtsphilosophie selber, aber auch vor einem globalen Kapitalismus! ad 3: Das Erfolgsgeheimnis Adornos bestand darin, dass noch seine radikalste Negation, die immer eine theoretische war, einen positiven Impuls sowohl voraussetzte als auch freisetzen wollte. So diente die „Philosophie der neuen Musik“ deren Wiedereinführung in Deutschland, die „Aufarbeitung der Vergangenheit“ dem Andenken an die Ermordeten und die Kritik der idealistischen Tradition der Freilegung des „Nichtidentischen“. Eine andere Frage ist, wie gut sich seine esoterischen Präferenzen in der Kunst bzw. die hegelianisierende Sprache in der Philosophie dafür eigneten. Dennoch ist weder die Aufbruchstimmung der Studentenbewegung ohne die muntere Allpräsenz des „negativen Dialektikers“ im Feuilleton der 50er Jahre denkbar, noch lässt sich der Anteil der Universitäten an der Veränderung der politischen Kultur in der späteren Bundesrepublik ohne „fröhliche Wissenschaft“ vorstellen. ad 4: Die „Zivilgesellschaft“ ist heute eine ebenso wohlfeile Universalwaffe der Kritik wie die „Globalisierung“ einen nur scheinbar probaten Erklärungsschlüssel für Tendenzen abgibt, die einigermaßen widersprüchlich und vieldeutig sind. Man dürfte Adornos methodologischem Credo, der Hingabe an das „Material“, am ehesten folgen, wenn man zugibt, dass er sich selber oft, und zwar nicht zuletzt in soziologischen Texten, eine ziemliche „Materialferne“ geleistet hat. Die wirkliche „Aktualität“ Adornos heute liegt für mich nicht auf dem Gebiet der Ökonomie, Soziologie und Politik, auch nicht auf deren gesellschaftstheoretischer Synthese, sondern in der Ästhetik, zumal der Musikphilosophie und der Kulturtheorie ganz allgemein. Hier war er zu den feinsten Unterscheidungen in der Lage, die in Kunst und Kultur oft einen Unterschied ums Ganze und nicht zuletzt ihre politische Wirkung ausmachen. zu Theodor W. Adorno Christoph Türcke 23 „... gründlicher als von Adorno selbst befürchtet“ ad 1: Der Hauptzug der Feierlichkeiten zu Adornos 100. Geburtstag geht gewiss dahin, ein Genie zu musealisieren. Aber es gibt auch Gegentendenzen, sowohl bei den Gedenkfeiern selbst als auch in den jubiläumsgerecht erschienenen Biografien. Überall, wo kritische Theorie als unerledigte Aufgabe begriffen und gefragt wird, wie sie weitergehen könnte, wird mit der Aktualität Adornos Ernst gemacht. Und sie liegt ja auf der Hand. Man nehme zum Beispiel die Theorie der Kulturindustrie. Wie töricht ist die Behauptung, sie hätte sich erledigt. Die Kulturindustrie hat auf der ganzen Linie gesiegt, in mancher Hinsicht gründlicher als von Horkheimer und Adorno selbst befürchtet. So gibt es nicht mehr – vielleicht gab es sie nie wirklich – jene kritischen Inseln, von denen Horkheimer und Adorno eine innezuhaben hofften, und wo, in strikter Verweigerung aller kulturindustrieller Klischees, sich wenigstens die Fähigkeit zur kompromisslosen geistigen Durchdringung des kulturindustriellen Vormarschs erhalten sollte, wenn er schon nicht praktisch aufzuhalten war. Im Bündnis fühlten sie sich dabei weniger mit kommunistischen Parteien oder Gewerkschaften als mit jener avancierten Kunst, die radikal mit den herkömmlichen tonalen, figürlichen oder dramaturgischen Schemata gebrochen hatte, unversöhnlich mit der Kulturindustrie schien und ebenfalls wie eine kritische Inselgruppe anmutete. Solche Inseln sind längst weggespült, auch die kritischsten geistigen und ästhetischen Intentionen sind durchdrungen von kulturindustriellen Standards. In dem Maße, wie sie gesiegt haben, werden sie zum allgemeinen Ausdrucks- und Verständigungsmedium der ganzen Gesellschaft. Sie machen eine ähnliche Karriere wie einst menschliche Sprache und 24 Umfrage Schrift. Schon Begriffe sind ja gestanzte Bedeutung, mentale Schablonen, und wenn sie mehr leisten als Schablonisierung der Wirklichkeit, so danken sie das ihrer produktiven Verknüpfung und Kontextualisierung. Nur durch Schablonen hindurch kommt Geist übers Schablonenhafte hinaus. Das hat Adorno in der Negativen Dialektik in einer großen Selbstkritik des Begriffs entwickelt. Er hat es bloß nicht auf die Schablonen der Kulturindustrie angewandt. Sinnlos jedoch wäre es, sich gegen sie rein erhalten zu wollen. Man muss durch sie hindurch. Sie bieten die Chance, gegen sich selbst gewendet zu werden, so dass durch sie hindurch Nervenpunkte des aktuellen Zustands bloßgelegt werden können. So war der Film zwar von Anfang an ein kulturindustrielles Medium, aber auch – und das geht bei Adorno manchmal fast unter – immer schon mehr als Hollywood. Nicht so der Comic. Aber selbst der hat teil an der Verallgemeinerung der kulturindustriellen Standards. Man mag Art Spiegelmans Geschichte der „Maus“ mehr oder weniger geglückt finden. Aber dass sogar der Comic zu einem distanzierenden, verfremdenden Mittel werden kann, das ermöglicht, eine Sprache für Ungeheuerlichkeiten wie die von Auschwitz zu finden, das zumindest ist damit dargetan – und wäre für Adorno noch undenkbar gewesen, ebenso wie eine Filmkomödie über ein Konzentrationslager, die auch noch mit dem provokativen Titel „Das Leben ist schön“ daherkommt und der Sache gleichwohl nichts von ihrem Ernst nimmt. Es gilt heute, die Chancen zu erkennen und nutzen, die in den kulturindustriellen Standards selbst stecken, was aber nicht dazu führen darf, sie zu überschätzen. Aufs Ganze gesehen, angesichts des audiovisuellen Mülls, mit dem wir täglich überschüttet werden und dessen verblödender Gewalt sich niemand vollständig entziehen kann, sind sie verschwindend gering. Und nur wenn man weiterhin auch aufs Ganze sieht, nicht nur aufs Detail, lässt sich ein kritischer Begriff von Kulturindustrie halten. Sie stellt sich heute anders dar als vor 60 Jahren, gibt aber keineswegs Anlass zu mehr Optimismus als damals. Ihre Modifikationen herauszuarbeiten ist dringlich, aber nur möglich in Bezug auf ihren Grundbegriff, der nun einmal von Horkheimer und Adorno stammt und wie eine Hypothek auf aller weiteren kulturellen Entwicklung liegt. ad 2: Dass der Mythos selbst schon Aufklärung sei, Aufklärung aber in Mythologie zurückschlage, ist ein Gedanke, der sich zwar vornehmlich am Nationalsozialismus gebildet hat, aber damit nicht erschöpft ist. Er misst zu Theodor W. Adorno 25 vielmehr die Spanne aus, in der Gegenwartsphänomene zu begreifen sind – und verlangt nach weiteren Modifikationen. Seit Herrschafts-, Arbeits- und Verkaufsimperative sich zunehmend über Bildschirme, als kleine audiovisuelle Schocks mitteilen, die, auf Dauer gestellt, eine zermürbende Wirkung auf Nervensysteme haben und seit der Steinzeit sedimentierte Perzeptionsstrukturen wieder aufrühren, in Unruhe und Gärung versetzen, bahnt sich eine fundamentale Krise des gesamten menschlichen Sensoriums an, deren Tragweite sich erst im Rekurs auf dessen steinzeitliche Konstitution erschließt. Damit wird es dringlich, die Rolle des archaischen Schocks und seiner Verarbeitung für die Strukturierung der Wahrnehmungs- und Denkformen zu begreifen – und noch weiter zurückzugehen als bis zum Mythos: bis zu den sakral-rituellen Formierungsprozessen kollektiver Handlungsund Perzeptionsstrukturen, von denen der Mythos schon der späte Nachhall ist. Wie der Kapitalismus nicht ohne Warenfetisch sein kann, so sein audiovisuelles Trommelfeuer nicht ohne die Gewalt archaischer Epiphanie. In seiner Hochtechnologie kehrt zugleich Ältestes wieder. – Was übrigens könnte das Zurückschlagen von Aufklärung in Mythologie übrigens besser verdeutlichen als der weltweit blühende Fundamentalismus? Er wird noch viel zu sehr als Gegner der „Moderne“ gesehen, wäre aber selbst als hochmodernes Phänomen zu begreifen. – Der Grundgedanke der Dialektik der Aufklärung, die Verschlingung von Aufklärung und Mythos, ist durch das gleichnamige Buch nicht abgegolten. Es ist vielmehr ein Exposé zu einem nach wie vor unerledigten Forschungsprogramm, und dass die detaillierte Ausarbeitung eines Exposés immer auch dessen Modifikation mit sich bringt, weiß jeder, der sich einmal an einer Magister- oder Doktorarbeit versucht hat. ad 3. und 4: Wer immer nur die beiden allgemeinsten Sätze Adornos, dass es kein richtiges Leben im falschen gebe und das Ganze das Unwahre sei, auf den Lippen führt, macht Gemeinplätze daraus und verkennt, dass sie nur die eine Seite einer intellektuellen Spannung repräsentieren. Die andere darf man getrost „Praxis“ nennen. Wer hat sich denn in die relevanten Diskurse des westlichen Nachkriegsdeutschland mehr eingemischt als Adorno? Wer hat in den 50er und 60er Jahren dort durchschlagender gewirkt als er: als Lehrer, Schriftsteller, öffentlicher Diskutant? Und diese Wirkung hat viel damit zu tun, dass er in hohem Maße unbekümmert um sie handelte. Wohl war ihm an massenmedialer Präsenz gelegen: etwa der neuen Musik im 26 Umfrage Radio das Forum zu verschaffen, das ihr in den Konzertsälen vorenthalten wurde, und auch selbst keine wichtige Diskussionsgelegenheit in Radio und Fernsehen zu versäumen. Aber auf die studentische Unruhe der 60er Jahre hatte er es nicht eigens, etwa aus politischen Erwägungen, abgesehen. Er schürte sie einfach durch seine Art, ungegängelt zu denken. Seine Praxis war Bewusstseinsbildung, Bildung überhaupt, „Erziehung zur Mündigkeit“, und hier war er sich nicht zu schade, konkrete Vorschläge zu machen, etwa wie man Schüler erfahrungsfähig machen könnte. Das war durchaus „positiv“ und alles andere als unpolitisch. Was Adorno nicht getan hat, ist „die Organisationsfrage“ zu stellen. Partei-, Gruppen-, Interessenpolitik, sei es auch für die berechtigten Interessen von Ausgebeuteten und Gedemütigten – das lag ihm nicht, sicher auch unter dem Eindruck des Bewusstseinsverlusts, den er bei sozialistischen Organisationen regelmäßig erlebt hatte. Aber die legitimen Impulse solcher Politik hat er nie verkannt. Ebenso würde er mit jenen Bürgerinitiativen, Netzwerken, NGO’s, die man unter dem Begriff „Zivilgesellschaft“ zusammenfasst, sympathisiert haben – sofern sie nicht nur Lobbies sind, sondern erkennbar an der Linderung von Leiden und Ausbeutung arbeiten. Zum Phänomen „Zivilgesellschaft“ selbst hätte er sich allerdings gewiss ähnlich verhalten wie zur Studentenbewegung: dialektisch. Wie er an der Studentenbewegung den antiautoritären, zumal antifaschistischen Impuls begrüßte, aber die Selbstüberschätzung als einer revolutionären Kraft zur Aushebelung der kapitalistischen Gesellschaft kritisierte, so dürfte er an der Zivilgesellschaft bei allem Respekt für ihre humanitären Initiativen den Hang zu vorschneller Selbstgenügsamkeit moniert haben. Zivilgesellschaft an sich ist noch nicht das Gute, zumal nicht unter globalen kapitalistischen Bedingungen. Ihre Einübung wäre immer zugleich als Vorübung zu etwas Grundsätzlicherem zu begreifen: der Überwindung der kapitalistischen Vergesellschaftungsform selbst. Roger Behrens Antisystem. Drei Stichpunkte zur kritischen Theorie der Gesellschaft* I. So oder so Die Kritische Theorie diagnostiziert, dass diese Welt alles andere als die beste aller möglichen Welten ist. Sie beschreibt die gegenwärtige gesellschaftliche Ordnung als total verwaltete Welt, als universellen Verblendungszusammenhang. Die Kritik fällt radikal aus, weil es ihr nicht um Reformen oder Korrekturen der herrschenden Verhältnisse geht, sondern letztlich um eine fundamentale Kritik, die auf die Abschaffung, also Aufhebung und Umwälzung dieser Verhältnisse zielt. Es scheint, gelinde gesagt, das Paradox zu sein, das der Kritischen Theorie, insbesondere Adorno, angehängt wird: Je grundsätzlicher und beunruhigender sie in ihrer Diagnose wird, desto lauter gebärdet sich der Einwand, dass mitnichten die Welt so schlimm sei. Im Gegenteil, von einem anderen Standpunkt aus betrachtet, scheint unsere Welt gerade heute weitgehend mit humanen Errungenschaften und kulturellen Verbesserungen gesegnet zu sein. Dieser andere Standpunkt will übrigens weniger überheblich, verbissen oder pessimistisch die Sache sehen. Freilich ist ohne Weiteres zuzugeben, dass es gerade denjenigen, die sich heute noch den Luxus erlauben können, in theoretischer Distanz zur Welt zu treten, nicht schlecht geht. Und wer es doch nicht so gut hat, wird zum Kollateralschaden der Zivilisation erklärt: ‚tendenziell‘ gehe es auch den Hungernden heute besser als früher. Dass es gegenwärtig gerade im Bereich der Unterhaltung die vielfältigsten Möglichkeiten gibt, sich genussvoll, lustig und eigentlich auf allen erdenklichen Niveaus die Zeit zu vertreiben, die man nicht hat, ist auch nicht von * Bei diesem Text handelt es sich um die Ausarbeitung eines Vortrags, der auf der Tagung ‚Theodor Adorno: Theoria Aesthetica, 1903/2003 Congresso Internacional‘ in Belo Horizonte (Brasilien), 9.-12.9.2003 gehalten wurde. Eine erweiterte Fassung erscheint in: Roger Behrens, Verstummen. Über Adorno, Laatzen 2004 (Wehrhahn). 28 Roger Behrens der Hand zu weisen: Tanzen, Fernsehen, für Freunde Kochen, in die Kneipe gehen etc. macht Spaß und hat natürlich den Nebeneffekt, sich ein wenig über die alltägliche Trostlosigkeit zu erheben. Was ist also der Punkt? Liegt Adorno, der die Produkte der Kulturindustrie für Schund hielt, deshalb falsch, weil man auf Konsumenten vertraut, die sich ihr Leben mit eben diesen Produkten zufrieden eingerichtet haben? Hat Adorno Unrecht mit seinem Befund eines zwar demokratisch organisierten, in der Freiheit der Einzelnen allerdings höchst kontrollierten Systems alles durchdringender Herrschaftsverhältnisse, weil gewisse Leute die für sie vorgesehenen Lücken finden, in denen sie den Anschein von Freiheit und Selbstbestimmung praktizieren dürfen? Und dann – so der neueste, fast empörte Einwurf anlässlich der aktuellen Biografisierungen des „Meisterdenkers“ (Titelseite: ‚Die Zeit‘ vom 3.9.2003) – habe der streitbare Philosoph selbst noch nicht einmal nach den vermeintlichen Maßstäben seiner Kritik gelebt, sei statt dessen fremdgegangen, habe statt Schund den Luxus bevorzugt und versuchte gar, es sich gut gehen lassen, machte schöne Reisen und dergleichen! Solche Beanstandung, die sich in der Regel pedantisch und gelehrt gibt, will Adorno Fehler in seiner kritischen Theorie nachweisen, will schließlich die kritische Theorie der Gesellschaft als Makel Adornos deklarieren und sie ihm wie ein philosophisches Versehen austreiben. Es gehe gar nicht gegen Adorno, sondern mit ihm! Erst der in der Konsequenz vollständig von der Gesellschaftskritik gesäuberte Adorno kann dann zu den Akten gelegt werden, darf – vor allem heute, wenn Adorno in der Berliner Republik der Neuen Mitte einhundert geworden wäre – im akademischen Diskurs weiterhin den Kulturkritiker geben und fungiert in den Feuilletons von ‚TAZ' und ‚FAZ' als das auf Konsens getrimmte Gewissen der Nation. Die Aussöhnung mit der Kritischen Theorie, die mittlerweile auch Neokonservative und Neue Rechte betreiben, funktioniert zu eben genau den Konditionen, von denen sie sich vehement distanzierte: Adornos Beitrag wird zur Kulturkritik degradiert, um ihm dann zu attestieren, dass er keine Ahnung hatte, zum Beispiel vom Jazz und vom Fernsehen. Die hatte er auch nicht; nur ist es für das, worum es Adorno ging, etwa in seiner Jazzkritik, irrelevant und egal. Zudem spricht in den Kritteleien an Adorno immer auch der beleidigte Bildungsbürger, der sich im Feuilleton zum Anwalt der Angestellten machen will: wenn es ihm „um die Sache“ geht, geht es immer um Mo- Antisystem. Drei Stichpunkte zur kritischen Theorie der Gesellschaft 29 ral, eigentlich nie um die Sache. Adornos Befund vom universellen Verblendungszusammenhang ist jedenfalls kein moralischer und ist auch nicht als ein solcher umzudeuten. Das ist nur möglich, wenn systematisch ausgeblendet wird, was das Kritische an der Kritischen Theorie ist und damit das Fundament der Philosophie Adornos: dass es ihr eben explizit nicht um Kultur-, sondern Gesellschaftskritik geht, in die eine Beschäftigung mit der Kultur allerdings als Ideologiekritik eingebettet ist; dass es ihr um die Bedingungen von Kritik selbst geht, und damit auch um die Frage nach Theorie und Praxis gleichermaßen; dass es ihr um eine Gesellschaft geht, deren immanenter Strukturzusammenhang - die kapitalistische Verwertungslogik - verborgen, d. h. verblendet und fetischistisch verzerrt ist, und Theorie daher keinen unmittelbaren Zugang zur Wirklichkeit hat; dass es ihr vor allem aber um die zentrale philosophische Frage der Neuzeit geht, was nämlich der Mensch sei, und zwar angesichts von Verhältnissen, die das Menschsein einerseits in ihrer Entwicklung behindern und sogar existenziell bedrohen, andererseits seine Möglichkeiten erweitern, ohne dass darüber hinaus der Mensch an sich ontologisch bestimmbar wäre, außer eben in seiner nicht-festgelegten Potenzialität und perfektiblen Universalität. Kritische Theorie operiert so am Grundwiderspruch der Ideologie: sie ist dialektisch als falsches Bewusstsein möglicher richtiger Zustände und richtiges Bewusstsein der falschen Zustände zugleich bestimmt. In solchen Figurationen ist indes die Architektur der Kritischen Theorie zu entschlüsseln. Entscheidend ist einmal mehr die dialektische Grundfigur rettender Kritik: sie kristallisiert sich in der Idee, dass Kritik nur im Bewusstsein der Widersprüche denkbar ist, dass die Konzepte nicht einseitig oder positivistisch von ihren Widersprüchen bereinigt werden können, sondern dass sie durch die Widersprüche überhaupt erst geformt werden. In dieser Weise ist im Übrigen der Entwurf einer negativen Dialektik als Dialektik der bestimmten Negation zu verstehen; und dies ist zugleich ihr materialistisches Motiv. Wenn Marx sagte, die Philosophie könne nur aufgehoben werden, wenn sie verwirklicht wird, und Adorno für das 20. Jahrhundert konstatierte, dass diese Verwirklichung misslang, dann sind zwei Deutungen möglich. 30 Roger Behrens Entweder meint das Misslingen der Verwirklichung, dass die Verwirklichung gar nicht stattfand, und die Einlösung des Marxschen Diktums noch aussteht. Das aber hieße konsequent, dass die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert, zu Marx‘ Zeiten, steckengeblieben ist, ohne dialektische Bewegung. Dazu gehören Vorstellungen wie die von den starren Formationen der Klassengesellschaft oder der aktionistische Schematismus sozialistischer Gruppen, aber auch die spätbürgerliche, popdiskursive Kapitulation vorm Kapitalverhältnis. Oder das Misslingen der Verwirklichung meint, die Verwirklichung habe stattgefunden, aber eben falsch, fehlgeschlagen. Dies formuliert eine Position der Aufhebung der Philosophie, die sich aber nur negativ und retrospektiv auf das Misslingen gründet, - sie ist der Ort der Kritischen Theorie Adornos, und in ihrem Rückblick aufs 19. Jahrhundert übrigens mit wichtigen Parallelen zum Konzept einer Dialektik im Stillstand wie sie Walter Benjamin diagnostizierte. Sie ist auch die Position, von der aus sich das systematische Antisystem entfaltet, das dann in die ‚Negative Dialektik‘ mündet. Hier wird deutlich, inwiefern die einzelnen Momente der kritischen Theorie Adornos selbst dialektisch ineinander greifen, und zwar vom Punkt der misslungenen Aufhebung der Philosophie aus, mit der ja immer Hegels philosophisches System gemeint ist. Von hier aus greifen die philosophischen Probleme von Totalität und Identität, Subjekt und Objekt mit den ästhetischen Fragen von Mimesis, Authentizität, Wahrheitsgehalt ebenso ineinander wie mit den soziologischen und psychologischen Analysen des Verhältnisses von Gesellschaft und Individuum, von Bewusstsein und Unbewusstem. II. Verbindlichkeit ohne System Als Antisystem ist die Komplexion der Begriffe in der Kritischen Theorie auch insofern zu verstehen, als alle positiven Kategorien systematischen Philosophierens nur noch negativ bestimmbar sind; und das betrifft schließlich die Konstruktion des systematischen Philosophierens selbst. Antisystem ist die letzte Philosophie dort, wo sie als System versagt, verstummt: der Entwurf einer negativen Dialektik korrespondiert nicht nur methodisch, sondern auch strukturell mit der negativen Totalität der Gesellschaft, mit der Begriffslogik des Nichtidentischen und vor allem mit der negativen - d. h. bilderlosen - Utopie sowie der negativen Ästhetik. Die negative Dialektik Antisystem. Drei Stichpunkte zur kritischen Theorie der Gesellschaft 31 der Kunst überspannt und durchzieht das gesamte Antisystem, weil in der Kunst die negative Dialektik des Antisystems selbst zum Ausdruck kommt. Denn einerseits ist Kunst die adäquate Sprache der Negation, ist die durch Kunst vermittelte Erfahrung negativ-negierend und Kunst also sozusagen die Waffe der Kritik als Erkenntnis; andererseits kristallisiert sich in ihr die negative Totalität, die negative Erkenntnis von der Negation der Kunst. Genau diese Figur bezeichnet die Dialektik des Verstummens. Sie ist exemplarisch im Antisystem selbst zu fassen, im deutlichen Kontrast zu den großen Systemen der Philosophie Kants und Hegels: Wo Kant nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis fragt, geht es Adorno um die Bedingungen, die Erkenntnis verhindern; und wo Hegel den Stufenweg des Selbstbewusstseins beschreibt, versucht Adorno herauszufinden, warum dieser Weg am Selbst vorbei in die Unmündigkeit führt. Antisystem impliziert darüber hinaus die materialistische Wendung des idealistischen Systems: „Die vom Hegelschen System begriffene Welt hat sich buchstäblich als System, nämlich das einer radikal vergesellschafteten Gesellschaft, erst heute, nach hundertfünfundzwanzig Jahren, satanisch bewiesen.“ (GS Bd. 5, 273) Zugleich aber bleibt der Gegenentwurf des Antisystems geschichtlich vermittelt, und nicht zuletzt deshalb konzentriert Adorno sich in der ‚Negativen Dialektik‘ auf das letzte philosophische System, die Fundamentalontologie Heideggers. Zu dessen Daseinsanalyse bildet Adornos Antisystem den diametralen Gegenpol: während Heidegger nach dem Sinn des Seins fragt, richtet sich Adornos Augenmerk darauf, überhaupt erst Sinn in die Welt zu bringen. Und insofern umkreist Adorno Heideggers Ontologie mit den beiden Tabus dessen Seinslehre, nämlich der Dialektik und der Utopie: „Angesichts der konkreten Möglichkeit von Utopie“, heißt es in der ‚Negativen Dialektik‘, „ist Dialektik die Ontologie des falschen Zustands. Von ihr wäre ein richtiger befreit, System so wenig wie Widerspruch“ (GS Bd. 6, 22). Zudem ist das Antisystem systematisch, indem es durch das Fragment hindurch der Totalität habhaft zu werden versucht; es ist nicht beliebig, sondern verbindlich. Seine Struktur ist eine der bestimmten Vermittlung: Modellanalysen als ein Denken in Konstellationen. Deswegen kann Adorno bisweilen etwas apodiktisch formulieren, ohne Dogmatik und Programmatik: „Theorie ist unabdingbar kritisch“ (GS Bd. 8, 197). Also ist Theorie immer schon kritische Theorie; das Verhältnis von kritischer Theorie und 32 Roger Behrens Kunst ist eines der Wahlverwandtschaft; und kritische Theorie ist ästhetische Theorie. Ästhetische Theorie ist daher sowohl eine Theorie der Ästhetik als auch eine nach ästhetischen Aspekten strukturierte Theorie. Da Kunst ästhetische Praxis ist, ist kritische Theorie als kritische auch Praxis. Und so weiter. In der ‚Vorlesung über Negative Dialektik‘ heißt es „thetisch ganz allgemein“, „dass die negative Dialektik ... mit einer kritischen Theorie im Wesentlichen dasselbe ist. Ich würde denken, die beiden Termini Kritische Theorie und Negative Dialektik bezeichnen das Gleiche.“ (VND, 36f.) Und Adorno setzt hinzu: „Vielleicht, um exakt zu sein, mit dem einen Unterschied, dass Kritische Theorie ja eben wirklich nur die subjektive Seite des Denkens, also eben die Theorie bezeichnet, während Negative Dialektik nicht nur dies Moment angibt, sondern ebenso auch die Realität, die davon getroffen wird.“ (VND, 37) Wenn Adorno hier von „Realität“ spricht, so verweist dies auf den Doppelcharakter des Systems, das eben nicht nur das philosophische Denken bezeichnet, sondern auch den Strukturzusammenhang der sozialen Wirklichkeit selbst. Gleichwohl sind diese beiden Systembegriffe oder eben Systemrealitäten miteinander vermittelt: das Antisystem der Negativen Dialektik ergibt sich sozusagen aus der negativen Dialektik der Gesellschaft. Was bei Adorno sich philosophisch-kritisch um den Komplex einer Logik der Identität gruppiert, zielt gesellschaftskritisch auf die Analyse der Logik des Tausches. Sie ist die instrumentelle, verdinglichte Praxis des identifizierenden, verdinglichten Denkens: „Das Tauschprinzip, die Reduktion menschlicher Arbeit auf den abstrakten Allgemeinbegriff der durchschnittlichen Arbeitszeit, ist urverwandt mit dem Identifikationsprinzip. Am Tausch hat es sein gesellschaftliches Modell, und er wäre nicht ohne es; durch ihn werden nichtidentische Einzelwesen und Leistungen kommensurabel, identisch. Die Ausbreitung des Prinzips verhält die ganze Welt zum Identischen, zur Totalität.“ (GS Bd. 6, 149) Die vermittelte Einheit von Totalität und Fragment bestimmt auch die durch den Tausch definierte Gesellschaft. Die Totalität ist nicht durch unmittelbares Miteinander, sondern durch das abstrakte Tauschverhältnis wesentlich gebannt, das als abstraktes Verhältnis den menschlichen Beziehungen allerdings äußerlich bleibt: sie halten sich an die falsche Unmittelbarkeit, an das Pseudokonkrete der alltäglichen Beziehungen. Insofern ist ihre Vergesellschaftung die von Produzenten und Konsumenten, nicht aber die Antisystem. Drei Stichpunkte zur kritischen Theorie der Gesellschaft 33 von Menschen. Nur kraft dieses entfremdeten Selbstbezugs können wir überhaupt die Einheit herstellen, die wir als sinnvolle soziale Totalität wahrnehmen, und die sich zudem durch Trennungsmechanismen wie Klassenwidersprüche, Herrschaft oder Selbstkontrolle erst konstituiert. Sie konstituiert sich so in der Dialektik von Integration und Desintegration, die sich bis zum faschistischen Terror verschärfen kann, die aber auch durch demokratische Selbstregulationen der Subjekte aufgefangen werden kann. Sie strukturiert so die „Systematik der bürgerlichen Gesellschaft“ und drückt sich zugleich in der radikalen Dialektik aus, die Adorno mit Marx erläutert, „dass sich in dieser Gesellschaft immer größere Missverhältnisse, nämlich rein vom Ökonomischen her Disproportionen zwischen den einzelnen Sektoren herausbilden und durch sie schließlich das ganze System gesprengt werden muss. Nach dieser Theorie ... beinhaltet das Gesetz des Systems den Untergang des Systems und nicht dessen Bestätigung oder Selbsterhaltung. Man kann dementsprechend das Marxische System ein negatives oder ein kritisches System nennen, eine durchaus kritische Theorie.“ (PT Bd. 2, 262) Im Antisystem kristallisiert sich indes die Grundfigur der Philosophie Adornos, nach der das Ganze das Unwahre ist: „Die Welt ist zwar ein System, aber sie ist das System, das den Menschen heteronom auferlegt ist als ein ihnen fremdes; sie ist ein System als Schein und hat nichts mit ihrer Freiheit zu tun. Das ist ein System als Ideologie, und das Ganze, das bei Hegel die Wahrheit sein soll, das wäre innerhalb der Marxischen Theorie ein Unwahres.“ (PT Bd. 2, 262 f.) III. Antisystem und Gesellschaft Eingebettet ist die Philosophie als Antisystem in die kritische Theorie der Gesellschaft. Marx hat sie bekanntlich als ‚Kritik der politischen Ökonomie‘ begründet, die darstellt, inwieweit die Produktionsverhältnisse, Produktivkräfte und überhaupt die allgemeine Struktur der Produktion den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang bestimmen. Was sich auf abstrakter Ebene als Wertvergesellschaftung ubiquitärer Tauschbeziehungen darstellt, geriert sich im konkreten Leben der Menschen als ihr verdinglichtes und entfremdetes Verhältnis zueinander und definiert zugleich ihre Stellung im Produktionsprozess. Ihre menschlichen Interessen konvergieren mit den ökonomischen, den beruflichen und finanziellen; und insofern die wirt- 34 Roger Behrens schaftlichen Bindungen zum subjektiven Schicksal werden, treten die Menschen sich objektiv als Klassen gegenüber, d.h. in unterschiedlicher Abstufung, was die Verfügung über und den Besitz an Produktionsmitteln angeht. Dass im Kapitalismus der gesellschaftliche Zusammenhang insgesamt als Äquivalententausch wie ein menschliches Naturverhältnis funktioniert, ist die erste und letzte Ideologie, mit der die kulminierenden, sich in der Krise des Systems zuspitzenden Widersprüche kaschiert werden sollen. Solche Ideologie als falsches Bewusstsein oder richtiges Bewusstsein der falschen Zustände, dem Marx und Engels einmal das Bild der ‚camera obscura‘ gaben, formiert sich nach materialistischer Lehre in der Dynamik eines Überbaus, der von der ökonomischen Basis abhängig bleibt. Gerade weil aber das gesellschaftliche Sein auch das individuelle Bewusstsein bestimmt, tangieren die Widersprüche nicht nur die Auseinandersetzungen und Spannungen der sozialen Klassen, sondern auch die Individuen selbst. In der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft entfalten sich Individualitäten zunehmend isoliert; Individuation wird zum Prozess der Desintegration. Zugleich gelingt die gesellschaftliche Integration vermittels der scheinbar vom ‚realen Leben‘ entkoppelten Sphäre der Kultur. Sowohl die Dialektik des Individuums wie auch die Dialektik der Kultur erscheinen als der Kitt, der das kapitalistische Gewaltverhältnis zeitweise und scheinbar befriedet oder ausblendet. Und dennoch verlängert sich in der Struktur des Individuums wie in der Dynamik der Kultur die Verwertungslogik der kapitalistischen Ökonomie, und zum Idealbild des Individuums wird der mündige Bürger als Unternehmer. Deshalb nennen Adorno und Horkheimer in der ‚Dialektik der Aufklärung‘ das Individuum einen „psychologischen Kleinbetrieb“, die „unermüdliche Verwirklichung des Idealtyps homo oeconomicus“ (GS Bd. 3, 229). Die Widersprüche indes entfalten sich in den Subjekten in nachgerade derselben Gewalt, mit der sie sich gesamtgesellschaftlich und heute global als Geschichte durchsetzen. In ‚Zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie‘ benennt Adorno diese dialektische Verkettung der Antagonismen: „Die Ungleichzeitigkeit von Unbewusstem und Bewusstem ist selbst ein Stigma der widerspruchsvollen gesellschaftlichen Entwicklung. Im Unbewussten sedimentiert sich, was immer im Subjekt nicht mitkommt, was die Zeche von Fortschritt und Aufklärung zu zahlen hat.“ (GS Bd. 8, 61) Und wie sich im Individuum die Dynamik von Bewusstem und Unbewussten psychisch manifestiert, geriert sich dieselbe Dynamik sozial Antisystem. Drei Stichpunkte zur kritischen Theorie der Gesellschaft 35 als Kultur. Freud hat das mit dem Unbehagen beschrieben; und Adorno korrigiert in diesem Sinne Marx: „Bei zunehmender Integration verliert die Basis-Überbau-Relation ihre alte Schärfe. Je mehr die Subjekte von der Gesellschaft erfasst, je mehr sie vom System bestimmt und je vollständiger sie determiniert werden, um so mehr erhält sich das System nicht einfach durch Zwangsanwendung den Subjekten gegenüber, sondern auch durch die Subjekte hindurch.“ (EIS, 253 f.) Der durch den Tausch vermittelte Zusammenhalt der Gesellschaft kulminiert in dem universellen Verblendungszusammenhang, der nicht von außen die Menschen unterwirft, sondern der zu einem Mechanismus der subjektiven Selbsterhaltung vollends zu werden droht. „Immer enger werden die Maschen des Ganzen nach dem Modell des Tauschakts geknüpft. Es lässt dem einzelnen Bewusstsein immer weniger Ausweichraum, präformiert es immer gründlicher, schneidet ihm a priori gleichsam die Möglichkeit der Differenz ab, die zur Nuance im Einerlei des Angebots verkommt. Zugleich macht der Schein der Freiheit die Besinnung auf die eigene Unfreiheit unvergleichlich viel schwerer, als sie im Widerspruch zur offenen Unfreiheit war, und verstärkt so die Abhängigkeit.“ (GS Bd. 10/1, 13) Die Wirklichkeit selbst kippt ideologisch in den Idealismus zurück, indem die Menschen glauben, dass die Welt, so wie sie ist, von ihnen gemacht wurde, und dass die Welt, so wie sie ist, prinzipiell ihr Glück befördert. Der Fetischcharakter der Ware ist zur Charaktermaske des Individuums geworden; Kritik des Verblendungszusammenhangs heißt daher nicht Kulturkritik, sondern Kritik der kapitalistischen Verwertungslogik. „Kritik am Tauschprinzip als dem identifizierenden des Denkens will, dass das Ideal freien und gerechten Tauschs, bis heute bloß Vorwand, verwirklicht werde. Das allein transzendierte den Tausch. Hat ihn die kritische Theorie als den von Gleichem und doch Ungleichem enthüllt, so zielt die Kritik der Ungleichheit in der Gleichheit auch auf Gleichheit, bei aller Skepsis gegen die Rancune im bürgerlichen Egalitätsideal, das nichts qualitativ Verschiedenes toleriert. Würde keinem Menschen mehr ein Teil seiner lebendigen Arbeit vorenthalten, so wäre rationale Identität erreicht, und die Gesellschaft wäre über das identifizierende Denken hinaus.“ (GS Bd. 6, 150) Zwar konstituiert sich der Verblendungszusammenhang als universeller, doch bleibt jedes seiner Momente, dialektisch, Bedingung seiner Aufhebung; darauf rekurriert das Antisystem. 36 Roger Behrens Die Abhängigkeit der Menschen von der Produktionsordnung kann nur durch Aufhebung der Produktionsordnung aufgehoben werden. Dies setzt voraus, „dass die gesamten Kategorien der bürgerlichen Gesellschaft, für die hier die Produktivität im Sinn des Tauschprinzips einsteht, also mit anderen Worten, das gesamte System, ... nicht etwa ein System des Absoluten oder der Wahrheit sein soll.“ (PT Bd. 2, 276) So zeigt sich, wie Adorno weiter erläutert, „dass hinter dem Marxschen Begriff der Produktivität eine Vorstellung steht, die nun doch über den Begriff der bloßen materiellen Produktion weit hinausgeht.“ (PT Bd. 2, 276) Sie ist insofern für das Antisystem einer kritischen Theorie der Gesellschaft zentral, weil das, was das Gefüge im Innersten zusammenhält, zugleich zum Hebel der Kritik wird, mit dem dieses Gefüge in eine neue, emanzipierte Ordnung gebracht werden kann: Die Produktivität wird zum Schlüssel dessen, was sie unter gegebenen Bedingungen zugleich verstellt: die menschliche Praxis. In diesem Sinne nennt Adorno wirkliche Produktivität „die Fähigkeit zum nicht schon Dagewesenen“ (GS Bd. 10/2, 651). Schon mit Marx ist der Aspekt am Begriff der Produktivität hervorzuheben, der „nicht rein ins Subjekt, will sagen, in menschliche Arbeit aufzulösen ist“ (PT Bd. 2, 268). Antisystemischsystematisch meint deshalb, den Begriff der Produktivität „nicht wieder in das Identitätsdenken herein[zu]ziehen“ (PT Bd. 2, 268). In solcher fast utopischen Perspektive ist wiederum die Kernproblematik der kritischen Theorie Adornos berührt, die in der Dialektik gründet, dass einerseits die Bedingungen eines befriedetes Daseins für alle Menschen hier und heute gegeben sind, und die Einrichtung menschlicher Zustände nicht einmal schwerwiegenden Verzicht bedeutete; dass andererseits jedoch die Menschen einen Großteil ihrer Kraft und ihres Vermögens darauf konzentrieren, dass alles so bleibt, wie es ist, und sich nichts Wesentliches ändert. In der Kritischen Theorie selbst sind diese beiden Pole im Antisystem nur kraft ihrer reflektierten Vermittlung zu begreifen. Die ästhetische Theorie ist ein Moment der kritischen Theorie der Gesellschaft, und die kritische Theorie der Gesellschaft kristallisiert sich in der Analyse der Kulturindustrie. Kunst, auf die ästhetische Theorie sich richtet, und an der sie versucht, den Erkenntnischarakter freizulegen, ist heute gleichsam ein Moment der Kulturindustrie. Weder die Kunst noch die Kritische Theorie selbst verfügen über eine Position außerhalb des Systems; wohl aber bleibt kritischer Praxis die Option, den Gewaltzusammenhang des Systems – sei's durch Antisystem. Drei Stichpunkte zur kritischen Theorie der Gesellschaft 37 Kunst, sei's durch Theorie – zu durchbrechen: erst in der Rekonstruktion des Antisystems ergibt sich die Möglichkeit verändernder Praxis, die sich nach keinem Sachzwang, nach keiner realpolitischen Notwendigkeit und Dringlichkeit sozialer Krisenintervention richten muss. Solange aber bleibt, nach Adornos Wort, „Praxis auf unabsehbare Zeit vertagt“, ist „nicht mehr die Einspruchsinstanz gegen selbstzufriedene Spekulation.“ (GS Bd. 6; 15) Praxis bleibt vorerst der kritische Gedanke, nicht weniger. Denn: „Das Ziel richtiger Praxis wäre ihre eigene Abschaffung ... Fällige Praxis wäre allein die Anstrengung, aus der Barbarei sich herauszuarbeiten.“ (GS Bd. 10/2, 769) Hier ist die Nuancierung entscheidend: Ist Praxis, die kritischtheoretisch begründet ist, verstellt, so wäre es gleichsam zynisch und Hohn, sich auf Theorie zurückzuziehen und Praxis da zu verweigern, wo die Dringlichkeit der Lage sie erfordert. Daran vermag auch das Antisystem nicht zu rütteln. Wohl aber ist es radikale Bedingung dafür, sich dem Sachzwang nicht blind und unreflektiert zu unterwerfen, weder theoretisch noch praktisch zu kapitulieren. Das meint Kritische Theorie als Haltung. Siglen: EIS: Th.W. Adorno, Einleitung in die Soziologie. Nachgel. Schriften, Abt. IV, Bd. 16, hg. vom ThW. Adorno-Archiv und von Chr. Gödde, Frankfurt/Main 1993. GS: Th.W. Adorno, Gesammelte Schriften in zwanzig Bänden, hg. von R. Tiedemann, unter Mitwirkung von Gretel Adorno, S. Buck-Morss und K. Schultz, Frankfurt/Main 1997. PT Bd. 2: Th.W. Adorno, Philosophische Terminologie Bd. 2, Frankfurt/Main 1974. VND: Th.W. Adorno, Vorlesung über Negative Dialektik. Nachgel. Schriften, Abt. IV: Vorlesungen Bd. 16, hg. vom Th.W. Adorno-Archiv und von R. Tiedemann, Frankfurt/Main 2003. WIDERSPRUCH Münchner Zeitschrift für Philosophie Nr.40 Kampf der Kulturbegriffe Kritik der Globalisierung Manuel Knoll: Die Grenzen des Westens Alexander von Pechmann: Zur neuen Dimension der Globalisierungskritik Wolfgang Melchior: Die alte Weltordnung Mohamed Turki: Arabische Vernunft versus westliche Vernunft? Charme I. Sucharewicz: Die israelische Entwicklung Kim Lan Thai Thi: Ein Koan zur Lehrbiographie ... und viele Rezensionen philosophischer Neuerscheinungen erhältlich in allen uni-nahen Buchhandlungen Preis: 6.- EUR Michaela Homolka Nach Adorno. Zum Aspekt des Räumlichen Die beiden kategorischen Imperative von Adornos Philosophie, das Rimbaud’sche: Il faut être absoluement moderne1 und, dass sich Auschwitz nicht wiederholen darf, sind mit der radikalen Absage an Nietzsches Lehre von der ewigen Wiederkunft aufeinander beziehbar und damit explizit historisch. Erst wenn uns dies geschichtsphilosophische Katapult: die explizite Forderung nach einem Denken auf der Höhe der Zeit heute noch etwas bedeutet, ist auch die Frage nach Adornos Aktualität berechtigt (und schon bejaht). Während Adorno ehemals der Wahrheit einen Zeitkern zuschrieb und Chronos somit eine hervorragende Stellung einräumte, wird Zeit heute vorwiegend im Problembereich von Be- und Entschleunigung diskutiert und problematisiert also einem räumlichen Kontext beigeordnet (Geschwindigkeit = Weg/Zeit). Die Debatte über die Zeit ist als Synchronisierungsproblem, das die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen beschreibt, in die Thematik von Globalisierung eingegangen. Für Adorno bestand solche Gleichzeitigkeit im nicht eingelösten Versprechen: „Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward.“2 Heutige Beispiele für dies Problem sind vor allem 1 Th.W. Adorno, Wozu noch Philosophie? In: Gesammelte Schriften (GS), Bd. 10/2, Frankfurt/Main 1997, S. 473. 2 Th.W. Adorno, Negative Dialektik. In: GS Bd. 6, S. 15 40 Michaela Homolka die angebliche Rückständigkeit peripherer Gebiete gegenüber den Zentren, so die Ränder der Städte im Verhältnis zu deren Mittelpunkten, die Ränder Europas bezogen auf seine Metropolen, die Grenzen der zivilisierten Welt verglichen mit deren Kernbereichen. Die Synchronisierungsdebatte bestimmt ebenso den Bereich der Medien: Die Beschleunigung der Informationsübertragung auf den Datenautobahnen des Internets lässt die Welt zum so genannten globalen Dorf schrumpfen. Damit wäre der Zeitbegriff in eine Kategorie des quasi selbst im Verschwinden begriffenen Raumes übergegangen. Offensichtlich führt die Relation unseres Empfindens von Raum und Zeit einen geschichtlichen Index mit sich. Komplementär zur altmodischen Vorstellung von Zeiträumen ist hier die neue Raumzeit installiert. (Raum und Zeit funktionieren anders als Apfelstrudel und Strudelapfel oder Erdöl und Ölerd: Sie sind nach einem dialektischen terminus technicus wechselseitig ineinander vermittelt.) Sie greift in unser Raum- und Zeitgefühl ein und verändert es virtuell nicht nur im Cyberspace. Der Tendenz zum Primat des Raumes entspricht auf wirtschaftlichem Gebiet der neuere Slogan „Raum ist Geld“, dem der alte „Zeit ist Geld“ gewichen ist. Und bald wird auch der Raum verschwunden sein und das Geld übrig bleiben. Heute wie zu Adornos Zeit führen die Abstraktionen ein beachtliches Quantum Leid mit sich, so ist die Zeit der Arbeitslosen fortan wertlos; und durch jüngste USamerikanische Expansion wurde ein Raum erobert, der Geld ist, der mit Menschenlebenszeit bezahlt ist. Selbst Adornos Lieblingsbereich, die avantgardistische Musik neigt sich der Seite des Raumes zu und beschäftigt sich mit Synchronisierungsproblemen: Karlheinz Stockhausens Helikopter-Streichquartett, seiner astronomischen Intention entsprechend allen Astronauten gewidmet, besteht aus Aufstieg – Flug – Formation – Abstieg – Landung. Die vier Musiker fliegen simultan in vier Hubschraubern so weit vom Auditorium entfernt, dass sie gesehen, aber nicht gehört werden können. Der Lärm der Rotoren soll die Darbietung nicht stören. Sie stehen über zwölf Mikrofone und Kopfhörer mit der Rotation ihrer Helikopter, den Piloten, einer Bodenstation und untereinander in Beziehung. Die polyphone und Takt für Takt gefügte Komposition ist selbst vom Fluggeräusch inspiriert und sieht zusätzlich durch Tremoli und Stakkati die Berücksichtigung der wechselnden Geschwindigkeit und Intensität der Rotoren vor. Am Mischpult werden Flug- Nach Adorno 41 und Streichergeräusche ausbalanciert und mit Lautsprechern zum Publikum übertragen. Fernsehkameras senden die Bilder der Spieler für das Publikum direkt auf vier Monitore. Nach dem Kommentar des Komponisten könnten nun auch Musiker auf unterschiedlichen Planeten miteinander spielen. Ein anderes spektakuläres Beispiel für die Entfaltung des Raumes in der zeitgenössischen Komposition ist das elektrische Singspiel: suchmaschinen im lichtleeren meer von Berkan Karpat und Klaus Schedl. Bei einer futuristisch anmutenden Klanginstallation, die das Zentrum der Aufführung bildet, stehen während der Aufführung fünf mit Einzelkabinen ausgestattete Taxis bereit, in die jeweils eine Sängerin und zwei Personen aus dem Publikum einsteigen und durch die Stadt fahren. Alle Taxis sind mit der zentralen Klanginstallation und den dortigen Sängerinnen über Funk gekoppelt. Die taxifahrenden Zuhörer entsteigen gänzlich desorientiert ihren Kabinen an einem anderen Ort dem Taxi wie einem Traum. Durch den wahrlich sirenenartigen Gesang und die Fahrt in der nur schemenhaft erkennbaren, fremd gewordene Stadt wird dem vereinzelten Publikum die archetypische Erfahrung eines Innenraumes gewährt. Entfaltet Stockhausen seine Idee des Raumes als ein machtvolles und nahezu beliebig erweiterbares Konzept, dessen Innenräume ebenso zur Waffe wie zum Musikinstrument und Transportmittel taugen, so wird der Außenraum von Schedl und Karpat futuristisch verfremdet und die Taxis als Vehikel der künstlichen Höhle zum Negativ. Negative Dialektik des Raumes War Adorno zu seiner Zeit geradezu verhängnisvoll aktuell, so steht die Frage von Adornos heutiger Aktualität, nach dem vielfach proklamierten Ende der Geschichte, eindeutig unter der Verschiebung von der Zeitthematik zum Raum. Und so lautet die Frage: Wie hält es Adorno, der doch vor allem als geschichtsphilosophischer Denker gilt, mit dem Raum? Gemeinhin werden mit einem räumlichen Denken Okkupation und Expansion assoziiert, Machtfaktoren, für die Adorno ein voll ausgebildetes, von Nietzsche ererbtes Sensorium besitzt. Negativ, wie seine Dialektik sind auch Adornos Orte. Daran weist sein ansonsten, asystematisches, dem Aphorismus und Essay zugeneigtes Denken eine große Stringenz auf: Allen diesen Orten voran steht die Utopie, der ou-topos oder Nichtort oder Noch-Nicht-Ort, der für alles, was Adorno 42 Michaela Homolka kritisiert, den – zu gut – verwahrten und von Nietzsche inspirierten Subtext einer Logik des Überflusses und des Schenkens bereithält. Gefolgt vom Abgrund, jenem unmöglichen und daher nach unten beschleunigten Standort, den Adorno paradox für sein Denken reklamiert, und an dem er sich allem zuwendet, was vor Furcht verhärtet und versteinert ist; und jenem Motiv des trennenden Abgrunds, für das Lukacs die Frankfurter Schule „Caffee Abgrund“ zu nennen liebte. Adorno negiert alle aufwärts und an systematischer Geschlossenheit interessierten idealistischen Bestrebungen; mit seiner Erkenntnis zielt er nach unten und folgt der Schwerkraft der Dinge nach – und darin ist er bis heute provokativ und materialistisch. Neben der Tradition des sokratischen Nichtwissens stehen: Iconoclash, Kritizismus, Nihilismus und Umwertung. Auschwitz, der Ort in Adornos Denken, mit dem er den Imperativ der Einmaligkeit unverrückbar installiert: „Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen: ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe.“3 Negativ auch der mythische Raum, den Odysseus durchirrt: „Mühselig und widerruflich löst sich im Bilde der Reise historische Zeit ab aus dem Raum, dem unwiderruflichen Schema aller mythischen Zeit.“4 Höhlen als Zwischenräume für den Widerspruch: „Die Ideen leben in den Höhlen zwischen dem, was die Sachen zu sein beanspruchen, und dem, was sie sind.“5 Amorbach, negativ als Hohlform der Erinnerungen heiler Kindheit. Die Eiswüste der Abstraktion, die es für den Philosophen wie für einen Polarforscher zu durchmessen gilt. Und nicht zuletzt das Bilderverbot als offen gelassene Stelle. An diesen spontan versammelten Beispielen zeigt sich eine für diesen großen Denker der Zeit eher unerwartete Vielfalt räumlicher Motive, die sich tatsächlich stringent dem negativen Duktus der Adornoschen Dialektik fügen und ihm Anschaulichkeit verleihen. Auch die zentralen Begriffe seiner Erkenntnismethode sind topologisch: Konstellation, Mittelpunkt und 3 4 5 ders., Negative Dialektik. In: GS, Bd. 6, S. 358. ders., Dialektik der Aufklärung. In: GS, Bd. 3, S. 66. ders., Negative Dialektik, a.a.O., S. 153. Nach Adorno 43 Durchgang durch die Extreme bilden eine Art Bausatz für die Konstruktion seiner kritischen Modelle. Konstellation, Mittelpunkt, Extrem Zur analytisch kritischen Methode, der Logik des Zerfalls, tritt in Adornos Philosophie der synthetische Aspekt der Konstellation hinzu. Sie ist eine Erkenntnisform, bei der der zentrale problematische Begriff einer Sache von außen, aus dessen geschichtlichem und gesellschaftlichem Kontext, erschlossen wird. Er bildet für Adorno eine Alternative zum identifizierenden, definierenden, hierarchischen Verfahren der traditionellen Philosophie. Das Identitätsdenken, von der Unberührbarkeit von Kants ‚Ding an sich’ aus betrachtet, gilt Adorno als mythisches Tabu fürs Subjekt: nicht an das zu rühren, was ihm nicht gleiche.6 Eine andere Analogie zum unkritisch identifizierenden Denken besteht für ihn im Vorgang des Fressens: „Durchweg verbindet es den Appetit des Einverleibens mit Abneigung gegen das nicht Einzuverleibende, das gerade der Erkenntnis bedürfte.“7 So demonstriert Adorno, dass das Denken noch kein eigentlich geistiges Stadium erreicht hat und, befangen in Urgeschichte, noch in Analogie zu den natürlichen Reflexen funktioniert. Ihm zufolge vermag Denken im Akt des Identifizierens nicht das Unauflösliche seiner Gegenstände zu Bewusstsein zu bringen und verschärft darin jenen Widerspruch von Allgemeinem und Besonderem, bei dem Adorno nicht stehen bleibt, und gegen den er seine Dialektik des Besonderen in dessen jeweiligem Zusammenhang entfaltet. „Nach dem dauerhaftesten Ergebnis der Hegelschen Logik ist es nicht schlechthin für sich sondern in sich sein Anderes und Anderem verbunden. Was ist, ist mehr, als es ist. Dies Mehr wird ihm nicht oktroyiert, sondern bleibt, als das aus ihm Verdrängte, ihm immanent. Insofern wäre das Nichtidentische die eigene Identität der Sache gegen ihre Identifikationen. Das Innerste des Gegenstandes erweist sich als zugleich diesem auswendig, seine Verschlossenheit als Schein, Reflex des identifizierenden, fixierenden Verfahrens. Dahin geleitet denkende Insistenz vorm Einzelnen, als auf dessen Wesen, anstatt auf das Allgemeine, das es vertrete.“8 Adorno vollzieht Hegels Gedanken, nach dem alles im Himmel und auf der Erde miteinander verbunden ist, mimetisch in einer erkenntnistheoreti6 7 8 ebd., S. 163. ebd. ebd., S. 164. 44 Michaela Homolka schen Intention nach. Wenn der Gegenstand aus dem Zusammenhang, in dem er steht, gedeutet wird, ist dieser Zusammenhang nicht ein rein äußerliches Nebeneinander, sondern bildet das Bedeutungsgeflecht, in dem der Gegenstand sich entäußert, nach. Diese Methode der Entfaltung von Konstellationen ermöglicht dem Denken den Ausweg aus dessen Selbstbezug. Bereits aus dieser knappen Betrachtung des Begriffs der Konstellation wird schon erkennbar, dass der Raum, in dem sie sich entfaltet, nicht als Totalität gesehen wird. Jedem Gegenstand wird sozusagen die Rekonstruktion seines eigensten geschichtlichen Raumes zugeschrieben, vergleichbar einem Kosmos en miniature, in dessen Mitte er wie in einem speziell für seine Erkenntnis angelegten zentralen Spannungsfeld steht. Adorno betreibt damit eine Wissenschaftskritik, die sich vor allem an den traditionellen Kategorien „Identität“ und „Totalität“ entzündet. Sein Denken benötigt statt des traditionellen Einheitsprinzips der Identität nur ein einheitsstiftendes Moment: „Das einigende Moment überlebt, ohne Negation der Negation, doch auch ohne der Abstraktion als oberstem Prinzip sich zu überantworten, dadurch, dass nicht von den Begriffen im Stufengang zum allgemeineren Oberbegriff fortgeschritten wird, sondern sie in Konstellation treten. Diese belichtet das Spezifische des Gegenstandes, das dem klassifikatorischen Verfahren gleichgültig ist oder zur Last. Modell dafür ist das Verhalten der Sprache. Sie bietet kein bloßes Zeichensystem für Erkenntnisfunktionen. Wo sie wesentlich als Sprache auftritt, Darstellung wird, definiert sie nicht ihre Begriffe. Ihre Objektivität verschafft sie ihnen durch das Verhältnis, in das sie die Begriffe, zentriert um eine Sache, setzt. Damit dient sie der Intention des Begriffs, das Gemeinte ganz auszudrücken.“9 Nach Adornos Diktum soll in der gelungenen Konstellation alles gleich nah zum Mittelpunkt zu stehen kommen. Allerdings hält er sich mit Auskünften über diesen Mittelpunkt bedeckt. Hegel benennt ganz am Anfang seiner Vorrede zu den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie den Mittelpunkt für das philosophiegeschichtliche Interesse als jenes Verhältnis, in dem die „scheinbare“ Vergangenheit mit der Gegenwart über den Kausalzusammenhang hinaus „auf eine eigentümliche Weise produktiv“10 ist. Die Anschaulichkeit der produktiven Wirksamkeit der Vergangenheit als des aus9 ebd., S. 164. 10 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, Werke, Bd. 18, Frankfurt/Main 1986, S. 20. Nach Adorno 45 dehnungslosen Raums entfaltet Adorno im Zentrum der Konstellation. Der Mittelpunkt oder Schnittpunkt von Vergangenheit und Gegenwart zentriert ein Spannungsfeld. Er findet seine zeitliche Entsprechung im Augenblick. Der Mittelpunkt ist die äußerste Zuspitzung des raumzeitlichen Motivs. Im Verhältnis von Begriff und Sprache wird die Isolation des Begriffs zugunsten seines Zusammenhangs aufgebrochen. Adorno nähert dadurch wiederum den Begriff Dialektik der Vielschichtigkeit des Wortes im Sinne der Dialektik der platonischen Dialoge an. Paradigmatisch scheinen für Adorno die Hegelschen Anmerkungen in den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie zur Bedeutung von Platos Dialogen zu sein: „... die Platonischen Dialoge sind nicht so beschaffen wie die Unterredung mehrerer, die aus vielen Monologen besteht, wovon der eine dies, der andere jenes meint und bei seiner Meinung bleibt. Sondern die Verschiedenheit der Meinungen, die vorkommt, ist untersucht; es gibt ein Resultat als das Wahre; oder die ganze Bewegung des Erkennens, wenn das Resultat negativ ist, ist es, die Platon angehört.“11 In der Bestimmung der ‚ganzen Bewegung des Erkennens, wenn das Resultat negativ ist,’ als Wahrheit, ist auch Adornos Konzeption erkennbar, die auf die Unabgeschlossenheit des Prozesses ihre Hoffnung setzt. Weiter unten heißt es bei Hegel: „Ich habe schon bemerkt, dass Platos Dialoge nicht so anzusehen sind, dass es ihm darum zu tun gewesen ist, verschiedene Philosophien geltend zu machen, noch dass Platos Philosophie eine eklektische Philosophie sey, die aus ihnen entstehe; sie bildet vielmehr den Knoten, indem diese abstrakten einseitigen Prinzipien jetzt auf konkrete Weise wahrhaft vereinigt sind. In der allgemeinen Vorstellung der Geschichte der Philosophie sahen wir schon, dass solche Knotenpunkte in der Linie des Fortganges der philosophischen Ausbildung eintreten müssen, in denen das Wahre konkret ist.“12 Da Adorno nicht vom Ding ausgeht, sondern von dessen Begriff, bevorzugt er die Sprache gegenüber der logischen Systematik als das ähnlichere, mimetische Mittel, sich dem Nicht-Identischen in seinem jeweiligen Zusammenhang zu nähern. Hegels Dialektik bezeichnet er dagegen als „eine ohne Sprache“: „Im emphatischen Sinn bedurfte er der Sprache nicht, weil bei ihm alles, auch das Sprachlose und Opake, Geist sein sollte und der Geist der Zusammenhang. Jene Supposition ist nicht zu retten. Wohl aber transzendiert das in keinen vorgedachten Zu11 12 ebd., 181. – Vgl. auch: L. Sichirollo, ∆ιαλεγσθαι Dialektik, Hildesheim 1966, S. 175. ebd., S. 175 bzw. 181 f. 46 Michaela Homolka sammenhang Auflösliche als Nichtidentisches von sich aus seine Verschlossenheit. Es kommuniziert mit dem, wovon der Begriff es trennte. Opak ist es nur für den Totalitätsanspruch der Identität; seinem Druck widersteht es. Als solches jedoch sucht es nach dem Laut. Durch die Sprache löst es sich aus dem Bann seiner Selbstheit.“13 Ist bei Adorno von Sprache die Rede, so steht nicht die Mitteilung im Vordergrund, sondern die plastische Darstellung; letztendlich ist es die Performance einer Kommunikation, nicht mit dem Leser, sondern dem Gegenstand, für den er eigens diese ideale Kommunikationssituation der Konstellation herstellt, und dem er das Vermögen der Kommunikation aus dessen Zusammenhang heraus zuspricht. Er kommuniziert also nicht über die Dinge, sondern mit den Dingen und für sie; von daher auch das Hermetische seiner Texte. Habermas hat diesem kommunikativen Prinzip dann eine völlig andere, intersubjektive Richtung gegeben. An diesen Begriffen: Verhältnis, Kommunikation, Sprache, Konstellation zeigt sich, wie anthropomorph der erkenntnistheoretische Aspekt von Adornos Denken geprägt ist. Neben und auch mit der Entfaltung von räumlichen Konstellationen nähert es sich beinahe unwillkürlich anthropomorphen und ästhetischen Kategorien. Allerdings ist die Kommunikationssituation, die er herstellt, trotz und gerade wegen seiner Bemühungen asymmetrisch, das Subjekt dem Objekt zunächst überlegen wie der Arzt dem Kranken oder wie die erfahrene Liebhaberin dem unerfahrenen Geliebten. Adornos Konzeption der Konstellation bezeichnet gewissermaßen das strukturelle Scharnier, an dem das Denken von der Systemkritik ab- und der Sprache zugewandt wird. Und von der Sprache aus ist es für Adorno, dem sich das Mehr der Dinge zuneigt, bloß ein winziger Sprung zur wortgewaltigen Rhetorik.. „Die Gewalttat des Gleichmachens reproduziert den Widerspruch, den sie ausmerzt.“14 Eines solchen Pathos des Gedankens sind wir Heutigen gänzlich entwöhnt; unvorstellbar heute die Wortgewalt Nietzsches oder dies Ätzende Voltaires. Nachdem man einen solchen Satz gelesen hat, bekommt man den Eindruck, man müsse die Begriffe aus deren Gefängnissen befreien, in denen sie, in Sträflingskleidung und mit Nummern versehen, in Reih’ und Glied 13 14 Th.W. Adorno, Negative Dialektik, a.a.O., S. 165. ebd., S. 146. Nach Adorno 47 zur Bewegung im Anstaltshof im Kreise gehen und auf Untaten sinnen. Die Vorliebe fürs Extreme hat bei Adorno Methode. War sie authentischer Ausdruck der zeitgenössischen Gefühlslage, so wurde sie als „Durchgang durchs Extrem“ Mittel negativer Dialektik und trug reziprok zur Steigerung der damals wohl zunehmend explosiven Gefühlslage bei. Und die Wahrheit der Übertreibung wurde ästhetisch moralisches Programm. „Während die hellen (Schriftsteller) das unlösliche Bündnis von Vernunft und Untat, von bürgerlicher Gesellschaft und Herrschaft durch Leugnung schützten, sprachen jene (die dunklen) rücksichtslos die schockierende Wahrheit aus. ‚...In die von Gattinnenund Kindermord, von Sodomie, Mordtaten, Prostitution und Infamien besudelten Hände legt der Himmel diese Reichtümer; um mich für diese Schandtaten zu belohnen, stellt er sie mir zur Verfügung’15, sagt Clairwil im Resümé der Lebensgeschichte ihres Bruders. Sie übertreibt. Die Gerechtigkeit ist nicht ganz so konsequent, nur die Scheußlichkeiten zu belohnen. Aber nur die Übertreibung ist wahr.“16 Die Affinität Adornos zum Extrem hängt sicherlich mit seiner Erfahrung des Dritten Reichs zusammen. Philosophisch vermittelt ist sie an den klassischen Kategorien der Totalität und Identität der subjektiven Philosophie, genauer gesagt: an deren, in Adornos Augen, totalen Identitätsanspruch. „... auch nur eingeschränkt, ist das Subjekt bereits entmächtigt. Es weiß, warum es im kleinsten Überschuß des Nichtidentischen sich absolut bedroht fühlt, nach dem Maß seiner eigenen Absolutheit. An einem Minimalen wird es als Ganzes zuschanden, weil seine Prätention das Ganze ist.“17 Meisterhaft führt hier Adorno den dialektischen Umschlag von der Totalität zur Nichtigkeit vor. Der Absolutheitsanspruch löst sich in Nichts auf. Soweit ist die These mitvollziehbar. Aber, dass dabei nicht auch das Subjekt „zuschanden“ wird, wie seine Rhetorik suggeriert, sollte festgehalten werden. Auf den ersten Blick ist die Radikalität seiner über das Ziel hinausschießenden Formulierungen verwunderlich. Doch über die Frage nach der Identität des Menschen, die im Roman, im Film wie auch in der Psychologie seit der Jahrhundertwende längst als Problem eingedrungen und thematisiert war, musste auf erkenntnistheoretischem Gebiet erst noch nachgedacht werden. Nietzsche wirft die Problematik der Identität erst auf. Bei ihm stellt sie sich mit einem geradezu theatralischen Ensemble von Charakteren im Zara15 16 17 M. de Sade, Histoire de Juliette, Hollande 1797, Bd, V, S. 319 f. Th.W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, a.a.O., S. 139. ders., Negative Dialektik, a.a.O., S. 184. 48 Michaela Homolka thustra dar. Kierkegaard schreibt in Pseudonymen. Adorno zeigt in seiner Philosophie das Bestreben, erkenntnistheoretisch die Höhe des modernen kulturellen Bewusstseins zu erreichen. Auch von daher ist sein Kampf gegen den subjektiven Identitätsanspruch und seine Demontage des Subjektbegriffs zu verstehen. Den von ihm proklamierten Vorrang des Objekts führt er nur darauf zurück, dass die Macht des Subjekts nicht absolut sei. Demnach ist er kein gewöhnlicher Kritiker der Macht und kein Anarchist – er ist ausschließlich der Kritiker absoluter Macht. Und nur von dieser äußersten Position aus, räumlich gesprochen, deren Entsprechung er im geschlossenen System sieht, ist er richtig zu verstehen. Und erst von hier aus stellt sich die Frage: Hat sich nicht der Systemgedanke vor ihm, Adorno, in den Plural geflüchtet?! Alexander von Pechmann Zwischen kritischer Moderne und Kritik der Moderne Zur Internationalen Adorno-Konferenz 2003 in Frankfurt/Main I. Zu seinem 100. ist Theodor Wiesengrund-Adorno in der Mitte der Gesellschaft angekommen, die zeit seines Lebens Abstand von ihm wahrte, wie auch er sich von ihr zu distanzieren trachtete. War es doch ihm, dem Judenkind Wiesengrund, Adorno, dem verworfenen Schreibtischtäter und auch Teddy, dem politischen Versager, weder in die Wiege noch ins Grab gelegt, dass seine Heimatstadt eine „Stabsstelle“ (sic!) einrichten wird, um mit Platz- und Denkmalseinweihung, mit Kongressen, Matineen und Abendveranstaltungen ihres nunmehr großen Sohnes zu gedenken; dass ihm die Feuilleton- und Kulturredaktionen nahezu aller deutschsprachigen Zeitungen und Magazine, Rundfunk- und Fernsehanstalten ausführliche Leitartikel widmen werden, die ihn zeitgemäß in der intellektuellen Landschaft von heute verorten; und dass von der Lektorenschaft der Großverlage bis zu den Pressen der Großdruckereien alles rotieren wird, um zur rechten Zeit ihre Adorno-Bücher auf dem aufnahmebereiten Markt zu platzieren. So sehr dem Menschen Adorno in den vergangenen Monaten auch gebührlich Achtung geschenkt wurde, und er als Intellektueller gar zu einem der geistigen Gründungsväter der Bundesrepublik avancierte – wie aber steht es um den Einfluss und die Wirkung seiner Theorie? Sind wir heute, wie einige vermuten, „nicht alle ein bisschen adorno“ oder gilt, dass in den Wissenschaften heute von Adorno nichts mehr zählt? Und in der Tat: sein Aufstieg ins Zentrum der Öffentlichkeit scheint mit seinem Abstieg an die Peripherie des Wissenschaftsdiskurses gekoppelt zu sein. Wo, so fragte Axel Honneth, der heutige Direktor des Instituts für Sozialforschung, zu Beginn der Frankfurter Adorno-Konferenz, wo sind die großen Entwürfe der Gegenwart, die sich auf Adorno beziehen? Angekündigt hatte die Götterdämmerung der „Kritischen Theorie“ sich bereits vor 20 Jahren, auf der mittlerweile legendären Konferenz zu Ador- 50 Alexander von Pechmann nos 80. Geburtstag. Fochten doch schon damals die hohen Priester der „Frankfurter Schule“ einen schier aussichtslosen Kampf gegen die Heraufkunft der neuen, der postmodernen Götter aus Frankreich. Und mit deren Herrschaftsbeginn musste die Rede von der einen, der total verwalteten Gesellschaft, deren einzig widerständiger Ort allein kritische Theorie sei, verblassen. An die Stelle der Gesellschafts- und Geschichtskritik trat nun die Arbeit der Dekonstruktion, die all die Ideen von einem irgendwie Ganzen in eine Pluralität von Macht- und Herrschaftsdiskursen zersetzte. Schon bald hielt die Post-Moderne selbst in Frankfurt Einzug, und die Rede vom Totalen und Universalen wurde als eine Mär aus alter Zeit belächelt. Musste doch selbst der frömmste Adornit einsehen, dass die große These des Meisters vom „universellen Verblendungszusammenhang“ weder den empirischen noch den logischen Kriterien genügen könne, weil doch dem je schon Überzeugten jeder Einwand gegen sie nichts anderes beweist als eben diese Verblendung, und weil ihr Sprecher den performativen Widerspruch begeht, sich selbst von der Verblendung ausnehmen zu müssen, die er gleichwohl als universell behauptet. So wurde denn auch Adornos Ganzes in seine Vielfalt zerstückelt, und seine Sätze zierten als ausdrucksstarke Ornamente die Arbeiten der Jüngeren. II. Wiederum 20 Jahre später ist nun auch die Postmoderne in die Jahre gekommen und scheint ihr Aufklärungswerk beendet zu haben. Seither herrscht ein ernsterer Zug zu begrifflicher Klarheit und analytischer Strenge, und eine pragmatische Ausrichtung aufs Gegebene hat im Wissenschaftsdiskurs Einzug gehalten. Und so konzentriert sich denn die Bezugnahme auf Adorno heute nicht mehr darauf, ihm all seine Irrtümer, Monstrositäten und heroischen Gesten vorzuhalten, sondern auf die Suche nach Ansätzen und Theoriestücken, die dem Gegenwartsdiskurs standhalten können und auf die heutige Lage als anwendbar erscheinen. Dementsprechend regierte denn die diesjährige Adorno-Konferenz zum 100. Geburtstag das große „Auch“ bzw. „Zwar – Aber“: einerseits bestehe zwar, so situierte sich der Soziologe Sighard Neckel in seinem Vortrag, der kapitalistische Fetisch- und Verdinglichungscharakter weiterhin; aber es gebe doch auch Individuen und Kollektive, die solchen Zwang durchbrechen, Autonomes kreieren und selbst mit den Mechanismen des Marktes spielen. An- Zur Internationalen Adorno-Konferenz 2003 in Frankfurt/Main 51 dererseits sei zwar festzustellen, dass sowohl die individuellen Chancen als auch die Vielfalt kultureller Ausdruckformen gewachsen seien, dass aber doch auch der Zwang zur Konkurrenz und der Druck zur Uniformität gestiegen sei. Lässt sich, so schlug Neckel vor, diese Gemengelage nicht im Begriff des „reflexiven Mitspielers“ erfassen, der unter dem „Regime der Selbstformung“ stehe? Da ist denn der Schritt nicht weit, Adorno selbst zum Urheber solch soziologischer Theoriebildung zu erheben. War es nicht Adorno, der, wie Josef Früchtl bemerkte, vom „Doppelcharakter“ der Moderne gesprochen habe, der zwar Misslingen, aber doch auch Gelingen beinhalte? Müssen wir daher die „Dialektik der Aufklärung“ nicht heute so lesen, dass sie die Moderne nicht eigentlich als einen Verfallsprozess beschreibt, sondern als Becksche „Risikogesellschaft“, die das entschiedene „Auch“ zum Thema hat, die Ambivalenz zwischen Handlungsfreiräumen und -zwängen, die dem einzelnen neue und höhere Anforderungen stellt? Und so bestand denn ein Großteil des Kongresses in dem Gesellschaftsspiel: eher gegen Adorno mit Adorno oder besser doch mit Adorno gegen Adorno. III. Neben diesen Anschlussbemühungen an den Stand der heutigen Sozialund Kulturwissenschaften zeigte der Kongress jedoch ein neu erwachtes Interesse, den Kern des Denkens Adornos aufzudecken; d.h. dessen Grundthesen nicht der Gegenwart vergleichend anzupassen, sondern ihren inneren Gehalt verstehen zu wollen und sie so in ihrem eigenen Kontext zu rekonstruieren. Dies wachsende Interesse muss allein deswegen als sinnvoll erscheinen, weil doch die Aktualität Adornos von heute morgen schon wieder ganz unaktuell sein mag, die Grundstruktur seines Denkens aber von bleibendem Interesse sein könnte. Freilich muss diese Zuwendung mehr als die Banalität zutage befördern, dass Adornos Philosophieren darin bestanden habe, dasjenige Leiden abschaffen zu wollen, das abgeschafft werden könnte. Oder dass für ihn, wie Raymond Geuss hervorhob, der Geist das Versprechen des Glücks sei und Philosophie daher nur vom Standpunkt solch gelungenen Lebens her möglich sei. Denn Zugänge dieser Art betten in ihrer Abstraktheit Adorno nur in den allgemeinen Strom der Philosophie ein; sie unterschlagen aber das Spezifische seines Denkens. 52 Alexander von Pechmann In dieser Hinsicht gehaltvoller war der Rekonstruktionsversuch von Martin Seel, der den Gebrauch untersuchte, den Adorno von zentralen philosophischen Begriffen machte. Sein Vortrag unternahm es, die allzu bekannten Schlagworte vom Denken des Nicht-Identischen, von Begriffen, die nicht aus-, sondern aufschließen, oder vom Vorrang des Objekts, anhand der erkenntnistheoretischen Grundbegriffe des Benennens und des Urteilens mit Inhalt zu füllen. Anders als die traditionelle formale Logik, der der Name als semiotisches Werkzeug dient, um den gemeinten Gegenstand zu identifizieren, zielt Adorno, so Seel, mit dem Benennen auf die Heraushebung der Individualität des Benannten. Der Akt der Namensgebung fixiere das Objekt nicht in der Gestalt eines Dings, sondern hebe es aus der Anonymität des Namenlosen heraus und mache es in seiner Einzigartigkeit und unvergleichlichen Besonderheit zum Gegenstand des Erkennens. Das Wort „Eigenname“ gebrauche Adorno nicht, um damit am Objekt ein bloß äußerliche Kennzeichnung und Etikettierung vorzunehmen, sondern um es darin in seinem Eigensein anzuerkennen. Was Adornos Rede vom „Vorrang des Objekts“ mithin meint, sei, dass schon im ersten Erkenntnisakt, der Namensgebung, das Objekt nicht einem festen Zeichen unterworfen wird, das den Gegenstand bedeutet (unum nomen, unum nominatum), sondern es in seiner unverwechselbaren Eigenheit zum Gegenstand gemacht wird. Dafür kann nun aber der Grund nicht darin liegen, dass das Einzelne, wie Aristoteles dies gesagt hat, als προτη ουσια sich dem Begrifflichen entzieht – und Adorno daher nicht den Universalienstreit neu aufzurollen gedenkt –, sondern dass das denkende Subjekt schon im Ursprung der Erkenntnis den Vorrang des Objekts, das uneinholbare Selbstsein des ihm Anderen, anerkennt. Die Folge solch ursprünglicher „Anerkenntnis“ ist freilich, dass der Gebrauch, den Adorno von den Begriffen im Urteil über den Gegenstand macht, kein „Zu-Griff“ ist, das ihn klassifizierend bestimmt oder als Einzelnes unter ein Allgemeines subsumiert, sondern dass er ihn als einen eröffnenden „Zu-Gang“ versteht, der im Verfahren der Prädikation die Sache in ihrer Eigentümlichkeit erst aufschließt und nicht, wie im Akt der Subsumtion, schon abschließt. Dass die Sache sich so verhält, wie das Urteil sagt, dass sie sich verhält, muss Adorno als ein unerträglicher Akt der Barbarei erscheinen, weil darin das Objekt mit dem Urteil gleichmacht wird. Solches Verfahren will das Objekt als Sache beherrschen, nicht aber in seinem Ei- Zur Internationalen Adorno-Konferenz 2003 in Frankfurt/Main 53 gensein vernehmen. Es denkt in festgestellten Lehrsätzen und fertigen Sachverhalten, nicht aber in Konstellationen der Begriffe, die das Objekt erund aufschließen. Ein solch offener und konstellativer Gebrauch der Begriffe nimmt sein Vorbild nicht an der Technik, sondern hat seine Affinität zur Musik. Das Unabschließbare, die Bewegung, so die New Yorker Philosophin Lydia Goehr in ihrem Vortrag, sei die Leitidee, die nach Adorno dem Denken wie der Musik innewohne. Diese Verbindung sei nichts bloß Biographisches, sondern prägend für Adornos Denkungsart. Sie setzt damit der kruden Vorstellung von der Logik als einem Werkzeug, das der Zurichtung der Objekte dient, die Unabschließbarkeit denkender Erkenntnis entgegen. So wie die Musik weder eine wirre Reihe von Tönen sei, sie ihre Wahrheit aber auch nicht in der Wiederholung eines gegebenen Schemas entfalte, sondern in der freien und doch gestalteten Exposition der Töne und Klänge, so sei auch das Denken weder beliebig noch gehorche es einem starren Schema, sondern folge der inneren Dialektik des Gedankens, der wird und nicht ist, und der über sich aufs Objekt hinausweist. So wie die Musik nie fertig ist, so ist auch die Philosophie, trotz Hegel, nie fertig. Freilich ist dieser unabschließbar dialektische Charakter des Denkens und damit die Relativität jeder gegebenen Erkenntnis, wie die anschließende Diskussion verdeutlichte, für Adorno weder in der geläufigen These gegründet, dass der Mensch eben nicht Gott, sondern ein endliches Wesen und Bescheidenheit daher eine ihm allemal hilfreiche Tugend sei, noch in der ebenso geläufigen These, dass die Welt – und erst recht die heutige Welt – so komplex und so undurchschaubar sei, dass ihre Erkenntnis allemal bruchstückhaft und vorläufig sein müsse, wie Andrea Kern dies zu verorten meinte. Man müsse es wohl vielmehr in dem grundlegend Moralischen in Adornos Denken sehen, das die Unverfügbarkeit des Objekts zum Grund aller denkenden Erkenntnis erhebt. Die Achtung vor dem Objekt verbietet, den Erkenntnisvorgang als abgeschlossen zu denken. IV. Was in erkenntnistheoretischer Sicht als Konstitution eines solch gewaltfreien Verhältnisses von Subjekt und Objekt gedacht wird, erscheint in soziologischer Hinsicht als Konstitution der Idee einer herrschaftsfreien Kommunikation. Tilman Allert, dem man nicht zuzustimmen braucht, wenn 54 Alexander von Pechmann er den Soziologen Adorno für heute als wertlos erachtet, versuchte dessen ungeachtet, hinter dem Gebäude kritischer Theoriebildungen gleichsam die Urform des Sozialen bei Adorno freizulegen, die, insbesondere in den „Minima Moralia“, als Idee einer gelungenen Kommunikation hervorscheint. In diesen Textstellen werde das Soziale nicht als eine Zumutung ans Individuum gedacht, die nur unter der Herrschaft der Vernunft gebändigt und erträglich wird; das Soziale werde hier aber auch nicht als eine zweckrationale Veranstaltung gedacht, die die sozialen Verhältnisse auf Macht und Herrschaft gründet, sondern als eine Beziehung freier Menschen, deren Band – in der Tat – die Liebe sei. „Liebe“, „Kuss“, „Duft“, „Aroma“ – dies seien die Metaphern, mit denen Adorno ausdeutet, was gelungene Kommunikation sein könnte. Diese Idee bildet, wofür Axel Honneth in seinem Referat den treffenden Ausdruck geprägt hat, Adornos „Urszene der Vernunft“. Ohne liebende Hingabe und Teilnahme wäre das Moralische bloß äußerlich auferlegte Pflicht, und das Epistemische nur unilaterales Verfügungsdenken. Adorno selbst hat diese gemeinte „Urszene der Vernunft“ nur an- und bisweilen in der Erinnerung gelungener Kindheit ausgedeutet. Dies muss freilich umso bedauerlicher erscheinen, als er angesichts dieser Einsichten nun nichts mehr zum Paulus-Wort sagen kann: „... und hätte ich der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle.“ Nach all diesen Rekonstruktionsbemühungen des „Eigentlichen“ mag es selbst dem eingefleischtesten Adorniten schwindeln, der in solchem Taumel der Begriffe und Relationen doch das Feste und Kritische vermisst. Sie machen jedoch zumindest die inneren Antriebe verständlich, die sowohl Adornos kategorische Aussagen über das intrinsisch Verkehrte der Gesellschaft wie auch seine diesbezügliche Unnachgiebigkeit motivieren. Sie erhellen, dass und warum Adornos kritische Gesellschaftstheorie, wie Axel Honneth ausführte, eigentlich nichts anderes gewesen ist sei eine „Pathologie der Vernunft“. Er habe zur Analyse des Verdinglichungscharakter, dem in der Tauschgesellschaft alles, was doch für sich einzeln ist, nivellierend unterworfen ist, die gleichsam idealtypischen Begriffe entwickelt, wie den der „Organisation“, der „Kulturindustrie“, des „kollektiven Narzissmus“ oder der „Halbbildung“. Diese waren ihm die diagnostischen wie therapeutischen Mittel, um hinter der scheinbaren Rationalität und Vernünftigkeit der Gesellschaft deren pathologische Tiefenstruktur sichtbar und um in der Alltäglichkeit der modernen Welt das Leiden erfahrbar zu machen. Dazu sei Zur Internationalen Adorno-Konferenz 2003 in Frankfurt/Main 55 er den historischen Ursprüngen nachgegangen, um den Mechanismus zu durchschauen, der das immer wiederkehrende Verhängnis der pathologischen Verkehrung des an sich Vernünftigen ins Gegenteil bewirkt. Und er habe sich kritisch mit den großen philosophischen Systemen auseinandergesetzt, um in ihnen dieses Umschlagen der Vernunft in Gewalt, der Autonomie in Herrschaft und Unterdrückung aufzudecken. Der Blick auf jene „Urszene der Vernunft“ kann aber auch – was auf der Konferenz zu kurz kam – darüber aufklären, dass die für Adorno unerträgliche Antinomie zwischen der realen Ohnmacht jener „wahren Vernunft“ und der faktischen Herrschaft einer allemal „pathologischen Vernunft“ offenbar durch die Vernunft selbst nicht aufgelöst werden kann. Denn da die pathologisch verkehrte Form, die der herrschenden Rationalität eignet, ihre Ursache nicht in der Vernunft selbst haben kann, vermag Vernunft es nicht, das Leiden, das Philosophie doch abschaffen soll, abzuschaffen. Adorno fehlt – worauf Axel Honneth kurz anlässlich der Adorno-LukácsDebatte hinwies – solch daseinsfrömmiger Optimismus. Sein Philosophieren bedarf daher der Idee des Noch-nie-dagewesenen, das gleichwohl als ein Anders-Mögliches notwendig zu denken ist, um jenes Unerträgliche aufzulösen. V. Solch hermeneutische Entschlüsselungsversuche der Fundamente adornitischer Theoriebildung scheinen endgültig das Urteil zu bestätigen, dass mit solcher Philosophie heute nichts mehr anzufangen ist. Dass dem nicht so ist, zeigte der nachdenkliche Vortrag von Jürgen Habermas, der, wenn ich ihn recht verstehe, bisher eingenommene Positionen vorsichtig einer Revision unterzieht. War es Habermas doch, der die „kritische Theorie“ dadurch anschlussfähig an die Moderne machte, dass er die Idee des einen und universellen Leidens- und Verblendungszusammenhangs verabschiedete, indem er klar und auch deutlich zwischen zwei „Vernunftsphären“ unterschied: zwischen der Sphäre strategisch-technischer Naturbeherrschung und der Sphäre vernunftgeleiteter Kommunikation. Wenn nun aber, so seine geäußerte Befürchtung, der Bereich technischer Naturbeherrschung heute so weit gediehen ist, dass ihm auch die natürlichen Fundamente des Kommunikativen verfügbar werden, wenn also das, was traditionell unter der Personalität autonomer Vernunftsubjekte verstanden wurde, zum tech- 56 Alexander von Pechmann nisch manipulierbaren Gegenstand verwandelt wird, dann fällt die Basis weg, auf der jene Trennung der Sphären ihren Sinn hatte. Verhält es sich so, dass in absehbarer Zeit das, was in der Sphäre der Kommunikation den Teilnehmer als ein innerer Vorgang, als ein mentales Ereignis, erscheint, wie dies etwa die Suche nach guten Gründen ist, in die Sphäre der Naturbeherrschung als Beobachtung eines kausalen Mechanismus hinreichend genau transformiert werden kann, dass also das bislang Unverfügbare verfügbar wird, dann gibt es für Habermas’ Theorie der Moderne ein Problem. Denn es könnte sich dann doch Adornos Konzept der Moderne als gerechtfertigt erweisen, das keinen Dualismus jener Sphären, sondern zwischen der Beherrschung der Natur einerseits und der Unterdrückung der Freiheit andererseits einen inneren Zusammenhang angenommen hatte. Habermas hat in seinem Vortrag „Ich selber bin ja ein Stück Natur“ diese Konzeption Adornos selbst zum Thema gemacht, ohne daraus allerdings die Konsequenzen zu ziehen. Wenn er an anderen Stellen jedoch eher soziologisierende Hinweise auf das Potential der Religionen gegeben hat, die das Bewusstsein des Unverfügbaren in der Moderne noch wachhalten können, dann deuten sie darauf hin, dass Adornos Konzeption einer „pathologischen Vernunft“, die in sich einen Mechanismus enthält, was Freiheit ist, in Beherrschung zu transformieren, vielleicht mehr Problembewusstsein und ‚Wahrheit‘ enthält, als die Apologeten einer noch so reflexiven Moderne es sich gedacht haben. Angesichts des Problems, dass es die Moderne selbst ist, die das Unverfügbare verfügbar macht, müssen Habermas’ Rückgriffe auf die Traditionsbestände der Religionen jedenfalls als theoretisch unausgereift und vorläufig erscheinen. Es könnte sein, dass sich statt solch halbherziger Rückgriffe aufs Divinatorische die Idee Adornos doch als zukunftsträchtiger erweist, die die Anerkennung des unverfügbar Anderen an den Anfang aller Moral und aller Naturerkenntnis stellt. Diese Idee erscheint heute freilich nicht als „anschlussfähig“; denn sie würde das reflexiv moderne „Auch“, das die Konferenz weitgehend regierte, beenden. Die Folge wäre – wieder – eine Fundamentalkritik moderner Praxis. Percy Turtur Notizen zur Internationalen Adorno-Konferenz Heute braucht eine Konferenz zu Theodor W. Adorno schon einen Anlass – der 100. Geburstag erzwang nach 20 Jahren eine derartige intellektuelle Pflichtübung an einer der Wirkungsstätten das Jubilars, der Johann-Wolfgang-von Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Es sollten sich in erster Linie nicht die Anhänger (soweit noch vorhanden), sondern „theoretisch avancierte Vertreter der jeweiligen Spezialdisziplinen“1 dieser geistigen Gymnastik unterziehen. Die Atmosphäre auf der Adorno-Konferenz war angenehm, entspannt, mit Studenten, die rege dabei waren und nicht versäumten, ihren Unmut über die allgegenwärtigen Kürzungen, speziell bei den Geisteswissenschaften, lautstark zum Ausdruck zu bringen. Es war möglich, mit jedem zu reden, an den man Fragen hatte – so es denn noch Fragen gab: *** Steht Jürgen Habermas noch auf dem Boden der Kritischen Theorie Theodor W. Adornos, der schließlich sein Lehrer war? – Einiges spricht dafür: Auch wenn sich die „Theorie des kommunikativen Handelns“ (TkH) weitgehend von der Art der Theoriebildung der früheren Kritischen Theorie gelöst hat, so geht sie, scheint mir, immer noch auf ein Ganzes. Auch wenn sie zergliedert, in Lebenswelt und Sphären des (zweckrationalen) Handelns, so versucht sie doch auch wieder, die verschiedenen Bereiche zusammenzufügen. Traditionelle Theorie, nicht erst seit Adorno, aber von ihm und Horkheimer trefflich analysiert, zergliedert ihren Gegenstand und ist es zufrieden, Ergebnisse zu erhalten, die sich in die jeweiligen Bereiche einpassen. Die Kommunikationstheorie in der Version von Habermas geht anders vor: sie macht sich diese Art der Zergliederung auch selber zum Thema. 1 So zu lesen in dem Veranspaltungsplan, der vorab im Internet einzusehen war: http://www.ifs.uni-frankfurt.de/veranstaltungen/2003/adorno.htm 58 Percy Turtur Noch Fragen? – Gibt es in der TkH einen Ort für das „ganz Andere“ Adornos? – Wenn nein, kann man Habermas getrost aus dem Umfeld Kritischer Theorie entlassen – sie ist, um im Jargon zu sprechen, „ins Affirmative gekippt“ (wie aus mittelprächtigem Wein Essig wird bei der Lagerung). – Wenn ja, dann wird man wohl im Umfeld des „herrschaftsfreien Diskurses“, der idealen, nicht verzerrten Sprechsituation suchen müssen. Die Frage, die sich dann stellt, ist, ob der „herrschaftsfreie Diskurs“ bereits das ganz Andere der herrschenden Misere ist – oder ob er lediglich die Voraussetzung dafür ist, aus einem ganz Anderen ein Etwas zu machen, das zur gesellschaftlichen Realität gehört. Dieses Utopie-Konstrukt würde dann dem ähneln, was Marx einmal über die menschliche Geschichte bemerkt hat: sie würde dann beginnen, wenn die Menschheit die gegenwärtige (und sie ist immer noch so gegenwärtig wie vor anderthalb Jahrhunderten) Malaise endlich überwunden hätte und sich alle Individuen in ihrer Gesellschaft so frei bewegen könnten, wie es ihnen zusteht. Dann wird man über das ganz Andere reden (können) ... *** Wie war das noch mit der Literaturtheorie? – Dazu hatte Jan Philipp Reemtsma Substanzielles beizutragen: Auch wenn nur 10% der Schriften Adornos sich damit befassen, so ist das doch noch eine ganze Menge und ein Steinbruch für den Germanisten: Eine gescheiterte Theorie des Romans (weil allzuviel an nicht nur modernen Romanen damit kaum vereinbar ist, meint Reemtsma), „agonale Aufsätze“ wie der „Versuch, das Endspiel zu verstehen“, die ihren Gegenstand noch übertreffen an Schwerverdaulichkeit – und letzlich immer das Primat der Philosophie, der Ästhetik über die Literaturwissenschaft. Glücklich kann damit kein gestandener Germanist sein. Zum Glück bietet Adorno ausreichend Ansatzpunkte, ihn mit seiner eigenen Rhetorik zu schlagen, wie Reemtsma es vormacht. Also doch das Primat der Theorie über ihre Anwendung? *** Was ist mit der „Dialektik der Aufklärung“? – Naja, sie ist halt eine Vorstudie, eine Materialsammlung, wie sich im Workshop von Gunzelin Schmid Noerr herausstellt. Die Aufklärung habe einen prozessualen Charakter, den man nicht stillstellen dürfe. Man dürfe eben die negativen Momente der Notizen zur Internationalen Adorno-Konferenz 59 Vernunftkritik nicht absolut setzen. Dass das Plus und Minus der Aufklärung sich nicht aufrechnen lassen, diese „unaufhebbare Ambivalenz“ sei die große Stärke der DdA. In der Diskussion stellte jemand sich (und uns) ernsthaft die Frage, ob das Ding nicht besser „Ambivalenz der Aufklärung“ geheißen hätte – oder doch lieber nicht. Sogar zum „Ökosophen“ wird Adorno – frei nach Sloterdijk.. Oder vielleicht doch besser „Paradox der Aufklärung“? Lieber nicht. *** Hat die Kritische Theorie, hat speziell Adorno noch Auswirkungen auf die moderne Pädagogik? – Ja, aber... Natürlich verdankt die Erziehungswissenschaft Kritischer Theorie viel – besonders, würde ein konservativer Pädagoge wohl sagen, dass heutzutage die Schrazen2 ihren armen Erziehungsberechtigten auf dem Kopf herumtanzen und vor nix Respekt erweisen. Natürlich hat anti- und unautoritäre Erziehung ihre Wurzeln auch in der Kritischen Theorie; alle Versuche, einen funktionalen Ansatz in die Erziehungstheorie zu bringen, scheinen nicht so recht zu funktion(alis)ieren. In gewisser Hinsicht sei die moderne Pädagogik, meint Frank-Olaf Radtke, tatsächlich weiter: der Begriff vom zu pädagogisierenden Subjekt sei bei Adorno noch recht traditionell. Auf der anderen Seite sei aktuelle Pädagogik heute oft mehr „Schadensbegrenzung“ gesellschaftlicher Mißstände als wirkliche „Erziehung zur Mündigkeit“ in dem Sinne, den der Begriff noch bei Adorno hatte. Inzwischen haben die Produkte der antiautoritären Erziehung (die heutigen Mitdreissiger) einen regelrechten Hass auf ihre Erzieher aus den 68ern entwickelt, den sie in Elternbeiratssitzungen und Feuilletons auslebten. Die gute Nachricht: Zu den repressiven Erziehungsmodellen unserer Jugend führt jedenfalls so recht kein Weg mehr zurück – und das ist doch schon was, oder nicht? *** Was ist denn nun mit der Soziologie? – Sieghart Neckel stellte eine Rekonventionalisierung soziologischer Forschung in den letzten Jahren fest. Der heutige „reflexive Mitspieler“ sei sich seiner Stellung in der Gesellschaft durchaus bewußt und dürfe nicht als „leeres Subjekt“ missverstanden wer2 bayerisch für: der mehr oder weniger erwünschte Nachwuchs in nicht volljährigem Zustand 60 Percy Turtur den. Er passe sich grade eben durch seine Individuierung an. Tilman Allert erklärte die Minima Moralia zum „begrifflichen Potential für eine Soziologie der elementaren Formen“: Adorno sei im Haus der Soziologie, die nur Soziologie sein will, angekommen, endlich. Naja, meint Axel Honneth im Schlussplenum, die Kapitalismuskritik der Kritischen Theorie sei weder eine deskriptive noch eine normative Theorie in dem Sinne, in dem Theorien heutzutage normiert werden – sie sei halt eine „Hermeneutik verfehlter Lebensform“. Peter Wagner forderte von einer „kritischen Gesellschaftstheorie“, sie müsse für die diversen Ausformungen kapitalistischer Gesellschaften verschiedene Deskriptionen bereithalten. Wie auch immer. *** Noch Fragen? Natürlich, die Entscheidende: Wie hältst Du’s mit der Theorie? – In Frankfurt fanden sich neben den üblichen Verehrern, vor denen Adorno zu schützen schon der intellektuelle Anstand gebietet, unter den Vortragenden und Diskutierenden Etliche, die den 100-Jährigen nebst seiner Theorie pietätvoll zu Grabe tragen wünschten. Still, mit etwas Melancholie, leise, auf dass der „tote Hund“ nicht etwa erwache und sie beiße. Diese Fraktion hatte vor allem unter den Soziologen und Philosophen aus Frankfurt ihre Anhänger. Andererseits gibt es in der in ihrem Gesamtzusammenhang so sperrigen Theorie doch etliches, was man gerne ausgeschlachtet und einem intellektuellen Recycling zugeführt hätte. Die Wissenschaftler aus Bereichen, die nicht ganz so „dem Ganzen“ verpflichtet sind, haben mit derlei Theorie-Aufarbeitung (und Ausbeutung) ohnehin weniger Probleme: Seit Jahrhunderten ist es in den Einzelwissenschaften üblich und legitim, nicht nur die empirischen Überlieferungen, sondern auch Fragmente von Theorien so lang weiter zu verwenden wie sich nichts Bess'res findet. Genau dieser Umgang mit „Wirklichkeit“ beschreibt einen Teil dessen, was der verblichene Jubilar als „Verdinglichung“ bezeichnete und kritisierte – vor allem dann, wenn er auch von Intellektuellen gepflegt wird, die doch dem Ganzen verpflichtet zu sein die Verpflichtung hätten. *** Noch Fragen? Besprechungen Bücher zum Thema Theodor W. Adorno Ontologie und Dialektik (1960/61). Nachgel. Schriften Abt. IV, Vorlesungen Bd. 7, hg. von R. Tiedemann und Th.W. Adorno-Archiv, Frankfurt/Main 2002 (Suhrkamp), Ln., 440 S., 32.80 EUR. Vorlesung über Negative Dialektik (1965/66). Nachgel. Schriften, Abt. IV, Vorlesungen Bd. 16, hg. von R. Tiedemann und Th.W. Adorno-Archiv, Frankfurt/Main 2003 (Suhrkamp), Ln., 358 S., 32.80 EUR. Die beiden, jetzt in den Schriften aus dem Nachlass zugänglichen Vorlesungen „Ontologie und Dialektik“ vom Wintersemester 1960/61 und „Über Negative Dialektik“ vom Wintersemester 1965/66 dokumentieren, zusammen mit den Vorlesungen zur „Metaphysik. Begriff und Probleme“ (SoSe 1965, Suhrkamp 1998) sowie „Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit“ (WiSe 1964/66, Suhrkamp 2001), Adornos Arbeit am Hauptwerk „Negative Dialektik“ (1966). Sie sind insofern Propädeutik und Kommentar, Einführung und Exkurs in das kritisch-theoretische Projekt einer Logik des Nichtidenti- schen. Die beiden jetzt vorliegenden Vorlesungen umkreisen mit dem Themenkomplex Ontologie und negative Dialektik das Grundgerüst von Adornos philosophischem Hauptwerk (während die beiden anderen Vorlesungen die drei abschließenden „Modelle“ der ‚Negativen Dialektik’ explizieren und ergänzen). Namentlich steht dabei, wie auch in der ‚Negativen Dialektik’ selbst, die Auseinandersetzung mit der Fundamentalontologie Martin Heideggers im Vordergrund. Der rote Faden, der sich durch die beiden Vorlesungen zieht, wird aus dem antinomischen Begriffspaar „Ontologie und Dialektik“ gebildet; in der ‚Negativen Dialektik‘ kulminiert dies bekanntlich in der Formulierung einer Dialektik als Ontologie des falschen Zustands. Das heißt nun nichts anderes, als die Prozesslogik mit der Seinslehre in Konstellation zu bringen, das Dasein selbst nicht statisch zu nehmen, sondern geschichtlich zu entfalten. In diesem Sinne formuliert Adorno in einer ersten Notiz zum Arbeitsvorhaben: „Hauptmotiv: dass Ontologie nicht geschichtsfrei gefunden werden kann und nicht geschichtsfrei ist.“ (OD, 425) Aus diesem nur prozessual zu 62 Bücher zum Thema denkenden Begriff der Ontologie resultiert bereits die Verbindung zur Dialektik. Das Verhältnis von Ontologie und Dialektik ist bereits ein dialektisches, ein vermitteltes Verhältnis von Gegensätzen. (In diesem Zusammenhang wäre es für eine materialistische Theorie durchaus von Interesse, Adornos Ansatz mit Blochs utopischer Figur einer prozessuallogisch verstandenen Ontologie des Noch-Nicht zu diskutieren.) Unkritisch ist Heideggers Philosophie freilich dort, wo die Ontologie verdinglicht wird durch den Schematismus des Ausschlusses, der Dialektik annulliert (Heidegger vollzieht diesen Schritt in den Schriften nach ‚Sein und Zeit’). Adorno dagegen insistiert auf der immanenten Kritik bzw. der Kritik der Immanenz. Immanente Kritik ist dabei mehr als nur Methode: „Der Weg“, so Adorno, „der Sie zu dialektischem Denken und zu einigen dialektischen Modellen geleiten soll, ist – wie wir das in der Dialektik zu nennen pflegen – der Weg der immanenten Kritik.“ (OD, 12) Er erlaubt es, die Momente der kritischen Theorie mit ihren Extremen, etwa der Existenzphilosophie Heideggers, in Berührung zu bringen; denn in gewisser Hinsicht bezeichnet die Dialektik selbst schon das radikale Denken der Extreme. Sie sprengt, was Ontologie immer schon supponiert, nämlich die falsche Unmittelbarkeit, die unvermittelte Immanenz. Wo Heidegger im Rückgriff, ja in der philosophischen Regression, die Frage nach dem Sinn des Seins als das eigentliche ontologische Problem, als erste Philosophie, zu reformulieren versucht, transzendiert Adorno die Frage wie das Problem: durch die Forderung, wie sie im ‚Jargon der Eigentlichkeit’ (ebenfalls eine Studie im Kontext der ‚Negativen Dialektik’) sich herauskristallisiert, einer letzten Philosophie. Als eine solche letzte Philosophie konfiguriert sich das Konzept der „negativen Dialektik“; sie ist, wie es in der ‚Vorlesung über Negative Dialektik’ heißt, „mit einer kritischen Theorie im Wesentlichen dasselbe“ (VND, 36). Hier berührt allerdings die Philosophie die Bereiche der kritischen Gesellschaftstheorie: Die Forderung nach einer letzten Philosophie ergibt sich nicht aus einem formal-logischen Argument, sondern aus der sachlichen Notwendigkeit der bestehenden Verhältnisse. „Sie können sagen: warum muss philosophiert werden, – und darauf kann ich Ihnen eine Antwort nicht geben. Aber immerhin: wenn man eine solche Nötigung überhaupt verspürt, dann ist sie ohne ein Moment des Vertrauens auf die Möglichkeit des Ausbruchs nicht zu vollziehen. Und dieses Vertrauen selbst ist ja wohl nicht zu trennen von dem utopischen Vertrauen darauf, dass es – also: das nicht schon Zugerichtete, nicht Veranstaltete, nicht Verdinglichte – nicht eben doch soll möglich sein können.“ (VND, 111) Dialektik indes vermag Ontologie nur einzuschließen, wenn sie auf das Exzentrische der Seinsanalyse rekurriert, auf Utopie. Insofern bündelt Adorno in der ‚Negativen Dialektik’ die Ontologie des falschen Zustands auch im utopischen Licht eines besseren: „angesichts der konkreten Möglich- Anstoß Adorno keit von Utopie“, wie es in der ‚Negativen Dialektik’ heißt. Wie bereits die anderen, bereits veröffentlichten Bände der Schriften aus dem Nachlass sind auch diese sorgfältig editiert und mit umfangreichen Kommentaren und Registern versehen. Insbesondere für diese beiden Vorlesungen gilt – wie im Übrigen schon für die zur ‚Einleitung in die Soziologie’ (Suhrkamp 1993) –, dass sie zur Einführung in die kritische Theorie Adornos zu empfehlen sind. Sie machen äußerst lebendig exemplarisch, inwiefern Adornos negative Dialektik mit seiner kritischen Theorie der gegenwärtigen Gesellschaft verschränkt und nur mit ihr zusammen zu denken ist; bzw.: dieses Zusammen-Denken der Momente ist nichts anderes als kritische Theorie. Roger Behrens Theodor W. Adorno / Thomas Mann: Briefwechsel 1943-1955. Hg. von Chr. Gödde und Th. Sprecher (Briefe und Briefwechsel. Hg. vom Theodor W. Adorno Archiv, Bd. 3), Frankfurt/Main 2002 (Suhrkamp), 180 S., 24.90 EUR. Der Briefwechsel ist zunächst zentriert um die Anfänge der Beraterschaft Adornos, zur Zeichnung von Komponistenfigur und Werk des „Adrian Leverkühn'' (Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde). Nach Erscheinen des Romans 1947 und weiter nach Erscheinen der „Entstehung des 63 Doktor Faustus. Roman eines Romans“ (1949) stand eine Beschäftigung mit ablehnenden Stellungnahmen im Vordergrund, insbesondere mit den Plagiats- und Inkompetenzvorwürfen Arnold Schönbergs zu den Schönberganleihen und zu der Motivund Figurenmontage (Faust; Nietzsche; Schönberg) überhaupt. Diese Linien des sorgfältig edierten und ausführlich kommentierten Briefwechsels sind extrapoliert zu Erörterungen musik- und literaturtheoretischer Fragen und zu philosophisch ästhetischen Positionen zur Moderne und deren Avantgarde. Durchgehend beschäftigen sich Th. Mann und Adorno mit politischen Themen, mit der Nachkriegslage und mit Entscheidungen zu einer Rückkehr aus dem amerikanischen Exil nach Europa, der Th. Mann weitaus pessimistischer gegenübersteht als Adorno. Eine Rückkehr „nach Deutschland“ ist für ihn ausgeschlossen. Aus Zürich schreibt er am 1. Juli 1950: „Nach Deutschland bringen mich keine zehn Pferde. Der Geist des Landes ist mir widerwärtig, die Mischung aus Miserabilität und Frechheit aufgrund vorzüglicher Aussichten abstossend. Man ist im Grunde das Vorzugskind der Welt. Amerika steht dahinter ...“ Zu den thematischen Akzenten des Briefwechsels schreiben die Herausgeber in ihrer „Nachbemerkung“ von einem Spannungsfeld zwischen Tradition und Avantgarde, zwischen Vergangenheit und Moderne, in welchem sich „die Vertreter zweier Generationen und unterschiedlicher ästhetischer Prägung“ auf eine überraschende Weise verbunden sahen. 64 Bücher zum Thema Nach einer Lektüre von Adornos „Spätstil Beethovens“ (veröffentlicht 1937) bittet Th. Mann im Brief vom 5. Okt. 1943 um eine kleine Skizzierung des Arietta-Themas aus Beethovens Sonate op. 111 (vgl. Anhang des Bandes). Durch Adornos Text sieht sich Th. Mann inspiriert zur Gestaltung der Vorträge „Wendell Kretzschmar“ und zu Beethovens letzter Klaviersonate, denen „Adrian Leverkühn“ zuhören soll. Die Vorträge sollen Überlegungen eröffnen, „dass, wenn Tod und Grösse zusammentreffen, ein Objektivismus (mit Neigung zur Konvention) entsteht, in dem das Herrisch-Subjektive ins Mythische übergeht“: „Ich brauche musikalische Intimität und charakterliches Détail und kann sie nur durch einen so erstaunlichen Kenner wie Sie gewinnen.“ Des weiteren hatte Adorno im Juli 1943 Th. Mann ein Typoskript des ersten Teils (Schönberg und der Fortschritt) seiner „Philosophie der neuen Musik“ (Erstveröffentlichung 1949) zukommen lassen. Th. Mann notierte in sein Tagebuch: „Augenblicke der Vermutung, wie Adrian zu stellen sei“. Adorno, ehemaliger Kompositionsschüler von Alban Berg und vor seiner Habilitation mit einer Arbeit über Kierkegaard tätig als Musikkritiker und -theoretiker, unter anderem als Redakteur der Wiener Zeitschrift „Musikblätter des Anbruch“ (19281931), war mit der Schönberg-Schule und den Entwicklungen der Musik seiner Zeit bestens vertraut. Er sah Schönbergs atonales Komponieren, dessen Zwölftontechnik, einerseits als rationalisierende Befreiung von dis- funktionalen romantischen Konventionen. Andererseits sah er eine Gefahr des Umschlagens in Unfreiheit, in eine entsubjektivierende, bloß technische Perfektion der Materialbeherrschung und in „Barbarei“. Analog zur zusammen mit Max Horkheimer verfassten „Dialektik der Aufklärung“ (1947), zur erkenntnisund gesellschaftstheoretischen Konstruktion eines Umschlagens von Aufklärung ins Mythische, misst Adorno der musikalischen Avantgarde eine aporetische Stellung bei. Zu Authentizitätsfragen heißt es: „Vielleicht wäre authentisch erst die Kunst, die der Idee von Authentizität selber, des so und nicht anders Seins, sich erledigt hätte.“ (Philosophie der neuen Musik, Frankfurt/Main 1975, 196) Sich eines erzwungenen Dilemmas entledigen zu wollen, führe schließlich zur Reaktion und zu scheiternden Restaurationsbestrebungen. Am 30./31. Dez. 1945 bittet Th. Mann Adorno um Vorschläge, „wie das Werk – ich meine Leverkühns Werk – ungefähr ins Werk zu setzen wäre; wie Sie es machen würden, wenn Sie im Pakt mit dem Teufel wären ...“ Ihm schwebe „etwas SatanischReligiöses, Dämonisch-Frommes, zugleich Streng-Gebundenes und verbrecherisch Wirkendes vor.“ Adorno arbeitete seine Vorschläge aus (vgl. Anhang des Bandes), und beide blieben über die Ausgestaltung im Roman im Austausch. Adorno sah sich als Komponist gefordert, wie „vor die Aufgabe gestellt ..., diese Werke selbst zu schreiben“. So in einem Brief vom 19. April 1962 an Erika Mann. Gewiss ist – nach dem durchgängi- Anstoß Adorno gen „Prinzip der Montage“ (Th. Mann) gearbeitet – die Figur Leverkühns das Werk des Romanciers. Rätselhaft bleibt jedoch, wie unbedarft die Konstruktion der diabolischen und avantgardistischen wie archaischen Figur materialiter mit Schönbergs Kompositionsweise ausstaffiert wurde; – und dies erst in den Romanausgaben seit 1948 mit einem Vermerk ausgewiesen. Im Blick auf Th. Manns Arbeit an der „Entstehung des Doktor Faustus“ bittet Adorno in einem Brief vom 5. Juli 1948 darum, seinen „gedanklich-phantasiemäßigen Anteil an Leverkühns oeuvre und seiner Ästhetik mehr hervorzuheben als den stofflich informatorischen“. Was genauer wäre unter diesem „Anteil“ zu verstehen? Es liegen einige Fragen nach den Adornoschen Werkhintergründen nahe. Mutete Adorno einer Adaption der Grundfigur der „Dialektik der Aufklärung“ (Rationalität/Mythos) an eine Kunstphilosophie zu Produktionen seiner Zeit zu viel zu? Mündete daher ein dialektisches Bestreben des Ästhetikers in eine polarisierende „Philosophie der neuen Musik“, von der sich letztlich über eine nachschönbergsche Avantgarde der seriellen Musik nur wenig ausmachen ließ? Zumindest ein Umstand, auf den Adorno später, 1961, mit seinem einflussreichen Vortrag „Vers une musique informelle“ antwortete, bemüht, eine strenge Reihentechnik mit einer freien Atonalität zu „versöhnen“? Aber was hieß „versöhnen“? Hatte nicht der (früh-)neukantianisch geprägte Theoretiker Adorno Schwierigkeiten, 65 Äquivokationen einer rezeptionsästhetischen und einer produktionsästhetischen Ausrichtung zu vermeiden? Mit dem Beitrag zum „Doktor Faustus“ werden deutlich Reflexionsergebnisse mit einer (Mit-)produktion des Reflektierten verbunden. Dass historiographisch wie ästhetisch die eingreifende Zeichnung der Schönbergschen Avantgarde zu starr geraten ist, fällt Adorno später auf. Am 25. Aug. 1951 und anlässlich des Todes von Schönberg im Juli 1951 schreibt er an Th. Mann von einer „seltsamen Lockerung“ im Spätwerk, die auch Früheres anders erscheinen lässt, ganz wie Schönberg dies in seinem letzten Buch (Style and Idea, New York 1950) ausgedrückt habe: „... daß es die Aufgabe der Musik sei, die Spannungen, die sie enthält, durch ihre Totalität auszugleichen“. „Im Grunde ein harmonistisches Ideal“, wie Adorno nun interpretierte. Kannte er Schönbergs letztes Werk, die „Fantasie für Violine und Klavier op. 47“ (1949), jene völlig unorthodoxe Inszenierung einer Fremdbeziehung zweier Instrumentallinien? Was situiert zudem den Briefwechsel zwischen Tradition und Moderne? Zu Th. Manns „Die Betrogene“ (1953) schreibt Adorno am 18. Januar 1954 von einer Auflösung des Gegensatzes von „subjektiver Durchdringung“ und einer durchgängigen Realismusforderung des Mannschen Oeuvres. Auf diese „abseitige Reflexion“ sei er durch seine Proust-Lektüre gekommen. Th. Mann antwortet am 8. März 1954: „Es war mir ganz seltsam, Ihren unglaublich hochgezüchteten kritischen Stil, der wie ein 66 Bücher zum Thema Dolch ins Fleisch der Dinge geht, so brieflich-privat angewandt zu finden auf das Eigene“. In den disparaten Formgebungen von Franz Kafka, Marcel Proust, James Joyce und Samuel Beckett zeichnen sich die Signaturen einer disparat gewordenen Autorenschaft ab. Das Spätwerk des auktorialen Erzählers Th. Mann deutet auf eine Schwellensituation des Misstrauens gegenüber Fremdgewordenem am Eigenen. Der fast Achtzigjährige äußert sich zum „wunderlich Allerneuesten aus der Joyce- und Nach-Joyce-Sphäre“ (ebd.). Zur Rezeption von Becketts „En attendant Godot“ (1952; Uraufführung 1953) schreibt er: „Die ‚Gegenseite’ hat wohl recht, von EndProdukten zu reden, wenn nur, was sie selbst macht, nicht so hoffnungslos ununterhaltend und komiklos wäre.“ (ebd.). Im letzten Brief an Th. Mann vom 28. Juli 1955 schreibt Adorno zur Lektüre von dessen „Versuch über Schiller“ (1955), ihn habe die Infragestellung „des Begriffs der Einheit der Künste“ überaus beeindruckt. Dass eine Lektüre der Briefe neue Anregungen bieten dürfte für eine Beschäftigung mit den besagten Antagonismen einer künstlerischen Moderne und ihrer philosophischen Rezeption, beruht letztlich auf der ebenso präzisen wie respektvoll responsiven Unmittelbarkeit dieser Korrespondenz. Für die brillante Herausgabe ist sehr zu danken. Ignaz Knips Dirk Auer, Lars Rensmann und Julia Schulze Wessel (Hg.) Arendt und Adorno, Frankfurt/Main 2003 (Suhrkamp), 312 S., 13.00 EUR. Einer komparativen Analyse zu Hannah Arendt und Theodor W. Adorno mag man zunächst mit Skepsis begegnen, denn trotz gewisser lebensgeschichtlicher Affinitäten wie Zeitgenossenschaft, Exilerfahrung und Kritik an Nachkriegsdeutschland, steht diesem Vorhaben entgegen, dass sich zu Lebzeiten das Verhältnis der beiden durch persönliche Antipathie und „dauerhafte wissenschaftliche Nichtbeachtung“ (7) auszeichnete, was sich posthum in der Anhängerschaft bis in die Gegenwart fortgesetzt hat. Die Herausgeber haben sich dennoch das Ziel gesetzt, als Beitrag zur „intellectual history“ erstmals beide Denker trotz theorieimmanenter Widersprüche und Brüche „nachholend“ ins Gespräch zu bringen (11) und sie systematisch nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden der theoretischen und zeitdiagnostischen Reflexionen zu befragen. Ausgangspunkt der vergleichenden Analyse ist der „Holocaust“ und seine gesellschaftliche Verarbeitung. Dieses Thema wird zunächst von der beiden Intellektuellen gemeinsamen biographischen Erfahrung des Exils ausgehend theoretisch verarbeitet. Arendt hat gleich nach dem Krieg Theorien zur Flüchtlings- und Menschenrechtsproblematik aufgestellt, und Adorno hat aus seiner Flucht aus Deutschland die Konsequenz der „Selbstverortung als ortloser Intellektueller“ gezogen. Anstoß Adorno Der erste Beitrag zum Themenkreis „Intellektuelle im Exil“ ist von Dirk Auer verfasst. Er bezeichnet beide Denker als „Parias wider Willen“, die ausgehend von der „Standortgebundenheit“ (52) des Wissens ihre Exilerfahrungen zu einem politisch-epistemologischen Standpunkt der Kritik verarbeitet haben und die klassische Rolle des Intellektuellen als Sprecher des Allgemeinen für überholt halten. Joanna Vecchiarelli Scott untersucht das Amerikabild der beiden Denker und erklärt die unterschiedlichen Emigrantenkarrieren u.a. aus den verschiedenen Bezugssystemen New York (Arendt) und Los Angeles (Adorno). Micha Brumlik ergründet die biographischen und denkmotivischen Beziehungen beider zum Judentum. Arendts politisch-existenzielle Erfahrung des Judentums sei „schicksalhaft“ und von Begriffen wie Pariaexistenz und Geburtlichkeit sowie vom Zionismus geprägt. In Adorno sieht er den Denker des jüdischen, messianischen Gottesverständnisses. Im Abschnitt „Totalitäre Herrschaft und Nachkriegsgesellschaft“ geht es darum, die Bedingungen der Möglichkeit des Holocaust zu begreifen und Konsequenzen für die Nachkriegszeit zu ziehen. Hat Adorno den Antisemitismus lange unterschätzt, so rückt dieses Thema bereits in der Emigration ins Zentrum seiner sozialwissenschaftlichen Anstrengungen. Ausgehend von Arendts und Adornos These vom Verschwinden des Antisemitismus vergleichen Julia Schulze Wessel und Lars Rensmann beider Antisemitismustheorien. Alexander Garcia Düttmann untersucht das Verhältnis 67 von Faktizität und Schuldzusammenhang und die epistemologischen Grenzen und Brüche, die durch die Tatsachenwahrheiten von Auschwitz gesetzt wurden. Adorno und Arendt kritisierten beide die „Schlussstrichmentalität“ und Erinnerungs- und Verantwortungsverweigerung der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Dem entsprechend konstatiert Lars Rensmann trotz des divergierenden theoretischen Zugangs zur totalitären Herrschaft eine Annäherung in der Erfassung der posttotalitären Entwicklung, die auf die ungelöste, unlösbare Spannung zwischen theoretischer Verallgemeinerung und konkreter historischer Erfahrung zurückzuführen sei. Trotz Differenzen in Axiomatik, Begrifflichkeit und Marxexegese kommen Arendt und Adorno zu analogen Resultaten bezüglich ihrer Kritik an der selbstvergessenen modernen Hypostasierung und Unterwerfung unter die Ideologie der Arbeit als Selbstzweck und an der gesellschaftlichen Reproduktion. Jörn Ahrens geht dem Unbehagen beider gegenüber der modernen Massen- und Arbeitsgesellschaft nach. Ihre Thematisierung der Gesellschaft sei primär getragen von der Furcht vor deren Präponderanz. Dabei gerate die Gesellschaft als Ermöglichungsbedingung des Individuums mitunter aus dem Blick. Der Frage des politischen Denkens und der politischen Kategorienbildung nach Auschwitz ist der dritte Themenkomplex gewidmet. Das Spätwerk beider Theoretiker ist geprägt von einer Auseinandersetzung mit Kant mit dem Ziel einer Problemati- 68 Bücher zum Thema sierung von Urteilskraft und Kontingenz und der Formulierung eines neuen kategorischen Imperativs bei Adorno. Thorsten Bonacker untersucht die normative Kraft der Kontingenz für politisches Handeln und die Legitimationsprobleme in der politischen Gesellschaft bei Arendt und Adorno. Axel Demirovics Beitrag über die postrevolutionären Emanzipationskonzepte hebt die „kaum überbrückbaren Gegensätze“ (283) bezüglich Befreiung, Freiheit und Gleichheit hervor. Samir Gandesha untersucht Arendts und Adornos Kritiken der Durchdringung von Natur und Geschichte in Auseinandersetzung mit Heideggers Fundamentalontologie. Die Autoren des Bandes haben sich ihrem Thema jeweils mit Bedacht genähert und die Legitimität einer komparativen Annäherung von Arendt und Adorno immer mitreflektiert. So gelingt die profilierende Absetzung der beiden voneinander, und die Gefahr einer Harmonisierung von Gegensätzen ist gebannt. Und schließlich steht der Bannspruch für dieses Unternehmen einer komparativen Analyse ja auch auf dem Buchdeckel. Hannah Arendts bissiges Bonmot über Adorno: „Der kommt uns nicht ins Haus.“ Marianne Rosenfelder Roger Behrens Kritische Theorie, Hamburg 2002 (EVA / Sabine Groenenwold), 95 S., 8.60 EUR. Die „kritische Theorie“ und ihrer Entwicklung zur „Frankfurter Schu- le“ hat einen nachhaltigen Einfluss auf die verschiedenen Theorieströmungen der kritischen Soziologie genommen, und gilt auch als Basis der neomarxistischen politischen Theorie. Dabei handelt es sich um keinen einfachen Ansatz oder um ein positivistisches Modell der Gesellschaft. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Herbert Marcuse übten eine radikale Kritik an den Institutionen der früh modernen Massenkultur, der Gesellschaft und der politischen Macht im Sinne dessen, was Roger Behrens als „Umgestaltung des Gegebenen“ (6) bezeichnet und versuchten aus marxistischer Sicht, „die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Veränderung der Gesellschaft wissenschaftlich zu begründen“ (6). Trotz der Komplexität der kritischen Theorie und der Vielfältigkeit der wissenschaftlichen und ideologischen Orientierungen ihrer Begründer, gelingt es Behrens in seiner sehr kurzen Einführung in die kritische Theorie, die fundamentalsten Prämissen, Ansätze, Begriffe und Fragestellungen der kritischen Denkschule treffend darzustellen. Nach Behrens „begreift kritische Theorie die strukturelle Dynamik der Gesellschaft als historischen Prozess. Sie geht vom Menschen aus, der prinzipiell seine Geschichte selbst gestalten kann – und sich damit überhaupt als Mensch erst entfaltet“ (10). Die im 19. Jahrhundert herrschende Betrachtung der Geschichte als linearer und fortschrittlicher Verlauf war einer der wichtigsten Kritikpunkte der kritischen Theorie, die „demgegenüber Geschichte als in sich widersprüchli- Anstoß Adorno chen, sprunghaften und diskontinuierlichen Prozess deutet“ (13). Behrens skizziert kurz die Geschichte des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main von 1924 bis 1933, wie sie in Abgrenzung zur traditionellen Sozialtheorie von der Ökonomie- und Kulturkritik von Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Theodor W. Adorno, Leo Löwenthal und Friedrich Pollock gestaltet wurde. Ziel der Forschung am Institut für Sozialforschung war, wie Behrens es formuliert, „eine unabhängige und zugleich engagierte kritische Theorie, die die gesellschaftlichen Widersprüche in all ihren Aspekten untersucht“ (21). In diesem Rahmen waren Ausgangspunkte der kritischen Theorie, so Behrens, die „Erkenntniskritik Kants“ (22), die „dialektische Logik der Geschichte“ in Hegels Philosophie (23), die „analytische Sozialpsychologie Freuds“ (26) und vor allem „Marx’ Kritik der politischen Ökonomie“ (24). Außerdem setzte sich die kritische Theorie, insbesondere Adorno und Horkheimer, auch mit Philosophen wie Schopenhauer, Kierkegaard und Nietzsche auseinander. Behrens präsentiert knapp die wichtigsten Beiträge der kritischen Schule: die Kritik der Ökonomisierung der Kunst Walter Benjamins sowie sein Verständnis der Kunst als „Traumschlaf“ (29) und seinen späteren Einfluss auf die Situationisten; die marxistische Philosophie der Praxis Antonio Gramscis; den linguistischen Strukturalismus Ferdinard de Saussures; den Beitrag Georg Simmels zur Kritik der Massenkultur und zur 69 Stadtsoziologie; die Verdinglichungstheorie von Lukács; die „Philosophie der Hoffnung“ Ernst Blochs (61); die marxistische Sozialanthropologie von Claude Lévi-Strauss; die literatursoziologischen Arbeiten Löwenthals und vor allem die Kunst-, Kultur-, Machtund Gesellschaftskritik Adornos. Seine „Entkunstung der Kunst“ (66), die „Kulturindustriethese“ (66) in der Dialektik der Aufklärung und seine vielschichtige Kritik an den ökonomischen Verhältnissen des Elitenkapitalismus bezeichnen gemäß Behrens „eine Verschmelzung von ökonomischen und politisch-sozialen Bedingungen mit technisch-ästhetischen und sozialpsychologischen Faktoren“ (67). Die kritische Theorie ist natürlich mit dem Werk von Adorno und Horkheimer nicht zu einem Ende gekommen, sondern sie entwickelte sich in den neomarxistischen Theorieströmungen und in der radikalen politischen Soziologie. Erwähnungen macht Behrens an verschiedenen Ansätzen, die von der kritischen Theorie geprägt wurden: die Ideologiekritik Luis Althussers; die Theorie des kommunikativen Handelns Jürgen Habermas’; die Theorie der Postmoderne Jean-François Lyotards und die poststrukturalistische Untersuchung der Disziplinierungs- und Normierungsmächte Michel Foucaults. Obwohl es sich bei Behrens Arbeit nur um einen Seiteneinstieg in die kritische Theorie handelt und damit unvermeidlich bestimmte Vereinfachungen anzutreffen sind, werden ihre wesentlichen Kennzeichen trotzdem dargestellt. Behrens weist auf die Entwicklung einer dynamischen, stän- 70 Bücher zum Thema dig veränderten und dialektischen Theorie hin. Die Aktualität der kritischen Theorie, die die bestehenden ökonomischen und politischen Verhältnisse problematisiert und die Gesellschaft als widersprüchlich auffasst, ist nach Behrens „eine reflexive, selbstkritische und negative Theorie, die sich um eine systematische Erfassung des gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs bemüht“ (9). Nicht nur eine (selbst)kritische Theorie der Gesellschaft und der Institutionen haben Adorno, Horkheimer und Marcuse konstruiert, sondern auch eine Kritik ihrer herrschenden Theorie und damit eine Großtheorie der Sozialwissenschaft. Maria Markantonatou Judith Butler Kritik der ethischen Gewalt. Adorno-Vorlesungen 2002, Frankfurt/Main 2002 (Suhrkamp), kart., 144 S., 14.90 EUR. „Wenn ich frage, wer ich für mich sein könnte, muss ich auch fragen, welchen Platz es in dem diskursiven Regime, in dem ich lebe, für ein ‚Ich’ gibt“ (123). Dieser Satz steckt die Fragen ab, mit denen sich die Autorin in den drei am Frankfurter Institut für Sozialforschung gehaltenen Vorlesungen auseinandersetzt. Ihr Ausgangspunkt ist der Abschied von Vorstellungen vom Menschen als von seiner Umwelt klar abgegrenztem, seiner selbst gewissem Lebewesen. Der Mensch erscheint als Subjekt, das auch immer aus etwas besteht, das es nicht selbst ist, aus einer Geschichte, einem Unbewussten, aus bestimmten Strukturen, aus der Geschichte der Vernunft, zitiert Butler aus einem Interview Michel Foucaults (124). Das veränderte Menschenbild blendet Verwundbarkeit und Fehlbarkeit nicht aus. Die Aussetzung der Forderung nach Selbstidentität oder, genauer, nach vollständiger Kohärenz stellt sich einer gewissen ethischen Gewalt entgegen, die verlangt, dass wir jederzeit unsere Selbstidentität vorführen und aufrecht erhalten und von anderen dasselbe verlangen. Für in der Zeit lebende Subjekte ist diese Norm nicht zu erfüllen, zeigt Butler auf (55). Vor diesem Hintergrund untersucht sie, ob das Postulieren eines Subjekts, das nur zu begrenzter Selbsterkenntnis fähig ist, die Möglichkeit, Rechenschaft von sich selbst zu geben, und die Möglichkeit der Verantwortung unterläuft (28). Die Konsequenz sei, sich die Grenzen des Selbstverständnisses einzugestehen, und diese Grenzen nicht nur zur Bedingung des Subjekts zu machen, sondern als die Situation der menschlichen Gemeinschaft überhaupt anzunehmen (94). Muss ich mich selbst kennen, um in sozialen Beziehungen verantwortlich zu handeln, fragt die Autorin und führt aus, dass wir dem Anderen auf eine Weise ausgeliefert sind, die wir nicht vollständig kontrollieren können. Die Frage der Verantwortung sei nicht losgelöst vom Anderen zu denken (95). Eine Ethik aus der Sphäre des Ungewollten zu entwickeln könnte bedeuten, dass man sich diesem Ausgesetztsein vor dem Anderen nicht verschließt, dass man nicht versucht, das Ungewollte in Gewoll- Anstoß Adorno tes zu überführen, sondern die Unerträglichkeit des Ausgesetztseins als Zeichen einer geteilten Verletzlichkeit begreift (100). Butler stellt auch die Frage, welcher Bezug zwischen einer kritischen Politik und einer Ethik bzw. Moral besteht, „die immer wieder eine Erklärung unserer selbst in der ersten Person verlangt“ (30). Mit Verweis auf Theodor W. Adorno und Michel Foucault sieht sie die Lösung darin, das Subjekt als Grundlage der Ethik zu entfernen, um es dann als Problem für die Ethik neu zu fassen (114). Ethisch handeln, bedeute einzugestehen, dass der Irrtum konstitutiv für die Frage ist, wer wir sind (116). Butlers Vorlesungen sind nicht zuletzt deswegen interessant, weil sie die philosophische Diskussion um die Kohärenzmöglichkeiten des Subjekts im allgemeinen in Bezug zu psychoanalytischen Verfahren setzt, die die konkrete Selbsterkenntnis eines Individuums ermöglichen sollen. Die Auseinandersetzung mit zwei Zugangsweisen zum Problem ‚Selbstidentität’ erhellt so die Aussagen beider Disziplinen. Jadwiga Adamiak Alex Demirovic (Hg) Modelle kritischer Gesellschaftstheorie. Traditionen und Perspektiven der Kritischen Theorie, Stuttgart 2003 (J. B. Metzler), 394 S., 39.95 EUR. Nach einem Abriss der Geschichte und Philosophie Kritischer Theorie (KT) durch den Herausgeber stellt 71 sich Alexander Garcia Düttmann die Frage, ob sich Aufklärung überhaupt verneinen ließe. Sein Artikel „TRUST ME” befasst sich mit Vertrauen als Basis des aufklärerischen Denkens. In „Dialektische Konstellationen. Zu einer kritischen Theorie gesellschaftlicher Naturverhältnisse” fordert Christoph Görg in Anlehnung an Herbert Marcuse, die ökologische Kritik an der heutigen Gesellschaftsformation so weit zu treiben, bis sich zeige, dass kapitalistische Produktion mit ökologischem Denken nicht vereinbar sei. Auch der Aufsatz „Zur sozialphilosophischen Kritik der Technik heute” von Gunzelin Schmid Noerr beschäftigt sich mit Naturverhältnis und KT, diesmal aus der Perspektive des Kommunikationsverhältnisses. Einerseits seien bestimmte theoretische Aspekte der KT in den Wissenschaftsbetrieb heute integriert; andererseits sei das utopische Potenzial eliminiert. Dies geschehe durch Individuierung der Ethik einerseits und Verdrängung der Ethik aus Soziologie und Politik andererseits. Ethik und Gesellschaft wieder zu vereinen betrachtet Schmid Noerr als eine der zentralen Aufgaben der KT heute. In „Entwicklungstendenzen und Krisen des Kapitalismus” untersucht Thomas Sablowski die Krisentheorie bei Marx und der KT. Nach dem Zusammenbruch des Systems, das je nach Sichtweise als „Sozialismus” oder „Staatskapitalismus” bezeichnet wurde, und mit der derzeitigen Entwicklung einer kapitalistischen Weltwirtschaft sind auch kritische Positionen umstritten. Angesichts völlig offener Fragen der „Akkumulations- 72 Bücher zum Thema schwäche im industriellen Sektor” und der Krisen im Wertpapierhandel hält Sablowski „Kritische Theorie als Krisen- und Entwicklungstheorie (für) ... aktueller denn je” (127). Andrea D. Bührmann nimmt in „‚Wir sind weit weniger Griechen als wir glauben‘. Überlegungen zum Projekt einer kritischen Geschlechterforschung” vor. Ihr geht es dabei um die Auslotung von Widerstandspotentialen und um die „Reformulierung geschlechtlicher Identitäten”. Christine Resch und Heinz Steinert befassen sich in ihrem Aufsatz zur Kulturindustrie mit der Wendung dieses Begriffs von der Kritik zum Affirmativen. Marcuses „eindimensionaler” Kritik der Kulturindustrie wird Kracauer entgegengesetzt, der gezeigt habe, wie mittels Ironie kulturindustrielle Mechanismen unterlaufen werden können. An Baudrillard wird gezeigt, wie ein einschneidendes Ereignis (11. September) kulturindustriell entpolitisiert und damit als unhintergehbar dargestellt wird. Die Frage nach dem „Warum?” lässt sich so nicht mehr adäquat stellen. An Habermas geht der Vorwurf, die „reflexive Kritik” der KT durch „moralische Wahrheit” zu ersetzen (dann hätte sich Habermas allerdings kaum bemühen müssen, eine kunstvolle Kommunikationstheorie zu entwerfen – er hätte einfach Platon abkupfern können, Anm. d. Rez.). Weiter behandeln die AutorInnen die Frage, wie es auf das „Produkt” zurückschlägt, wenn sich „Kunst” in Ware verwandelt, und wie staatliche Bürokratie etwa die Festivalkultur prägt. In der aktuelle Kulturindustrie wird die Reflexion auf ihren Entstehungsprozess selber mitgeliefert – allerdings ins Affirmative gewendet. Der Rückschluss auf die herrschende und bestimmende Struktur ist auf diese Weise nicht mehr möglich. Politik selber trennt sich in „Infotainment” einerseits und die davon völlig abgekoppelte reale Politik auf der anderen Seite. Beide AutorInnen halten dagegen an der Notwendigkeit echter Ideologiekritik im Sinne der KT fest, die sich um Analyse der Herrschaftsbedingungen bemüht, unter denen Kulturindustrie sich entwickelt. Gerhard Schweppenhäuser resümiert in seinem Aufsatz „Ästhetische Theorie, Kunst und Massenkultur” die Entwicklung von KT der Kulturindustrie bis hin zu den „Cultural Studies”. Er plädiert dafür, „dass ... die produktiven Aspekte der Massenkultur ... nicht vernachlässigt werden”. Dort seien Erfahrungen möglich, die in der „Hochkunst” kompromittiert seien, wie „körperliche Präsenz,... das Glück der Wiederholung,... Begehren...” und so weiter. Wolfgang Bonß beschäftigt sich im letzten Aufsatz mit dem Begriff der Kritik und seinen Bedeutungen in verschiedenen Theorien. Der Maßstab der Kritik für die KT sei das mögliche Andere, das in der Gesellschaft aufzufinden sei. Im weiteren Verlauf der Moderne entwickelt sich die (praktische) Kritik immer mehr zu einer „Pathologie der kapitalistischen Gesellschaft”, die immer weniger an irgendwelchen Zielvorstellungen orientiert ist. Sie wandelt sich vielmehr zur Beschreibung einer „Katastrophengesellschaft”. Anstoß Adorno Der Sammelband enthält eine Vielzahl von Aufsätzen verschiedener Richtungen, die Kritische Theorie weiter zu denken versuchen, manche mehr, manche weniger nachvollziehbar. Nicht zuletzt die ausführliche Sammlung von Literatur macht ihn zur Materialsammlung einer Denkrichtung, innerhalb derer zwar mit Eifer gestritten wird, die sich jedoch nicht zum Schweigen bringen lässt. Percy Turtur Lars Rensmann Kritische Theorie über den Antisemitismus. Studien zu Struktur, Erklärungspotential und Aktualität, Hamburg 2001 (Argument), kart., 365 S., 25.50 EUR. Wenn anlässlich des 100. Geburtstags Theodor W. Adornos heute manchmal angestrengt und oder sogar überheblich nach der Aktualität von dessen Theorie gefragt wird, sollte man sich den kategorischen Imperativ des Philosophen in Erinnerung rufen, „Denken und Handeln so einzurichten, dass sich Auschwitz nicht wiederhole, nichts ähnliches geschehe“ und dass die Vergangenheit erst dann aufgearbeitet wäre, „wenn die Ursachen des Vergangenen beseitigt wären. Nur weil die Ursachen fortbestehen, ward sein Bann bis heute nicht gebrochen“. Bestimmt doch die Kritische Theorie den modernen Antisemitismus und dessen Kulminierung in der deutschen Massenvernichtung der europäischen Juden, für die Auschwitz als Synonym steht, als wesentliches Element der gesell- 73 schaftlichen Totalität und der immanenten Dialektik der Vergesellschaftung des modernen Subjekts, weshalb sich eine simple dualistische Aufteilung der heutigen deutschen Gesellschaft in eine Mehrheit der Anständigen und eine rechtsradikale Peripherie, der der Antisemitismus zugeordnet wird, verbietet. So versteht der Berliner Politikwissenschaftler Lars Rensmann seine vorliegende Arbeit auch nicht als historisierende Einordnung, sondern als Versuch, die „theoretischen Überlegungen der Frankfurter Schule systematisch zu analysieren und unter der Perspektive ihres Potentials für eine politische Theorie und Psychologie über den Antisemitismus im gegenwärtigen Deutschland zu bewerten“. Seine Studien bieten erstmals eine umfassende Gesamtdarstellung einer Kritischen Theorie über den Antisemitismus dar, die auf der Sammlung und Auswertung sämtlicher, auch bisher kaum beachteter Texte aus dem Kreis der Frankfurter Schule, namentlich Max Horkheimers, Theodor W. Adornos, Leo Löwenthals und auch des frühen Erich Fromm zu dieser Thematik beruhen. Rensmann gelingt es dadurch nicht nur den zentralen Stellenwert, den die Kritische Theorie dem Phänomen des Antisemitismus einräumt, aufzuweisen, sondern auch die Überlegungen darüber als ein vielschichtiges zusammenhängendes theoretisches Konzept zu vermitteln. Stehen frühe Ansätze, wie Max Horkheimers bekannter Aufsatz „Die Juden in Europa“, noch ganz in der Tradition einer aus der herkömmli- 74 Bücher zum Thema chen marxistischen Theorie deduzierten Auffassung des Antisemitismus, erblickt die spätere Kritische Theorie entsprechend dem von Horkheimer und Adorno in der „Dialektik der Aufklärung“ geprägten Begriff totaler Herrschaft, die in der Herrschaft über die Natur gründet, im Begriff des autoritären Charakters die Form der Repression der inneren Natur des modernen Subjekts. In der Bestimmung des autoritären Charakters reflektieren sie die Voraussetzungen des antisemitischen Wahns als „eine politisch-psychologische Form des sozialen Kitts“ der modernen Gesellschaft. Gemäß ihrer Relevanz steht die Analyse der psychologischen und gesellschaftlichen Bedingungen zur Entstehung des autoritären Charakters im Zentrum des ersten Teils von Rensmanns Untersuchungen. Mit Kategorien psychoanalytischer und kritisch-dialektischer Theorie nach Freud und Marx reflektierte die Kritische Theorie den Typus des autoritären Charakters als jene Form moderner Subjektivität, die gekennzeichnet ist durch Ich-Schwäche, da das „Ich“ ebenso beherrscht ist von seinen unbewußten, sich widersprechenden als fremd erfahrenen und nicht integrierbaren Trieben und Wünschen, wie von den Instanzen des Über-Ich, die als äußerlich bleibende repressive gesellschaftliche Normen und Werte vom „Ich“ ebenfalls nicht integriert werden können. Als Folge kann das Ich seiner Rolle als Vermittlungsinstanz zwischen dem Subjekt und der Außenwelt nicht gerecht werden. Das Ich-schwache, von äußeren Autoritä- ten abhängige Individuum sucht Halt in Konformität und Überhöhung dieser äußeren Autoritäten. Dieses Ich-schwache Subjekt steht unter dem Zwang, die erfahrene Gewalt als Quelle der eigenen Identität zu wiederholen. Die durch die Triebunterdrückung und -entstellung erfahrene Gewalt wird, nur schwach rationalisiert, sadistisch gegen scheinbar Schwächere und sich dem Konformitätsdruck Entziehende gewendet. Dieser „Sadismus im Kampf mit seinen eigenen Regungen, ... der sich in der Form von Lebensneid nach außen gegen die wirklich oder scheinbar Genussfähigen“ (Löwenthal) richtet, findet in Juden die Objekte seiner Projektionen. Da sich autoritär strukturierte Persönlichkeiten andrerseits in masochistischer Weise überhöhten Autoritäten unterwerfen, werden, Ausdruck „pathischer Projektionen“ und einer „paranoiden Beziehung zur Außenwelt“ (Löwenthal), auf die Juden all diejenigen widersprüchlichen Elemente der Moderne projiziert, die von den autoritär zugerichteten Subjekten mit Aggression besetzt werden. Das antisemitische Zerrbild zeichnet Juden so verantwortlich als „Exponenten der Zivilisation als auch dessen, was in der Zivilisationsgeschichte ausgegrenzt und unterworfen wurde.“ Auf der Ebene des Bewußtseins korreliert der psychischen Struktur des autoritären Charakters eine Regression des Denkens, die – bedingt durch die Dominanz von Es und Über-Ich über das Ich – die Ausbildung eines kritisches Gewissen verhindert, ein Weltbild, das auf vereinfachenden und persona- Anstoß Adorno lisierenden Erklärungen beruht. Adorno kennzeichnet dies als Stereopathie. Resümierend lassen sich so „nationalistische Selbstkonstruktionen und antisemitische Fremdprojektionen ... als autoritäre Rebellion der unterdrückten, von gesellschaftlicher Herrschaft entstellten Natur im Dienste noch autoritärer Herrschaft und der (selbst)zerstörerischen Verfolgung von all denjenigen ‚Anderen’, die sich vermeintlich oder real dem sozialen Konformitätsdruck entziehen“, begreifen. So plausibel und aktuell die Einsichten der Kritischen Theoretiker prima facie erscheinen, so bedürfen sie nach Rensmann, gerade um ihre Aktualität zu akzentuieren, im Licht neuerer Forschungen in einigen Punkten kritischer Revision und Ergänzung. Der Autor erblickt dies zunächst in den psychologischen Grundlagen des Ansatzes der Frankfurter Schule, in die er aus der feministischen FreudKritik Jessica Benjamins gewonnene Erkenntnisse einarbeitet. Problematisch erscheint Rensmann auch der, nach seinem Dafürhalten, zu allgemein bestimmte Begriff des Antisemitismus als „Ticket“. Rensmann moniert, dass hier die zuvor herausgearbeitete Spezifik von Nationalsozialismus und Antisemitismus im Begriff der spätkapitalistischen Totalität zu verschwinden drohe. „Die Kritische Theorie über den Antisemitismus wirkt hier, trotz der Aufrechterhaltung des Bewußtseins vom Umschlag der Dialektik der Aufklärung in Wahnsinn, zum Teil deterministisch und verallgemeinernd 75 gegenüber der historischen Differenz, die die konkrete Totalität des NS als 'neue Qualität' markierte.“ So berechtigt die Insistenz der Kritischen Theorie auf den universalen Anspruch ihres gesellschaftstheoretischen Ansatzes ist, ist dem Einwand Rensmanns zuzustimmen, dass gerade angesichts der Singularität des in den Holocaust mündenden eliminatorischen Antisemitismus in Deutschland und einer besonders aggressiven Form des Autoritarismus, die spezifischen historischen, mentalitätsgeschichtlichen und kulturellen Konkretionen, wie sie Rensmann etwa in der Entwicklung der deutschen Nation erblickt, in die von den Frankfurter Theoretikern erarbeiteten allgemeinen Grundlagen integriert werden müssten. Generell postuliert der Autor vor dem Hintergrund dieser Einsichten, den Ansatz kritisch-dialektischer Gesellschaftstheorie und politischer Psychologie um die Dimension einer „vergleichenden politischen Kulturforschung“ zu erweitern. Dass die Kritische Theorie andrerseits den Blick für das Besondere keineswegs verlor, zeigt gerade der Begriff des „sekundären Antisemitismus“, der sich als deutsches Spezifikum gerade in der „Verarbeitung“ des Holocaust entfaltete. Dieser, in der Rezeption einer „Kritischen Theorie des Antisemitismus“ bisher kaum beachtete Aspekt nimmt in den Untersuchungen Rensmanns im zweiten Teil seiner Studien breiten Raum ein. Besonders Adorno hob immer wieder den strukturellen Zusammenhang von Revisionismus, Nationalismus und Antisemitismus, deren Kern eine 76 Bücher zum Thema aggressive Erinnerungsabwehr bildet, hervor. „Die politische Kultur der Abwehr, die sich der Stereotypie bedient und in die judenfeindliche überführt, zielt gegen die Opfer so sehr wie auf die Restauration eines deutschen Nationalismus, der von jeher dem Antisemitismus eng verwandt ist; diese Erkenntnis ist nicht zuletzt der Kritischen Theorie Adornos geschuldet.“ Angesichts von nationalistischen Tendenzen in der aktuellen politischen Entwicklung in Deutschland, einhergehend mit einer aggressiven Nivellierung oder gar Verkehrung von Opfern und Tätern und einem sich in diversen Projektionsflächen artikulierenden Antisemitismus, dem ein – symptomatisch für die Kontinuität des Autoritarismus – pseudo-rebellisches „tabubrechendes“ Aufbegehren gegen eine zunehmend ohnmächtiger agierende offizielle Erinnerungskultur korreliert, verdeutlichlicht sich die ungebrochene Aktualität der Potentiale des Kritisch-Theoretischen Denkens. Georg Koch Heinz Steinert Die Entdeckung der Kulturindustrie oder: Warum Professor Adorno Jazz-Musik nicht ausstehen konnte. Münster 2003 (Westfälisches Dampfboot), 285 S., 24.80 EUR. Adorno in Wien. Über die (Un-)Möglichkeit von Kunst, Kultur und Befreiung, Münster 2003 (Westfälisches Dampfboot) 231 S., 24.80 EUR. Kulturindustrie, 2. Auflage, Münster 2002 (Westfälisches Dampfboot) 218 S., 15.30 EUR. Hört man Exile (2003), das mit dem BBC Musics Award ausgezeichnete Album des im Londoner Exil lebenden Saxophonisten Gilad Atzmon, dann erübrigen sich lange Diskussionen darüber, ob Adorno etwas vom Jazz verstand. Atzmon & The Orient House Ensemble machen politischen Jazz nach dem „Ende der Jazzmusik selber“, das Adorno 70 Jahre zuvor ausgerufen hatte. Heinz Steinert hält derartige Diskussionen allerdings ohnehin für unnötig und will sich an ihnen auch gar nicht beteiligen. Mit seinem Buch Die Entdeckung der Kulturindustrie oder: Warum Professor Adorno JazzMusik nicht ausstehen konnte bekennt sich zum Jazz und zu Adorno und zieht daraus die Konsequenz, auch dessen Jazz-Theorie ernst zu nehmen. Vermutungen darüber, ob eine JazzCD aus dem „Adorno-Jahr“ sein Urteil hätte beeinflussen können, bleiben zwangsläufig spekulativ; müßig sind sie deshalb noch nicht. Bedenkt man, dass es schon zu dessen Lebzeiten Aufnahmen gab, von denen sich stilistische Bögen in die Zukunft hätten schlagen lassen, z.B. Ornette Colemans The Shape of Jazz to Come (1959), dann hilft auch der Hinweis nicht weit genug, dass Adorno sich vorwiegend auf den Swing der Zwischenkriegszeit bezogen habe. Steinert zeigt u.a. anhand der 1953 im Merkur ausgetragenen Debatte zwischen Adorno und dem ihm unterliegenden JazzExperten Joachim Ernst Berendt, dass Adorno seine Position nie wirklich Anstoß Adorno revidiert hat. Er nimmt andere Gründe an als Ignoranz oder Unverständnis und stützt sie biografisch. Bei Die Entdeckung der Kulturindustrie (A) handelt es sich – wie auch bei Adorno in Wien (B) – um eine überarbeitete Neuauflage (zuerst 1992) und trotz der biografischen Annäherung um keine (Teil-)Biografie. Adorno interessiert Steinert „als Exponent einer Form von kritischer Intellektualität“ (A 8). Er arbeitet an einer „Theorie des Intellektuellen“ (A 7), die er bei Adorno am Werk sieht, und zwar „in der Haltung der ‚öffentlichen Einsamkeit‘„, die er von Schönberg übernommen habe (vgl. B 58 ff). Heute, diagnostiziert Steinert, stehe diese Haltung den Intellektuellen nicht mehr zur Verfügung, und er schlägt vor, sie in Konfrontation mit der des Jazz-Musikers auf die Höhe der Zeit zu bringen. Dessen Praxis soll als Vorbild einer zeitgemäßen kritischen Intellektualität dienen. Wien steht für die große musikalische Revolution, die nach Steinert für Adorno das Modell der Revolution war (B 168 f). Als er 1925 nach Wien kam, um bei Alban Berg Komposition zu studieren, war die Revolution bereits Geschichte und gescheitert. Schönberg hatte Harmoniebindung und Sonatenform aufgelöst und die Dissonanz emanzipiert. Diese künstlerische Arbeit mochte zum „Selbstbewusstsein des Produzenten“ beigetragen haben, „sprengende Wirkung“ entfaltete sie kaum; und die gewonnene Freiheit hatte sich längst wieder in Regeln niedergeschlagen. Für Steinert (B 7) entstammen die bis heute aktuellen Thesen aus der Dialek- 77 tik der Aufklärung (1944/47) nicht der Enttäuschung über die Arbeiterbewegung, sondern Adornos Enttäuschung über Schönberg. Kunst bewahre bestenfalls Nicht-Identisches, das jedoch ständig in der gleichmacherischen Kulturindustrie zu verschwinden drohe. Auf diesem Hintergrund wird von Adorno der Jazz als Gegenmodell zur Arbeit von Schönberg und als paradigmatisch für die Kulturindustrie eingeführt. Es handele sich um „Gebrauchsmusik“, an der sich nichts lernen lasse, was sich nicht längst hätte lernen lassen, schreibt er in Abschied vom Jazz (1933) anlässlich des Rundfunksendeverbots. Im selben Jahr wird ihm von den Nazis die Lehrbefugnis entzogen. Über Jazz (1936) entsteht schon im Oxforder Exil. Weil Adornos JazzTheorie den Grund legt für seine späteren Ausführungen zur Kulturindustrie, hält Steinert sie für bedeutsam und nicht etwa für peinlich. Er entwickelt parallel zu seiner Auseinandersetzung mit Adornos Theorie des Jazz seine eigene. In ihrem Licht erscheint Jazz als „kollektiv hervorgebrachtes Ereignis“ (A 139), das den Widerstreit zelebriert und zeigt, wie Anerkennung funktionieren kann. Jazz gehört zur Kulturindustrie; und Steinert sagt (A 63), er lebe in ihr. Als „ironische Musik“ (A 145) sei es möglich, in ihr lebendig zu bleiben. Indem Steinert gegen Adorno das Befreiungspotenzial des Jazz behauptet, eröffnet er die Kontroverse erneut, die schon Adorno und Benjamin (und Brecht) geführt worden ist. Mit Adornos intellektueller Haltung 78 Bücher zum Thema sei auch der Gegensatz zwischen Kunst und Kulturware verschwunden, und innerhalb der Kulturindustrie – zu der Steinert eine ausführliche, aktualisierende Interpretation anbietet (C) – bleibe dann nur noch kritische Improvisation und Weiterentwicklung. Gesucht seien daher Kritiker vom Typ des sog. „Kulturindustrie-Intellektuellen“ (A 34). Im Exil konfrontierte der Israeli Atzmon traditionelle jüdische Musik mit arabischen Klängen und integriert beide in die Tradition des Jazz. Er steht Adorno damit sicher näher als dieser es einem Jazz-Musiker zugetraut hätte. Es lohnt sich reinzuhören, bei Atzmon wie bei Steinert, der sich wünscht, so gelesen zu werden wie Jazz gehört wird: als Abfolge von Variationen (A 8). Olaf Sanders Udo Tietz, Ontologie und Dialektik Heidegger und Adorno über das Sein, das Nichtidentische, die Synthesis und die Kopula, Wien 2003 (Passagen), br., 160 S., 18.00 EUR. Ontologie und Dialektik – schon der Titel lässt Heidegger und Adorno ahnen. Und in der Tat, Udo Tietz, Privatdozent für Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin und Mitherausgeber der Zeitschrift „Initial“, knöpft sich in vorliegender Arbeit das Seinsdenken Heideggers und die negative Dialektik Adornos vor. Er konzentriert sich dabei allerdings auf einen zentralen und elementaren Punkt: die Theorie des Urteils. Wie haben beide, Heidegger und Adorno, diese grundlegende Erkenntnisfunktion verstanden? Tietz selbst setzt recht umstandslos voraus, dass man für eine adäquate Theorie des Urteils von Frege auszugehen habe. Für diesen ist nicht das Urteil, sondern der Satz das Fundamentale bzw. das prädikative Urteil oder der Aussagesatz. Er ist „die kleinste semantische Einheit, die sich auf ihren Sinn befragen läßt“ (16). Von hier ausgehend stellt Tietz fest, dass sowohl Heidegger als auch Adorno – so unterschiedlich ihr Philosophieren auch war – den Sinn dieser Urteilstheorie nie recht verstanden haben. Zwar gehören alle drei, Frege, Heidegger und Adorno in die gemeinsame Front der Antipsychologisten zu Anfang des letzten Jahrhunderts, die die Auffassung vertraten, dass Urteile keine empirisch-psychischen Operationen seien, wie die Psychologieschule seit Herbart und Fries bis zu Wundt, Brentano und Lipps angenommen hatte, sondern dass sie ‚logische Operationen’ seien. Heidegger jedoch habe sie nicht wie Frege als Prädikation, sondern, in der Tradition des Neukantianismus und mit Husserl, als einen intentionalen Akt der Synthesis zweier Begriffe verstanden, worin die Kopula, das „ist“, die Gegenständlichkeit, das Sein des Seienden, ausdrückt. Das Satz „Der Einband ist gelb“ drückt demnach nicht aus, dass der Einband gelb ist, sondern die Verknüpfung des Begriffs „Einband“ mit dem des „Gelben“, worin gilt, dass dem Einband das Gelbsein zukomme. Zwar habe Hei- Anstoß Adorno degger, so Tietz, diese Urteilstheorie dann „ontologisch fundiert“ (59), indem er ihr als Wahrheitsbedingung des Urteils die „Erschlossenheit von Welt“ als dem Ursprungsort von Wahrheit zum Grunde legte, aber dies ändert nichts an der Tatsache, dass er „die logische Struktur des prädikativen Satzes nie verstanden hat“ (15). Ähnlich Adorno. Auch er stand in der neukantianischen Tradition. „Die Auseinandersetzung mit Heidegger“, so Tietz, „ist eine Auseinandersetzung, die auf einer gemeinsamen Basis geführt wird – und diese gemeinsame Basis ist die phänomenologische Urteilstheorie, so wie sie Husserl in den Logischen Untersuchungen entwickelt hat.“ (114) Während Heidegger diese fundamentalontologisch untermauerte, begriff Adorno die Synthesisleistung jedoch mit Hegel als Dialektik. Hegel, so Adorno, habe den Nachweis geführt, dass jedem Ist im Satze ein Nicht-Ist innewohne. „Nach dem Maß des ‚Ist’ enthüllt Sein sich als Werden, im Sinn der Ausgangsbestimmungen der dialektischen Logik.“ (Adorno, GS, Bd. 8, 229) Von dieser Einsicht ins Dialektische des Urteils aus habe Adorno einerseits an Heidegger kritisiert, dass dessen ontologische Fundierung sich aller Begrifflichkeit entziehe und sich in tiefem seinsgeschichtlichen Raunen verliere; an der Theorie der Prädikation hingegen, dass sie genau jene innere Dialektik im Urteil stillstelle. Während Heideggers Seinsdenken begrifflos raune, schneide prädizierendes Urteilen ab, richte zu. Es sei ein identifizierendes Denken, das, was ungleich ist, gleichsetzt. Wenn Ador- 79 no nun aber die Kritik an solchem Urteilen mit dem „Nachweis“ führen will, dass selbst der Identitätssatz „a ist a“ nicht wahr sei, weil, wie er in der Metakritik der Erkenntnistheorie schreibt: „wenn wir in diesem Satz das zweitemal unter a nicht dasselbe verstehen wie das erstemal, so ist das erste a eben nicht das zweite a, das heißt der Satz ‚a ist a’ gilt dann nicht mehr“ (89), dann kann man wenig einwenden, wenn Tietz meint, diese These sei „eine der irrsinnigsten Thesen, die im 20. Jahrhundert vertreten wurden“ (120). Auch wenn Adornos dialektische Logik negativ konzipiert ist, so bleibt sie dennoch, wie Tietz zurecht bemerkt, in jener Theorie der Synthesis befangen. Er nennt es deren „versöhnungsutopisches Motiv“ (112). Denn Adorno will letztlich doch „auf eine ‚Identität von Begriff und Sache’ hinaus – wobei die entscheidende Frage lautet: Wie ist diese Identität urteilstheoretisch zu denken?“ (108) Adorno intendiert eine Identität von Begriff und Sache, von Subjekt und Objekt, die er nicht mehr ausweist. Und dort, wo er davon spricht, dass im Künftigen „das Objekt (begänne) unter dem verweilenden Blick des Gedankens selbst zu reden“ (Negative Dialektik, Fft/M. 1982, 122), kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, Tietz habe nicht ganz Unrecht, wenn er sich darüber Gedanken macht, wie dies denn gehen solle, und es zu einer Phantasie der Romantiker erklärt, wo in einer Welt der Märchen auch Tiere und Steine sprechen. Der Ertrag dieser Studie über Heideggers und Adornos Urteilstheorie 80 Bücher zum Thema ist, was Tietz schon voraussetzt. Sie vollzieht sorgfältig nach und zeigt überzeugend auf, dass da, wo nicht der Aussagesatz, und damit die Sprache, und damit der öffentliche Diskurs das Erste und Fundamentale ist, sondern das heroisch-elitäre, intentionale und selbst weltsetzende Ich, dass da der Satz zum Unwahren, die Sprache verstellend und der öffentliche Diskurs zum bloßen Gerede wird. In der Distanz dazu und der Kritik daran stimmen beide überein; mit der Herrschaft des Volkes und ihren öffentlichen Strukturen konnten weder Heidegger noch Adorno etwas Rechtes anfangen. Tietz folgt hier entschieden R. Rortys Grundsatz, dass im Zweifel Demokratie vor Philosophie gehe. Auf dieser Basis kann er dann allerdings Adornos Philosophieren deutlich mehr abgewinnen als dem Heideggers: der Idee des „Nichtidentischen“, die dem Individuellen und damit der Pluralität Rechnung trägt, sowie Adornos Begriff einer „nicht-reglementierten Erfahrung“, der die Lücke zwischen einer Konsenstheorie und Erfahrungsevidenzen schließen könnte (125). Maßstab hierfür aber bleibt der prädikative Satz, ohne den doch ein wechselseitiges Verstehen gar nicht möglich wäre. Tietz, so scheint es, hat offenbar kein Gespür für die Frage, wie denn ein Standort möglich sein sollte, der nicht nur in, sondern an dieser Öffentlichkeit Kritik übt. Er scheint in ihr, anders als Heidegger und Adorno, ganz zu hause zu sein. Alexander von Pechmann Wolfgang Langer Im Inneren des Empire: „Staat“ und „bürgerliche Gesellschaft“ bei Hegel und Hardt/Negri Anmerkungen zu einer Philosophie der Globalisierung. Der Inhalt eines fraglos Bekannten in der Philosophie verliert das Beruhigende, wenn sich dagegen Einspruch erhebende Perspektiven auf die Gegenwart ergeben und diese, auch rückwirkend, ihre Stichhaltigkeit erweisen. In der Staatswissenschaft insistiert nach wie vor eine Problemstellung, die auch in der Phase des „Empire“1 und seinen „zentralisierenden und vereinheitlichenden Tendenzen in der Regulierung des Weltmarkts und der globalen Machtverhältnisse“ (HN 25) nichts an Bedeutung eingebüßt hat. Sie besteht in der Frage nach der Bedeutung des Staates in seiner Beziehung zur ökonomischen Verfassung der bürgerlichen Gesellschaft. Zur Erforschung dieser Beziehung bietet sich die Konfrontation der Vorstellung einer „neuen Weltordnung“, so der Untertitel des genannten Werkes, mit der Rechtsphilosophie Hegels nicht zuletzt deshalb an, weil Hegel „als der erste große Philosoph der modernen Gesellschaft angesehen werden“2 kann. Die Abhandlung geht von der Zentralität einer Aussage von M. Hardt und A. Negri aus, die die Ermächtigung von globalen Prozessen und deren Autonomie zum Inhalt hat: „Die Regierung im Empire“, schreiben sie, „lässt sich nicht mehr mit der Begrifflichkeit verstehen, in der Hegel die Regierung definierte: gegründet auf den Vermittlungen der bürgerlichen Gesellschaft, die den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens konstituieren.“ (HN 348) Jetzt, so die Autoren, gebe es „eine neue und weitergehende Vereinbarkeit von Souveränität und Kapital“ (HN 339), allerdings „ohne 1 2 M. Hardt, A. Negri,, Empire. Die neue Weltordnung, Frankfurt/New York 2003 (HN). Sh. Avineri, Hegels Theorie des modernen Staates, Frankfurt/Main 1976, 10. 82 Wolfgang Langer irgendwelche Vermittlungsinstanzen. Darin liegt das wirklich Neue der imperialen Situation.“ (ebd., H.v.m.) Im „Empire“ wird das Thema der Globalität von Hardt und Negri als eine Beziehung zwischen der politischen und der ökonomischen Verfassung diskutiert. Sie trennen in ihrem geschichtlichen Rückblick deutlich beide Ebenen voneinander: „Die Transzendenz moderner Souveränität tritt ... mit der Immanenz des Kapitals in Konflikt.“ (HN 336) Gleichzeitig habe jedoch eine Hierarchie bestanden: „Historisch war das Kapital auf die Souveränität und die Unterstützung durch deren Rechts- und Machtstrukturen angewiesen“ (ebd.). Sie heben in diesem Zusammenhang hervor, dass die bürgerliche Gesellschaft „für eine historische Epoche als Vermittlungsinstanz zwischen den immanenten Kräften des Kapitals und der transzendenten Macht der modernen Souveränität (diente). Hegel ... verstand sie als Vermittlerin zwischen den unternehmerischen Einzelinteressen einer Vielzahl ökonomisch Handelnder und dem vereinten Interesse des Staates“ (HN 337). Die gegenwärtige Verfassung des Empire markiere nun den Übergang von einer durch Hierarchien gekennzeichneten Form der Regulierung des sozialen Lebens zu einer der verfeinerten Schritte, in denen diese Ausdrücklichkeit verschwunden ist. Diesen Prozess beschreiben Hardt und Negri als den Wandel von einer durch Disziplinierung zu einer durch Kontrolle gekennzeichneten Beherrschung der Gesellschaft.3 Ausgehend vom Gedanken einer ehemals gelungenen Vermittlung leiten sie zu den Prinzipien über, die das Regime des Empire auszeichnet. Dieses nehme Abstand von der „Allgemeingültigkeit“ der staatlichen Praxis und werde durch die „Einmaligkeit ... von Handlungen“ (HN 349) bestimmt. Des weiteren koaliere es mit gesellschaftspolitischen Interessengruppen legaler und gesetzwidriger Gestalt und wirke daher nicht integrierend. Die Durchsetzung politischer Ziele tendiere so zu „einer Streuung und Differenzierung“ (ebd.); und in ihrer Ordnung würden diese Formen der Verwirklichung mit „heterogenen und indirekten Mitteln“ (HN 350) erreicht. Hardt und Negri ziehen daraus die Konsequenz, dass gegenwärtig keine „Vermittlungsschemata“ oder „Vermittlungsinstanzen“ (HN 400) mehr bestehen, die geeignet wären, gesellschaftliche Divergenzen zu beherrschen. 3 siehe: HN. 336 ff. – Vgl. zum Begriff der “Disziplinargesellschaft”: M. Foucault, Überwachen und Strafen, Frankfurt/Main 1994 und zum Begriff der “Kontrollgesellschaft”: G. Deleuze, Unterhandlungen 1972-1990, 243 ff. Im Inneren des Empire 83 Diese fehlende Vermittlung gewinne ihre Brisanz durch die allgemein herrschende Tendenz zur Entmachtung der einzelstaatlichen Verfassungen gegenüber dem weltumspannenden Prozess der Globalisierung, „die im Verhältnis zu den Nationalstaaten überdeterminiert und relativ autonom agiert“ (HN 30). Zu untersuchen wird also sein, ob der Staat jemals in die beschriebene Form der Vermittlung integriert war, und ob sich nunmehr eine in der Tat neue Situation im Verhältnis der wirtschaftlichen zur politischen Verfassung ergeben hat. Daran schließt sich das Problem an, ob der Staat sich wirklich dem Primat einer sich autonom entwickelnden Weltwirtschaftsverfassung gebeugt hat. Dabei wird sich der Fokus der Untersuchung darauf richten, inwieweit die hegelschen Gestalten der Dialektik tatsächlich unvermittelt in die Verfassung des „Empire“ übergegangen sind, oder ob sie nicht nach wie vor eine Unvereinbarkeit zeigen. Den Ausführungen liegt die Begrifflichkeit Hegels zugrunde. Sie gliedert sich in die folgenden Schritte: Ausgegangen wird von der Autorität des „Staates“ als Grundlage des menschlichen Zusammenlebens und damit der Gebundenheit der „bürgerlichen Gesellschaft“ an die staatliche Ordnung. Im Rahmen der Betrachtung der Verfassungen der „Familie“ und der „bürgerlichen Gesellschaft“, in denen sich der Staat ausdifferenziert, wird nach der Instanz gesucht, die geeignet wäre, die nach wie vor bestehende Differenz zwischen diesen Institutionen auszufüllen. Damit soll der Punkt ihrer Vermittlung geklärt werden. Die weiteren Überlegungen beleuchten, inwieweit und wo die ökonomische Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft und der Staat übereinstimmen bzw. divergieren. Im Anschluß daran erst lässt sich die Position des Staates im Rahmen der Globalisierung klären. Eine der Konsequenzen, weiterhin die hegelsche Begrifflichkeit des „Staates“, der „bürgerlichen Gesellschaft“ und der „Familie“ zu verwenden, liegt darin, provokative, aber nicht entmutigende Züge aufrechtzuerhalten. Sie findet ihre Berechtigung auch darin, dass wesentliche Elemente aus dem 19. ins 21. Jahrhundert übernommen werden können, ohne grobe Sinnfälschungen vorzunehmen oder in Willkür abzugleiten. Dies zu klären, setzt allerdings die Kenntnis hegelscher Begrifflichkeit voraus. In diesem Sinn birgt, Hegel – auch gegen sich und das „Empire“ – in Anspruch zu nehmen, eine Polemik, die ihre Ironie nicht verschweigen will. 84 Wolfgang Langer Die Allgemeinheit der Autorität des Staates Die Bezeichnung des Staates als „Machtstaat“4 beinhaltet den Verweis auf eine ursprüngliche und allgemeingültige Totalität der Macht, deren Hoheitsgewalt und Legitimation sich aus sich selbst begründet. Betonte Hegel seine „grundlose Selbstbestimmung“5 „das schlechthin aus sich Anfangende“6 und seine „innere und äußere Unmittelbarkeit“7, ziehen Deleuze und Guattari daraus die Konsequenzen: „Immer wieder wird man auf die Idee eines Staates verwiesen, der voll entwickelt zur Welt kommt und auf einmal da ist, der „Urstaat ohne Vorbedingung.“8 Mit dem Staat erreicht der Geist in Hegels dialektischer Rechts- und Staatsphilosophie eine Gestalt „der Notwendigkeit des über alles bloß Besondere Macht habenden Allgemeinen“9, eine unnachgiebige, „unbiegsame kalte Allgemeinheit“10, deren Wesen die Unantastbarkeit seiner Autorität und Herrschaft ist. Das Wohl und das Recht aller sieht Hegel allerdings nicht in der Bilanz des Wohlergehens der Einzelnen, sondern vielmehr in dieser konzentrierten Form im Wohl des Staates und dem Interesse seiner Regierung an ihrem eigenen Bestehen. Das „Allgemeinwohl“ ist damit sowohl der unwiderrufliche Ursprung als auch das unanfechtbare gewordene Ergebnis, das keine Revision zulässt. – Diese substantielle Autorität „der 4 Th. Petersen, Die Freiheit des Einzelnen und die Notwendigkeit des Staates, in: Ch. Fricke, Th. König, Th. Petersen (Hg), Das Recht der Vernunft: Kant und Hegel über Denken, Erkennen und Handeln, Stuttgart 1995, 333-354, 346. Wir haben damit noch nichts über das Wirken des Staates ausgesagt; vgl. z.B. die Aussage M. Webers: “Staat soll ein politischer Anstaltsbetrieb heißen, wenn und insoweit sein Verwaltungsstab erfolgreich das Monopol legitimen physischen Zwanges für die Durchführung der Ordnungen in Anspruch nimmt.” (Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie, Tübingen 1980, 29) 5 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frankfurt/Main 1972, 249. 6 ebd. 250. 7 ebd. 255. Damit wird, im Blick auf die Monarchie, eine Erweiterung der Hegelschen Philosophie vorgenommen, die zwar den Kern einer gewissen Polemik beinhaltet, zunächst jedoch nur einer intensiven Wahrnehmung dienen soll. 8 G. Deleuze, F. Guattari, Tausend Plateaus, Berlin 1992, 592. Hegel betont auch die zeitenüberdauernde “Idee des Staates”, durch die eine Vernachlässigung der geschichtlich-historischen Aspekte gerechtfertigt wird. Vgl. G.W.F. Hegel, a. a. O., 215 f. 9 R.-P. Horstmann, Über die Rolle der bürgerlichen Gesellschaft in Hegels politischer Philosophie, in: Hegel-Studien Band 9 (1974), 209-240, 239. 10 G.W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Frankfurt/Main 1983, 330. Diese Bezeichnung ist – trotz ihrer Beziehung zur französischen Revolution – übertragbar, weil sie die Behauptung der Macht des Allgemeinen am deutlichsten zum Ausdruck bringt. Im Inneren des Empire 85 Dominanz der Allgemeinheit des Staates als der existierenden Vernünftigkeit“11 bildet nun auch die Gestalten des Lebens aus, die als „Wirklichkeit“ und „Wahrheit“ in ihrer Allgemeinheit bei den Menschen zu gelten hat. In diesem Monopol des Staates wird bereits das Moment der Ausgrenzung deutlich, das später noch zur Sprache kommen soll. Das Allgemeinwohl verwirklicht Herrschaft: „Souveränität“, schreibt v. Bogdandy, „hat bei Hegel den präzisen Sinn, dass das Grundprinzip des Staates in allen Momenten der Gesellschaft wirksam ist und gerade in den tatsächlichen Basisstrukturen und den sie reflektierenden Gesetzen lebt.“12 Aus seinem Einflussbereich differenzieren sich die verschiedenen Lebensbereiche der Menschen aus, die „Familie“ und die „bürgerliche Gesellschaft“13, zu denen in der Konsequenz dann der „Staat“ in Widerspruch tritt. So spiegelt sich in Hegels Charakterisierung der Familie der Prozess einer selektiven Schätzung des Wertes der Menschen für den Staat. Aus ihr lässt sich jedoch zunächst kein allgemeiner Einfluss ihrer maßgebenden Elemente ableiten, die Hegel im Gefühl konzentriert sieht, weil in der „Kälte“ der Allgemeinheit Empfindungen, Neigungen und Liebe nichts zu suchen haben.14 Die Familie mit ihren Mitgliedern erfüllt jedoch insgesamt eine maßgebliche Funktion, die Gesetze der Ökonomie zu verwirklichen. Schonungslos eröffnet Hegel der Familie ihre Wahrheit, dem Allgemeinen als „Material“ zur Verfügung zu stehen, aus dem wiederum eine bestimmte „Menge“ für die Erfüllung weiterer Ansprüche der Arbeitsverfassung vermittelt wird.15 „Unter den Bedingungen des ökonomischen Reproduktionsprozesses“, so M. Riedels Darstellung, „der die Grenzen des ‚ganzen Hauses’ überschritten hat, wird das Individuum aus ihm ‚herausgerissen’ und zum ‚Sohn der bürgerlichen Gesellschaft’.“16 Übrigens dient die entsprechende Verwendung bei Hardt und Negri ebenfalls der Unterdrückung und Ausbeutung (HN 400 ff.). Wird die Familie so aus der Perspektive der bürgerlichen Gesellschaft und der Finanzverfassung des Staates betrachtet, erhält sie neben dieser „Material“-Funktion eine weitere grundlegende Bedeutung: 11 12 13 R.-P. Horstmann, a. a. O. 237. A.v. Bogdandy, Hegels Theorie des Gesetzes, Freiburg; München 1989, 186 f. Vgl. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frankfurt/Main 1972, 214. 14 Vgl. G.W.F. Hegel, a. a. O. 153 f. 15 ebd. 223 f. 16 M. Riedel, Bürgerliche Gesellschaft und Staat bei Hegel, Neuwied; Berlin 1970, 22. 86 Wolfgang Langer „Die Familie hat als Person ihre äußerliche Realität in einem Eigentum, in dem sie das Dasein ihrer substantiellen Persönlichkeit nur als in einem Vermögen hat.“17 In diesem Zusammenhang verweist Hegel auf die „unmittelbare Grundlage (Kapital)“18, das den Maßstab für eine Partizipation am gesellschaftlichen Leben darstellt. Er setzt dabei schon die „Ungleichheit des Vermögens“19 voraus. Diese Abschätzung des „Vermögens“ der Familien wird für Hegel nun zu einer elementaren Komponente zur Bestandsicherung staatlicher Autorität. Die Finanzverfassung ist nicht nur bedeutsam für die Interessen der Einzelnen; sie ist entscheidend auch für den Staat und seine Beurteilung, welche Fähigkeiten er für besonders wichtig erachtet. Hegel betont unmissverständlich, dass es weniger die Begabungen sind als das Geld, das das Wesentliche für den Staat entfaltet: „In der Tat ist das Geld aber nicht ein besonderes Vermögen neben den übrigen, sondern es ist das Allgemeine derselben“20. Damit wird eine erste Diskrepanz zwischen Hegel und Hardt/Negri deutlich: Zwar mag das Geld ein erhabener Ordnungsfaktor der staatlichen Verfassung sein, es geht jedoch über seine Kontrollfunktion hinaus und hat deshalb nicht das letzte Wort21; es bedarf noch seiner Legitimation durch den Staat als das Allgemeinwohl. Hegel verdeutlicht bereits mit diesen Punkten, welche Aspekte für ihn aus staatlicher Sicht als „Allgemeinheit“ relevant sind: So findet die „Familie“ als dem Besonderen nur in Ausschnitten, die sich im „Material“ oder „Vermögen“ konzentrieren, Eingang in die Gesetze der Wirtschaftsverfassung. Das Geld hat deshalb nicht unvermittelt die „Allgemeingültigkeit“ (HN 349) des staatlichen Handelns abgelöst oder ist einer „Vermittlungsinstanz“ unterlegen, sondern es trifft auf dessen Beharrlichkeit, ohne in eine Vermittlung oder Versöhnung zu münden. Armut und Reichtum: Betrachtungen zur Verfassung der „bürgerlichen Gesellschaft“ Für Hegel ist die „bürgerliche Gesellschaft“ durch die gemeinschaftliche Umsetzung von unterschiedlichen und auch gegensätzlichen Interessen als 17 18 19 20 21 G.W.F. Hegel, a.a.O. 159. ebd. 179. ebd. ebd., 266f. vgl. HN 354. Im Inneren des Empire 87 dem je besonderen Wohl bestimmt, in das sowohl das „Kapital“ als das Vermögen der „Familien“ als auch die Geltung der „Familie“ als „Material“ von Arbeitskräften einmündet. Er betrachtet zunächst die allgemeine Konkurrenzverfassung der „bürgerlichen Gesellschaft“ als Äußerung des Besonderen: „Der selbstsüchtige Zweck in seiner Verwirklichung, so durch die Allgemeinheit bedingt, begründet ein System allseitiger Abhängigkeit, dass die Subsistenz und das Wohl des Einzelnen und sein rechtliches Dasein in die Subsistenz, das Wohl und Recht aller verflochten, darauf gegründet und nur in diesem Zusammenhange wirklich und gesichert ist.“22 Dadurch partizipiert die bürgerliche Gesellschaft bereits an der Autorität des Staates und der Allgemeinheit des Wohls.23 Die Wirklichkeit der bürgerlichen Gesellschaft als der Ordnung der gegenseitigen Abhängigkeit erfährt ihre Fundierung zudem durch eine bestimmte Gleichgültigkeit: „In der bürgerlichen Gesellschaft ist jeder sich Zweck, alles andere ist ihm nichts. Aber ohne Beziehung auf andere kann er den Umfang seiner Zwecke nicht erreichen; diese anderen sind daher Mittel zum Zweck des Besonderen.“24 Insofern übt der Wettbewerb in seiner Neutralität gegenüber dem Einzelnen eine herrschaftliche wie diskriminierende Funktion aus, weil er das Leben auf Zwecksetzungen reduziert und eine auf Gegenseitigkeit beruhende Legalität der Unterordnung schafft. Diese Funktion ist dem „Geld“ immanent. Das „Vermögen“ wird in Hegels Verfassung der bürgerlichen Gesellschaft zum Vorbild der Gesellschaft, das in seiner Bilanzierung die 22 G.W.F. Hegel, a.a.O. 169. – Der folgenden Behauptung kann daher nicht zugestimmt werden: “In der bürgerlichen Gesellschaft stehen sich Besonderheit und Allgemeinheit unversöhnt gegenüber. ... Die Allgemeinheit hat Vorrang: sie ist Form und Macht über die Besonderheit.” (R. Sonnenschmidt, Herrschaft und Knechtschaft: Hegel politische Philosophie und ihre theoretischen Implikation für eine Soziologie der Herrschaft, Bochum 1990, 67 f.) Denn die “Allgemeinheit” der Herrschaft verwirklicht sich in der Verfassung der bürgerlichen Gesellschaft. Dies belegt, obwohl aus einer anderen Ausgangsposition, folgende Stelle: “Hegel zeigt ... zwei Vermittlungsebenen, von der jede ihre Form der Allgemeinheit hat: die Ebene des Marktes, bestimmt durch die ökonomischen Gesetze, und die Ebene des Rechts, bestimmt durch die Rechtsgesetze.” (A.v. Bogdandy, a. a. O. 66) 23 Wir bestreiten damit die Rolle der bürgerlichen Gesellschaft als es “eigenständigen Bereich(s) zwischen Familie und Staat” (ebd. 63; vgl. auch 135; H.v.m.). Die bürgerliche Gesellschaft und der Staat werden aufgrund des Ausübens von Herrschaft als Einheit gesehen. 24 G.W.F. Hegel, a. a. O. 169. 88 Wolfgang Langer „Vereinzelung und Beschränktheit“ sowie „Abhängigkeit und Not“25 zeigt, das aber auch das Ergebnis der Mechanismen der ökonomischen Verfassung darstellt, „unverhältnismäßige Reichtümer in wenige Hände zu konzentrieren“26. Im Geld konzentrieren sich die Bestimmungen der bürgerlichen Gesellschaft, die auch für den Staat unmittelbar maßgebend sind. Während sich zum einen durch die Armut der „Pöbel“ bildet, sorgt die ökonomische Verfassung der bürgerlichen Gesellschaft zum anderen für den Reichtum. Das Geld regelt die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und erfüllt zugleich die Bedürfnisse der Regierungen. Dennoch kann es, obwohl es auch eine universal gültige Verfassung zur Stabilisierung von Herrschaft in sich trägt, das Versprechen der Allgemeinheit nicht erfüllen; denn: „Der Staat ist die alleinige Bedingung der Erreichung des besonderen Zwecks und des Wohls.“27 Mit dem „Staat“ nun tritt die Untersuchung in das Universum einer Allgemeinheit ein, das dann „erfüllt und wirklich lebendig [ist], wenn es mit der Besonderheit ... erfüllt ist“28. Zwar geht für Hegel die Handlungsfähigkeit des Staates und der Regierenden von einer „grundlosen Unmittelbarkeit“ der Autorität aus; sie bedarf jedoch auch einer inneren Bestimmung zur Überwindung der Differenz zur bürgerlichen Gesellschaft. Deshalb kann hier H. Marcuse nicht zugestimmt werden, wenn er schreibt: „Nach Hegel hat der Staat kein anderes Ziel als die ‚Vereinigung als solche’. Er hat mit anderen Worten überhaupt kein Ziel, wenn die gesellschaftliche und ökonomische Ordnung eine ‚wahre Vereinigung’ darstellt.“29 Denn diese Fusion ist nicht das Ziel; sie ist die Voraussetzung zur dauernden Sicherung der Macht und ihrer Ausbreitung. Die Verfassung der „bürgerlichen Gesellschaft“, die die Wirklichkeit des Staates insofern beeinflusst, als die wesentlichen Momente der „Besonderheit“, das Gewinnstreben und das Vermögen, erhalten bleiben, beeinträch25 26 27 28 29 ebd. 207. ebd. 208 ebd. 223 (H. v. m.). ebd. 274. H. Marcuse, Vernunft und Revolution, Frankfurt/Main 1990, 191. Damit ist auch die Grenze unterschritten, die Weber anführt: “Es ist nicht möglich, einen politischen Verband – auch nicht: den “Staat” – durch Angeben eines Zweckes seines Verbandshandelns zu definieren. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie, Tübingen 1980, 30. Im Inneren des Empire 89 tigt nicht sein Allgemeines, da er eben nicht als eine statische Einrichtung verstanden werden darf: Der als „Staat“ verobjektivierte Geist muss sich als flexibel und formbar zeigen, nicht nur um auf die Interessensituationen der bürgerlichen Ökonomie einzugehen, sondern auch um seinen eigenen Erhalt zu garantieren. Daher schafft der Staat nicht erst eine Gesamtordnung, da er an sich bereits die Einheit des Allgemeinen ist. Dieses Ganze bedarf jedoch bestimmter Interessen, die wiederum an die verfassungsmäßige Ordnung des Allgemeinen als der Bedingung, dass sie sich darin verwirklichen können, gebunden sind. „Die Entwicklung der Differenz zwischen Staat und bürgerlicher Gesellschaft ist“, wie R.-P. Horstmann schreibt, „eine notwendige Bedingung für die Begründung des Primats des Allgemeinen, also des Staates.“30 Damit wird bereits der Einfluss der bürgerlichen Wirtschaftsverfassung auf den Staat deutlich: sie ist verantwortlich für die Notwendigkeit der Berücksichtigung des „Besonderen“, das für den Erhalt des Staates erforderlich ist. Daraus aber folgt nun, dass auch das „Empire“ sich nicht vom Staat lösen kann, da jegliche „Verfolgung politischer Ziele“ (HN 350) vom Staat als deren Bedingung abhängig sind. Dies erklärt sich daraus, dass dessen eigene dialektische Mechanismen der Produktion von Armut für eine „Menge“ von Familien und von Reichtum als „Vermögen“ – wie bei Hegel zu sehen – in jeweils unterschiedlicher Hinsicht der Stabilisierung staatlicher Macht nicht entgegenstehen. Sie bestimmen die relevanten Mechanismen der Partizipation im Umfang des Vermögens und des ihm entsprechenden Einflusses. Die Beziehung des Staates zu dieser Instanz kann daher nicht dahingehend ausgelegt werden, wie Hardt und Negri es tun, dass in letzter Konsequenz der Wirtschaftsverfassung, als Gestalt des „Empire“, die „Ausübung legitimer Gewalt“ (HN 351) übertragen wird. Die Ordnung der differenzierten Interessen: Zur bürgerlichen Verfassung des Staates In einem dritten Schritt ist nun noch der Verwirklichung der „bürgerlichen Gesellschaft“ mit ihrer Besonderung des Strebens nach Reichtum im Allgemeinen des „Staates“ nachzugehen. Diese Verwirklichung vollzieht sich bei Hegel nicht als Versöhnung, sondern in der beständigen Konfrontation der ökonomischen und politischen Interessen, die in ihrer Unvereinbarkeit 30 R.-P. Horstmann, a.a. O. 238. Vgl. ebenfalls dazu Hegel, a.a. O. 169. 90 Wolfgang Langer dennoch zu einer partiellen Übereinstimmung kommen können. Hegel spricht vom „Konflikt ... gegen die gemeinschaftlichen besonderen Angelegenheiten und dieser zusammen mit jenem gegen die höheren Gesichtspunkte und Anordnungen des Staats“31. Die Beschreibung dieser Konfrontation der bürgerlichen Gesellschaft mit dem Staat betrifft jedoch, sehr zusammengefasst formuliert, die Verfassung der Differenz zwischen dem allgemeinen Interesse des Erhalts des Staates und den besonderen Interessen der bürgerlichen Gesellschaft in der Profitmaximierung. Genau diese Differenz bedingt, dass es auch einer Übereinstimmung der beiden Sphären bedarf. Der spezifische Ausdruck der bürgerlichen Gesellschaft, konzentriert in den wesentlichen Ansprüchen und institutionalisiert in ihren Interessenvertretungen, „schlägt in sich selbst zugleich in den Geist des Staats um, indem er an dem Staat das Mittel der Erhaltung der besondern Zwecke hat.“32 Dabei handelt es sich jedoch um kein Umschlagen aus einer „herrschenden Stellung ... in eine dienende Funktion“33; hier wird vielmehr deutlich, dass bürgerliche Gesellschaft und Staat ineinander mit unterschiedlichen Schwerpunkten verschränkt sind, ohne dass es einer Vermittlung oder Versöhnung der Differenz bedarf. In der Dimension des Staates gewinnen die Repräsentanten der Ökonomie allerdings nur dann eine Bedeutung, wenn sie erheblich und bedeutsam für den Staat selbst sind. Erst dann können sie fordern, durch das Allgemeine des Staates „vertreten“ zu werden. Der Staat enthält zwar in sich die Mehrdeutigkeit von Interessen, die zu ihrer Verwirklichung drängen, sich dabei aber im „Geld“ konzentrieren. Insofern repräsentiert der „Staat“ zunächst das „Geld“, da keine der staatlichen Gewalten allein über das erforderliche Vermögen verfügt, um die wirtschaftliche Verfassung aufrechtzuerhalten. Den absoluten Maßstab aber, der auch die Ordnung der 31 G.W.F. Hegel, a.a. O. 260. Der “Interessenkampf der Gruppen und Verbände” (O. Höffe, Politische Gerechtigkeit, Frankfurt/Main 1994) stellt die Herrschaft des Staates nicht in Frage, sondern ist der gegenwärtige Ausdruck einer herrschaftlichen Beziehung, der sie ermöglicht. 32 ebd. – Die folgende weitergehende Interpretation enthält ebenfalls den Schwerpunkt der Sorge um das Interesse: “Die Korporation ist kein bloßer Interessenverband, sondern für die Einzelnen von substantieller Bedeutung, da deren rechtliche Existenz von ihr abhängt.” (Th. Petersen, a.a.O., 345) Hier steht das Interesse steht im Vordergrund, denn ansonsten könnte diese Einrichtung keine wesentliche Bedeutung erlangen. 33 O. Cöster, Hegel und Marx: Struktur und Modalität ihrer Begriffe politisch-sozialer Vernunft, Bonn 1983, 372. Im Inneren des Empire 91 bürgerlichen Arbeitsverfassung und der politisch-administrativen Regelungen des Staates absichert, bildet für Hegel die Vertretung derjenigen, die den „besondern Interessen ... selbst angehören“34: „Es bietet sich von selbst das Interesse dar, dass unter den Abgeordneten sich für jeden besonderen großen Zweig der Gesellschaft z. B. für den Handel, für die Fabriken usf. Individuen befinden, die ihn gründlich kennen und ihm selbst angehören“35. Daher wird das Allgemeinwohl durch die „wesentlichen Sphären der Gesellschaft, Repräsentanten ihrer großen Interessen“36 ausgefüllt. Die „bürgerliche Gesellschaft“ treibt über ihre angenommene Begrenzung einzig und allein insofern hinaus, als das, was bisher ausschließlich durch die Ökonomie geprägt war, nun im Einverständnis mit dem Allgemeinen des Staates und seiner Autoritätsbildung besteht und die vermögenden Bürger dadurch auch für die Erfüllung des allgemeinen Wohls im Sinne der Stabilisierung staatlicher Autoritätsstrukturen auftreten können.37 Die eigensüchtigen Interessen können jetzt mit dem Staat als ihrem Mittel, und insofern sie für ihn und seine Selbsterhaltung bedeutsam und maßgebend sind, durchgesetzt werden. Diese Priorität des Staates wird z.B. von K. Lichtblau bezweifelt, der hinsichtlich dieser „Differenzierung“ in der Konsequenz ausschließlich dem Kapital die Position zuschreibt, die absolute Substanz zu bilden.38 Doch bei allem Einfluss der Dimension des „Geldes“, die die bürgerliche Gesellschaft durchzieht, enthält sie für Hegel zugleich die Einverständniserklärung durch die Verfassung des Staates, weil diese deren Allgemeinheit bildet, und weil auch der Staat auf sie nicht verzichten kann, nicht jedoch auf die Macht darüber selbst. Allerdings wird durchs Geld eine wechselseitige Beeinflussung erreicht; denn der Staat ist auf das Besitztum wie das Kapital angewiesen, und deren Konzentration ist wiederum geeignet, das Interesse des Staates zu erwecken. „Es ist Hegels These“, so Th. Petersen, „dass sowohl bürgerliche wie politische Freiheit abstrakt bleiben, solange sie kein Fundament in der ökonomischen Selbständigkeit der Einzelnen finden, der aus der Realisation seines Vermögens, insbesondere seines Arbeitsvermö34 35 36 37 38 G.W.F. Hegel, a.a.O. 276. ebd. 277. ebd. Vgl. ebd. 209. Vgl. K. Lichtblau, Das Zeitalter der Entzweiung, Berlin 1990, 91. 92 Wolfgang Langer gens, leben kann. In ‚ungehinderter Wirksamkeit’ (§ 243) realisiert die bürgerliche Gesellschaft diese Selbständigkeit aber nur für wenige.“39 Die Übereinstimmung von politischen und ökonomischen Interessen, die freilich den Widerspruch nicht dialektisch aufhebt, betont eine andere Wirklichkeit des „Empire“, die nach wie vor in der Abhängigkeit vom Staate herrscht. Dieser vertritt nicht unvermittelt die besonderen Interessen; sie haben vielmehr, wenn sie mit seiner Allgemeinheit übereinstimmen, Einfluss auf ihn. Das „Geld“, ausgedrückt in der Verfassung des Besonderen der bürgerlichen Gesellschaft, bestimmt bei Hegel die Partizipation der „Wenigen“ an der staatlichen Gewalt. Diese enge Beziehung zwischen der bürgerlichen Gesellschaft und dem Staat in der Form einer diskriminierenden Gewalt bestätigt Hegel noch in anderer Weise: durch diese Stabilität, die Konzentration von Vermögen einerseits und von Armut andererseits, erfährt die „Menge“ als Vielzahl der Menschen den Ausschluss von ihrer Teilhabe an der Wirtschaftsordnung und damit auch vom Staat, was wiederum die herrschende Ordnung festigt. „Es ist, als ob der Souverän allein auf der Welt wäre ... und nichts mehr mit seinen tatsächlichen oder potentiellen Untertanen zu tun hätte.“40 Zusammenfassung: Die zwei Modernen, die „Grundlinien der Philosophie des Rechts“ und das „Empire“, und ihr Grund Die dialektisch geprägte Figur der Diskrepanz beherrscht nach wie vor die Beziehung des Staates und der Ökonomie. Sie verdrängt die Annahme einer einseitigen und uniformen Herrschaft, wie sie die Autoren des „Empire“ vertreten. Nach wie vor ist richtig, dass das Kapital der Legitimation als Allgemeinwohl durch die Souveränität des „Staates“ bedarf. Hegels Vorhaben, den Staat mit der bürgerlichen Gesellschaft zu vermitteln, war bereits in der Durchführung seiner politischen Philosophie gescheitert.41 Dieses Kernproblem seiner politischen Philosophie zeigt das Misslingen einer dialektischen Rechtsverfassung, die maßgebende Machtverhältnisse verdecken würde. Weder hat Hegel eine „Vermittlung“ gegeben, noch gibt es erst 39 Th. Petersen, Wie modern ist Hegels Theorie der “bürgerlichen Gesellschaft?”, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Bd. 80, Nr.1, 1994, 109-116, 116. 40 G. Deleuze, F. Guattari, a. a.O. 516. – Vgl. auch Sh. Avineri: “Die Allgemeinheit des Gesetzes, wie sie durch den Staat vertreten wird, verdrängt die bloß individuellen Intentionen.” (a.a.O., 167) 41 M. Riedel, a.a.O. 79. Im Inneren des Empire 93 heute (als dem „Neuen“) eine Radikalität der Konflikte ohne Tendenzen ihrer Annäherung. Die Perspektive einer ehemals erfolgreichen Vermittlung suggeriert, die Prozesse wären früher kanalisiert gewesen42, während sie heute nicht mehr abgemildert seien. Mit einer solch einseitigen Betonung der Priorität einer grenzüberschreitenden Wirtschafts- und Handelsverfassung gerät der „Staat“ unzutreffenderweise aus dem Blick. Zwar mag seine Souveränität, wie Hardt und Negri meinen, aus der „Transzendenz“ in die „Immanenz“ des globalisierten Kapitals übergegangen sein, er übt jedoch immer noch mit dem Kapital seine Hoheitsgewalt über die Menschen aus. Er steht nicht etwa macht- und einflusslos der „Globalisierung“ oder dem „Empire“ gegenüber, sondern hat auf der politischen Ebene diese Entwicklungen bewusst gefördert. Bereits bei Hegel ist die Differenz zwischen der Verfassung des Staates und der Ökonomie vorherrschend, wenn diese auch der Sicherung der staatlichen Herrschaft dient. Für Hardts und Negris These vom Übergang einer transzendenten Disziplinarverfassung des gesellschaftlichen Lebens zu einer immanent wirkenden Instanz einer Kontrolle lassen sich zwar gute Gründe finden, doch bedeutet dies nicht, dass in solcher Verflachung der Hierarchie auch zwischen „Staat“ und „bürgerlicher Gesellschaft“ ein Übergang stattgefunden hat. Die Transzendenz des „Staates“ wirkt unaufhörlich fort, mag sie auch ihre Gestalt geändert und er bestimmte Aspekte einer wirtschaftlichen Verfassung in seine Regierung übernommen haben.43 Formulieren lässt sich daher in Abgrenzung zu Hardt und Negri (HN 339), dass die transzendenten Momente der vormaligen Disziplinargesellschaft sich auch in den immanenten Seiten der Kontrollgesellschaft des „Empire“ behaupten, und sie sich eher ergänzen. 42 43 siehe HN 337. Die Verfassung des Staates und der bürgerlichen Gesellschaft werden durch die Herrschaft ausgezeichnet. Vgl. dazu M. Weber: “I. Unter den Typus der ‚legalen’ Herrschaft fällt natürlich nicht etwa nur die moderne Struktur von Staat und Gemeinde, sondern ebenso das Herrschaftsverhältnis im privaten kapitalistischen Betrieb, in einem Zweckverband oder Verein gleichviel welcher Art, der über einen ausgiebigen hierarchisch gegliederten Verwaltungsstab verfügt. Die modernen politischen Verbände sind nur die hervorragendsten Repräsentanten des Typus.” (Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft, in: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 1985, 475488, 476) Sie unterscheidet sich lediglich in der Konzeption des privatisierten Rechts: “Die Geltung des ‚Vertrages’ als Basis stempelt den kapitalistischen Betrieb zu einem hervorragenden Typus der ‚legalen’ Herrschaftsbeziehung.” (ebd. 477) 94 Wolfgang Langer Zu keiner Zeit bestand zwischen den Interessen der „bürgerlichen Gesellschaft“ und denen des „Staates“ aufgrund ihrer unvereinbaren und andauernden Differenz die Möglichkeit einer Vermittlung, da die je besonderen nie zu allgemeinen Interessen werden können. Trotz dieser Unvereinbarkeit besteht eine Deckung, wo die besonderen Interessen der bürgerlichen Machthaber das Allgemeine des Staates ausfüllen, weil dessen Zweck nur durch die substantiellen und bedeutsamen „Selbstsüchte“ bestimmt wird. Sie gewinnen für Hegel daraus ihre Weihe durch den „Gang Gottes“ als der höchsten „Allgemeinheit“, womit sie unanfechtbar werden.44 Die bürgerliche Gesellschaft war daher auch nie geeignet, „die Vermittlungsfunktion zwischen Kapital und Souveränität zu übernehmen“ (HN 337), sondern war stets Ausdruck der für den Staat nützlichen und einflussreichen Konzentration des Geldes, die sich durch die Besonderungen der Gewinnsucht und der eigennützigen Zwecke konstituierte. Durch sie sieht Hegel zwar die Allgemeinheit des Staates im wesentlichen Umfang bestimmt; doch ist der Umkehrschluss verfehlt, der Staat vertrete lediglich diese „besonderen“ Interessen. Der „Staat“ und die „bürgerliche Gesellschaft“ sind daher allein durch ihre Differenz, die das „Geld“ ausfüllt, verbunden, die wiederum auch ihre politische und wirtschaftliche Verfassung rücksichtslos aufrechterhält. Zwar mag die Vereinbarkeit von Souveränität und Kapital „weitergehend“ sein; „neu“ ist sie nicht. Nach wie vor beruht die „Einmaligkeit ... von Handlungen“ (HN 349), durch die Hardt und Negri das Regime des „Empire“ ausgezeichnet sehen, auf der Autorität eines Allgemeinen, das den Grund für diese Modifikation auf „spezifische Ziele“ (ebd.) bildet. Mag die Beziehung oder der Zugriff auf die verschiedenen Institutionen und Interessengruppen heute einer Pluralisierung unterliegen, gesichert wird sie jedoch, wie gesehen, nach wie vor durch den Staat. Denn die Logiken der indirekten Machtausübung verleihen keine Autorität, sondern ergänzen sie nur oder füllen sie mit entsprechenden Inhalten. Und daher besteht nach wie vor die Abhängigkeit 44 Vgl. G.W.F. Hegel, a.a.O. 218. – Die Mechanismen der bürgerliche Gesellschaft können zwar in ihrer Willkür nicht vorhergesehen werden, doch ist nicht eine “Koinzidenz der besonderen Zwecke mit dem Ganzen der Gesellschaft ... eine Sache des Zufalls”. (M.A. Giusti, Hegels Kritik der modernen Welt: Über die Auseinandersetzung mit den geschichtlichen und systematischen Grundlagen der praktischen Philosophie, Würzburg 1987, 136) Im Inneren des Empire 95 der ökonomischen Verfassung vom Staat. So beschreibt das „Empire“ zwar durchaus angemessen eine neue Verfassung der ökonomisch-politischen Herrschaft, aber diese setzt bereits eine andere Ordnung, die des „Staates“ zur „bürgerlichen Gesellschaft“, voraus und kann sich daher nicht in der Autonomie, wie Hardt und Negri sie beschreiben, verwirklichen. Solche Annahme bewertet die – allein durch die Differenz bestimmte – Mitwirkung und -gestaltung der staatlichen Gewalt durch die „bürgerliche Gesellschaft“ nicht intensiv genug, die den „Staat“ und damit auch jede ihm übergeordnete supranationale Verfassung bestimmt. Aus der Einsicht in dieses Verhältnis von Staat und bürgerlicher Gesellschaft könnte sich auch eine Diskussion über die künftigen Machtpositionen der Hegelschen „Menge“45 ergeben, wenn etwa das von Hardt und Negri anvisierte Ziel einer künftigen „Weltbürgerschaft“ (HN 403 ff) betrachtet wird. Sein Sinn könnte dann fraglich erscheinen, wenn sich darin Elemente verbergen, die geeignet sind, die Verfassung der „bürgerlichen Gesellschaft“ mit ihren Konsequenzen im globalen Maßstab zu verwirklichen. Die Sorge, dass aufgrund des gewachsenen Einflusses der Finanzmärkte eine Ausgrenzung der „Menge“ aus den wirtschaftlichen und politischen Prozessen mit der Folge einer zunehmenden Ohnmacht weiter Teile der Menschheit zu befürchten sei, bestätigt sich in der hegelschen Philosophie. Deren Begriffsverfassung wirkt also fort. Denn auch der Globalisierung liegt weiterhin die innige Beziehung des „Staates“ zur „bürgerlichen Gesellschaft“, sei sie durch Widersprüche und Konflikte zwischen den wirtschaftlichen und staatlichen Verfassungen oder den Interessen der bürgerlichen Gesellschaft gekennzeichnet, zugrunde. Und die „lokale Wirksamkeit“ (HN 350) des „Empire“, die Hardt und Negri konstatieren, beruht auf dem ungebrochenen Ansehen des Staates mit seiner Autorität. Dieses Fortwirken nur vermeintlich „alter“ Begrifflichkeiten gilt es, zu berücksichtigen, wenn die modernen Herrschafts- und Unterdrückungsmechanismen des „Empire“ in ihrer ganzen Tiefe erkannt werden sollen. 45 Vgl. HN 400 ff. WIDERSPRUCH Münchner Zeitschrift für Philosophie Nr.39 Kritik der Globalisierung außereuropäische Perspektiven Afe Adogame: eine afrikanische Perspektive Oliver Kotzlarek: Zur Kritik der Moderne in Lateinamerika Norbert Walz: Die Erlösung der Natur Raúl Claro Huneeus: Das „Memorandum“ der Heinrich-Böll-Stiftung Thies Boysen / Markus Breuer: Ausverkauf der Ethik? Ram Adhar Mall: zwischen Asien und Europa ... und viele Rezensionen philosophischer Neuerscheinungen erhältlich in allen uni-nahen Buchhandlungen Preis: 6.- EUR Eberhard Simons Die „Neue Oikonomia“. Ein Gespräch Widerspruch: Herr Simons, wie sind Sie eigentlich zur Philosophie gekommen? Simons: Als Gymnasiast habe ich gar nicht gewusst, was Philosophie ist. Man studierte damals auch nicht Philosophie. Widerspruch: Weil die Eltern sagten, Philosophie sei brotlose Kunst? Simons: Nein, weil es abseitig war. Fast so abseitig wie Hethitologie. In der Oberstufe bekam ich dann einen Deutschlehrer, der uns – und zwar fakultativ – einen Zugang zur Philosophie vermittelte. Nun hatte ich aber noch immer nicht Philosophie studieren wollen, sondern Theologie. Ich begann mein Studium in Innsbruck; und da war es obligatorisch, vor der Theologie vier Semester Philosophie zu studieren. Wer mich dann aber eigentlich zur Philosophie brachte, das war ein Theologe, nämlich Karl Rahner. Er hat so gute Vorlesungen gehalten, in denen er versuchte, wirklich theologisch zu denken – einer der wenigen denkenden Theologen. Ich habe ihn sehr bewundert. Durch ihn wurde ich darauf gebracht, dass man Theologie nicht mehr in herkömmlicher Weise betreiben kann – zumal er zwar immer die Folie „scholastische Theologie“ zugrundelegte, dann aber anhob, in Abgrenzung dazu eine neue denkende Theologie zu entwickeln, die er philosophisch „Transzendentalmetaphysik“ nannte. Ich merkte bald, dass man Theologie eigentlich nicht ohne Philosophie studieren kann. Und so ging ich 1963 dann nach München. 98 Eberhard Simons Widerspruch: Rahner kam ein Jahr später nach München. Er ist ihnen sozusagen gefolgt. Simons: Hahaha. Ja. Er kam auf den Guardini-Lehrstuhl. Und ich war bei den Jesuiten als Externer. Mein Lizenziat oder meinen Magister ich habe dann bei Johann Baptist Lotz gemacht, der am Berchmannskolleg in München-Pullach und an der Gregoriana war. Mein Magisterthema war damals recht hochgegriffen: „Der Seinsbegriff bei Thomas von Aquin und bei Heidegger“. Danach wandte ich mich der Transzendentalphilosophie zu. Mein Terrain wurde: Kant, Fichte, Fichte, Kant – und so kam ich zu Reinhard Lauth, dem Herausgeber der ersten kritischen Fichte-Ausgabe. Lauth brachte mich zu der Erkenntnis, dass die „Transzendentalmetaphysik“, die von Heidegger kam und in München von Lotz, Rahner und Max Müller vertreten wurde, zur Transzendentalphilosophie werden müsse. Und über die Mängel der Transzendentalmetaphysik, dass sie keine Interpersonalitätstheorie und keine zureichende Geschichtstheorie hatte, habe ich dann in Auseinandersetzung mit einer bestimmten religionsphilosophischen Schrift Karl Rahners meine Dissertation verfasst. Widerspruch: Bei Reinhard Lauth? Transzendentalmetaphysik contra Wissenschaftslehre? Simons: Ja. Das Buch hieß „Philosophie der Offenbarung“ und erschien bei Kohlhammer. Es erregte denn auch bei den Jesuiten recht großes Aufsehen und wurde in der Akademie der Wissenschaften diskutiert. Aber sie kamen mit ihrer Kritik nicht durch. Rahner selbst war mit der Kritik sehr einverstanden und meinte, es sei eine der besten Kritiken, die er je in seinem Leben erfahren habe. Ja – und das alles machte ich eigentlich nur als Vorbereitung, um Theologie zu studieren. Widerspruch: Wann war das? Simons: Ende der 60er Jahre. Bald kamen mir aber doch große Bedenken bezüglich des Berufes der Theologie. Denn damals waren Laien in der theologischen Fakultät nicht gefragt, und außerdem hatte ich eine Lebensgefährtin kennen gelernt. Jedenfalls, mit Priester-Werden war nichts mehr drin. Die „Neue Oikonomia“ 99 Widerspruch: Hatten Sie auch Probleme wegen der Kritik in Ihrer Dissertation? Simons: Nein. Sie kam eigentlich recht gut an. Ich hatte also vor, weiter Philosophie zu betreiben und mich zu habilitieren. Und da traf es sich, dass gerade Hermann Krings von Saarbrücken nach München kam. Bei ihm habe ich dann – damals musste man noch fragen, ob man auch genommen wird – als Habilitand gearbeitet und schließlich über die philosophische Gottesfrage habilitiert, dargestellt an Ernst Blochs „Geist der Utopie“. Widerspruch: Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen? Simons: Über einige „Umsteiger“. Anfangs wollte ich über Nikolaus von Kues’ Schrift „De visione dei“ habilitieren – eine wunderschöne Schrift, die er 1451 seinem Freund am Tegernsee geschenkt hatte. Krings meinte, ob sich das nicht etwas aktualisieren ließe, und so kam Feuerbach dazu. Bloch war dann natürlich auch naheliegend. Und so hatte ich drei Autoren. Ich sagte Krings: „Nee, also drei, das ist zuviel.“ Cusanus und Feuerbach habe ich fallen lassen und mich ganz auf den Bloch gestürzt. Widerspruch: Unter welcher Thematik? Simons: Eben nicht mehr unter dem Gottesbegriff; denn bei Bloch gibt es zwar ein Transzendieren, aber ohne Transzendenz. Das Buch hieß: „Freiheit und Methode“, worin ich neue Methoden entwickelt habe, die die Kategorien und die Logik künstlerischer Produktion und Imagination betrafen. Widerspruch: Dies geschah in Auseinandersetzung mit Bloch? Simons: Ja. In Darstellung und Auseinandersetzung mit Ernst Bloch. Ich hatte damals das Glück, dass von den fünf Gutachtern jeder in meiner Habilitationsschrift sein Kapitel fand. Denn zunächst zweifelte ich, ob ich meine Bloch-Schrift in München überhaupt durchkriege. Wir hatten nämlich in München eigentlich nur zwei Schulen: die eine war die „Metaphysik“ – von Platon über Plotin bis kurz vor Descartes –; die andere ging von Descartes bis zu Schelling, Fichte und dem früheren Hegel. Mehr gab’s nicht. Und dementsprechend gab es auch zwei Fußballmannschaften: die Metaphysiker und die Transzendentalen. 100 Eberhard Simons Widerspruch: Und da lag Bloch nicht nur dazwischen, sondern ganz daneben. Simons: Ja. Aber es war damals eben auch die Zeit der Studentenbewegung, 1971 und folgende. Und da kam ich nicht nur recht, sondern – gewissermaßen wie die Jungfrau zum Kinde – auch zum Einsatz. Denn die „Roten Zellen“ und dann die „Marxistische Gruppe“ setzten den Herren sehr zu, teils mit faulen Eiern und Tomaten, aber auch mit sehr gezielten Sit-ins. Und die Professoren dachten, dass jetzt ein Junger an die Front müsse, und so verfiel man auf mich und hat mich an die vorderste „MG-Front“ geschickt. Aber dazu musste ich Hegel studieren; denn mit Fichte allein ging das nicht. Also: Kritische Theorie, Hegel und Marx, das waren die Schwerpunkte. Ich habe dann selbständig Hegel studiert, und in der Folgezeit 10 Semester Hegels „Logik“ und daraufhin noch mal 10 Semester die „Phänomenologie des Geistes“ gelehrt. Widerspruch: Aber „Subjekt-Objekt“ von Bloch, das ist im Grunde doch Hegel. Und Sie hatten sich damals noch nicht damit befasst? Simons: Nein. Es war nicht das Thema meiner Arbeit gewesen, sondern das Geschichts- und Religionsphilosophische bei Bloch, vor allem in seinem Frühwerk „Geist der Utopie“. Widerspruch: Es überrascht, dass die Auseinandersetzung damals so koordiniert geschah, und man vom Fachbereich an die „vorderste Front“ geschickt wurde. Gab es dafür wenigstens auch Meriten? Simons: Ja, nämlich ein gutes Gehalt. Es gab auch Neid-Unmeriten. Denn der Hörsaal, wo ich las, war bis auf den letzten Notsitz krachend voll. Einem älteren Kollegen, der auch teilnehmen wollte, erging es so, dass er keinen Platz fand und schließlich wieder abziehen musste. So etwas sollte man mit 32 Jahren nicht tun. Da gab es panischen Neid. Der hat mich dann so erwischt, dass, wenn bei den Berufungsverhandlungen gefragt wurde, man mich immer über alles gelobt hat. Ich dachte immer: „was wollen die denn nun?“ – Man hat dann auch gesagt, es sei ja leicht, heute mit „Kritischer Theorie“, Hegel und Marx alles voll zu haben. Und so wurde ich schließlich auf die Antike angesetzt: Platon, Aristoteles, Vorsokratiker usw. Die „Neue Oikonomia“ 101 Widerspruch: Aber Sie hatten doch eine freie Wahl Ihrer Themen. Simons: Hatte ich schon. Aber wenn man damit Geld verdienen will, darf man nicht. Da ich damals eine C3-Stelle vertrat, musste ich antike Philosophie machen. Ich hab’s auch gerne gemacht. Und da geschah dasselbe wieder: erst waren es wenige – und man meinte, ich müsse jetzt auch mal das trockene Brot kennen lernen –, aber dann wurde es auch da immer voller. Und so habe ich mir auch die antike Philosophie angeeignet. Widerspruch: Sehen Sie im Rückblick auf ihre Arbeiten so etwas wie einen „roten Faden“, der Ihr Philosophieren durchzieht? Simons: Ja. Es gibt einen „roten Faden“, der immer stärker wurde, zumal ich als Nebenfächer noch Kunst- und Kulturgeschichte und auch Ökonomie studiert habe. Also, ich sage das mal etwas schematisch: Die Scholastik mit Thomas von Aquin, die in der katholischen Kirche ja bis zum 2. Vatikanum für alle Theologen und alle philosophischen Hochschulen verbindlich war, hatte ich spätestens mit meiner Kritik an Rahners Transzendentalmetaphysik ad acta gelegt und mit der Hinwendung zur Transzendentalphilosophie überwunden. Dann kam Hegel dazu, der vor allem durch die Kategorienlehre in seiner „Logik“ eine ganze weitere Dimension eröffnet hat. Ich kam so zu einem dialektischen Denken. Schließlich kam noch ein Weiteres hinzu. Das dialektische Denken war für mich – wie soll ich sagen – keine reine Dialektik, sondern von Marx her gedacht auf die Ökonomie bezogen, zumal der junge Hegel ja auch sehr viel ökonomisch gearbeitet hatte. Es war zwar anders als bei Marx, aber doch auf Ökonomie bezogen. Was nun die Ökonomie anlangt, so kam ich bald auf eine neue Erkenntnis, nämlich einen neuen Begriff des Handelns. Aristoteles kennt als Handlungsbegriffe ja nur die Techne, die Praxis und die Energeia. Im Timaios jedoch, in seiner Kosmologie, spricht Platon vom „drãn“, vom göttlichen Handeln, woher das Wort „Drama“ stammt. Und dies dramatische Handeln hat es mir angetan: das dialektisch-dramatische Handeln. Denn es eröffnet ganz besondere Möglichkeiten in der Umsetzung des Dialektischen auf die Ökonomie, aber auch auf die Um- und Lebenswelt. Und da lag es nahe, dramatisches Handeln von Nietzsche her neu zu durchdenken. Die „Tragodia“ und die „Komodia“, das sind ja die beiden Eröffnungen des dramatischen Handelns. Ich stürzte mich also auf Nietzsche und bemerkte, dass er ungeheuer 102 Eberhard Simons viel Antikes hatte und es umgeprägt hat, und dass er Fragen behandelt, die sehr nahe an einer Lebensökonomie sind. Widerspruch: War Ihr dramatischer Handlungsbegriff mehr ethisch oder geschichtsphilosophisch gemeint, oder alles übergreifend, wenn man so sagen will? Simons: Na ja, also. Bei Nietzsche ist dieser Handlungsbegriff sehr durchgängig: eine gänzliche Umwandlung der Moral. Und bei mir wandelten sich die Vernunftkonzepte: erst eine metaphysische Vernunft, dann eine transzendentale und eine dialektische Vernunft, schließlich die dialektischdramatische Vernunft. Und die letztere hat es mir angetan. Diesen Vernunftbegriff habe ich durchentwickelt; und da zeigte sich, dass, was als roter Faden erst klein anfing, sich als das Tragfähigste erwies. Nämlich eine neue Ökonomie, die eine Ökonomie des Lebens, des Kosmos und auch der Welt umfasst. An der bin ich jetzt dran, und habe dazu eine Stiftung gegründet, die Europäische Stiftung „Neue Oikonomia für Wirtschaft und Kultur“, die ganz schöne Erfolge hat und sich für die heutige Wirtschaft als sehr ergiebig erweist. Mit ihr hat man die Chance, wirklich philosophisch zu arbeiten, hat es aber zugleich auch mit sehr konkreten Projekten zu tun. Widerspruch: Können Sie das erläutern? Simons: Die Oikonomia? Widerspruch: Ja. Und ihre Verbindung mit dem dramatischen Handlungsbegriff und mit Nietzsche. Simons: Ich sage Ihnen erst mal etwas zur Hardware der Oikonomia. Sie beinhaltet ein Beratungs- und Führungswissen. Und die Software der Oikonomia ist eine kyklische Risikokalkulierung. Denn wenn man kalkulierend etwa auf Erwartungen erwartend eingeht und diese Erwartung ihrerseits erwartet, dann kann man das nicht mehr linear darstellen. Während die gängige Kalkulation linear ist, verwenden wir eine kyklische. Wir setzen sie an einzelnen, teils ganz aktuellen Punkten und Themen an. Das Dramatische an ihr ist, dass man auf Konflikte nicht regulativ eingeht, sie wegreguliert, sondern dass man sie austrägt. Und aus dieser, auch ökonomischen, Konfliktaustragung kommt etwas in Gang, was im anderen Fall unterdrückt wird. Die „Neue Oikonomia“ 103 Widerspruch: Denkt man diese Konfliktaustragung mit Hegel oder Marx, dann ist sie mit einem Begriff vom Fortschritt verbunden: ein Fortschritt in und durch Gegensätze und Widersprüche. Mit Nietzsche aber lässt sich das wohl kaum verbinden. Simons: Nein, so nicht mehr. Also, den Marx habe ich schon rauf- und runterstudiert; allein schon wegen der „MG“. Nein, in diesem Sinne gibt es keinen Fortschritt. Es ist aber auch kein Rückschritt, sondern eine Art von ... Widerspruch: Lebensbewältigung? Simons: Ja, genau. Ich denke schon auch, dass es Fortschritte gibt; aber im Sinne einer Geschichtslogik des Fortschritts meine ich das nicht. Widerspruch: Wenn es Konflikte gibt, dann muß es entweder Regeln zu ihrer Bewältigung geben oder sie werden ausgetragen. Man braucht dann aber eine Art Fundament, das den Optimismus begründet, dass es keiner Regeln bedarf, sondern die Konflikte sich selber tragen. Was ist das? Simons: Die Konflikte teilen sich mit. Und aus der Mitteilung der Konflikte kommt etwas in Gang. Widerspruch: Und das, was in Gang kommt, ist nicht schlecht, sondern gut. Simons: Ja, das ist gut. Widerspruch: Woher wissen Sie das? Simons: Das ist gewissermaßen die Grundvoraussetzung der Oikonomia, daß Konfliktaustragung etwas bringt. Sie bringt von selber etwas aus sich selbst. Zu ihr gehört deshalb auch wesentlich die Initiation des Anfangs. Die Oikonomia – und das ist ganz frühe Antike – ist nicht ausschließlich zielorientiert, um nicht zu sagen: zielhypnotisiert, wie die moderne Ökonomie, sondern sie ist anfangserschlossen. Sie ist ein Denken ex arches. Und die Arche ist es, um die es geht. Mein Freund Albert – wenn ich mir erlauben darf, so zu reden – wen hatte der denn als seinen Lehrer? Parmenides. Mit Parmenides, dem Arche-Denker, hat Albert Einstein die Gegenwart als das Jetzt wiederentdeckt. Denn physikalisch war die Zeit ja verschwunden und war Dimension des Raumes oder ein Punkt. Einstein hat die Zeit und die Zeitigung der Gegenwart wiederentdeckt, und diese Gegenwartswieder- 104 Eberhard Simons entdeckung hat uns von der „Weltraumwelt“ zu einem neuen Universum gebracht. Und kam durch Parmenides. Widerspruch: Sie meinen, die Relativitätstheorie wäre ohne Parmenides nicht möglich gewesen? Simons: Ja. Und so anfangsorientiert ist die Neue Oikonomia auch. Sie ist nicht mehr einfach zielorientiert. Sie hat keinen Gott im Sinne einer causa prima, die die Schöpfung macht, aber auch nicht im Sinne eines zielbestimmten metaphysischen Seins als finaler Kausalität. Die Anfangserschlossenheit ist das Eigentümliche der Oikonomia. Sie ermöglicht daher nicht nur Innovationen, sondern auch Initiationen. Sie bedenkt: „Woher kommen die Einfälle?“ „Was ist die Einbildungskraft, die sie hervorbringt?“ Und: „Wie kann man Einfälle erschließen?“ Daher gibt es in der Oikonomia auch als Spezial- und Sonderthemen etwa eine Ökonomie des Geizes und daraus dann eine Ökonomie des Gewinns. Das ist natürlich ganz aktuell. Widerspruch: Dann ist hier also die Initiierung der Ausgangspunkt. Wenn was mal aufs richtige Gleis gesetzt ist, dann... Simons: Wenn das nicht mechanisch gedacht ist, dann ja. Dann geht’s gut. Widerspruch: Nun hat der Anfang jedoch die zwei Seiten: einerseits ist noch nichts da, sonst wär’s nicht der Anfang; andererseits ist aber doch etwas da. Und darin soll nun gleichsam keimförmig Vieles angelegt sein. Woher weiß man denn, dass das am Anfang gut ist? Simons: Es ist eben nicht am Anfang, so daß er am Anfang eingeordnet ist, sondern es ist aus dem Anfang: ex arches. Und aus dem Anfang geschieht ein bleibendes Anfangen. Es bleibt der Anfang der Vergegenwärtigung der Welt aus dem Zeitigen von Zeit als Gegenwart. Der Anfang bleibt. Es ist eben ein Unterschied, ob man zielorientiert oder anfangsorientiert denkt. Auch die Transzendentalphilosophie ist ja anfangsorientiert, wenn sie die Gegenständlichkeit der Gegenstände überhaupt und die Selbstbewusstseinsvoraussetzungen für Gegenständlichkeit behandelt. Sie ist eine Anfangs-, Aprioriforschung. Widerspruch: Aber bei Ihnen ist dieses Apriori doch nicht transzendental gemeint, sondern selbst geschichtlich. Die „Neue Oikonomia“ 105 Simons: Ja. Und wir haben wegen dieser Geschichtlichkeit auch die Chance, so etwas wie eine Schicksalsökonomie zu betreiben. Wir können zum Beispiel die Frage verhandeln, was daraus folgt, dass Deutschland über 600 Jahre ein königs- und führungsloses Land war. Und warum Deutschland zu den ganz wenigen Ländern gehört, in dem bis zum hohen Mittelalter die Sonne – wie sonst überall auch – maskulin war: „der Sun“. Vom 12. bis 16. Jahrhundert dann aber feminin wurde: „die Sunna“. Man kann sagen, das seien läppische Geschichten, aber schicksalsökonomisch ist das, glaube ich, bedeutsam. Widerspruch: Wollen Sie sagen, die Sonne wurde feminin, weil die StauferHerrschaft zerbrochen ist? Simons: Ja, natürlich. Denn danach gab es keinen deutschen König mehr; es folgte eine führungslose Zeit von 600 Jahren, wo mit Deutschland alle machen konnten, was sie wollten. Die Herrschaft ging über an die Habsburger und die haben sich um Deutschland nicht gekümmert. Einer kam zwar zur Zeit der Reformation mal kurz herein, verschwand aber schnell wieder. Es gab freilich auch Ludwig den Bayern, der ja hier an der Oper eine Akademie gegründet hat. Aber das blieb Episode. Die 600 Jahre Führungslosigkeit zeigen viel von Deutschland, und daraus kann man schicksalökonomisch einiges entdecken und neue Zugänge zur Deutschlandfrage entwickeln. Wir machen das in unser Stiftung, die das theoretisch erforscht und dazu Veranstaltungen macht. Zudem ist an der Münchner Fakultät eine Zusatzausbildung für eine Managerausbildung von zwei Semestern vorgesehen, die mit einem „Master of consulting“ abschließt. Dieser Studiengang soll interdisziplinär mit Betriebswirten, Ökonomen und anderen betrieben werden. Der Rektor hat schon verkündet, dass die Münchner Universität eine Hohe Schule der Managerausbildung wird. Und dabei haben wir mit unserer Stiftung eine wichtige Funktion. Widerspruch: Das hat aber nun nichts mit der Schicksalsökonomie zu tun, sondern bezieht sich doch wohl eher auf das kyklische Management, das Sie beschrieben haben. 106 Eberhard Simons Simons: Na ja; ich halte jetzt eine Vorlesung über „Neue europäische Vernunft“. Und da kommen doch auch schon schicksalsökonomische Fragestellungen herein. Widerspruch: Sie haben längere Zeit Vorlesungen über Ägypten gehalten. Haben diese auch mit jenem Anfangs-Gedanken zu tun? Simons: Ja. Denn das normale Schema sagt doch: Europa hat zwei Wurzeln, die eine ist das Juden- und Christentum, und die andere das Griechen- und Römertum. Völlig ausgeblendet wird dabei jedoch, dass die Wiege Europas am Nil stand. So ist die ganze griechische Kultur die Fortsetzung der ägyptischen Weltauslegung, die über Kreta, die minoische Kultur, bis zur mykenischen Kultur reicht, bis dann die Dorer den ägyptischen Mythos umformuliert haben und die griechische Dichtung entstand, wo auch die Philosophie ihre Anfänge hat. Die Griechen jedenfalls haben sich immer als die Söhne Ägyptens verstanden. Auch die Juden sind ja Söhne Ägyptens. Wenn wir annehmen, dass Moses eigentlich „Tutmosis“ hieß, vielleicht sogar ein Pharaosohn war, dann wird das evident. Dass Ägypten aus dem europäischen Kulturhorizont so herausgefallen ist, liegt daran, dass für die Juden immer der Exodus entscheidend war, und Ägypten das Land der Knechtschaft. Und das hat sich durchgesetzt, so daß wir den ägyptischen Kulturhorizont nicht mehr haben. Widerspruch: Historisch mag das ja stimmen. Aber liegt der Anfang nicht da, wo es nicht kontinuierlich weitergeht, sondern wo es Brüche gibt: Anfänge, die ein Feld eröffnen, das vorher nicht schon vorhanden war? In Griechenland ist geistesgeschichtlich doch etwas passiert, was sich nicht von Ägypten her erschließen läßt. Meinen Sie wirklich, das parmenideisches Denken sei schulmäßig ägyptisches Denken? Simons: Ja. Denn der Lehrer von Parmenides war Pythagoras. Und Pythagoras hatte „Bünde“ geschaffen, aus denen Parmenides hervorgegangen ist. Ich sage ja nicht, daß es unmittelbar folgt, sondern nur, dass Parmenides davon inspiriert war, und dass er das nun in eine andere Sprache übersetzt hat. Insofern sehe ich hierin eine Kontinuität, die übrigens bis zu Alexander dem Großen weitergeht. Widerspruch: Es gibt aber doch den Streit zwischen Ägypten und Israel. Auch wenn man den monotheistischen Gedanken vielleicht ansatzweise bei Die „Neue Oikonomia“ 107 den Ägyptern schon finden kann; aber dass der Gott der Juden ein moralischer Gott war mit Verpflichtungen, Sünden und Aspekten der Freiheit – das wird doch als Kontrapunkt gegenüber dem Ägyptischen verstanden. Selbst wenn man den einen oder anderen Pharao nennen mag, der dem Monotheismus nahe kommt. Simons: Amenophis Echnaton. Widerspruch: Etwa. Juden und Christen würden dennoch behaupten, daß bei allem Vergleichbaren eine entscheidende Differenz bleibt. Simons: Also. Normalerweise ist es das Schema, dass der Monotheismus als höher angesehen wird als der sogenannte Polytheismus, von dem allerdings vor dem 9. Jahrhundert niemand geredet hat. Aber die Monokratie – jetzt sag ich es mal so – war für Europa verheerend. Denn wir haben die größten Konflikte und Kriege der Monokratie, also der Einmannherrschaft bis hin zu Stalin und Hitler, zu verdanken. Die Monokratie war überhaupt kein Segen für Europa, sondern eher ein Unglück. Und von daher halte ich die Auskunft, der Monotheismus sei das bei weitem Höhere und das andere das „Heidnische“, für obsolet. Die Sprache nicht nur der Ägypter, sondern auch der Griechen war nicht nur monokratisch. Sie hatten zum Beispiel auch ein Verhältnis zu den Tieren. Das war nicht übles Heidentum, sondern Zeus selbst hatte ein Verhältnis zu den Tieren, zum Stier, zum Schwan, zur Schlange sogar und zum Adler. Er verwandelte sich in einen Stier, als er die Europa nach Kreta holt. Aber auch die Juden schielten nach Ägypten oder nach dem Baal und wollten gern einen Stierkult haben. Als Moses auf dem Berg Horeb war, haben sie es gewagt, nur ein Stierlein, das berühmte „Goldene Kalb“, zu verehren. Da gab es gleich ein Donnerwetter sondergleichen. Lesen Sie das bitte mal nach. Man kann diese Geschichte aber auch ganz anders herum lesen. Im Ägyptischen jedenfalls war es eben nicht einfach der Pharao, sondern es war die Pharaofamilie: Isis und Osiris mit Horus. Das ist eine ganz andere Weltauffassung als die Weltauslegung, wie sie in der Moderne dann zum Tragen kam. Bei Kant z.B. haben wir ja so etwas wie die eine „Rund-umdie-Uhr-Erkenntnis“, das transzendentale Bewusstsein. Ägyptisch konnotiert aber wäre es, wenn wir auf die Unterschiede zwischen einer Morgenund Abend-, Mittags- und Mitternachtserkenntnis achten würden. 108 Eberhard Simons Widerspruch: Sie sagen damit, dass die neue Oikonomia in der Rückbesinnung auf ägyptische Denkformen vieles wiederentdecken kann. Simons: Ja. Eben auch als Heilungsökonomie. Wir halten auch Tagungen in der Oase Siwa ab, einem herrlichen Oliven- und Palmenhain mit Quellen, südlich von Alexandrien. Dort wurde Alexander der Große zum Pharao und zum Sohn Gottes ernannt; erst in Memphis, dann in Siwa. Er hat eine für das alexandrinische Reich äußerst wichtige, friedensstiftende Oikoumene geschaffen, indem er zwischen „Jupiter“, dem Gott der Römer, „Zeus“, dem Vatergott der Griechen, „Ammon“, dem ägyptischen Gott und dann, durch die Hochzeit zwischen Perserinnen und Griechen, auch die Mesopotamier und Perser versöhnte. Alexander konnte im Gesamtreich aus Feinden Freunde machen. Das ist schon allerhand. Widerspruch: Wie kommen Sie denn, der Sie theologisch angefangen haben, mit der Differenz zwischen solch sog. heidnischem und christlichem Denken klar? Wenn man das, was Sie sagen, mit dem christlichen Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist verbinden will, dann hat man doch ganz schön zu tun. Simons: Na ja, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da muss man erstmal darstellen, weshalb das eine erlösende Bedeutung haben kann. Ich will jetzt mal etwas einbringen, worüber wir philosophisch noch nicht genügend nachgedacht haben. Mit Nietzsche haben wir zwei Kategorien des dramatischen Denkens: die Tragodia und die Komodia. Das Dritte, eigentlich Christliche, aber ist amnos, das Lamm. Und damit wäre die sog. „Amnologie“ eine ganz neue friedensstiftende Versöhnungsart, die in der christlichen Liturgie als „agnus dei“ erscheint: dona nobis pace. Aus ihr kommt die friedensstiftende Welt des Geistes hervor. Und von daher ist hinsichtlich der Verbindung, nach der Sie fragten, schon einiges möglich. Der dreifaltige Gott der christlichen Theologie ist kein Monokrat. Widerspruch: Mir stand jetzt auch mehr die augustinische Theologie vor Augen. Simons: Seit der Spätantike gibt es aber auch ganz andere Zugänge und Wurzeln, z.B. die griechische Theologie, die koptische oder die armenische. Widerspruch: Man kann also die Trinitätslehre als Abminderung oder Relativierung des Monotheismus interpretieren. Die „Neue Oikonomia“ 109 Simons: Ja, das kann man. Aber das wäre dann auch die Aufgabe, sie aus einer solchen Agnologie heraus zu entwickeln. Vielleicht bin ich der erste, der so etwas macht. Wenn man einmal dramatisch durchdenkt, was das bedeutet, dann bringt das was: Das Dramatische nicht als eine Trag-odia, als „Bocksgesang“, sondern als Lammlied: Christus das Lamm. Die griechischen Tempel sind zweifelsohne wunderbare Gebilde, die sehr nach Griechenland passen; aber das spezifisch Christliche ist das menschlich Nahe, wie das Lamm es symbolisiert. Jedenfalls scheint mir ein monokratisch verfaßter Vernunftbegriff heute obsolet zu sein. Wir sehen das doch schon bei Adorno. Bei ihm wird die Vernunft zum Prinzip der Herrschaft, weil vernünftig denken heißt: Identifizieren mit Begriffen; und das ist schlechthin das Wesen von Herrschaft. Die Vernunft ist keineswegs nur Aufklärung, sondern ungeheuer unterdrückend. Mit anderen Worten: hier setzt die Auflösung der Vernunft ein. Derrida macht da weiter – auch wenn er mit der Chora bei Platon dann etwas anderes beginnt. Angesichts einer solchen Zerrüttung des Vernunftanspruchs ist aber ein neuer Anfang wichtig. Den kann Adorno meines Erachtens jedoch nicht mehr machen. Bei ihm ist mit dem vor-ichlichen Impuls sozusagen Schluß. Und daher ist wichtig, was über Adorno herausführt. Für die Moderne ist das Denken Verallgemeinerung und die Vernunft die Verallgemeinerungsfähigkeit. Und das setzt voraus, daß alle Menschen ungefähr das gleiche Bewußtsein und die gleiche Wahrnehmung haben. Für die Antike jedoch war es ganz wesentlich, Denken lernen zu können, das heißt, eingeweiht zu werden. Ohne „Einweihung“, ohne Initiation, ist kein Denken zu lernen. Dieser Sinn für den Kultus der Einweihung fehlt in der Moderne vollständig. Er ist ja nicht nur irgendeine religiöse Geschichte, sondern ist für das Bewußtwerden des Gegenwärtigen selber wesentlich. Wenn man die Vernunft so denkt, dann wird die bislang generalisierende Vernunft in eine initiierende Vernunft umgewandelt. Widerspruch: Muß man nicht sagen, daß es einigermaßen verwegen erscheint, wenn wir Europäer jetzt auch noch meinen, aus unserem Zentrismus heraus einen neuen Vernunftbegriff kreiieren zu müssen? Geht es an, daß wir die Kritik an unserer eigenen Tradition auch noch selbst leisten? Wenn es so ist, daß eine bestimmte Form von Vernunft diskreditiert ist, muß man in Zeiten der Globalität dann nicht vielleicht warten, ob sich etwas Neues 110 Eberhard Simons herauskristallisiert, das nicht mehr nur aus Europa kommt, sondern das aus den Zugängen, den Archai, der anderen Kulturen entsteht? Simons: Ich meine, dass man erstmal nicht darum herumkommt, daß andere Kulturen keine Philosophie erfunden haben. Widerspruch: Aber sie denken doch auch. Simons: Ja. In ihrer Weise schon. Aber das weltweite wissenschaftlichtechnisch-ökonomische Reproduktionssystem haben sie nicht erfunden. Das waren die Europäer. Wissen Sie, das soll sich ja nicht ausschließen. Die Europäer können zu einem neuen Anfang finden, gerade wenn sie nicht generalisieren. Sie müssen nicht sagen: „das gilt jetzt weltweit“. Das Generalisierungsparadigma ist heute typisch für Amerika; Europa muß das nicht machen. Aber ganz ohne Eigenes wäre es verheerend. Erst wenn die Europäer ihr Eigenes haben wie die anderen auch, erst dann wird man das, was man hat, mit anderen auch kommunizieren können. Widerspruch: Herr Simons, wir danken Ihnen für das Gespräch. Das Gespräch führten Franz Piwonka und Alexander von Pechmann Besprechungen Neuerscheinungen Armin Adam, Franz Kohut, Peter K. Merk, Hans-Martin Schönherr-Mann (Hrsg.) Perspektiven der Politischen Ökologie. Festschrift für Peter Cornelius Mayer-Tasch zum 65. Geburtstag, Würzburg 2003 (Königshausen & Neumann), 277 S., 35.90 EUR. „Es ist die Aufgabe der Politischen Ökologie, die gegenwärtigen Umweltzerstörungen in all ihren Dimensionen und aus unterschiedlichen Perspektiven einsichtig zu machen.“ (Klappentext). Gleichzeitig avanciert – nach Mayer-Tasch – Politische Ökologie zur Leitwissenschaft der Postmoderne wegen „ihre[r] herausragende[n] soziale[n] als Überlebenswissenschaft“ (S. 12; alle H. v. m.). Im Rahmen von Methodenpluralismus, Interdisziplinarität und ganzheitlichem (globalen) Ansatz soll die Politische Ökologie ein weites Feld beackern, man mag fast geneigt zu sagen, die „ganze Welt“ bestellen. Diesem Anspruch wird der vorliegende Band nicht gerecht und den Rezensenten beschleicht der Verdacht, dass dies auch an anderer Stelle nicht geleistet werden kann, auch nicht näherungsweise. In diesem Band fällt auf, dass zwei Wissenschaftsbereiche vollkommen ausgeblendet werden, die eine interdisziplinäre Behandlung dieses Themas eigentlich nahe legen müsste: naturwissenschaftliche (insbesondere Biologie, Ökologie) und wirtschaftswissenschaftliche Beiträge sucht man vergebens, mit Ausnahme von Knolls Artikel. So kreisen die Artikel allein um klassische philosophische und sozialwissenschaftliche Ansätze. Während der erste Teil („Theoretische Entwürfe“) die philosophischen Grundlagen der ökologischen Krise, erhellen will, beschäftigen sich die Artikel des zweiten Teils („Aktuelle Problemfelder“) mit der ökologischen Krise vornehmlich aus (empirisch-)sozialwissenschaftlicher und politologischer Perspektive. Der – wenn auch lediglich philosophiezentrierte – Theorien- und Methodenpluralismus, den der theoretischen Teil des Bandes vorstellt, ist beeindruckend, selbst wenn der Leser sich zuzeiten schwer tut, die zentralen Fragestellungen und Angriffspunkte der Politischen Ökologie nicht aus den Augen zu verlieren. Ausgangspunkt ist stets die Prämisse, dass wir in der Zeit einer ökologischen Krise leben. Gemeinsam ist allen Autoren eine kapitalismuskritische Haltung und eine tiefe Skepsis bis Ablehnung gegenüber dem „Projekt 112 Neuerscheinungen Moderne“, welchselbig beide als Hauptursachen der ökologischen Krise identifiziert und untersucht werden. Aus geschichtstheoretischer Sicht etwa kritisiert Armin Adam die Entmächtigung der Gegenwart durch das Fortschrittsdenken der Moderne, der er das Modell der Nachgeschichte gegenüberstellt. Die Gegenwart müsse wieder „rückerobert“ werden aus „den Klauen des Geschichtsdenkens“ und dies gelinge nur durch einen radikalen „Verzicht auf historische Deutung“. Wolfgang Zängl wirft ein wenig fruchtbares Schlaglicht auf die Dialektik von Menschen und Natur, wenn Prämissen und Konklusion lauten: „Die Welt gehört der Welt – dem Leben vor uns, dem mit uns und dem nach uns“(S. 39). Martin Schönherr-Mann will die natürliche Unordnung der ökologischen Krise an der Unordnung unserer Theorien über die Natur festmachen: Relativitäts-, Chaostheorie und Unschärferelation seien kein Erkenntnisfortschritt, sondern ein groß angelegtes Rückzugsgefecht von Galileis mechanistischem Optimismus, an dessen Ende heute eingeräumt werde, die Natur sei prinzipiell nicht oder nur in vagen Annäherungen erkennbar. Interessant auch Bernd Meyerhöfers Artikel zum Katastrophenbegriff („Poetik der Katastrophe“), der den Begriff zunächst aus der aristotelischen Poetik heraus entwickelt, ihn dann vor den Hintergrund mythologischer Vorläufer platziert, um am Ende zu dem Ergebnis zu kommen, dass es vor allem die Machiavellisti- sche Politik der Machttechnik sei (technokratische Beherrschbarkeit vor Respekt/Anschmiegen an die Natur), die ein echtes Lernen aus den Katastrophen verhindere. Politischer ausgerichtet sind die drei Artikel, die den theoretischen Teil beschließen. Zum ersten fordert Rudolf zur Lippe – am Beispiel des Gemeingutbegriffs - eine quasi-kommunitäre, wertkonservative Korrektur liberaler Theorie und Praxis durch die Rückkehr zu informellen, traditionellen Normen (etwa: Treu und Glauben). Im liberalen Vertragsmodell werde „existentielle Verbundenheit [...] abgelöst durch normative Verbindlichkeit“ (S. 108), was dazu führe das Gemeinsame zunehmend als Negativität eines Privaten erfahren werde. Bernd Guggenberger untersucht im Anschluss daran mit Begriff der Nachhaltigkeit eine zentrale Kategorie der Politischen Ökologie und kommt zu dem Ergebnis, dass er nicht zu halten ist. Zum einen fuße das Konzept der Nachhaltigkeit mit ihrer Konstanzannahme auf der – wenig plausiblen und ebenso wenig wünschbaren – Vorstellung einer entwicklungslosen Gesellschaft, zum zweiten sei die Differenz zwischen „hochgradiger Beschleunigungsgesellschaft“ und der Linearität der Nachhaltigkeitsmaxime schlichtweg zu groß und zum dritten sei der Begriff der Nachhaltigkeit nur auf lebendige Systeme anwendbar, während wir heute im Zeitalter von Cyberspace und Genmanipulation „nach Künstlichkeit und totem Lebensersatz [gieren]“ (S. 117) Abgeschlossen wird der theoretische Neuerscheinungen Teil durch den Beitrag Manuel Knolls, der anhand der Marxschen Werttheorie die ökologische Krise als ökonomisch notwendige Folge der kapitalistischen Verwertungsgesellschaft sieht. Der Selbstzweck, die Verwertung des Wertes, die Marx in der „allgemeinen Formel des Kapitals“ festgemacht habe, zwinge die Produzenten zu ständigem Wachstum. Verstärkt durch den Konkurrenzdruck seien dauernde Produktivitätssteigerungen notwendig, die den Ersatz der menschlichen Arbeitskraft ressourcenfressende Maschinen erzwinge. Und genau dort liege die Ursache der ökologischen Krise. Da die Politik weitgehend von diesen ökonomischen Notwendigkeiten getrieben sei, sieht Knoll es als „eher unwahrscheinlich“ an, dass marktwirtschaftliche Systeme „angemessen und schnell genug“ auf die ökologische Krise reagieren könnten. Im zweiten Teil seien an dieser Stelle lediglich die Beiträge Bernd Malunats sowie von Winfried Schulz als besonders lesenswert vermerkt. Es fällt auf, dass die Autoren die Ursachen der ökologischen Krise jedoch allein im „Überbau“ und nicht an ihrer ökonomischen Wurzeln festmachen. Es sind die falschen Theorien, die falschen politischen Konzepte oder die Schieflage geschichtlicher Perspektiven, die für die Ursachen der Krise gehalten werden. So nimmt es nicht Wunder, wenn die Lösungen aus der Krise sich in normativen Appellen zur korrektiven Umkehr oder resignativ-pessimistischen Zukunftsbildern erschöpfen. Einzige und hervorstechende Ausnahme bildet der 113 Beitrag Manuel Knolls, der die ökologische Krise aus ihren ökonomischen Ursachen heraus entwickelt und analysiert, um zu fragen, welche immanenten systemischen Kräfte denn dem Kapitalismus zur Lösung zur Verfügung stehen. Nahezu sämtliche Beiträge glänzen durch einen hohen Grad an sprachlicher Meisterschaft, die die Lektüre schon aus literarischer Sicht zu einem Lesevergnügen macht. Wolfgang Melchior Norbert Bolz Das konsumistische Manifest München 2002 (Fink-Verlag), kart., 156 S., 10.- EUR. Nichts kann die Welt dafür, dass Norbert Bolz mal über Adorno promovierte und das kurze Zeit später offenbar zutiefst bereute. Nichtsdestotrotz gibt der 50jährige, in Berlin lehrende Medientheoretiker auf der wissenschaftlichen Bühne seither mit Vorliebe den geläuterten Ex-Adorniten, der mit nicht geringer Penetranz der Welt erklärt, dass im Grunde alles gut ist, was sein früheres Idol einst im Grunde für böse hielt. Als Ausgangsszenario für eine therapeutische Sitzung mag das in Ordnung gehen, als wissenschaftliches Kredo, von Bolz in nuce schon Anfang der 1990er Jahre („Eine kurze Geschichte des Scheins“) vorgestellt und hernach mit Regelmäßigkeit variiert, ist das mindestens ermüdend – zumal, wenn die Belege für die gern forsch formulierten Analysen weitgehend fehlen. Nun also ein konsumistisches Mani- 114 Neuerscheinungen fest, in dem Norbert Bolz in sechs Kapiteln – Die These / Der Terror / Der Krieg / Das Geld / Der Konsum / Die Liebe – zu zeigen beansprucht, dass Kapitalisten alles in allem die besseren weil friedlicheren Menschen sind. Seine auf den ersten zehn Seiten zum Manifest erhobene These ist schlicht: Permanentes Einkaufen absorbiert sehr viel Zeit und Leidenschaften, die außerhalb der westlichen Weltshoppinggemeinschaft in Ermangelung gut gefüllter Konsumstätten in Terroranschläge und Kriege investiert werden. Kapitalistische Gesellschaften mögen unromantisch nüchtern, von sozialer Kälte, Entfremdung, Sinnverlust und vielen säkularen Plagen mehr gekennzeichnet sein – aber, so konstatiert Bolz, wer sich erst einmal damit abgefunden hat, dass das Leben nicht viel mehr zu bieten hat, als die Warenregale der Kaufhäuser bereit halten, der kommt auch nicht auf die fundamentalistische Idee, mit Gewalt seine Mitmenschen zur allein selig machenden Weltsicht zu bomben. Demgegenüber ist die Geschichte des Kapitalismus für Bolz auf lange Sicht ein fortwährendes Heilsgeschehen. Den mörderischen Hobbes‘ schen Ur-Wolf verwandelt das Marktgeschehen am Ende in einen friedlebenden Kunden (59 f.), der sich mit anderen Kunden im „ruhige(n) Begehren nach Reichtum“ (74) ergeht. Eine kalte Idylle steht am Ende der Bolzschen Märchenstunde, wie man sie auch in den „Erwachet”-Heftchen der Zeugen Jehovas findet, und die schlimmstenfalls noch den „gehegten Krieg”, die „dosierte Feindschaft” (48) und die unvermeidliche gähnende Langeweile eines durch Konsum befriedeten Gemeinwesens kennt. Viel, sehr viel muss Bolz verdrängen, um Plausibilität für seine plüschige, schematische globale Zustandsbeschreibung reklamieren zu können. Ein Manifest für den Kapitalismus, dessen empirische Basis wesentlich auf der Beobachtung gründet, dass sich nach Ladenschluss auf dem Berliner Kudamm keine Leichenberge türmen, genügt jedenfalls nicht wirklich als angemessene Bewerbung für den Friedensnobelpreis. Muss man denn wirklich noch zeigen, dass die Geschichte des Kapitalismus keine Aneinanderreihung von Kaffeekränzchen war und ist? Muss man tatsächlich in Erinnerung rufen, dass die Händler und politischen Generalbevollmächtigten dieser Welt ganz ganz böse werden können, wenn die Warenzirkulation nicht gemäß ihrer geostrategischen Bedingungen funktioniert? Und ist es etwa bloß die fiebrige Phantasmagorie der ewig Neidischen und Ausgegrenzten, wenn man konstatiert, dass die westliche Konsumökumene und ihr unersättlicher Hunger nach Rohstoffen, Menschen, Land und Absatzmärkten weltweit zu viele blutige Messen gefeiert hat, um die seit Kant und Hegel nicht verstummen wollende, geschichtsphilosophische Mär vom „Konsum als ... genaue(m) Gegenteil von Gewalt” (61) nicht als ärgerliches Gerede eines Provokateurs erscheinen zu lassen? Freilich: Derart angestrengtes Ignorieren der Fakten ermüdet auf Dauer auch den größten Apologeten des Konsums – so sehr, dass selbst der Neuerscheinungen eigene Friedensdienst am Warenregal unterbleibt. In einem Interview mit dem Kölner Magazin „StadtRevue” bekannte Bolz unlängst, er selbst lebe nicht konsumistisch, um sich hernach gar für die Askese als Lebensform zu erwärmen. Man würde sich wünschen, die Bolzsche Wertschätzung der Enthaltsamkeit würde auch wirksam, wenn das nächste traumatische Adorno-Schub in Buchform bewältigt werden will. Franco Zotta Erhard Eppler Vom Gewaltmonopol zum Gewaltmarkt? Die Privatisierung und Kommerzialisierung der Gewalt; Frankfurt 2002 (Suhrkamp), 154 S., 9.- EUR. Mögen Optimisten am Ende des Kalten Krieges an ein Ende der Kriege überhaupt gedacht haben, so könnten sie sich eines Besseren belehrt sehen. Das Gegenteil ist richtiger, der kalte Krieg ist dem heißen, dem SchießKrieg gewichen. Schieß-Kriege, begrifflich auf Konflikte heruntergespielt, hat es seit dem Ende des 2. Weltkrieges unüberschaubar viele gegeben. Sie wurden kaum wahrgenommen, weil sie weit weg, irgendwo in der sogenannten „Dritten Welt“, Elend und Tod brachten. Daß diese Kriege nur scheinbar weit weg sind, hat der 11. September 2001 mit einigen Blitzschlägen erhellt. Der Krieg hat uns eingeholt, er heißt nun Terror; der konventionelle Krieg ist zu globalen postnationalen Terror-Kriegen mutiert. Krieg wird seither wieder 115 gebührend gewürdigt, obwohl oder: weil sich die Gründe, die Formen und Mittel, vor allem die Akteure vollständig gewandelt haben. Diesem Paradigmenwechsel ist Eppler durch seine gehaltvolle Analyse gefolgt, die bemerkenswert auch deshalb ist, weil der Autor für sich selbst einen Paradigmenwechsel vollzieht – vom erklärten Pazifisten zum nachdenklich gewordenen Verfechter eines ‚gerechten Krieges‘. Die Gründe dieses Wandels scheinen im Titel der Schrift deutlich auf. Das Gewaltmonopol, seit Thomas Hobbes’ Leviathan Signum des modernen Staates, wird nicht nur verdrängt und ausgehöhlt, das staatliche Gewaltmonopol wird partiell durch auf Märkten käufliche Gewalt ersetzt. Gewalt wird privatisiert und kommerzialisiert, vor allem in ökonomisch wenig entwickelten Ländern, aber auch in etablierten Demokratien. Dieser Befund klingt zunächst bieder-bürgerlich, passend zur zeitgenössischen ökonomischen Liberalisierung der sich globalisierenden Wirtschaft. Seine Virulenz erlangt er durch die potentielle Allgegenwart der privatisierten Gewalt, die kriminell oder terroristisch jederzeit und überall gegen Private wie Staaten zuschlagen kann, ohne daß dagegen ein Kraut gewachsen scheint. Noch virulenter aber ist, daß sich diese kriminell-terroristische Privatisierung der Gewalt gerade aus der Deregulierungsideologie der EntStaatlichung legitimieren läßt. Im Gegensatz zu legitimer staatlicher Gewalt, die Eppler als rational kalkulierbar einschätzt, hat private Gewalt weder feste Adressaten noch Absen- 116 Neuerscheinungen der, kann von jedem ausgehen, jeden treffen. Privatisierte Gewalt ist kaum lokalisierbar, trifft keine Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten; sie ist absolut gesetzlos und von unvorstellbarer Brutalität. Entspringt sie nationalistischen oder religiösen Fundamentalismen, bieten diese die moralische Legitimation, Gewalt mit einträglichen kriminellen Geschäften zu verbinden, und für Söldner ist Beute ohnehin erklärtes Kriegsziel. Privatisierte Gewalt ist regellos, in jeder Hinsicht asymmetrisch. Das ist ein qualitatives Novum seit den mittelalterlichen Condottieri, die nun Warlords heißen, als ‚multinationale Gewaltunternehmer‘ (H. Münkler) aber vergleichbare Ziele verfolgen; ihnen geht es um Politik oft noch am Rande, um Profit aber fast ausnahmslos. Dies gilt etwa auch für bin Laden, den Eppler als zwar charismatischen religiösen Fundamentalisten, aber eben auch als Drogenhändler und Börsenspekulanten beschreibt, der mit der Terrororganisation al-Qaida ein an das Zeitalter der Globalisierung perfekt angepaßtes Gewaltunternehmen als global player betreibt. Eppler analysiert die Entwicklung vom staatlichen Gewaltmonopol zum kommerzialisierten Gewaltmarkt zwar als multikausales Geschehen, das aber, vor dem Hintergrund der seit Ende der Bipolarität entstandenen amerikanischen Superiorität, im Kontext der wirtschaftlichen Globalisierung gedeiht. Anstatt die anstehende politische Führungsaufgabe zur Gestaltung einer neuen (Welt-)Ordnung zu übernehmen, breitet sich – schon seit Reagan – die liberalistische Tendenz aus, den Markt regeln zu lassen, was die Politik nicht regeln kann oder nicht regeln will. An dieser Haltung zu leiden haben vor allem die schwachen, also wirtschaftlich wenig entwickelten Staaten. Als Folge ihrer Schwäche läßt sich der Mißbrauch staatlicher Gewalt beobachten, aus dem dann häufig privatisierte Gewalt von oben oder von unten entsteht, wobei sich deren Funktionen gelegentlich auch verkehren. Die Privatisierung der Gewalt ‚von oben‘ beginnt überwiegend durch die Verletzung des legitimen Gewaltmonopols durch Staatsdiener, so Eppler. Sie geht aus von Regierungen und deren Armeen oder der besitzenden Oberschicht, die sog. „Paramilitärs“ einsetzt, um die ‚Drecksarbeit‘ verrichten zu lassen, also gegen das vorzugehen, was sie selbst als Gewalt von unten ansehen – man denke etwa an die lateinamerikanischen Todesschwadronen. Diese ausgelagerte, halb-offizielle Gewalt neigt dazu, sich zu verselbständigen. Die ursprünglichen politischen Ziele treten hinter aufkommende kommerzielle Interessen soweit zurück, daß sie alle Versuche hintertreiben, zwischen Regierung und Aufständischen Frieden zu schließen. Ähnliche Tendenzen gelten für die privatisierte Gewalt ‚von unten‘. Traditionell geht sie aus von revolutionären Bewegungen, die sich um eine gerechtere gesellschaftliche Ordnung bemühen. Sie bekennen sich zwar zumeist zu Ideologien, die oft in religiösen oder nationalistischen Fundamentalismen wurzeln, doch zur Neuerscheinungen Finanzierung ihres Kampfes – oder auch nur noch um des Profits willen – eignen sie sich kriminelle Strukturen an, den Schmuggel und Drogenhandel, die Schutzgelderpressung u.ä. Wenn die staatliche Autorität zerfällt, ein Staat sich dem – von der UN-Charta gar nicht vorgestellten – Ende nähert, weil er für angemessene ‚Daseinsvorsorge‘ aufzukommen nicht mehr in der Lage ist – wie in einem Viertel der schwarzafrikanischen Staaten bereits geschehen –, können Warlords mit terroristischen Methoden ungestört ihren lukrativen Geschäften nachgehen. Wo Gewalt zum Geschäft wird, muß das Interesse an der Friedenssicherung durch einen funktionierenden Staat schwinden, der dem kriminellen Treiben Einhalt gebieten könnte. Zugleich werden derartige funktionsunfähige Staaten, die schwach bleiben, weil sie vom globalisierten Kapital gemieden werden, zu idealen Schlupfnestern des internationalen Terrorismus. Eppler will aber nicht nur die Wege der Gewalt analysieren – er will auch aufklären, belehren. Seine erste Lehre ist, daß die Kriege des 20. Jahrhunderts mit Massenheeren vorüber sind. Deshalb ist Amerikas ‚Krieg gegen den Terrorismus‘ mit seiner anachronistischen Orientierung nicht zu gewinnen. Eine Ausnahme möchte Eppler zulassen, die allerdings zur Regel zu werden verspricht: Den Einsatz militärischer gegen privatisierte Gewalt, um einen Staat wieder aufzubauen, wie etwa in Afghanistan, oder um massiven Menschenrechtsverletzungen zu begegnen, wie etwa in Bosnien oder im Kosovo. Und er 117 geht noch einen Schritt weiter: Es gibt nicht nur machtpolitisch motivierte Interventionen, sondern schlimmer, weil aus zynischem Kalkül, auch machtpolitisch begründete Nicht-Interventionen, etwa in Liberia oder im Kongo. Dies kennzeichnet zugleich seinen Bruch mit dem ‚alten‘ Pazifismus, der zwar nicht falsch, sondern ungeeignet geworden ist angesichts der Bedrohungen, die von privat-terroristischer Gewalt ausgehen. Die zweite, weiterreichende Folgerung ist, daß als souverän nur noch der Staat angesehen werden soll, der den inneren Frieden, insbesondere also die Menschenrechte achtet. Staaten, die dazu aufgrund des fehlenden Gewaltmonopols nicht (mehr) in der Lage sind, verlieren auch ihre äußere Souveränität, – und dies legitimiert militärische Interventionen durch die UNO. Daraus entsteht eine Form von Welt-Innenpolitik, durch welche das Gewaltmonopol der Staaten nicht nur verteidigt, sondern durch ein internationales Gewaltmonopol auch überbaut wird. Organisatorisch läuft dies auf eine Weltpolizei hinaus, die aber als Militär auftritt, das für diese Aufgabe vorbereitet und ausgerüstet werden muß. Und gestärkt wird dieses Konzept durch die Einrichtung einer internationalen Strafgerichtsbarkeit. Neben diese Welt-Innenpolitik gehört, so Epplers eindringliches Plädoyer, eine Welt-Sozialpolitik, die – vor allem in der Armen Welt – dazu beiträgt, daß es zum Staatszerfall gar nicht kommt, weil eine entsprechende internationale Zusammenarbeit zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklungen ermöglicht. 118 Neuerscheinungen Recht besehen plädiert Eppler für eine Rekonstruktion der traditionellen Staatslehre, die durch privatisierte Gewalt notwendig geworden ist. Zu überwölben sei dieses Konstrukt durch die verbindliche Implementierung im Ansatz bereits vorhandener internationaler Institutionen, aus der letztlich die höhere Qualität einer neuen Welt-Ordnung resultieren könnte. Angesichts dieser Wendung könnte man auf den Gedanken verfallen, privatisierte Gewalt gewissermaßen als deren Geburtshelfer zu verstehen. Freilich würden dadurch Ursache und Wirkung verkehrt; denn die Schwächung der Staaten liegt in der Kommerzialisierung und Privatisierung begründet, die durch die Globalisierung – durchaus beabsichtigt – bewirkt worden ist. Daß Eppler diesem Aspekt nur wenig Aufmerksamkeit zuwendet, ist zwar seinem Thema geschuldet. Es bleibt gleichwohl ein Manko – weshalb seine Vorschläge letztlich nur ‚gut gemeint‘ (G. Benn) sein könnten. Bernd M. Malunat Angelika Krebs Arbeit und Liebe Die philosophischen Grundlagen sozialer Gerechtigkeit, Frankfurt/Main 2002 (Suhrkamp), 324 S., 12.- EUR. Der größte Teil der Frauen- und Familienarbeit ist noch immer unbezahlt, nicht anerkannt und unterbewertet. Dieser Befund ist der Ausgangspunkt von Angelika Krebs’ inhaltsreicher und klar argumentierender Schrift. Unter Familienarbeit versteht sie „Arbeit für Kinder, Kranke und Alte, die konstitutiv auf Fürsorge angewiesen sind“ (12). Ihre vielschichtige Argumentation zielt darauf ab, eine gerechtigkeitstheoretisch fundierte Begründung dafür zu liefern, daß Familienarbeit als ökonomische Arbeit anerkannt und aus öffentlichen Mitteln entlohnt werden soll. Auf dem Weg zu diesem Ziel verarbeitet Krebs eine Fülle von Material zum Arbeits-, Gerechtigkeits- und Liebesbegriff. So weist sie eine Reihe von gängigen Vorschlägen zurück, was unter Arbeit zu verstehen ist. Alternativ dazu entwickelt sie im Anschluß an Friedrich Kambartel ein institutionelles Verständnis von Arbeit, nach dem jeder tätige Beitrag zu einem gesellschaftlichen Leistungsaustausch als ökonomische Arbeit gilt und als solcher Anerkennung verdient. Nach diesem Arbeitsbegriff muß Familienarbeit als ökonomische Arbeit anerkannt werden, da sie in einen gesellschaftlichen Leistungsaustausch zwischen Familientätigen einerseits und Singles und Dinks [double income, no kids, M.K.] andererseits eingebunden ist: „Familientätige produzieren, indem sie Kinder großziehen und Alte pflegen, öffentliche Güter, und dafür verdienen sie gesellschaftlich-ökonomische Anerkennung. Am augenfälligsten tritt der Öffentliche-GutCharakter von Familienarbeit in der umlagefinanzierten Rentenversicherung zutage. Singles und Dinks profitieren im Alter davon, dass die Kinder anderer ihre Rente mittragen“ (15). Mit der erfolgreichen Anwendung ihres Arbeitsbegriffs auf die Famili- Neuerscheinungen enarbeit ist Krebs ein erster Schritt zu ihrem Argumentationsziel gelungen. Damit gibt sie sich allerdings nicht zufrieden, sondern läßt sich im zweiten Teil ihrer Untersuchung auf eine grundsätzliche und umfangreiche Auseinandersetzung mit Gerechtigkeitskonzeptionen ein. Dabei knüpft sie an die Why Equality?-Debatte und an das von ihr 2000 herausgegebene Buch Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik an. So geht auch die Einleitung zu diesem Sammelband, die einen Überblick über die neue Egalitarismuskritik vermittelt, nahezu wortwörtlich in ihr neues Buch ein. Die neue Kritik am Egalitarismus wird von Krebs nicht nur geteilt. Sie knüpft auch an alternative Ansätze in der Gerechtigkeitstheorie – primär den von Avishai Margalit und sekundär den von Michael Walzer – an und macht sie für ihre Argumentation fruchtbar. Sowohl diese Ansätze als auch ihre eigene Position versteht sie als „nonegalitaristischen Humanismus“ (17 f., 132 f.). Kerngedanke der Kritik am Egalitarismus ist, daß Gerechtigkeit gar nicht auf Gleichheit abzielt, sondern auf die Erfüllung von absoluten Gerechtigkeitsstandards für alle, wie etwa den allgemeinen Zugang zu Nahrung und Obdach. Gleichheit ist zwar auch eine Folge der Erfüllung absoluter Standards, aber nur als Nebenprodukt und nicht als Ziel der Gerechtigkeit. Für Krebs’ weitere Argumentation ist der von ihr postulierte absolute Standard des „Menschenrechts auf soziale Zugehörigkeit“ von zentraler Bedeutung (210). In einer Arbeitsge- 119 sellschaft erachtet sie die Erfüllung dieses Gerechtigkeitsstandards für ein menschenwürdiges Leben als unabdingbar. Da soziale Zugehörigkeit in Arbeitsgesellschaften „wesentlich vermittelt ist über die Teilnahme an Arbeit und an der monetären Anerkennung, die sie genießt“, läßt sich aus diesem Menschenrecht auch ein Recht auf entlohnte Arbeit und ein Recht auf ihre Anerkennung als moralisch gefordert ableiten (200 f., 210 f.; das Argument für ein Recht auf Arbeit findet Krebs bereits bei Margalit, 157 f.). Die Konsequenz, die sich daraus für das Problem der weder entlohnten noch anerkannten Familienarbeit ergibt, liegt auf der Hand: „Menschen, die ihren Arbeitsbeitrag zum gesellschaftlichen Leistungsaustausch leisten, aber behandelt werden, als arbeiteten sie gar nicht, werden sozial ausgeschlossen. Ihre Menschenwürde wird verletzt“ (210 f.). Will eine Arbeitsgesellschaft für sich das Prädikat gerecht oder anständig reklamieren, ist es nach dieser Argumentation erforderlich, daß sie die Familienarbeit aufwertet, indem sie sie bezahlt und so anerkennt. Im letzten Teil ihrer Untersuchung tritt Krebs dem ihres Erachtens stärksten Einwand gegen das von ihr entwickelte „Lohn-für-FamilienarbeitModell“ entgegen: „Dieser Einwand lautet auf Pervertierung der Liebe durch das Eindringen des ökonomischen Do-ut-des-Denkens in persönliche Nahbeziehungen“ (19). Ihre dagegen vorgebrachte Argumentation läuft darauf hinaus, das altruistische Moment des Füreinander, des „um des anderen willen“, der vor- 120 Neuerscheinungen herrschenden Liebesbegriffe zurückzuweisen und statt dessen „den Aspekt des eigeninteressierten Tausches in realen Liebensbeziehungen“ und das Moment des geteilten Miteinanders herauszustellen (13 f.). Abschließend sind noch zwei Einwände anzuführen, die sich gegen die von Krebs dargelegte Position erheben. In theoretischer Hinsicht ist es grundsätzlich problematisch, mit der allgemeinen Würde des Menschen und im besonderen mit einem „Menschenrecht auf soziale Zugehörigkeit“ als absoluten Gerechtigkeitsstandards zu argumentieren. Beides läßt sich nämlich nur postulieren und nicht wiederum überzeugend begründen. Das zeigt sich etwa an den gängigen Begründungen für die Würde des Menschen. So kann die religiöse Begründung und Ableitung, die sich auf die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott beruft, genausowenig überzeugen wie die Kantische, die sich auf die sittliche Autonomie des Menschen bezieht. Krebs rekurriert weder explizit auf diese Begründungen noch macht sie einen eigenständigen Versuch, die von ihr postulierten Gerechtigkeitsstandards rational zu untermauern. Der Einwand in praktischer Hinsicht ist simpler. Die Erfüllung der von Krebs erhobenen und ihrem Selbstverständnis nach dem linken politischen Spektrum zuzuordnenden Forderungen läuft nämlich, wie sie selbst betont auf den „Ausbau des Sozialstaates“ hinaus (17). Wie spätestens durch die aktuellen Krisen des Sozialstaates deutlich geworden sein dürfte, ist jedoch bereits das bestehende Ausmaß an Gerechtigkeit in vielen westlichen Arbeitsgesellschaften nur noch schwer bezahlbar. Insofern fragt sich, woher die beträchtlichen Mittel kommen sollen, um das von Krebs entwickelte „Lohn-für-Familienarbeit-Modell“ zu finanzieren. Manuel Knoll Albert Kümmel/Petra Löffler (Hg) Medientheorie 1888-1933. Texte und Kommentare, Frankfurt/Main 2002 (Suhrkamp), brosch., 568 S.,17.- EUR. Kaum etwas hat die sozialen, ökonomischen und politischen Verhältnisse unserer Zeit derart fühlbar verschoben, wie die rasante Ausbreitung digitaler Medientechnologien während der letzten Jahrzehnte. Deshalb ist es keineswegs besonders überraschend, wenn heutzutage nicht zuletzt innerhalb der geisteswissenschaftlichen Debatten immer häufiger Beiträge erscheinen, die sich ausdrücklich medientheoretischen Argumentationsstrategien und Konzepten zuwenden, um solcherart philosophische, sprachwissenschaftliche oder kulturhistorische Fragestellungen zu erörtern. Andererseits ist bei einer genaueren Betrachtung diese momentane Attraktivität der Medientheorie schon deshalb äußerst verwunderlich, weil bis dato ihr wissenschaftlicher Status eher undeutlich geblieben ist. Davon zeugt zumal die systematische Inkompatibilität und Zusammenhangslosigkeit medientheoretischer Lesarten des Medienbegriffs. Während beispielsweise die funktionalistische Medientheorie, Neuerscheinungen wie sie etwa Friedrich Kittler vertritt, den Begriff des Mediums aufgrund der medialen Grundfunktionen „Speichern“, „Übertragen“, „Verarbeiten“ bestimmt, und damit primär die jeweiligen medientypischen Unterschiede betont, definiert demgegenüber die sogenannte Medienontologie Marshall McLuhans alle technischen Kommunikationsmittel zwischen Federkiel und Computer rein subsumtiv als „extensions of man“. Vor dem Hintergrund dieser eklatanten Unschärfen zeitgenössischer Medientheorie richtet die vorliegende Anthologie ihren Blick absichtlich auf eine ausdrücklich historische Thematik, indem sie ausschließlich Originaltexte aus den zwischen 1888 und 1933 in Deutschland geführten medientheoretischen Diskussionen wiedergibt. Mag dies zunächst auch wie die allenfalls akademisch relevante Beschäftigung mit einem marginalen Seitenaspekt der Medientheorie anmuten, so verknüpfen damit die beiden Herausgeber, die Medienwissenschaftler Albert Kümmel und Petra Löffler, ein theoretisch höchst anspruchsvolles Projekt: Vermöge des präsentierten Textmaterials soll nämlich insofern ein Schritt zur Rekonstruktion der „historischen Epistemologie“ medientheoretischer Rede als solcher geleistet werden, als dadurch jene (diskurs-)geschichtliche Schnittstelle sichtbar wird, an der „die Voraussetzungen geschaffen wurden, Technologien wie Kino, Radio und Fernsehen vergleichbar zu machen, ohne bereits über eine explizite Medientheorie zu verfügen.“ (12) Jener „medientheoretische Diskurs 121 avant la lettre“ entstammt für Kümmel und Löffler einer spezifischen Ereigniskonstellation, in der sich ein explosionsartiger Innovationsschub im wissenschaftlich-technischen Bereich mit der radikalen Umgestaltung des privaten wie öffentlichen Lebens vermischte. In knapper Form umreißt die nachstehende Chronologie diesen Sachverhalt: „1895 Lumières Cinématographe; 1896 Marconis drahtlose Telegraphie; 1897 Brauns Elektronenröhre; 1905 Ladenkinos; ab 1912 abendfüllende Spielfilme; 1923 Eröffnung des Unterhaltungsrundfunks in Deutschland; 1929 erster deutscher Tonfilm und erste Fernsehversuchssendungen.“ (14 f.) Parallel zu diesen einschneidenden Metamorphosen des technisch-gesellschaftlichen Milieus etablierte sich in Deutschland eine überaus vielgestaltige und intensive medientheoretische Debatte, die, so die These der Herausgeber, trotz aller massiven inhaltlichen Differenzen, aufgrund ihrer „Verwendung eines zunehmend stabilen Repertoires rhetorischer Topoi und diskursiver Figuren, das den neuen Kommunikationsapparaten Gemeinsame als Medialität hervortreten läßt“ (15). Zwar blieb nach Löffler und Kümmel dem deutschen Mediendiskurs die kardinale medientheoretische Bedeutung der Medialität – also jenes technisch erzeugte Moment massenmedialer Kommunikationsmittel, das von den davon betroffenen Individuen als ein befremdendes „Walten a-subjektiver Mächte“ erlebt wird – letztendlich verborgen. Aber ihrem Befund zufolge verweisen die zusammengetragenen Dokumente nach- 122 Neuerscheinungen drücklich darauf, dass sich damals schon zumindest jene „diskursiven Felder“ herauskristallisierten, welche Medientheorie überhaupt erst denkbar machen, und die somit auch für jede Vergegenwärtigung der „Genealogie des medientheoretischen Wissens“ konstitutiv sind. Eine herausragende Rolle spielte in den medientheoretischen Diskussionszusammenhängen besonders das diskursive Feld der Masse: „Die meisten der neuen technischen Medien zwischen 1890 und 1930 wurden in enge Beziehung zum diskursiven Gegenstand Masse gesetzt und erhielten auf diese Weise ein erstes gemeinsames Merkmal.“ (539 f.) In Deutschland wurde die Diskursfigur der Masse geradezu das „Gravitationszentrum“ medientheoretischer Reflexionen zumal deshalb, weil sich damit eine anscheinend unmittelbar evidente Verbindungslinie zwischen den disparaten Sphären von Technik, Wahrnehmung und Gesellschaft herstellen ließ. Aber wie die diskursanalytische Durchleuchtung der betreffenden Arbeiten zeigt, wurde dadurch hauptsächlich jene extrem problembelastete Antinomie erneut reproduziert und bekräftigt, die sich schon in dem diesbezüglichen Standardwerk „Psychologie des foules“ nachweisen lässt, das Gustave Le Bon 1895 veröffentlichte: „Einerseits geht es (Le Bon; Th. W.) um eine soziologische Analyse eines wesentlichen Kennzeichens der Gegenwart“, die er aufgrund dieses Merkmals das „Zeitalter der Massen“ nennt. Andererseits geht es um ein psychologisches Phänomen, das die innere Struktur spontan gebildeter ... Kollektiva beschreiben soll.“ (541) Die dergestalt dem „wissenschaftlichen“ Massendiskurs endemische Verschleifung politisch-sozialer in geistig-seelische Tatbestände verfestigte sich in Deutschland zu einer prinzipiell restaurativen Denkhaltung, welche in der Folge zwar nicht vollständig, aber doch überwiegend den Ton in den hiesigen medientheoretischen Auseinandersetzungen vorgab. Pointiert stellen dazu die Herausgeber in einer abschließenden Bemerkung fest: „Diffus assoziiert das Soziologem ‚Masse’ die ‚unteren Schichten’, ‚das Proletariat’, ‚die Arbeiter’ ... Wird diese Theoriefigur überschrieben durch das Psychologem „Masse“, entsteht eben jener ungenaue Begriff, der Massenpsychologie erst ermöglicht... Das Psychologem „Masse“ wird vom Ereignis her gedacht: von Aufstand, Lynchmord, Revolution. Anhand gewalttätiger Kollektiva, wird ein Paradigma ausgeprägt, das dann auf die statistische Masse subkutan, als schlummernde Möglichkeit sozusagen, übertragen wird. Die psychologische Masse ist immer die potentiell aufständische Masse ... Wiewohl die Sorge um die Latenz des Aufstandes politisch eine Einheit der Massen gar nicht wünschbar erscheinen lässt, kehrt doch die Diagnose einer beklagenswerten Atomisierung der Gesellschaft immer wieder. Dieser Querstand entfaltet eine recht simple Dialektik, die auf die Unterscheidung zwischen einer schlechten, weil anarchischen, und einer guten, weil richtig geführten Masse hinausläuft. In dieser Weise werden Massenmedien in Deutschland immer wieder in schlech- Neuerscheinungen te Unterhaltungsmedien und gute Bildungsinstrumente eingeteilt: das gilt für das Kino genauso wie für den Rundfunk oder das Fernsehen.“ (541 f.) Bietet somit der Erläuterungsteil des Bandes auch erhellende Einsichten in den strukturellen Unterbau deutscher Mediendebatte zwischen Wilhelminismus und Drittem Reich, so bleibt dennoch die von Kümmel und Löffler eingenommene Kommentarperspektive insgesamt fragwürdig. Zwar gelingt es ihnen dadurch die diffizilen und hochkomplexen Prozesse des Diskurssystems „Medientheorie“ während der genannten Epoche bündig darzulegen. Aber indem sich ihr Interpretationsrahmen am Wissenschaftsideal völlig subjektfreier Beschreibung funktionaler Abläufe orientiert, unterlassen sie es in ihren Anmerkungen weitgehend, jene unstrittig wertvollen Erkenntnisse zum epistemologischen Wie sowohl mit dem jeweiligen Was als auch dem historisch-gesellschaftlichen Substrat medialer Kommunikation in ein aussagekräftiges Verhältnis zu setzen. Der vorgestellte Reader ist insoweit in erster Linie dafür zu loben, dass er dem zeitgenössischen Publikum überhaupt den Zugang zu einem bislang versperrten Archiv früher medientheoretischer Deutungsansätze eröffnet. Doch weil er lediglich das karge Diskursornament der Massenmedien im Auge hat, bedarf es schon der nuancierten Lektüre interessierter Leser, um die in ihm ausgebreiteten Trouvaillen auch angesichts der heutigen medientechnischen Entwicklung fruchtbar werden zu lassen. Thomas Wimmer 123 Ludger Lütkehaus Schwarze Ontologie, Über Günther Anders, Lüneburg 2002 (zu Klampen), kart., 133 S., 14.- EUR. Konrad Paul Liessmann Günther Anders. Philosophieren im Zeitalter der technologischen Revolutionen, München 2002 (C. H. Beck), Ln., 208 S., 19.90 EUR. Während Adorno zu seinem 100. Geburtstag mit Biographien, Ausstellungen, Symposien und Vorlesungsreihen gefeiert wurde, war es ein Jahr zuvor bei Günther Anders’ Jubiläum vergleichsweise still geblieben. Der Kämpfer gegen die atomare Drohung und die Antiquiertheit des Menschen ist offenbar selbst zu einer antiquierten Gestalt geworden. Mit dem Ende des kalten Krieges scheint die atomare Gefahr gebannt. Scheint – denn die Waffenarsenale ermöglichen noch immer allem Leben auf diesem Planeten ein Ende zu machen, und weitere Staaten haben oder drängen nach Atomwaffen, um ihre Nachbarn zu terrorisieren. Und: das Vergessen ist, wie Anders darstellte, selbst antiquiert – Technologien die einmal entwickelt wurden, sind prinzipiell immer anwendbar, ein Vergessen gibt es für uns nicht mehr. Während zu Anders’ Lebzeiten noch die Auswirkungen von Technologien auf menschliches Bewußtsein und Handeln untersucht wurden, und die Frage nach der Wertfreiheit von Technik gestellt wurde, scheinen die Technologien heute weitgehend akzeptiert, ja sogar von den früheren Kritikern selbst verwendet zu werden. Ob die neuen 124 Neuerscheinungen Technologien wie Internet und Handy aus dem ‚Masseneremiten’ jedoch solidarische und kommunikationsfähige Menschen machen, sei dahingestellt. Im Gegenteil, angesichts der globalen Konkurrenz scheint statt Kritik eher noch die Flucht nach vorne geboten. Wer zu spät kommt, den bestraft – nicht die Geschichte, aber – die wirtschaftliche Konkurrenz. Wer zaudert, wer fragt, gilt als Standortrisiko. Aber da es sich dabei um unsere Welt und unser Leben handelt, ist ein Zaudern, ein Fragen vielleicht doch ganz sinnvoll. Und dazu kann man bei Anders eine ganze Menge lernen, und darüber hinaus noch einen Philosophen, der neben dem Moralisten und ‚Barbareikritiker’ bislang weitgehend unbekannt geblieben war: der Philosoph der Kontingenz. Aus Anlaß des 100. Geburtstags von Günther Anders wurden zwei ältere Monographien neu aufgelegt. Die Monographie von Ludger Lütkehaus ist die textidentische Neuausgabe seines Buches „Philosophieren nach Hiroshima. Über Günther Anders“, 1992 im Fischer Taschenbuch Verlag erschienen. Bei dem Werk von Konrad Paul Liessmann handelt es sich um die Neufassung der 1988 erstmals bei Junius in Hamburg erschienen Einführung. Bei beiden Autoren handelt es sich um ausgewiesene Kenner des Werkes von Anders, die hier zwei unterschiedliche Wege verfolgen. Lütkehaus stellt in vier von einander unabhängigen Essays die zentralen Punkte seiner Philosophie vor. In den ersten beiden Essays werden die Grundbegriffe der Anders’schen Technikkritik – prometheische Scham, prometheisches Gefälle, Diskrepanzphilosophie u.ä. –, seine Analyse der Bedeutung der Atombombe und der heutigen Technik vorgestellt. Der dritte Essay geht der Bedeutung von Kunst nach Hiroshima nach. Im vierten und längsten, für mich interessantesten Essay der Sammlung werden die ontologischen Thesen zur Kontingenz dargestellt. Diese Untersuchungen, Essays und Aphorismen, die Anders’ Werk von Anfang an durchziehen und großenteils wohl noch der Veröffentlichung harren, sind eher im Hintergrund geblieben und trotzdem von größtem Interesse. Liessmanns Buch ist eine Einführung in das Gesamtwerk. Neben den schon angesprochenen Themen nimmt die Biographie breiten Raum ein. Weiterhin wird auch die Auseinandersetzung mit Auschwitz – unter dem Begriff des Monströsen – und der Emigrationsroman ‚Die molussische Katakombe’ behandelt. Ebenso wird auch auf Berührungspunkte und Differenzen zur Frankfurter Schule und, wenn auch kurz, zu Jaspers’ Thesen zur Atombombe eingegangen. Da es sich hier um eine Neufassung handelt, konnten auch Neuerscheinungen wie die kürzlich erschienene Sammlung mit Texten zu Heidegger einbezogen werden. Liessmann geht darüber hinaus auch der Frage nach, was an Anders’ Technikkritik heute aktuell ist, ob „die Antiquiertheit selbst ‚antiquiert’ ist“. Nach Liessmann wäre dies ein Schein, der eher auf einem veränderten Verhältnis zur Technik als auf grundlegenden Neuerscheinungen Änderungen derselben beruht. Und daher behält das Werk von Anders seine Aktualität. Beide Autoren nehmen in ihren Reflexionen zur Philosophie die Anders’sche Postition etwas unreflektiert auf. Bei Anders ist die Rede von „der Weltfremdheit des Menschen“, wodurch der Mensch genötigt sei, seine Welt immer neu zu erschaffen. Dahinter steckt eine unhistorische Sicht auf ‚den Menschen’, über dessen Verhältnis zur Welt undifferenziert über Raum und Zeit hinweg sich kaum etwas sagen läßt. Die ‚Frankfurter’ haben hier wohl zu recht ‚Freiburger Existenzialdüfte’ gerochen. Auch werden Menschen in Verhältnisse geboren, die sie nicht neu erschaffen, sondern über die sie eher wenig vermögen. Interessanterweise werden die Thesen von Anders jedoch sehr prägnant und präzise, wenn man sie nicht als abstrakte Bestimmungen ‚des Menschen’, sondern als Analyse des modernen Menschen des 20. Jahrhunderts begreift. Hier erhalten auch Anders’ Kunstinterpretationen, besonders zu Rodin, ihre Faszination. Anders’ ‚schwarze Ontologie’ wird besonders von Ludger Lütkehaus behandelt. Ihre zentrale These, die der Kontingenz, lautet: es gibt keinen Grund, warum Menschen sein sollen. Daß wir sind, ist zufällig und unterliegt keiner höheren Seinsordnung; wir genießen keinem anderen Seienden gegenüber einen höheren ontologischen Rang. Diese Seite gehört zum Faszinierendsten an Anders’ Philosophie. Allerdings möchte ich auch hier einen kleinen Einspruch anmelden: 125 daß ich bin, ist zufällig, nicht aber, wie Anders meint, daß ich der bin, der ich bin. Anders zitiert hier Grabbes Wort: „Einmal auf der Welt, und dann ausgerechnet als Klempner in Detmold“. Unterstellt wird hier ein Sein unabhängig vom konkreten Lebensvollzug, der kontingent sei. Aber ich habe kein Sein unabhängig von meinem konkreten Lebensvollzug. Daß ich bin, ist kontingent; mein Sein jedoch vollzieht sich in konkreten sozialen und gesellschaftlichen Lebenszusammenhängen und ist damit nicht mehr kontingent. Beide Bücher liefern solide Einführungen mit etwas unterschiedlichem Schwerpunkt. Lütkehaus diskutiert intensiv Anders’ ‚schwarze Ontologie’, Liessmann bettet Anders in den geschichtlichen Kontext und bietet eine Gesamtübersicht, in der auch neuere Fragestellungen aufgenommen werden. Sympathisch, daß beide Autoren keine Berührungsängste haben und auf die Arbeiten des anderen verweisen, wo sie es für sinnvoll halten. Beide Bücher sind uneingeschränkt lesenswert. Wer Günther Anders noch nicht kennt, ist vielleicht mit Liessmans Einführung besser bedient. Wer neben dem Technikkritiker auch den Ontologen kennenlernen möchte, dem sei besonders der vierte Essay in Ludger Lütkehaus’ Sammlung empfohlen. Lothar Butzke 126 Neuerscheinungen Manfred Niehaus In und nach Cages 4’ 33’’, Köln 2003 (édition questions im Salon Verlag), brosch., 40 S., 7.50 EUR. Im Verlauf der Avantgardebewegungen des 20. Jahrhunderts hat die Kunst mehrmals und in verschiedener Hinsicht Endpunkte erreicht. Ein solcher, durch keine Weiterentwicklung zu überbietender Endpunkt war Duchamps’ objekt trouvé: jeder beliebige Gegenstand – und nicht nur Pissoirs – konnten nun aufs Podest erhoben und zum Kunstwerk erklärt werden. Ein anderer Endpunkt war Malewitschs Monochromie, die das Kolorit der Malerei auf Null reduzierte und eine weiß bemalte Leinwand als Kunstwerk präsentierte. Ein dritter Endpunkt – diesmal auf dem Gebiet der Musik – ist mit dem Namen von John Cage verbunden; es handelt sich um das Verhauchen der Klänge ins Nichts. Damit sind wir bei jenem Werk angekommen, das Manfred Niehaus im Titel seiner hommage an Cage nennt: „4’ 33’’“, in Worten: 4 Minuten und 33 Sekunden. Das nämlich ist exakt die Länge des Klavierstücks, das nichts anderes zu Gehör bringt als – Stille. Um es genau zu sagen: das Stück zerfällt in drei Sätze mit einer Dauer von 33 Sekunden, 2 Minuten und 40 Sekunden und 1 Minute und 20 Sekunden, die dadurch voneinander getrennt sind, dass der Pianist den Klavierdeckel öffnet und wieder schließt. Was dazwischen zu hören ist, hängt vom Zufall ab – nicht im Sinne von Boulez und seiner Aleatorik, bei der es dem Interpreten über- lassen bleibt, in welcher Reihenfolge er verschiedene, komponierte Fragmente darbietet, sondern im Sinne von Cage. Die Stille kann nämlich auf ganz unterschiedliche Weise gehört werden, je nachdem sie von Räuspern und Gekicher des Publikums, vom Anspringen der Klimaanlage im Konzertsaal oder von der Sirene eines draußen vorbeifahrenden Feuerwehrautos unterbrochen und gestört wird. Wie schon gesagt, es handelt sich um eine hommage. Erzählt werden ein paar Dinge aus dem Leben von Cage, der 1912 in Los Angeles geboren wurde, 1934 für einige Zeit Schüler von Arnold Schönberg war, 1942 bei Max Ernst und Peggy Guggenheim in New York lebte, 1948 eine Lehrtätigkeit in North Carolina aufnahm und 1992 starb. Erzählt werden auch ein paar Dinge aus dem Leben von Martin Niehaus, der 1933 in Köln geboren wurde, 1942 vom Großvater eine Geige zu Weihnachten geschenkt bekam, bei Bernd Alois Zimmermann Komposition studierte und schließlich lange Jahre als Redakteur beim Westdeutschen Rundfunk in Köln arbeitete. Vor allem aber wird von den Begegnungen beider Männer berichtet, die nicht geplant waren, ganz zufällig zustande gekommen sind und doch – wie die Zufälle, die auch „4’ 33’’“ zu einem Erlebnis machen können – einen so tiefen Eindruck hinterlassen haben. Was diese Begegnungen über alles bloß Private und Subjektive hinaushebt, sind die Schlaglichter, die damit auch auf die Entwicklung der Neuen Musik in der noch jungen Bundesrepublik geworfen werden. Wir befin- Neuerscheinungen den uns in den 50er und 60er Jahren, in denen sich die Neue Musik nicht nur gegen die konservativen Hörgewohnheiten des Publikums durchsetzen muss, sondern auch gegen den entschlossenen Widerstand der Mandarine, die ihre einflussreichen Stellungen über den Zusammenbruch des Faschismus hinweg retten konnten und sie als „entartet“ bekämpften. Wir erfahren von dem steinigen Weg, den die kammermusikalischen Werke Anton von Weberns zurücklegen mussten, bis ihnen die rechte Anerkennung zuteil geworden ist, oder von den ersten Auftritten der jungen Komponisten-Generation nach dem Kriege, d.h. von Pierre Boulez und Luigi Nono, von Hans-Werner Henze, Henri Pousseur oder Karlheinz Stockhausen. Nicht zuletzt erzählt Niehaus auch von den ex kathedra-Auftritten Th. W. Adornos bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik, die die Avantgarde auf die serielle Technik „einschwor“, den Zufall als produktives Element der Kunst proklamierte und gegen den Klassizismus Strawinskis, Bartóks und Hindemiths auftrat. Es gab auch andere Zentren der Gegenwartsmusik, in Donaueschingen etwa, in Köln, Westberlin oder München („musica viva“); sie blieben aber von Darmstadt abhängig, wo „alljährlich entschieden wurde, was als Neue Musik ernst zu nehmen war und was nicht“ (17). Am Ende einer Aufführung blickte man auf Adorno; hob er die Hände zum Applaus, so war das Stück genehmigt. Dass sich Adorno zu Cage nicht geäußert hat, wie Niehaus schreibt 127 (18), stimmt übrigens, wie sich bei Gelegenheit einer Tagung zum 100. Geburtstag Adornos herausgestellt hat, nicht ganz. Heinz-Klaus Metzger, der geistige Wegbegleiter der Neuen Musik, hat den freilich nur im privaten Kreis geäußerten Satz notiert: „Dass ein so reizender Mensch solche Gräuel komponieren kann, lässt einen wieder an die Menschheit glauben“. Es handelt sich bei Niehaus’ Essay um keine wissenschaftliche Arbeit, keine historische oder musiktheoretische Abhandlung, sondern um persönliche Erinnerungen, die viel „Hintergrund“ freilegen und einen lebendigen Zugang zur Neuen Musik vermitteln. Am Ende der Lektüre bedauert man die Kürze und wünschte noch mehr zu erfahren. Konrad Lotter Werner Rügemer arm und reich. Bibliothek dialektischer Grundbegriffe, Bd. 3, Bielefeld 2002 (transcript Verlag), kart., 49 S., 7.60 EUR. Eine solide Einführungsreihe in die verschiedenen Ansätze dialektischen Philosophierens verspricht die von Andreas Hüllinghorst herausgegebene „Bibliothek dialektischer Grundbegriffe“ zu werden, in der bislang Christoph Hubig und Renate Wahsner über die Begriffe „Mittel“ und „Naturwissenschaft“ publiziert haben und weitere Beiträge von u.a. András Gedö, Hans Heinz Holz, Jörg Zimmer und Thomas Metscher geplant sind. Der Publizist Werner Rügemer be- 128 Neuerscheinungen fasst sich in seiner 50-seitigen Abhandlung so knapp wie prägnant und schlagend mit dem Thema „arm und reich“, indem er sich in einem ersten Schritt der Empirie zuwendet, um dann den Gegenstand im Rekurs auf Mandeville, Smith, Hegel und Marx philosophisch umfassend zu behandeln. So widmet er sich erst einmal dem Lebenslagenbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2001, welcher die Armutsentwicklung in Deutschland im Zeitraum von 1973 bis 1999 behandelt. Dieser stellt als zentrales Armutskriterium den Umstand auf, daß einem privaten Haushalt weniger als die Hälfte des durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommens zur Verfügung steht. Als wichtigstes Erkennungsmerkmal gilt hier der Bezug von Sozialhilfe (die 1988 3,5% der deutschen Bevölkerung in Anspruch nahm), gefolgt von der Über- und Verschuldung privater Haushalte (7%). Rügemer bemängelt, daß der Bericht, „nahelegt, dass die Armut das Ergebnis individueller ‚Defizite’ [wie z.B. Arbeitslosigkeit, Bildungsstatus, Familiensituation, R.J.] sei und sich deshalb nur individuell überwinden lasse.“ (10) Weiterhin wird kritisch angemerkt, dass die Bundesregierung sich nicht einmal an den Fakten orientiert, die statistisch zu erfassen sind; denn Phänomene wie ‚verdeckte Armut’ (die nationale Armutskonferenz schätzt, dass unter drei Millionen Menschen derzeit unterhalb des Sozialhilfeniveaus leben, ohne diese zu beantragen) oder der ‚working poors’ (sie haben einen oder mehrere Jobs, und sind trotzdem arm) werden hierbei nicht be- rücksichtigt. Außerdem treffe der von der Bundesregierung angenommene Tatbestand, dass Menschen, die eine Rente beziehen, automatisch nicht arm sein können, empirisch nicht zu. Überdies blieben viele Begleitumstände der Armut, wie chronische Krankheiten und mangelnde Gesundheitsversorgung in dem Bericht unerwähnt. Noch nebulöser ist nach Rügemer aber die Erfassung der globalen Armut. Gilt in der Bundesrepublik z.B. jemand mit einem Einkommen unter 500 Euro als arm, so wird global von einem ‚absoluten’ Armutskriterium eines Verdiensts unter 2 $ pro Tag ausgegangen, in der „nur“ 47% der Erdbevölkerung leben. Rügemer nennt dieses 2$-Kriterium willkürlich und realitätsfern, weil hierbei die konkreten Umstände nicht mitbedacht werden. „Und selbstverständlich ist es ein Hohn, wenn Menschen mit einem Tagesverdienst von 2,01 Dollar nicht mehr als arm bezeichnet werden. Eine sichere Behausung, ausreichende Ernährung und Kleidung, Strom, sauberes Trinkwasser, Anschluss an Kanalisation und Internet, eine Kühlanlage für Lebensmittel, Busfahrten, Schulbesuch, eine regelmäßige Informationsquelle, medizinische Versorgung – solche elementaren Voraussetzungen würdigen Lebens sind auch für 900 Dollar im Jahr nirgends zu haben.“ (14 f.) Würden hier die Armutskriterien der reichen Länder Anwendung finden, wäre die überwältigende Mehrheit der Menschheit als arm einzustufen. „Die methodisch-definitorische Ebene spiegelt dabei die politische Ebene wider, auf Neuerscheinungen der der Mehrheit der Menschen die vollen Menschenrechte verweigert werden. Das bedeutet gleichzeitig, dass es der Menschheit unmöglich gemacht wird, sich ein wahrheitsgemäßes Bild von sich selbst zu machen.“ (15) Im Vergleich zum Thema ‚Armut’ wird zwar der Topos ‚Reichtum’ unausgesetzt als existenzielles Lebensmodell gepriesen, die Dimensionen des realen Reichtums (mit geschätzten 2,5 Millionen reichen Haushalten in Deutschland, die ab 5.500 Euro netto verdienen. Somit wäre die Zahl der Wohlhabenden höher als die der Sozialhileempfänger!) jedoch heruntergespielt bzw. der Zusammenhang von Armut und Reichtum sowie der qualitative Umschlag von Einkommen und Vermögen verschwiegen. Denn wie Rügemer anhand der Marxschen Akkumulationstheorie darstellt, sind Armut und Reichtum die Pole desselben Akumulationsverhältnisses und somit Relationskategorien: Reichtum entsteht nicht aus sich heraus, sondern aus der einseitigen Abschöpfung der Mehrwert bzw. Profit generierenden Arbeitskraft. So gedacht ist Reichtum nicht etwa Besitz schlechthin, sondern das Vermögen, andere für sich an seinen privaten Produktionsmittel arbeiten zu lassen (und mithin die daraus entspringenden Profite nicht ganz auszugeben, sondern wieder gewinnbringend reinvestieren zu können). Hier stellt der Arbeitslohn der abhängig Beschäftigten kein gerechtes System von Entlohnung dar, sondern ist ein gesellschaftlich erfochtener, kultureller Standard, der zur Erhaltung der Ware 129 Arbeitskraft dient, während die Kapitalakkumulation exponentiell zunimmt. Nach Rügemer wird aber das Lohnniveau nirgends auf der Welt mit den Kapitalgewinnen in Relation gesetzt. Desweiteren ergibt sich für Rügemer aus der Analyse der aktuellen Phase des Kapitalismus, dass dieser keine Arbeitsplätze mehr schafft, sondern abbaut, und die übrig gebliebenen auszehrt. Zusätzlich erweist sich die Aussage, daß möglichst hohe Gewinne zu mehr Beschäftigung führen, als ein Trugbild, das von der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt seit den 70er Jahren in Deutschland wie anderen Ländern faktisch widerlegt wird. Vielmehr ist eine Entkoppelung des Einkommens von der Leistung in den oberen Etagen zu verzeichnen, die sich in den Phantasie-Einkommen von Vorständen und Managern niederschlägt, die, wie die aktuelle Situation nahelegt, weniger das Interesse an einer positiven Entwicklung des Arbeitsmarkt als an ihrer Rendite hegen, deren vorzüglichster Hebel zu ihrer Steigerung wiederum die Freisetzung von Arbeitskräften ist. Somit sind Armut und Reichtum keine für sich bestehenden Kategorien, sondern „Fernwirkungen des dialektischen Verhältnisses von Lohnarbeit und Kapital“ (31). Dies überzeugend nachgewiesen zu haben, ist das unbestreitbare Verdienst der exzellenten Abhandlung, der man, wie der ganzen Einführungsreihe, nur eine möglichst weite Verbreitung wünschen kann. Reinhard Jellen 130 Neuerscheinungen Kersten Schüßler Helmuth Plessner. Ein intellektueller Sonderweg. Berlin 2000 (Philo-Verlagsgesellschaft), 298 S., 25.- EUR. „Man kommt immer noch früh genug zu spät“, schrieb Helmuth Plessner in einem späten Aufsatz. Zwei Jahrzehnte nach der gebundenen Werkausgabe erscheint nun im Suhrkamp Verlag endlich die Paperback-Ausgabe der Werke des Anthropologen und Philosophen, während die Zahl der ihm gewidmeten Einzelveröffentlichungen weiter zunimmt. Besser spät als nie, könnte man mit Blick auf die Rezeption sagen. Unter dem Unstern der Verspätung verlief auch die Publikationsgeschichte von Plessners bekanntestem Werk: „Die verspätete Nation“ erlangte nach dem Erscheinen 1959 schlagwortartige Berühmtheit – und war sofort umstritten. Wurde dem Verfasser der geistesgeschichtlichen Studie über die Deutschen doch ein apologetischer Schicksalsglaube an einen deutschen Sonderweg unterstellt. Übersehen wurde Plessners Eintreten für das stete Offenhalten von Alternativen im politischen Prozess; aber auch, dass die Analysen über „die Verführbarkeit des bürgerlichen Geistes“ in Deutschland nicht im Rückblick auf die Katastrophe des Dritten Reichs formuliert worden waren, sondern schon 1935 unter anderem Titel im holländischen Exil erschienen, wo Plessner seinen Studenten – und sich – die Erschütterungen und den Niedergang des bürgerlichen Verhältnisses zur Politik in seiner Heimat zu erklären versuchte. „Auch Bücher haben Schicksale“, schrieb Plessner. Der Gedanke lag eigentlich nahe, an Hand seiner Bücher und jener Werke, auf die sie reagierten, das Außerordentliche, von Verspätung, Exzentrizität und vor allem hochreflektierter Zeitgenossenschaft bestimmte Schicksal Plessners nachzuzeichnen. Das hat der Berliner Historiker Kersten Schüßler in seiner Dissertation unternommen. Dabei kommt tatsächlich der erstaunliche Denk- und Lebensweg eines Wissenschaftlers zum Vorschein, der auf seinem Weg von der Zoologie zur Anthropologie, Philosophie und Geistesgeschichte in vielfacher Weise die intellektuelle Auseinandersetzung mit berühmten zeitgenössischen Denkern wie Weber und Husserl, Heidegger und Schmitt, schließlich Horkheimer und Adorno suchte. Durch die politischen Umstände und durch den ungewöhnlichen Horizont des eigenen Denkens geriet Plessner in die Rolle eines Außenseiters, der erst spät im Leben gesellschaftliche und intellektuelle Anerkennung erfuhr. Die exzentrische Position wurde auf diesem Lebensweg aber zur zentralen Denkfigur einer Anthropologie, welche die Modernisierungskrisen der Weimarer Republik als Zivilisierungschancen für das exzentrische Kulturwesen Mensch zu begreifen wagte. Wie Plessner zu dieser Haltung kam und in welchem prekären Umfeld er sie formulierte, das zeichnet Schüßler – vor allem für die Zeit bis ins Exil – textnah und unter Einbeziehung der bedeutendsten Auseinandersetzungen, Begegnungen und Lektüren nach. Mit stetem Blick auf den politischen Kontext Neuerscheinungen entfaltet sich die spannende Geschichte eines Wissenschaftlers, dessen Ringen um anthropologische Erkenntnis und eine politische Haltung in der politischen Situation des Deutschen Reichs in den 20er und 30er Jahren mit seinem Ringen um eine akademische Karriere, um den Sinn der eigenen politischen Existenz und das Überleben selbst parallel verlief: ein wirklicher „deutscher Sonderweg“ im 20. Jahrhundert. Plessners Lebensweg begann 1892 in Wiesbaden, wo er als Sohn eines Arztes im bürgerlichen Haushalt und väterlichen Sanatorium durch eine Schar wohlhabender, i.e.S. exzentrischer Patienten mit fremden Sprachen, Lebens- und Denkwelten in Berührung kam. Als Junge sah er den Kaiser durch Wiesbaden paradieren und entdeckte, dass Wilhelm II. wie er selbst einen verkürzten Arm hatte. Die Behinderung verhinderte die Einziehung des kriegsbegeisterten Studenten im Ersten Weltkrieg; stattdessen musste er im Germanischen Museum in Nürnberg Hilfsdienste bei der Ordnung der Sammlungen leisten. Das Studium der Zoologie und Philosophie hatte Plessner nach Freiburg, Heidelberg und kurz auch Berlin (was Schüßler leider zu erwähnen vergisst) geführt, und er hatte bereits über den „Lichtsinn der Seesterne“ publiziert, als er sich verstärkt der Philosophie zuwandte. Der gleichzeitige Zugriff auf Biologie und Philosophie erlaubte Plessner die Grundlegung einer eigenen Anthropologie – als Philosophie der Biologie. Wie dieser Ansatz aus Heidelberger Begegnungen und einem früh erwachten 131 politisch-historischen Interesse erwuchs, skizziert Schüßler facettenreich und schlüssig nach. Plessner war in Heidelberg 1913 Gast im elitären Weber-Kreis und hat dort sowohl den berühmten Kulturhistoriker und späteren Staatssekretär E. Troeltsch als auch die Kommilitonen G. von Lukács und E. Bloch kennen gelernt. Neben der Promotion und der Habilitation zu den drei kantischen Kritiken als selbst tragendem System erschienen als Frucht dieser Zeit zahlreiche kleine Aufsätze. Dabei verband Plessner sein Interesse an historischen Epochen und außereuropäischen Kulturen mit einem anthropologisch wachen Blick auf den gesellschaftlichen Wandel im Deutschen Reich, der eine Politisierung der unpolitischen Deutschen auch in Plessners Augen dringend notwendig machte. 1923 erschien „Die Einheit der Sinne“, der erste ganz eigene Versuch, menschliche Erkenntnis- und Ausdrucksmöglichkeiten in den Bereichen Sprache, Konstruktion, Musik zu analysieren und den einzelnen Kulturgebieten zuzuordnen – der Grundstein zur eigenen Anthropologie. 1924 folgte „Die Grenzen der Gemeinschaft“, nach Schüßler ein „Durchspielen“ der anthropologischen Grundfigur des exzentrischen Wesens in der Sphäre moderner Gesellschaft und zugleich eine Begründung ihrer notwendigen „Offenheit“ im Interesse zwischenmenschlicher Seelenhygiene. Die endgültige Formulierung der Philosophischen Anthropologie – im Wettlauf mit dem älteren und erfolgreicheren Kollegen Max Scheler – gelang Plessner 1928. In „Die Stufen des Organischen 132 Neuerscheinungen und der Mensch“ zeigte er, dass der Mensch Teil der Natur ist und ihr verhaftet bleibt, dass aber der Bruch zwischen körperlicher Existenz und geistiger Abhebung davon konstitutiv für die Gestaltung der menschlichen Existenz wird. „Existenz“ ist auch das Schlüsselwort von Heideggers „Sein und Zeit“, das ein Jahr früher erschien und in dessen philosophischem Schatten Plessner von da an stand. An Heidegger arbeitete er sich nun ab, 1931 unter Zuhilfenahme des Begriffs des Politischen von Carl Schmitt. Beide, so Schüßlers Deutung, versuchte Plessner in einer Weise gemeinsam zu denken, dass sich die absolute und willkürliche Begründungslogik in der Philosophie (Heidegger) wie in der Politik (Schmitt) in ein „weltoffenes“ Wechselverhältnis bringen lassen. Dass er sich hier verbrannt und die beiden Kollegen sich verrannt hatten, erkannte Plessner 1935, nach der Emigration ins holländische Exil. Während sich Heidegger und Schmitt als „NSGeistesführer“ etablierten, räsonierte Plessner über die Verspätung der Nation als versäumte Chance: Im politisch undefinierten Feld zwischen westlicher Demokratie, östlicher Stalin-Herrschaft sowie faschistischen und autoritären Regimen in Süd- und Osteuropa gelegen, hätte Deutschland zu einem Beispiel für eine weltoffene, sozial und ästhetisch engagierte Bewältigung der in der Weltwirtschaft politisch akut gewordenen Modernitätsprobleme werden können. Dieser Intellektuellentraum mag heute irrational und, was Deutschland als Modell betrifft, elitär klingen, spiegelt aber das besondere, von großen Zukunftshoffnungen getragene Bewusstsein des liberalen Teils jener Generation wider, der Plessner angehörte. Noch während der Nazi-Terror wütete, erschien das zweit bekannteste Buch Plessners, die Studie über „Lachen und Weinen“. Es wirft ein Licht auf Plessners randständige Position auch in der deutschen Nachkriegsphilosophie, dass er damit philosophisch sowohl Distanz zu den persönlichen Freunden Adorno und Horkheimer als auch zur dann reüssierenden, als Sprachphilosophie verkleideten Vernunftphilosophie hielt. Zwar vertrat er Adorno auf seinem Lehrstuhl im Frankfurter Institut für Sozialforschung, als der für ein Jahr nach Amerika ging. Doch die ‚Frankfurter’ empfanden Plessners Philosophische Anthropologie schlicht als überholt, während er selbst Adornos Kritische Theorie skeptisch als einen „Kopfsprung aus dem Bannkreis der Gesellschaft, den ihm immerhin die Gesellschaft gewährt“, betrachtete. Als Adorno und Plessner 1962 gleichzeitig Artikel für die Monatszeitschrift Merkur schrieben, wurde zwar deutlich, dass für beide „die Todeszone des Dritten Reiches“ die entscheidende Zäsur in ihren Biographien war. Doch Adorno sah in der Weimar Republik vor allem den sich ankündigen Niedergang, Plessner dagegen die versäumte Chance. Und während Auschwitz für Adorno zum Verbot gerann, sich von gelungener individueller Lebenspraxis ein konkretes Bild zu machen, variierte Plessner seine anthropologische Denkfigur ex- Neuerscheinungen zentrisch gewahrten Glücksanspruchs in einer Fülle von soziologischen Anwendungsbeispielen von Sport über Schauspielerei bis zur Politik und moderner Kunst. Die späten Aufsätze und Artikel machen immerhin die Hälfte der Gesamtausgabe von Plessners Werk aus. Dem nazistischen Terror entkommen und „besser spät als nie“ ordentlicher Professor in Göttingen geworden, fühlte sich Plessner in der Bundesrepublik endlich angekommen. Weit entfernt von jeder Hippiekultur, in seinem fächerübergreifenden, synästhetischen Zugriff aber dem Zeitgeist nah, verarbeitete Plessner im späten Werk einige Thesen der 20er Jahre aufs Neue – und stellte unter anderem dar, dass ein ‚Musizieren in Farben’ doch möglich sei. Dass Schüßler dem Nachkriegswerk nur einen Bruchteil seiner Studie einräumt, zeigt das Erkenntnisinteresse eines Historikers, dem die frühen, krisenreicheren Jahre spannenderen intellektuellen und biographischen Stoff liefern, der damit aber auch auf die intellektuelle wie politische Offenheit eines Denkens hinweisen will, das sich der Krise seiner Zeit stellte. Letzteres lässt sich gerade im philosophischen Werk Plessners neu entdecken. Bei aller Frische der Darstellung leidet Schüßlers Buch stellenweise unter editorischer Sorglosigkeit, zu denen Rechtschreibmängel und ein gelegentlich überambitionierter Satzbau gehören. Zudem weist es einen hohen, wenn auch im hinteren Teil gut verpackten „Wasserstand an Fußnoten“ (Plessner) auf. Wo Plessner oft seine Quellen verschwieg, 133 meint es der Biograph eher zu gut mit deren Offenlegung – eine Fleißarbeit, die ein Drittel des Buchumfangs ausmacht. Dafür machen Schüßlers frischer Stil und sein Gespür für die zwischenmenschlichen Verhältnisse und geistigen Auseinandersetzungen unter den deutschen Intellektuellen jener Zeit die Biographie zu einem gut lesbaren und außerordentlich anregenden Text. „Die menschliche Welt ist weder auf ewige Wiederkehr noch auf ewige Heimkehr angelegt. Ihre Elemente bauen sich aus dem Unvorhersehbaren auf und stellen sich in Situationen dar, deren Bewältigung nie eindeutig und nur in Alternativen erfolgt“, schreibt Plessner 1973. Dass eine weltoffene Politik, ein zivilisiertes Wägen von Alternativen, auch den Deutschen möglich sei, das ist ein zentraler Gedanke im Werk und eine bleibende Hoffnung im Leben Hellmuth Plessners, woran Kersten Schüßlers intellektuelle Biographie – noch immer früh genug – erinnert. Karsten Bammel Ulrich Sieg Jüdische Intellektuelle im Ersten Weltkrieg. Kriegserfahrungen, weltanschauliche Debatten und kulturelle Neuentwürfe, Berlin 2001 (Akademie Verlag), geb., 400 S., 44.80 EUR. Die Geschichte des deutschen Judentums im Ersten Weltkrieg steht assoziativ noch immer unter dem Narrativ jüdischer Kriegseuphorie und Überidentifizierung. Dies ging so weit, 134 Neuerscheinungen dass noch im Dritten Reich viele Juden in Deutschland die verhängnisvolle Vorstellung hegten, ein ‚eisernes Kreuz’ in der Familie als Beweis patriotischer Tugend schütze gegen nationalsozialistische Übergriffe. Ulrich Sieg, Privatdozent für Neuere Geschichte an der Universität Marburg, stellt in seiner Habilitationsschrift dieses Narrativ und die stilisierte Selbsteinschätzung vieler deutscher Juden als „überzeugte Nationalisten“ und „Hüter traditioneller kultureller Werte“ (11) infrage. Er analysiert die Wahrnehmung, Verarbeitung und Deutung des Ersten Weltkriegs innerhalb der deutsch-jüdischen Kultur sowie den raschen geistigen Umbruch, den der Krieg bewirkte: ein Umbruch von Assimilation und ersehnter Symbiose mit Deutschland hin zu einer eigenen, ‚anderen’ philosophischen und politischen Position. Dabei berücksichtigt Sieg das gesamte ideologische Spektrum des deutschen Judentums, das er im Kontext der allgemeinen Geschichte erfasst. Der kurze Zeitabschnitt des Ersten Weltkrieges wird vom individuellen und kollektiven Gedächtnis her auf sehr breiter Quellenbasis, von Feldpost bis hin zu philosophischen und politischen Publikationen, ausgewertet. Der Untersuchung liegt ein dem jüdischen Bildungsbürgertum entsprechender, viele akademische Berufe einbeziehender Begriff des Intellektuellen zugrunde; und die Religion und Kultur umfassende Definition des Jüdischen entspricht dem zeitgenössischen jüdischen Selbstverständnis und Grad der Akkulturation. Die Studie beginnt mit den religiö- sen und politischen Strömungen im deutschen Judentum und dessen Identitätssuche vor 1914. Die Auswertung zeitnaher Dokumente zu den unterschiedlichen Kriegserfahrungen in Front, Etappe und Heimat zeigt, dass der religionsneutrale „Burgfriede“ schon vor der vom „Alldeutschen Verband“ lancierten Konfessionsstatistik vom Oktober 1916 gefährdet und mit der Grenzsperre für jüdische Arbeiter aus Polen 1918 beinahe aufgekündigt war. Die für jüdische Intellektuelle typischen Reaktionsmuster auf den Krieg waren zu Beginn sowohl die Verherrlichung der Friedensidee als auch die Kriegsbejahung verbunden mit der Hoffnung auf einen schnellen Siegfrieden. Für die Friedensidee, in der sich die Heterogenität des Judentums widerspiegelt, stehen Leo Baecks Frontpredigten, Einsteins Pazifismus, der scharfe Ton der Kriegskritiker Ernst Bloch, Gustav Landauer und Gershom Sholem sowie Stefan Zweigs dramatische Dichtung „Jeremias“. Hingegen näherte sich Hermann Cohen, als Exponent des liberalen Judentums, mit seiner die Kantische Pflichtethik bemühenden Kriegsapologetik nicht selten der deutschen „Professoren-Kriegsliteratur“ (322). Im Laufe des Krieges geriet er mit seiner harmonisierenden Vorstellung einer deutsch-jüdischen Kultursymbiose allerdings in die Defensive. Auch Martin Buber war 1914 keineswegs immun gegen den Kriegstaumel und legitimierte den Krieg als ‚Letztwert’, ein Topos, das in „Ich und Du“ (Erstfassung 1916) existenzphiloso- Neuerscheinungen phisch transformiert wird. Wie später auch in Franz Rosenzweigs „Stern der Erlösung“ werden Kriegserfahrung und Todesfurcht die unhintergehbaren Voraussetzungen des Denkens. Siegs Analysen zeigen, dass die großen weltanschaulichen Diskussionen des deutschen Judentums während des Ersten Weltkrieges um die Definition der politischen und kulturellen Schlüsselbegriffe angesichts des sich radikalisierenden Antisemitismus kontrovers geführt wurden und oft von nicht- oder antijüdischem Gedankengut beeinflusst waren, so dass z.B. durch die Auseinandersetzung mit H. St. Chamberlain oder W. Sombart völkische und rassische Vorstellungen den innerjüdischen Diskurs über Zionismus und Ostjudentum prägten. Ulrich Sieg hat umfassend und mit großer Akribie eine kurze und spannende Zeit deutsch-jüdischer „intellectual history“ nachvollzogen. Der Bogen dieser Geschichte spannt sich von der Idee einer philosophischen Synthese von Deutschtum und Judentum, über die Hinwendung zu Geschichte und Existenzphilosophie bis hin zur Verklärung des Ostjudentums und des israelitischen Prophetentums. Als ideologische Konsequenz dieses Krieges resümiert Sieg für das deutsche Judentum eine charismatische Überhöhung des Nationsbegriffs, wie sie durch den Zionismus geschah. Für Philosophen dürfte vor allem die enge Verquickung von Denken und Zeitgeschichte von Interesse sein sowie die Vielseitigkeit und situationsbedingte Wendigkeit jüdischer Denker. Nicht zu vergessen sei ihre Stär- 135 ke, die vielen antisemitischen publizistischen und persönlichen Affronts deutscher Intellektueller und Philosophieprofessoren(-kollegen) auszuhalten. All dies gehört leider auch zu dieser Geschichte und führt drastisch vor Augen, welche Chance auf eine echte deutsch-jüdische intellektuelle Symbiose hier vertan wurde. Marianne Rosenfelder Bernhard Waldenfels Spiegel, Spur und Blick Zur Genese des Bildes, Köln 2003 (édition questions im Salon Verlag), brosch., 32 S., 7.50 EUR. Was ist ein Bild? In seiner Definition, die sich nicht auf das vom Maler produzierte Werk beschränkt, sondern auf den gesamten Bereich der visuellen Erfahrung abzielt, beginnt Waldenfels mit verschiedenen Differenzierungen: mit der „signifikativen Differenz“ zwischen dem was ist und dem, was sichtbar wird; mit der „ikonischen Differenz“ zwischen dem was sichtbar wird und dem Medium, worin es sichtbar wird; mit der „pikturalen Differenz“ (bei künstlerischen Bildern) zwischen dem Inhalt oder dem Material des Bildes und seiner Form oder seiner Funktion. Nach zwei Seiten wird der Begriff des Bildes abgegrenzt: einerseits gegen die Ontologisierung des Bildes, in der die ikonische Differenz verschwindet, d.h. Bild und Realität gleichgesetzt werden, andererseits gegen die semiologisch-funktionale Herabstufung des Bildes zu einem bloßen Hilfsmittel, wo das Bild die Realität vertritt. Nur 136 Neuerscheinungen das Festhalten an der ikonischen Differenz ermöglicht es, das Bild zugleich in Übereinstimmung mit der Realität wie im Unterschied oder im Gegensatz zu ihr zu betrachten, d.h. als interpretierte Realität. Waldenfels’ Anliegen geht über die Definition des Bildes hinaus. Er will eine „Genese des Bildes“ geben, d.h. die Abfolge verschiedener Generationen von Bildauffassungen. Dabei unterscheidet er drei Generationen, die er als Spiegel, Spur und Blick bezeichnet. „Spiegel“ oder Abbild meint die Ähnlichkeit des Bildes mit der Wirklichkeit, die Quasi-Verdoppelung des Sichtbaren. Auf die wichtige (Aristotelische) Unterscheidung zwischen der Abbildung der bloß empirischen und der „möglichen“, notwendigen oder wesentlichen Wirklichkeit, zwischen der naturalistischen Abbildung des Einzelnen und der realistischen des Allgemeinen oder Typischen kommt Waldenfels dabei nicht zu sprechen. Von „Spur“ oder Fernbild ist dann die Rede, wenn hinter der Spiegelung oder der Ähnlichkeit „ein Ganzes sichtbar“ wird, wenn sich im Hier und Jetzt „Abgründe der Ferne“ (14) auftun. In der Abbildung der Gegenwart finden sich Spuren der Erinnerung (Vergangenheit) oder Vorzeichen (Zukunft); Fernbilder können als Wunsch- oder Angstbilder auftreten. Als Zeugen ruft Waldenfels Platons Begriff der Anamnesis und Derridas Begriff der Urspur auf; der eine erklärt alles Erkennen als Wiedererkennen und Erinnerung an ein Vergessenes, der andere verschränkt die Vergangenheit mit der Zukunft. Der wichtige Unter- schied zwischen der Assoziation, die nur im Bewusstsein der Menschen liegt, und der konkreten Utopie, in der das Ferne, Zukünftige in der Sache selbst als reale Möglichkeit angelegt ist, bleibt unerörtert. Die dritte Generation des Bildes, die die beiden vorhergehenden in sich vereint und höher hebt, ist der „Blick“ oder das Fluchtbild. Sie bezeichnet die Verdoppelung des Sehens und des Gesehen-werdens. Das Bild steigt gewissermaßen vom Sockel herab, gewinnt – wie Pygmalion – ein Eigenleben und macht den Sehenden selbst zum Gegenstand. „Sofern Spiegelbild und Spur an diesem Geschehen teilhaben, erreichen sie ... eine Tiefendimension, wie sie in Lacans Deutung des Spiegelstadiums oder bei Levinas in der Spur des Anderen zum Vorschein kommt.“ (22) Im Prozess der Angleichung öffnet sich ein Spalt der Andersheit und der Fremdheit, die Vergegenwärtigung wird zur Ent-gegenwärtigung, das Bild der Realität zur Spur und zum Sprung in die Transzendenz. Wer Waldenfels’ phänomenologischen Ansatz kennt und schätzt, der wird sich über die vorliegende Abhandlung als einer klar gegliederten, komprimierten und anregenden Darstellung freuen. Wer sich dagegen eine Einführung in die Theorie des Bildes erhofft, wird weniger Freude haben. Zu viele Voraussetzungen fließen in die Darstellung ein, die nicht eingeholt und geklärt werden, so dass am Ende der Eindruck dominiert, es seien mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet worden. Konrad Lotter Neuerscheinungen Immanuel Wallerstein Utopistik. Historische Alternativen des 21. Jahrhunderts; aus dem Amerikanischen von J. Pelzer, mit einem Nachwort von A. Komlosy, Wien 2002 (Promedia), kart., 118 S., 9.90 EUR. Utopistik nennt Immanuel Wallerstein, renommierter Soziologe, der sich zuerst als Entwicklungstheoretiker, dann als Theoretiker des modernen, also kapitalistischen ‚Weltsystems‘ akademische Reputation erwarb, seinen Ansatz, die Möglichkeiten darzulegen, die nach dem von ihm vorausgesagten, unweigerlich bevorstehenden endgültigen Zusammenbruch des Kapitalismus aufscheinen. Im Gegensatz zu Utopie erörtert Utopistik die Optionen, wie eine alternative, glaubhaft bessere, historisch auch mögliche Zukunft gestaltet werden könnte, die aber keineswegs mit Gewißheit eintreten müsse. Unter Bezugnahme auf Max Webers ‚materiale Rationalität‘ geht es Utopistik also um die Vereinbarung all dessen, was von Wissenschaft, Moral und Politik darüber zu erfahren ist, welches die letzten (welt)gesellschaftlichen Ziele sein sollten. Finale gesellschaftliche Gesamtziele festzulegen ist nur in der Phase einer systemischen Weichenstellung, also in der Zeit eines historischen Übergangs realistisch, den Wallerstein ‚VerwandlungsZeitRaum‘ nennt. Eine derartige Situation sieht der Autor am Übergang des Jahrtausends gegeben. Die Kraft des die Geokultur des Weltsystems bestimmenden zentristischen Liberalismus verfällt, und 137 mit ihm geht das Vertrauen in die Fähigkeit staatlicher Strukturen verloren, das wichtigste Ziel, die Verbesserung des Gesamtwohls, zu erreichen. Durch die implizierte Delegitimierung staatlicher Strukturen greift eine Antistaatsideologie um sich, die einen entscheidenden Pfeiler des modernen Weltsystems unterminiert, das Staatensystem selbst, ohne den die notwendige endlose Kapitalakkumulation nicht möglich ist. Das kapitalistische Weltsystem ist damit in seine Krisenphase eingetreten. Die Träume von einer besseren Welt aufgrund beständiger Fortschritte sind gescheitert, das erwartete Paradies ist verloren. In der bereits angebrochenen schwierigen Phase des Übergangs, die vielleicht die kommenden fünfzig Jahre andauert, wird der Kapitalismus weiter geschwächt, vor allem durch den weltweiten Trend zur Erhöhung der Lohnkosten, durch die Erhöhung der staatlichen Ausgaben, durch welche sich die steuerliche Belastung der Unternehmen erhöht, sowie durch die unabdingbare Notwendigkeit, die Kosten für die Reparatur der globalen Umwelt zu tragen, wodurch wieder die Steuerquote und zugleich die Produktionskosten der Unternehmen erhöht werden. Diesen Kostendruck von den Unternehmen zu nehmen, werden die geschwächten Staaten, die ohnehin in einer ‚fiskalischen Krise‘ stecken, weil sie die Ausgaben für unternehmerisch relevante Infrastrukturen erhöhen, die Steuern aber zugleich senken sollen, zunehmend weniger in der Lage sein. Als Folge tritt global verstärkt das Problem auf, angemessene Profite realisieren zu 138 Neuerscheinungen können, wodurch zugleich die ‚Unvermeidbarkeit des Fortschritts‘ obsolet wird. Wallerstein zeichnet so ein Szenario, das von großer Unordnung, persönlichen Unsicherheiten und Gefährdungen, von Auflösung und Desintegration gekennzeichnet ist – das Bild eines historischen Systems in tiefster Krise, das nicht mehr in der Lage ist, in ein Gleichgewicht zurückzukehren, sondern in ein unkontrollierbares Chaos Unterversinken Bezugnahme muß.auf den Ansatz der ‚materialen Rationalität‘ erwartet und erhofft Wallerstein für die Zeit nach dem Übergang ein System sozialer Gerechtigkeit, das relativ demokratisch und egalitär sein könnte, weil der Primat der endlosen Kapitalakkumulation beendet sein wird. So ließen sich Strukturen entwickeln, die der Optimierung jedermanns Lebensqualität dienen, aber auch die Rettung der Biosphäre bedeuten. Die Errichtung gemeinnütziger Betriebe könnte die Grundlage für den Produktionsmodus des neuen Systems abgeben, das dann vielleicht die nächsten 500 Jahre bestimmen wird, wobei die Kreativität der menschlichen Phantasie herausgefordert ist. Natürlich wird die letzte Phase des Übergangs nicht kampflos verlaufen, vielmehr werden die Privilegierten mit allen Mitteln versuchen, ihre Privilegien zu bewahren. Wirksam führen kann die bevorstehenden Auseinandersetzungen für die Unterdrückten wohl nur eine zivilgesellschaftliche Regenbogen-Koalition, auch wenn dies ein Kampf wird, der keine Garantie dafür bietet, daß er von den sozialen Bewegungen gewonnen werden wird. So vage diese Aussichten, so vage abgefaßt ist die gesamte kleine Schrift, und zwar sowohl argumentativ wie auch sprachlich, wozu die oft unglückliche Übersetzung beiträgt. Die argumentative Vagheit verdankt sich wohl der Tatsache, daß Wallerstein hier bloß eine Kompilation früherer Publikationen vorlegt, ohne deren Kenntnis die Schrift häufig unverständlich wirkt. Über den Inhalt kann man geteilter Meinung sein, aber wer von dem marxistisch geprägten Autor eine Marx gemäße Interpretation des Übergangs vom kapitalistisch geprägten Weltsystem in ein anderes (oder auch in mehrere andere) erwartet, wird gewiß enttäuscht. Wallerstein wollte mit diesem Büchlein wohl ein ‚Alterswerk‘ vorlegen – sehr ‚weise‘ scheint es mir nicht geraten zu sein. Bernd M. Malunat Jutta Weber Umkämpfte Bedeutungen. Naturkonzepte im Zeitalter der Technoscience, Frankfurt/Main 2003 (Campus), 318 S., 39.90 EUR. Schon lange überzeugt es nicht mehr recht, Natur als das Gegebene, als das vor aller gesellschaftlichen Formierung bloß bereit stehende Rohmaterial zu denken. In letzter Zeit jedoch verschwinden auch noch die Restplausibilitäten solcherart Natürlichkeitsvorstellungen. Wenn Computer denken und Roboter Fußball spielen können könnten, sind gedanklich auch die letzten Bastionen säkularisierter Gottesebenbildlichkeit schlicht durch Neuerscheinungen Menschen mittels der Natur produziert, und also mitnichten natürlich gegeben. Was macht das mit unserem Umgang mit der Natur? Es ist schon ein paar Jahre her, da meinten einige Linke, in der oder auch gegen die marxistische Debatte eine Banalität festhalten zu sollen. Für uns Erdenbürger sei Natur niemals an sich, sondern eben für uns gegeben. Oder anders: Natur sei ein durch und durch gesellschaftlich infiziertes Phänomen bzw. Konzept. Prompt wurde ihnen von anderen Idealismus vorgerechnet und die Rechnung der Gegen-Banalität aufgemacht: Natur gibt es auch historisch vor und unabhängig von der Existenz menschlicher Kultur. Doch dieser Einwand hatte schon damals aus guten Gründen einen schweren Stand. De facto wahrnehmbar existierte er nämlich nur in zwei unattraktiven Varianten. Die harmlose Variante bestand in einer konsequenzlosen Verdoppelung: man gestand zu, dass Natur nur als gesellschaftliches Phänomen zu haben sei, aber man hatte zu Anfang dieser Rede einmal ganz doll und nachdrücklich betont, dass es Natur als solche trotzdem auch unabhängig von uns tatsächlich und in echt gibt. Die ganze Rede stand sozusagen in Anführungszeichen, und ggf. konnte man daher immer darauf verweisen, dass man es gar nicht so kulturalistisch meine, wie man es sagte. Die zweite, ganz und gar nicht harmlose Variante war der Stalinismus in allen reinen und vermeintlich bereinigten Abarten. Unterstellt war ein privilegierter Ort des Zugangs zu ‚der‘ Natur als der sogenannten materiellen 139 Basis der Gesellschaft. Das Politbüro als gleichsam Heiliger Stuhl der Arbeiterbewegung, von dem aus ‚die‘ Gesetze ‚der‘ Natur abgelauscht und ‚der‘ Entwicklung ‚der‘ (sozialistischen) Gesellschaft implementiert werden können. Gegen solche, schon lange vor Stalin lebendigen Vorstellungen hat eine berühmte Fußnote aus Lukács‘ Geschichte und Klassenbewußtsein eine steile Karriere gemacht. Lukács ist gleichsam der innermarxistische Gründungsvater jenes Konzepts einer rein gesellschaftlichen Natur und hatte damit wesentlichen Anteil daran, dass Engels‘ Konzept einer Dialektik der Natur nur mehr mit spitzen Fingern angefasst wurde. Dass Lukács selbst später seine Bemerkung deutlich zurückgenommen hat, spielte keine Geige mehr; und erst angesichts drückender ökologischer Probleme wurde gelegentlich darauf verwiesen, dass in dem Konzept einer rein gesellschaftlichen Natur eine Allmachtsphantasie versteckt ist. Oskar Negt gehörte damals zu den Wenigen, die eigene frühere Einschätzungen zurück genommen haben. Die ganze Debatte war und ist dadurch gekennzeichnet, dass beide genannten Banalitäten theoretisch in Anspruch genommen werden müssen, aber nur jeweils eine von beiden ins Feld geführt und gegen die andere stark gemacht wird. Wolfdietrich Schmied-Kowarzik hat damals (1977) im Anschluss an Heintel treffend die Formel von der „Natur auf der Schaukel” gebraucht. Nun ist sie wieder da, die Debatte. Freilich nicht als marxistische. Idea- 140 Neuerscheinungen lismus oder Kulturalismus heißt heute Konstruktivismus, gelegentlich gar „radikaler” Konstruktivismus. Und wieder gilt die Sorge der Materialität der Konstruktionen. Vielfach schwingt die Schaukel immer noch. In positiver oder in negativer Absicht wird dort von Vertretern oder von Gegnern unterstellt, dass ein Konstruktivismus keinerlei Begriff eines Gegebenen mehr habe bzw. dass eine Gegenkonzeption einen Begriff des Gegebenen im Sinne eines unveränderlichen, eines ahistorischen und akulturellen Gegebenen – einer fixen „Substanz” – benötige. Aber die Debatte ist nicht exakt die selbe; ihre Grundlagen haben sich verschoben. In der Praxis der Wissenschaften, in den Kommentierungen dieser Praxis, in den Feuilletons und selbst im Alltagsverständnis ist jener Realismus, der früher einmal „Alltagsrealismus” hieß, in die Defensive geraten. Man kann ihn eigentlich nur noch in taktischer Absicht zur Relativierung anderer Positionen und zur Provokation, aber nicht mehr ernsthaft vertreten. Damit ist die Luft für Gegner des Konstruktivismus gleichsam dünner geworden, denn jede Gegenposition muss das Grundmotiv des Konstruktivismus bewahren und kann ihn bestenfalls gegen sich selbst ausspielen. „Die Technowissenschaften sind längst zum Posthumanismus übergegangen, während die philosophischen Debatten ihn noch lauthals und mit Begeisterung fordern.” (243) Das eröffnet zunehmend die Chance, sich nicht selbst auf die Schaukel zu setzen, sondern gleichsam mit ihr zu spielen – durch ihr Schwingen hindurch zu huschen sozusagen. Es scheint mir das wesentliche Verdienst der Arbeit von Jutta Weber zu sein, dieses Programm auf die Tagesordnung gesetzt und dessen theoretische und praktische Schwierigkeiten verfolgt zu haben. Selbstverständlich gibt es der selbsternannt ‚dritten‘ Wege zwischen Abbildrealismus und radikalem Konstruktivismus gar viele. Aber diese dritten Wege machen es sich eben in der Schaukel bequem: Man nehme ein bisschen Realismus und ein bisschen Konstruktivismus – und schon machen nur die Anderen alle erdenklichen Fehler der „kruden” Realismen und Konstruktivismen, man selber aber schwingt „ausgewogen”. Genau aus dieser Bequemlichkeit steigt das vorliegende Buch aus. „Im Lamento unterscheiden sich die naturalistische und die kulturalistische Position nicht – nur in der Strategie, mit dieser Aporie und dem durch sie verursachten Schmerz umzugehen.” (240) Thema ist weder der Naturalismus noch der Kulturalismus als solcher, sondern deren gemeinsamer Grundansatz. Nach einer allgemeinen Einführung zeigt das 2. Kapitel zunächst auf, dass jene Sorge um die Materialität der Konstruktionen durchaus berechtigt ist. Anhand der Konzeptionen von Derrida, Luhmann und Latour werden unterschiedliche Varianten von Weltlosigkeit und Naturvergessenheit herausgearbeitet, mit guten Gründen z.T. gegen die erklärten Absichten der verhandelten Autoren. So plausibel und berechtigt es auch immer sein mag, der Natur einen Status als gegebene Substanz in allen Spielarten zu Neuerscheinungen bestreiten, so problematisch sind die Gegenentwürfe dann, wenn sie die Konstruktion eines konstruktiven Naturbegriffs nicht ihrerseits als Konstruktion reflektieren, sondern durch Verweis auf vermeintliche Selbstverständlichkeiten, empirische Forschungen oder unantastbare ‚Transzendentalien‘ als gegebene Tatsache verkaufen wollen. Etwas pauschal gesprochen: Die Konstruktion des Konstruktivismus wird nur selten als Ausdruck der (Post-) Moderne historisch verortet, sondern nimmt den Schein einer endgültigen, ahistorisch gültigen Errungenschaft an. Doch der Text führt keine nur innertheoretische, bereits rein akademisch hoch interessante Diskussion. Ein besonderes und durchgehendes Anliegen liegt in der Problematisierung des Verhältnisses von Theorie und Politik. Die besondere Pointe liegt darin, dass nicht bestimmte theoretische Positionen in einem logisch zweiten Schritt nachträglich auf ihre politischen Konsequenzen befragt werden, sondern dass die Unterstellung erprobt wird, dass bestimmte theoretische Positionen auch bestimmte politische Einsätze sind. Und um auch hier pauschal das Ergebnis zu benennen: Jene Weltlosigkeit geht mit erstaunlicher Konstanz mit einer Art Positivismus und Pragmatismus einher, die gewisse bestehende Grundannahmen und gesellschaftliche Grundstrukturen gar nicht erst als veränderbare und veränderungswürdige in den Blick nehmen kann (exemplarisch 96 ff.). Kapitel 3 und 4 machen dann den Hauptteil der Arbeit aus. Dort wird 141 der Versuch unternommen, die bis dato skizzierte erkenntnistheoretische und ontologische Debatte in der Gegenwart zu verankern. Jene allgemein-philosophische Debatte wird unter zeitgenössischen Bedingungen spezifisch gebrochen; u.a. und wesentlich sei unsere Gegenwart durch die neu entstandenen Technowissenschaften – Artifical-Life-Forschung, Robotik, Biowissenschaften etc. – geprägt. Und dort sei die Bedeutung von Natur zum einen überhaupt zentrales Thema und zum anderen wesentlich umkämpft, was insbesondere an den Debatten um das Verhältnis von lebendiger und nichtlebendiger Natur nachvollziehbar wird. In ausgezeichneter Weise bilden diese Wissenschaften Fundierung und Anwendungsfall konstruktivistischer Erkenntnistheorien. Dort gilt Natur längst nicht mehr als gegebene Substanz, sondern ihrerseits als konstruiert und konstruierend. Und dort findet sich ebenfalls eine starke, wenn auch nicht unumstrittene, Tendenz zur Entmaterialisierung der Konstruktionen. Vielfach gerät die Materie zum bloßen Träger von Information, was theoriestrategisch die Übertragbarkeit von Lebendigkeit von kohlenstoffbasierten Organismen zu Computern und Robotern und vice versa ermöglicht. Die Bedeutsamkeit dieser Wissenschaften, ja ihr paradigmatischer Charakter dürfte unbestritten sein. Doch damit nicht genug. Die Autorin übernimmt explizit die Auffassung, von der Technoscience auch als Epochenbegriff zu sprechen (116-123, 130, 135, pass.). Das hat 142 Neuerscheinungen zum Teil schlicht theoriestrategische Gründe: der Begriff Technoscience erlaube eine nüchternere Diskussion des Verhältnisses von Kontinuität und Bruch zur Moderne als der Begriff der Postmoderne. So weit, so gut. Dennoch verblüfft die Selbstverständlichkeit, mit der heutzutage selbst bei durchaus nicht fehlenden Verweisen auf marxistische Theoriekontexte ein Epochenbegriff nicht an eine ökonomisch basierte Gesellschaftsformation gebunden wird. ‚Plötzlich‘ ist eine Epoche nicht mehr dadurch gekennzeichnet, wie die Mitglieder einer Gesellschaft mitund gegeneinander ihr Leben produktiv leben, sondern scheinbar dadurch, wie sie sich (wissenschaftlich) in ihrer Welt orientieren und/oder die lebensnotwendigen Mittel zum Leben herstellen. In „altlinker” (vgl. 13 f.) Terminologie gesprochen: ‚plötzlich‘ sind die Produktivkräfte doch ein wenig materieller als die Produktionsverhältnisse. Allerdings fehlt nicht das verbale Bekenntnis der Abgrenzung von einem „technologischen Determinismus” Das 5. Kapitel (122).formuliert den philosophischen Kern des Ansatzes, vielfach im Modus der Suche. Wie jede erkenntnistheoretische Position ist auch der Konstruktivismus nicht als rein erkenntnistheoretische Position zu haben: auch die These der Konstruiertheit der Welt ist eine ontologische Annahme. Wenn aber erkenntnistheoretische Positionen nicht nicht Ontologien sein können, ist gegen vielfache Selbstmissverständnisse festzuhalten, dass viele Konstruktivismen nicht Welthaltigkeit verloren haben, die es nun gelte, ihnen wieder beizubringen. Vielmehr liegt das Problem darin, dass eine je bestimmte Welthaltigkeit, die nicht nicht sein kann, geleugnet wird. Das Credo der Arbeit liegt, wesentlich im Anschluss an Donna Haraway, darin, dass man nur die Wahl hat zwischen verleugneten und selbstreflexiv explizit gemachten Ontologien, wobei letztere als die ‚besseren‘ Geschichten von Welt gelten. Das Verdienst der Arbeit liegt darin, eine alte Debatte wiederbelebt und in ihrer aktuellen Bedeutsamkeit und zeitgenössisch gebrochenen Gültigkeit aufgezeigt zu haben. Über die Charakterisierung der Epoche mag man weiter streiten. Klar ist jedoch, was wieder einmal auf dem Spiel steht: im Klima der neuen Wissenschaften, artig begleitet von ‚radikal‘konstruktivistischen Erkenntnistheorien, dokumentiert sich wieder einmal, vermutlich in radikalerer Weise als je zuvor, eine Allmachtsphantasie unbedingter Naturbeherrschung. Dass wir alle, oder doch wenigstens die industrielle und wissenschaftliche Elite, kleine Götter seien, die ihre Evolution nunmehr selbst in die Hand nehmen könnten, ist längst eine wirkmächtige Idee diesseits aller spinnerten Träumereien. Heute heißt das in kritischer Absicht „Hyperproduktionismus” und wird von Haraway wie folgt charakterisiert: „Der Mensch schafft alles, einschließlich seiner selbst, aus der Welt heraus, die lediglich Ressource und Potential für sein Projekt und sein aktives Handeln sein kann.” (zit. nach 266) Früher hieß das Idealismus und wurde 1843 Neuerscheinungen von Feuerbach wie folgt charakterisiert: „dieser hat seinen Pantheismus im Ich − außer dem Ich ist nichts, alle Dinge sind nur als Objekte des Ich.” Und schon sind die Etiketten wieder säuberlich verteilt: Ein Idealist wäre, wer in dieser Kritik von Haraway und Weber angesichts der alten Feuerbachschen Einsicht nur die ewige Wiederkehr des Gleichen, nicht aber eine Aufforderung zum politischen Eingreifen im Hier und Jetzt wahrnimmt. Volker Schürmann Kurt Wuchterl Handbuch der analytischen Philosophie und Grundlagenforschung. Von Frege zu Wittgenstein, Stuttgart/Wien 2002 (Haupt), 682 S., 36.00 EUR. Die analytische Philosophie ist tot! Es lebe die analytische Philosophie ... vor allem, wenn sie so vorgetragen und vermittelt wird wie im vorliegenden Band. Kurt Wuchterl (1931) mag einigen durch sein „Lehrbuch der Philosophie“ bekannt sein, das mittlerweile in die 5. Auflage geht und sich zum Standardlehrbuch gemausert hat. Der Autor ist derzeit außerplanmäßiger Professor an der Universität Stuttgart und gehört seit einigen Jahren zu den „Schwergewichten“ der analytischen Philosophie in Deutschland. Wuchterls Handbuch hält sich nicht lange mit Erklärungen zur Relevanz der analytischen Theorie auf. Analytische Philosophie (AP) bezeichnet für Wuchterl zweierlei: einmal historisch 143 eine Denkschule, die Ende des 19. Jahrhunderts mit Freges sprachlogischen und meta-mathematischen Schriften begann und in der programmatischen Aufforderung Moores zusammengefasst wurde, die Philosophen sollten ihre oft so spekulativen Aussagen doch einer Analyse unterziehen. Und zum zweiten eine bestimmte Klasse von Methoden (Methodenlehre) – man möchte fast geneigt sein hinzuzufügen: eine philosophische Haltung – , die auch heute noch einflussreich ist. Hier zeichnet sich bereits ein definitorisches Problem ab, welches das gesamte Handbuch begleitet. Zum einen wird die AP als ein historisches geschlossenes Phänomen, als eine philosophische Schule aufgefasst, zum anderen jedoch rein systematisch als eine bestimmte Methode oder als eine Menge definiter Methoden begriffen, die sich hinreichend genau von anderen Methoden abgrenzen lassen. Der Zweck dieser oszillierenden Definition von AP ist klar: den Interessierten sollen Ergebnisse eines historisch abgeschlossenen Prozesses dargeboten werden, um sie als noch heute relevant auszuweisen. Neben diesen definitorischen Prämissen liegt dem Handbuch noch eine weit weniger begründete (ich meine jedoch: begründbare) zugrunde. Dass nämlich die AP mit Wittgenstein ihren Höhepunkt erreicht habe. Das Modell des Lehrbuchs folgt damit dem klassischen Muster philosophischer Schulen (und damit weniger der systematischen Abgrenzung), in der ein „Meister“ als Höhe- und Kulminationspunkt einer theoretischen Rich- 144 Neuerscheinungen tung zu setzen, um anschließend aus ihm die Paradigmen der Strömung „abzuleiten“. Das Handbuch ist in acht Abschnitte geteilt und folgt einer historischen Schilderung. Es beginnt mit einer historischen Einführung in den Analysebegriff bzw. dem „Analytischen Denken in der philosophischen Tradition“, die mit einer vorläufigen Charakterisierung der AP abschließt. AP sei demnach gekennzeichnet durch eine analytische Methode, die vor allem mathematischen Methoden entlehnt sei. Zum zweiten sei AP charakterisiert durch ein Wendung zur Sprache, gepaart mit „zwei weiteren Hauptmerkmalen, Logik und Erfahrungsbezug“. (27) Dabei unterscheidet Wuchterl trotzdem zwischen verschiedenen „Ausprägungen der AP als Methode“: - die Idealsprachphilosophie (Frege, früher Wittgenstein), - die neopositivistische Philosophie, wie sie im Wesentlichen vom Wiener Kreis (Carnap, Neurath, Schlick) vertreten wurde, - die Philosophie der Normalsprache (ordinary language philosophy), die vor allem vom späten Wittgenstein in Anknüpfung an Moores Programm vertreten wurde. In den weiteren Abschnitten („Mitbegründer der AP“, „Entwicklung der AP in Cambridge“, „Philosophische Reflexionen im Umfeld mathematischlogischer Grundlagenfragen“, „Philosophische Reflexionen im Umfeld physikalischer Grundlagenfragen“, „AP als wissenschaftliche Theorie“, „Spätphilosophie Wittgensteins als Höhepunkt der analytischen Entwick- lung“, „Ausblicke auf die Weiterentwicklung der AP zu einer neuen Tradition“) werden die Stationen der AP am Beispiel der jeweils führenden Philosophen beleuchtet. Jeder Unterabschnitt widmet sich einem einzelnen Autor, der mit einem Lebenslauf, einer je nach Bedeutung mehr oder weniger kurzen philosophischen Biografie und einer Auswahl seiner Primärwerke vorgestellt wird. Besonders lobenswert sind die Absätze, in denen Wuchterl auf die „philosophische Motivation“ der Autoren eingeht. Der biografische Hintergrund steht nie vereinzelt im Raum, sondern leitet stets zu einem thematischen Teil über, in dem die wichtigsten Theorien und Konzepte des Autors vorgestellt und kurz diskutiert werden. Geradezu genial geraten ist Wuchterl dabei die autorenübergreifende thematische Verzahnung – trotz des historischen und autorenorientierten Aufbaus. So verweisen behandelte Theoriekonzepte eines Autors bereits auf die eines Opponenten, wo sie didaktisch geschickt aufgegriffen und weitergetragen werden. Nahezu perfekt ist dies bei der Behandlung der Philosophie der Mathematik gelungen. Obwohl Freges Philosophie von der Begriffsschrift bis zu den Logischen Untersuchungen behandelt wird, greift Wuchterl das logizistisches Programm Freges im nächsten Abschnitt (Hilbert) wieder auf, um den Formalismusstreit zu beleuchten. Weitere hundert Seiten später wird dann Brouwers intuitionistisches Konzept gegen beide vorherigen Ansätze mathematischer Begründung gesetzt, ohne dass der Leser noch einmal vorblättern müss- Neuerscheinungen te. Ein Monografie zur Philosophie der Mathematik hätte dies nicht besser tun können! Im Handbuch der analytischen Philosophie sind kaum thematische Schwerpunkte zu entdecken. Dies soll keinerlei Kritik bedeuten; im Gegenteil, es setzt klar auf Vollständigkeit und liefert sie auch (einzig die analytische Ethik kommt etwas zu kurz, aber dazu gibt es ja bereits Frankenas Standardwerk). Nahezu alle wichtigen Themen und Richtungen der AP werden behandelt, allerdings sind bei den einzelnen Autoren dann Schwerpunkte gesetzt. Das Handbuch ist weniger als Nachschlagewerk als vielmehr als umfassende Einführung in die analytischen Einzeldisziplinen und -themen gedacht (herauszuheben sind die Abschnitte zu Russell und Wittgenstein). Es wendet sich an alle Studierenden und an den „Nichtfachmann“ der AP (so Wuchterl selbst) und erfüllt seinen didaktischen Anspruch vollkommen. Obwohl historisch geordnet, vermag der Leser durch den didaktisch geschickten Aufbau der Abschnitte an jeder beliebigen Stelle des Handbuches „einzusteigen“. Im Gegensatz zu Stegmüllers Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie oder Specks Grundprobleme der großen Philosophen. Philosophie der Gegenwart II-V weist es einen klaren roten 145 Faden auf und stellt erst einmal die Zusammenhänge her, die Fachdiskussionen außen vor zu lassen. Wer mit Stegmüllers Hauptströmungen seine Probleme hatte, möge sich erst Wuchterls Handbuch zuwenden, um dann nochmals Stegmüllers Vierbänder zu konsultieren. Das gesamte Lehrbuch atmet noch den optimistischen Aufbruchsgeist, mit dem Wittgenstein und Russell ihre Theorien vertraten, und in dem sich die AP auch heute noch als vernünftiges methodisch orientiertes Korrektiv – nicht Lehrmeister – dessen begreift, was außerhalb ihrer Denktradition vertreten wird. Das Zitat des Leiters des Münchner Instituts für Wissenschaftstheorie & Logik, Ulises Moulines, mag dies abschließend verdeutlichen: „Die analytische Philosophie hat Standards gesetzt, hinter die es kein Zurück mehr gibt, so dass Anzeichen dafür sprechen, dass nicht nur das 20. das Jahrhundert der Analytischen Philosophie gewesen ist, sondern dass das 21. Jahrhundert es auch bleiben wird.“ Man mag es ihr wünschen, wenn sich auch nicht zu übersehende und zu leugnende Gegenentwicklungen abzeichnen. Wuchterls Handbuch jedenfalls sollte zuvor noch gelesen werden. Wolfgang Melchior AutorInnen JADWIGA ADAMIAK, Journalistin, München GEORG KOCH, M.A., Antiquar und freier Autor, München KARSTEN BAMMEL, Studienrat, Seminarleiter am Goethe-Institut, Berlin WOLFGANG LANGER, Dr. phil., Beamter, Brannenburg ROGER BEHRENS, M.A., Wiss. Mitarbeiter an der Bauhaus-Universität Weimar, Lehrbeauftragter an der Uni Hamburg und Uni Lüneburg HAUKE BRUNKHORST, Prof., Dr. phil, geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Soziologie, Flensburg MICHAELA HOMOLKA, Dr. phil., philosophische Beratung & Moderation, Kirchseeon REINHARD JELLEN, Doktorand der Philosophie, München IGNAZ KNIPS, Lehrbeauftragter der Uni Köln, Abt. Internationale Beziehungen, Köln MANUEL KNOLL, Dr. phil., Lehrbeauftragter am Institut für Politische Wissenschaft der LMU und der Hochschule für Politik, München KONRAD LOTTER, Dr. phil., Privatgelehrter, München BERND M. MALUNAT, freiberufl. Politikwissenschaftler, München MARIA MARKANTONATOU, Soziologin, (Keele, Staffordshire) WOLFGANG MELCHIOR, M.A., Doktorand der Philosophie, Unternehmensberater, Publizist, München ALEXANDER VON PECHMANN, Dr. phil., Lehrbeauftragter für Philosophie an der LMU und VHS München FRANZ PIWONKA, Diplomsoziologe, München MARIANNE ROSENFELDER, M.A. der politischen Philosophie, freie Journalistin, München OLAF SANDERS, Dr. phil., wiss. Assistent am Institut für 147 Allgemeine Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg VOLKER SCHÜRMANN, Dr. phil. habil., Dozent an der sportwiss. Fakultät der Uni Leipzig GERHARD SCHWEPPENHÄUSER, Prof., Dr. phil., Professor am Fachbereich Gestaltung der FHS Würzburg und am Fachbereich Erziehungswissenschaft der Uni Kassel EBERHARD SIMONS, Prof., Dr. phil., Professor für Philosophie, Vorsitzender des Stiftungsrats der „Europ. Stiftung: Neue Oikonomia für Wirtschaft und Kultur“, München ALFONS SÖLLNER, Prof., Dr. phil., Lehrstuhl für Politische Theorie und Ideengeschichte, TU Chemnitz CHRISTOPH TÜRCKE, Prof., Dr. phil., Professor für Philosophie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig PERCY TURTUR, M.A., freier Autor, München THOMAS WIMMER, M.A., freier Autor und Herausgeber, München FRANCO ZOTTA, Dr. phil., freier Autor, Unna. Impressum Widerspruch Münchner Zeitschrift für Philosophie 24. Jahrgang (2004) Herausgeber Münchner Gesellschaft für dialektische Philosophie Tengstr. 14, 80798 München Redaktion Jadwiga Adamiak, Manuel Knoll, Georg Koch, Konrad Lotter, Wolfgang Melchior (Internet), Alexander von Pechmann (verantw.), Franz Piwonka, Marianne Rosenfelder, Percy Turtur Verlag Widerspruch Verlag Tengstr. 14, 80798 München Tel & Fax: (089) 2 72 04 37 e-mail: [email protected] Erscheinungsweise halbjährlich / 500 Exemplare Gestaltung: Percy Turtur, München ISSN 0722-8104 Preis Einzelheft: 6.- EUR Abonnement: 5.50 EUR ( zzgl. Versand) Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. – Für unaufgefordert zugesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. – Nachdruck von Beiträgen aus Widerspruch ist nur nach Rücksprache und mit Genehmigung der Redaktion möglich. http://www.widerspruch.com W I D E R Das Archiv im Internet: S P R U C H alle Nummern; alle Artikel Widerspruch 1/81___ (Heft 1) _______Wissenschaft und sozialer Fortschritt Widerspruch 2/81___ (Heft 2) _______________ Freiheit der Wissenschaft? Widerspruch 1/82___ (Heft 3) ______ Friedensbewegung & Friedenstheorie Widerspruch 2/82___ (Heft 4) _____ Krise in Gesellschaft und Wissenschaft Widerspruch 1/83___ (Heft 5) ________________ Ethik in der Disskussion Widerspruch 2/83___ (Heft 6) _____________ Marx-Rezeption in Munchen Widerspruch 1/84___ (Heft 7) ________________Abschied von der Arbeit? Widerspruch 2/84___ (Heft 8) ___ Hilfe zur Selbsthilfe im Konservativismus Widerspruch 1/85___ (Heft 9) _______________________ Frauen-Denken Widerspruch 2/85__ (Heft 10) ________ Computer – Denken – Sinnlichkeit Widerspruch 1/86__ (Heft 11) ______________________ Gen-Technologie Widerspruch 12______ (1986) ________________ Wiederkehr des Mythos? Widerspruch 13______ (1987) ______ Philosophie im deutschen Faschismus Widerspruch 14______ (1987) ____ Heimat. Zwischen Ideologie und Utopie Widerspruch 15______ (1988) ________________________ Neues Denken Widerspruch 16/17___ (1989) ______________ Ich – Subjekt – Individuum Widerspruch 18______ (1990) _____Restauration der Philosophie nach 1945 Widerspruch 19/20___ (1990) ______________________Ende der Linken? Widerspruch 21______ (1991) ______________ Multikulturelle Gesellschaft Widerspruch 22______ (1992) _______________ Wozu noch Intellektuelle? Widerspruch 23______ (1992) _______________"Markt und Gerechtigkeit" Sonderheft _________ (1992) ______________________ Walter Benjamin Widerspruch 24______ (1993) _________________ Gewalt und Zivilisation Widerspruch 25______ (1994) _______________ Die Philosophie des Mülls Widerspruch 26______ (1994) _________________ Ästhetik des Nationalen Widerspruch 27______ (1995) __________________ Philosophie und Alltag Widerspruch 28______ (1996) _______________________ Public Relations Widerspruch 29______ (1996) ______________________ Geist und Gehirn Widerspruch 30______ (1997) ________________ Afrikanische Philosophie Widerspruch 31______ (1998) ________________________ Globalisierung Widerspruch 32______ (1998) ______________________ Problem Bildung Widerspruch 33______ (1999) ________________________ Wagnis Utopie Widerspruch 34______ (1999) _________________ Geschlechter-Differenz Widerspruch 35______ (2000) ______________________ Nie wieder Krieg Widerspruch 36______ (2001) ____ Perspektiven postnationaler Demokratie Widerspruch 37______ (2001) ____jüdisches Denken – jüdische Philosophie Widerspruch 38______ (2002) ___________________Ökologische Ästhetik Widerspruch 39______ (2003) ________________ Kritik der Globalisierung Widerspruch 40______ (2003) _______________ Kampf der Kulturbegriffe http://www.widerspruch.com [email protected]