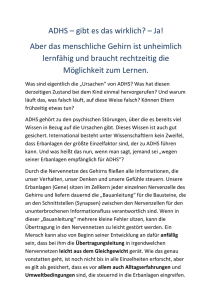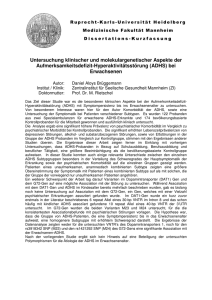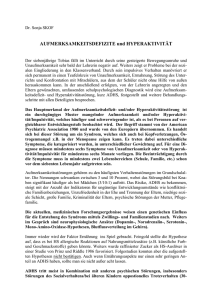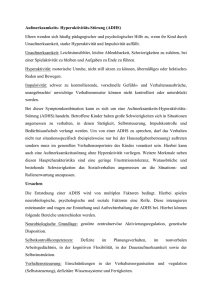Grenzgänge zwischen Pädagogik und
Werbung

Berliner Debatte Initial 1 24. Jg. 2013 Bildung und Biologie ADHS aus Sicht Becker von Experten und Eltern Salaschek Bildgebende Hirnforschung „Gold“ in Leben und Werk Busch Richard Wagners Flige u.a. Leben mit dem Stalinschen Terror Wohlfahrt elektronische Sonderausgabe ISBN 978-3-941880-56-6 © www.berlinerdebatte.de ohne Wachstum Koch Berliner Debatte Initial 24 (2013) 1 Sozial- und geisteswissenschaftliches Journal © Berliner Debatte Initial e.V., Vorsitzender Erhard Crome, Ehrenpräsident Peter Ruben. Berliner Debatte Initial erscheint viermal jährlich. Redaktionsrat: Harald Bluhm, Wladislaw Hedeler, Cathleen Kantner, Rainer Land, Udo Tietz, Andreas Willisch. Redaktion: Ulrich Busch, Erhard Crome, WolfDietrich Junghanns, Raj Kollmorgen, Thomas Müller, Dag Tanneberg, Matthias Weinhold. Redaktionelle Mitarbeit: Jonas Frister, Robert Stock, Johanna Wischner. Verantwortlicher Redakteur: Jan Wielgohs, in Vertretung Thomas Müller. V.i.S.P. für dieses Heft: Jonas Frister und Thomas Müller. Copyright für einzelne Beiträge ist bei der Redaktion zu erfragen. E-Mail: [email protected] Berliner Debatte Initial erscheint bei WeltTrends, c/o Universität Potsdam, August-Bebel-Straße 89, D-14482 Potsdam, Tel. +49/331/977 45 40, Fax +49/331/977 46 96 Preise: Einzelheft: 15 € Jahresabonnement: 40 €, Institutionen 45 €, Studenten, Rentner und Arbeitslose 25 €. Ermäßigte Abos bitte nur direkt bei Berliner Debatte Initial bestellen. Nachweis (Kopie) beilegen. Das Abonnement gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn nicht sechs Wochen vor Ablauf gekündigt wird. Bestellungen Einzelhefte und Abos im Webshop oder per E-Mail: [email protected] Bestellungen Pdf im Webshop oder per E-Mail: [email protected] www.berlinerdebatte.de www.welttrends.de Berliner Debatte Initial 24 (2013) 1 1 Bildung und Biologie Zusammengestellt von Jonas Frister und Thomas Müller Editorial3 Ulrich Busch „Das Gold ist schuld!“ Zur Rolle des Geldes im Leben und im Werk Richard Wagners Nebenschwerpunkt: Leben mit dem Stalinschen Terror Zusammengestellt von Wladislaw Hedeler 6 Schwerpunkt: Bildung und Biologie. Die pädagogische Präsenz biowissenschaft­lichen Wissens Irina Anatoljewna Flige Denkmale für die Opfer des Sowjetterrors. Eine Bestandsaufnahme 80 Alexander Dawydowitsch Margolis Orte der Erinnerung an den Terror in Sankt Petersburg und im Leningrader Gebiet 88 Anatolij Rasumow Zur Geschichte des Gedenkfriedhofes Lewaschowo 93 Thomas Müller Erziehung auf biowissenschaftlicher Grundlage? Aktuelle Tendenzen der Naturalisierung im pädagogischen Feld 24 Nicole Becker Grenzgänge zwischen Pädagogik und Psychiatrie: ADHS aus Sicht von Experten und Eltern Lew Gudkow Spiele mit Stalin: Über das Legitimationsdefizit des Putin-Regimes 99 35 Jonas Frister Die Hirnforschung aus der Sicht von Praktikern 51 *** Max Koch Wohlfahrt ohne Wachstum. Theoretische Debatte und sozialpolitische Implikationen 109 Mario Neukirch Offshore-Windkraft als Plan B der Energiekonzerne? 125 Oliver Neun Die Geburt des amerikanischen „Neokonservatismus“. Daniel Bell, Michael Harrington und die Zeitschrift „Dissent“ 137 Ulrich Salaschek Bildgebende Hirnforschung zwischen Hype und Kritik. 20 Jahre funktionelle Magnetresonanztomographie64 2 Besprechungen und Rezensionen Michael Nedo (Hg.): Ludwig Wittgenstein. Ein biographisches Album Rezensiert von Mariele Nientied148 Wolfgang Uwe Eckart: Medizin in der NS-Diktatur. Ideologie, Praxis, Folgen Rezensiert von Regina Casper151 Berliner Debatte Initial 24 (2013) 1 Wladislaw Hedeler Zwei unangepasste Intellektuelle: Karl Radek und Chaim Zhitlowsky 154 Gunther Teubner: Verfassungsfragmente. Gesellschaftlicher Konstitutionalismus in der Globalisierung Rezensiert von Oliver Römer157 Autoren162 Berliner Debatte Initial 24 (2013) 1 3 Editorial Was bedeutet es, dass Neurobiologen in Fern­sehtalkshows als Experten für Bildung und Erziehung auftreten? Was bedeutet es, dass Kritiker der Institution Schule auf die Hirnentwicklung von Heranwachsenden verweisen, wenn sie für Veränderungen werben? Was bedeutet es, dass immer mehr Kinder und Jugendliche die Diagnose erhalten, an einer biologisch bedingten Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zu leiden, die medikamentös zu behandeln ist? Was bedeutet es, dass Bildungsreformer Methoden und Erkenntnismuster aus den Biowissenschaften und der Medizin als neuen Maßstab pädagogischer Forschung empfehlen? Die angesprochenen Phänomene sind zu­nächst einmal zeitdiagnostisch interessant. Sie legen den Schluss nahe, dass biowissenschaftliches Wissen im pädagogischen Feld an Präsenz gewinnt. Das Spektrum reicht dabei von massenmedialen und populärwissenschaftlichen Darstellungen über die institutionalisierte pädagogische Praxis und die Lebenswelten von Eltern und Kindern bis zur Erziehungswissenschaft als Disziplin. Die Phänomene deuten auch auf systematische Probleme, die mit der Verbindung von Bildung und Biologie einhergehen. Sie beziehen sich u. a. auf das Verhältnis verschiedener Formen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Wissens, das Verständnis pädagogischer Professionalität, die Abgrenzung zwischen „normalem“ und „pathologischem“ Verhalten und die disziplinäre Identität einer Wissenschaft von der Erziehung. Diese systematischen Probleme haben zugleich eine politische Dimension, da Sachfragen auch Machtfragen sind. Darum lässt sich die inhaltliche Frage nach der pädagogischen Relevanz biowissenschaftlichen Wissens nicht von der Frage trennen, welche Wissenschaften als Produzenten legitimen Wissens über Bildung und Erziehung akzeptiert werden und Zuständigkeit für die institutionalisierte pädagogische Praxis beanspruchen dürfen. Gerade in diesen Punkten scheint die Erziehungswissenschaft heute Konkurrenz von den Biowissenschaften zu bekommen, wobei vor allem Neurowissenschaftler versuchen, ihr Wissensgebiet als alternative Pädagogik zu etablieren. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass sich Pädagogik und Biologie gegenwärtig nicht zum ersten Mal begegnen. Deutlich wird dies am modernen Bildungsbegriff, der für biologisch-organologische Interpretationen offen ist. Johann Friedrich Blumenbachs anthropologische Schrift über den „Bildungstrieb“ (1781) oder Goethes bekannter Ausspruch, Bildung sei „geprägte Form, die lebend sich entwickelt“, sind frühe Beispiele hierfür. Auch die Reformpädagogik um 1900 schreibt sich auf die Fahnen, Pädagogik und Biologie miteinander zu verbinden. Dass die Biologie dabei Vorrang hat, stellt etwa Ellen Key klar, wenn sie in ihrem Buch „Das Jahrhundert des Kindes“ die „Umwandlung der Pädagogik in psycho-physiologische Naturwissenschaft“ propagiert. Für Key ist empirische Forschung naturwissenschaftlicher Art der Schlüssel dazu, „etwas über die wirkliche Natur des Kindes zu wissen“ und falsche Vorstellungen über Bildung und Erziehung auszuräumen. In 4 der aktuellen Bildungslandschaft stößt man auf ähnliche Argumente, um Verbindungen von Bildung und Biologie zu plausibilisieren. In der Erziehungswissenschaft hat man die Frage nach Nutzen und Nachteil der Biowissenschaften für die Pädagogik in den letzten Jahren intensiv erörtert. Gleichwohl steckt diese Diskussion in einer Sackgasse, in der diejenigen, die biowissenschaftliche Perspektiven auf Bildung und Erziehung unbedingt stärken möchten, und diejenigen, die diese Entwicklungen ablehnen, auf ihren Standpunkten beharren und zusehends aneinander vorbeireden. Genau an dieser Stelle setzen die Beiträge des Themenschwerpunkts an. Jenseits rhetorischer Auseinandersetzungen geht es ihnen darum, kritische Perspektiven auf die pädagogische Präsenz der Biowissenschaften zu entwickeln und Aspekte anzusprechen, die bislang kaum Beachtung fanden. Die Beiträge gehen zurück auf ein Forschungsforum, das im März 2012 auf dem 23. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft in Osnabrück stattfand. Unter der leitenden Frage, wie sich das pädagogische Feld unter dem Einfluss der Biowissenschaften wandelt, verbinden sie theorieorientierte mit empirischen Zugängen. Thomas Müller setzt sich mit dem Angebot auseinander, Erziehung und Bildung auf biowissenschaftliche Grundlagen zu stellen. Er ordnet dieses Angebot in einen größeren epistemischen Zusammenhang ein, den er als naturalistisch bezeichnet, und untersucht verschiedene Tendenzen einer Naturalisierung des Pädagogischen. Am Beispiel der ADHS beleuchtet Nicole Becker Grenzverschiebungen zwischen Medizin und Pädagogik. Sie kann zeigen, dass die Frage, ob ein verhaltensauffälliges Kind (noch) als „schwierig“ oder (schon) als „krank“ gilt, von Experten höchst unterschiedlich bewertet wird und Auswirkungen auf Familie und Schule hat. Ob die Hirnforschung bei Lehrkräften tatsächlich so nachgefragt ist, wie man zuweilen vermutet, untersucht Jonas Frister. Er zeichnet ein differenziertes Bild der Erwartungen und Interessen professioneller Pädagogen, das von der Sehnsucht nach Berliner Debatte Initial 24 (2013) 1 Rezeptwissen bis zur Rechtfertigung eigener pädagogischer Überzeugungen reicht. Ulrich Salaschek lenkt schließlich den Blick zurück auf biowissenschaftliche Deutungsangebote. Seine These ist, dass die bildgebende Hirnforschung den Menschen als neuronale Maschine begreift – ein Menschenbild, das etwa bei der zunehmenden Einnahme von Psychopharmaka handlungswirksam wird. Der erste Beitrag dieses Heftes ist einem ganz anderen Thema gewidmet: Richard Wagner, vor 200 Jahren, am 22. Mai 1813, in Leipzig geboren und vor 130 Jahren in Venedig gestorben, war das größte Musikgenie des 19. Jahrhunderts, ein Künstler von europäischem Rang und von säkularer Bedeutung. Aus Anlass des diesjährigen Wagner-Jubiläums eröffnen wir den neuen Jahrgang mit einem Essay von Ulrich Busch, der die Rolle des Geldes im Werk Wagners sowie dessen Verhältnis zu Geld, Kredit und Schulden zum Gegenstand hat. Im Nebenschwerpunkt präsentieren wir vier Beiträge, die sich mit der Bewältigung des Stalinschen Terrors im heutigen Russland auseinandersetzen. Wir setzen damit die Diskussion aus Heft 1/2012 fort. Die hier versammelten Texte gehen zurück auf eine internationale Konferenz, die im Oktober 2012 in Sankt Petersburg stattfand. Es war die 5. Tagung, die u. a. vom Moskauer Rosspen-Verlag – dort erscheint dieses Jahr der dazugehörige Sammelband –, von der JelzinStiftung, der Menschenrechtsorganisation „Memorial“ und der Lichatschow-Stiftung organisiert wurde. Zu den Mitveranstaltern gehörten die Leningrader Eremitage, das Staatsarchiv der Russischen Föderation und das Archiv für sozialpolitische Geschichte (beide Moskau). Die Idee, „Leben im Terror“ als Tagungsthema zu wählen, geht zurück auf den Schriftsteller und Schirmherren der Veranstaltung, Daniil Granin. Debattiert wurde über gesellschaftliche Mechanismen und Techniken des Terrors, Widerstand, das Verhältnis von Terror und Sozium, den Stellenwert regionaler Identitäten, die Akteure des Terrors sowie die Erinnerung an den Terror und die Geschichtspolitik. Neben dem Moskauer Soziologen Lew Gudkow und Berliner Debatte Initial 24 (2013) 1 zwei Mitarbeitern der Petersburger Menschenrechtsorganisation „Memorial“, Irina Flige und Alexander Margolis, kommt auch Anatoli Rasumow zu Wort, der seit 1995 zu den Herausgebern des „Leningradskij Martirolog“ gehört und die Gruppe „Wiedergegebene Namen“ leitet. Bis auf den heutigen Tag sind elf Bände erschienen, die Namenslisten, biografische Skizzen über die Opfer des Terrors und ausgewählte Dokumente über Planung und Durchführung des „Großen Terrors“ in und um Leningrad enthalten. 5 Rasumows Beitrag über den Gedenkfriedhof Lewaschowo ist der gleichnamigen Broschüre entnommen, die demnächst auch in deutscher Sprache erscheint. Alle Aufsätze des Nebenschwerpunkts handeln von einer „unbewältigten Vergangenheit“, vom Umgang mit der Erinnerung, der Gedenkkultur und Geschichtspolitik in Russland im Allgemeinen und in Sankt Petersburg im Besonderen. Thomas Müller, Wladislaw Hedeler Berliner Debatte Initial 24 (2013) 1 35 Nicole Becker Grenzgänge zwischen Pädagogik und Psychiatrie: ADHS aus Sicht von Experten und Eltern Rein formal betrachtet lässt sich die Grenze zwischen Pädagogik und Psychiatrie eindeutig bestimmen, denn deren professionelle Zuständigkeiten sind klar definiert: Pädagogische Institutionen haben den Auftrag, alle Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu fördern, psychiatrische Einrichtungen sind nur für diejenigen zuständig, die im Sinne diagnostischer Kriterien psychisch krank sind. Oder anders formuliert: Auf der einen Seite geht es um Erziehung, auf der anderen um Therapie.1 Diese theoretisch klare Abgrenzung führt in der Praxis jedoch zu Schwierigkeiten, denn sie setzt ein kategoriales Modell voraus, demzufolge sich „Kinder mit psychopathologischen Symptomen als kranke Gruppe“ eindeutig von gesunden Kindern unterscheiden lassen (DuBois/Resch 2005, S. 39). Das ist aber nur bedingt der Fall, denn während sich viele somatische Krankheiten beispielsweise durch Normabweichungen physiologischer Werte nachweisen lassen und man auf dieser Basis eindeutiger krankhafte von gesunden Zuständen unterscheiden kann, existieren im Bereich psychischer Störungen keine entsprechenden (labor-)technischen Nachweismethoden.2 Dem kategorialen Modell wird deshalb in der Psychiatrie ein dimensionales Modell gegenübergestellt, das „psychopathologische Symptome als unspezifische Reaktionsmuster des Menschen auf Überforderung der Anpassungskapazität“ betrachtet, „wobei unterschiedliche pathogenetische Bedingungen diese Anpassungsstörungen bewirken können. Pathologie definiert sich daher nicht absolut aus einem Symptom allein, sondern aus dem Wechselverhältnis zwischen Anpassungsnotwendigkeiten (Problemlagen) und Anpassungsmöglichkeiten (Ressourcen)“ (ebd.). Ein zentrales diagnostisches Instrument ist deshalb das klinische Gespräch, das durch weitere Verfahren, wie psychologische Tests und Verhaltensbeobachtungen, ergänzt wird. DuBois und Resch (2005) weisen nun darauf hin, dass sich auch nach erfolgter Diagnosestellung sowohl die Zuständigkeiten als auch die Vorgehensweisen von Psychiatrie und Pädagogik überschneiden. Zwar orientiere sich die Psychiatrie an einem „Krankheitsmodell“ und konzentriere sich daher auf „ein Defizit oder eine Störung“, während sich die Pädagogik „an einem Modell der zu fördernden Entwicklung“ orientiere, doch letztlich sei auch die Behandlung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher durch ein „pädagogisches Milieu“ geprägt: „Vom Prinzip her enthält Therapie immer auch Pädagogik, und Pädagogik ist immer auch zugleich Therapie“ (DuBois/Resch 2005, S. 530). Die Autoren sprechen sich deshalb gegen eine strikte Trennung von Pädagogik und Psychiatrie aus, die auch eine Aufteilung von Zuständigkeiten mit sich bringen würde. Stattdessen fordern sie, dass psychische Schwierigkeiten „solange wie möglich als Alltagsschwierigkeiten behandelt“ und „im pädagogischen Alltag bewältigt werden“ (ebd., 531) sollten. Mit anderen Worten: Pädagogik endet nicht dort, wo Psychiatrie beginnt, sondern Pädagogik und Psychiatrie ergänzen sich bei der Therapie, Behandlung und Erziehung von psychisch kranken Kindern. Das Verständnis von Pädagogik und Psychiatrie, das DuBois und Resch als Vertreter der 36 Kinder- und Jugendpsychiatrie formulieren, zielt darauf, jenseits von disziplin- und professionspolitischen Interessen einen sachlichen und konstruktiven Zugang zu schaffen. Konsensfähig dürfte es jedoch wohl kaum sein, denn wenn es um die Frage geht, ob ein Kind oder Jugendlicher „schwierig“ – im Sinne von „schwer erziehbar“ oder „renitent“ – oder „krank“ – im Sinne von „psychisch gestört“ – ist, beginnen in der Wissenschaft Auseinandersetzungen um Deutungsansprüche und zwischen den Professionen Kämpfe um Zuständigkeiten. ADHS als Modellfall Besonders ausgeprägt ist das Spannungsverhältnis zwischen Pädagogik und Psychiatrie in der Diskussion über die AufmerksamkeitsdefizitHyperaktivitätsstörung (ADHS). Mit einer durchschnittlichen Prävalenzrate von 5,3% ist die ADHS die derzeit im Kindes- und Jugendalter am häufigsten diagnostizierte psychische Erkrankung (vgl. Steinhausen 2010a, S. 31). Die Diagnose erfolgt anhand von Kriterien, die im DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4. Auflage) und in der ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Auflage) festgelegt sind. In der ICD-10 ist von der Hyperkinetischen Störung (HKS) die Rede; in der wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion hat sich jedoch die Bezeichnung ADHS durchgesetzt.3 Zu den Kernsymptomen der ADHS zählen Unaufmerksamkeit, Überaktivität und mangelnde Impulskontrolle; beide Klassifikationssysteme geben eine Reihe von Parametern vor (z. B. im Hinblick auf Problemkontexte, Auftretenshäufigkeit und zeitliche Dauer), die der diagnostischen Einschätzung dienen sollen. Die Kriterien sind bei der Diagnostik leitend und können mit anderen Tests, etwa zur Leistungs- oder Intelligenzdiagnostik, kombiniert werden. Ein „testpsychologisches Verfahren, mit dem eine ADHS definitiv festgestellt werden kann“ (Bundesärztekammer 2005, S. 18), gibt es jedoch nicht. Seit Jahren sorgt das Thema für wissenschaftliche Auseinandersetzungen zwischen Vertretern unterschiedlicher Disziplinen und Nicole Becker Professionen. Dabei ist es allerdings nicht so, dass eine Disziplin oder Profession jeweils für eine bestimmte Position steht, vielmehr kommt es auch innerhalb von Wissenschaftsdisziplinen und Berufsgruppen zu Kontroversen. Selbst in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es inhaltlich extrem unterschiedliche Positionen, die mit Abgrenzungs- und Behandlungsfragen zu tun haben. Dammasch (2009, S. 131) unterscheidet zwischen Vertretern der „biologischpsychiatrischen Sicht“ und Vertretern der „psychoanalytisch-psychosozialen Sicht“, die jeweils unterschiedliche Krankheitsverständnisse und verschiedene Ansichten über die angemessene Behandlung haben. Im Kern geht es dabei immer wieder um zwei grundsätzliche Fragen, die miteinander verschränkt sind: Die erste Frage bezieht sich auf die diagnostische Validität der aktuellen Klassifikation und lautet: Handelt es sich bei der ADHS tatsächlich um eine von anderen psychischen Störungen klar abgrenzbare Erkrankung? (1) Die zweite Frage bezieht sich auf die Zuverlässigkeit des diagnostischen Prozesses und lautet: Kann man davon ausgehen, dass sich die Mehrzahl der Fachärzte an die diagnostischen Richtlinien hält und somit hinreichend abgesicherte Diagnosen stellt? (2) (1) Die erste Frage betrifft das im vorigen Abschnitt angesprochene Abgrenzungsproblem: Der Einwand der Kritiker lautet, dass sich auf die ADHS weder ein kategoriales noch ein dimensionales Krankheitsmodell anwenden lässt, weil die unter dieser Bezeichnung zusammengeführten Symptome kein einheitliches Störungsbild ergeben. Damit wird nicht bestritten, dass sich die entsprechenden Verhaltensweisen dauerhaft und in unterschiedlichen Ausprägungen beobachten lassen und Leiden erzeugen, sondern dass sich deren Kombination sinnvollerweise als eine psychische Störung beschreiben lässt. Als Begründung wird insbesondere die hohe Komorbidität von ADHS mit weiteren Störungen angeführt: Eher selten wird eine ADHS als Einzeldiagnose gestellt; neben der ADHS liegen „in der überwiegenden Mehrheit der Fälle – bis zu 85% – eine weitere Störung und bei 60% der Fälle sogar multiple Komorbiditäten“ vor (Steinhausen 2010b, S. 174). Deshalb Grenzgänge zwischen Pädagogik und Psychiatrie bezweifelt Hopf (2008, S. 208), „ob es überhaupt möglich ist, ein Krankheitsbild ADHS mit einem Kometenschweif von Komorbiditäten (depressive Störungen 9,1%, Angststörungen 17,2%, dissoziale Störungen 46,9%) exakt zu diagnostizieren“. Ähnlich äußert sich Günter (2009, S. 390): „Eine nosologische Entität ist vor allem durch eine einheitliche Ätiologie und Symptomatik gekennzeichnet“, mit Blick auf die ADHS stelle sich jedoch die Frage, „ob nicht eine mehr oder weniger zufällige Kombination von Symptomen künstlich zu einer Einheit zusammengefasst“ werde. Furman (2005, S. 995) formuliert deshalb die Hypothese, dass die drei Leitsymptome der ADHS weder als Krankheitssymptome noch als Extremausprägungen normaler Verhaltensweisen treffend beschrieben sind, sondern dass sie vielmehr als Ausdruck innerer Konflikte oder unerfüllter emotionaler oder pädagogischer Bedürfnisse gedeutet werden können. Als Begründung führt Furman an, dass auch andere Störungsbilder mit eingeschränkter Konzentration, Unaufmerksamkeit, Bewegungsunruhe und impulsiven Ausbrüchen einhergingen, ohne dass diese als krankheitsspezifische Leitsymptome gewertet würden (vgl. ebd.; vgl. auch Hopf 2008; Günter 2009). Konsequenterweise liefe das darauf hinaus, die für eine ADHS typischen Verhaltensweisen eben nicht als psychopathologische Symptome zu interpretieren, sondern schlicht als problematische Verhaltensweisen, die beispielsweise als Reaktion auf belastende Ereignisse oder persönliche Krisen auftreten. Folglich hätten sie für sich genommen keinen „Krankheitscharakter“ und die betroffenen Kinder und Jugendlichen wären – es sei denn, sie hätten eine andere diagnostizierbare psychische Störung – auch kein Fall für die Psychiatrie. (2) Den Anlass zur zweiten Frage liefert die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegene Zahl gestellter Diagnosen, die mit gestiegenen Verschreibungen sogenannter Psychostimulanzien einhergeht (vgl. Barmer GEK 2013, S. 135ff.). Hopf (2008) geht davon aus, dass diese Entwicklung nicht – wie einige Fachvertreter behaupten – auf verbesserte Früherkennungs- und Versorgungsstrukturen zurückzuführen sei, sondern schlicht das Re- 37 sultat laxer Diagnosepraxen sei: „Oft wird nach kurzer Symptombeschreibung undifferenziert Bewegungsunruhe und ADHS gleichgesetzt, so als wäre jede Angst bereits eine Angstneurose“ (ebd., S. 208). Bruchmüller und Schneider (2012) konnten jüngst im Rahmen einer repräsentativen Befragung unter Kinder- und Jugendtherapeuten und -psychiatern in Deutschland zeigen, dass die Diagnose ADHS potentiell zu häufig – und das bedeutet: fälschlicherweise – gestellt wird. Für die Vereinigten Staaten gibt es ähnliche Befunde: Furman (2005) verweist auf eine Befragung US-amerikanischer Kinderärzte, die zu dem Ergebnis kommt, dass sich nur ein Viertel (25,8%) von ihnen an die in den Richtlinien angegebenen vier diagnostischen Komponenten hält und nur die Hälfte (53,1%) der Ärzte die Anzahl der jährlich vorgesehenen Kontrolltermine bei Patienten einhält, die mit Stimulanzien behandelt werden (vgl. ebd., S. 994f.). Miteinander verschränkt sind die beiden Grundsatzfragen insofern, als eine negative Antwort auf die erste Frage eine Antwort auf die zweite Frage überflüssig machen würde, denn wenn sich belegen ließe, dass das Konstrukt der ADHS an sich angreifbar ist, könnten Experten selbst dann nicht zuverlässig diagnostizieren, wenn sie sich strikt an die Richtlinien hielten. Die naheliegende Frage wäre dann, was sie eigentlich diagnostizieren bzw. bisher diagnostiziert haben, wenn sie eine ADHS-Diagnose stellen bzw. gestellt haben. Die pädagogische Referenz der ADHS-Symptome Die einleitend angedeutete Grenzproblematik spielt bei der ADHS deshalb eine besonders große Rolle, weil es keine andere psychische Störung im Kindes- und Jugendalter gibt, deren Symptome sich so eng auf das Verhalten in pädagogischen, vor allem in pädagogischinstitutionellen Kontexten beziehen (vgl. Becker, im Erscheinen). Die überwiegende Zahl der Verhaltensbeschreibungen, die den drei Leitsymptomen Unaufmerksamkeit, Überbzw. Hyperaktivität und Impulsivität in den relevanten Klassifikationssystemen ICD-10 38 und DSM-IV zugeordnet wird, bezieht sich auf Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit Schule verbunden sind. Beispielsweise finden sich für das Symptom „Unaufmerksamkeit“ in den diagnostischen Manualen Beschreibungen wie „führt häufig Anweisungen anderer nicht vollständig durch und kann Schularbeiten, andere Arbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht zu Ende bringen“ und „vermeidet häufig, hat eine Abneigung gegen oder beschäftigt sich häufig nur widerwillig mit Aufgaben, die länger andauernde geistige Anstrengungen erfordern wie Mitarbeit im Unterricht oder Hausaufgaben“ (DSM-IV, zit. n. Bundesärztekammer 2005, S. 9). Ähnlich verhält es sich mit den Symptomen „Hyperaktivität“ und „Impulsivität“. Hier heißt es unter anderem: „zappelt häufig mit Händen oder Füßen oder rutscht auf dem Stuhl herum“, „steht in der Klasse und anderen Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird, häufig auf“ (Hyperaktivität) und „platzt häufig mit den Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist“ (Impulsivität) (ebd., S. 10). Die diagnostischen Kriterien sehen zwar vor, dass die Verhaltensweisen „in mehr als einer Situation erfüllt“ (ebd.) sein müssen, doch das ändert nichts an der pädagogischen Referenz der beschriebenen Symptome: Letztlich geht es – auch bei den hier nicht zitierten Beschreibungen – durchgängig darum, dass ein Kind etwas nicht tut oder kann, was es eigentlich tun oder können sollte, oder aber, dass es etwas tut, was es eigentlich nicht tun sollte. Versteht man unter Erziehung „jene sozialen (d. h. auf Mitmenschen gerichteten) Handlungen, durch die Menschen versuchen, das Gefüge der psychischen Dispositionen anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll beurteilten Komponenten zu erhalten“ (Brezinka 1976, S. 11) und fasst man unter den Begriff der psychischen Disposition „Erlebnis- und Verhaltensbereitschaften aller Art (…), also Fähigkeiten, Fertigkeiten, Haltungen, Einstellungen, Gesinnungen, Überzeugungen, Tugenden, Wissen, Können usw.“ (ebd.), so könnte man die beschriebenen Symptome bzw. Verhaltensweisen dahingehend interpretieren, dass die Erziehung bei den betroffenen Kindern Nicole Becker bisher ihr Ziel verfehlt hat.4 Die positiven Entsprechungen der Symptome ließen sich nämlich ohne weiteres als Erziehungsziele formulieren, weil es sich bei den meisten Verhaltensweisen um solche handelt, die Kinder erlernen bzw. sich zu Eigen machen sollen. Auch der Verweis auf die Nutzlosigkeit verbaler Aufforderungen unterstreicht die pädagogische Dimension der typischen ADHSSymptome: Das Kind führt nämlich Anweisungen „nicht aufgrund oppositionellen Verhaltens oder von Verständnisschwierigkeiten“ – also weil es nicht will oder nicht begreift – nicht aus, sondern weil es in einem Maße „unaufmerksam“ ist, das mit seinem „Entwicklungsstand“ unvereinbar ist (vgl. Bundesärztekammer 2005, S. 9). Es reagiert nicht auf den „Appell“, der in der Erziehungstheorie Klaus Pranges als „direktives Zeigen“ eine von drei grundlegenden Erziehungsoperationen darstellt (Prange 2005, S. 121). Erziehung kann die Form des Appells bzw. der Aufforderung oder des Vormachens, Erklärens, Anleitens haben, doch unabhängig davon, in welcher Form sie sich vollzieht, ist sie ein Mittel zum Zweck des Lernens – und zwar nicht zum Lernen von irgendetwas, sondern von etwas (durch den Erzieher) Bestimmtem. Gleichzeitig ist das Lernen „die Unbekannte in der pädagogischen Gleichung“ (ebd., S. 82), so dass der Erzieher zwar wollen kann, dass das Kind etwas (Bestimmtes) lernt, es jedoch – egal welche Mittel er auch immer einsetzt – keine Erfolgsgarantie gibt. Mit Blick auf erziehungstheoretische Überlegungen könnte man die Symptombeschreibungen einer ADHS deshalb so formulieren: Das Kind hat nicht gelernt (a) „zuzuhören, wenn andere es ansprechen“, (b) seine „Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren“, (c) dass es auf Gegenstände, die es „für Aufgaben oder Aktivitäten benötigt (z. B. Spielsachen, Hausaufgabenhefte, Stifte, Bücher oder Werkzeug)“, achten muss, (d) dass es Situationen gibt, in denen Herumlaufen oder Klettern „unpassend ist“, (e) dass es warten muss, bis es „an der Reihe ist“, und (f ) dass man andere, während sie sich unterhalten oder miteinander spielen, nicht „unterbricht und stört“ (vgl. DSM-IV, zit. n. Bundesärztekammer 2005, S. 10). Grenzgänge zwischen Pädagogik und Psychiatrie Die pädagogische Dimension der ADHS zeigt sich also nicht nur darin, dass sich deren Symptome in pädagogischen Kontexten am deutlichsten manifestieren, sondern auch darin, dass sie sich als pädagogische Probleme beschreiben lassen. Und zwar dann, wenn man – wie in der Erziehungswissenschaft üblich – unter pädagogischen Problemen „erlebte Schwierigkeiten im Umgang mit Kindern/ Lernen/Unterricht/Schule/der Ordnung des Generationenverhältnisses“ versteht (Tenorth 1994, S. 41), für deren Lösung sich die jeweiligen Bezugspersonen verantwortlich fühlen (vgl. auch Rühling 2008). Pädagogische Probleme müssen, ebenso wie psychopathologische Symptome, zunächst einmal als solche definiert werden, und dabei sollte man sich darüber im Klaren sein, dass eine pädagogische Problemdefinition nur eine Möglichkeit darstellt und man ein und dasselbe Problem häufig ebenso plausibel als psychologisches, soziales, politisches, juristisches, medizinisches oder anderweitiges Problem beschreiben kann. Problemdefinitionen entwickeln sich in einer konkurrierenden Theorieumwelt, und das würde bei der Debatte über ADHS darauf hinauslaufen, dass die beobachteten schwierigen Verhaltensweisen (mindestens) sowohl als psychopathologische Symptome als auch als pädagogische Probleme gedeutet werden können. Damit wäre die Frage nach Deutungsansprüchen und Zuständigkeiten unentschieden. Die eingangs skizzierte Position von DuBois und Resch ließe sich damit durchaus in Einklang bringen: Für die ADHS gälte dann, was auch für andere psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen gilt – dass nämlich Pädagogik und Psychiatrie gleichermaßen in der Verantwortung stehen. Aus Sicht einer biologisch orientierten Kinder- und Jugendpsychiatrie wäre eine solche Lösung aber wenig wünschenswert, denn sie würde nicht nur darauf hinauslaufen, Deutungsansprüche mit anderen Disziplinen zu teilen, sondern auch, sich bei der Behandlung der Störung mit anderen, nicht-medizinischen Professionen koordinieren zu müssen (und nicht bloß Aufgaben zu delegieren, etwa an Verhaltenstherapeuten). Alternative Problembeschreibungen werden deshalb vehement mit 39 dem Verweis auf die hirnorganischen Ursachen der ADHS, sprich: auf die Ätiologie der Störung, abgewiesen. Das biologische Ursachenmodell als zentrales Argument Definitorischen Fragen stellen sich bei der ADHS nicht nur in Bezug auf das beobachtete Verhalten, sondern auch mit Blick auf deren Ursachen. DuBois und Resch sprechen in der eingangs zitierten Definition davon, dass psychopathologische Symptome bzw. Anpassungsstörungen durch „unterschiedliche pathogenetische Bedingungen“ zustande kommen können. Doch in der biologisch-medizinisch ausgerichteten Forschung wird die Ursache der ADHS eindeutig in einer genetisch bedingten hirnfunktionellen Störung gesehen: „Heute geht man von einem multifaktoriellen Entstehungsmodell auf der Basis einer genetischen Prädisposition zu einer neurobiologischen Dysregulation und einer darauf aufbauend neuropsychologischen Inhibitionsstörung aus. Als Grundlage zur Entstehung der ADHS gilt eine genetische Disposition als gesichert“ (Schmidt/Petermann 2008, S. 266). Weil das biologische Ursachenmodell weitreichende Konsequenzen für die Bewertung der Symptome und die Behandlung der ADHS hat, wird dessen Gültigkeit auch öffentlichkeitswirksam proklamiert. So heißt es beispielsweise in einer aktuellen Erklärung führender ADHSForscher:5 „International besteht kein Zweifel, dass genetische Ursachen den größten Einflussfaktor in der Entstehung der ADHS bilden“ (Zentrales ADHS-Netz 2012, S. 3). Weiter heißt es zwar: „Wie bei allen psychischen Störungen und bei vielen körperlichen Erkrankungen sind auch bei ADHS die Ursachenzusammenhänge noch nicht abschließend geklärt. Sowohl die molekulargenetischen Faktoren als auch die komplexen Interaktionen von genetischen und verschiedenen Umweltfaktoren bedürfen noch weiterer Erforschung“ (ebd.). Doch daran, dass die Ursachen der ADHS biologischer Natur sind, bestehe kein Zweifel. Umweltfaktoren wird üblicherweise ein „modulierender“, jedoch kein ursächlicher Einfluss zugeschrieben: „Ein 40 Einfluss psychosozialer Bedingungen auf die Ausprägung der ADHS ist wahrscheinlich, doch liegen hierzu bislang nur wenige gesicherte Erkenntnisse vor. Für die mögliche ätiologische Relevanz einer zunehmenden Reizüberflutung (…) sowie einer Erziehung mit mangelnder Zuwendung und fehlender Grenzziehung gibt es keine gesicherten empirischen Belege“ (ebd.). Demnach können sich die sozialen Umstände, in denen ein Kind oder Jugendlicher aufwächst, möglicherweise günstig oder ungünstig auf die Ausprägung der Symptome auswirken, eine ursächliche Bedeutung kommt ihnen aber nicht zu. Mit Blick auf das Verhältnis von Pädagogik und Psychiatrie ist diese Auffassung in mehrfacher Hinsicht folgenreich, weil das biologische Ursachenmodell nicht nur Erklärungscharakter hat, sondern weil ihm auch eine Legitimationsfunktion zugeschrieben wird. Blieb im letzten Abschnitt noch offen, weshalb sich ein Kind so verhält, wie es sich verhält, so gibt es nun eine klare Antwort: Das Kind hat die entsprechenden Verhaltensweisen deshalb nicht gelernt, weil sein Gehirn nicht in der Lage war, sie zu erlernen; die ,neurobiologische Dysregulation‘ führt zu einer „neuropsychologischen Inhibitionsstörung“, die sich auf der Verhaltensebene in der typischen ADHS-Symptomatik manifestiert (Schmidt/Petermann 2008, S. 266). Weil man es nun gewissermaßen mit einem organpathologischen Befund zu tun hat, liegt entsprechend eine medikamentöse Intervention nahe, so dass das biologische Ursachenmodell und die Legitimation der pharmakologischen Behandlung im Falle der ADHS Hand in Hand gehen: „Die meisten Befunde sprechen dafür, dass die ADHS-Symptomatik durch einen polygenetisch bedingten Dopaminmangel im synaptischen Spalt hervorgerufen wird, der durch die Gabe von stimulierenden Medikamenten wie Methylphenidat ausgeglichen werden kann“ (Petermann/Toussaint 2009, S. 83). Der unterstellte Zusammenhang hat allerdings den Status einer Hypothese, denn empirisch nachgewiesen ist weder ob tatsächlich ein Dopaminmangel als Auslöser für das Verhalten gelten kann noch ob dieser genetisch bedingt ist. So schreiben etwa Roessner und Rothenberger (2010, S. 76) in einem Forschungsüberblick, Nicole Becker „eine direkte und umfassende Untersuchung der neurochemischen Prozesse im menschlichen Gehirn ist bis heute nicht möglich. So lassen sich oft nur indirekte Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der Studien zu Genetik, medikamentöser Behandlung und Neuroanatomie ziehen“. Daher konzentriere sich die Forschung auf tierexperimentelle Studien sowie Untersuchungen „von Blut, Liquor und Urin des Menschen, die allerdings auch nur indirekte Rückschlüsse auf die Neurochemie der ADHS im menschlichen Gehirn erlauben“ (ebd.). Auch die Wirkweise der Psychostimulanz Methylphenidat – bekannt unter den Handelsnamen Ritalin oder Medikinet – ist noch nicht geklärt (vgl. Banaschewski/Rothenberger 2010, S. 294), wird aber hier ähnlich dargestellt wie die anderer Medikamente, indem erklärt wird, dass die Substanz einen nachweisbaren Mangel kompensiert (analog zur Funktion von Insulin bei Diabetes). Trotz vieler ungeklärter Fragen suggeriert der Mainstream der ADHS-Debatte eine Eindeutigkeit, die für die Behandlung des Störungsbildes leitend ist. Wird die ADHS als hirnfunktionelle Störung verstanden, so liegt der Nutzen der pharmakologischen Behandlung gewissermaßen auf der Hand und Eltern werden entsprechend beraten: „Eine relativ frühzeitige Pharmakotherapie wird (…) bei Kindern ab dem Alter von sechs Jahren dann empfohlen, wenn die Symptomatik zu erheblicher Einschränkung von Alltagsfunktionen führt. In solchen Fällen wird eine Pharmakotherapie nach der immer grundlegend notwendigen Psychoedukation und Aufklärung und Beratung der Eltern empfohlen“ (Zentrales ADHS-Netz 2012, S. 4). Psychoanalytisch-psychosozial ausgerichtete ADHS-Forscher kritisieren nicht nur dieses Ursachenmodell, sondern auch den hier skizzierten therapeutischen Ansatz. Die Aussagekraft formal- und verhaltensgenetischer sowie neurowissenschaftlicher Studien relativieren sie mit Blick auf deren Inkonsistenz, und insgesamt werfen sie ihren biologisch argumentierenden Kollegen ein unzureichendes Verständnis von Hirnentwicklung vor. Die „Beziehung zwischen Erbe und Umwelt, Natur und Kultur“, so schreibt beispielsweise der Psychoanalytiker und Erziehungswissenschaftler Bernd Ahr- Grenzgänge zwischen Pädagogik und Psychiatrie beck, stelle sich heute „ganz anders dar (…), als es das multimodale Modell behauptet. Zur Entwicklung von Hirnstrukturen tragen soziale Einflüsse und Beziehungserfahrungen wesentlich bei. (…) Auch die Aktivierung von Genen hängt von Umwelteinflüssen ab, zwischenmenschliche Erfahrungen können sich bis in die Genregulation hinein auswirken“ (Ahrbeck 2009, S. 375). Ausgehend von eigenen Fallstudien entwickeln Psychoanalytiker deshalb alternative Erklärungsmodelle, die den Blick vor allem auf emotionale und soziale Störungen während früher Entwicklungsphasen richten (vgl. im Überblick Günter 2009). Während die Darstellungen der psychosozialen Zusammenhänge in solchen Beiträgen gut nachvollziehbar sind, zeigt sich bei dem Rekurs auf Befunde zur erfahrungsabhängigen Hirnentwicklung ein ähnliches Problem wie bei den Vertretern des biologischen Modells: Dass sich die kognitive und emotionale Entwicklung in Interaktion mit der Umwelt vollzieht, ist zwar unbestritten, doch bei der Suche nach neuronalen Korrelaten stoßen die Vertreter des „Plastizitätsgedankens“ an die gleichen Grenzen wie die Verfechter der „Gendefektthese“, denn schließlich können auch sie dem Gehirn nicht bei der Entwicklung zusehen und rekurrieren deshalb bei ihrer Argumentation auf hypothetische Modelle.6 Die Sicht der Eltern Die beschriebenen Kontroversen werden zwar im Feld der Wissenschaften am intensivsten geführt, haben aber längst Eingang in die populäre Berichterstattung gefunden. Da Eltern im Prozess der Diagnostik mit Experten interagieren und im Falle der Diagnosestellung eine Entscheidung über die Intervention verantworten müssen, habe ich in einer explorativen Studie untersucht, wie betroffene Eltern mit den hier angesprochenen Problemen umgehen bzw. inwiefern sie überhaupt davon erfahren. Zu den Sichtweisen von Eltern liegen bislang insgesamt nur wenige Studien aus dem englischsprachigen Raum vor, die entweder durch eine soziologische oder eine klinische Perspektive geprägt sind. Zudem wurden 41 bisher ausschließlich Eltern befragt, bei deren Kindern bereits eine ADHS-Diagnose gestellt wurde (vgl. z. B. Rafalovich 2004; Singh 2003; Singh 2004; Brinkman et al. 2009). Im Rahmen einer qualitativen Studie habe ich Interviews mit 21 Eltern geführt, darunter 18 Mütter und drei Väter, die ihr Kind zur diagnostischen Abklärung einer ADHS in der Ambulanz einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie angemeldet hatten. Ziel der Studie ist es, zu rekonstruieren, wie sich die Problemwahrnehmung von Eltern im Zusammenspiel mit Akteuren pädagogischer Institutionen und medizinischer Einrichtungen darstellt. Dabei wurden auch die bisherigen Bewältigungsstrategien der Eltern, deren Informationsstrategien sowie ihre Einstellungen zu verschiedenen Interventionsformen untersucht. Als Methode wurde das problemzentrierte Interview (Witzel 2000) eingesetzt. Dieses möchte zu spontanen Erzählungen anregen, behält dabei aber ein bestimmtes Problem im Blick. Im Hintergrund gibt es zwar einen Leitfaden mit bestimmten Themen, die im Laufe des Gesprächs angesprochen werden, aber es handelt sich nicht um ein klassisches strukturiertes Interview, bei dem Fragen in festgelegter Reihenfolge angesprochen werden. Ein problemzentriertes Interview beginnt mit einem festgelegten Einstieg, der ins Zentrum des Problems stoßen soll und für den Interviewpartner Aufforderungscharakter hat, und greift dann auf verschiedene Strategien zurück, um den Erzählfluss in Gang zu halten. Der Einstieg „Erzählen Sie bitte mal, wie das war, als Sie das erste Mal darüber nachgedacht haben, ob [Name Sohn/Tochter] ADHS haben könnte. Wie kamen Sie darauf?“ sollte die Interviewpartner dazu anregen, mit einem Ausgangspunkt (in der Vergangenheit) beginnend, eine Geschichte zu erzählen, die (möglicherweise) mit der Vorstellung in der Ambulanz endet. Die Interviews fanden statt, bevor der diagnostische Prozess in der Ambulanz begonnen hatte. Im Sample gibt es sowohl Eltern, die ihr Kind erstmals zur diagnostischen Abklärung vorgestellt haben (N=7), als auch solche, bei denen zum wiederholten Male eine Diagnostik durchgeführt wurde (N=14).7 Das Alter 42 der Kinder (16 Jungen und 5 Mädchen) liegt zwischen 8 und 16 Jahren, wobei die 12- und 13-Jährigen am häufigsten vertreten sind. Neben der Altersvariation wurde im Sample auch eine maximale Variation der besuchten Schultypen (Förderschule, Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium) erreicht. Nach dem Abschluss der Diagnostik und der Auswertung der Interviews wurde auf der Basis der Patientenakten rekonstruiert, ob der ADHSVerdacht im weiteren Verlauf der Diagnostik bestätigt oder zurückgewiesen wurde. Die Auswertung der Interviewtranskriptionen erfolgte in Anlehnung an Kelle und Kluge (2010) sowie Kuckartz (2010). Dabei werden ausgehend von den Themen in den Interviews sogenannte Merkmale herausgearbeitet und deren jeweilige Ausprägungen bestimmt.8 Auf diese Weise können die Fälle miteinander verglichen und anhand empirischer Regelmäßigkeiten gruppiert werden. In der Gesamtstudie wurde im nächsten Schritt eine Typologie elterlicher Handlungsstrategien entwickelt. Im Rahmen dieses Beitrags werde ich nicht auf die Typologie eingehen, sondern mich auf den Teil der Auswertung beschränken, der sich mit der Rekonstruktion des ADHS-Verdachts und den Erwartungen befasst, die Eltern mit der Diagnostik verbinden. Mit Blick auf die oben beschriebenen Expertenkontroversen werde ich darstellen, welche Beobachtungen Eltern zur diagnostischen Abklärung bewegen und welchen Status sie der ADHS und, davon ausgehend, der Diagnostik zusprechen.9 Da qualitative Studien mit vergleichsweise kleinen Samples arbeiten (müssen), können die Ergebnisse keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben. Qualitative Arbeiten verfolgen theoretische Interessen, sie wollen soziale Phänomene detailliert beschreiben und greifen deshalb (zum Beispiel) auf Erzählungen von Akteuren zurück. Dadurch können inhaltliche Zusammenhänge aufgezeigt werden, die für die systematische Beschreibung eines Phänomens aufschlussreich sind und zur Hypothesenbildung genutzt werden können. Nicole Becker ADHS-Verdacht und Erwartungen an die Diagnostik Auf die Frage nach dem Anlass des ADHSVerdachts antworten viele Eltern mit verhältnismäßig langen Eingangserzählungen, in denen sie bereits konkrete Schwierigkeiten ihres Kindes schildern. Dazu gehören viele der Verhaltensweisen, die sich auch in den einschlägigen Klassifikationssystemen finden, aber auch einige, die auf den ersten Blick nicht zu dem Störungsbild passen. Im Vordergrund stehen Schwierigkeiten bei der Bewältigung schulischer Anforderungen sowie Konflikte mit anderen Personen, vor allem Gleichaltrigen und Geschwistern sowie mit den Eltern selbst. Im vorliegenden Sample entstand der ADHS-Verdacht entweder in einem medizinischen Kontext (z. B. bei einer kinderärztlichen Untersuchung), in einem pädagogisch-institutionellen Kontext (z. B. im Kindergarten oder in der Schule) oder im familiären Kontext (d. h. die Mutter oder der Vater kam selbst auf die Idee). Der ADHS-Verdacht im familiären Kontext entstand allerdings in allen Fällen mit Rekurs auf (mindestens) einen weiteren Kontext: Selbst wenn Eltern Schwierigkeiten bei ihren Kindern beobachten und das Störungsbild ADHS vom Hören-Sagen kennen, bedarf es der Rückmeldung professioneller Akteure, damit ein Krankheitsverdacht entsteht. Für Eltern sind ihre Kinder zunächst primär „schwierig“, erst die Äußerungen von Akteuren aus dem pädagogisch-institutionellen oder medizinischen Kontext rücken diese Schwierigkeiten in die Nähe von Krankheit. Frau Gröschner antwortet auf den Erzählimpuls: „Also ich habe da gar nicht selber darüber nachgedacht, die Idee kam mir gar nicht, sondern wir waren in Kur, Mutter-Kind-Kur, und der Laurenz war schon immer furchtbar verhaltensauffällig, und in dieser Kur hat mich dann eine Ärztin darauf angesprochen, dass ich das doch bitte abklären lassen soll, dass er, also dass sie ihn nach ADHS einschätzt“ (I16P33). Obwohl Frau Gröschner ihren Sohn Laurenz als „schon immer furchtbar verhaltensauffällig“ beschreibt, kommt sie selbst nicht auf den ADHS-Verdacht. Sie hat zwar bereits von ADHS gehört, aber erst als die Grenzgänge zwischen Pädagogik und Psychiatrie Ärztin den Verdacht äußert (Laurenz ist zu diesem Zeitpunkt 6 Jahre alt), beginnt sie, sich intensiver zu informieren. Frau Gröschner nimmt den Verdacht der Ärztin ernst und lässt im Anschluss an die Kur bei Laurenz‘ Kinderarzt eine Diagnostik durchführen, bei der der Verdacht bestätigt und Ritalin verordnet wird. Laurenz‘ Verhalten wird jedoch trotz der medikamentösen Intervention immer problematischer und die Mutter fühlt sich nach eigenen Angaben überfordert. Sie stellt ihren Sohn zu einer nochmaligen diagnostischen Abklärung in der Ambulanz vor, weil sie auf andere Interventionsmöglichkeiten hofft. Frau Franke stellt ihren Sohn Fabian erstmals zu einer Diagnostik vor, sie antwortet auf den Erzählimpuls: „Also ADHS war jetzt früher für uns kein Begriff. Es war ab und zu mal, wo er schon als Kleinkind, wo eben manchmal der Satz von anderen kam: ‚Meinst du nicht der ist ein bisschen hyperaktiv?’ oder ... Ja ich hab das dann immer ausgeschlossen; weil wir jetzt, mein Mann und ich, eigentlich immer gut damit klar kamen, und bei Hyperaktivität denke ich immer, die sind ja so also 20 Stunden aktiv am Stück“ (I10P28). Auch Frau Franke deutet zunächst an, dass der ADHS-Verdacht nicht in der Familie entstand; sie und ihr Mann kamen mit Fabians Verhalten gut klar, unter Hyperaktivität hatte sie sich bislang etwas anderes vorgestellt. Sie schildert zwar im weiteren Verlauf einige Schwierigkeiten, die sich bereits vor Schulbeginn zeigten, doch erst mit dem Übertritt auf das Gymnasium werden diese so gravierend, dass schließlich eine Lehrerin den Verdacht auf ADHS äußert, dem die Eltern nun nachgehen. Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal zwischen den im Sample vertretenen Fällen besteht darin, ob im Vorfeld bereits eine ADHS-Diagnostik stattfand oder nicht. In einigen Fällen ist die Ambulanz die erste Station nach einem entstandenen Verdacht, in anderen Fällen fanden bereits eine oder sogar mehrere Diagnostiken statt, bei denen, wenn die Diagnose ADHS gestellt wurde, eine pharmakologische Intervention eingeleitet oder zumindest angeboten wurde. In den meisten Fällen wurden schwierige Verhaltensweisen jedoch eher früh, meistens schon im Säuglings- 43 oder Kleinkindalter, registriert, so dass der Zeitpunkt der diagnostischen Erstabklärung nicht zwingend etwas über den Beginn der Schwierigkeiten aussagt. Vielmehr scheinen Eltern unterschiedliche Belastungsgrenzen und Normalitätsvorstellungen zu haben, die, zusammen mit den Rückmeldungen anderer Akteure (vor allem aus dem pädagogischen Feld), ausschlaggebend dafür sind, zu welchem Zeitpunkt sie professionelle Hilfe suchen. Das wiederum entscheidet darüber, wie früh der Krankheitsverdacht auftritt. Im vorliegenden Sample zeigt sich hier ein deutliches Muster: Je früher sich Eltern mit Schwierigkeiten an Ärzte oder Beratungsstellen wenden, desto früher wird der Krankheitsverdacht ins Spiel gebracht und desto eher setzen diverse Hilfemaßnahmen ein, die aber alle nicht die erwünschten Wirkungen haben. Frau Conrad nimmt beispielsweise sehr früh eine Erziehungsberatung in Anspruch, da sie ihren neun Monate alten Sohn Jonas als extrem anstrengend empfindet und sich überfordert fühlt. In diesem Zusammenhang wird das Thema ADHS zum ersten Mal von Seiten der Beraterin aufgebracht. Frau Conrad erzählt von der Beratung und sagt: „von mir selber kam eigentlich nicht der der Name ADS, sondern ich habe halt einfach nur erklärt und geschildert, was Sache ist“ (I05P40). Die Beraterin weist Frau Conrad jedoch darauf hin, dass man die Diagnose in dem Alter noch nicht stellen könne. Anderthalb Jahre später wird das Thema dann wieder aufgegriffen, diesmal durch eine Sozialpädagogin, die die Familie im Rahmen einer Hilfemaßnahme begleitet. Frau Conrad wendet sich daraufhin an ihren Kinderarzt und anschließend werden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Die Diagnose wird bestätigt und Jonas wird bereits ab dem Alter von vier Jahren mit verschiedenen Stimulanzien behandelt, weil seine Verhaltensauffälligkeiten so gravierend sind, dass die Erzieherinnen im Kindergarten nicht mit ihm zurecht kommen und Frau Conrad immer wieder dazu auffordern, ihren Sohn abzuholen. In der Grundschule setzt sich dieses Muster fort. Zum Zeitpunkt des Interviews ist Jonas neun Jahre alt; in den vergangenen Jahren hat er diverse Therapien durchgeführt 44 und wurde dauerhaft medikamentös behandelt. Seine Familie hat währenddessen mehrfach und über längere Zeiträume sozialpädagogische Hilfen in Anspruch genommen.10 Dennoch meldet ihn seine Mutter wiederum mit der Verdachtsdiagnose ADHS zur diagnostischen Abklärung an. Abhängig von der Vorgeschichte hat der ADHS-Verdacht – und mit ihm die aktuelle Entscheidung zu einer diagnostischen Abklärung – unterschiedliche Relevanzen: Bei denjenigen Fällen, bei denen es im Vorfeld noch keine Diagnostiken gab, ist die Vorstellung in der Ambulanz ein erster Schritt in einem Prozess, dessen Abläufe und Folgen die Eltern noch nicht einschätzen können. Mit der Diagnostik verbinden sie deshalb die Vorstellung einer Gewissheit, die sich nicht nur auf den Krankheitsstatus bezieht, sondern auch auf die anschließenden Therapiemöglichkeiten. Sie gehen davon aus, dass im Falle einer Bestätigung des ADHS-Verdachts auch die passenden Interventionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die die aktuellen Probleme lösen können. Letztlich geht es dabei um die Frage, ob das Kind tatsächlich nicht anders kann, weil es krank ist, oder ob es anders könnte, dies aber nicht will. Frau Franke bringt diesen Konflikt auf den Punkt: „Das ist so das wo ich einfach halt wissen möchte, woran bin ich, wie ich vorher sagen wollte, mit der Reaktion jetzt auf schlechte Schulnoten, damit ich nochmal Rat bekomme, wo ich jetzt gerade wirklich dastehe und denke: ‚Ja vielleicht kann er ja gar nichts dafür.’ Und dann schimpfe ich mit ihm und das will ich nicht. Oder ähm ja ... Oder mach ich’s wie die normale Mutter, die dann auf den Tisch haut und sagt: ‚Jetzt bleibst du erst mal eine Woche daheim und lernst!’ Ja, das ist gerade bei mir so ein bisschen schwierig“ (I10P132). Wenn Fabian eine ADHS hat, dann kann er aus Sicht der Mutter nichts für seine schlechten Noten, und sie will dann nicht mehr mit ihm schimpfen oder ihn zum Lernen zwingen. Die Frage, ob er krank ist oder bloß „faul“, erzeugt einen Gewissenskonflikt, den die Diagnose entscheiden soll. Frau Franke sagt: „wenn er’s nicht hat, bin ich glücklich, auf der anderen Seite weiß ich dann natürlich, dass er einfach stockfaul Nicole Becker ist“ (I10P132). Wenn Fabian keine ADHS hat, ist seine Mutter glücklich – denn dann ist er nicht krank, seine Schwierigkeiten sind dann eine Frage des Wollens und nicht des Könnens. Frau Franke wünscht sich, dass man ihrem Sohn pädagogisch oder therapeutisch helfen kann; Medikamente kämen für sie und ihren Mann erst dann in Frage, wenn alle anderen therapeutischen Maßnahmen versagen: „wir wollen ihn nicht dämpfen. Ja, also... Wir wollen ihn eigentlich so behalten wie er ist“ (I10P80). Genau wie Frau Franke glauben auch die meisten anderen interviewten Eltern, die eine diagnostische Erstabklärung durchführen lassen, dass man eine ADHS eindeutig diagnostizieren kann. Die Eltern gehen davon aus, dass es zur Diagnosestellung zuverlässige Testverfahren gibt und dass der Diagnose gegebenenfalls zuverlässige Interventionen folgen. Der eindeutige Nachweis der ADHS ist wiederum die Voraussetzung für die Akzeptanz einer pharmakologischen Behandlung, und die meisten Eltern wären nicht bereit, ihrem Kind ein Medikament zu verabreichen, wenn es einen Restzweifel an der Diagnose gäbe (vgl. Becker 2012). Die Eltern, die ihr Kind zur Erstabklärung vorstellen, folgen somit noch der üblichen medizinischen Dramaturgie und glauben an sie: Bei einem Krankheitsverdacht sucht man einen Arzt auf, der bestimmte Untersuchungen durchführt und der den Verdacht dann entweder bestätigt und eine Behandlung einleitet oder ihn zurückweist. Die Eltern sind sich selbst nicht sicher, ob ihr Kind eine ADHS hat, aber sie gehen davon aus, dass es Experten gibt, die das herausfinden können und die am Ende sagen werden: „Ihr Kind ist krank und deshalb verhält es sich so schwierig“ oder „Ihr Kind verhält sich schwierig, aber krank ist es nicht“. Mit dieser Ungewissheit können die Eltern leben, denn sie hoffen auf Gewissheit am Ende des diagnostischen Prozesses. Problematischer ist die Situation für diejenigen, bei denen es im Vorfeld bereits eine Diagnostik gab, die aber entweder zu keinem eindeutigem Ergebnis kam oder in deren Verlauf zwar die Diagnose ADHS gestellt und entsprechende Interventionen eingeleitet wurden, durch die sich aber die Situation nicht Grenzgänge zwischen Pädagogik und Psychiatrie wesentlich verbessert hat. Hier wurden die Gewissheitserwartungen enttäuscht, weil die Diagnose ADHS und die pharmakologische Intervention, die in einigen Fällen mit anderen Maßnahmen (z. B. Ergotherapie) einherging, keine dauerhafte, meistens nicht einmal eine mittelfristige Entlastung brachte. Deshalb soll nun eine weitere Diagnostik Gewissheit bringen. Frau Meyer möchte, dass eine weitere Diagnostik bei ihrem Sohn Niklas durchgeführt wird, obwohl zwei Ärzte im Vorfeld die Diagnose bestätigt haben. Niklas wurde bereits mit drei unterschiedlichen Stimulanzien behandelt, die keine längerfristige Besserung bewirkt haben. Die Mutter erzählt, dass sie sich selbst oft frage, weshalb ihr Sohn so schwierig sei: „Ja, ich weiß es nicht, von wo das kommt. Das kannte ich früher nicht und manchmal denke ich: ‚Ja, ist es wirklich ADS?’“ (I18P73). Mit der ersten Diagnose und der daran anschließenden Pharmakotherapie hatte sie die Erwartung verbunden, dass sie selbst wieder besser mit ihrem Sohn umgehen kann, sich die Streitigkeiten zwischen Niklas und seinem Bruder legen und sich auch seine schulischen Leistungen bessern; doch nichts von alledem trat ein. Dennoch hofft sie darauf, dass sich mit dieser Diagnostik und den darauf folgenden Interventionen alles zum Besseren wenden wird. Der Glaube an die Zuverlässigkeit medizinischer Diagnosen und Interventionen ist in vielen Fällen, trotz gegenteiliger Erfahrungen, ungebrochen. Nur eine Mutter spricht die Irrelevanz der Diagnose für das weitere Vorgehen an: „Ob das ADHS ist oder nicht, letzten Endes, finde ich, ist völlig egal (lacht). Ich finde das Verhalten einfach ziemlich heftig und anstrengend“ (I21P23). Sie wünscht sich unabhängig von einer ADHS-Diagnose kompetente Hilfe; der ADHS-Verdacht ist bloß ein Vorstellungsanlass. Psychiatrie als Helfer in der pädagogischen Not? Welche Schlussfolgerungen lässt dieser knappe Einblick in die Sichtweisen von Eltern zu? Wie stellt sich die ADHS aus Elternsicht dar und 45 was drückt sich in den Erwartungen aus, die Eltern an die Diagnostik haben? Schließlich: Welche Konsequenzen lassen sich aus der Gegenüberstellung der Expertenkontroversen und den Elternerwartungen ziehen? Zunächst einmal wird deutlich, dass das Verständnis der meisten Eltern einem kategorialen Krankheitsmodell nahekommt: Die meisten der Befragten glauben, dass man eine ADHS eindeutig diagnostizieren kann und dass nach erfolgter Diagnosestellung dann auch eine wirksame Behandlung eingeleitet wird. Auch die Eltern, die ihr Kind zum wiederholten Male zur diagnostischen Abklärung vorstellen, zweifeln nicht an der Zuverlässigkeit der Diagnose, sondern gehen davon aus, dass die bisherige Behandlung nicht ausreichend ist – möglicherweise sei das Medikament nicht das richtige oder man bräuchte zusätzlich eine Psychotherapie. Viele Eltern hätten sich letztere übrigens gewünscht, berichten aber, dass sie der Hinweis auf die langen Wartezeiten zunächst abgeschreckt habe und sie es deshalb erst einmal mit einem Medikament probiert hätten. Die pädagogische Dimension der Probleme wird in mehrfacher Hinsicht deutlich: Zum einen entsprechen viele der berichteten Verhaltensprobleme den typischen ADHSBeschreibungen in den diagnostischen Klassifikationen – wobei man hinzufügen muss, dass die Eltern in ihrem Schilderungen häufig auf Lehrerberichte zurückgreifen. Über das Verhalten ihrer Kinder im Klassenzimmer oder Kindergarten werden sie von den Lehrern oder Erziehern informiert und oft zeigt sich eine Diskrepanz zwischen dem, was Pädagogen problematisch finden, und dem, was Eltern stört. In einigen Fällen reagieren Eltern deshalb trotz früher Beschwerden erst relativ spät, was vor allem mit ihrem eigenen Belastungserleben zusammenhängt. Diejenigen Eltern, die sich als sozial und psychisch stark belastet beschreiben (z. B. durch sozial und ökonomisch prekäre Lebensverhältnisse), reagieren auf Beschwerden früher und ziehen auch eher professionelle Helfer (wie Ärzte, Erziehungsberater, Sozialpädagogen) hinzu als diejenigen, die von sich sagen, dass sie selbst mit dem Verhalten ihres Kindes unterm Strich gut zurechtkommen. Nichtsdestotrotz treffen die Elternschil- 46 derungen in vielen Punkten die typischen ADHS-Symptome. Gleichzeitig zeigen sie, dass für die Eltern das Problem darin besteht, dass sie weder durch Gut-Zureden, wiederholte Aufforderungen, Erklärungen und diverse Unterstützungsstrategien noch durch Strafen eine dauerhafte Verhaltensänderung bewirken können. Die meisten der interviewten Eltern haben, bevor sie sich für die diagnostische Abklärung einer ADHS entscheiden, diverse Maßnahmen ergriffen, um ihrem Kind zu helfen, aber die Erfahrung des Scheiterns führt letztlich – vor dem Hintergrund der häufig drängenden Forderungen von Pädagogen – zum Entschluss einer diagnostischen Abklärung.11 Die Elternberichte zeigen darüber hinaus, dass professionelle Pädagogen abhängig von der Art der problematischen Verhaltensweisen und vom Alter der Kinder tendenziell unterschiedlich reagieren: Bei jüngeren Kindern wird motorische Unruhe und auch eine geringe Konzentrationsfähigkeit offenbar eher toleriert; erst mit dem Übertritt auf die weiterführenden Schulen entsteht daraus ein Problem, um das sich nun die Eltern kümmern sollen (z. B. bei Frau Franke und ihrem Sohn Fabian). Kommen hingegen zu den genannten Schwierigkeiten auch Störungen des Sozialverhaltens hinzu, werden von institutioneller Seite schon früh Exklusionsstrategien angewandt und die Eltern zum Handeln aufgefordert (so z. B. bei Frau Conrad und ihrem Sohn Jonas). Mehrere Mütter berichten, dass sie immer wieder dazu aufgefordert wurden bzw. werden, ihre Kinder aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule abzuholen, weil das Verhalten des Kindes den organisatorischen Rahmen sprengt und die alltägliche pädagogische Praxis behindert. Die Eltern suchen dann, in vielen Fällen aufgrund der konkreten Empfehlungen der Pädagogen, einen Arzt auf. Somit vollzieht sich in dem Moment, in dem Eltern den ADHS-Verdacht ernst nehmen, ein Wechsel der institutionellen Referenz: Pädagogen geben Eltern die Rückmeldung, dass ihr Kind verhaltensschwierig bzw. untragbar für die Institution ist. Daraufhin wenden sich die Eltern an einen Arzt, der darüber entscheiden soll, ob es sich um eine psychische Erkrankung handelt oder nicht. Anders als in den eingangs skizzier- Nicole Becker ten Überlegungen von Du Bois und Resch läuft das nicht auf ein kooperatives Verhältnis von Pädagogik und Psychiatrie hinaus, sondern auf ein Delegations- und Korrekturverhältnis: Das schwierige Kind wird dem Facharzt übergeben, damit er die richtige Diagnose stellt und die richtige Intervention veranlasst, so dass das Kind mit besseren (Lern-)Voraussetzungen in die Schule zurückkehren kann. Die Tatsache, dass in einigen Fällen auch das Thema Pharmakotherapie zuerst durch Akteure im pädagogischen Feld ins Spiel gebracht wird, stützt diese Deutung und zeigt darüber hinaus, dass die Grenzen zwischen „Medikation als Therapie“ und „pharmakologischem Enhancement“ (Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit durch die Einnahme psychoaktiver Substanzen) in der erzieherischen Wirklichkeit fließend sind. So berichtet beispielsweise eine Mutter über ein Gespräch mit einer Lehrerin: „die hatte […] Schüler, die auch Ritalin genommen haben, und die hatte dann auch gemeint: ‚Ja das ist eigentlich ganz toll (betont)’. Und die älteren Kinder, die würden sich auch das selber einstellen, die würden sagen: ‚Oh je, ich schreib bald eine Arbeit, jetzt nehm ich das eine Weile und lerne und schreib dann die Arbeit.’ Die würden sich das selber dann irgendwie, sich dann einrichten, wann sie’s nehmen, wie sie’s nehmen, und die meinte eigentlich, das wär gar nicht so schlecht und das würde auch nichts schaden, das hätte keine sonstigen Nebenwirkungen oder bleibende Schäden würd’s auch nicht verursachen. Und da dachte ich, […] es wär ja schon was für die Sarah [ihre Tochter, NB], vielleicht würde es ihr helfen.“ (I01P101). Nur zwei Eltern gaben an, im Vorfeld keine Informationen über die ADHS eingeholt zu haben und auch von den biologischen Ursachen der ADHS noch nichts gehört zu haben; alle anderen Eltern waren darüber, wenn meistens auch nur in groben Zügen, informiert. Das biologische Ursachenmodell und der pharmakologische Behandlungsansatz waren in ihrem Verständnis genauso miteinander verschränkt wie es der Mainstream der ADHS-Diskussion vorsieht: Ausgehend von einem biologischen Erklärungsmodell würden fast alle Eltern einer pharmakologischen Behandlung zustimmen – vorausgesetzt, die ADHS wäre eindeutig Grenzgänge zwischen Pädagogik und Psychiatrie diagnostiziert und andere Maßnahmen wären nicht erfolgversprechend. Den meisten fällt diese Entscheidung zwar nicht leicht, doch am Ende trauen sie dem Expertenvotum. Nach Abschluss der Interviewauswertung habe ich auf Basis der Patientenakten rekonstruiert, ob am Ende der ausführlichen Diagnostik tatsächlich eine ADHS bzw. HKS diagnostiziert wurde. Dabei zeigte sich, dass vier der 21 Eltern die Diagnostik vorzeitig abgebrochen hatten und von den restlichen 17 Kindern am Ende nur vier die Diagnose HKS erhielten. Bei einigen Kindern wurden „Störungen des Sozialverhaltens“, bei anderen „Emotionale Störungen“ oder andere Störungen diagnostiziert, in zwei Fällen wurde letztlich gar keine psychiatrische Diagnose gestellt. Interessanterweise wurde auch bei einigen Kindern, die im Vorfeld die Diagnose ADHS bekommen hatten, nun eine andere Diagnose gestellt, was die oben angesprochene Problematik der diagnostischen Zuverlässigkeit einmal mehr bestätigt. Insgesamt stützen diese Ergebnisse die Einwände der Kritiker. Zugleich zeigen sie, dass sich in der aktuellen Praxis der ADHS-Diagnostik offenbar ein problematisches Verhältnis von Pädagogik und Psychiatrie entwickelt. Aus Sicht der Eltern üben insbesondere Pädagogen großen Druck aus, so dass die ständigen Beschwerden aus der Schule, verbunden mit der Sorge um die schulische Zukunft des Kindes, letztlich vielfach ausschlaggebend für die diagnostische Abklärung sind. Das war auch bei Frau Imhof so: Die Beschwerden von Achims Grundschullehrerin, verbunden mit der Drohung, ihm eine Förderschulempfehlung auszusprechen, bewogen die Mutter zunächst zu einer diagnostischen Abklärung und schließlich zur Pharmakotherapie. Frau Imhof begründet ihre Entscheidung so: „es gibt einfach keine passende Schule, die auf ADHS-Kinder eingestellt ist. Wo man sagt: ,Hey da sitzen sieben Kinder in der Klasse, und die haben alle ADHS, und die Lehrer wissen damit umzugehen.‘ […] Also das heißt, die Kinder müssen in einer normalen Schule klar kommen, und da steht man dann halt echt zwischen den Stühlen. Also komm ich damit zurecht, wenn mein Kind Medikamente nimmt 47 jeden Tag, oder kann ich es verantworten, dass mein Kind in einer normalen Regelschule nicht zurechtkommt und immer nur Probleme hat?“ (I11P51) . Dieses Anpassungsargument führen auch andere Eltern an, wenn sie über ihre Entscheidung zur Pharmakotherapie erzählen. Dahinter steht eine nachvollziehbare Überlegung: Aus Sorge um die (schulische) Zukunft ihrer Kinder akzeptieren die Eltern eine Intervention, die sie zwar durchaus heikel finden, die jedoch in Anbetracht der ADHS-Diagnose geboten scheint. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn die Diagnose als Antwort auf die Frage nach den Ursachen des problematischen Verhaltens akzeptiert und der Krankheitsstatus der ADHS nicht hinterfragt wird. Unter den befragten Eltern gab es (nur) zwei, die sich im Vorfeld der diagnostischen Abklärung vergleichsweise intensiv mit dem Thema ADHS auseinandergesetzt hatten. Je mehr Informationen sie einholten, umso skeptischer sahen beide das Thema, so dass sie sich zwar zur Abklärung entschlossen, jedoch auf eine Zurückweisung des Verdachts hofften. Herr Nuhn hatte im Vorfeld diverse Internetforen durchstöbert und auch ein Gespräch mit dem Kinderarzt seiner Tochter geführt, über das er sagt: „wo ich natürlich verunsichert bin, ist über die Aussage des Herrn [Name Arzt], dass es wohl keine eindeutige Erkennung gibt. […] Es gibt wohl keine gefestigte Nachweismethode, habe ich verstanden. Das ist natürlich, ist ein bisschen beunruhigend, weil letztendlich bleibt man ja dann in der Verantwortung, auf auf der Basis von ungesicherten Daten eine Entscheidung zu treffen. Es wäre leichter, wenn man das zu 100 Prozent wüsste oder nicht wüsste“ (I08P142). Herr Nuhn hat verstanden, dass die Diagnose nicht auf der Grundlage objektiver Testverfahren gestellt wird und potentiell „irrtumsanfällig“ ist; dadurch würde die Entscheidung über eine pharmakologische Behandlung zum Problem. Das wirft die Frage auf, ob die Expansion der ADHS nicht zuletzt auch der einseitigen öffentlichen Berichterstattung geschuldet ist, die eine biologische Sichtweise ins Zentrum stellt, ohne die Schwierigkeiten bei der Klassifikation und Diagnose der Störung offenzulegen. Es wäre daher interessant zu untersuchen, ob eine 48 ausgewogenere Information all derjenigen, die in ihrem persönlichen oder beruflichen Umfeld mit dem Thema ADHS potenziell in Berührung kommen, nicht letztlich eine kritischere Haltung und einen bewussteren Umgang mit dem Thema erzeugen könnte. Anmerkungen 1 Entsprechende Bestimmungen finden sich beispielsweise in den Schulgesetzen der Bundesländer und im 8. Sozialgesetzbuch („Kinderund Jugendhilfe“) sowie im 5. Sozialgesetzbuch („Gesetzliche Krankenversicherung“). 2 Bestimmte psychische Störungen gehen mit hirnfunktionellen oder neuroanatomischen Veränderungen einher. Deshalb wird der Einsatz neurowissenschaftlicher Forschungsmethoden, insbesondere sogenannter „bildgebender Verfahren“, in der Diagnostik psychischer Störungen gegenwärtig diskutiert. Experten sind sich jedoch weitgehend einig darüber, dass sich solche Verfahren bislang nicht als diagnostische Instrumente eignen (vgl. Hyman 2007). 3 Gelegentlich wird auch die Abkürzung ADS verwendet, die für eine Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität stehen soll. Das spiegelt den „vorwiegend unaufmerksamen Subtyp“ wider, der zwar im DSM-IV existiert, in der ICD-10 jedoch nicht. Die Verfasser der ICD haben sich gegen die Aufnahme eines solchen Störungsbildes entscheiden: „Wie die Praxis gezeigt hat, wirft der überwiegend unaufmerksame Typus differentialdiagnostische Probleme auf, indem die entsprechende Symptomatik auch bei Störungsbildern vorkommt, die anderen diagnostischen Kategorien zuzuordnen sind.“ (Bundesärztekammer 2005, S. 9) 4 Die Orientierung des Erziehungsbegriffs an ausschließlich intentionalen Handlungen wird in der Erziehungswissenschaft seit langem kritisch diskutiert. In diesem Beitrag nutze ich diese Erziehungsdefinition in heuristischer Absicht. 5 Die Erklärung, die unter dem Titel „Stellungnahme des zentralen adhs-netzes zu häufigen Fehlinformationen der Presse zur AufmerksamkeitsdefizitHyperaktivitätsstörung“ auf der Homepage des Zentralen ADHS-Netzes veröffentlicht wurde, ist von vier renommierten deutschen ADHSForschern unterzeichnet. Darin heißt es gleich zu Beginn, dass sich in der Öffentlichkeit kursierende Fehlinformationen vermutlich „ungünstig auf eine leitlinienbasierte Versorgung von Betroffenen aus[wirkt]“ (S. 1). Deshalb wollen die Experten „zu häufigen Streitpunkten fundiert Stellung neh- Nicole Becker men und so zur Versachlichung der Diskussion“ beitragen (ebd.). 6 Zu den am häufigsten zitierten Autoren in der kritischen ADHS-Diskussion gehört der Neurobiologe Gerald Hüther (vgl. z. B. den Sammelband von Bonney 2008), der selbst eine kritische Position vertritt, die er unter anderem mit dem Argument der „erfahrungsabhängigen Hirnentwicklung“ stützt. Seine neurobiologischen Argumente leitet er vor allem aus tierexperimentellen Studien ab. Dabei ergeben sich die gleichen Probleme wie bei der Darstellung neurochemischer und genetischer Grundlagen der ADHS: Es handelt sich um Ableitungen und (Tier-Mensch-) Übertragungen und nicht selten auch um Umkehrschlüsse (von entwicklungshemmenden auf entwicklungsfördernde Faktoren). 7 Die erste Diagnostik fand nicht in der Ambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie statt, sondern in den meisten Fällen bei niedergelassenen Kinderärzten oder Fachärzten für Kinder-und Jugendpsychiatrie. Bei vier Kindern war im Vorfeld ein Verdacht auf eine ADHS geäußert worden, bei einem Kind war der Verdacht zurückgewiesen worden und bei den restlichen neun lag eine gesicherte Diagnose vor. 8 Zum Beispiel wurde ausgehend von den Antworten auf den Erzählimpuls das Merkmal „Kontext des ADHS-Verdachts“ mit den Ausprägungen „Medizinischer Kontext“, „Pädagogisch-institutioneller Kontext“ und „Familiärer Kontext“ herausgearbeitet. Das bedeutet, dass der Verdacht in allen 21 Fällen in einem dieser drei Kontexte entstand und die Fälle entsprechend gruppiert werden können. 9 Sämtliche Personennamen in den Interviews wurden pseudonymisiert. Die Interviews wurden nach einem vereinfachten System transkribiert, das folgende Kennzeichnungen nutzt: nonverbale Äußerungen werden in Klammern an der entsprechenden Stelle aufgenommen, z.B. (lacht); drei Punkte mitten im Satz … kennzeichnen einen abgebrochenen Satz; ein Komma in Klammern (-) kennzeichnet eine Sprechpause, die länger als 3 Sekunden ist; drei Punkte in eckigen Klammern […] kennzeichnen eine Auslassung der Autorin im Zitat. Die Angaben in Klammern hinter den Zitaten beziehen sich auf die Nummer des Interviews und die Position der Sprechpassage, z. B. (I03P134) = Interview 3, Passage 134. 10 Dabei handelt es sich um „Hilfen zur Erziehung“ (§27ff.) nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (8. Sozialgesetzbuch). 11 Die Maßnahmen der Eltern umfassen sowohl unmittelbare Handlungen (z. B. Üben, Strukturierung des Tages, konkrete Unterstützung während der Hausaufgaben) als auch Entscheidungen, die das schulische Umfeld betreffen (z. B. Schul- Grenzgänge zwischen Pädagogik und Psychiatrie formwechsel, Schulwechsel oder Wiederholung von Schulklassen). Darüber hinaus ziehen viele Eltern schon vor der Kontaktaufnahme zu einem Arzt externe Helfer, z.B. Heilpraktiker oder Hausaufgabenbetreuer, hinzu. Einige Eltern beschreiben, dass sie auch ihr eigenes Verhalten geändert hätten (z. B. inspiriert durch Ratgeber oder Elternprogramme). Literatur Ahrbeck, Bernd (2009): Das hyperaktive Kind, die multimodale Therapie und die evidenzbasierte Medizin. In: Kinderanalyse. Zeitschrift für die Anwendung der Psychoanalyse in Psychotherapie und Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters 17 (4), S. 366-387. Banaschewski, Tobias; Rothenberger, Aribert (2010): Pharmakotherapie mit Stimulanzien bei Kindern und Jugendlichen. In: Hans-Christoph Steinhausen (Hg.): Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. 1. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, S. 289-307. Barmer GEK: Arztreport 2013: Schwerpunkt ADHS. Hg. v. Barmer GEK. URL: http://presse.barmer-gek.de/barmer/web/Portale/Presseportal/ Subportal/Presseinformationen/Aktuelle-Pressemitteilungen/130129-Arztreport-2013/ PDF-Arztreport-2013,property=Data.pdf (Stand: 20.02.2013). Becker, Nicole (2012): Rücksichtlose Ritalin-Bejaher? Wie Eltern mit ADHS-Kindern umgehen. Unter Mitarbeit von Ralf Caspary (Red.), SWR2 Wissen: Aula, Sendung vom 15.07.2012. URL: http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/ wissen/-/id=9831482/property=download/ nid=660374/1cs46r6/swr2-wissen-20120715.pdf (Stand: 20.02.2013). Becker, Nicole (im Erscheinen): Abwesenheit und Störung als Ausdruck von Unaufmerksamkeit – Erzählungen von Eltern und Darstellungen in Klassifikationssystemen. In: Reh, Sabine/ Berdelmann, Kathrin/Dinkelaker, Jörg (Hg.): Aufmerksamkeit. Zur Geschichte, Theorie und Empirie eines pädagogischen Phänomens. Wiesbaden: Springer VS. Bonney, Helmut (Hg.) (2008): ADHS. Kritische Wissenschaft und therapeutische Kunst. 1. Aufl. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme-Verl. Brezinka, Wolfgang (1976): Erziehungsziele, Erziehungsmittel, Erziehungserfolg. Beiträge zu einem System der Erziehungswissenschaft. München, Basel: E. Reinhardt. Brinkman, William B.; Sherman, Susan N.; Zmitrovich, April R.; Visscher, Marty O. (2009): Parental 49 Angst Making and Revisiting Decisions About Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. In: Pediatrics 124 (2), S. 580-589. Bruchmüller, Katrin; Schneider, Silvia (2012): Fehldiagnose Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom? In: Psychotherapeut 57 (1), S. 77-89. Bundesärztekammer (2005): Stellungnahme zur Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Langfassung. Hg. v. Vorstand der Bundesärztekammer. Ohne Ort. URL: http://www. bundesaerztekammer.de/downloads/ADHSLang. pdf (Stand: 22.01.2013). Dammasch, Frank (2009): Der umklammerte Junge, die frühe Fremdheitserfahrung und der abwesende Vater. In: Kinderanalyse. Zeitschrift für die Anwendung der Psychoanalyse in Psychotherapie und Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters 17 (4), S. 313-334. Du Bois, Reinmar; Resch, Franz (2005): Klinische Psychotherapie des Jugendalters. Ein integratives Praxisbuch. 1. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer. Furman, Lydia (2005): What is attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)? In: Journal of Child Neurology 20 (12), S. 994-1002. Günter, Michael (2009): Die Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung (ADHS) - eine Denk- und Affektverarbeitungsstörung? In: Kinderanalyse. Zeitschrift für die Anwendung der Psychoanalyse in Psychotherapie und Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters 17 (4), S. 388-415. Hopf, Hans (2008): Bewegungsunruhe – ein archaisches Reaktionsmuster bei Jungen? In: Helmut Bonney (Hg.): ADHS. Kritische Wissenschaft und therapeutische Kunst. 1. Aufl. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme-Verl., S. 201-227. Hopf, Hans (2009): „Ich fühlte mich allein in der schweren Situation…“ Supervision der psychoanalytischen Behandlung eines neunjährigen Jungen mit der fachärztlichen Diagnose ADHS. In: Kinderanalyse. Zeitschrift für die Anwendung der Psychoanalyse in Psychotherapie und Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters 17 (4), S. 335-365. Hyman, Steven E. (2007): Can neuroscience be integrated into the DSM-V? In: Nature Reviews Neuroscience 8 (9), S. 725-732. Kelle, Udo; Kluge, Susann (2010): Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung. 2. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag. Kuckartz, Udo (2010): Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten. 3. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag. Petermann, Franz; Toussaint, Anne (2009): Neuropsychologische Diagnostik bei Kindern mit ADHS. In: Kindheit und Entwicklung 18 (2), S. 83–94. Prange, Klaus (2005): Die Zeigestruktur der Erziehung. Grundriss der operativen Pädagogik. Paderborn: Schöningh. 50 Rafalovich, Adam (2004): Framing ADHD Children: A Critical Examination of the History, Discourse, and Everyday Experience of Attention Deficit/ Hyperactivity Disorde. Lanham u.a. Roessner, Veit; Rothenberger, Aribert (2010): Neurochemie. In: Hans-Christoph Steinhausen (Hg.): Handbuch ADHS. A.a.O., S. 76-91. Rühling, Helga (2008): Alles ADS? Erfahrungen in der Erziehungsberatung. In: Helmut Bonney (Hg.): ADHS. Kritische Wissenschaft und therapeutische Kunst. 1. Aufl. Heidelberg: Carl-Auer-SystemeVerl., S. 163–200. Schmidt, Sören; Petermann, Franz (2008): Themenschwerpunkt: Entwicklungspsychopathologie der ADHS. In: Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie 56 (4), S. 265–274. Singh, Ilina (2002): Bad Boys, Good Mothers, and the “Miracle” of Ritalin. In: Science in Context 15 (4), S. 577–603, zuletzt geprüft am 22.01.2013. Singh, Ilina (2003): Boys will be boys: fathers’ perspectives on ADHD symptoms, diagnosis, and drug treatment. In: Harvard Review of Psychiatry 11 (6), S. 308–316. Singh, Ilina (2004): Doing their jobs: mothering with Ritalin in a culture of mother-blame. In: Social Sciene and Medicine 59 (6), S. 1193-1205. Steinhausen, Hans-Christoph (2010a): Epidemiologie. Nicole Becker In: Hans-Christoph Steinhausen (Hg.): Handbuch ADHS. A.a.O., S. 29-40. Steinhausen, Hans-Christoph (2010b): Definition und Klassifikation. In: Hans-Christoph Steinhausen (Hg.): Handbuch ADHS. A.a.O., S. 17-28. Tenorth, Heinz-Elmar (1994): Die Konstruktion pädagogischer Probleme - oder: Das Alltägliche an der Tätigkeit der Erziehungswissenschaft. In: Klaus-Peter Horn und Lothar Wigger (Hg.): Systematiken und Klassifikationen in der Erziehungswissenschaft. Weinheim: Dt. Studienverl, S. 35-46. Witzel, Andreas (2000): Das problemzentrierte Interview (Forum Qualitative Sozialforschung, 1). URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114fqs0001228. (Stand: 21.01.2013). Zentrales-ADHS-Netz (2012): Stellungnahme des zentralen-ADHS-Netzes zu häufigen Fehlinformationen der Presse zur Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Unter Mitarbeit von Manfred Döpfner, Tobias Banaschewski, Michael Rösler und Klaus Skodzki. Hg. v. Zentrales-ADHS-Netz. URL: http://www. zentrales-adhs-netz.de/uploads/media/Fehlinformationen_der_Presse_zur_ADHS_Mrz_01. pdf (Stand: 22.01.2013). 162 Berliner Debatte Initial 24 (2013) 1 Autoren Nicole Becker, Prof. Dr., Erziehungswissenschaftlerin, Technische Universität Berlin Ulrich Busch, Dr. habil. Finanzwissenschaftler, Berlin, Mitglied der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin Regina Casper, Prof. em., Dr., Ärztin, Department of Psychiatry, Stanford University Medical School, CA, USA Irina Anatoljewna Flige, Direktorin des Forschungs- und Informationszentrums von „Memorial“ Sankt Petersburg, Leiterin des Forschungsprojektes „Virtuelles Museum des Gulag“ Jonas Frister, M.A., Erziehungswissenschaftler, Universität Münster Lew Dmitrijewitsch Gudkow, Dr., Soziologe, Direktor des Analytischen JurijLewada-Zentrums, Moskau Wladislaw Hedeler, Dr., Historiker und Publizist, Berlin Max Koch, Prof. Dr., Soziologe, Lund University, Faculty of Social Sciences Alexander Dawydowitsch Margolis, Vorsitzender der Sankt Petersburg Filiale der Allunionsvereinigung zum Schutz von historischen und Kulturdenkmalen, Vorsitzender des Rates des Forschungs- und Informationszentrums von „Memorial“ Sankt Petersburg Thomas Müller, M.A., Erziehungswissenschaftler, Universität Münster Mario Neukirch, Dr. Soziologe und Politikwissenschaftler, Universität Stuttgart, Helmholtz-Allianz Energy-Trans Oliver Neun, Dr. Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Universität Kassel Mariele Nientied, PD, Dr. habil., Philosophin, Viadrina-Universität Frankfurt/ Oder Anatoli Jakowlewitsch Rasumow, Herausgeber des „Leningradskij Martirolog“ und Leiter der Gruppe „Wiedergegebene Namen“ bei der Russischen Nationalbibliothek, Sankt Petersburg Oliver Römer, Diplom-Soziologe, Fachbereich für Philosophie und Gesellschaftswissenschaften, Universität Marburg Ulrich Salaschek, Dr. phil. Humboldt-Universität zu Berlin